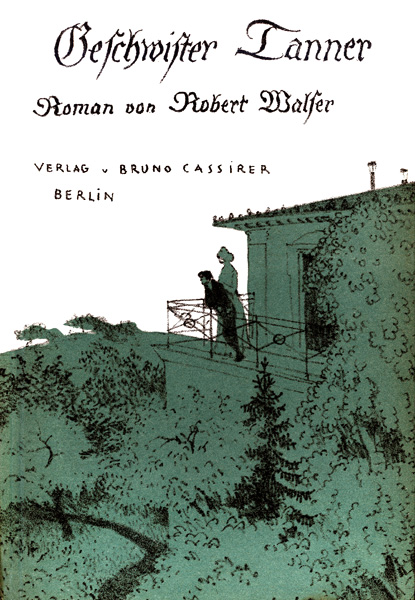
Title: Geschwister Tanner
Author: Robert Walser
Release date: May 21, 2011 [eBook #36172]
Language: German
Credits: Produced by Jana Srna and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text gekennzeichnet, der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
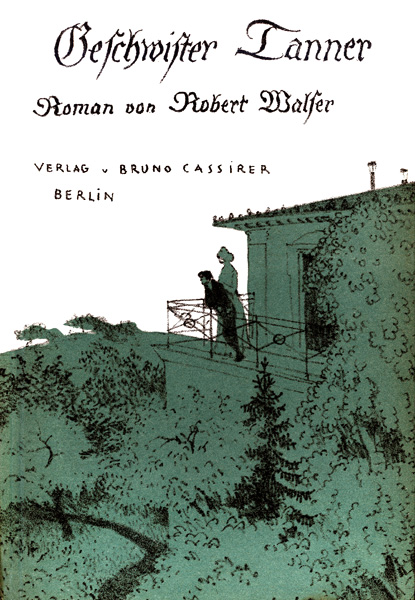
Geschwister Tanner
Roman
von
Robert Walser
Zweite Auflage
Verlag von Bruno Cassirer
Berlin
Eines Morgens trat ein junger, knabenhafter Mann bei einem Buchhändler ein und bat, daß man ihn dem Prinzipal vorstellen möge. Man tat, was er wünschte. Der Buchhändler, ein alter Mann von sehr ehrwürdigem Aussehen, sah den etwas schüchtern vor ihm Stehenden scharf an und forderte ihn auf, zu sprechen. »Ich will Buchhändler werden,« sagte der jugendliche Anfänger, »ich habe Sehnsucht darnach und ich weiß nicht, was mich davon abhalten könnte, mein Vorhaben ins Werk zu setzen. Unter dem Buchhandel stellte ich mir von jeher etwas Entzückendes vor und ich verstehe nicht, warum ich immer noch außerhalb dieses Lieblichen und Schönen schmachten muß. Sehen Sie, mein Herr, ich komme mir, so wie ich jetzt vor Ihnen dastehe, außerordentlich dazu geeignet vor, Bücher aus Ihrem Laden zu verkaufen, so viele, als Sie nur wünschen können zu verkaufen. Ich bin der geborene Verkäufer: galant, hurtig, höflich, schnell, kurzangebunden, raschentschlossen, rechnerisch, aufmerksam, ehrlich und doch nicht so dumm ehrlich, wie ich vielleicht aussehe. Ich kann Preise herabsetzen, wenn ich einen armen Teufel von Studenten vor mir habe, und kann Preise hochschrauben, um den reichen Leuten ein Wohlgefallen zu erweisen, von denen ich annehmen muß, daß sie manches Mal nicht wissen, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Ich glaube, so jung ich noch bin, einige Menschenkenntnis zu besitzen, außerdem liebe ich die Menschen, so verschiedenartig sie auch sein mögen; ich werde also meine Kenntnis der Menschen nie in den Dienst der Übervorteilung stellen, aber auch ebensowenig daran denken, durch allzu übertriebene Rücksichtnahme auf gewisse arme Teufel Ihr wertes Geschäft zu schädigen. Mit einem Wort: meine Liebe zu den Menschen wird angenehm balancieren auf der Wage des Verkaufens mit der Geschäftsvernunft, die ebenso gewichtig ist und mir ebenso notwendig erscheint für das Leben wie eine Seele voll Liebe: Ich werde schönes Maß halten, dessen seien Sie zum voraus versichert.« – Der Buchhändler sah den jungen Mann aufmerksam und verwundert an. Er schien im Zweifel darüber zu sein, ob sein Vis-à-vis, das so hübsch sprach, einen guten Eindruck auf ihn mache, oder nicht. Er wußte es nicht genau zu beurteilen, es verwirrte ihn einigermaßen und aus dieser Befangenheit heraus frug er sanft: »Kann ich mich denn, mein junger Mann, geeigneten Ortes über Sie erkundigen?« Der Angeredete erwiderte: »Geeigneten Ortes? Ich weiß nicht, was Sie einen geeigneten Ort nennen! Mir würde es passend erscheinen, wenn Sie sich gar nicht erkundigen wollten. Bei wem sollte das sein, und was für einen Zweck könnte das haben? Man würde Ihnen allerlei über mich hersagen, aber genügte denn das auch, Sie meinetwegen zu beruhigen? Was wüßten Sie von mir, wenn man Ihnen zum Beispiel auch sagte, ich sei aus einer sehr guten Familie entsprossen, mein Vater sei ein achtbarer Mann, meine Brüder tüchtige, hoffnungsvolle Menschen und ich selber sei ganz brauchbar, ein bißchen flatterhaft, aber zu Hoffnungen nicht unberechtigt, ein bißchen dürfe man mir schon vertrauen, und so weiter? Sie wüßten doch nichts von mir und hätten absolut nicht die kleinste Ursache, mich nun mit mehr Ruhe in Ihr Geschäft als Verkäufer anzunehmen. Nein, Herr, Erkundigungen taugen in der Regel keinen Pfifferling, ich rate Ihnen, wenn ich mir Ihnen, dem alten Herrn gegenüber einen Ratschlag herausnehmen darf, entschieden davon ab, weil ich weiß, daß, wenn ich geeignet und beschaffen wäre, Sie zu hintergehen und die Hoffnungen, die Sie, gestützt auf Informationen, auf mich setzen, zu täuschen, ich dies in um so größerem Maße täte, je besser besagte Erkundigungen lauten würden, die dann nur gelogen hätten, weil sie Gutes von mir sagten. Nein, verehrter Herr, wenn Sie gedenken, mich zu verwenden, so bitte ich Sie, etwas mehr Mut zu bezeigen als die meisten andern Prinzipale, mit denen ich zu tun hatte, und mich einfach auf den Eindruck hin anzustellen, den ich Ihnen hier mache. Außerdem würden einzuziehende Erkundigungen über mich nur schlecht lauten, um offen die Wahrheit zu sagen.«
»So? Warum denn? –«
»Ich bin noch überall, wo ich gewesen bin,« fuhr der junge Mensch fort, »bald weitergegangen, weil es mir nicht behagt hat, meine jungen Kräfte versauern zu lassen in der Enge und Dumpfheit von Schreibstuben, wenn es auch, nach aller Leute Meinung, die vornehmsten Schreibstuben waren, zum Beispiel gerade Bankanstalten. Gejagt hat man mich bis jetzt noch nirgends, ich bin immer aus freier Lust am Austreten ausgetreten, aus Stellungen und Ämtern heraus, die zwar Karriere und weiß der Teufel was versprachen, die mich aber getötet hätten, wenn ich darin verblieben wäre. Man hat, wo ich auch immer gewesen bin, regelmäßig meinen Austritt bedauert und mein Tun beklagt, mir eine schlimme Zukunft versprochen, aber doch den Anstand besessen, mir Glück auf meine fernere Laufbahn zu wünschen. Bei Ihnen (und des jungen Mannes Stimme wurde auf einmal treuherzig), Herr Buchhändler, werde ich es sicherlich jahrelang aushalten können. Jedenfalls spricht vieles dafür, Sie zu veranlassen, einmal einen Versuch mit mir zu machen.« Der Buchhändler sagte: »Ihre Offenherzigkeit gefällt mir, ich will Sie probeweise acht Tage in meinem Geschäft arbeiten lassen. Taugen Sie, und machen Sie dann Miene, weiter bei mir zu bleiben, so wollen wir weiter miteinander reden.« Mit diesen Worten, die zugleich des jungen Stellesuchers vorläufige Entlassung bedeuteten, klingelte der alte Herr an der elektrischen Leitung, worauf, wie von einem Strom herbeigeweht, ein kleiner, ältlicher, bebrillter Mann erschien.
»Geben Sie diesem jungen Herrn eine Beschäftigung!«
Die Brille nickte. Damit war nun Simon Buchhandlungsgehilfe geworden. Simon, ja so hieß er nämlich. –
Um diese Zeit herum machte sich einer der Brüder Simons, der in einer Residenzstadt wohnhafte und dort namhaft bekannte Doktor Klaus, Sorgen wegen seines jungen Bruders Betragen. Es war dies ein guter, stiller, pflichttreuer Mensch, der gar zu gern gesehen hätte, wenn seine Brüder so wie er, der Älteste, im Leben einen festen, achtunggebietenden Boden unter die Füße bekommen hätten. Dies war aber so sehr nicht der Fall, wenigstens bis jetzt, ja so sehr war das Gegenteil der Fall, daß Doktor Klaus anfing, in seinem Herzen sich Selbstvorwürfe zu machen. Er sagte sich zum Beispiel: »ich hätte derjenige sein sollen, der schon längst allen Grund hätte haben müssen, diese Brüder auf die rechte Bahn zu leiten. Ich habe es bis jetzt versäumt. Wie konnte ich nur diese Pflicht versäumen und so weiter.« Doktor Klaus kannte tausende von kleinen und großen Pflichten, und es mochte bisweilen den Anschein tragen, als sehne er sich nach noch mehr Pflichten. Er war einer von den Menschen, die sich, aus Pflichterfüllungsbedürfnis, in ein ganzes, beinahe zusammenstürzendes Gebäude von lauter sauren Pflichten stürzen, aus Angst, es möchte vorkommen, daß ihnen eine geheime, wenig bemerkbare Pflicht davonliefe. Sie schaffen sich viele unruhige Stunden wegen solcher unerfüllten Pflichten, denken nicht daran, daß eine Pflicht immer eine neue auf den Übernehmer der ersten ladet und glauben, schon etwas wie eine Pflicht erfüllt zu haben, wenn sie sich wegen deren dunklen Vorhandenseins ängstigen und beunruhigt fühlen. Sie mengen sich leicht in Vieles, was sie, wenn sie weniger sorgenvoll darüber nachdächten, in Gottes Welt gar nichts angeht, und wollen auch gern andere so sorgenbelastet sehen. Sie pflegen mit Neid auf Unbefangene und Pflichtenfreie zu blicken und sie dann leichtfertige Menschenbrüder zu schelten, weil sie so schön, mit so leicht erhobenem Kopf, durch das Leben ziehen. Doktor Klaus zwang sich des öftern zu einer gewissen kleinen, bescheidenen Sorglosigkeit, aber immer wieder kehrte er zu den grauen, trüben Pflichten zurück, in deren Bann er wie in einem dunklen Gefängnis schmachtete. Er hatte vielleicht einmal die Lust zum Abbrechen, damals als er noch jung war, aber ihm fehlte die Kraft, etwas, das wie eine mahnende Pflicht aussah, unerledigt hinter sich zu lassen und darüber mit einem Lächeln der Wegwerfung hinwegzuschreiten. Wegwerfung? O, er warf nie etwas weg! Es hätte ihn, so deuchte ihn, wenn er es einmal versuchen wollte, von unten bis oben zerschnitten; er würde immer des Weggeworfenen mit Schmerz gedacht haben. Er warf nie etwas weg und er verlor sein junges Leben damit, zurechtzulegen und zu untersuchen, was nie der Untersuchung, Prüfung, Liebe und Beachtung wert war. So war er denn älter geworden, und weil er denn doch durchaus nicht etwa ein empfindungs- und phantasieloser Mensch war, machte er sich oft schwere Vorwürfe darüber, daß er die Pflicht versäumte, selbst ein bißchen glücklich zu sein. Das war nun wieder ein neues Pflichtversäumnis und bewies nur auf das Allertreffendste, daß es eben Pflichtmenschen nie gelingt, alle ihre Pflichten zu erfüllen, ja, daß es solchen am leichtesten vorkommen kann, über ihre Hauptpflichten hinwegzusehen, um erst später, wenn es vielleicht schon zu spät geworden ist, ihrer wieder zu gedenken. Doktor Klaus war mehr als einmal traurig über sich, wenn er des lieblichen Glücks gedachte, das ihm entschwunden war, des Glücks, sich mit einem jungen, lieben Mädchen verbunden zu sehen, das natürlich ein Mädchen aus tadelloser Familie hätte sein müssen. Um diese Zeit herum, als er mit Wehmut seiner selber gedachte, schrieb er an seinen Bruder Simon, den er aufrichtig lieb hatte und dessen Betragen in der Welt ihn beunruhigte, einen Brief, der ungefähr folgendermaßen lautete:
Lieber Bruder. Du scheinst gar nichts über Dich schreiben zu wollen. Vielleicht geht es Dir nicht gut und schreibst deshalb nicht. Du bist wieder, wie nun schon so oftmals, ohne eine feste, fixierte Tätigkeit, ich habe es zu meinem Leidwesen erfahren müssen, und zwar von fremden Menschen. Von Dir darf ich, wie es scheint, keine aufrichtigen Berichte mehr erwarten. Glaube nur, dies schmerzt mich. Es sind jetzt so viele Dinge, die mich nur unangenehm berühren, mußt auch Du, von dem ich mir immer vieles versprach, dazu beitragen, meine Stimmung, die aus vielen Ursachen keine rosige ist, zu verdunkeln? Ich hoffe noch, aber laß mich, wenn Du Deinen Bruder noch ein bißchen lieb hast, nicht allzulang vergeblich auf Dich hoffen. Mache doch einmal etwas, das einen berechtigen könnte, an Dich, sei es in dieser oder jener Hinsicht, noch zu glauben. Du hast Talent und besitzest, wie ich mir gerne einbilde, einen hellen Kopf, bist auch sonst klug, und in allen Deinen Äußerungen spiegelte sich immer der gute Kern wieder, den ich in Deiner Seele von jeher wußte. Warum nun aber, da Du doch die Einrichtungen dieser Welt einmal kennst, immer wieder so wenig Ausdauer, so rasch wieder der Sprung in etwas anderes? Ängstigt Dich Dein eigenes Betragen gar nicht? Ich muß Kraft in Dir vermuten, daß Du diesen immerwährenden Berufswechsel, der zu nichts in der Welt taugt, ertragen kannst. Ich an Deiner Stelle würde längst an mir verzweifelt haben. Ich verstehe Dich wirklich nicht in diesem Punkt, aber ich gebe gerade aus diesem Grunde keineswegs die Hoffnung auf, Dich nun einmal energisch eine Laufbahn ergreifen zu sehen, nachdem Du sattsam genug mußtest die Erfahrung gemacht haben, daß ohne Geduld und guten Willen auf der Welt nichts zu erreichen ist. Und Du willst doch sicher etwas erreichen. So ganz unehrgeizig kenne ich Dich wenigstens nicht. Mein Rat ist nun der: Harre aus, füge Dich drei oder vier kurze Jahre unter eine strenge Arbeit, folge Deinen Vorgesetzten, zeige, daß Du etwas leisten kannst, aber auch, daß Du Charakter besitzest, dann wird sich Dir eine Bahn eröffnen, die Dich durch die ganze bekannte Welt führt, wenn Du Lust zum Reisen hast. Welt und Menschen werden sich Dir in ganz anderer Weise zu erkennen geben, wenn Du wirklich etwas bist, wenn Du der Welt etwas bedeuten kannst. So, scheint es mir, wirst Du vielleicht weit mehr Genugtuung am Leben finden, als selbst der Gelehrte, der, obschon er die Fäden, an denen alles Leben und Wirken hängt, genau erkennt, doch an die enge Welt seines Studierzimmers gefesselt bleibt, wo ihm, wie ich aus eigener Erfahrung sagen darf, oft nicht behaglich zumute ist. Noch ist es Zeit, daß Du ein ganz hervorragend tüchtiger Kaufmann werden kannst, und Du weißt gar nicht, in welchem Maße gerade der Kaufmann Gelegenheit hat, sein Leben zu einem von Grund aus lebensvollen Leben zu gestalten. Wie Du jetzt bist, schleichst Du nur so um die Ecken und durch die Spalten des Lebens: das soll aufhören. Vielleicht hätte ich da früher, viel früher eingreifen, hätte Dir mehr mit Taten als mit bloßen, ermahnenden Worten emporhelfen sollen, aber ich weiß nicht bei Deinem stolzen Sinn, der darauf gerichtet ist, Dir immer und überall selber zu helfen, hätte ich Dich vielleicht eher kränken als Dich wirklich überzeugen können. Was tust Du jetzt mit Deinen Tagen? Erzähle mir doch davon. Ich verdiene es vielleicht, um der Sorge willen, die ich mir Deinetwegen mache, daß Du etwas gesprächiger und mitteilsamer mir gegenüber wirst. Ich selber, was bin ich denn für einer, daß man sich hüten sollte, mir unbefangen und vertraulich in die Nähe zu treten? Bin ich Dir ein Gefürchteter? Was gibt es an mir zu meiden? Etwa den Umstand, daß ich der »Ältere« bin und vielleicht etwas mehr weiß, als Du? Nun denn, so wisse, daß ich froh wäre, noch einmal jung zu werden, und unvernünftig und unwissend. Ich bin nicht ganz so froh, lieber Bruder, wie es der Mensch sein sollte. Ich bin nicht glücklich. Vielleicht ist es zu spät für mich, noch glücklich zu werden. Ich bin jetzt in einem Alter, wo der Mann, der noch kein eigenes Heim hat, nicht ohne die schmerzlichste Sehnsucht der Glücklichen gedenkt, die die Wonne genießen, über der Leitung ihres Haushaltes eine junge Frau besorgt zu sehen. Ein Mädchen zu lieben, das ist schön, Bruder. Und es ist mir versagt. – Nein, Du brauchst mich gar nicht zu fürchten, ich bin es, der Dich wieder aufsucht, der Dir schreibt, der hofft, es werde ihm freundlich und zutraulich geantwortet. Du stehst vielleicht reicher da, als ich, hast mehr Hoffnungen und viel mehr Recht, solche zu hegen, hast Pläne und Aussichten, von denen ich mir nicht einmal etwas träume, ich kenne Dich eben nicht mehr ganz, und wie wäre das auch möglich nach Jahren der Trennung. Laß mich Dich wieder kennen lernen und zwinge Dich, mir zu schreiben. Vielleicht erlebe ich es noch, meine Brüder alle glücklich zu sehen; Dich möchte ich jedenfalls froh wissen. Was macht Kaspar? Schreibt Ihr Euch? Was macht seine Kunst? Ich möchte gerne auch von ihm etwas erfahren. Lebe wohl, Bruder. Vielleicht sprechen wir bald einmal miteinander. Dein Klaus.
Nach Ablauf von acht Tagen trat Simon, als es Abend wurde, zu seinem Prinzipal ins Kabinett und hielt diesem folgende Ansprache: »Sie haben mich enttäuscht, machen Sie nur nicht solch ein verwundertes Gesicht, es läßt sich nicht ändern, ich trete heute aus Ihrem Geschäft wieder aus und bitte Sie, mir meinen Lohn auszubezahlen. Bitte, lassen Sie mich ausreden. Ich weiß nur zu genau, was ich will. In den acht Tagen ist mir der ganze Buchhandel zum Greuel geworden, wenn er darin bestehen soll, vom frühen Morgen bis am späten Abend, während draußen die sanfteste Wintersonne scheint, an einem Pult zu stehen, den Buckel zu krümmen, weil das Pult viel zu klein für meine Figur ist, zu schreiben wie der verflucht-erst-beste Schreiber und eine Beschäftigung zu erfüllen, die sich für meinen Geist nicht ziemt. Ich kann ganz anderes leisten, mein Herr Buchhändler, als was man hier glaubt, für mich erübrigen zu können. Ich glaubte, ich könne bei Ihnen Bücher verkaufen, elegante Menschen bedienen, einen Bückling machen und adieu sagen zu Käufern, wenn sie im Begriffe sind, den Laden zu verlassen. Auch dachte ich, ich bekäme Gelegenheit, einen Blick in das geheimnisvolle Wesen des Buchhandels zu werfen und die Züge der Welt im Gesichte und Gang des Geschäftes zu erhaschen. Aber nichts von alledem. Glauben Sie, es stände so schlimm mit meiner Jugend, daß ich nötig hätte, sie in einem nichtsnutzigen Bücherladen zu verkrümmen und zu ersticken? Sie irren sich zum Beispiel auch, wenn Sie der Meinung sind, der Buckel eines jungen Menschen sei dazu da, um krumm zu werden. Warum haben Sie mir nicht ein gutes, anständiges, mir angemessenes Sitz- oder Stehpult angewiesen? Gibt es nicht prachtvolle Schreibpulte nach amerikanischem Schnitt? Wenn man schon einen Angestellten will, so meine ich, muß man ihn auch unterzubringen wissen. Das wußten Sie, wie es scheint, nicht. Weiß Gott, es wird alles mögliche von einem jungen Anfänger verlangt: Fleiß, Treue, Pünktlichkeit, Takt, Nüchternheit, Bescheidenheit, Maß und Zielbewußtheit und wer weiß was noch alles. Wem aber fiele es je ein, irgend welche Tugenden von einem Herrn Prinzipal zu verlangen. Soll ich meine Kräfte, meine Lust, tätig zu sein, meine Freude an mir selber, und das Talent, daß ich das so glänzend imstande bin, an ein altes, mageres, enges Buchladenpult wegwerfen? Nein, ehe ich das täte, könnte es mir vorher einfallen, unter die Soldaten zu gehen und meine Freiheit vollends zu verkaufen, nur um sie überhaupt nicht mehr zu besitzen. Ich bin nicht gern, gnädiger Herr, der Besitzer von etwas Halbem, lieber will ich zu den ganz Besitzlosen gehören, dann gehört mir meine Seele wenigstens noch an. Sie werden denken, es zieme sich wenig, so heftig zu reden, und dies sei auch nicht der schickliche Ort zu einer Rede: Wohlan, ich schweige, bezahlen Sie mich, wie es mir zukommt, und Sie werden mich nie wieder zu Gesicht bekommen.«
Der alte Buchhändler war ganz erstaunt, den jungen, stillen, schüchternen Menschen, der während der acht Tage so zuverlässig gearbeitet hatte, nun in solcher Weise sprechen zu hören. Aus dem anstoßenden Arbeitsraume sahen und horchten einige fünf zusammengedrängte Köpfe von Beamten und Handlungsdienern der Szene zu. Der alte Herr sprach: »Wenn ich das von Ihnen vermutet hätte, Herr Simon, würde ich mich besonnen haben, Ihnen in meinem Geschäfte Arbeit zu geben. Sie scheinen ja ganz merkwürdig wankelmütig zu sein. Weil Ihnen ein Schreibpult nicht paßt, will Ihnen gleich das Ganze nicht passen. Aus welcher Gegend der Welt kommen Sie denn her und gibt es dort lauter junge Leute von Ihrem Schlag? Sehen Sie, wie Sie nun vor mir altem Manne dastehen. Sie wissen wohl selbst nicht, was Sie in Ihrem unreifen Kopf eigentlich wollen. Nun, ich halte Sie nicht davon ab, von mir wegzugehen, hier ist Ihr Geld, aber offen gestanden, es hat mir nicht Freude gemacht.« Der Buchhändler zahlte ihm sein Geld aus, Simon strich es ein.
Als er nach Hause kam, sah er den Brief seines Bruders auf dem Tisch liegen, er las ihn und dachte dann bei sich: »Er ist ein guter Mensch, aber ich werde ihm nicht schreiben. Ich verstehe es nicht, meine Lage zu schildern, sie ist auch gar nicht des Beschreibens wert. Zu Klagen habe ich keinen Anlaß, zu Freudesprüngen ebensowenig, zu schweigen allen Grund. Es ist wahr, was er schreibt, aber eben deshalb will ich es bei der Wahrheit bewenden lassen. Daß er unglücklich ist, hat er mit sich selbst abzumachen, aber ich glaube gar nicht, daß er so sehr unglücklich ist. Das klingt in Briefen so. Man wird während des Schreibens einfach fortgerissen zu unvorsichtigen Äußerungen. In den Briefen will die Seele immer zu Wort kommen und sie blamiert sich in der Regel. Ich schreibe also lieber nicht.« – Damit war die Sache abgetan. Simon war voller Gedanken, schöner Gedanken. Wenn er dachte, kam er ganz unwillkürlich auf schöne Gedanken. Am nächsten Morgen, die Sonne blendete hell, meldete er sich beim Stellenvermittlungsbureau. Der Mann, der dort saß und schrieb, stand auf. Der Mann kannte Simon sehr gut und pflegte mit ihm mit einer Art spöttischer, hübscher Vertrautheit zu verkehren. »Ah, Herr Simon! Sind Sie wieder da! In welcher Angelegenheit kommen Sie denn?«
»Ich suche eine Stelle.«
»Sie haben schon zu wiederholten Malen Stelle gesucht bei uns, man möchte versucht sein, zu sagen: Sie suchen mit einer unheimlichen Schnelligkeit Stellen.« Der Mann lachte, aber leise, denn eines groben Lachens war er doch nicht fähig. »Wo waren Sie denn zuletzt beschäftigt, wenn man Sie fragen darf?«
Simon erwiderte: »Ich war Krankenwärter, und es stellte sich heraus, daß ich alle Eigenschaften besitze, um die Kranken pflegen zu können. Warum staunen Sie so sehr bei dieser Eröffnung? Ist es so fürchterlich seltsam, wenn ein Mann in meinem Alter verschiedenen Berufsarten nachgeht, wenn er den Versuch macht, sich den verschiedenartigsten Menschen nützlich zu erweisen? Ich finde das hübsch an mir, weil ich dabei etwas tue, was einen gewissen Mut erfordert. Mein Stolz wird in keiner Weise verletzt dadurch, im Gegenteil, ich bilde mir etwas darauf ein, allerhand Lebensaufgaben lösen zu können und nicht vor Schwierigkeiten zu zittern, vor denen die meisten Menschen zurückschrecken. Man kann mich brauchen, diese Gewißheit genügt mir, um meinen Stolz zu befriedigen. Ich will nützlich sein.«
»Warum sind Sie denn nicht bei dem Krankenwärterberuf geblieben?« fragte der Mann.
»Ich habe keine Zeit, bei einem und demselben Beruf zu verbleiben,« erwiderte Simon, »und es fiele mir niemals ein, wie so viele andere, auf einer Berufsart ausruhen zu wollen wie auf einem Sprungfederbett. Nein, das bringe ich, und wenn ich tausend Jahre alt werde, nicht fertig. Lieber gehe ich unter die Soldaten.«
»Passen Sie auf, daß es nicht mit Ihnen noch so weit kommt.«
»Es gibt auch noch andere Auswege. Das mit den Soldaten ist eine flüchtige Redensart von mir, die ich mir angewöhnt habe, um meine Reden zu beschließen. Was hat ein junger Mann, wie ich, nicht für Auswege. Ich kann, wenn es Sommer ist, zu einem Bauern gehen, ihm auf dem Felde helfen, daß die Ernte beizeiten unter Dach kommt, er wird mich willkommen heißen und meine Kraft schätzen. Er wird mir zu essen geben, gutes Essen, denn man kocht gut auf dem Lande, er wird mir, wenn ich von ihm wegziehe, etwas Bargeld in die Hand drücken, und seine junge Tochter, ein frisches, bildschönes Mädchen, wird mir zum Abschied zulächeln, in einer Weise, daß ich lange daran denken muß, während ich weiter wandere. Was schadet es, zu wandern, auch wenn es regnet oder gar schneit, wenn man seine gesunden Glieder hat und sich weiter keine Sorgen macht. Sie, in Ihrer gedrückten Enge, stellen sich nicht vor, wie köstlich das Laufen auf Landstraßen ist. Sind sie staubig, so sind sie es eben, wer frägt da lange darnach. Nachher sucht man sich an einem Waldrande ein kühles Plätzchen aus, wo der Blick, wenn man so daliegt, die herrlichste Aussicht genießt, wo die Sinne auf eine natürliche Weise ausruhen und die Gedanken nach Lust und Geschmack denken können. Sie werden mir entgegenhalten, das könne ein anderer, zum Beispiel Sie selber, auch haben, während Ihrer Ferien. Aber Ferien, was ist das! Darüber kann ich nur lachen. Ich will mit Ferien nichts zu tun haben. Ich hasse die Ferien geradezu. Verschaffen Sie mir nur nicht einen Posten mit Ferien. Das hat nicht den geringsten Reiz für mich, ja ich würde sterben, wenn ich Ferien bekäme. Ich will mit dem Leben kämpfen, bis ich meinetwegen umsinke, will weder Freiheit noch Bequemlichkeit kosten, ich hasse die Freiheit, wenn ich sie so hingeworfen bekomme, wie man einem Hund einen Knochen hinwirft. Da haben Sie Ihre Ferien. Wenn Sie etwa denken, Sie hätten in mir einen Menschen vor sich, den es nach Ferien gelüstet, so irren Sie sich, aber ich habe leider alle Ursache, zu vermuten, Sie denken so von mir.«
»Hier ist eine Aushilfsstelle bei einem Advokaten zu besetzen, für ungefähr einen Monat. Paßt Ihnen das?«
»Gewiß, mein Herr.«
Damit war Simon beim Advokaten. Er verdiente dort ein ganz hübsches Geld und war ganz glücklich. Nie erschien ihm die Welt schöner, als während dieser Advokatenzeit. Er machte angenehme Bekanntschaften, schrieb leicht und mühelos den Tag über, rechnete Rechnungen nach, schrieb nach dem Diktat, was er außerordentlich gut verstand, betrug sich, zu seinem Erstaunen ganz reizend, so daß sein Vorgesetzter sich lebhaft um ihn bekümmerte, trank jeweilen nachmittags seine Tasse Tee, und träumte, während er schrieb, zum luftigen, hellen Fenster hinaus. Träumen, und doch seine Pflicht nicht hintenansetzen, das verstund er prächtig. »Ich verdiene so viel Geld, dachte er bei sich, daß ich eine junge Frau damit haben könnte.« Der Mond schien oft, wenn er arbeitete, zum Fenster hinein, das entzückte ihn sehr.
Seiner kleinen Freundin Rosa gegenüber äußerte sich Simon folgendermaßen: »Mein Advokat hat eine lange, rote Nase und ist ein Tyrann, aber ich komme sehr gut aus mit ihm. Ich empfinde sein mürrisches, gebieterisches Wesen als Humor und wundere mich, wie gut ich mich allen seinen, und oft ungerechten Geboten unterziehe. Ich liebe es, wenn es ein wenig scharf zugeht, das paßt mir, das schwingt mich bis zu einer gewissen warmen Höhe hinauf und reizt meine Arbeitslust. Er hat eine schöne, schlanke Frau, die ich malen möchte, wenn ich ein Maler wäre. Sie hat, glauben Sie es nur, wunderbar große Augen und herrliche Arme. Oft macht sie sich etwas bei uns im Bureau zu schaffen; wie muß sie da auf mich armen Schreibteufel herabsehen. Ich zittere, wenn ich solche Frauen sehe und bin doch glücklich. Lachen Sie? Ihnen gegenüber bin ich leider gewöhnt, ohne Schranken offen zu sein, und ich hoffe, Sie sehen das gerne an mir.«
Rosa liebte es in der Tat, wenn man offen zu ihr war. Sie war ein merkwürdiges Mädchen. Ihre Augen hatten einen wundervollen Glanz, und ihre Lippen waren geradezu schön.
Simon fuhr fort: »Wenn ich morgens um acht Uhr zur Arbeit gehe, fühle ich mich so schön verwandt mit allen denen, die ebenfalls morgens um acht Uhr anzutreten haben. Welche große Kaserne, dieses moderne Leben! Und doch wie schön und gedankenvoll ist gerade diese Einförmigkeit. Man sehnt sich beständig nach etwas, das an einen herantreten sollte, das einem begegnen müßte. Man hat ja so sehr nichts, ist so sehr armer Teufel, kommt sich so verloren vor in all der Gebildetheit, Geordnetheit und Exaktheit. Ich steige die vier Treppen hinauf und trete ein, sage guten Tag und beginne mit meiner Arbeit. Du guter Gott, wie wenig muß ich leisten, wie wenig Kenntnisse verlangt man doch von mir. Wie wenig scheint man zu ahnen, daß ich noch ganz anderes fähig wäre. Aber mir behagt jetzt diese reizende Anspruchslosigkeit seitens meiner Arbeitgeber. Ich kann, während ich arbeite, denken, ich habe alle Aussicht ein Denker zu werden. Ich denke oft an Sie!«
Rosa lachte: »Sie sind ein Schlingel! Aber fahren Sie fort, es interessiert mich, was Sie da sagen.«
»Die Welt ist eigentlich herrlich,« sprach Simon weiter, »ich kann da bei Ihnen sitzen, und es hindert mich niemand daran, stundenlang mit Ihnen zu plaudern. Ich weiß, daß Sie mir gerne zuhören. Sie finden, daß ich nicht ohne Anmut spreche, und ich muß jetzt innerlich furchtbar lachen, weil ich das gesagt habe. Aber ich sage eben alles, was mir gerade durch den Sinn schießt, wäre es auch zum Beispiel gerade ein Eigenlob. Ich kann mich auch mit ebensolcher Leichtigkeit tadeln, und es freut mich sogar, wenn ich dazu Gelegenheit habe. Sollte man denn nicht alles aussprechen dürfen? Wie vieles geht verloren, wenn man es erst langsam prüfen will. Ich mag nicht lange überlegen, bevor ich spreche, und ob es sich schickt oder nicht, es muß eben heraus. Wenn ich eitel bin, so muß eben meine Eitelkeit ans Licht treten, wäre ich geizig, der Geiz spräche aus meinen Worten, bin ich anständig, so wird ohne Zweifel die Honettheit aus meinem Munde tönen, und würde mich Gott zu einem braven Menschen gemacht haben, so redete die Tüchtigkeit aus mir, was ich auch immer spräche. Ich bin in dieser Beziehung ganz sorglos, weil ich mich und uns ein wenig kenne und weil ich mich davor schäme, im Gespräch Furcht zu bezeigen. Wenn ich beispielsweise mit Worten jemanden beleidige, verletze, kränke oder ärgere, kann ich den üblen Eindruck nicht mit den paar nächsten Worten wieder gutmachen? Ich denke über mein Sprechen erst nach, wenn ich auf dem Gesicht meines Zuhörers unangenehme Falten sehe, so wie jetzt auf Ihrem Gesicht, Rosa.«
»Das ist etwas anderes.« –
»Sind Sie müde?«
»Gehen Sie nach Hause, nicht wahr, Simon. Ich bin allerdings jetzt müde. Sie sind hübsch, wenn Sie sprechen. Ich habe Sie sehr lieb.«
Rosa streckte ihrem jungen Freund ihre kleine Hand entgegen, dieser küßte die Hand, sagte gute Nacht und ging fort. Als er weg war, weinte die kleine Rosa lange still für sich. Sie weinte um ihren Geliebten, einen jungen Mann mit Locken auf dem Kopf, elegantem Schritt, edelgeschnittenem Mund, aber liederlicher Lebensart. »So liebt man die, die es nicht wert sind,« sagte sie für sich, »und doch, liebt man etwas deshalb, weil man einen Wert abschätzen möchte? Wie lächerlich. Was geht mich das Wertvolle an, wo ich das Geliebte haben möchte.« Dann ging sie zu Bett.
Eines Tages klingelte Simon, es war in der Mittagsstunde, vor einem eleganten, freigelegenen Hause, das einen Garten hatte, ziemlich schüchtern an. Ihm war, als ob da ein Bettler geklingelt hätte, wie er es läuten hörte. Wenn er jetzt drinnen im Hause zum Beispiel als Hausinhaber gesessen hätte, vielleicht gerade beim Mittagstisch, würde er, sich zu seiner Frau träge umwendend, gefragt haben: Wer klingelt denn jetzt, gewiß ein Bettler! »Vornehme Leute,« dachte er, während er wartete, »denkt man sich immer an der Tafel, oder in der Kutsche, oder beim Anziehen, wo ihnen Diener und Dienerinnen behilflich sind, dagegen Arme immer draußen in der Kälte, mit emporgezogenen Mantelkragen, wie ich jetzt, vor einer Gartentür herzpochend wartend. Arme Leute haben in der Regel schnelle, pochende, hitzige Herzen, Reiche kalte, weite, geheizte, gepolsterte und vernagelte! Ach, wenn nur rasch jemand herbeigesprungen käme, wie würde ich aufatmen. Dieses vor einer reichen Türe Warten hat etwas Beengendes. Wie stehe ich doch, trotz meinem bißchen Welterfahrung, auf schwachen Beinen.« – In der Tat, er zitterte, als ein Mädchen herbeisprang, um dem Draußenstehenden zu öffnen. Simon mußte immer lächeln, wenn jemand ihm eine Tür öffnete und ihn zum Eintreten ersuchte, auch jetzt ging es nicht ohne dieses Lächeln ab, das wie eine leise Bitte im Gesicht aussah, und das vielleicht bei vielen Menschen zu beobachten ist.
»Ich suche ein Zimmer.«
Simon nahm seinen Hut vor einer schönen Dame ab, die den Ankommenden aufmerksam prüfte. Simon war es lieb, daß sie das tat; denn er fühlte, daß sie ein Recht dazu hatte, und weil er sah, daß sie dabei ihre Freundlichkeit nicht verlor.
»Wollen Sie kommen? Da! Die Treppe hinauf.«
Simon bat die Dame, voranzugehen. Er machte dabei zum ersten Male in seinem Leben mit der Hand eine Handbewegung. Die Dame zeigte dem jungen Mann das Zimmer, indem sie eine Tür öffnete.
»Welch ein schönes Zimmer,« rief Simon, der wirklich überrascht war, »viel zu schön für mich, leider, viel zu fein für mich. Sie müssen wissen, ich bin ein so wenig für ein so feines Zimmer geeigneter Mensch. Und doch, ich würde sehr gerne darin wohnen, allzugerne, viel, vielzugerne. Es ist eigentlich von Ihnen nicht gut getan gewesen, mir dieses Gemach zu zeigen. Viel besser, Sie würden mich zu Ihrem Hause hinausgewiesen haben. Wie komme ich dazu, meine Blicke in einen so heiteren, schönen, wie als Wohnung für einen Gott geschaffenen Raum zu werfen. Welch schöne Wohnungen bewohnen doch die Wohlhabenden, die, die etwas besitzen. Ich habe nie etwas besessen, bin nie etwas gewesen, und werde trotz den Hoffnungen meiner Eltern nie etwas sein. Welch schöne Aussicht aus den Fenstern, und so hübsche, glänzende Möbel, und so reizende Vorhänge, die dem Zimmer etwas Mädchenhaftes geben. Ich würde hier vielleicht ein guter, zarter Mensch werden, wenn es wahr ist, wie man sagen hört, daß Umgebungen den Menschen verändern können. Darf ich es noch ein wenig anschauen, hier noch eine Minute stehen bleiben?«
»Gewiß dürfen Sie das.«
»Ich danke Ihnen.«
»Was sind Ihre Eltern, und, wenn ich fragen darf, inwiefern sind Sie »nichts«, wie Sie sich vorhin ausdrückten?«
»Ich bin ohne Stelle!«
»Das würde mir ganz gleichgültig sein. Es kommt drauf an!«
»Nein, ich habe wenig Hoffnungen. Zwar, das darf ich, wenn ich ohne Falsch sprechen soll, auch nicht sagen. Ich bin voll Hoffnung. Nie, nie verläßt sie mich. – Mein Vater ist ein armer, aber lebensfröhlicher Mensch, dem es nicht einmal von ferne einfällt, seine jetzigen kargen Tage mit den früheren glänzenden zu vergleichen. Er lebt wie ein Junger von fünfundzwanzig Jahren und gibt sich in keiner Weise Gedanken über seine Lage hin. Ich bewundere ihn und suche ihn nachzuahmen. Wenn er bei seinem schneeweißen Alter noch munter sein kann, so muß es dreißig-, ja hundertmal seines jungen Sohnes Pflicht sein, den Kopf hoch zu tragen und die Menschen mit Augen wie der Blitz anzuschauen. Aber die Mutter gab mir, und meinen Brüdern weit mehr als mir, Gedanken mit auf die Welt. Die Mutter ist gestorben.«
Der Dame, die sehr lieb dastand, kam ein klagendes Ach aus dem Munde.
»Sie war eine herzlich gute Frau. Wir Kinder sprechen immer und immer über sie, wann und wo wir auch immer zusammentreffen. Wir leben zerstreut auf dieser runden, weiten Welt, und das ist sehr gut, denn wir haben alle solche Köpfe, wissen Sie, die nicht lange zueinander taugen. Wir haben alle eine etwas schwere Art, die hinderlich sein würde, wenn wir verbunden unter den Menschen aufträten. Das tun wir gottlob nicht, und jedes von uns weiß genau, warum wir es nicht tun wollen. Doch lieben wir uns, wie es sich geziemt. Einer meiner Brüder ist ein nicht unbekannter Gelehrter, ein anderer ist ein Spezialist im Börsenfach, wieder ein anderer ist weiter nichts als mein Bruder, weil ich ihn mehr als einen Bruder liebe, und es mir, wenn ich an ihn denke, nicht einfiele, noch sonst etwas anderes hervorzuheben an ihm, als eben den Umstand, daß er der meinige ist, der, der so aussieht, wie er, sonst nichts. Mit diesem Bruder zusammen möchte ich hier bei Ihnen wohnen. Groß genug wäre das Zimmer. Aber es geht wohl nicht gut. Wieviel kostet es?«
»Was ist Ihr Bruder?«
»Landschaftsmaler! Wieviel würden Sie für das Zimmer verlangen? – – So viel? Es ist sicherlich nicht zu viel für dieses Zimmer, aber für uns ist es viel zu viel. Auch, wenn ich recht bedenke, und wenn ich Sie eindringlich anschaue, sind wir zwei Menschen nicht dazu geeignet, in diesem Hause aus- und einzugehen, als ob wir darin ansässig wären. Wir sind noch so grob, wir würden Sie enttäuschen. Auch haben wir die Gewohnheit, mit Bettbezügen, Möbelstücken, Wäschegegenständen, Fenstervorhängen, Türklinken, Treppenabsätzen hart umzugehen, das würde Sie erschrecken, Sie würden uns böse werden, oder Sie würden vielleicht verzeihen, ein Auge bemühen zuzudrücken, was noch schmählicher wäre. Ich möchte nicht veranlassen, daß Sie später mit uns Ärger hätten. Sicher, sicher! Wehren Sie nur nicht ab. Ich sehe es zu deutlich. Wir haben, im Grunde genommen, für alles feine Wesen auf die Länge wenig Hochachtung übrig. Dergleichen Menschen, wie wir sind, müssen vor reichen Gartengittern stehen, wo ihnen die Freiheit gelassen wird, über den Glanz und die Sorgfalt spöttische Bemerkungen zu machen. Wir sind Spötter! Adieu!«
Die Augen der schönen Frau hatten einen tiefen Glanz angenommen, und nun sagte sie auf einmal: »Ich möchte doch Ihren Herrn Bruder und Sie annehmen. Ich werde, was den Preis betrifft, mit Ihnen schon einig werden.«
»Nein lieber nicht!«
Simon schritt schon die Treppe hinunter. Da rief ihm die Stimme der Dame nach: »Bitte, bleiben Sie doch noch.« Und sie eilte ihm nach. Unten holte sie ihn ein und veranlaßte ihn, stehen zu bleiben und auf sie zu horchen: »Was fällt Ihnen ein, so schnell wegzugehen. Sehen Sie, ich will, ich möchte Sie beide dabehalten. Und wenn Sie auch nicht bezahlen! Was macht das? Gar nichts, gar nichts, kommen Sie doch, kommen Sie. Treten Sie mit mir in dieses Zimmer. Marie! Wo bist du? Bringe doch gleich den Kaffee hier ins Zimmer.«
Drinnen sagte sie zu Simon: »Ich habe den Wunsch, Sie und Ihren Bruder näher kennen zu lernen. Wie konnten Sie nur davonrennen. Ich bin oft so allein in diesem abgelegenen Hause, daß es mich ängstigt. Mein Mann ist die ganze Zeit abwesend, auf weiten Reisen, er ist Forscher, segelt auf allen Meeren, von deren bloßem Vorhandensein seine arme Frau keine Ahnung hat. Bin ich nicht eine arme Frau? Wie heißen Sie? Wie heißt der andere, Ihr Bruder? Ich heiße Klara. Nennen Sie mich einfach: Frau Klara. Ich mag gern diesen einfachen Namen hören. Sind Sie nun etwas zutraulicher geworden? Würde mich sehr, so sehr freuen. Glauben Sie nicht, das wir miteinander leben und auskommen können? Gewiß, das wird schon gehen. Ich halte Sie für einen zarten Menschen. Ich fürchte mich nicht, Sie in meinem Hause zu haben. Sie haben ehrliche Augen. Ist Ihr Bruder älter als Sie?«
»Ja, er ist älter und ein viel besserer Mensch, als ich.«
»Sie sind ein braver Mensch, daß Sie das sagen dürfen.«
»Ich heiße Simon und mein Bruder heißt Kaspar.«
»Mein Mann heißt Agappaia.«
Sie erbleichte, als sie das sagte, doch sammelte sie sich rasch und lächelte.
Simon schrieb an seinen Bruder Kaspar: »Wir sind eigentlich seltsame Käuze, wir zwei. Wir treiben uns auf diesem Erdboden umher, als ob nur wir, und sonst keine anderen Menschen darauf lebten. Wir haben eigentlich eine verrückte Freundschaft geschlossen, als ob es sonst unter den Männern nichts ausfindig zu machen gäbe, was wert könnte genannt werden, Freund zu heißen. Eigentlich sind wir gar keine Brüder, sondern Freunde, wie zwei sich einmal auf der Welt zusammenfinden. Ich bin wirklich nicht für die Freundschaft gemacht und begreife nicht, was ich so Tolles an Dir nur finde, das mich zwingt, mich immer wieder an Deine Seite, gleichsam an Deinen Rücken heranzudenken. Dein Kopf kommt mir jetzt bald wie der meinige vor, so sehr bist Du schon in meinem Kopf; ich werde vielleicht im Verlauf einiger Zeit, wenn es so weiter geht, mit Deinen Händen greifen, mit Deinen Beinen laufen und mit Deinem Mund essen. Unsere Freundschaft hat sicher etwas Geheimnisvolles, wenn ich Dir sage, daß es gar nicht so unmöglich ist, daß im Grunde genommen unsere Herzen voneinander wegstreben, daß sie nur nicht können. Ich bin ja nun noch recht froh, daß Du noch immer nicht zu können scheinst, denn Deine Briefe klingen sehr artig und ich wünsche vorläufig auch von mir, daß ich im Banne dieses Geheimnisvollen sitzen bleibe. Für uns ist es ja gut, aber, wie kann ich nur gar so trocken reden: ich finde es einfach, um nicht zu lügen, entzückend. Warum sollten nicht einmal zwei Brüder über das Maß hauen. Wir passen ganz gut zusammen, wir paßten auch schon damals zusammen, als wir uns haßten und beinahe totprügelten. Weißt Du noch? Es braucht nichts als diesen Aufruf, mit einer Portion gesunden Lachens vermischt, um in Dir Bilder aufzurühren, zu leimen, zu malen, zu heften, die wahrhaftig der Rückerinnerung mehr als wert sind. Wir waren, ich weiß nicht mehr aus welcher Ursache heraus, Todfeinde geworden. O, wir verstunden es, einander zu hassen. Unser Haß war entschieden erfinderisch im Auffinden von Qualen und Demütigungen, die wir uns gegenseitig bereiteten. Beim Eßtisch warfst Du mir einmal, um nur ein einziges Beispiel dieses jammervollen und kindischen Zustandes anzuführen, eine Platte mit Sauerkraut entgegen, weil Du mußtest, und sagtest dazu: »Da, pack!« Ich muß Dir sagen, damals zitterte ich vor Wut, schon deshalb, weil es für Dich eine schöne Gelegenheit war, mich aufs grimmigste zu kränken, und ich dazu nichts sagen konnte. Ich packte die Platte an, und war eben dumm genug, den Schmerz der Kränkung bis zur Kehle hinauf voll auszukosten. Weißt Du noch, wie eines Mittags, es war ein stiller, totenstiller, sommerheißer, vor Totenstille ganz toller Sonntagnachmittag, dann einer zu Dir in die Küche herangezaudert kam und Dich bat, mir wieder gut zu sein. Es war ein unglaubliches Werk der Überwindung, kann ich Dir sagen, sich so durch das Gefühl der Beschämung und des Trotzes hindurchzuwinden, bis zu Dir, der Gestalt des zur ablehnenden Verachtung neigenden Feindes. Ich tat es, und ich bin mir dankbar dafür. Ob Du auch mir, ist mir freudig und duftig egal. Das kann nur ich abschätzen. Geh mir weg, da willst Du mir was dazwischenreden. Einfach nicht möglich. Weg da! – Wie viele köstliche Stunden habe ich von da an mit Dir genossen. Ich fand dich auf einmal zart, liebend rücksichtsvoll. Ich glaube, die Wonne der Freude brannte uns beiden auf den Wangen. Wir streiften, Du als Maler, ich als Zuschauer und Dreinreder, über die Matten auf den breiten Bergen, wateten im Duft des Grases, in der Nässe des kühlen Morgens, in der Hitze des Mittags und im feuchten, verliebten Untergehen der Sonne. Die Bäume sahen uns zu, was wir da oben trieben und die Wolken ballten sich zusammen, gewiß aus Zorn, daß sie keine Macht besaßen, unsere neugebackene Liebe zu brechen. Abends kamen wir gräßlich zerbrochen, verstaubt, verhungert und vermüdet nach Hause, und auf einmal gingst Du dann weg. Weiß der Teufel, ich half Dir wegreisen, als ob ich dazu durch Handgeld verpflichtet gewesen wäre, oder als hätte ich Eile gehabt, Dich verduften zu sehen. Gewiß war es mir eine heilige Freude, Dich abreisen zu sehen, denn Du reistest der großen Welt entgegen. Wie wenig groß ist die große Welt, Bruder.
Komm doch ja bald hierher. Ich kann Dich beherbergen, wie ich eine Braut beherbergen würde, von der ich annehmen müßte, daß sie gewohnt sei, auf Seide zu liegen und von Bedienten bedient zu werden. Ich habe zwar keine Dienerschaft, aber doch ein Zimmer wie für einen gebornen Herrn. Ich und Du, wir beide haben ein prachtvolles Chambre einfach geschenkt, vor die Füße gelegt bekommen. Du kannst hier ebensogut Bilder malen, wie dort in Deiner dicken, fernen Landschaft, Du hast ja Phantasie. Eigentlich sollte es jetzt Sommer sein, daß ich Deinetwegen im Garten ein Gartenfest mit chinesischen Lichtern und Bändern von lauter Blumen veranstalten könnte, um Dich einigermaßen Deiner würdig zu empfangen. Komm eben so, aber mach nur, daß dieses Kommen rasch vorwärtskommt, sonst komme ich und hole Dich. Meine Herrin und Wirtin drückt Dir die Hand. Sie ist davon überzeugt, daß sie Dich bereits aus meinen Schilderungen von Dir kennt. Wenn sie Dich erst kennen wird, wird sie weiter auf der Erde niemand mehr kennen lernen wollen. Hast Du einen stattlichen Anzug? Schlottern Dir Deine Hosen nicht gar so sehr um die Kniee herum und darf man Deine Kopfbedeckung noch Hut nennen? Sonst darfst Du nicht vor mir erscheinen. Alles Spaß, alles Dummheiten. Laß Dich von Deinem Simönchen umarmen. Leb wohl, Bruder. Hoffentlich kommst Du bald.« –
Einige Wochen waren verflossen, es fing an, wieder Frühling zu werden, die Luft war feuchter und weicher, es meldeten sich unbestimmte Düfte und Klänge, die aus der Erde herauszukommen schienen. Die Erde war weich, man schritt auf ihr wie auf dicken, biegsamen Teppichen. Man glaubte, Vögel singen hören zu müssen. »Es will Frühling werden,« so redeten sich die empfindungsvollen Menschen auf der Straße an. Selbst die kahlen Häuser bekamen einen gewissen Duft, eine sattere Farbe. Es ging ganz sonderbar zu, und war doch eine so alte, bekannte Erscheinung, aber man empfand es als gänzlich neu, es regte zu einem seltsamen, stürmischen Denken an, die Glieder, die Sinne, die Köpfe, die Gedanken, alles regte sich, wie wenn es hätte von neuem wachsen mögen. Das Wasser des Sees glänzte so warm und die Brücken, die sich über den Fluß schlangen, schienen einen kühneren Bogen bekommen zu haben. Die Fahnen flatterten im Winde, und es machte den Menschen Vergnügen, sie flattern zu sehen. Die Sonne erst trieb die Leute in Reihen und Gruppen auf die schöne, weiße, saubere Straße, wo sie stehen blieben und den Kuß der Wärme begierig fühlten. Viele Mäntel von vielen Menschen wurden abgelegt. Man konnte die Männer wieder freier sich bewegen sehen und die Frauen machten so sonderbare Augen, als möchte ihnen etwas Seeliges zu den Herzen herauskommen. In den Nächten hörte man wieder zum ersten Mal den Klang der vagabondierenden Gitarren, und Männer und Frauen standen im Gewühl der fröhlichen, spielenden Kinder. Die Lichter der Laterne flackten wie Kerzen in stillen Stuben, und man empfand, wenn man über nachtdunkle Wiesen hinschritt, das Blühen und Regen der Blumen. Das Gras wird bald wieder wachsen, die Bäume werden ihr Grün bald wieder über die niederen Hausdächer schütten und den Fenstern die Aussicht nehmen. Der Wald wird prangen, üppig, schwer, o, der Wald. – – Simon arbeitete wieder in einem großen Handelsinstitut.
Es war ein Bankhaus von weltbedeutendem Umfang, ein großes Gebäude von palastähnlichem Aussehen, in welchem hunderte von jungen und alten, männlichen und weiblichen Leuten beschäftigt waren. Diese Leute schrieben alle mit emsigen Fingern, rechneten mit Rechnungsmaschinen, auch wohl bisweilen mit ihren Gedächtnissen, dachten mit ihren Gedanken und machten sich nützlich mit ihren Kenntnissen. Es gab da etliche junge, elegante Korrespondenten, die vier bis sieben Sprachen schreiben und sprechen konnten. Diese schieden sich durch ihr feineres, ausländisches Wesen von dem übrigen Rechnervolk aus. Sie waren schon auf Meerschiffen gefahren, kannten die Theater in Paris und New-York, hatten in Jokohama die Teehäuser besucht und wußten, wie man sich in Kairo vergnügte. Nun besorgten sie hier die Korrespondenz und warteten auf Gehaltserhöhung, während sie spöttisch von der Heimat sprachen, die ihnen ganz klein und lausig vorkam. Das Rechnervolk bestund zumeist aus älteren Leuten, die sich an ihre Posten und Pöstlein wie an Balken und Pflöcken festhielten. Sie hatten alle lange Nasen von dem vielen Rechnen und gingen in zersessenen, zerschabten, zerglätteten, zerfalteten und zerknickten Kleidern. Es gab aber etliche intelligente Leute unter ihnen, die vielleicht im Geheimen seltsamen, kostbaren Liebhabereien frönten und so ein wenn auch stilles und abgelegenes so doch immerhin würdiges Leben führten. Viele von den jungen Angestellten waren dagegen feinerer Zeitvertreibe nicht fähig, diese stammten meist von ländlichen Grundbesitzern, Gastwirten, Bauern und Handwerkern ab, waren, da sie in die Stadt kamen, sofort bemüht, städtisch-feines Wesen anzunehmen, was ihnen jedoch schlecht gelang, und kamen über eine gewisse tölpische Grobheit nicht hinaus. Indessen, es gab da auch stille Bürschchen von zartem Betragen, die seltsam abstachen von den andern Flegeln. Der Direktor der Bank war ein alter, stiller Mann, der überhaupt nie gesehen wurde. In seinem Kopfe schienen die Fäden und Wurzeln des ganzen ungeheuren Geschäftsganges ineinandergeworfen zu liegen. Wie der Maler in Farben, der Musiker in Tönen, der Bildhauer in Stein, der Bäcker in Mehl, der Dichter in Worten, der Bauer in Strichen Landes, so schien dieser Mann in Geld zu denken. Ein guter Gedanke von ihm, zur guten Zeit ausgedacht, brachte in einer halben Stunde dem Geschäft eine halbe Million. Vielleicht! Vielleicht mehr, vielleicht weniger, vielleicht nichts, und gewiß, manchmal verlor dieser Mann ganz im stillen, und alle seine Untergebenen wußten nichts davon, gingen, wenn die Glocke zwölf schlug, zum Essen, kamen um zwei Uhr wieder, arbeiteten vier Stunden, gingen fort, schliefen, erwachten, standen zum Frühstück auf, gingen wieder, wie am gestrigen Tag ins Gebäude, nahmen die Arbeit wieder auf und keiner wußte, denn keiner hatte Zeit, etwas von diesem Geheimnisvollen in Erfahrung zu bringen. Und der stille, alte, grämliche Mann dachte im Direktionszimmer. Für die Angelegenheiten seiner Angestellten hatte er nur ein mattes, halbes Lächeln. Es hatte etwas Dichterisches, Erhabenes, Entwerfendes und Gesetzgeberisches. Simon versuchte oft, sich in Gedanken an die Stelle des Direktors zu setzen. Aber im allgemeinen verschwand ihm dieses Bild, und wenn er darüber nachdachte, verschwand ihm überhaupt jeder Begriff: »Etwas Stolzes und Erhabenes ist dabei, aber auch etwas Unbegreifliches und beinahe Unmenschliches. Warum gehen nur alle diese Leute, Schreiber und Rechner, ja sogar die Mädchen im zartesten Alter, zu demselben Tor in dasselbe Gebäude hinein, um zu kritzeln, Federn anzuprobieren, zu rechnen und zu fuchteln, zu büffeln und nasenschneuzen, zu bleistiftspitzen und Papier in den Händen herumtragen. Tun sie das etwa gern, tun sie es notgedrungen, tun sie es mit dem Bewußtsein, etwas Vernünftiges und Fruchtbringendes zu verrichten? Sie kommen alle aus ganz verschiedenen Richtungen, ja einige fahren sogar mit der Eisenbahn aus entfernten Gegenden daher, sie spitzen die Ohren, ob es noch Zeit ist, vor Antritt einen privaten Gang zu unternehmen, sie sind so geduldig dabei wie eine Herde von Lämmern, verstreuen sich, wenn es Abend wird, wieder in ihre speziellen Richtungen, und morgen, um dieselbe Zeit, finden sie sich alle wieder ein. Sie sehen sich, erkennen sich am Gang, an der Stimme, an der Manier, eine Türe zu öffnen, aber sie haben wenig miteinander zu tun. Sie gleichen sich alle und sind sich doch alle fremd und wenn einer unter ihnen stirbt oder eine Unterschlagung macht, so verwundern sie sich einen Vormittag lang darüber, und dann geht es weiter. Es kommt vor, daß einer einen Schlaganfall bekommt während des Schreibens. Was hat er dann davon gehabt, daß er fünfzig Jahre lang im Geschäft »arbeitete«. Er ist fünfzig Jahre lang jeden Tag zu derselben Türe ein und ausgegangen, er hat tausend und tausendmal in seinen Geschäftsbriefen dieselbe Redewendung geübt, hat etliche Anzüge gewechselt und sich öfters darüber gewundert, wie wenig Stiefel er des Jahres verbrauche. Und jetzt? Könnte man sagen, daß er gelebt hat? Und leben nicht tausende von Menschen so? Sind vielleicht seine Kinder ihm der Lebensinhalt, ist seine Frau die Lust seines Daseins gewesen? Ja, das kann es sein. Ich will lieber über solche Dinge nicht klugreden, denn mir will scheinen, als zieme es mir nicht, da ich noch jung bin. Draußen ist jetzt Frühling und ich könnte zum Fenster hinausspringen, so weh tut mir dieses lange, lange Glieder-Nicht-Bewegen-dürfen. Ein Bankgebäude ist doch ein dummes Ding im Frühling. Wie nähme sich eine Bankanstalt etwa auf einer grünen, üppigen Wiese aus? Vielleicht würde meine Schreibfeder mir wie eine junge, eben aus der Erde gesprossene Blume vorkommen. Ach, nein, spotten mag ich nicht. Vielleicht muß das alles so sein, vielleicht hat alles einen Zweck. Ich erblicke nur nicht den Zusammenhang, weil ich zu sehr den Anblick erblicke. Der Anblick ist wenig entmutigend: vor den Fenstern dieser Himmel, im Gehör dieses süße Singen. Die weißen Wolken gehen am Himmel und ich muß da schreiben. Warum habe ich ein Auge für die Wolken. Wenn ich ein Schuhmacher wäre, so machte ich doch wenigstens Schuhe für Kinder, Männer und Damen, diese gingen im Frühlingstag in meinen Schuhen auf der Gasse spazieren. Ich würde den Frühling empfinden, wenn ich meinen Schuh an dem fremden Fuß erblickte. Hier kann ich den Frühling nicht empfinden, er stört mich.«
Simon ließ seinen Kopf hängen und war zornig über seine weichen Gefühle.
Eines Abends, als er nach Hause ging, fiel Simon auf der abendlich beleuchteten Brücke ein Mensch, der vor ihm mit langen Schritten daherging, auf. Die Gestalt in ihrer bemäntelten Schlankheit flößte ihm einen süßen Schrecken ein. Er glaubte diesen Gang, dieses Paar Hosen, diesen sonderbaren Kessel von Hut, die flatternden Haare erkennen zu sollen. Der fremde Mann trug eine leichte Malmappe unter dem Arm. Simon ging mit etwas rascheren Schritten, von zitternden Ahnungen befallen, und plötzlich, mit dem Schrei »Bruder«, stürzte er dem Gehenden an den Hals. Kaspar umarmte seinen Bruder. Sie gingen laut miteinander plaudernd nach Hause, das heißt, sie hatten einen ziemlich steilen Weg den Berg hinauf zu machen, über dessen Abhang sich die Stadt mit Gärten und Villen hinzog. Ganz oben am Berge schauten ihnen die kleinen, verfallenen Vorstadthäuschen entgegen. Die untergehende Sonne flammte in den Fenstern und machte sie zu strahlenden Augen, die starr und schön in die Ferne blickten. Unten lag die Stadt, weit und wohllüstig über die Ebene gebreitet, wie ein flimmernder, glitzernder Teppich, die Abendglocken, die immer anders sind als Morgenglocken, tönten herauf, der See lag schwach gezeichnet, in seiner zarten unaussprechlichen Form zu Füßen der Stadt, des Berges und der vielen Gärten. Noch blitzten viele Lichter nicht, aber die, die leuchteten, brannten mit einer herrlichen, fremdartigen Schärfe. Die Menschen gingen und liefen jetzt da unten in all den krummen, versteckten Straßen, man sah sie nicht, aber man wußte es. »In der eleganten Bahnhofstraße würde es jetzt herrlich zu gehen sein,« dachte Simon. Kaspar ging schweigend. Er war ein prachtvoller Kerl geworden. »Wie er daherschreitet,« dachte Simon. Endlich kamen sie vor ihrem Hause an. »Wie? Am Waldesrande wohnst du?« lachte Kaspar. Sie traten beide ins Haus.
Als Klara Agappaia den neuen Ankömmling erblickte, ging in ihren großen müden Augen ein seltsames Flammen auf. Sie schloß ihre Augen und bog ihren schönen Kopf auf die Seite. Es schien nicht, daß sie sehr große Freude empfunden hätte, diesen jungen Mann zu sehen, es erschien wie etwas ganz anderes. Sie versuchte unbefangen zu sein, zu lächeln, wie man zu lächeln pflegt, wenn man jemanden willkommen heißt. Aber sie vermochte es nicht. »Geht hinauf,« sagte sie, »heute bin ich so müde. Wie sonderbar. Ich weiß wirklich nicht, was ich habe.« Die beiden suchten ihr Zimmer auf: Der Mond beleuchtete es. »Wir zünden gar kein Licht an,« sagte Simon, »laß uns so zu Bette gehen.« – Da klopfte jemand an die Türe, es war Klara, sie sagte, draußen stehend: »Habt ihr auch alles Notwendige, fehlt euch nun nichts?« – »Nein, wir liegen schon im Bett, was könnte uns fehlen.« – »Gute Nacht, Freunde,« sagte sie, und öffnete ein wenig die Türe, schloß sie wieder und ging. »Sie scheint eine seltsame Frau zu sein,« meinte Kaspar. Dann schliefen sie beide.
Am andern Morgen packte der Maler seine Landschaften aus der Mappe und es fiel zuerst ein ganzer Herbst heraus, dann ein Winter, alle Stimmungen der Natur wurden wieder lebendig. »Wie wenig das ist von allem dem, was ich gesehen habe. So schnell das Auge eines Malers ist, so langsam, so träge ist seine Hand. Was muß ich noch alles schaffen! Ich meine oft, ich müßte verrückt werden.« Alle drei, Klara, Simon und der Maler, umstanden die Bilder. Es wurde wenig, aber nur in Ausrufen des Entzückens gesprochen. Plötzlich sprang Simon zu seinem Hut, der auf dem Boden des Zimmers lag, setzte ihn wild und zornig auf den Kopf, stürzte zur Türe hinaus, mit dem Ausruf: »Ich habe mich verspätet.«
»Eine Stunde zu spät! Das sollte bei einem jungen Manne nicht vorkommen!« wurde ihm auf der Bank gesagt.
»Wenn es aber doch vorkommt?« fragte der Gescholtene trotzig.
»Wie, Sie wollen noch aufbegehren? Meinetwegen! Machen Sie, was Sie wollen!«
Das Betragen Simons wurde dem Direktor gemeldet. Dieser beschloß, den jungen Mann zu entlassen, er rief ihn zu sich und sagte es ihm mit ganz leiser, sogar gütiger Stimme. Simon sprach:
»Ich bin recht froh, daß es ein Ende hat. Glaubt man vielleicht, daß man mir damit einen Schlag versetzt, daß man meinen Mut knickt, mich vernichtet, oder dergleichen? Im Gegenteil, man erhebt mich, man schmeichelt mir damit, man flößt mir wieder, nach so langer Zeit, einen Tropfen Hoffnung ein. Ich bin nicht dazu geschaffen, eine Schreib- und Rechenmaschine zu sein. Ich schreibe ganz gern, rechne ganz gern, betrage mich mit Vorliebe unter meinen Mitmenschen mit Anstand, bin gern fleißig und gehorche, wo es mein Herz nicht verletzt, mit Leidenschaft. Ich würde mich auch bestimmten Gesetzen zu unterwerfen wissen, wenn es darauf ankäme, aber es kommt mir hier seit einiger Zeit nicht mehr darauf an. Als ich mich heute morgen verspätete, wurde ich nur zornig und ärgerlich, war mit gar keiner ehrlichen, gewissenhaften Besorgnis erfüllt, machte mir keine Vorwürfe, oder höchstens den Vorwurf, daß ich noch immer der dumme, feige Kerl sei, der, wenn es acht Uhr schlägt, springt, in Bewegung kommt, wie eine Uhr, die man aufzieht und die eben läuft, wenn sie aufgezogen wird. Ich danke Ihnen, daß Sie die Energie besitzen, mich zu entlassen, und bitte Sie, von mir zu denken, was Ihnen beliebt. Sie sind gewiß ein schätzenswerter, verdienstvoller, großer Mann, aber, sehen Sie, ich möchte auch so einer sein, und deshalb ist es gut, daß Sie mich fortschicken, deshalb war es eine segensreiche Tat, daß ich mich heute, wie man sich ausdrückt, unstatthaft benommen habe. In Ihren Bureaus, von denen man solches Aufheben macht, in denen so gern jeder beschäftigt sein möchte, ist von einer Entwicklung eines jungen Mannes nicht zu reden. Ich pfeife darauf, den Vorzug zu genießen, der mit der Auszahlung eines festen monatlichen Gehaltes verbunden ist. Ich verkomme, verdumme, verfeige, verknöchere dabei. Sie werden es überraschend finden, mich solcher Ausdrücke bedienen zu hören, aber Sie werden es zugeben, daß ich die völlige Wahrheit spreche. Hier kann nur einer ein Mann sein: Sie! – Kommt Ihnen nie der Gedanke, es möchten sich unter Ihren armen Untergebenen Leute befinden, die den Drang haben, auch Männer zu sein, wirkende, schaffende, achtunggebietende Männer. Ich kann es unmöglich hübsch finden, so ganz in der Welt auf der Seite zu stehen, nur um nicht in den Ruf zu gelangen, ein unzufriedener und wenig anstellbarer Mensch zu sein. Wie groß ist hier die Versuchung zur Furcht und wie klein die Verlockung, sich aus dieser jämmerlichen Furcht loszureißen. Daß ich es heute herbeigeführt habe, dieses beinahe Unmögliche, das schätze ich an mir, mag man dazu sagen, was man nur immer will. Sie, Herr Direktor, verschanzen sich hier, Sie sind nie sichtbar, man weiß nicht, wessen Befehlen man gehorcht, man gehorcht gar nicht, sondern stumpft nur seinen eigenen schwachen Angewöhnungen nach, die das richtige treffen. Welch eine Falle für junge, zur Bequemlichkeit und Trägheit neigende junge Leute. Hier wird nichts verlangt von all den Kräften, die möglicherweise den jungen Mannesgeist beseelen, nichts erforderlich gemacht, was einen Mann und Menschen auszeichnen könnte. Weder Mut noch Geist, weder Treue noch Fleiß, weder Schaffenslust noch Begierde nach Anstrengungen können einem hier helfen, sich vorwärtszubringen: ja, es ist sogar verpönt, Kraft und Fülle zu zeigen. Natürlich, es muß ja verpönt sein, bei diesem langsamen, trägen, trocknen, erbärmlichen Arbeitssystem. Leben Sie wohl, mein Herr, ich gehe, um mich gesund zu arbeiten, wäre es auch, um Erde zu schaufeln oder etliche Säcke Kohlen auf meinem Rücken zu schleppen. Ich liebe jedwelche Arbeit, nur solche nicht, bei deren Ausübung nicht sämtliche verfügbare Kräfte angespannt werden.«
»Soll ich Ihnen, trotzdem Sie es eigentlich nicht verdient haben, ein Zeugnis ausstellen?«
»Ein Zeugnis? Nein, stellen Sie mir keines aus. Wenn ich kein Zeugnis, als höchstens ein schlechtes verdient habe, will ich gar keines. Ich selbst stelle mir von jetzt an meine Zeugnisse aus. Ich will mich von nun an nur noch auf mich selbst berufen, wenn jemand nach meinen Zeugnissen fragt, das wird bei vernünftigen, klarblickenden Menschen den allerbesten Eindruck hervorrufen. Ich freue mich, zeugnislos von Ihnen wegzugehen, denn ein Zeugnis von Ihnen würde mich nur an meine eigene Feigheit und Furcht erinnern, an einen Zustand der Trägheit und Kraftentäußerung, an die Zeit der nutzlos dahingelebten Tage, an die Nachmittage voll wütender Befreiungsversuche, an die Abende der schönen, aber zwecklosen Sehnsucht. Ich danke Ihnen, daß Sie die Absicht hatten, mich in freundlicher Weise zu entlassen, das zeigt mir, daß ich einem Manne gegenübergestanden bin, der vielleicht einiges von dem, was ich sprach, begriffen hat.«
»Junger Mann, Sie sind viel zu heftig,« sprach der Direktor, »Sie untergraben sich Ihre Zukunft!«
»Ich will keine Zukunft, ich will eine Gegenwart haben. Das erscheint mir wertvoller. Eine Zukunft hat man nur, wenn man keine Gegenwart hat, und hat man eine Gegenwart, so vergißt man, an eine Zukunft überhaupt nur zu denken.«
»Leben Sie wohl. Ich fürchte, Sie werden etwas Schlimmes erleben. Sie interessierten mich, deshalb habe ich Ihre Worte angehört. Sonst würde ich mit Ihnen nicht so viel Zeit verloren haben. Vielleicht haben Sie Ihren Beruf verfehlt, vielleicht wird etwas aus Ihnen. Lassen Sie es sich immerhin gut gehen.«
Mit einer Neigung des Kopfes war Simon entlassen, und er befand sich bald draußen auf der Straße. Vor einer Konditorei erblickte er einen Mann auf- und abgehen, wahrscheinlich in Erwartung von irgend jemandem, vielleicht einer Frau, was konnte er wissen. Aber der Mann erweckte sein Interesse. Es war, auf den ersten Blick, ein abschreckend häßlicher Mensch, mit einem ganz ungewöhnlich großen und gebogenen Schädel, einem Vollbart im Gesicht und etwas müdem, ja tierischem Ausdruck in den Augen. Sein Gang war geziert, aber edel, seine Kleidung fein und geschmackvoll. In der Hand trug er einen gelben Spazierstock; er schien ein Gelehrter zu sein, aber ein noch junger Gelehrter. Der ganze Mann, wie er sich bewegte, hatte etwas Sanftes, Herzenbewegendes. Es schien, daß man es wagen durfte, diesen Herrn ohne weiteres anzusprechen, und Simon tat es.
»Verzeihen Sie, mein Herr, Sie so ohne weiteres anzureden. Ich habe eine Vorliebe für Sie gewonnen, sowie ich Sie nur anblickte. Ich wünsche ihre Bekanntschaft zu machen. Sollte dieser lebhafte Wunsch nicht genügender Anlaß sein, um einen Menschen, wie Sie sind, auf offener Straße anzusprechen? Sie sehen so aus, als ob Sie jemand suchten, als ob Sie irgend jemanden vermuteten, der auf diesem Platze Sie erwartete. Es ist ein solches Gewimmel von Menschen hier, daß es schwer sein wird für Sie allein, die betreffende Person zu entdecken. Ich will Ihnen suchen helfen, wenn Sie das Vertrauen haben, mir mit einigen Merkmalen den Menschen zu schildern, zu dem es Sie hinzieht. Ist es eine Dame?«
»Es ist allerdings eine Dame,« erwiderte der Herr lächelnd.
»Wie sieht sie aus?«
»Schwarzgekleidet vom Kopf bis zu den Füßen. Große, schlanke Erscheinung. Große Augen, die, wenn Sie sie erblicken, Ihnen noch nachsehen, lange, lange, wenn es auch gar nicht der Fall ist. Um den Hals trägt sie eine Kette von großen, weißen Perlen, an den Ohren lange, herabhängende Ohrringe. Ihre Knöchel sind von goldenen, einfachen Reifen umschlossen. Ich meine die Knöchel der Hände; das Gesicht hat etwas Volles, Ovales, Üppiges. Sie werden es schon sehen. Um ihren Mund, obgleich man sich darin täuscht, spielt etwas Verschlossenes und Listiges, es ist ein etwas zugekniffener Mund. Übrigens trägt sie gern einen breiten Hut mit herabhängenden Federn. Der Hut scheint dem Kopf und dem Haar nur so angeflogen. Genügt Ihnen diese Beschreibung noch nicht, so mache ich Sie darauf aufmerksam, daß sie ein Windspiel bei sich an einer dünnen, schwarzen Leine führt. Sie geht nie aus ohne den Hund. Ich werde auf diesen Posten bleiben und Sie zurückerwarten. Ich bin Ihnen dankbar für Ihr Anerbieten, ganz abgesehen davon, daß Sie mich schon Ihrer Anrede halber lebhaft interessieren. Das Gewirr von Menschen wird wirklich immer größer. Es scheint hier ein Fest zu sein.«
»Ja, ich glaube, es ist so etwas. Ich pflege mich um Feste wenig zu bekümmern.«
»Warum denn?«
»Man geht so seine eigenen Wege! Auf Wiedersehen!« Damit ging Simon durch die dichten Menschenmassen so schnell als möglich hindurch. Von allen Seiten wurde er gedrängt und geschoben, beinahe gehoben. Aber auch er drängte und er fand es höchst belustigend, so das Gewühl von Leibern und Gesichtern langsam zu durchqueren. Endlich gelangte er auf eine Art Insel, das heißt, auf einen kleinen, leeren Platz, und wie er sich umsah, erblickte er plötzlich Frau Klara. Sie hatte wirklich einen Hund bei sich. Seit er bei ihr wohnte, hatte er sich nie um die Frau näher gekümmert, wußte also auch nicht, daß sie die Gewohnheit hatte, mit ihrem Hund auszugehen.
»Es sucht Sie ein Herr,« sagte er als sie ihn bemerkte.
»Mein Mann wahrscheinlich,« erwiderte sie, »kommen Sie, wir gehen zusammen. Er ist von der Reise plötzlich zurückgekehrt, ohne mir nur ein Wort zu schreiben. So macht er es immer. Wie haben Sie seine Bekanntschaft gemacht? Wie kommen Sie dazu, in seinem Auftrag Damen zu suchen? Sie sind doch ein sonderbarer Mensch, Simon. Was? Ihre Stellung haben Sie aufgegeben? Nun, was wollen Sie jetzt unternehmen? Kommen Sie! Hier durch! Hier ist besser durchkommen. Ich werde Sie meinem Mann vorstellen.«
Man beschloß, den Abend im Theater zu verbringen. Kaspar wurde davon benachrichtigt und er fand sich zur bestimmten Stunde vor dem Theater, das sich als ein weißes, herrliches Gebäude am Ufer des Sees erhob, ein. Als der Vorhang aufging, sah man nur in einen grauen, leeren Raum hin. Doch der Raum belebte sich alsobald, denn es erschien eine Tänzerin mit nackten Beinen und Armen, die zu einer leisen Musik tanzte. Ihr Leib war von einem durchschimmernden, flatternden, fließenden Gewand umhüllt, das, so schien es, die Linien des Tanzes noch einmal für sich, in der schwebenden Luft, nachzeichnete. Man empfand die völlige Unschuld und Grazie dieses Tanzes und es würde niemandem eingefallen sein, in der Nacktheit des Mädchens etwas Unkeusches und unrein-Beabsichtigtes zu finden. Ihr Tanz löste sich oft in ein bloßes Schreiten auf, doch auch dieses blieb Tanz, und ein anderes Mal wieder schien die Tanzende von ihren eigenen Wellen in die Höhe erhoben zu werden. Wenn sie zum Beispiel ein Bein erhob und den schönen Fuß krümmte, so geschah das in einer so neuen, unbefangenen Weise, daß jedermann dachte: wo habe ich das einmal gesehen, wo? Oder habe ich das nur irgend einmal geträumt? Der Tanz dieses Mädchens hatte etwas Schweres und Naturgemäßes. Gewiß, ihre Kunst war vielleicht, streng nach Ballettregeln genommen, nicht allzugroß, ihr Können mochte weit zurückbleiben hinter dem Können und Leisten anderer Tänzerinnen. Aber sie besaß die Kunst, mit ihrer bloßen, mädchenscheuen Anmut zu entzücken. Wenn sie niederflog, so geschah es so süß-schwer, und das Emporfliegen zu höherem Schwung berauschte alle Seelen durch die Wildheit und Unschuld dieser Bewegung. Wenn sie sich bewegte, war sie auch erregt von dieser ihrer flüchtigen Bewegung, und ihre Erregung erfand zu den Tönen immer neue Schwingungen. Ihre Hände glichen zwei schönen weißen, flatternden Tauben. Das Mädchen lächelte, wenn es tanzte, es mußte glücklich dabei sein. Ihre Kunstlosigkeit wurde als höchste Kunst empfunden. Einmal flog sie in großen weichen Sprüngen, wie ein gejagter Hirsch, von einem Takt in den andern. Sie schien wie ein Wellengesprudel zu tanzen, daß sich an einem niedern Ufer zerschlägt und verspritzt, bald floß sie wie eine breite, sonnige, machtvolle Welle dahin, wie eine Welle mitten im See, bald war es wieder wie ein Geriesel von Flocken und Steinchen, immer war es anders, und immer so seelenvoll. Die Empfindungen aller Zuschauer tanzten mit Lust und mit Schmerzen mit. Einigen preßte der Tanz Tränen in die Augen, reine Tränen des Mit-Entzückens, Mit-Tanzens. Wie schön war es, zu sehen, daß, da das Mädchen seinen Tanz beendete, bejahrte, ehrfurchtgebietende Frauen sich stürmisch erhoben, dem Mädchen mit Tüchern zuwinkten und ihr Blumen in den Bühnen-Abgrund hinabwarfen. »Sei unsere Schwester,« schien aller Lächeln zu bitten. »Welche Freude, dich meine Tochter, wenn du's wolltest, zu nennen,« schienen die Damen zu jubeln. Das hundertköpfige Zuschauerpublikum sah die Kleine auf der einsamen Bühne und vergaß die Grenze, überhaupt alle Scheidewand. Viele Arme bogen sich, wie wenn sie hätten liebkosen mögen, in die Luft; die Hände, die zuwinkten, bebten. Man rief Worte hinab, die die bloße Freude erfand. Selbst die kalten, goldenen Figuren der Dekoration schienen lebendig werden zu wollen und den Lorbeer, den sie in den Händen trugen, einmal auf ein Haupt fallen zu lassen. So schön hatte Simon das Theater noch nie gesehen. Klara war sehr entzückt, wer hätte es an diesem Abend nicht sein können. Nur Herr Agappaia blieb still und sagte kein Wort. Kaspar sagte: »Ich will eine solche Ovation malen, das müßte ein herrliches Bild werden.« »Aber schwer zu malen,« sagte Simon, »dieser Duft und Glanz der Freude, dieses Schimmern des Entzückens, das Kalte und Warme, das Bestimmte und Verschwommene, Farben und Formen in diesem Duft, das Gold und das schwere Rot, so untergehend in allen Farben, und die Bühne, der kleine Brennpunkt und das kleine, selige Mädchen darauf, die Kleider der Damen, die Gesichter der Männer, die Logen und alles andere, wirklich, Kaspar, es würde sehr schwer sein.«
Klara sagte: »Wenn man jetzt an eine stille Landschaft denkt, da draußen liegen sie, die Wälder und Hügel und die weiten Wiesen, und man sitzt hier in einem glitzernden Theater. Wie sonderbar. Vielleicht ist aber alles Natur. Nicht nur das Große und Stille da draußen, sondern auch das Bewegliche und Kleine, was die Menschen erschaffen. Ein Theater ist auch Natur. Was die Natur uns heißt zu bauen, kann auch nur Natur, etwas freilich wie Abart der Natur sein. Mag die Kultur so fein werden wie sie will, sie bleibt doch Natur, denn sie ist doch nur die langsame Erfindung durch Zeiten, und zwar von Wesen, die an der Natur immer hangen werden. Wenn Sie ein Bild malen, Kaspar, so wird es Natur, denn Sie malen mit Ihren Sinnen und Fingern und diese haben Sie doch von der Natur bekommen. Nein, wir tun gut daran, sie zu lieben, immer ihrer recht zu gedenken, sie, wenn ich so sagen darf, anzubeten, denn irgendwo müssen die Menschen gebetet haben, sonst werden sie schlecht. Wenn wir nun lieben, was uns am nächsten ist, so ist das ein Vorteil, der unsere Jahrhunderte stürmischer vorwärts treibt, der uns mit der Erde gedankenvoll rollen läßt, ein Vorteil, der uns das Leben schneller und seliger empfinden macht, den wir also packen und ergreifen müssen, tausendmal, in tausend Momenten, was weiß ich!« – – –
Sie war ganz feurig geworden im Sprechen. »Habe ich auch etwas Vernünftiges gesprochen?« fragte sie Kaspar.
Kaspar antwortete nicht. Sie waren längst aus dem Theater heraus und befanden sich auf dem Nachhauseweg.
Simon war mit Herrn Agappaia ein Stück vorausgegangen.
»Erzählen Sie mir etwas,« bat Klara ihren Begleiter.
»Ich habe einen Kollegen, Erwin mit Namen,« erzählte Kaspar, indem er neben der Frau herging, »er ist wenig talentvoll, oder vielleicht war er in seiner frühesten Jugend einmal talentvoll. Dagegen ist er noch immer, trotzdem ihm das Malen nicht den geringsten Erfolg verspricht, wie ein Satan in seine Kunst verliebt. Alle seine Bilder nennt er schlecht, und sie sind es auch, aber er arbeitet jahrelang an ihnen. Er kratzt immer wieder ab und malt von neuem. So die Natur zu lieben, wie er, muß eine Qual sein und ist eine Schande; denn ein Mann von Vernunft läßt sich nicht lange von einem Gegenstand, und sei es auch die Natur selber, foppen und narren und peinigen. Natürlich ist nicht die Kunst seine Peinigerin, sondern er selber ist sein Quäler mit seiner armseligen Auffassung von Kunst und Welt. Dieser Erwin liebt mich. Ich malte, als wir beide Anfänger waren, zusammen mit ihm. Wir tummelten uns auf den Wiesen herum, unter den Bäumen, die ich immer nur in vollster prangendster Blütenpracht vor mir sehe, wenn ich an jene »gottvolle« Zeit denke. Dieses Wort »gottvoll« ist eines, das Erwin in seiner blinden Überschwenglichkeit geprägt hat, wenn er vor Landschaften stand, deren Schönheit seine Fassungskraft überstieg. »Kaspar, sieh einmal diese gottvolle Landschaft,« das hat er, ich weiß nicht wie viel hundertmal, zu mir gesagt. Schon damals, obgleich er ganz hübsche Bilder zustande brachte, die mit Talent gemacht waren, kritisierte er sich bissig und schonungslos. Er vernichtete seine gelungenen Bilder und hob nur die mißlungenen auf, weil er nur diese als wertvoll empfand. Sein Talent litt furchtbar unter diesem beständigen Mißtrauen, bis es schließlich unter solcher schlechter Behandlung eintrocknete und versiegte wie ein Quell, der von der Sonne verbrannt und ausgesogen wird. Ich riet ihm öfters, fertige Bilder zu einem bescheidenen Preis zu verkaufen, aber er hätte mir für diese Zumutung beinahe die Freundschaft aufgekündet. Über mich verwunderte er sich täglich mehr, wie ich nur so leicht und ziemlich frivol vor mich hinmalen konnte, aber er achtete mein Talent, das er zugeben mußte. Er wünschte, ich möchte meine Kunst mit mehr Ernst betreiben, ich antwortete, daß es bei der Kunstausübung nur des Fleißes, des fröhlichen Eifers und der Naturbeobachtung bedürfe, um zu etwas zu kommen, und machte ihn auf den Schaden aufmerksam, den der übertriebene, heilige Ernst um eine Sache der Sache antun könne und müsse. Er glaubte mir wirklich, war aber zu schwach, um sich von seinem verbohrten Ernst, in den er festgebissen war, loszureißen. Dann reiste ich weg, und bekam die sehnsüchtigsten Briefe von ihm, die voll Trauer über meine Abreise klangen. Ich sei noch derjenige gewesen, der ihn noch ein wenig munter erhalten hätte. Ich möchte doch zurückkehren, oder wenn nicht, so bäte er mich, daß ich ihm erlaube, mir nachzureisen. Er tat es auch. Er war immer hinter mir wie mein leibeigener Schatten, so oft ich ihn auch kalt, spöttisch und von oben herab behandelte. Er vermied die Frauen, ja er haßte sie, denn er befürchtete, von ihnen von der Heiligkeit seiner Lebensaufgabe abgelenkt zu werden. Infolgedessen lachte ich ihn aus und es kann sein, daß ich ihn ziemlich verächtlich behandelt habe. Er malte immer schwerfälliger und war immer versessener in die Studien. Ich riet ihm, nicht so sehr zu studieren und mehr die Hand an den Pinsel zu gewöhnen. Er versuchte es und weinte beim Anblick meines sorglosen In-den-Tag-hinein-Schaffens. Da unternahmen wir zusammen eine Reise nach meiner Heimat, Sie wissen! Über die breiten hohen Berge geht es da, in tiefe Täler steil hinunter und sogleich wieder hinauf. Mir war es ein Spaß zum Handausstrecken, ein Genießen, ein etwas schnelleres Atmen, eine größere Inanspruchnahme der Beine, weiter nichts. Erwin kam kaum vorwärts: wirklich, seine Kräfte waren bereits zerrüttet von der Ausschweifung seines Kunstsehnens. Eines Tages erblickten wir, es war gegen Abend, auf einer hohen Bergweide stehend, vor uns, durch Tannengeäst hindurch die drei Seen meiner Heimat. Erwin schrie bei diesem Schauspiel auf. Es war in der Tat unvergeßlich schön. Unten klang das Gelärm der Eisenbahnen, und Glocken tönten herauf. Die Stadt konnte man noch nicht sehen, aber ich wies Erwin mit der ausgestreckten Hand auf die Stelle, wo sie liegen mußte. Wie die Gewänder von Fürstinnen lagen blitzend und sanft leuchtend die Seen ausgebreitet, von edlen Berglinien umschlossen, mit entzückend zierlichen Uferbildungen, und so weit in der Ferne, und doch so nah. Noch an diesem Abend rückten wir, verstaubt und ausgehungert, zu Hause an. Meine Schwester freute sich über den stillen Gast, den ich brachte. Es mag jetzt etwa drei Jahre her sein. Sie schloß sich mit der Zeit an ihn an, und ich darf glauben, daß eine stille Liebe zu Erwin in ihr brannte. Es schmerzte sie, zu sehen, in welcher Weise ich mit ihrem Schutzbefohlenen umging. Sie bat mich, freundlicher und achtungsvoller von ihm zu reden, wenn ich von ihm in etwas lustigem Tone sprach. Lange hielt es der arme Kerl auch nicht aus. Eines Tages nahm er Abschied. Meiner Schwester hat er einen Spruch ins Tagebuch schreiben müssen. Wie komisch das alles ist und doch wie tief. Vielleicht hatte er, da er ihr ins Buch schrieb, die Hand gedankenvoll gestützt, und sich eine Zukunft mit meiner Schwester ausgedacht. Was versprach ihm die Kunst? Ich hatte einige Sorge, meine Schwester würde etwas wie eine Szene machen. Aber sie schaute ihn bloß innig und gütig an beim Abschiednehmen. Er durfte sie nicht anschauen, er wagte es nicht. Kam er sich vor wie ein Erbärmlicher? Leicht möglich. Vielleicht glaubte er überhaupt nicht, daß Mädchen ihn lieben und zum Mann begehren könnten, denn er hatte ein Muttermal quer über das ganze Gesicht. Aber in meinen Augen hat ihn das immer veredelt. Ich sah ihn sehr gerne an. Wir reisten, und dann frug er mich einmal, ob er meiner Schwester schreiben dürfe. »Was geht das mich an,« rief ich aus. »Schreibe, wenn du Lust hast!« Er ging wieder nach Hause, in die ganz tote, düstere Umgebung seiner Akademieprofessoren. Ich bemitleidete ihn, aber trennte mich kalt von ihm, wenigstens zeigte ich ihm die Kälte, denn es war mir unangenehm, einem Bemitleidenswerten gegenüber warm zu werden. Er schrieb einige Briefe, die ich nicht beantwortete, und er schreibt auch jetzt, und auch jetzt antworte ich nicht. Er hängt zum Verzweifeln an mir. Ist es da nötig, noch zu antworten? Er ist verloren, er macht absolut keinen Fortschritt. Seine gegenwärtigen Bilder sind schrecklich. Und doch hat kein Mensch ein so inniges Bündnis mit mir gehabt wie er, und wenn ich an jene Tage denke, wo wir zusammen an der Natur hingen! Was geht alles in der Welt vorüber. Man muß schaffen, schaffen und nochmals schaffen, dazu ist man da, nicht zum Bemitleiden.«
»Der arme Mensch,« sagte Klara, »ich habe Mitleid mit ihm. Ich möchte, daß er hier wäre, und wenn er krank wäre, wie gerne möchte ich ihn pflegen. Ein unglücklicher Künstler ist wie ein unglücklicher König. Wie tief in der Seele muß es ihn schmerzen, sich so talentlos zu wissen. Ich kann es mir so gut denken. Armer Kerl. Ich möchte ihm Freundin sein, da Sie keine Zeit haben, Mitleid mit ihm zu empfinden. Ich hätte Zeit. Was für arme Menschen gibt es doch auf der Welt!«
Kaspar sagte leise zu ihr und ergriff zum ersten Mal ihre Hand: »Wie gut Sie sind!« –
Der Wald war tiefschwarz, alles war dunkel, das Haus war ein dunkler Fleck im Dunkel. Simon und Agappaia warteten auf die beiden andern an der Haustür.
»Sie kommen nicht. Kommen Sie, wir wollen hineingehen.«
»Ich möchte mich gleich schlafen legen,« sagte Simon.
Als er bereits im Bett lag und die Augen zuschließen wollte hörte er plötzlich einen Schuß fallen. Erschreckt bis zum äußersten sprang er auf, riß das Fenster auf und schaute hinaus. »Was ist das,« rief er hinunter. Aber nur seine eigene Stimme widerhallte vom Walde her. Der Wald war in eine schauerliche Totenstille gehüllt. Plötzlich vernahm er, wie unten eine Männerstimme sprach: »Es ist nichts, schlafen Sie. Verzeihen Sie, daß ich Sie erschreckt habe. Ich pflege des Nachts öfters im Walde zu schießen, es macht mir Vergnügen, so den Schuß knallen und widerhallen zu hören. Der eine pfeift gern eine Melodie, um sich, wenn alles so still um ihn ist, zu zerstreuen. Ich schieße. Tragen Sie Sorgfalt, daß Sie sich nicht erkälten so am offenen Fenster. Die Nächte sind jetzt noch kühl. Gleich werden Sie wieder schießen hören und dann werden Sie sich wohl nicht mehr ängstigen. Ich erwarte noch meine Frau. Gute Nacht. Schlafen Sie wohl.« Simon legte sich wieder nieder. Dennoch fand er keinen Schlaf. Die Stimme des Mannes hatte ihm so merkwürdig geklungen, so ruhig, und das eben war das Eigentümliche. So eisig, eigentlich ganz gewöhnlich freundlich, aber eben darin lag das Eisige. Es mußte etwas dahinter stecken. Aber vielleicht kannte er nur dieses Mannes Gewohnheiten nicht. »Es gibt,« dachte er für sich, »heutzutage ja sonderbare Käuze genug. Das Leben ist ja so langweilig, das fördert das Anwachsen der Käuze. Man wird, ehe man es recht weiß, zum seltsamen Kauz. So mag auch dieser Agappaia gar nichts Wunderliches mehr in seinen Wunderlichkeiten sehen. Man nennt es einfach Sport und schlägt alle fremden Gedanken damit nieder. Immerhin, ich will jetzt versuchen, zu schlafen.« – aber es kamen andere Gedanken, die alle mit Nächten zu tun hatten. Er dachte an kleine Kinder, die nicht in dunkle Zimmer zu gehen wagen, die nicht einschlafen können im Dunkel. Die Eltern prägen den Kindern die fürchterliche Angst vor dem Dunkel ein und schicken dann zur Strafe die Unartigen in stille, schwarze Kammern. Da greift nun das Kind im Dunkel, im dicken Dunkel und stößt nur auf Dunkel. Des Kindes Angst und das Dunkel kommen ganz gut miteinander aus, aber nicht das Kind mit der Angst. Das Kind hat soviel Talent, Angst zu haben, daß die Angst immer größer wird. Sie bemächtigt sich des kleinen Kindes, denn sie ist etwas so Großes, Dickes, Schweratmendes; das Kind würde zum Beispiel gern schreien wollen, aber es wagt es nicht. Dieses Nicht-Wagen vergrößert noch seine Angst; denn etwas Furchtbares muß da sein, wenn man nicht einmal vor Angst Angstschreie ausstoßen darf. Das Kind glaubt, jemand horche im Dunkel. Wie schwermütig einen das macht, sich solch ein armes Kind vorzustellen. Wie die armen Öhrchen sich anstrengen, ein Geräusch zu erhorchen: nur den tausendsten Teil eines Geräuschleins. Nichts hören ist viel angstvoller als etwas hören, wenn man schon einmal im Dunkel steht und hinhorcht. Überhaupt schon: hinhorchen und beinahe das eigene Horchen hören. Das Kind hört nicht auf, zu hören. Manchmal horcht es, und manchmal hört es nur, denn das Kind weiß zu unterscheiden in seiner namenlosen Angst. Wenn man sagt: hören, so wird eigentlich etwas gehört, aber wenn man sagt: horchen, so horcht man vergeblich, man hört nichts, man möchte hören. Horchen ist Sache des Kindes, das in eine dunkle Kammer eingesperrt wird, zur Strafe für Unarten. Denke man sich jetzt, daß jemand herankäme, leise, fürchterlich leise. Nein, das lieber nicht denken. Lieber das nicht denken. Derjenige, der das denkt, stirbt mit dem Kinde vor Schreck. So zarte Seelen haben Kinder, und solchen Seelen solche Schrecknisse zudenken! Eltern, Eltern, stecket nie eure unartigen Kinder in dunkle Kammern, wenn ihr sie vorher gelehrt habt, Angst vor dem sonst so lieben, lieben Dunkel zu empfinden. – –
Jetzt hatte Simon keine Angst mehr, es möchte noch in dieser Nacht etwas vorkommen. Er schlief ein, und als er am Morgen erwachte, sah er seinen Bruder ruhig neben sich im Bett schlafen. Er hätte ihn küssen mögen. Er zog sich, um den Schlafenden nicht zu wecken, so behutsam wie möglich an, öffnete leise die Türe und ging die Treppe hinunter. Auf der Treppe begegnete er Klara. Sie schien schon eine ganze Weile da gewartet zu haben. Simon hatte jedoch kaum guten Morgen gesagt, als ihn auch schon die Frau, die heftig bewegt schien, um den Hals faßte und an sich zog und voll Liebe küßte. »Ich will dich auch küssen, du bist ja sein Bruder,« sagte sie mit leiser, gepreßter, glückseliger Stimme.
»Er schläft noch,« sagte Simon. Es war seine Gewohnheit, Zärtlichkeiten, die nicht ihm galten, sanft abzuweisen. Diese Ruhe brachte ihre Seele erst recht in Bewegung. Sie ließ ihn nicht weitergehen, sondern schloß ihn fester an sich, indem sie seinen Kopf in ihre beiden Hände nahm und Küsse auf seine Stirne und auf seine Wangen drückte. »Ich habe dich so lieb wie einen Bruder. Du bist jetzt mein Bruder. Ich habe so wenig und so viel, siehst du! Ich habe gar nichts, ich habe alles gegeben. Wirst du mich meiden? Nein, nicht wahr, nein! Ich besitze dein Herz, ich weiß es. Ich bin reich mit einem solchen Vertrauten. Du liebst deinen Bruder, wie keiner ihn liebt. Mit so viel Stärke und Willen. Erzähle mir von dir. Wie schön kommst du mir vor. Du bist ganz anders, als er. Man kann dich nicht beschreiben. Er sagte es auch, man könne dich kaum fassen. Und doch, wie vertrauensvoll wirft man sich dir entgegen. Küsse mich. Ich bin dein, in dem Sinne, wie dein Herz es will. Dein Herz ist das Schöne an dir. Sage nur nichts. Ich verstehe, daß man dich nicht versteht. Du verstehst alles. Du bist gut zu mir, sage, sage ja. Nein, sage nicht ja. Es ist nicht nötig, ist gar, gar nicht nötig. Deine Augen haben schon ja gesagt. Ich wußte es schon lange. Ich wußte schon lange, daß es solche Menschen gäbe, zwinge dich nur nicht zur Kälte. Schläft er? O nein, gehe noch nicht. Ich muß mich noch ein wenig zanken mit dir. Ich bin eine dumme, dumme, dumme Frau, nicht wahr.«
In diesem Tone würde sie fortgeredet haben, aber Simon wehrte ihr ab, ganz sanft, wie es seine Art war. Er sagte, er wolle einen Spaziergang machen. Sie sah ihm nach, wie er davonging, aber er bekümmerte sich nicht im geringsten um ihren Blick. »Ich diene ihr, wenn sie mich zu einem Dienst braucht; selbstverständlich!« sagte er zu sich. »Ich würde wahrscheinlich mein Leben hinwerfen für sie, wenn es ihr diente zu ihrem Wohlsein, es zu fordern; sehr wahrscheinlich! Ja, es ist ziemlich sicher, daß ich das täte, gerade für so eine. Sie hat so etwas Derartiges. Mit einem Wort: sie beherrscht mich natürlich, aber was ist da weiter zu grübeln. Ich habe an andere Sachen zu denken. Zum Beispiel heute morgen bin ich glücklich, ich spüre meine Glieder wie feine, geschmeidige Drähte. Wenn ich meine Glieder spüre, bin ich glücklich, und da denke ich an keinen Menschen auf der Welt, weder an ein Weib, noch an einen Mann, einfach an nichts. Ach, ist das schön hier im Wald so am sonnigen Morgen. Ist das schön, frei zu sein. Mag jetzt eine Seele an mich denken, mag sie, oder mag sie nicht, jedenfalls denkt die meinige an gar nichts. Ein solcher Morgen weckt immer eine gewisse Brutalität in mir, aber das schadet nichts, im Gegenteil, ist die Grundlage zum selbstlosen Naturgenuß. Herrlich, herrlich. Wie das Gras in der Sonne blitzt. Wie der weiße Himmel um die Erde brennt. Es kann ja auch heute noch kommen, dieses Weichwerden. Wenn ich an jemand denke, dann tu ich es heftig. Aber köstlicher ist es, so wie ich jetzt bin. Lieblicher Morgen. Soll ich dir ein Lied singen. Ja, du bist selber ein Lied. Viel lieber möchte ich schreien und laufen wie der Teufel, oder Schüsse abknallen wie der dumme Teufel Agappaia.« –
Er warf sich auf die Matte nieder und träumte.
An diesem Morgen fuhren Kaspar und Klara in einem kleinen, farbigen Boot auf dem See. Der See war ganz ruhig wie ein glänzender, stiller Spiegel. Ab und zu kreuzten sie einen kleinen Dampfer, dann gab es für eine kurze Zeit breite, sanfte Wellen, und sie durchschnitten diese Wellen. Klara war in ein ganz schneeweißes Kleid gehüllt, die weiten Ärmel hingen an den schönen Armen und Händen träge herunter. Den Hut hatte sie abgenommen: die Haare hatte sie aufgelöst, ganz unabsichtlich, mit einer schönen Bewegung der Hand. Ihr Mund lächelte zu dem Munde des jungen Mannes hinüber. Sie wußte nichts zu sagen, sie mochte nichts sagen. »Wie schön das Wasser ist, es ist wie ein Himmel,« sagte sie. Ihre Stirne war heiter wie die Umgebung von See, Ufer und wolkenlosem Himmel. Das Blau des Himmels war von einem duftenden und schimmernden Weiß durchzogen. Das Weiß trübte ein wenig das Blau, verfeinerte es, machte es sehnsüchtiger und schwankender und milder. Die Sonne schien halb durch, wie Sonne in Träumen. Es lag eine Zaghaftigkeit in allem, die Luft fächelte ihnen um das Haar und das Gesicht, Kaspars Gesicht war ernst, doch ohne Sorgen. Er ruderte eine Weile stark, dann jedoch ließ er die Ruder fahren, das Schiff schaukelte ohne Führung weiter. Er bog sich nach der versinkenden Stadt um, sah die Türme und Dächer in der halben Sonne leicht glitzern, sah, wie die emsigen Menschen über die Brücken liefen. Die Karren und Wagen kamen nach, die elektrische Trambahn sprang mit ihrem eigenartigen Geräusch vorüber. Die Drähte sausten, die Peitschen knallten, Pfeifen hörte man und große schallende Klänge von irgend woher. Auf einmal tönten die Elfuhr-Glocken in all die Stille und in all das ferne, zitternde Geräusch hinein. Sie empfanden beide eine unaussprechliche Freude am Tag, am Morgen, an den Tönen und Farben. Es wurde alles zu einem Erfassen, zu einem Ton! Liebende, wie sie waren, hörten sie alles in einen einzigen Ton überschlagen. Ein Strauß von einfachen Blumen lag in Klaras Schoße. Kaspar hatte seinen Rock ausgezogen und ruderte wieder weiter. Da schlug es Mittag, und alle diese Arbeits- und Berufsmenschen liefen wie ein Haufen von Ameisen nach allen Straßenrichtungen auseinander. Es wimmelte auf der weißen Brücke von schwarzen, beweglichen Punkten. Und wenn man daran dachte, daß jeder dieser schwarzen Punkte einen Mund hatte, mit dem er jetzt das Mittagessen essen wollte, so mußte man unwillkürlich lachen. Wie so ein Bild des Lebens einzig sei, empfanden sie, und lachten dabei. Auch sie kehrten jetzt um, denn schließlich waren sie auch Menschen, die Hunger bekamen; und je näher sie dem Ufer kamen, desto größer wurden wieder die Ameisen; und dann stiegen sie aus und waren ebenfalls Punkte, wie die andern. Aber sie spazierten selig unter den hellgrünen Bäumen auf und ab. Viele Neugierige schauten sich nach dem seltsamen Paare um: der Frau in dem langen, nachschleppenden, weißen Gewande und dem Flegel von Burschen, der nicht mal eine ordentliche Hose trug, der so seltsam frech abstach von der Dame, die er begleitete. So pflegen sich die Menschen zu empören und zu irren in ihren Mitmenschen. Auf einmal kam jemand auf Kaspar lebhaft zugeschritten. Es war in der Tat einer, der Grund hatte, ihn auf diese Weise zu begrüßen, nämlich Klaus, der seinen Bruder schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Hinter ihm kam die Schwester und ein anderer Herr, und nun begrüßte sich alles gegenseitig. Der fremde Herr hieß Sebastian.
Simon saß unterdessen, kaum tausend Schritte weit entfernt, in einer Speisehalle, einem kleinen Raum, vollgepfropft mit essenden Menschen. Hier pflegte allerhand Volk zu essen, das billig und schnell essen mußte. Simon liebte gerade diesen Ort, wo doch jede Bequemlichkeit und Eleganz durchaus fehlte. Auch hatte er ja mit dem Gelde zu rechnen. Das Speisehaus war von einer Gruppe von Frauen gegründet, die sich, alle zusammen gerechnet, Verein für Mäßigkeit und Volkswohl nannten. In der Tat, wer da hineinging, der mußte mit einem mäßigen und dünnen Essen zufrieden sein. Meistens waren auch alle zufrieden, wenn man die kleinen, bornierten Unzufriedenheiten abrechnet. Allen, die hier verkehrten, schien das Essen zu behagen, das aus einem Teller Suppe, einem Stück Brot, einer Portion Fleisch, dito Gemüse und einem winzigen und zierlichen Dessert bestand. Die Bedienung ließ nichts zu wünschen übrig, als ein wenig mehr Behendigkeit, aber im Grunde genommen war sie schnell genug in Anbetracht der zahlreichen hungrigen Esser. Jeder bekam sein Essen frühzeitig genug, auch wenn jeder eine kleine Ungeduld nach noch frühzeitigerem Verabreichen verspürte. Es war ein immerwährendes Essen-Austeilen, Essen-In-Empfangnehmen und Essen-Verschlingen. Mancher, der verschlungen hatte, mochte den Wunsch empfinden, noch nicht soweit zu sein, und sah neidisch auf solche, die zu erwarten hatten, was doch eigentlich ganz nett war hinunterzuschlingen. Warum aßen sie so schnell. Eine absurde Gewohnheit, so schnell sein Essen zu essen. Die Bedienung bestand aus ganz lieblichen Mädchen aus der ländlichen Umgebung der Stadt. Eine kurze Zeit waren diese Geschöpfe ziemlich unbeholfen, aber sie lernten es, abzuwehren und mit dem Ablehnen Zeit zu gewinnen, ganz dringende, brennende Wünsche zu befriedigen. Wo so viele Wünsche waren, mußte unter den Wünschen fein unterschieden und gewählt werden. Ab und zu kam eine der Erfinderinnen dieses Geschäftes, eine der Wohltäterinnen, und sah sich das Volk an, wie es aß. Eine solche Dame setzte ihre Lorgnette ans Auge und musterte das Essen und diejenigen, die es verzehrten.
Simon empfand eine Vorliebe für diese Damen und freute sich immer, wenn sie kamen, denn es kam ihm so vor, als besuchten diese lieben, gütigen Frauen einen Saal voll kleiner, armer Kinder, um zu sehen, wie diese sich an einem Festmahl ergötzten. »Ist denn das Volk nicht ein großes, armes, kleines Kind das bevormundet und überwacht werden muß?« rief es in ihm, »und ist es nicht besser, es wird überwacht von Frauen, die doch vornehme Damen sind und gütige Herzen haben, als von Tyrannen im alten, freilich heroischeren Sinn?« – Was aß nicht alles in der Eßstube, zu einer friedlichen Familie vereint! Studentinnen in erster Linie. Hatten Studentinnen Zeit und Geld, um im Hotel Continental zu essen? Und dann Dienstmänner in blauen, leichten Kitteln mit Stiefeln an den Beinen, großen, borstigen Schnurrbärten und ziemlich eckigen Mäulern im Gesicht. Was konnten sie dafür, daß sie eckige Mäuler hatten? Mancher im Hotel Royal hatte gewiß auch ein eckiges Gebaren rund um den Schnurrbart herum. Freilich war dort das Eckige übertüncht mit einer Rundung, aber was hatte das wohl zu heißen? Auch Dienstmädchen ohne Stellung waren da, arme Schreiber, überhaupt Weggejagte, Brotlose, Heimatlose und auch solche, die nicht einmal eine Adresse besaßen. Ebenso verkehrten hier Frauen von schlechtem Lebenswandel, Weiber mit seltsamen Frisuren und blauen Gesichtern, dicken Händen und frechen aber verschämten Blicken. Alle diese Leute, allen voran natürlich die heiligen Betbrüder, die ebenfalls zu sehen waren, benahmen sich in der Regel schüchtern und zuvorkommend. Alle schauten allen ins Gesicht während des Essens; kein Wort wurde gesprochen, nur hin und wieder ein leises und höfliches. Das war der sichtbare Segen des Volkswohles und der Mäßigkeit. Etwas Drolliges, etwas Einfaches, etwas Gedrücktes und wiederum etwas Befreites lag auf den armseligen Menschen, in ihren Manieren, die bunt waren wie die Farben eines Sommervogels. Wie mancher benahm sich hier feiner als der Feinste sonst in vornehmen Häusern. Wer konnte wissen, wer er war, was er gewesen, vordem, ehe er ins Volksspeisezimmer gelangte. Würfelte denn nicht das Leben die Schicksale der Menschen heftig durcheinander wie mit einem Würfelbecher? Simon saß in einer kleinen Ecke, einer Art Erker, und aß Butter mit Honig, auf ein Stück Brot zusammengestrichen, und trank eine Tasse Kaffee dazu: »Was brauche ich mehr zu essen an einem so schönen Tage. Blickt nicht der blaue Frühsommerhimmel holdselig durch das Fenster auf mein goldnes Essen herab. Freilich ist mein Essen ein goldenes. Man erblicke nur den Honig: hat er nicht ein hellgelbes, süßgoldenes Aussehen? Dieses Gold fließt so angenehm auf dem kleinen, weißen Tellerchen herum, und wenn ich mit dem spitzen Messer davon absteche, so komme ich mir vor wie ein Goldgräber, der einen Schatz entdeckt hat. Das Weiß der Butter liegt entzückend daneben, dann folgt die braune Farbe des wohlschmeckenden Brotes, und über alles schön ist das Dunkelbraun des Kaffees in der zierlichen, sauberen Tasse. Gibt es ein Essen auf der Welt, das schöner und appetitlicher aussehen könnte? Und ich stille meinen Hunger damit ganz vortrefflich, und was brauche ich mehr, als meinen Hunger zu stillen, um sagen zu können: ich habe gegessen? Es soll Menschen geben, die sich aus dem Essen eine Kultur, eine Kunst machen; nun, kann ich das etwa nicht auch von mir sagen? Freilich! Nur ist meine Kunst eine bescheidene und meine Kultur eine delikatere, denn ich genieße das Wenige stürmischer und üppiger als jene das Viele und Nicht-Aufhören-Wollende. Ich ziehe außerdem nicht gern Mahlzeiten so sehr in die Länge, ich könnte sonst leicht den Appetit darnach verlieren. Mir liegt daran, immer und immer wieder Lust zum Essen zu verspüren, deshalb esse ich spärlich und fein. Außerdem habe ich noch etwas: eine pikante Unterhaltung mit immer neuen Menschen.«
Kaum hatte Simon dieses gemurmelt oder gedacht, als ein alter Mann in weißen Haaren sich auf den freien Platz zu ihm hinsetzte. Des alten Mannes Gesicht war von einer grauen, abgemagerten Blässe, die Nase tropfte, oder vielmehr, es hing ein großer Tropfen an seiner Nase, der nicht fallen konnte, der aber doch schwer zum Fallen war. Beständig glaubte man ihn herunterfallen sehen zu sollen. Aber der Tropfen hing immer noch. Der Mann bestellte sich einen Teller mit gesottenen Kartoffeln, sonst weiter nichts, und aß dieselben, indem er mit der Messerspitze sorgfältig Salz darauf streute, mit umständlichem Behagen. Aber vorher hatte er die Hände zusammengefaltet, um ein Gebet an seinen Herrgott zu verrichten. Simon erlaubte sich folgenden kleinen Spaß: er bestellte heimlich ein Stück Braten bei dem aufwartenden Mädchen und als das Bratenstück herankam, mußte er über des Mannes Staunen, als es ihm und keinem andern hingereicht wurde, herzlich lachen.
»Warum beten Sie, bevor sie essen,« fragte Simon einfach.
»Ich bete, weil ich dessen bedarf,« erwiderte der alte Mann.
»Dann freut es mich, Sie beten gesehen zu haben. Ich interessierte mich bloß, welches Gefühl Sie dazu könnte veranlaßt haben.«
»Man hat viele Gefühle dabei, mein junger Herr! Sie zum Beispiel beten gewiß nicht. Dazu haben junge Leute von heute keine Zeit und auch kein Verlangen mehr. Ich kann es begreifen. Wenn ich bete, so fahre ich bloß in meiner Gewohnheit fort, denn ich habe mir das angewöhnt und es hat mir Trost gespendet.«
»Waren Sie immer ein armer Mann?«
»Immer.« –
Indem der alte Mann das sagte, erschien in dem dumpfigen, wenngleich sauberen, so doch armseligen Speiselokal die schöne Gestalt der Frau Klara. Sämtliche Hände, die eine Gabel, einen Löffel oder ein Messer, oder den Henkel einer Tasse festhielten, zögerten einen Augenblick, in ihrem Geschäft fortzufahren. Alle Mäuler sperrten sich auf, alle Augen hefteten sich fest auf eine Erscheinung, die so wenig geeignet schien, etwas in diesem Raume zu suchen zu haben. Sie war eine vollendete Dame und war es in diesem Moment noch viel mehr. Es war gerade, auch für Simons Augen und Sinne, als wenn sich aus einem offenen, flatternden Himmel ein Engel loslöse und nun zur Erde niederschwebe und dort irgend ein dunkles Loch aufsuche, um die Menschen, die dort wohnen, mit seinem bloßen seligen Anblick zu beglücken. So dachte sich Simon immer eine Wohltäterin, die hingeht, zu den Elenden und Armen, die nichts besitzen, als den zweideutigen Vorzug, von Moment zu Moment mit Sorgen wie mit Ruten gepeitscht zu werden. Klara benahm sich in dem Volkshause, ganz wie wenn es sich von selber ergäbe, als ein höheres, fernes, zugeflogenes Wesen aus anderen Grenzen, aus einer andern Schicht und Welt. Das war ja das Herrliche, Strahlende, das alle diese schüchternen Menschen veranlaßte, die Augen aufzureißen, mit dem Atem zu kämpfen und die Hände zu halten mit der andern Hand, daß das Messer nicht herausfiel vor heftigem Erbeben. Klaras Schönheit gab den Menschen urplötzlich mit Schmerz etwas zu denken. Es kam ihnen plötzlich allen in den Sinn, was es noch, außer rauher Arbeit und Kummer um das tägliche Brot, auf der Welt gäbe. Von dieser Art Gesundheit und völligen, üppigen, lächelnden Reizes hatten sie alle beinahe keine Vorstellung mehr, so sehr zerfloß ihnen das Leben in schwarzen, unsauberen Alltäglichkeiten, zerrieb sich in Sorgen, klammerte sich um Niedrigkeiten. Das alles fiel ihnen jetzt, wenn vielleicht nicht jedem so deutlich, mit Qualen ein; denn eine Qual ist es, eine Schönheit zu erblicken, an deren bloßem Duft man sich zu berauschen meint, die einen tötet, wenn der Gedanke sich dazu versteigt, mit ihrem Lächeln mitzulächeln. Deshalb machten sie unwillkürlich auch alle Grimassen, verzerrten ihre Gesichter zu der Frau hinauf, die sie alle überragte, da alle auf niederen Stühlen, an engen Plätzen festgeklemmt saßen, während sie, die Hohe, hoch aufrecht stand. Sie schien jemand zu suchen. Simon hielt sich still in seiner Ecke und lächelte die Umherblickende unverwandt an. Sie bemerkte ihn lange nicht, obschon der Raum verhältnismäßig klein war; denn es mochte sie anstrengen, ihre Augen an das zerwürfelte dunkle, vermischte Bild zu gewöhnen und Gestalten zu fixieren, die ihre Augen gewohnt waren, sonst überhaupt nicht zu beachten. Schon wollte sie sich, etwas unwillig geworden, wieder entfernen, als sie Simon mit einem Blick streifte und erkannte. »Also hier sitzen Sie, und noch dazu in solch eine Ecke gedrückt?« sagte sie, und setzte sich mit der größten Freude neben ihn nieder, auf den Platz zwischen ihrem jungen Freunde und dem alten Mann, dessen Nase immer noch den großen glitzernden Tropfen trug. Der Greis schlief. Es war nicht gestattet, in solchen Lokalen zu schlafen, aber es war ein alltägliches Vorkommnis, daß alte Leute hier, nachdem sie gegessen hatten, einschliefen, aus einfacher, nicht mehr zu bezähmender Müdigkeit. Dieser Greis hatte vielleicht eine lange nutzlose Fußwanderung durch alle Straßen der Stadt hinter sich. Er mochte vielleicht um Arbeit nachgefragt haben, überall, wo ihn seine Gedanken nur leise hinweisen konnten. Immer müder geworden, hatte er es vielleicht trotzdem versucht, etwas an diesem Tag zu erreichen, hatte seine äußersten Kräfte angespannt, um einen Berg zu erklimmen, denn die Stadt liegt den Berg hinan, und war dort oben eben so schnell abgewiesen worden, als hier unten; zog wieder abwärts, den Tod im Herzen, mit zerbrochenen Kräften, bis hierher. Daß sich der Greis überhaupt vielleicht, wie man vermuten durfte, noch um Arbeit umgeschaut hatte, daß er noch den Willen hegte, zu arbeiten, er, der Greis, das nur zu denken hatte etwas Klägliches und Erschreckendes. Aber man konnte auf diesen Gedanken sehr wohl kommen. Dieser Greis hatte nirgends eine Heimat, als hier in diesem Lokal, aber auch hier nur auf Stunden, denn dann wurde das Lokal geschlossen. Deshalb vielleicht betete er, um dem furchtbaren Ernst seiner Lage eine leise, besänftigende Melodie zu verschaffen. Deshalb sagte er: »Ich bedarf des Gebetes.« Also nichts weniger als Hang zur Frömmelei war es, sondern das überaus traurige Bedürfnis, eine Hand zu spüren, die ihn liebkosen möchte, eine Kinder- oder Tochterhand zu fühlen, die leise und trostvoll über seine arme, zerfaltete Stirne hinstrich. Vielleicht hatte der alte Mann Töchter gezeugt, – und nun er selber? Mit solchen Gedanken konnte sich leicht einer abgeben, der neben dem Alten saß und ihn so schlafen sah, den Kopf seltsam unbeweglich, die Hände den Kopf stützend. Klara sagte: »Ihr Bruder ist gekommen, Simon, in der Offiziersuniform, auch Ihre Schwester und dann noch ein Herr, mit Namen Sebastian.« Darauf bezahlte Simon, was er schuldig war, und sie gingen zusammen fort. Als sie fortgegangen waren, bemerkte eines der bedienenden Mädchen den schlafenden Mann, sie rüttelte und schüttelte ihn und sagte mit komischer Strenge: »Nicht schlafen da! Sie! Hören Sie nicht? Hier dürfen Sie nicht schlafen!« Da erwachte der alte Mann.
Es gab einen herrlichen Abend nach diesem Tag. Alle Welt lustwandelte am schönen Seeufer entlang, unter den breiten, großblättrigen Bäumen. Wenn man hier, unter so vielen aufgeräumten, leise plaudernden Menschen, spazierte, fühlte man sich in ein Märchen versetzt. Die Stadt loderte im Feuer der untergehenden Sonne und später brannte sie, schwarz und dunkel, in der Glut und Nachglut der Untergegangenen. Die Sonne im Sommer hat etwas Wundervolles und Hinreißendes. Der See glitzerte im Dunkel, und die vielen Lichter schimmerten in der Tiefe des stillen Wassers. Herrlich sahen die Brücken aus; und wenn man über die Brücken ging, so sah man unten im Wasser die kleinen, dunklen Boote vorbeischießen; Mädchen in hellen Kleidern saßen in den Nachen, oft auch erklang aus einem größeren, langsam und feierlich dahinschwebenden, flachen Boote der warme, zur Nacht stimmende Ton einer Handharfe. Der Ton verlor sich in Schwarz und tauchte wieder tönend heraus, hell und warm, dunkel und herzenergreifend. Wie weit klang das einfache Instrument, von irgend einem Schiffsmann gespielt! Die Nacht schien noch größer und tiefer dadurch zu werden. Aus der weiten Uferferne schimmerten die Lichter der ländlichen Ansiedelungen herüber, als wären sie blitzende, rötliche Steine im dunklen, schweren Gewand von Königinnen. Die ganze Erde schien zu duften und still zu liegen wie ein schlafendes Mädchen. Das große, dunkle Rund des nächtlichen Himmels breitete sich über alle Augen aus, über die Berge und die Lichter. Der See hatte etwas Raumloses bekommen und der Himmel etwas den See Umspannendes, Einschließendes und Überwölbendes. Ganze Gruppen von Menschen bildeten sich. Junge Leute schienen zu schwärmen, und auf allen Bänken saßen dichtgedrängt ruhende, stille Menschen. Auch an flatterhaften, stolz kokettierenden Frauen fehlte es nicht und auch nicht an Männern, die nur diese Frauen im Auge behielten, die hinter ihnen hergingen, immer etwas zögernd und dann wieder vorstürmend, bis sie schließlich den Mut oder das Wort fanden, ihre Damen anzusprechen. Manch einem wurde an diesem Abend der Kopf gewaschen, wie man sich auszudrücken pflegt.
Simon ging neben Klaus und war glücklich, seinem Bruder, der beständig fragte und fragte, durch treffende und einfache Antworten die Überzeugung beizubringen, daß er ein noch durchaus nicht verlorner Mensch sei. Er sprach mit einem gewissen Stolz und zugleich mit einem Tone der Demut vor dem reiferen Bruder, der nach manchen Dingen doch wie ein ungeschultes Kind fragte, aber eine liebevolle Besorgnis an den Tag legte. Sie sprachen in schönen, langen, gewundenen Sätzen, ganz wie von selber, und Klaus freute sich über seines Bruders Einsicht in so manches, wo er zuerst angenommen hatte, daß Simon, seinen Verhältnissen gemäß, darüber spotten und lachen würde. »Ich habe dich lange nicht für so ernst gehalten, als wie du dich zeigst!« Simon antwortete: »Es ist nicht meine Gewohnheit, zu zeigen, daß ich Ehrfurcht vor vielen Dingen besitze. So etwas pflege ich für mich zu behalten, denn ich denke, was nützt es, eine ernste Miene aufzusetzen, wenn man vom Schicksal dazu bestimmt, ich meine, vielleicht dazu erwählt ist, den Narren zu spielen. Es gibt viele, viele Schicksale, und vor ihnen will ich in allererster Linie meinen Nacken beugen. Es bleibt nicht anderes zu tun übrig. Im übrigen soll mir einer kommen mit der Zumutung, verdutzt und mutlos den Kopf hängen zu lassen. Ich habe es schon Verschiedenen gesagt, wie es in dieser Beziehung mit meinem Inneren steht.« – Wenn Simon so sprach, redete er in fließenden Sätzen und mit richtiger Betonung, aber völlig ruhig und freundlich, so daß Klaus diese Aussprüche nicht als Weltgroll empfand, sondern als ein gewisses Suchen in seines jungen Bruders Seele nach Klarlegung seines eigenen Zustandes in Beziehung zur Welt. Er überzeugte sich davon, daß Simon tüchtige Eigenschaften besaß, aber er fürchtete ein bißchen, daß diese Eigenschaften nur oberflächlich, scheinbar nur spielend und lockend und tanzend ihn umgaben, während er wünschte, sie möchten in ihm stecken. Im Feuer der Rede redete sich solch eine Seele ja so leicht in eine Welt der Bravheit und schönen Tüchtigkeit hinein, um sich daran selber für Stunden zu berauschen, namentlich in Augenblicken des Wiedersehens seit langer Zeit. Dennoch hatte Klaus Freude an seinem Bruder und sprach mit sichtlichem Vergnügen allerhand Schönes und Tröstendes zu ihm. Hinter ihnen, in einiger Entfernung, gingen, eng aneinander gedrängt, Klara und Kaspar. Der Maler war berauscht von der Schönheit und von der Musik der Nacht. Er phantasierte von Pferden, die durch nächtliche Gärten galoppierten, schöne, schlanke Reiterinnen tragend, deren Röcke am Boden mit den Hufen der Pferde spielten. Dann lachte er über alles mit einem frechen, unbändigen Lachen, über die Menschen, über die Landschaft, einfach über alles, was ihm vor das Auge kam. Klara versuchte gar nicht, ihn zu besänftigen, im Gegenteil, sie hatte Freude an dieser Ungebundenheit eines schönen Geistes. Wie liebte sie das Jugendliche, das Freche, ja sogar das Sich-Überhebende in dieser Knabennatur, die sich hinüberarbeitete zur Mannesnatur. Er mochte das Tollste schwatzen, das ihr wahrscheinlich aus dem Munde eines anderen würde lächerlich und blöde geklungen haben, aber an ihm liebte sie es. Was hatte dieser Mensch, daß sie ihn so ohne Bedingung schön finden mußte, in allen Lagen, in jeder Gebärde, im Benehmen, Tun, Lassen, Reden und Stillschweigen? Er schien ihr allen übrigen Menschen gewachsen, allen andern Männern überlegen zu sein, und er war kaum ein Mann. Sein Schritt, wie sollte sie sagen, hatte für sie etwas Läppisches und zugleich Gebietendes. Der ganze junge Mensch nicht die Spur des Aufgeregtseins und doch etwas Schüchternes, Dummes, Tief-Kindliches. So gelassen und so schnell in Flammen! Sie sah, wie seine Haare im Dunkel hell hervorleuchteten, jugendlich und wellenhaft. Dazu sein Schritt und das Tragen des Kopfes mit solchem bescheidenen, fragenden, sinnenden Stolz. Wie dieser Jüngling träumen mußte, wenn er an jemand dachte. Kaspar war stiller geworden. Sie sah ihn immer an, immer! Hier, in dieser Nacht voll umherwandelnder Menschen war es schön, zum vergehen schön, ihn anzuschauen. Ihn anzuschauen, das fand sie schöner, als ihn küssen. Seinen Mund sah sie schmerzvoll geöffnet; gewiß dachte er weiter nichts, nein, gar keine Rede; es war eben nur die Stellung der Lippen, die den Eindruck des Schmerzlichen hervorrief. Seine Augen waren kalt und ruhig in die Ferne gerichtet, als wüßten sie dort Besseres zu sehen. Sie schienen zu sprechen: »Wir, wir sehen Schönes; quält euch doch nicht, ihr andern Menschenaugen, ihr werdet es ja doch nie sehen, was wir sehen!« Seine Augenbrauen bogen sich entzückend leicht und wie besorgt, als wenn sie Engel gewesen wären, über ihre Kinder, die Augen, die so aussahen und in die Welt blickten, als könnten sie jeden Augenblick verletzt werden. »Gewiß, eines jeden Menschen Auge ist leicht verletzbar, aber wenn ich seine betrachte, so tut es mir auf einmal so weh, so, als sähe ich sie schon von Splittern verletzt. Sie sind so groß, treten so weit hervor, scheinen sich um nichts zu kümmern, sind so achtlos und immer so groß geöffnet; wie leicht können sie verletzt werden!« jammerte sie. Sie wußte nicht einmal, ob er sie liebte, aber was machte das aus, sie, sie liebte ihn ja, das genügte, ja, das mußte so sein, sie war dem Weinen nahe. Da kamen Simon und Klaus zurückgegangen, um die andern aufzusuchen. Klara beherrschte sich, so gut sie konnte, nahm Simon beim Arm und ging mit ihm voraus. »Laß mich in deine Augen sehen, du hast so schöne Augen, Simon, Augen, in deren Anblick man liegt wie im Bett, wenn alles beruhigt ist und man betet,« sprach sie zu ihm.
Klaus und Kaspar gingen schweigend. Sie wollten einander nicht mehr verstehen, seit vor ein paar Jahren ein kleiner Zwist zwischen ihnen ausgebrochen war, und seither hatten sie sich nie mehr gesehen und auch nie geschrieben. Klaus nahm sich das sehr zu Herzen, während Kaspar es einfach als eine Art Notwendigkeit hingehen ließ. Er sagte sich, daß es ganz in der Ordnung der Dinge liege, einmal auch von einem Bruder nicht begriffen zu werden. Er mochte nicht den Kopf zurückwenden nach vergangenen Angelegenheiten, die er übrigens, eben weil sie vorüber waren, als für weiterer Gedanken nicht wert hielt. Seine Art war, geradeaus zu marschieren; er hielt das Zurückblicken auf alte Beziehungen für schädlich. Nun fing, da ihm das Schweigen Kaspar gegenüber unerträglich wurde, Klaus an, von der Kunst des Bruders zu sprechen und ermunterte ihn, doch einmal nach Italien zu gehen, um da die gehörige Reife als Künstler zu erlangen.
Kaspar rief aus: »Lieber will ich gleich vom Teufel geholt werden! Nach Italien! Warum nach Italien? Bin ich krank, und soll ich etwa gesund werden in dem Lande der Orangen und Pinien? Was brauche ich denn nach Italien zu gehen, wenn ich hier sein kann und es mir hier ganz gut gefällt? Könnte ich in Italien vielleicht Besseres tun, als malen, und kann ich etwa hier nicht malen? Du meinst, weil es so schön in Italien ist, müsse ich dahin gehen. Ist es denn etwa hier nicht schön genug? Kann es dort schöner sein, als hier, da, wo ich bin, wo ich schaffe, wo ich tausend Schönheiten sehe, die fortleben, wenn ich längst vermodert bin? Ist es möglich, nach Italien zu gehen, wenn man schaffen will? Sind in Italien die Schönheiten schöner als hier? Sie sind vielleicht nur anspruchsvoller, und eben deshalb will ich sie lieber gar nicht sehen. Wenn ich in sechzig Jahren so weit bin, eine Welle oder eine Wolke, einen Baum oder ein Feld malen zu können, so wollen wir sehen, ob es klug getan war, nicht in Italien gewesen zu sein. Kann mir etwas entgehen, diese Tempelsäulen, diese Allerweltsrathäuser, diese Brunnen und Bogen, diese Pinien und Lorbeerbäume, diese italienischen Trachten und Prachtbauten nicht gesehen zu haben? Muß man mit den Augen denn alles auffressen wollen? Ich könnte jedesmal außer mir geraten, wenn man mir zumutet, die Absicht zu haben, in Italien ein besserer Künstler zu werden. Italien, das ist unsere Falle, in die wir hineinpatschen, wenn wir turmhoch dumm sind. Kommen die Italiener zu uns, wenn sie malen oder dichten wollen? Was nützt es mir, wenn ich mich an vergangenen Kulturen berausche? Habe ich damit meinen Geist, wenn ich ehrlich mit mir abrechnen will, bereichert? Nein, ich habe ihn bloß verpfuscht und feige gemacht. Mag eine alte, untergegangene Kultur noch so herrlich gewesen sein, mag sie immerhin die unsrige an Stärke und Pracht überragen, so schnüffle ich deshalb noch lange nicht wie ein Maulwurf darin herum, sondern betrachte sie eben, wenn es angeht und es mir Spaß macht, aus Büchern, die mir zu jeder Zeit zu Diensten sind. So sehr schätzenswert ist übrigens das Verlorene und Vergangene niemals; denn ich erblicke rund um mich, in unserer oft als so unschön und unhold verschrieenen Gegenwart Bilder die Menge, die mich entzücken, und Schönheiten, beide Augen zum Überfließen voll. Ich könnte zornig werden und aus der Haut fahren bei dieser Italienraserei, die etwas seltsam Beschämendes für uns ist. Es kann sein, daß ich mich irre, aber keine zwanzig borstigen Teufel, und wenn sie die Luft neben mir verpesteten und ihre scheußlichen Gabeln schwenkten, brächten mich nach Italien.«
Klaus wurde betroffen und traurig über Kaspars Heftigkeit, die Dinge zu messen. So war er immer gewesen, und auf diese Art konnte es nicht vorauszusehen sein, wie man in eine ersprießliche Verbindung mit ihm treten könnte. Er schwieg und reichte ihm die Hand; denn man war vor der Wohnung Klausens angekommen.
In seinem einförmigen Zimmer angekommen, sagte er sich: »So habe ich ihn nun zum zweiten Male verloren, durch eine ganz unschuldige, gutgemeinte, aber in der Tat etwas unvorsichtige Äußerung. Ich kenne ihn zu wenig, das ist alles, und ich werde ihn vielleicht nie kennen lernen. Unsere Lebensläufe sind zu verschieden. Aber vielleicht führt uns ein anderes Mal die Zukunft, die man ja nie ergründet, zusammen. Man muß warten und es ertragen, langsam ein reiferer, besserer Mensch zu werden.« Er kam sich so einsam vor und beschloß, bald wieder abzureisen, an seinen Wirkungsort zurück.
Sebastian war ein junger Poet, der seine Verse von einer kleinen Bühne herab dem Publikum vortrug. Er pflegte sich dabei durch sein Ungestüm immer ein wenig lächerlich zu machen. Er war in jungen Jahren seinen Eltern durchgebrannt, hatte mit sechzehn Jahren in Paris gelebt und war mit zwanzig zurückgekommen. Sein Vater war Musikdirektor in der kleinen Stadt, wo auch Hedwig, die Schwester der drei Brüder, zu Hause war. Dort trieb Sebastian ein merkwürdig tagediebisches Wesen, saß oder lag tagelang in einer hochgelegenen, verstaubten Kammer, ausgestreckt auf einem schmalen Bett, in dem er des Nachts schlief, ohne sich die Mühe zu nehmen, es für den Schlaf in Ordnung zu bringen. Seine Eltern hielten ihn für verloren und ließen ihn tun, was er wollte. Geld gaben sie ihm nicht, denn sie hielten es für unangebracht, mit Geldspenden den Ausschweifungen ihres Sohnes entgegenzukommen, denen sie ihn ausgesetzt wußten. Zu einem ernsthaften Studium war Sebastian nicht mehr zu bewegen; er trieb sich, irgend ein Buch unter dem Arm oder in der Tasche, auf den Bergen, in den Wäldern umher, kam oft mehrere Tage lang nicht nach Hause, übernachtete, wenn das Wetter nur einigermaßen es gestattete, in verfallenen, von keinem Menschen, nicht einmal von wilden und rauhen Hirten benutzten Hütten, auf Weiden, die dem Himmel näher lagen als irgend einer menschlichen Zivilisation. Er trug immer denselben zerschossenen Anzug aus hellgelbem Tuch, ließ sich den Bart wachsen, legte aber sonst sehr viel Wert darauf, angenehm und sauber zu erscheinen. Seine Fingernägel pflegte er mehr als seinen Verstand, den er einfach verwildern ließ. Er war schön, und da es bekannt war, daß er dichtete, so verbreitete sich um seine Person ein halb lächerlicher, halb wehmütiger Zauberschein, und es gab viele vernünftige Menschen in der Stadt, die den jungen Mann aufrichtig bemitleideten und sich seiner, wo sie nur konnten, aufs herzlichste annahmen. Man lud ihn, da er ein vortrefflicher Gesellschafter war, öfters zu Abendgeselligkeiten ein, und entschädigte ihn solchermaßen ein wenig dafür, daß ihm die Welt weiter keine Aufgaben stellte, die seinen Drang nach Betätigung hätten befriedigen können. Sebastian besaß in hohem Grade diesen Drang, aber er war zu sehr aus dem Geleise des allgemein gültigen und vorgeschriebenen Strebens hinausgekommen. Er strebte vielleicht zu wild, und nun, da er einsah, daß sein Streben ihm nichts half, mochte er gar nicht mehr streben. Er spielte seine eigenen Lieder, die er gedichtet hatte, auch auf der Laute und sang mit angenehmer, weicher Stimme dazu. Das einzige Unrecht, allerdings ein großes, das man ihm angetan hatte, bestand darin, daß man ihn, schon als Schulknaben, verhätschelte und ihm half, sich einzubilden, daß er so etwas wie ein genialer Bursche sei. Wie bohrte sich solch eine stolze Einbildung in das empfängliche Knabenherz hinein! Erwachsene Frauen bevorzugten den Umgang mit dem frühreifen, allesverstehenden Knaben, der ihnen einen unvergleichlichen Reiz einflößte, auf Kosten seiner eigenen menschlichen Entwicklung. Sebastian pflegte oft zu sagen: »Meine Glanzzeit liegt längst hinter mir.« Es war schrecklich, einen so jungen Mann so sprechen zu hören. In der Tat, was er auch machte, bezweckte, einleitete und tat, er tat es mit müdem, kaltem, halbem Herzen, und so tat er eben nichts, er spielte bloß noch mit sich. Hedwig sagte einmal zu ihm: »Sebastian, hören Sie, ich glaube, Sie weinen oft über sich selber.« Er nickte mit dem Kopf und bestätigte es. Hedwig bemitleidete ihn und steckte ihm manchmal etwas an Geld oder dergleichen zu, um ihm das Leben etwas freundlicher zu machen. So nahm sie ihn auch diesmal auf die kleine Reise mit, zu ihren Brüdern. An dem Abend, an dem Klara so selig war, Klaus traurig und einsam, Simon glücklich, Kaspar aufgebracht und übermütig, wandelten die beiden, Hedwig und ihr Poet, langsam und stillschweigend, ebenfalls am Ufer entlang. Was konnte man sprechen; so schwieg man eben. Kaspar kam ihnen entgegen:
»Wie ich höre, arbeiten Sie an einem Gedicht, das den Inhalt Ihres Lebens widerspiegeln soll. Wie können Sie ein Leben wiedergeben wollen, wo Sie doch kaum eines erlebt haben. Sehen Sie sich einmal an: wie stark und jung Sie sind, und das will sich hinter den Schreibtisch verkriechen und in Versen sein Leben besingen. Machen Sie das, wenn Sie fünfzig alt sind. Ich finde es übrigens beschämend für einen jungen Mann, Verse zu verfertigen. Das ist keine Arbeit, sondern nur ein Schlupfwinkel für Müßiggänger. Ich wollte nichts sagen, wenn Ihr Leben fertig und abgeschlossen wäre durch irgend ein großes besänftigendes Erlebnis, das den Menschen berechtigt, Rückschau zu halten auf Fehler, Tugenden und Verirrungen. Sie aber scheinen noch nie gefehlt zu haben und scheinen auch noch nie eine gute Tat begangen zu haben. Dichten Sie erst, wenn Sie als Sünder oder als Engel dastehen. Dichten Sie lieber überhaupt gar nicht.« –
Kaspar hatte keine gute Meinung von Sebastian; deshalb machte er sich auch über ihn lustig. Für tragische Menschen fehlte ihm überhaupt jedes Verständnis, oder vielmehr, weil er sie zu leicht und zu gut verstand, achtete er sie nicht. Überdies befand er sich heute abend in einer diabolischen Laune.
Hedwig ergriff für den armen Beleidigten, der sich nicht wehren konnte, das Wort: »Das war nichts weniger als schön gesprochen von dir, Kaspar,« rief sie ihrem Bruder mit der Wärme, die ihr die Lust an der Verteidigung gab, zu, »und nichts weniger als klug. Es macht dir Freude, einen Menschen zu verletzen, den alle Menschen um seines Unglücks willen schonen und achten sollten. Lache, so viel du willst. Du bereust doch, was du gesagt hast. Kennte ich dich nicht so genau, so müßte ich dich für einen rohen Burschen halten, für einen Quäler. So gut man einen armen Menschen, einen Wehrlosen, peinigen kann, so gut kann man auch ein armes Tier quälen. Wehrlose reizen nur zu leicht in den Starken die Lust am Schmerzzufügen. Sei doch froh, wenn du dich stark fühlen kannst und laß Schwächere in Frieden. Es wirft einen schlechten Schein auf deine Stärke, wenn du sie mißbrauchst, um Schwache zu plagen. Warum genügt es dir nicht, auf festen Füßen zu stehen, mußt du deinen Fuß noch auf den Nacken von Schwankenden und Suchenden setzen, daß sie noch mehr irr an sich werden und hinab, ganz hinab taumeln in die Wellen des An-Sich-Selbst-Verzweifelns? Müssen denn Selbstvertrauen, Mut, Stärke und Zielbewußtheit immer die Sünde begehen, roh und mitleidlos und so taktlos gegen die andern zu verfahren, die ihnen doch gar nicht im Wege sind, die dastehen und begierig auf die Töne des Ruhmes, der Achtung und des Erfolges horchen, die andern gelten? Ist es edel und gut, eine sich sehnende Seele zu beleidigen? Dichter sind so leicht verletzbar; o man verletze nie die Dichter. Übrigens spreche ich jetzt gar nicht von dir, Kasparchen; denn was bist du denn schon so Großes in der Welt? Auch du bist vielleicht noch nichts und hast keine Ursache, Menschen zu verhöhnen, die ebenfalls noch nichts sind. Wenn du mit dem Schicksal ringst, so laß doch andere, so wie sie's eben verstehen, auch ringen. Ihr seid beide Ringende und bekämpft euch? Das ist sehr töricht und unklug. Es gibt für euch beide, durch allerhand Tücken und Verirrungen und Verheißungen und Mißerfolge in eurer Kunst Schmerzen genug, müßt ihr es da darauf abgesehen haben, euch noch mehr Schmerz zuzufügen? Ich würde in Wahrheit Bruder zu einem Dichter sein, wenn ich ein Maler wäre. Man blicke auch nie zu früh verächtlich auf einen Fehlenden oder scheinbar Trägen und Tatlosen hernieder. Wie schnell kann sich aus langen, dumpfen Träumen seine Sonne, seine Dichtung erheben! Nun dann: wie stehen dann die voreiligen Verächter da? Sebastian ringt ehrlich mit dem Leben, schon das sollte ein Grund zur Achtung und Liebe sein. Wie kann man sich über sein weiches Herz lustig machen? Schäm' dich nur, Kaspar, und gib mir nie wieder Anlaß, wenn du eine Spur von Liebe für deine Schwester hegst, mich so über dich zu ereifern. Ich tu es nicht gern. Ich schätze Sebastian, weil ich weiß, daß er den Mut hat, seine vielen Fehler einzugestehen. Übrigens, das ist alles geschwatzt und wieder geschwatzt, du kannst ja gehen, wenn es dir nicht paßt, mit uns zu gehen. Was machst du nun für ein Gesicht, Kaspar! Weil dir ein Mädchen, das den Vorzug genießt, deine Schwester sein zu dürfen, einen Vortrag hält, willst du böse sein? Nein, sei es nicht. Bitte. Und du darfst dich ja gewiß auch über den Dichter lustig machen. Warum nicht. Ich nahm es zu ernst vorhin. Vergib mir.« –
Ein feines, schüchternes, aber zärtliches Lächeln spielte im Dunkeln um Sebastians Lippen. Hedwig machte sich mit dem Bruder solange schmeichelnd zu schaffen, bis er wieder heiter wurde. Er gab dann eine komische Nachahmung ihrer schwungvollen Rede zum besten, daß alle drei in ein schallendes Gelächter ausbrachen. Sebastian namentlich krümmte sich vor Lachen. Allmählich war unter den Bäumen alles still und leer geworden; die Menschen waren in ihre Häuser zurückgegangen, die Lichter träumten, aber es waren viele Lichter gelöscht worden, die Ferne glitzerte nicht mehr. Dort, auf dem ländlichen Boden, schien man die Lichter früher zu löschen; die fernen Berge lagen jetzt wie tote, schwarze Körper, aber noch gab es einzelne Menschenpaare, die nicht heim gingen, sondern die Absicht zu haben schienen, die ganze Nacht unter dem Himmel plaudernd und wachend zu verbringen.
Simon und Klara saßen, in stille, lange Gespräche versunken, auf einer Bank. Sie hatten sich so viel zu sagen, hätten eigentlich endlos plaudern mögen. Klara würde immer über Kaspar gesprochen haben und Simon immer über die, die neben ihm saß. Er hatte eine seltsame, freie, offene Manier, über Menschen zu reden, die gerade seine Gefährten waren, die neben ihm saßen oder standen und ihm zuhorchten. Es kam von selber, er fühlte immer für die am stärksten, die ihn zum Sprechen veranlaßten, und sprach infolgedessen über sie und nicht über Abwesende. Klara dachte nur an den Abwesenden. »Quält es dich nicht,« fragte sie, »daß wir nur über ihn sprechen?« »Nein,« erwiderte Simon, »seine Liebe ist die meine. Ich habe mich immer gefragt, wird nie einer von uns lieben? Ich betrachtete es immer als etwas Wundervolles, für das wir beide zu schlecht wären. Ich las viel in Büchern über Liebe, ich liebte immer die Liebenden. Schon als Schulknabe lag ich über solchen Büchern stundenlang gebeugt und bebte und zitterte und erschrak mit meinen Liebenden. Da war fast immer eine stolze Frau und ein noch unbeugsamerer Charakter von Mann, ein Arbeiter in der Bluse oder ein simpler Soldat. Die Frau war immer eine vornehme Dame. Für ein Liebespaar von einfachen Leuten hätte ich damals keinen Sinn gehabt. Meine Sinne wuchsen mit diesen Büchern auf und gingen darin unter, wenn ich das Buch schloß. Dann kam ich ins Leben und vergaß das alles. Ich biß mich in Freiheitsgedanken fest, aber ich träumte davon, eine Liebe zu erleben. Was nützt es mir, böse zu sein, daß die Liebe nun da ist und nicht mir gilt? Wie kindisch. Beinahe bin ich sogar froh, daß sie nicht mich will, sondern einen andern, ich möchte sie zuerst gesehen haben und sie erst dann erleben. Doch ich erlebe sie nie. Ich glaube, das Leben will anderes von mir, hat anderes mit mir vor. Es läßt mich alles lieben, was es nur an Erscheinungen mir zuwirft. Ich darf dich doch lieben, Klara, auf andere, vielleicht dümmere Weise. Ist es nicht dumm, daß ich so genau weiß, daß ich, wenn du es willst, sterben könnte für dich, sterben wollte? Kann ich nicht sterben für dich? Ich würde es ganz selbstverständlich finden. Ich lege keinen Wert auf mein Leben, nur Wert auf anderer ihr Leben, und trotzdem liebe ich das Leben, aber ich liebe es deshalb, weil ich hoffe, daß es mir Gelegenheit verschafft, es anständigerweise wegzuwerfen. Nicht wahr, das ist töricht gesprochen? Laß mich deine beiden Hände küssen, damit du die Empfindung hast, daß ich dir angehöre. Natürlich bin ich nicht dein und du wirst nie etwas von mir verlangen wollen, denn was könnte dir einfallen, von mir zu verlangen. Aber ich liebe Frauen von deinem Schlag, und einer Frau, die man liebt, macht man gerne ein Geschenk, und so schenke ich dir mich, weil ich kein besseres Geschenk weiß. Ich kann dir vielleicht nützlich sein, ich kann springen für dich mit diesen meinen Beinen, ich kann den Mund halten, wo du wünschen solltest, daß einer für dich schweigen möchte, ich kann lügen, wenn du in den Fall kommst, dich eines schamlosen Lügners bedienen zu müssen. Es gibt edle Fälle dieser Art. Ich kann dich tragen in meinen Armen, wenn du umfallen solltest, und ich kann dich über Pfützen heben, damit du deinen Fuß nicht beschmutzest. Sieh einmal meine Arme an. Kommen sie dir nicht vor, als höben, als trügen sie dich schon? Was würdest du lächeln, wenn ich dich trüge, und ich würde ebenfalls lächeln, denn ein Lächeln, wenn es kein unzartes ist, zwingt immer das andere hervor. Dieses Geschenk, das ich dir mache, ist ein bewegliches und ewiges; denn der Mensch, auch der simpelste, ist ewig. Ich werde dir noch angehören, wenn du längst nichts mehr bist, nicht einmal ein Stäubchen; denn das Geschenk überdauert immer den Beschenkten, damit es trauern kann, das es seinen Besitzer verloren hat. Ich bin zum Geschenk geboren, ich gehörte immer jemandem an, es verdroß mich, wenn ich einen Tag lang umherirrte und niemanden fand, dem ich mich anbieten konnte. Nun gehöre ich dir an, obgleich ich weiß, daß du dir wenig machst aus mir. Du bist gezwungen, dir wenig aus mir zu machen. Geschenke pflegt man bisweilen zu verachten. Ich zum Beispiel, wie verächtlich denke ich in meiner Seele von Geschenken. Ich hasse förmlich das Beschenktwerden. Deshalb will es auch das Schicksal, daß mich niemand liebt; denn gut und allsehend ist das Schicksal. Ich würde Liebe nicht ertragen können, denn ich kann Lieblosigkeit ertragen. Den darf man nicht lieben, der lieben will, sonst würde man ihn nur stören in seiner Andacht. Ich möchte nicht, daß du mich liebtest. Und sieh, daß du den andern liebst, macht mich so glücklich; denn nun, versteh mich, gibst du mir die Bahn frei, dich lieben zu dürfen. Ich liebe Gesichter, die sich von mir ab, einem andern Gegenstand zu wenden. Die Seele, die eine Malerin ist, liebt diesen Reiz. Ein Lächeln ist so schön, wenn es über eine Lippe geht, die man ahnt, nicht sieht. So wirst du mir gefallen. Glaubst du, daß du nicht nötig hättest, mir zu gefallen? Doch jetzt fällt es mir ein: Du brauchst mir nicht zu gefallen, du hast es wirklich nicht nötig; denn ich bin dir gegenüber keines Urteils fähig, höchstens einer Bitte; doch ich weiß nicht mehr, was ich rede.«
Klara weinte über seine Erklärung. Sie hatte ihn längst nahe zu sich herangezogen und befühlte mit ihren schönen Händen, die von der Nachtluft kühl geworden waren, seine brennenden Wangen. »Was du mir da sagtest, hättest du gar nicht zu sagen brauchen, ich wußte es ja doch, wußte es ja doch, wußte – es – ja – doch.« – Ihre Stimme nahm diejenige Zärtlichkeit an, die man anwendet, wenn man Tieren, denen man ein bißchen weh getan hat, wieder Liebe und Zutraulichkeit einflößen will. Sie war glücklich, und ihre Stimme lispelte in den langgezogenen und hohen Tönen der Freudigkeit. Ihr ganzer Körper schien mitzusprechen, als sie sagte: »Du tust so gut daran, mich zu lieben, jetzt, da ich lieben muß. Ich werde jetzt noch einmal so freudig lieben. Vielleicht werde ich einmal unglücklich sein, aber mit welcher Wonne werde ich unglücklich sein. Es macht uns Frauen nur einmal im Leben Freude, unglücklich zu sein, aber wir verstehen es, das Unglück auszukosten. Aber wie kann ich von Schmerzen zu dir sprechen. Sieh, es empört mich bereits, davon nur gesprochen zu haben. Wie kann ich es wagen, dich bei mir zu haben und nicht an mein Glück zu glauben? Du machst einen glauben, du machst, daß man glauben darf. Bleibe immer mein Freund. Du bist mein süßer Knabe. Deine Haare gleiten durch meine Hände, und dein Kopf voll so unergründlicher Gedanken der Freundschaft liegt mir im Schoße. Ich komme mir schön vor so; du machst mich das empfinden. Du mußt mich küssen. Auf meinen Mund mußt du mich küssen. Ich will eure Küsse vergleichen, Kaspars und deine. Ich will denken, daß er mich küßt, wenn du mich küssest. Ein Kuß ist doch etwas Wundervolles. Wenn du mich jetzt küssest, küßt mich eine Seele, kein Mund. Hat dir Kaspar gesagt, wie ich ihn geküßt habe und wie ich ihn bat, daß er mich küssen solle? Er muß anders küssen, er soll küssen lernen wie du, doch nein, warum sollte er küssen wie du? Er küßt so, daß ich ihn gleich wieder küssen muß, du küssest so, daß man sich noch einmal von dir küssen läßt, so, wie du es jetzt tust. Behalte mich lieb, sei immer so lieb, und küsse mich noch einmal, daß ich, wie du vorhin gesagt hast, die Empfindung habe, daß du mir angehörst. Ein Kuß macht das so verständlich. Wir Frauen wollen so belehrt werden. Du verstehst Frauen eigentlich sehr gut, Simon. Man sollte es dir nicht anmerken. Komm nun, wir wollen gehen!«
Sie erhoben sich, und als sie eine Weile gegangen waren, trafen sie auf die drei andern. Hedwig nahm Abschied von ihren Brüdern und Frau Klara. Sebastian begleitete das Mädchen. Als die beiden sich entfernt hatten, fragte Klara Kaspar leise: »Darfst du deine Schwester der Begleitung dieses Herrn anvertrauen?« Kaspar antwortete: »Würde ich es tun lassen, wenn ich es nicht ruhig dürfte?«
Als sie nach Hause kamen, hörten sie im Wald einen Schuß fallen. »Er schießt wieder,« sagte leise Klara. »Was will er mit seinem Schießen?« fragte Kaspar, und Simon kam lachend mit der raschen Antwort zuvor: »Er schießt, weil es ihm noch sonderbar vorkommt. Es liegt noch bis jetzt eine Art Idee dahinter. Wann es aufgehört hat, interessant zu sein, wird er es schon bleiben lassen.« Schon hörte man wieder einen Schuß. Klara runzelte die Stirn und seufzte, und versuchte dann, die Ahnungen, die sie hatte, in einem Lachen zu ersticken. Aber es war ein grelles Lachen, und die Brüder erbebten auf einen Augenblick.
»Du benimmst dich seltsam,« sagte Agappaia, der plötzlich unter der Haustüre erschien, eben, als sie eintreten wollten, zu seiner Frau. Diese schwieg, als hätte sie nichts gehört. Dann legten sie sich alle schlafen.
Noch in derselben Nacht schrieb Klara, die keinen Schlaf fand, an Hedwig:
»Sie, liebes Mädchen, Schwester meines Kaspars, ich muß Ihnen schreiben. Ich kann nicht schlafen, finde keine Ruhe. Ich sitze hier, halb ausgezogen, vor meinem Schreibtisch, und bin gezwungen, so hin und her zu träumen. Es deucht mich, daß ich an alle Menschen Briefe schreiben könnte, an jeden beliebigen Unbekannten, an jedes Herz; denn alle Menschenherzen zittern für mich vor Wärme. Heute, als Sie mir die Hand reichten, sahen Sie mich so lange an, fragend, und mit einer gewissen Strenge, als wüßten Sie bereits, wie es mit mir steht, als fänden Sie, daß es schlimm mit mir stehe. Sollte es in Ihren Augen schlimm mit mir stehen? Nein, ich glaube nicht, daß Sie mich verdammen, wenn Sie alles wissen werden. Sie sind so ein Mädchen, vor dem man keine Geheimnisse haben mag, dem man alles sagen will, und ich will Ihnen alles sagen, damit Sie alles wissen, damit Sie mich lieben können; denn Sie werden mich lieb haben, wenn Sie mich kennen, und ich begehre darnach, von Ihnen geliebt zu werden. Ich träume davon, alle schönen und klugen Mädchen um mich geschart zu sehen, als Freundinnen und Beraterinnen und auch als meine Schülerinnen. Sie wollen, hat mir Kaspar gesagt, Lehrerin werden und sich der Erziehung der kleinen Kinder opfern. Ich möchte auch Lehrerin werden, denn Frauen sind zu Erzieherinnen wie geboren. Sie wollen etwas werden, wollen etwas sein: das paßt zu Ihnen, das entspricht dem Bilde, das ich mir von Ihnen mache. Er entspricht auch der Zeit, in der wir leben, und der Welt, die ein Kind dieser Zeit ist. Das ist schön von Ihnen, und wenn ich ein Kind hätte, würde ich es zu Ihnen in die Schule schicken, würde es ganz Ihnen überlassen, so daß es sich daran gewöhnen müßte, Sie als eine Mutter zu verehren und zu lieben. Wie werden die Kinder zu Ihnen emporblicken, um zu sehen, an Ihren Augen, ob Sie strenge blicken oder gütig. Wie werden sie jammern in ihren kleinen, blühenden Herzen, wenn sie Sie mit Sorgen im Gesicht in die Stunde kommen sehen; denn Kindern ist Ihre Seele verständlich. Sie werden nicht lange mit unartigen Kindern zu tun haben; denn ich denke mir, selbst die unartigsten und verzogensten unter ihnen werden sich in kurzer Zeit ihrer Unarten vor Ihnen schämen und es bereuen, Ihnen Schmerz eingeflößt zu haben. Ihnen gehorchen, Hedwig, wie muß das süß sein. Ich möchte Ihnen gehorchen, möchte ein Kind werden und die Lust empfinden, Ihnen folgsam sein zu dürfen. Sie wollen in ein kleines, stilles Dorf ziehen! Um so schöner. Dann werden Sie Dorfkinder zu unterrichten haben, die noch besser zu erziehen sind als die Kinder der Städte. Aber Sie würden auch in der Stadt Erfolge erzielen. Sie sehnen sich nach dem Lande, nach den niederen Häusern, nach den Gärtchen vor den Häusern, nach den Menschengesichtern, die man dort sieht, nach dem Fluß, der vorbeirauscht, nach dem einsamen, entzückenden Seeufer, nach den Pflanzen, die man im stillen Walde sucht und findet, nach den Tieren auf dem Lande, nach der Welt auf dem Lande. Sie werden alles finden; denn Sie passen dahin. Man paßt dahin, wohin man sich sehnt. Gewiß finden Sie dort eines Tages die Antwort auf die Frage, wie man es zu machen habe, daß man glücklich sei. Sie sind jetzt schon glücklich, und ich fühle wohl, wie gern ich Ihre Munterkeit besitzen möchte. Wenn man Sie sieht, möchte man glauben, daß man Sie schon längst gekannt hätte und daß man auch wüßte, wie Ihre Mutter aussieht. Andere Mädchen findet man hübsch, ja schön, aber von Ihnen möchte man gekannt und geliebt sein, sowie man Sie nur ansieht. Sie haben etwas Lockendes, beinahe Großmütterliches in Ihrem jungen, hellen Gesicht; vielleicht ist das das Ländliche, was Sie an sich haben. Ihre Mutter war Bäuerin? Sie muß eine schöne, liebe Bäuerin gewesen sein. Sie hat viel gelitten in der Stadt, sagte mir einmal Kaspar; das glaube ich; denn ich meine sie vor mir sehen zu sollen, diese Ihre Mutter. Sie soll sich stolz betragen haben und darunter gelitten haben. Freilich; denn in der Stadt darf sich ein Mensch nicht so stolz betragen wie auf dem Lande, wo sich eine Frau leicht als freie Herrin vorkommt. Ich möchte Ihnen ein bißchen damit gefallen daß ich von Ihrer Mutter spreche, die Sie, als die Arme gebrochen und krank war, gepflegt und besorgt haben. Ich habe auch ein Bild Ihrer Mutter gesehen und verehre und liebe sie, wenn Sie mir erlauben, das zu tun. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich es dann noch viel inniger tun. Könnte ich sie sehen, könnte ich ihr zu Füßen fallen und ihre Hand nehmen und meine Lippen darauf pressen. Wie wohl würde mir das tun. Es gliche einem einstweiligen, teilweisen, armen Schuldenbezahlen; denn ich bin ihre Schuldnerin und auch Ihre, Hedwig. Ihr Bruder Kaspar wird oft lieblos und rauh zu Ihnen gewesen sein; denn junge Männer müssen oft hart zu denen sein, von denen sie am meisten geliebt werden, um sich eine Bahn in die offene Welt zu brechen. Ich begreife, daß ein Künstler oft Liebe als etwas ihn Hemmendes abschütteln muß. Sie haben ihn als ganz jung gesehen, als einen Schulknaben, der zur Schule gegangen ist, haben ihm seine Unarten vorgehalten, haben sich mit ihm gestritten, haben ihn bemitleidet und beneidet, beschützt und gewarnt, ausgescholten und gelobt, haben mit ihm seine ersten, erwachenden Empfindungen geteilt und ihm gesagt, daß es schön sei, Empfindungen zu hegen; haben sich von ihm zurückgezogen, als Sie merkten, daß er anderes, als Sie, im Sinne trug; haben ihn gehen und machen lassen und gehofft, daß er gedeihen möchte und nicht fallen möchte. Sie sehnten sich, als er fort war, nach ihm und flogen ihm an den Hals, als er eines Tages zurückkehrte, und fingen auch schon wieder an, ihn in Ihre Obhut zu nehmen; denn er ist solch ein Mensch, daß er der Obhut zu bedürfen, beständig zu bedürfen scheint. Ich danke Ihnen. Ich habe nicht Atem genug, nicht Herz genug und kein Wort, um Ihnen zu danken. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken darf. Vielleicht wollen Sie nichts von mir wissen. Ich bin eine Sünderin, aber vielleicht verdienen Sünderinnen, daß man ihnen gestattet, zu lernen, was man zu tun hat, um demütig zu erscheinen. Ich bin demütig, nicht geknickt, nicht etwa gebrochen, aber voll flammender, bittender, flehender Demut. Ich will mit Demut gut machen, was ich mit Liebe verbrochen habe. Wenn Sie Wert darauf legen, eine Schwester zu haben, die froh ist, Ihre Schwester zu sein, so gehorche ich Ihnen. Wissen Sie, was Ihr Bruder Simon mir gegeben hat? Sich selbst hat er mir geschenkt, er hat sich weggeworfen an mich, und ich möchte mich wegwerfen an Sie. Aber, Hedwig, wegwerfen kann man sich an Sie nicht. Das hieße ja: Ihnen wenig geben zu wollen. Doch ich bin viel, seit ich Kaspar umarmt habe. Ich fange an, mich zu brüsten und stolz reden, das will ich nicht. Ich will jetzt versuchen, ob ich schlafen kann. Der Wald schläft ja auch, warum müssen Menschen nicht schlafen können. Doch ich weiß, daß ich jetzt schlafen kann!« – Während die Frau den Brief schrieb, saßen Simon und Kaspar bei der Lampe, die sie angezündet hatten. Sie hatten noch keine Lust, sich zu Bett zu legen und sprachen noch miteinander. Kaspar sagte: »Seit den letzten Tagen male ich überhaupt nicht mehr, und ich werde, wenn das so weiter geht, meine ganze Kunst an den Nagel hängen und Bauer werden. Warum nicht? Muß es denn gerade die Kunst sein? Könnte man denn nicht anders leben? Vielleicht ist es nur eine Angewohnheit, daß man sich einbildet, um alles willen künstlerisch zu arbeiten. Ja, vielleicht nach zehn Jahren wieder damit beginnen! Man würde alles anders ansehen, viel einfacher, viel weniger phantastisch, und das könnte nicht schaden. Man müßte den Mut und das Vertrauen besitzen. Das Leben ist kurz, wenn man mißtraut, aber lang, wenn man vertraut. Was kann einem entgehen? Ich fühle, daß ich von Tag zu Tag träger werde. Sollte ich mich da aufraffen und wie ein Schulbub mich zwingen, meine Pflicht zu erfüllen? Habe ich der Kunst gegenüber irgend eine Pflicht zu erfüllen? Das ließe sich so oder so umwenden, man könnte es drehen, wie es einem gerade behagte. Bilder malen! Das kommt mir jetzt so stupide vor, ist mir so gleichgültig. Man muß sich gehen lassen. Ob ich hundert Landschaften male oder zwei, ist das nicht ganz gleichgültig? Es kann einer immer malen und bleibt doch ein Stümper, dem es nie einfällt, seinen Bildern einen Hauch von seinen Erfahrungen einzugeben, weil er keine Erfahrungen gemacht hat, so lange er lebte. Wenn ich erfahrener sein werde, werde ich auch den Pinsel geistvoller und gedankenvoller führen, und dieses ist mir nicht gleichgültig. Was kommt's auf die Anzahl an. Und trotzdem: irgend ein Gefühl sagt mir, daß es nicht gut ist, auch nur einen Tag lang außer Übung zu bleiben. Das ist die Faulheit, die verdammte Faulheit!« – – –
Er sprach nicht weiter; denn in diesem Augenblick tönte durch die Wände ein langer, furchtbarer Schrei. Simon ergriff die Lampe und beide stürzten die Treppe hinunter, in das Gemach, wo sie wußten, daß sie schlief. Den Schrei hatte Klara ausgestoßen. Agappaia war auch herbeigesprungen, und sie fanden die Frau ausgestreckt am Boden liegen. Sie hatte sich, wie es schien, ausziehen wollen, um zu Bett zu gehen, und war, von einem heftigen Anfall gepackt, umgefallen. Ihre Haare waren aufgelöst und die herrlichen Arme zuckten fieberisch am Boden. Ihre Brust hob und senkte sich stürmisch, während ein verwirrtes Lächeln um ihren Mund flog, der weit geöffnet war. Alle drei Männer bogen sich zu ihr nieder, hielten ihre Arme fest, bis die Zuckungen allmählich sich verloren. Weh hatte sie sich beim Umfallen nicht getan, was leicht hätte geschehen können. Man hob die Bewußtlose auf und legte sie, halb angekleidet, wie sie war, auf ihr Bett, das säuberlich abgedeckt war. Sie wurde ruhiger, als man ihr das Korsett öffnete. Sie atmete erleichtert auf und schien jetzt zu schlafen. Und immer schöner lächelte sie und fing an zu schwärmen in Lispeltönen, die wie Glocken aus weiter Ferne daherklangen, scharf, und doch kaum vernehmbar. Man horchte gespannt und beratschlagte, ob es einen Zweck hätte, aus der Stadt einen Arzt heraufzuholen. »Bleiben Sie doch noch,« sagte Agappaia ruhig zu Simon, der sogleich sich auf den Weg machen wollte, »es wird vorübergehen. Es ist nicht das erste Mal.« Sie saßen und horchten weiter und sahen einander bedeutend an. Aus Klaras Munde war nicht viel zu verstehen, als etwa kurze, abgerissene, halb gesungene, halb gesprochene Sätze: »Im Wasser, nein, sieh doch, tief, tief. Das hat lange gebraucht, lange, lange. Und du weinst nicht. Wenn du wüßtest. Es ist so schwarz und so schlammig um mich herum. Aber sieh doch. Ein Veilchen wächst mir zum Munde heraus. Es singt. Hörst du? Hörst du's? Man sollte meinen ich wäre ertrunken. So schön, so schön. Gibt es nicht ein Liedlein darauf? Die Klara! Wo ist sie nun? Such sie, such sie doch. Aber du müßtest ins Wasser gehen. Hu, schauert dich, nicht wahr? Schauert mich gar nicht mehr. Ein Veilchen. Ich sehe die Fische schwimmen. Ich bin ganz still, ich mache gar nichts mehr. Sei doch lieb, sei gut. Du blickst böse. Die Klara liegt da, da. Siehst du, siehst du? Ich hätte dir noch etwas sagen wollen, aber ich bin froh. Was hätte ich dir sagen wollen? Weißt es nicht mehr. Hörst du mich klingen? Mein Veilchen ist es, das klingelt. Ein Glöckchen. Das habe ich immer gewußt. Sage es nur nicht. Ich höre ja nichts mehr. Bitte, bitte« – –
»Gehen Sie nur zu Bett. Wenn es schlimmer wird, werde ich Sie wecken,« sagte Agappaia.
Es wurde nicht schlimm. Am andern Morgen war Klara wieder munter und wußte nichts davon, was mit ihr geschehen war. Sie hatte etwas Kopfschmerzen, das war alles.
Klara fühlte sich himmlisch. Sie saß in einem dunkelblauen Morgengewand, das in edlen Falten frei an ihrem Leibe herunterfloß, auf dem Balkon, der eine Aussicht auf Tannen gewährte, die an diesem Morgen, wo ein leiser Windzug daherwehte, sich sanft in ihren Spitzen hin und herbogen. Der Wald ist doch herrlich, dachte sie und beugte sich, über das zierlich gearbeitete Geländer gelehnt, mehr nach ihm zu, um seinen Duft näher zu haben. »Wie er daliegt, der Wald, als schlummerte er schon jetzt der Nacht entgegen. Am Tag, mitten im Sonnenschein, geht man in einen Wald, wie in einen Abend hinein, wo die Geräusche schärfer und leiser sind und die Düfte feuchter und empfindsamer, wo man ruhen kann und beten. Im Wald betet man unwillkürlich, und es ist auch der einzige Ort in der Welt, wo Gott nahe ist; Gott scheint die Wälder erschaffen zu haben, daß man wie in heiligen Tempeln darin bete; der eine betet nun so, der andere so, aber alle beten. Wenn man unter einer Tanne liegt und ein Buch liest, so betet man da, wenn Beten dasselbe ist wie das Verlorensein in Gedanken. Mag Gott immer sein, wo er sein mag, im Wald ahnt man ihn und gibt ihm das bißchen Glauben mit stillem Entzücken hin. Gott will nicht, daß man so sehr an ihn glaubt, er will, daß man ihn vergißt, es freut ihn sogar, wenn er geschmäht wird; denn er ist über alle Begriffe gütig und groß; Gott ist das Nachgiebigste was es im Weltraum gibt. Er besteht auf nichts, will nichts, bedarf nichts. Etwas wollen, das mag für uns Menschen sein, aber für ihn ist das nichts. Für ihn ist nichts. Er ist froh, wenn man ihn anbetet. O dieser Gott ist entzückt und weiß sich vor Seligkeit nicht zu fassen, wenn ich jetzt hingehe und ihm danke, nur ein bißchen, wenn auch ganz oberflächlich, danke. Gott ist so dankbar. Ich möchte wissen, wer dankbarer wäre. Er hat uns alles gegeben, der Unvorsichtige, Gütige, und nun ist er so, daß er froh sein muß, wenn seine Geschöpfe seiner ein wenig gedenken. Das ist das Einzige an unserem Gott, daß er nur dann Gott sein will, wenn es uns gefällt, ihn als unseren Gott zu erhöhen. Wer lehrt mehr Bescheidenheit als Er? Wer ist ahnungsvoller und stiller? Vielleicht hat Gott auch nur Ahnungen über uns, so wie wir über ihn, und ich spreche zum Beispiel hier bloß meine Ahnungen aus über ihn. Ahnt er auch, daß ich jetzt hier auf dem Balkon sitze und seinen Wald wundervoll finde? Wüßte er doch, wie schön sein Wald ist. Aber ich glaube, Gott hat seine Schöpfung vergessen, nicht etwa aus Gram, denn wie könnte er des Grames fähig sein, nein, er hat einfach vergessen, oder es scheint wenigstens, daß er uns vergessen hat. Man kann alles empfinden über Gott; denn er läßt alle Gedanken zu. Aber man verliert ihn leicht, wenn man über ihn denkt, deshalb betet man zu ihm. Großer Gott, führe uns nicht in Versuchung. So habe ich als Kind gebetet, wenn ich im Bettchen lag, und ich habe mich immer über mich gefreut, wenn ich gebetet habe. Wie bin ich heute glücklich und froh; alles an mir ist ein Lächeln, ein seliges Lächeln. Das ganze Herz lächelt, die Luft ist so frisch, ich glaube, es ist Sonntag heute, da werden die Leute aus der Stadt kommen und im Wald spazieren, und ich werde mir irgend ein Kind aussuchen, es mir von seinen Eltern auf eine kleine Weile erbitten, und mit ihm spielen. Wie ich so dasitzen kann und Freude empfinden kann um mein bloßes Dasein, Dasitzen, Mich-über-das-Geländer-lehnen! Wie ich mir schön vorkomme so. Fast könnte ich Kaspar vergessen, alles vergessen. Ich begreife jetzt nicht, wie ich jemals über etwas weinen, wie mich jemals etwas erschüttern konnte. Wie unerschütterlich ist der Wald und doch so biegsam, warm, lebendig und süß. Welch ein Atmen aus den Tannen, welch ein Rauschen! Das Rauschen der Bäume macht jede Musik überflüssig. Überhaupt, nur in der Nacht möchte ich Musik hören, aber am Morgen nie, denn der Morgen ist mir zu heilig dafür. Wie merkwürdig frisch ich mich fühle. Wie geheimnisvoll das ist, sich schlafen legen, nein, zuerst müde sein, dann sich schlafen legen, und dann erwachen und sich wie neugeboren fühlen. Jeder Tag ist ein Geburtstag für uns. Wie wenn man in ein Bad stiege, so steigt man aus den Schleiern der Nacht in die Wellen des blauen Tages. Nun wird bald die Glut des Mittags kommen, bis wieder die Sonne sehnsüchtig versinkt. Welche Sehnsucht, welches Wunder vom Abend zum Morgen, vom Mittag zu Abend, von der Nacht zum Morgen. Alles würde man wundervoll finden, wenn man alles empfände, denn es kann ja nicht eines wundervoll sein und das andere nicht. Ich glaube, ich muß gestern krank gewesen sein, und man sagt es mir nur nicht. Wie schön und unschuldig noch immer meine Hände aussehen. Wenn sie Augen hätten, so würde ich ihnen einen Spiegel entgegenhalten, damit sie sähen, wie schön sie sind. Der kann glücklich sein, den ich liebkose mit meinen Händen. Was für seltsame Gedanken ich doch habe. Wenn Kaspar jetzt käme, müßte ich weinen, mich so sehen zu lassen. Ich habe nicht an ihn gedacht, und er würde es fühlen, daß ich nicht an ihn gedacht habe. Wie elend mich das auf einmal macht, zu denken, daß ich ihn vernachlässigt habe. Bin ich denn seine Sklavin? Was geht er mich an?«
Sie weinte. Da kam Kaspar: »Was fehlt dir, Klara?«
»Nichts! Was sollte mir fehlen? Du bist ja da. Du hattest mir gefehlt. Ich bin glücklich, aber ich leide es nicht, daß ich allein glücklich bin, ohne dich. Deshalb weinte ich. Komm, komm,« und sie preßte ihn fest an sich.
Simon fing an, das träge, schlenderische Leben, das er führte, als etwas Unerträgliches zu empfinden. Er fühlte, daß er bald wieder schaffen und tagewerken mußte: »Es hat doch etwas für sich, zu leben wie die Meisten. Es beginnt mich zu ärgern, so müßig und absonderlich zu sein. Das Essen schmeckt mir nicht mehr, die Spaziergänge ermüden mich, und was ist denn Großes und Erhebendes daran, sich auf heißen Landstraßen von Fliegen und Bremsen zerstechen zu lassen, durch Dörfer zu laufen, steile Wände hinunter zu springen, auf erratischen Felsblöcken zu hocken, den Kopf zu stützen, ein Buch anzufangen zu lesen und es nicht bis zu Ende lesen zu können, dann in einem, wenn auch schönen, so doch abgelegenen See zu baden, sich wieder anzuziehen und auf den Heimweg zu machen und dann zu Hause den Kaspar zu finden, der ebenfalls vor Trägheit nicht mehr weiß, auf welchem Bein er stehen und mit welcher Nase er denken soll, oder welchen Finger er an eine seiner Nasen legen soll. Man bekommt bei diesem Leben leicht eine Menge Nasen und möchte den ganzen Tag seine zehn Finger an seine zehn Nasen legen und denken. Dabei lachen einen die eigenen Nasen nur aus und machen die lange Nase. Nun, was ist das etwa Göttliches, wenn man sieht, wie einem zehn Nasen oder mehr die lange Nase machen. Ich illustrierte damit nur die Tatsache, daß man bei diesem Herumlungerleben dumm wird. Nein, ich fange an, mir wieder so etwas wie ein Gewissen zu machen, und zu denken, daß es wiederum bei dem Gewissenmachen nicht bleiben darf, sondern daß man irgend etwas tun muß. In der Sonne herumlaufen, kann auf die Dauer kein Tun sein, und Bücher liest nur ein Tropf; denn das ist man, wenn man sonst weiter nichts tut. Das Schaffen unter Menschen ist doch schließlich das allein und einzig Bildende. Was nun tun? Vielleicht Gedichte schreiben? Wenn ich das tun möchte bei dieser Sommerhitze, müßte ich zuerst Sebastian heißen, dann täte ich's vielleicht. Der tut es, das bin ich überzeugt. Das ist ein Mensch, der erst einen Ausflug macht, See, Wald, Berge, Bäche, Pfützen und Sonnenschein genau studiert, eventuell Notizen macht, dann heimgeht und einen Aufsatz darüber schreibt, den dann die Zeitungen drucken, die die Welt bedeuten. Kann das ein Tun für mich sein? Wohl, wenn ich es verstünde, aber ich bin Stümper in diesen Sachen. Also hingehen und wieder Buchstaben kratzen, Rechnungen ausradieren und Tinte verbrauchen. Ja, ich glaube, daß ich das tun muß, obwohl es keine Ehre für mich ist, wieder von vorne anzufangen, was ich einst verlassen habe. Aber es muß sein. In diesem Falle denkt man nicht an die Ehre, sondern an das Notwendige und Unabänderliche. Ich bin jetzt zwanzig Jahre alt. Wie komme ich dazu, schon zwanzig Jahre alt zu sein? Welche Entmutigung müßte für einen anderen darin liegen, zwanzig Jahre alt zu sein und nun von vorne anzufangen, da, wo man bei der Entlassung aus der Schule stand. Aber ich will es so lustig wie nur möglich nehmen, da es doch einmal sein muß. Ich will ja auch gar nicht vorwärtskommen im Leben, ich will nur leben, daß es ein bißchen eine Art und Weise hat. Weiter gar nichts. Eigentlich will ich nur leben, bis es wieder Winter wird, und dann, wenn es schneit und Winter ist, werde ich weiter zu leben wissen, wird es mir zum Bewußtsein kommen, wie ich am besten weiter zu leben habe. Es macht mir viel Vergnügen, so das Leben in kleine, einfache, leicht zu lösende Rechnungen einzuteilen, die kein Kopfzerbrechen machen, die sich von selber lösen. Im Winter bin ich übrigens immer klüger und unternehmender als im Sommer. Bei der Wärme, bei all dem Blühen und Duften ist nichts anzufangen, während die Kälte und der Frost schon von selber vorwärtstreiben. Also bis im Winter etwas Geld zusammenscharren, und im schönen Winter dann das Geld zu irgend etwas Nützlichem verbrauchen. Es käme mir nicht drauf an, im Winter Sprachen zu studieren, tagelang, in ungeheizten Zimmern, bis mir die Finger abgefrören, aber der Sommer ist für diejenigen, die Ferien erhalten, für solche, die sich in Sommerfrischen gütlich tun, die ein Vergnügen darin finden, barfuß, ja nackt auf heißen Wiesen herumzuspringen, höchstens einen ledernen Schurz um die Lenden, wie Johannes der Täufer, der außerdem Heuschrecken soll gegessen haben. So will ich mich jetzt auf das Bett der täglichen Arbeit in Schlaf legen und erst wieder erwachen, wenn der Schnee über die Erde fliegt und die Berge weiß werden und die Nordstürme dahersausen, daß einem die Ohren erfrieren und in Flammen des Frostes und Eises zergehen. Die Kälte ist mir eine Glut, unbeschreiblich, nicht auszudrücken! So wird's gemacht, oder ich müßte nicht Simon heißen. Klara wird im Winter eingehüllt sein in dicke, weiche Pelze, ich werde sie durch die Straßen begleiten, es wird auf uns herabschneien, so leise, so heimlich, so lautlos und so warm. O, Einkäufe zu machen, wenn es schneit in den schwarzen Straßen und die Magazine mit Lichtern erhellt sind. In einen Laden hineinzutreten mit Klara oder hinter Klaras Gestalt her und zu sagen: die Dame wünscht dies und das zu kaufen. Klara duftet in ihren Pelzen und ihr Gesicht, wie wird das schön sein, wenn wir dann wieder auf die Straße hinausgehen. Vielleicht wird sie im Winter dann irgendwo in einem feinen Geschäft arbeiten, wie ich, und ich werde sie jede Nacht abholen können, außer sie beföhle mir einmal, sie lieber nicht abzuholen. Agappaia jagt seine Frau vielleicht fort, und sie wird dann gezwungen sein, irgendwo eine Anstellung anzunehmen, was ihr leicht sein wird, da sie eine vornehme Erscheinung ist. Weiter denke ich nicht. Weiter als so denkt vielleicht Herr Spielhagen von der Aktiengesellschaft für elektrische Leuchtkörper, aber ich nicht; denn ich bin nicht so gestellt und häufe mir nicht so viele Verpflichtungen in der Welt an, daß ich gezwungen wäre, weiter als so zu denken. Ach, der Winter! Wenn er nur bald kommt.« –
Schon am nächsten Tag arbeitete er in einer großen Maschinenfabrik, die zur Inventuraufnahme eine ganze Anzahl von jungen Leuten brauchte. Den Abend verbrachte er dann lesend an einem Fenster, oder er verlängerte seinen Heimweg von der Fabrik nach Klaras Hause, indem er einen weiten Bogen um den ganzen Berg herummachte, in dem dunklen Grün der vielen Waldschluchten, welche den breiten Berg durchschnitten. An einer Quelle, bei der er stets vorbeikam, löschte er jedesmal seinen großen Durst und lag dann auf einer einsam gelegenen Waldwiese, bis ihn die Nacht daran erinnerte, endlich nach Hause zu gehen. Er liebte das Übergehen des Sommerabends in die Sommernacht, dieses langsame, rötliche Sinken der Farben des Waldes in das Dunkel der gänzlichen Nacht. Er pflegte dann ohne Worte und Gedanken zu träumen, sich keinen Vorwurf mehr zu machen und sich der schönen Müdigkeit zu überlassen. Oft schien es ihm, als zische neben ihm, in den dunklen Büschen, eine feurig-rote große Kugel aus der schlafenden Erde empor, und wenn er dahin blickte, war es der Mond, der schwebend und schwer aus dem Welt-Hintergrund hervortanzte. Wie hing dann sein Auge an der bleichen, leichten Gestalt dieses schönen Gestirnes. Es war ihm so sonderbar, daß diese ferne Welt gleich hinter dem Gebüsch versteckt zu sein schien, zum befühlen und daran fassen nahe. Alles schien ihm nahe zu sein. Was war denn dieser Begriff der Ferne gegen solche Fernen und Nähen. Das Unendliche schien ihm plötzlich das Nächste. Wenn er nach Hause kam, durch all das schwere, singende, duftende Grün der Nacht hindurch, empfand er es als etwas Geheimnisvolles und Liebes, wenn ihm Klara, was sie jeden Abend tat, entgegentrat, um ihn zu empfangen. Ihre Augen schienen immer geweint zu haben, wenn sie so kam oder auf diese Weise wartete. Dann saßen sie zusammen, bis tief in die Nacht hinein, auf dem kleinen Balkon, der in eine Art Sommerhäuschen in schwebender Höhe verwandelt war und spielten mit winzigen Karten ein Spiel, oder die Frau sang irgend eine Melodie, oder sie ließ sich von ihm etwas vorerzählen. Wenn sie ihm zu guter Letzt Gute Nacht sagte, so schlief er so wohl, als wenn es ein Zauberwort gewesen wäre, dieses ›Gute Nacht‹ von ihr, mit dem sie die Macht besessen hätte, ihn an einen besonders tiefen und schönen Schlaf zu fesseln. Am Morgen glitzerte der silberne Tau an den Gesträuchen, an den Gräsern und Blättern, wenn er in sein Geschäft lief, um zu schreiben und das Inventar der Maschinenfabrik aufnehmen zu helfen. Einmal, an einem Sonntag, da er von einem Spaziergang zurückkehrte, fand er Klara schlafend auf dem Diwan in seinem Zimmer. Von draußen tönte eine Handharfe aus einem der armseligen Berg-Vorstadthäuschen, in denen arme Arbeiter wohnten. Die Fensterläden waren zugezogen, und ein grünes, heißes Licht befand sich im Zimmer. Er setzte sich neben die Schlafende ans Fußende und sie berührte ihn leise mit ihren Füßen. Dieser Druck tat ihm so wohl, und er sah unverwandt das Gesicht der Schlummernden an. Wie schön war sie, wenn sie schlief. Sie gehörte zu den Frauen, die am schönsten sind, wenn ihre Gesichtszüge unbeweglich ruhen. Klara atmete in ruhigen Wellen; ihre Brust, die halb entblößt war, bewegte sich sanft auf und ab; ihren herabhängenden Händen war ein Buch entfallen. In Simon stieg der Gedanke auf, hinzuknieen und diese schönen Hände still zu küssen, aber er tat es nicht. Er würde es vielleicht getan haben, wenn sie wach dagelegen wäre, aber schlafend? Nein! Geheime, verstohlene, erschelmte Zärtlichkeiten sind nicht meine Sachen, dachte er. Ihr Mund lächelte, als schliefe sie nur so und wüßte, daß sie schliefe. Dieses Lächeln der Schlafenden verbot jeden unzarten Gedanken, aber es zwang, hinzusehen auf diesen Mund, auf dieses Gesicht, auf dieses Haar und auf diese länglichen Wangen. Im Schlaf preßte Klara plötzlich ihre Füße stärker an Simon, dann erwachte sie und schaute sich fragend um und blieb lange an Simons Augen hängen, als verstände sie irgend etwas nicht. Dann sagte sie: »Du, Simon! Höre einmal.«
»Was denn?«
»Wir werden nicht mehr lange in diesem Hause wohnen. Agappaia hat alles verspielt und verloren. Er ist in die Hände von Schwindlern geraten. Das Haus ist bereits verkauft und zwar an deinen Frauenverein für Volkswohl und Mäßigkeit. Die Damen gründen hier ein Waldkurhaus für das arbeitende Volk. Agappaia hat sich einer Gesellschaft von Asienforschern angeschlossen und wird bald wegreisen, um dort irgendwo in Indien eine versunkene griechische Stadt zu entdecken. An mich denkt er schon gar nicht mehr. Wie seltsam, es kränkt mich gar nicht einmal. Mein Mann war überhaupt nie fähig, mich zu kränken. Genug! Ich werde in einem einfachen Zimmer wohnen, in der Stadt unten, und Kaspar und du, ihr werdet mich besuchen. Ich werde eine Stelle bekleiden, irgend eine Stelle, so wie du. Im Herbst ziehen wir aus, dann soll auch sogleich dieses Haus umgebaut werden. Was sagst du dazu?«
»Mir ist das sehr lieb. Ich dachte auch schon daran, mich zu ›verändern‹. Jetzt kommt es ja von selbst. Ich freue mich sehr darauf, dich in deinem zukünftigen Heim besuchen zu können.«
Und beide malten sich die Zukunft aus und lachten dabei.
Kaspar befand sich in einem kleinen Landstädtchen, wo er den Auftrag zu erledigen hatte, einen Tanzsaal zu dekorieren, das heißt, dessen Wände von oben bis unten zu bemalen. Es war inzwischen Herbst geworden und eines Tages machte sich Simon, es war ein Sonnabend, nach Feierabend auf den Weg, um die Nacht durch die Strecke zu Fuß zu gehen, die ihn von Kaspar trennte. Warum sollte er nicht eine ganze Nacht lang wandern können. Er hatte eine Landkarte zur Hand genommen und darauf mit dem Zirkel die Zahl der Stunden, die er brauchte, um nach dem Städtchen zu gelangen, scharf abgemessen und hatte wahrgenommen, daß er gerade in einer Nacht, wenn er die Zeit ausnutzte, hingelangen konnte. Der Weg führte ihn zuerst durch die Vorstadt, wo Rosa, seine alte Freundin, wohnte, und er verschmähte nicht, ihr im Vorbeilaufen einen kurzen Besuch abzustatten. Sie war sehr erfreut, ihn nach so langer Zeit wieder einmal zu sehen, nannte ihn einen bösen, treulosen Menschen, daß er sie so habe im Stich lassen können, sagte das aber mehr in einem schmollenden als in einem gereizten Ton und ließ es sich nicht nehmen, Simon ein Glas Rotwein zu trinken zu geben, das, wie sie sagte, ihn für seine Nachtwanderung stärken solle. Auch briet sie ihm auf ihrem Gasherde schnell eine Wurst, stichelte den Dastehenden, während sie kochte, mit nicht unartigen, aber wohlgesetzten Worten, sagte, er müsse ja sehr gut mit Frauen versehen sein und machte ihn lachend darauf aufmerksam, daß er eigentlich die Wurst nicht verdiene, sie nun aber doch haben solle, wenn er künftig fleißiger zu ihr käme. Das versprach, während er sich das Essen schmecken ließ, Simon und trat bald darauf seine Wanderung mit einigem Bangen vor der Anstrengung, die ihm bevorstand, an. Aber jetzt noch feige zurückkehren und die Eisenbahn benutzen, das mochte er doch nicht. So lief er denn vorwärts und fragte immer wieder nach dem richtigen Weg, um ja sicher zu gehen. Bei den Wegweisern zündete er ein Streichhölzchen an, hielt es in die nötige Höhe, um zu sehen, wo der Weg weiter hinliefe. Er ging mit einer ganz rasenden Schnelligkeit, als fürchtete er, der Weg möchte ihm unter seinen Füßen entgehen und davonlaufen. Der Rotwein Rosas hatte ihn befeuert und er wünschte nur, daß bald die Berge kämen, die zu überwinden ihm eine Lust und Leichtigkeit gewesen wäre. So kam er in das erste Dorf und hatte Mühe, sich auf den verschiedenen Dorfwegen, die alle kreuz und quer liefen, zurechtzufinden. Er rief deshalb einen Schmied an, der noch hämmerte, und von diesem erfuhr er, daß er richtig ging. Nun kam eine Landschaft, die ganz verschwommen war, weil sie aus lauter Gebüschen bestand; es ging bergaufwärts; dann kam eine Art Hochebene, die etwas Schauerliches an sich hatte. Es war tiefdunkel, kein Stern am ganzen Himmel, hin und wieder kam der Mond hervor, aber die Wolken verdeckten sein Licht wieder. Nun lief Simon durch einen finsteren Tannenwald, er fing an zu keuchen und paßte besser auf seine Schritte auf; denn er stieß immer wieder an Steine, die im Wege lagen, und das langweilte ihn doch ein wenig. Der Tannenwald hörte auf, Simon atmete freier; denn in dunklen Wäldern zu gehen, so allein, ist nicht immer ungefährlich. Ein großes Bauernhaus stand plötzlich vor ihm wie aus der Erde emporgewachsen und engte seinen Blick ein, ein großer Hund schoß hervor, sprang auf den Wanderer los, aber biß nicht. Simon blieb ganz still und ruhig stehen, starrte den Hund nur an, und so wagte der Hund nicht zu beißen. Weiter ging es! Brücken kamen, die donnerten in der Stille unter den raschen Schritten, denn sie waren von Holz, es waren alte Holzbrücken mit Dächern und Heiligenbildern am Ein- und Ausgange. Simon fing an, gezierte Schritte zu machen, um sich Unterhaltung zu verschaffen. Plötzlich, auf ganz offenem, aber düsterem Feld stand ein starker Mann vor ihm, der ihn anschrie und ihn dabei fürchterlich anstarrte. »Was wollen Sie?« schrie Simon seinerseits, aber er machte eine Schwenkung rund um den Mann herum und lief fort, ohne hören zu wollen, was der Mann wollte. Sein Herz klopfte, es war die Plötzlichkeit der Erscheinung, nicht der Mann selber, die ihn erschreckt hatte. Dann marschierte er durch ein schlafendes, endlos langes Dorf. Ein weißes, langes Kloster sah ihm entgegen und verschwand wieder. Es ging wieder bergauf. Simon dachte an gar nichts mehr, die zunehmende Anstrengung lähmte seine Gedanken; stille Brunnen wechselten mit einsamen Baumgruppen, Wälder mit Wolken, Steine mit Quellen, es schien alles mit ihm zu gehen und hinter ihm zu versinken. Die Nacht war feucht, finster und kalt, seine Wangen aber brannten und seine Haare wurden naß vom Schweiß. Auf einmal erblickte er zu seinen Füßen etwas gestreckt Liegendes, Weites, Schimmerndes und Glänzendes: es war ein See; Simon blieb stehen. Von da an ging es abwärts auf einem fürchterlich schlechten Weg. Zum ersten Mal taten ihm seine Füße weh, aber er achtete nicht darauf, sondern ging weiter. Äpfel hörte er dumpf auf die Wiesen fallen. Wie geheimnisvoll schön die Wiesen waren: undurchsichtbar und dunkel. Das Dorf, das nun folgte, erweckte sein Interesse durch die vornehmen Häuser, die es zur Schau trug. Aber hier wußte Simon nicht mehr weiter. So sehr er suchte, den rechten Weg fand er nicht. Da es ihn erbitterte, wählte er, ohne sich lange zu besinnen, die Hauptstraße. Eine Stunde mochte er gegangen sein, als ihm ein deutliches Gefühl sagte, daß er eine falsche Richtung eingeschlagen hatte, er kehrte wieder um, weinte beinahe vor Zorn und schlug seine Füße gegen die Straße, als hätten sie die Schuld getragen. Er kam wieder ins Dorf zurück: zwei Stunden versäumt: welche Schmach! Er fand auch sogleich den rechten Weg, nun, da er die Augen besser auftat, lief fort, unter Bäumen, die ihr Laub fallen ließen, auf einem schmalen Seitenwege, der ganz mit raschelnden Blättern bedeckt war. Er gelangte in einen Wald, es war ein Bergwald, der schroff in die Höhe strebte, und da Simon keinen Weg mehr vor sich sah, ging er einfach gerade aus, suchte sich, immer höher steigend, durch das dichteste Tannengeäst seine Bahn, zerkratzte sich sein Gesicht, zerrieb seine Hände, aber es ging wenigstens hinauf, bis endlich der Wald aufhörte, durch den er sich stöhnend und fluchend hindurchgerungen, und eine freie Weide vor seinen Augen lag. Er ruhte einen Moment: »Herrgott, wenn ich zu spät komme: welche Blamage!« Weiter! Er ging nicht mehr, er sprang, indem er rücksichtslos seine Beine in die weiche Ackererde stampfte. Ein bleiches, schüchternes Morgenlicht streifte von irgendwoher seine Augen. Er sprang über Hecken, die ihn zu höhnen schienen. Auf einen Weg achtete er schon längst nicht mehr. Eine anständige, breite Straße, das blieb in seiner Phantasie als etwas Köstliches hängen, nach dem er sich von Herzen sehnte. Es ging wieder bergabwärts, in schmale, kleine Schluchten, wo die Häuser an den Halden wie Spielzeuge klebten. Er roch die Nußbäume, unter denen er lief; unten im Tal schien so etwas wie eine Stadt zu sein, aber das war nur eine gierige Ahnung. Endlich fand er die Straße. Seine Beine selbst schienen mitzujubeln über den Fund und er ging ruhiger, bis er einen Brunnen fand, zu dessen Röhre er sich wie ein Wahnsinniger hinstürzte. Unten gelangte er in eine kleine Stadt, kam bei einem weißglänzenden, zierlichen, anscheinend geistlichen Palais vorbei, dessen Verfallenheit ihn tief rührte, und wieder ging es ins offene Land hinaus. Hier fing der Tag an zu grauen. Die Nacht schien zu erbleichen; die lange, stille Nacht machte ein Zeichen der Bewegung. Simon stürmte jetzt den Weg nur so beiseite. Wie bequem erschien ihm das Gehen auf einer solchen glatten Straße, die in großen Windungen zuerst aufwärts, dann prachtvoll gedehnt bergab führte. Nebel sanken auf die Wiesen nieder und gewisse Tagesgeräusche meldeten sich dem Ohr. Wie lang doch eine Nacht war. Durch diese Nacht, die er auf der Erde durchgelaufen, saß vielleicht ein Gelehrter, vielleicht gar sein Bruder Klaus, bei der Lampe am Schreibtisch, und wachte ebenso sauer und mühsam. Ebenso wundervoll mußte einem solchen Stillesitzenden der erwachende Tag vorkommen, wie jetzt ihm, dem Landstraßenläufer. Schon zündete man in kleinen Häusern die Frühmorgenlichter an. Eine zweite, größere Stadt erschien, zuerst mit Vorhäusern, dann mit Gassen, dann mit Toren und einer breiten Hauptstraße, in der Simon ein herrliches Haus mit Statuen von Sandstein auffiel. Es war eine alte Stadtburg, die jetzt als Postgebäude diente. Schon gingen Menschen auf der Straße, die er fragen konnte nach dem Weg, wie am Abend zuvor. Es ging wieder ins flache, freie Land hinaus. Der Nebel zerstob, Farben zeigten sich, entzückte Farben, entzückende Farben, Morgenfarben! Es schien ein herrlicher, blauer Herbstsonntag werden zu wollen. Nun begegnete Simon Leuten, namentlich Frauen, sonntäglich geputzten, die vielleicht schon von weit herkamen, um in die Stadt zur Kirche zu gehen. Immer bunter wurde der Tag. Jetzt sah man die roten, glühenden Früchte neben der Straße in der Wiese liegen, auch fielen beständig reife Früchte von den Bäumen. Es war das reine Obstland, durch das Simon nun weiterschritt. Handwerksburschen begegneten ihm, ganz bequemlich; die nahmen das Gehen nicht so ernst wie er. Eine ganze Gesellschaft dieser Burschen lag ausgestreckt an einem Wiesenrand in den ersten Strahlen der Sonne: welches Bild der Behaglichkeit! Eine Kuh wurde vorbeigeführt, und die Frauen sagten so schön ›guten Tag‹. Simon aß Äpfel auf dem Weg, auch er wanderte jetzt ruhig durch das fremde, schöne, reiche Land. Die Häuser an der Straße waren so einladend, aber noch schöner und zierlicher waren die Häuser, die mitten unter den Bäumen, tiefer im Land, mitten im Grün steckten. Die Hügel gingen anmutig und sanft in die Höhe, die Höhen lockten, alles war blau, von einem herrlichen, feurigen Blau durchzogen, auf Wagen fuhren ganze Gesellschaften von Leuten daher und endlich sah Simon ein kleines Häuschen am Weg, dahinter eine Stadt, und sein Bruder steckte den Kopf durch das Fenster des Hauses. Er war zur rechten Zeit angekommen, kaum eine Viertelstunde nach der vereinbarten Zeit. Und er ging mit Frohlocken in das Haus hinein.
Drinnen im Zimmer, beim Bruder, betrachtete er alles mit großen Augen, obschon gar nicht viel zu betrachten war. In einer Ecke stand das Bett, aber es war ein interessantes Bett; denn Kaspar schlief darin, und das Fenster war ein wunderbares Fenster; obgleich es nur aus einfachem Holz war und simple Vorhänge hatte, schaute doch eben erst Kaspar durch dieses Fenster hinaus. Am Boden, auf dem Tisch, auf der Bettdecke, auf Stühlen herum lagen Zeichnungen und Bilder. Jedes einzelne Blatt glitt durch des Besuchers Finger, alles war schön und so vollendet. Es war Simon beinahe unbegreiflich, was für ein Arbeiter der Maler war, es lag so viel vor seinen Augen, er konnte kaum mit Ansehen fertig werden. »Wie das die Natur selber ist, was du malst!« rief er aus: »Es wird mir immer halb traurig zumute, wenn ich neue Bilder von dir betrachte. Jedes ist so schön, glänzt von Empfindung und trifft die Natur wie in ihr Herz, und du malst immer Neues, willst immer Besseres, vernichtest womöglich Vieles, das in deinen Augen schlecht geworden ist. Ich kann keines von deinen Bildern schlecht finden, alle rühren mich und bezaubern meine Seele. Nur ein Strich von dir oder eine Farbe geben mir von deinem schlechthin wundervollen Talent eine feste und unerschütterliche Überzeugung. Und wenn ich deine Landschaften, die so breit und warm mit dem Pinsel gemalt sind, ansehe, sehe ich immer dich, und ich fühle eine Art Weh mit dir, das mir sagt, daß es nie ein Ende gibt in der Kunst. Ich verstehe die Kunst so gut und das Drängen der Menschen, das sie ihretwegen empfinden, und die Sehnsucht, so um die Liebe und Gnade der Natur zu werben. Was wollen wir, wenn wir es entzückend finden, eine Landschaft abgebildet zu sehen? Ist es nur ein Genuß? Nein, wir wollen damit etwas erklärt finden, aber etwas, das gewiß immer unerklärlich bleiben wird. Es schneidet so tief in uns hinein, wenn wir, an einem Fenster liegend, träumend eine untergehende Sonne betrachten, aber das ist noch gar nichts gegen eine Straße, in der es regnet, wo die Frauen ihre Röcke zierlich hochheben, oder gegen den Anblick eines Gartens oder Sees unter dem leichten Morgenhimmel oder gegen eine einfache Tanne im Winter oder gegen eine Gondelfahrt bei Nacht oder gegen eine Alpenansicht. Nebel und Schnee entzücken uns nicht minder als Sonne und Farben; denn der Nebel verfeinert wieder die Farben, und der Schnee ist doch, zum Beispiel unter dem Blau des erwärmenden Vorfrühlingshimmels, eine tiefe, wundervolle, beinahe unverständliche Sache. Wie schön ich das von dir finde, Kaspar, daß du malst und so schön malst. Ich möchte ein Stück Natur sein und mich lieben lassen, so wie du jedes Stück Natur liebst. Der Maler muß doch wohl die Natur am heftigsten und am schmerzlichsten lieben, viel stürmischer und zitternder und aufrichtiger als selbst der Dichter, als zum Beispiel so ein Sebastian, von dem ich doch hörte, daß er sich eine Hütte auf den Weiden zum Wohnen eingerichtet hat, damit er ungestört, wie ein Einsiedler in Japan, die Natur anbeten kann. Die Dichter hangen sicher weniger treu an der Natur, als ihr Maler; denn sie treten in der Regel mit verbildeten und verstopften Köpfen an sie heran. Doch vielleicht irre ich mich, und ich würde mich in diesem Fall gerne geirrt haben. Wie mußt du gearbeitet haben, Kaspar. Du hast doch gewiß keine Ursache, dir selber Vorwürfe zu machen. Das würde ich nicht tun. Nicht einmal ich tue es, und wahrhaftig, ich hätte es sicher nötig. Aber ich tu es deshalb nicht, weil es einen unruhig macht und weil die Unruhe ein häßlicher, des Menschen unwürdiger Zustand ist.« –
»Da hast du recht,« sprach Kaspar.
Sie gingen dann beide durch die kleine Stadt, sahen alles an, was bald, und wiederum bei der Innigkeit, womit sie es taten, doch nicht bald geschehen war, begegneten dem Briefträger, der Kaspar einen Brief einhändigte und eine Grimasse dazu schnitt. Der Brief war von Klara. Die Kirche wurde bewundert und die Majestät der Stadttürme, die trotzigen Stadtmauern, welche oft durchbrochen worden waren, die Rebhäuser und Lusthäuser am Berge, in denen das Leben ausstarb seit so langer Zeit. Die Tannen schauten ernst auf das alte Städtchen herab, dazu war der Himmel so süß und die Häuser schienen zu trotzen und verdrießlich zu sein in ihrer Dicke und Breite. Die Wiesen schimmerten, und die Hügel mit den goldenen Buchenwäldern lockten in die Höhe und Ferne hinein. Am Nachmittag gingen die jungen Männer in den Wald. Viel sagten sie nicht mehr. Kaspar war still geworden, sein Bruder fühlte, an was er dachte und wollte ihn nicht aufwecken; denn ihm schien es wichtiger, daß gedacht werde, als wenn geredet worden wäre. Sie setzten sich auf eine Bank. »Sie will nicht von mir lassen,« sagte Kaspar, »sie ist unglücklich.« Simon sagte nichts, aber er empfand eine gewisse Freude für seinen Bruder, daß die Frau unglücklich um ihn war. Er dachte: »Ich finde es schön, daß sie unglücklich ist.« Diese Liebe entzückte ihn. Bald wurde jedoch Abschied genommen; denn Simon mußte, und diesmal mit der Bahn, zurückreisen.
Es wurde Winter. Simon, der sich selber überlassen war, saß in einem kleinen Zimmer, mit einem Mantel bekleidet, am Tische und schrieb. Er wußte nicht, was er mit der Zeit beginnen sollte, und weil er von seinem Beruf her zu schreiben gewöhnt war, so schrieb er jetzt ganz wie absichtslos von selber und zwar auf kleine Papierstreifen, die er sich mit der Schere zurechtgeschnitten hatte. Draußen war nasses Wetter, und der Mantel, mit dem Simon umhüllt war, diente dazu, einen Ofen zu ersetzen. Ihm behagte dieses In-der-Stube-sitzen, während draußen heftige Winde wehten, die Schnee versprachen. Es war ihm behaglich zumute, so zu sitzen und etwas zu machen und sich der Einbildung zu überlassen, ein vergessener Mensch zu sein. Er dachte zurück an seine Kindheit, die noch gar nicht so weit rückwärts entfernt war, und die doch so fern lag wie ein Traum, und schrieb:
»Ich will mich an die Kindheit zurückerinnern, da dies, in meinem jetzigen Falle, eine spannende und belehrende Aufgabe ist. Ich war ein Knabe, der sich gern an warme Öfen mit dem Rücken lehnte. Ich kam mir dabei wichtig und traurig vor und machte ein zufriedenes und zugleich wehmütiges Gesicht. Auch zog ich, wenn ich nur immer konnte, weiche Filzschuhe für die Stube an, das heißt, das Wechseln der Schuhe, das Tauschen der nassen mit den warmen, machte mir die größte Freude. Eine warme Stube hatte etwas Zauberhaftes für mich. Ich war nie krank und beneidete immer die, die krank sein konnten, die man pflegte, für die man etwas feinere Worte hatte, wenn man zu ihnen sprach. Deshalb dachte ich mich öfters krank und war gerührt, wenn ich in meiner Einbildung vernahm, wie meine Eltern zärtlich zu mir redeten. Ich hatte ein Bedürfnis darnach, zärtlich behandelt zu werden, und es geschah nie. Vor meiner Mutter fürchtete ich mich, weil sie so selten zärtlich sprach. Ich hatte das Renommee eines Spitzbuben, und ich glaube, nicht mit Unrecht, aber es war doch manchmal verletzend für mich, immer daran erinnert zu werden. Ich hätte gern verzärtelt werden mögen; als ich aber einsah, daß es unmöglich war, daß man mir diese Aufmerksamkeit schenke, wurde ich ein Flegel und verlegte mich darauf, diejenigen zu ärgern, welche den Vorzug genossen, brave, geliebte Kinder zu sein. Das war meine Schwester Hedwig und mein Bruder Klaus. Nichts machte mir größeres Vergnügen, als Ohrfeigen von ihnen zu bekommen; denn daran sah ich, daß ich das Geschick dazu hatte, sie zornig auf mich zu machen. Von der Schule habe ich keine große Erinnerung mehr, aber ich weiß, daß sie mir eine Art Entgeltung wurde für die kleine Zurücksetzung, die ich im elterlichen Hause erfuhr: ich konnte mich auszeichnen. Es war mir eine Genugtuung, gute Zeugnisse nach Hause zu tragen. Ich fürchtete die Schule und verhielt mich infolgedessen dort brav; ich blieb in der Schule überhaupt immer zurückhaltend und zaghaft. Die Schwächen der Lehrer blieben mir indessen nicht lange verhüllt, doch kamen sie mir mehr schrecklich als lächerlich vor. Einer der Lehrer, ein plumper, ungeheurer Mensch, hatte ein wahres Säufergesicht; trotzdem fiel es mir nie ein, daß er ein Säufer hätte sein können, dagegen von einem andern ging ein rätselhaftes Gerücht in der Schulwelt umher, daß er am Trunk untergegangen wäre. Dieses Mannes Leidensgesicht vergesse ich nie. Die Juden hielt ich für vornehmere Menschen als die Christen; denn es gab etliche entzückend schöne Judenfrauen, vor denen ich, wenn ich ihnen auf der Gasse begegnete, erbebte. Öfters mußte ich, im Auftrage meines Vaters, in eines der eleganten Judenhäuser gehen, und es roch immer wie nach Milch in diesem Hause, und die Dame, die mir dort die Tür aufzuschließen pflegte, hatte weiße, weite Kleider an und brachte einen warmen, gewürzigen Duft mit sich heraus, vor dem ich anfangs einen Abscheu hatte, den ich aber nachher lieben lernte. Ich glaube, ich trug nicht gerade hübsche Kleider als Knabe, jedenfalls sah ich mit boshafter Bewunderung einige andere Knaben an, die hohe schöne Schuhe trugen, glatte Strümpfe und gutsitzende Anzüge. Ein Knabe besonders machte mir tiefen Eindruck wegen seiner Zartheit an Gesicht und Händen, wegen der Weichheit seiner Bewegungen und der Stimme aus seinem Munde. Er glich völlig einem Mädchen, war immer in weiche Stoffe gekleidet und genoß bei den Lehrern eine Achtung, die mich stutzig machte. Ich sehnte mich krankhaft danach, von ihm eines Wortes gewürdigt zu werden und war glücklich, als er mich eines Tages vor dem Schaufenster einer Papierhandlung unvermittelt ansprach. Er schmeichelte mir, weil ich so schön schrieb, und sprach das Verlangen danach aus, eine ebenso schöne Schrift wie ich zu besitzen. Wie freute mich das, diesem jungen Gott von Knaben in einem Stück wenigstens überlegen zu sein, und ich wehrte seine Schmeicheleien errötend und selig von mir ab. Dieses Lächeln! Ich erinnere mich noch, wie er lächelte. Seine Mutter war lange Zeit mein Traum. Ich überschätzte sie zu Ungunsten meiner eigenen Mutter. Welches Unrecht! Diesen Knaben griffen einige Spottvögel in unserer Klasse an, indem sie die Köpfe zusammensteckten und sagten, er sei ein Mädchen und zwar ein wirkliches, nur verkleidet in den Kleidern eines Knaben. Natürlich war es nur Unsinn, aber mich traf das wie ein Donnerschlag und ich glaubte lange Zeit, in diesem Knaben ein verkleidetes Mädchen verehren zu sollen. Seine überweiche Figur gab mir allen Anlaß zu überspannten romantischen Empfindungen. Natürlich war ich zu schüchtern und stolz, ihm meine Vorliebe für ihn zu erklären, und so hielt er mich für einen seiner Feinde. Wie vornehm wußte er sich abzusondern. Wie merkwürdig, jetzt das zu denken! – Im Religionsunterricht entzückte ich einmal meinen Lehrer, weil ich für eine bestimmte Empfindung ein bestimmtes treffendes Wort fand; auch das ist mir unvergeßlich geblieben. In verschiedenen Fächern war ich überhaupt sehr gut, aber es war immer beschämend für mich, als Muster dazustehen, und ich bemühte mich oft förmlich, schlechte Resultate zu erzielen. Mein Instinkt sagte mir, daß mich die Überflügelten hassen könnten, und ich war gerne beliebt. Ich fürchtete mich davor, von den Kameraden gehaßt zu werden, weil ich das für ein Unglück hielt. Es war in unserer Klasse Mode geworden, die Streber zu verachten, deshalb kam es öfters vor, daß sich intelligente und kluge Schüler aus Vorsicht einfach dumm stellten. Dieses Verhalten, wenn es bekannt wurde, galt als musterhaftes Betragen unter uns, und in der Tat, es hatte wohl einen Anstrich von Heroismus, wenn auch in mißverstandenem Sinne. Von Lehrern ausgezeichnet zu werden, war also mit der Gefahr der Mißachtung verbunden. Welch eine seltsame Welt: die Schule. In einer der frühesten Schulklassen hatte ich einen Schulkameraden, einen kleinen Knirps mit Flecken im spitzigen Gesicht, dessen Vater ein herumsaufender Korbflechter war, den alle Leute kannten. Da mußte nun der kleine Kerl immer vor der ganzen höhnenden Klasse das Wort Schnaps aussprechen, was er nicht konnte, da er immer Snaps statt Schnaps sagte, infolge eines armseligen Zungenfehlers. Wie gab uns das zu lachen. Und wenn ich jetzt daran denke: wie roh war doch das. Ein anderer, ein gewisser Bill, ein drolliger kleiner Bursche, kam immer zu spät in die Schulstunde, weil seine Eltern ein Haus in einer einsamen, wilden, weit von der Stadt entfernten Berggegend bewohnten. Dieser Spätling mußte jedes Mal für sein Zuspätkommen die Hand ausstrecken, um einen bissigen, scharf schmerzenden Schlag mit dem Meerrohr darauf zu empfangen. Der Schmerz preßte dem Kleinen jedes Mal Tränen zu den Augen heraus. Welche Spannung rief in uns diese Abstrafung hervor. Ich hebe übrigens hervor, daß ich hier nicht irgend jemand, vielleicht den betreffenden Lehrer, wie man leicht glauben könnte, anklagen will, sondern einfach mitteile, was ich noch weiß aus jenen Zeiten. – Auf dem Berge, im Wald, oberhalb der Stadt, pflegte sich, damals mehr als heutzutage, wie ich annehme, allerhand arbeitsloses, wildes, verkommenes Volk anzusammeln, um aus Schnapsflaschen im Dickicht zu trinken, Karten zu spielen, oder um mit den Weibern zu buhlen, denen das Elend und der Jammer zum Gesicht herausglotzten, und die aus den Fetzen von Kleidern, die sie trugen, erkenntlich waren. Man nannte diese Menschen Vaganten. Eines Sonntag Abends gingen wir, Hedwig, Kaspar und ich mit einem Mädchen, das wir Anna nannten, und das unserem Hause treu war, auf einem schmalen Weg über diesen Berg und sahen, als wir in eine Waldlichtung voll Felsstücken hinaustraten, wie ein Mann eben eines dieser Felsstücke mit seiner Faust ergriff und es einem andern Mann, seinem Gegner, ins Gesicht schleuderte, daß es einen Krach gab und das Blut des Getroffenen, der alsobald zu Boden stürzte, herausspritzte. Der Streit, dessen Ende, da wir sogleich flohen, wir nicht sahen, schien aus Anlaß eines Weibes entstanden zu sein, wenigstens ist mir eine düstere, große Weibsfigur noch immer deutlich vor Augen, die damals gelassen dagestanden ist und dem Streit mit böser Haltung zusah. Ich trug ein tiefes Weh und einen Schauder nach Hause, der mich am Essen verhinderte und noch lange Zeit jene Waldstelle meiden ließ. Es lag etwas Furchtbares, Uranfängliches in diesem Männerkampf. –
Kaspar und ich hatten einen gemeinschaftlichen Freund, Sohn eines Großrates und angesehenen Kaufmanns, den wir wegen seiner Bereitwilligkeit und Unterwürfigkeit gegen unsere Pläne sehr liebten. Zu diesem gingen wir oft in das elterliche, großrätliche Haus, wo uns eine zierliche Dame, seine Mutter, jedes Mal freundlich willkommen hieß. Wir spielten mit unseres Freundes Baukasten und Bleisoldaten stundenlang und unterhielten uns vortrefflich. Kaspar zeichnete sich im Bauen von Festungen und Palästen und im Entwerfen von Schlachtenplänen aus. Unser Freund hing sehr an uns; an Kaspar, wie es mir schien, noch mehr als an mir; und er besuchte auch uns öfters in unserem Hause, wo es freilich nicht ganz so fein war. Hedwig hatte ihn sehr lieb. Seine Mutter war von der unsrigen ganz verschieden, die Zimmer waren glänzender als bei uns, der Ton war ein anderer, ich meine: der Ton der Umgangssprache; aber bei uns war es in allem lebhafter. Damals lebte in unserer Stadt eine reiche Dame für sich allein in einem herrlichen Garten, natürlich in einem Haus, aber das Haus sah man nicht vor lauter Efeu und Bäumen und Springbrunnen, die es verdeckten. Diese Dame hatte drei Töchter, schöne, blasse Mädchen, von denen es hieß, daß sie alle zwei Wochen ein neues Kleid anzögen. Die Kleider behielten sie nicht im Schrank, sondern ließen sie durch besondere Botenläufer unter den Leuten der Stadt verkaufen. Hedwig besaß einmal ein Seidenkleid und ein paar Schuhe von einem dieser Mädchen, und diese schon getragenen Sachen flößten mir, als ich sie betrachtete und anrührte, einen geheimen Abscheu ein, vermischt mit dem höchsten Interesse und einer Teilnahme, wegen der ich oft ausgelacht wurde. Die Dame saß immer in ihrem Hause oder höchstens einmal im Theater, wo sie erschreckend weiß aussah in ihrer dunkelroten Loge. Das mittlere von den drei Mädchen war wohl das schönste. Ich sah sie in meiner Phantasie immer zu Pferde; sie hatte so ein Gesicht, das dazu geschaffen war, vom Rücken eines tanzenden Pferdes auf eine gaffende Volksmenge herabzublicken und alle die Augen niederschlagen zu machen. Alle drei Mädchen sind jetzt wohl längst verheiratet. – Einmal hatten wir eine Feuersbrunst, und zwar nicht in der Stadt selber, sondern in einem Nachbardorfe. Der ganze Himmel in der Runde war gerötet von den Flammen, es war eine eisige Winternacht. Die Menschen liefen auf dem gefrorenen, knirschenden Schnee, auch ich und Kaspar; denn unsere Mutter schickte uns weg, um zu erfahren, wo es brenne. Wir kamen zu den Flammen, aber es langweilte uns, so lang in das brennende Gebälk zu schauen, auch froren wir, und so liefen wir bald wieder nach Hause, wo uns Mutter mit all der Strenge einer Geängstigten empfing. Meine Mutter war damals schon krank. Kaspar trat ein wenig später aus der Schule aus, in der er keinen Erfolg mehr hatte. Ich hatte noch ein Jahr vor mir, aber eine gewisse Melancholie ergriff mich und hieß mich auf die Dinge der Schule mit Bitterkeit herabsehen. Ich sah das nahe Ende kommen und den nahen Anfang von etwas Neuem. Was es sein sollte, darüber konnte ich mir nur allerhand unkluge Gedanken machen. Ich sah meinen Bruder öfters, mit Paketen beladen, in seinem Geschäftsleben, und dachte darüber nach, warum er so niedergeschlagen dabei aussah und sein Gesicht zur Erde niederhing. Es mußte nicht schön sein, dieses Neue, wenn man dabei die Augen nicht aufschlagen durfte. Aber Kaspar hatte damals sich auf seinen Beruf zu besinnen angefangen, er schien immer zu träumen und war von einer sonderbaren Gelassenheit, was dem Vater nichts weniger als gefiel. Wir bewohnten jetzt ein geringeres Vorstadthaus, dessen Anblick ein erkältender war. Die Wohnung war Mutter nicht recht. Sie hatte überhaupt eine eigentümliche Krankheit, sich von ihrer jeweiligen Umgebung verletzt zu fühlen. Sie mochte von vornehmen kleinen Häusern in Gärten schwärmen. Was kann ich wissen. Sie war eine sehr unglückliche Frau. Wenn wir zum Beispiel alle beim Essen saßen, ziemlich schweigsam, wie wir es gewohnt waren, erfaßte sie plötzlich eine Gabel oder ein Messer und warf es von sich weg, über den Tisch hinaus, so daß alle mit den Köpfen zur Seite bogen; wenn man sie dann beruhigen wollte, kränkte es sie, und wenn man ihr Vorwürfe machte, noch viel mehr. Vater hatte einen schweren Stand mit der Kranken. Wir Kinder erinnerten uns mit Wehmut und Schmerz der Zeiten, wo sie eine Frau war, der alles mit einem Gemisch von Hochachtung und Zärtlichkeit begegnete, wo, wenn sie die helle Stimme ansetzte und einen rief, man sich beglückt fühlte zu ihr hinzueilen. Alle Damen der Stadt erwiesen ihr Artigkeiten, die sie mit Grazie und Bescheidenheit abzulehnen wußte; diese entschwundene Zeit erschien mir schon damals wie ein zaubervolles Märchen voll entzückender Düfte und Bilder. Ich lernte also schon früh, mich schönen Erinnerungen mit Leidenschaft hinzugeben. Ich sah wieder das hohe Haus, wo die Eltern ein reizendes Galanteriewarengeschäft hatten, wo viele Menschen zu uns hineinkamen, um zu kaufen, wo wir Kinder eine helle, große Kinderstube besaßen, in welche die Sonne mit einer Art Vorliebe hineinzuscheinen schien. Dicht neben unserem hohen Hause kauerte ein kleines, schräges, zerdrücktes, uraltes Haus mit einem spitzigen Giebeldach, darin wohnte eine Witwe. Sie hatte einen Hutladen, einen Sohn und eine Verwandte und, ich glaube, noch einen Hund, wenn ich mich recht erinnere. Wenn man zu ihr in den Laden trat, begrüßte sie einen so freundlich, daß man das bloße dieser Dame Gegenüberstehen als einen Wohlgenuß empfand. Sie preßte einem dann verschiedene Hüte auf den Kopf, führte einen vor den Spiegel und lächelte dazu. Ihre Hüte rochen alle so wunderbar, daß man wie gebannt dastehen mußte. Sie war eine gute Freundin meiner Mutter. Dicht daneben, das heißt, dicht neben dem Hutladen glitzerte und lockte eine schneeweiße Konditorei, eine Zuckerbäckerei. Die Zuckerbäckersfrau schien uns ein Engel zu sein, nicht eine Frau. Sie hatte das zarteste, ovalste Gesicht, das man sich denken kann; die Güte und die Reinheit schienen diesem Gesicht die Formen gegeben zu haben. Ein Lächeln, das einen zum frommen Kinde machte, wenn es einen traf, bezauberte und versüßte noch ihre süßen Züge. Die ganze Frau schien wie geschaffen dazu, Süßigkeiten zu verkaufen, Sachen und Sächelchen, die man nur mit Nadelspitzenfingern anrühren durfte, wenn man ihnen den köstlichen Geschmack nicht rauben wollte. Das war auch eine Freundin meiner Mutter. Sie hatte viele Freundinnen.« –
Simon hörte auf zu schreiben. Er ging zu einer Photographie seiner Mutter, die an der schmutzigen Wand seines Zimmers hing, und preßte, indem er sich auf die Fußspitzen erhob, einen Kuß darauf. Dann zerriß er das Geschriebene, weder mit Unmut noch mit vielem Besinnen, einfach deshalb, weil es keinen Wert mehr für ihn besaß. Dann ging er zu Rosa, in die Vorstadt hinaus und sagte zu ihr: »Ich werde nun vielleicht bald eine Anstellung in einer kleinen Landstadt bekommen, was für mich jetzt das Schönste wäre, was es geben könnte. Eine kleine Stadt ist doch etwas Entzückendes. Man hat da sein altes, behagliches Zimmer, das man für merkwürdig wenig Geld bekommt. Vom Geschäft ins Zimmer zu gelangen, wäre mit ein paar Schritten leicht abgetan. Alle Leute grüßen einen in der Gasse und denken sich, wer der junge Herr wohl sein könne. Diejenigen Weiber, die Töchter haben, geben einem schon im Geiste eine ihrer Töchter zur Frau. Das wird die jüngste Tochter sein mit den Ringellocken und den herabhängenden, schweren Ohrringen an den kleinen Ohren. Im Geschäft würde man sich langsam unentbehrlich machen, und der Chef wäre glücklich, eine solche Erwerbung wie mich gemacht zu haben. Abends nach Hause gekommen, säße man im geheizten Zimmer, und die Bilder an den Wänden würden angesehen, von denen eines vielleicht die schöne Kaiserin Eugenie darstellen dürfte und ein anderes eine Revolution. Die Tochter des Hauses käme vielleicht herein und brächte mir Blumen, warum nicht? Ist dies alles in einer Kleinstadt nicht möglich, wo die Menschen einander so zärtlich begegnen? Eines Tages aber, in der warmen, hellen Mittagspause, würde dasselbe Mädchen schüchtern an meiner Tür anklopfen, einer Tür, nebenbei gesagt, die aus der Rokokozeit herstammte, würde sie aufmachen und zu mir in das Zimmer treten und zu mir, unter einer unendlich feinen Seitenbeugung des schönen Kopfes, sagen: »Wie sind Sie immer so still, Simon. Sie sind so bescheiden und machen gar keine Ansprüche. Sie sagen nicht: mir fehlt dieses oder jenes. Sie lassen alles so gehen. Ich fürchte, Sie sind unzufrieden.« Ich würde lachen und sie beruhigen. Dann plötzlich, wie von seltsamen Gefühlen ergriffen, könnte es ihr einfallen zu sagen: »Wie still und schön die Blumen sind, da auf dem Tische. Sie sehen aus, als ob sie Augen hätten und es ist mir, als ob sie lächelten.« Ich würde überrascht sein, so etwas aus dem Munde einer Kleinstädterin zu hören. Dann würde ich es plötzlich natürlich finden, in langsamen Schritten zu der Dastehenden und Zaudernden hinzugehen, meinen Arm um ihre Figur zu legen und das Mädchen zu küssen. Sie würde es geschehen lassen, aber nicht so, daß man versucht wäre, auf unschöne Gedanken zu verfallen. Sie würde die Augen tief niederschlagen und ich hörte das Pochen ihres Herzens, das Wogen ihren schönen, runden Brust. Ich würde sie bitten, mir ihre Augen zu zeigen, und daraufhin würde sie sie aufmachen und ich würde in den Himmel ihrer geöffneten, fragenden Augen hineinschauen. Das würde ein langes Bitten und Schauen sein. Erst wäre es ein flehender Blick von ihr, dann würde es mich reizen, sie ebenso anzusehen, dann würde ich natürlich lachen müssen und sie würde mir trotzdem vertrauen. Wie wunderbar könnte das sein, und das kann sein in einer kleinen Stadt, wo die Menschen mit Blicken so viel sagen. Ich würde sie wieder küssen auf ihren seltsam gebogenen und geschweiften Mund und ihr schmeicheln, so, daß sie meinen Schmeicheleien glauben müßte und es also dann wieder keine bloßen Schmeicheleien wären, und ihr sagen, daß ich sie als mein Weib betrachtete, worauf sie, wieder den Kopf so wundervoll zur Seite biegend, ja sagen würde. Denn was könnte sie mir entgegnen, wenn ich ihr den Mund zudrückte, wie einem Kind, wenn ich sie nun mit Küssen bedeckte, die Herrliche, die ein Lächeln des Übermutes und des Siegesgefühles nicht zu unterdrücken vermöchte? Freilich, Siegerin wäre sie und ich ihr Besiegter, das würde sich ja bald zeigen, denn ich würde ihr Mann werden und ihr damit mein ganzes Leben, meine Freiheit und alle Gelüste, die Welt zu sehen, opfern und schenken. Nun würde ich sie immer betrachten und sie immer schöner finden. Bis zu unserer Vermählung würde ich wie ein Schelm hinter ihren Reizen, die sie hinter sich fallen ließe, her sein. Ich würde ihr zusehen, wenn sie auf den Zimmerboden hinkniete, abends, um im Ofen Feuer anzufachen. Ich würde viel lachen, wie ein Blödsinniger, nur um nicht immer allzu feine Worte des Zärtlichseins zu gebrauchen, und vielleicht würde ich sie öfters auch roh behandeln, um die Züge des Schmerzes aus ihrem Gesicht abzufangen. Nach solcher Handlungsweise käme es mir nicht darauf an, heimlich, wenn sie es nicht sähe, vor ihrem Bette hinzuknieen und die Abwesende mit heißem Herzen anzubeten. Ich würde mich vielleicht sogar dazu versteigen, ihren Schuh, der doch mit Wichse bedeckt wäre, an meinen Mund zu pressen; denn der Gegenstand, in den sie ihre kleinen weißen Füße steckte, würde für das Gefühl der Anbetung vollkommen genügen, zum Beten braucht es ja nicht viel. Ich stiege öfters auf die nahen, hohen Felsenberge hinauf, sorglos mich hinaufziehend an kleinen Baumstämmchen, über Abgründe hinauf, und würde mich oben über einen Felssturz auf die gelbliche Weide hinlegen und mich darauf besinnen, wo ich denn eigentlich wäre, und mich fragen, ob mir ein solches Leben in der Enge mit einer allerdings geliebten, aber doch alles heischenden Frau wohl genügen würde. Ich schüttelte auf solche Fragen nur mit dem Kopf und träumte mit herrlich gesunden Sinnen in die Ebene hinab, wo die kleine Stadt ausgebreitet läge. Vielleicht würde ich eine halbe Stunde lang weinen, warum nicht, um meine Sehnsucht zu versöhnen und würde wieder ruhig und glücklich daliegen, bis die Sonne untersänke, dann hinuntergehen und meinem Mädchen die Hand reichen. Es wäre alles beschlossen und hinter mir zugeriegelt, aber ich wäre von Herzen froh über die feste, gebietende Abgeschlossenheit. Alsdann würde ich Hochzeit feiern und so meinem Leben ein neues Leben geben. Das alte würde wie eine schöne Sonne untergehen, und nicht einmal einen Blick würde ich ihm nachwerfen, weil ich das für gefährlich und schwach hielte. Die Zeit verginge, und nun würden wir uns, um für unsere Zärtlichkeit eine Abbildung zu haben, nicht mehr über Blumen beugen, sondern über Kinder und uns entzücken über ihr Lächeln und Fragenstellen. Die Liebe zu unseren Kindern und die tausend Sorgen, die sie heischen würden, machte unsere eigene Liebe sanfter und nur größer, aber stiller. Mich zu fragen, ob mir meine Frau noch gefalle, würde mir niemals einfallen, und mir einzureden, daß ich ein kleines, dürftiges Leben führte, käme mir nie in den Sinn. Ich hätte alles erfahren, was an Erfahrung das Leben gibt und würde gern auf den Gedanken verzichten, der mir allerhand elegante Abenteuer vorhielte und vorspiegelte, die ich versäumt hätte. »Was ist noch ein Versäumnis zu nennen?« würde ich mich ruhig und überlegen fragen. Ich wäre ein fester Mensch geworden, das wäre alles und bliebe alles bis zu meiner Frau Tode, der es vielleicht bestimmt wäre, früher als ich zu sterben. Doch weiter mag ich nicht denken; denn das liegt doch zu fernab im Dunkel der schönen Zukunft. Was sagen Sie dazu? Ich träume jetzt immer so viel, aber Sie müssen wenigstens zugeben, daß ich mit einer gewissen Aufrichtigkeit und mit dem Verlangen träume, ein besserer Mensch zu werden, als ich jetzt bin.«
Rosa lächelte. Sie schwieg eine Weile, indem sie Simon aufmerksam betrachtete und fragte dann:
»Was macht Ihr Herr Bruder, der Maler?«
»Er will nächstens nach Paris gehen.«
Rosa erblaßte, schloß die Augen und atmete schwer. Simon dachte: Also auch sie liebt ihn.
»Sie lieben ihn,« sagte er leise.
Am nächsten Morgen trat Simon in einem kurzen, dunkelblauen Mantel, mit einem zierlichen, unbehülflichen Stöckchen in der Hand, aus dem Hause heraus. Ein dicker, schwerer Nebel empfing ihn und es war noch vollständige Nacht. Nach einer Stunde aber erhellte es sich, als er auf einer Anhöhe stand und auf die große Stadt zu seinen Füßen zurückblickte. Es war kalt, aber die Sonne, die eben jetzt feurig und hellrot über den verschneiten Büschen und Feldern emporstieg, versprach einen wundervollen Tag. Er blieb in den Anblick des immer höher fliegenden roten Balles gebannt und sagte sich, daß die Sonne im Winter noch drei Mal so schön sei, wie eine Sonne mitten im Sommer. Der Schnee brannte bald in dieser eigentümlich hellroten, warmen Farbe, und dieser wärmende Anblick und die wirkliche Kälte dazwischen wirkten belebend und anspornend auf den Wanderer, der sich auch nicht allzu lange mehr aufhalten ließ, sondern tüchtig weiterschritt. Der Weg war derselbe, den Simon damals in der Herbstnacht gegangen war, er hätte ihn jetzt beinahe schlafend gefunden. So lief er den ganzen Tag. Im Mittag spendete die Sonne schöne Wärme auf die Gegend herab, der Schnee wollte schon wieder zerrinnen, und das Grün blickte an einigen Stellen naß hervor. Die rieselnden Quellen verstärkten den Eindruck der Wärme, aber gegen Abend, als der Himmel in dunkelblauer Farbe prangte und der rote Schein der Sonne sich über dem Bergrücken verlor, wurde es auch gleich wieder grimmig kalt. Simon stieg wieder den Berg hinauf, den er schon einmal, aber in wilderer Hast, in der Nacht erklommen hatte; der Schnee knirschte unter seinen Schritten. Die Tannen waren so voll mit Schnee beladen, daß sie ihre starken Äste herrlich zur Erde niederhängen ließen. Ungefähr in der Mitte des Aufstieges sah Simon plötzlich einen jungen Mann mitten im Wege im Schnee daliegen. Es war noch so viel letzte Helle im Wald, daß er den schlafenden Mann ins Auge fassen konnte. Was veranlaßte diesen Menschen, sich hier in der bitteren Kälte und an einer so einsamen Stelle im Tannenwald niederzulegen? Des Mannes breiter Hut lag quer über dessen Gesicht, wie es oft im heißen, schattenlosen Sommer vorkommt, daß ein Liegender und Ausruhender sich auf diese Weise gegen die Sonnenstrahlen schützt, um einschlafen zu können. Das hatte etwas Unheimliches an sich, dieses Gesichtverdecken mitten im Winter, zu einer Zeit, wo es wahrhaftig keine Lust konnte genannt werden, es sich hier im Schnee bequem zu machen. Der Mann lag unbeweglich und schon fing es an, immer dunkler im Walde zu werden. Simon studierte des Mannes Beine, Schuhe, Kleider. Die Kleider waren hellgelb, es war ein Sommeranzug, ein ganz dünner und fadenscheiniger. Simon zog den Hut von des Mannes Gesicht, es war erstarrt und sah schrecklich aus, und jetzt erkannte er auf einmal das Gesicht, es war Sebastians Gesicht, kein Zweifel, das waren Sebastians Züge, das war sein Mund, sein Bart, seine etwas breite, gedrückte Nase, seine Augenbildungen, seine Stirn und seine Haare. Und er war hier erfroren, ohne Zweifel, und er mußte schon etliche Zeit liegen, hier am Wege. Der Schnee zeigte hier keine Fußspuren, es war also denkbar, daß er schon lange liege. Gesicht und Hände waren längst erstarrt, und die Kleider klebten an dem erfrorenen Leib. Sebastian mochte hier, durch große, nicht mehr zu ertragende Müdigkeit, hingesunken sein. Allzukräftig war er nie gewesen. Er ging immer in gebückter Haltung, als ertrüge er die aufrechte nicht, als täte es ihm weh, seinen Rücken und seinen Kopf stramm zu halten. Wenn man ihn ansah, empfand man, daß er dem Leben und seinen kalten Anforderungen nicht gewachsen war. Simon schnitt Tannenäste von einer Tanne und bedeckte den Körper damit, doch zog er vorher noch ein kleines dünnes Heft aus der Rocktasche des Toten, das dort hervorgeschaut hatte. Es schien Gedichte zu enthalten, Simon unterschied die Schriftzeichen nicht mehr. Es war mittlerweile völlige Nacht geworden. Die Sterne funkelten durch die Lücken der Tannen und der Mond schaute in einem schmalen, zierlichen Reifen der Szene zu. »Ich habe keine Zeit,« sagte Simon still vor sich, »ich muß mich beeilen, daß ich die nächste Stadt noch erreiche, ich würde sonst keine Bangigkeit verspüren, noch etwas längere Zeit bei diesem armen Kerl von Toten zu verweilen, der ein Dichter und Schwärmer war. Wie nobel er sich sein Grab ausgesucht hat. Mitten unter herrlichen, grünen, mit Schnee bedeckten Tannen liegt er. Ich will niemanden davon Anzeige erstatten. Die Natur sieht herab auf ihren Toten, die Sterne singen leise ihm zu Häupten, und die Nachtvögel schnarren, das ist die beste Musik für einen, der kein Gehör und kein Gefühl mehr hat. Deine Gedichte, lieber Sebastian, will ich in die Redaktion tragen, wo man sie vielleicht lesen und dem Abdruck übergeben wird, damit von dir wenigstens dein armer, funkelnder, schönklingender Name der Welt erhalten bleibt. Eine prachtvolle Ruhe, dieses Liegen und Erstarren unter den Tannenästen, im Schnee. Das ist das beste, was du tun konntest. Die Menschen sind immer geneigt, derartigen Käuzen, wie du einer warst, weh zu tun und ihre Schmerzen zu verlachen. Grüße die lieben, stillen Toten unter der Erde und brenne nicht zu sehr in den ewigen Flammen des Nichtmehrseins. Du bist anderswo. Du bist sicher an einem herrlichen Ort, du bist jetzt ein reicher Kerl, und es verlohnt sich, die Gedichte eines reichen, vornehmen Kerls herauszugeben. Lebe wohl. Wenn ich Blumen hätte, ich schüttete sie über dich aus. Für einen Dichter hat man nie Blumen genug. Du hattest zu wenig. Du erwartetest welche, aber du hörtest sie nicht über deinem Nacken schwirren, und sie fielen nicht auf dich nieder, wie du geträumt hast. Siehst du, ich träume auch viel, und viele, viele Menschen, denen man es nicht zutrauen würde, träumen, aber du glaubtest, ein Recht zu haben auf das Träumen, während wir anderen nur träumen, wenn wir uns recht elend vorkommen, aber froh sind, es einstellen zu können. Du verachtetest deine Mitmenschen, Sebastian! Aber, Lieber, das darf sich nur ein Starker erlauben, und du warst schwach! Doch ich will nicht dein heiliges Grab gefunden haben, um es zu beschmähen. Was weiß ich, was du gelitten hast. Dein Tod unter den offenen Sternen ist schön, ich werde das lange nicht vergessen können. Ich will Hedwig dein Grab unter diesen edlen Tannen schildern, und ich werde sie damit weinen machen. Die Menschen werden wenigstens noch deine Gedichte lesen, wenn sie mit dir doch einmal nichts anzufangen wußten.« – Simon schritt von dem Toten weg, warf einen letzten Blick auf das Häufchen Tannenäste, unter denen jetzt der Dichter schlief, wandte sich mit einer schnellen Drehung seines schmiegsamen Körpers von dem Bilde ab und lief, was er konnte, im Schnee weiter, den Berg hinauf. Er mußte also zum zweiten Mal den Berg bei Nacht ersteigen, aber dieses Mal schauerten Leben und Tod heiß durch seinen ganzen Körper. Er hätte jubeln mögen in dieser eisigen, sternengeschmückten Nacht. Das Feuer des Lebens trug ihn vom sanften, blassen Bild des Todes stürmisch hinweg. Er spürte keine Beine mehr, nur noch Adern und Sehnen, und diese gehorchten biegsam seinem vorwärtseilenden Willen. Droben auf der freien Bergmatte genoß er den erhabenen Anblick der herrlichen Nacht erst ganz, und er lachte laut auf, wie ein Knabe, der noch nie einen Toten gesehen hat. Was war denn ein Toter? Ei, eine Mahnung ans Leben. Weiter gar nichts. Eine köstliche zurückrufende Erinnerung und zugleich ein Treiben in die ungewisse, schöne Zukunft. Simon spürte, daß seine Zukunft noch recht weit und offen vor ihm liegen mußte, wenn er so ruhig mit Toten umgehen konnte. Es machte ihm eine tiefe Freude, diesen armen, unglücklichen Menschen noch einmal gesehen zu haben und so geheimnisvoll angetroffen zu haben, so schweigend, so beredt, so dunkel und ruhig und so vornehm fertig. Jetzt gab es gottlob über diesen Dichter nichts mehr zu lächeln und zu naserümpfen, bloß noch zu fühlen. – Simon schlief herrlich in einem Gasthausbett, nämlich in demselben Gasthaus, dessen Tanzsaal sein Bruder bemalt hatte. Den andern Tag benutzte er zu frischem Laufen auf beschwerlichen Straßen voll Schnee. Er sah immer einen blauen Himmel über sich, Häuser zu beiden Seiten der Straßen, schöne große Häuser die auf eine wohlhabende und stolze Landbevölkerung schließen ließen, Hügel mit schwarzen, zerzausten Bäumen besetzt, in die der blaue Himmel hineinkroch, und Menschen, die an ihm vorübergingen und solche, die mit ihm die gleiche Richtung liefen, die er aber überholte; denn er lief, während die andern gemächlich gingen. Als es Nacht wurde, ging er durch ein stilles, enges, sonderbares Tal, ganz von Wäldern umschlossen und voll Windungen und seltsamer Ausblicke in erhöhte Dörfer, wo die Nachtlichter brannten und die Menschen spärlich umherliefen. Da ihn nun doch eine ernstliche Müdigkeit zu plagen anfing, kehrte er im nächsten Gasthaus wieder ein. Die Wirtsstube war mit Menschen angefüllt, und die Wirtin sah eher wie eine vornehme Frau aus feinem Haus aus als wie eine Wirtin, die Gäste bediente. Er verlangte schüchtern, was er begehrte, worauf ihn die schöne Frau mit seltsamen Blicken maß. Er aber war so müde, so zerschlagen, daß er nur froh war, als er bald darauf in sein Zimmer geführt wurde, wo er sich mit Wonne in ein eiskaltes Bett legte, um sogleich einzuschlafen. Der dritte Tag brachte ihn in eine schöne, mächtige Stadt, wo er nur ein Geschäft hatte: einen Redakteur ausfindig zu machen, um Sebastians Gedichte abzugeben. Vor dem ihm bezeichneten Hause angekommen, fiel ihm ein, daß es nicht klug wäre, selber hineinzugehen und Gedichte eines Totaufgefundenen abzugeben. Er schrieb daher auf den Umschlag des blauen Heftes den Titel: »Gedichte eines im Tannenwald erfroren aufgefundenen jungen Mannes zur Veröffentlichung, wenn es möglich ist«, und warf das Heft in den großen, plumpen Briefkasten, in den es hinunterprallte. Dieses getan machte sich Simon neuerdings auf den Weg. Das Wetter war milder geworden, Schnee wirbelte in großen, nassen Flocken auf die Straßen, zu denen hinaus es ihn drängte. Die unbekannten Menschen dieser Stadt sahen ihn so sonderbar groß an, daß er beinahe glauben mußte, sie kennten ihn, den völlig Fremden. Bald kam er zur eigentlichen Stadt hinaus in die vornehme Villenvorstadt, und zu dieser auch wieder hinaus, in einen Wald, auf ein Feld, auf ein anderes, wieder in einen kleineren Wald, dann in ein Dorf, in ein zweites und drittes, bis es Nacht wurde.
In dem kleinen Dorfe schneite es am Morgen. Die Schulkinder kamen alle mit nassen, verschneiten Schuhen, Hosen, Röcken und Köpfen und Kappen in die Schule. Sie brachten Schneeduft in die Schulstube und allerhand Geröll von den schmutzigen, aufgeweichten Wegen. Die Schar der Kleinen war infolge des Schneefalles zerstreut und angenehm aufgeregt, zu Aufmerksamsein wenig geneigt, worüber die Lehrerin ein wenig unmutig wurde. Sie wollte eben mit Religion beginnen, als sie einen dunklen, schlanken, beweglichen, gehenden Fleck vor dem Fenster gewahrte, einen Fleck, den kein Bauer hätte machen können, denn er war zu zierlich und beweglich. Es flog nur so an der Fensterreihe vorüber, und auf einmal sahen die Kinder ihre Lehrerin, alles vergessend, zur Stube hinauseilen. Hedwig trat nur zur Schulstubentür hinaus, um ihrem Bruder, der dicht davor stand, in die Arme zu fliegen. Sie weinte und küßte Simon und führte ihn in eines von den zwei Zimmern, die ihr zur Verfügung standen. »Du kommst unerwartet, aber es ist gut, daß du kommst,« sagte sie, »lege deine Sachen hier ab. Ich muß noch Schule halten, aber ich will die Kinder heute eine Stunde früher nach Hause schicken. Das wird nichts ausmachen. Sie sind heute doch sonst so unaufmerksam, daß ich einen Grund habe, böse zu sein und sie früher abzufertigen.« – Sie ordnete sich ihr Haar, das bei der heftigen Begrüßung ziemlich aus den Fugen geraten war, sagte Auf Wiedersehen zu ihrem Bruder und ging wieder zurück an ihr Geschäft.
Simon fing an, sich auf dem Lande einzurichten. Seine Koffer kamen mit der Post nach, worauf er alle seine Sachen auspackte. Vieles besaß er nicht mehr, ein paar alte Bücher, die er nicht hatte veräußern oder weggeben mögen, Wäsche, einen schwarzen Anzug und einen Knäuel von Kleinigkeiten wie Bindfaden, Seidenreste, Krawatten, Schuhbändel, Kerzenstümpchen, Knöpfe und Fadenteile. Man lieh sich bei der Nachbarsschullehrerin eine alte eiserne Bettlade, dazu eine Strohmatratze, das genügte, um auf dem Lande schlafen zu können. Diese Bettstelle wurde auf einem breiten Schlitten in der Nacht vom nächsten Dorf herbeigeführt. Hedwig und Simon setzten sich auf das sonderbare Fahrzeug; der Sohn der befreundeten Lehrerin, ein strammer Bursche, der eben den Militärdienst verlassen hatte, leitete den Schlitten bergab in die Einsenkung, in der sich das Schulhaus befand. Man lachte viel. Das Bett wurde im zweiten Zimmer aufgeschlagen und mit dem nötigen Bettzeug versehen und so für einen Menschen hergerichtet, der keine zu überspannten Ansprüche an ein Bett machte, was auch Simon keineswegs tat. Hedwig dachte im Anfang eine Weile: »Da kommt er nun zu mir, weil er sonst nirgendswo anders zu leben hat in der weiten Welt. Dafür bin ich ihm gut. Wenn er wüßte, wo schlafen und essen, er würde sich sicher seiner Schwester nicht erinnert haben.« Aber sie verscheuchte diesen Gedanken bald, der nur in einem Anflug von Trotz entstand, der ausgedacht wurde, weil er so kam, nicht, weil man ihn gerne dachte. Simon seinerseits schämte sich ein wenig, die Güte seiner Schwester in solcher Weise zu beanspruchen, aber auch nicht sehr lange; denn die Gewohnheit schluckte diese Empfindung bald auf, er gewöhnte sich daran, ganz einfach! Geld hatte er wirklich keines mehr, aber er ließ sofort, in den ersten Tagen schon, ein Schreiben an alle umliegenden Notare ergehen, mit der Bitte, ihm, einem gewandten Schönschreiber, Arbeiten zuzuweisen. Und was brauchte man auf dem Lande Geld! Viel jedenfalls nicht. Nach und nach sank jede empfindliche Scheidewand zwischen den beiden Bewohnern des Schulhauses, sie lebten, als wenn sie immer miteinander gelebt hätten, und teilten Entbehrung sowie Lustbarkeiten fröhlich miteinander.
Es war Vorfrühling. Man durfte schon mit weniger Zagheit die Fenster offen stehen lassen und brauchte den Ofen nur noch leichter zu heizen. Die Kinder brachten Hedwig ganze Sträuße von Schneeglöckchen mit in die Schule, so daß man in Verlegenheit geriet, wohin sie alle setzen, da nicht genug kleine Gefäße vorhanden waren. Die Ahnung des Frühlings duftete beklemmend in der Dorfluft. In der Sonne gingen schon Menschen spazieren. Simon war den einfachen Leuten bekannt geworden, ganz spurlos, so ganz nebenher, man fragte nicht viel, wer er sei, es hieß, es sei einer der Brüder der Lehrerin, das genügte, um ihm hier Achtung zu verschaffen. Er wird einige Zeit zu Besuch bleiben, dachte man. Simon ging ziemlich abgerissen umher, aber mit einer gewissen leichten, kleidsamen Eleganz, die die Ärmlichkeit der Stoffe, die er trug, hübsch verdeckte. Seine zerrissenen Schuhe machten nicht viel Aufsehen. Simon fand es reizend, auf dem Lande in defekten Schuhen zu gehen; denn darin spürte er eine der hervorragenden Annehmlichkeiten des ländlichen Lebens. Wenn er Geld bekäme, würde er leise daran denken, das Schuhwerk aufbessern zu lassen, nur ganz gemach und leise! Vielleicht würde er vierzehn Tage lang hinzaudern damit; denn was kommt es auf dem Lande auf vierzehn Tage an! In der Stadt mußte man alles schnell tun, aber hier hatte man die schöne Verpflichtung, alles von einem Tag auf den anderen zu verschieben, ja, es verschob sich ganz von selber; denn die Tage kamen so still und ehe man es denken konnte, war der Abend schon wieder da, dem eine innige Nacht folgte, ein wahrer Schlaf von einer Nacht, den der Tag leise wieder aufweckte, sorgsam und zärtlich. Simon liebte auch die meist schmutzigen Dorfwege, die kleinen, die über Geröll führten, und die großen, in denen man im Kot versank, wenn man nicht aufpaßte. Aber das war es ja eben! Man hatte Gelegenheit, aufzupassen, man konnte den Städter herauszeigen, der daran gewöhnt war, mit Sorgfalt und etwas posiertem Schrecken vor dem Schmutz eine Straße zu passieren. Die älteren Dorfweiber konnten denken, das sei ein reinlicher und achtsamer junger Mann und die Mädchen konnten lachen über die weiten Sprünge, mit denen Simon über Gräben und Pfützen hinübersetzte. Der Himmel war vielmals dunkel umwölkt, mit Wolken besetzt, die dick aufgeblasen waren, und köstliche Stürme wehten oft und schüttelten den Wald und rasten über das Moos, wo die Leute arbeiteten, die Erde stachen und die Pferde geduldig daneben standen. Oft auch lächelte der Himmel, daß alle Menschen, die es sahen, augenblicklich mitlächeln mußten. Hedwigs Gesicht nahm einen frohlockenden Ausdruck an, der Lehrer, der im oberen Stock wohnte, steckte seine Brille neugierig zum Fenster hinaus und genoß auf seine Weise das Entzücken eines freundlichen Himmels. Simon hatte sich in einem kleinen Laden eine billige Pfeife und dazu Tabak gekauft. Es erschien ihm schön und angemessen, auf dem Lande nur Pfeife zu rauchen, denn eine Pfeife konnte man stopfen, und dieses Stopfen war eine Bewegung, die zum offenen Feld, zum Wald paßte, wo er beinahe den ganzen hellen Tag verbrachte. Am warmen Mittag lag er im hellgelben Gras unter dem herrlichen sanften Himmel, am Flußufer hingestreckt und durfte nicht nur, sondern mußte sogar träumen. Aber er träumte von nichts Weitem, Entfernterem und Schönerem, sondern er sann und träumte glücklich in seine Umgebung hinein; denn er wußte von nichts Schönerem. Hedwig, die Nahe, war der Gegenstand seiner Träume. Er hatte die ganze übrige Welt vergessen und der Pfeifentabak, den er rauchte, führte ihn nur wieder ins Dorf, zu dem Schulhause, zu Hedwig. Er dachte von ihr: »Sie fährt mit einem in einem Nachen, der sie entführt hat. Der See ist klein wie ein Parkteich. Sie sieht immer in die großen, schwarzen, düsteren Augen des Mannes, der unbeweglich im Nachen sitzt, und denkt: »Wie doch seine Augen ins Wasser blicken. Mich sieht er nicht an. Aber das ganze, weite Wasser blickt mich mit seinen Augen an!« Der Mann hat einen struppigen Bart, wie die Räuber Bärte zu tragen pflegen. Dieser Mann kann galant sein, wie keiner. Er kann die Galanterie bis zum Verlust seines Lebens treiben, ohne mit einer Wimper zu zucken und gewiß ohne die Hand aufs Herz zu legen und sich mit seiner Tat zu brüsten. Dieser Mann würde sich nie brüsten. Er hat eine warme, wundervolle Männerstimme, aber er gebraucht sie nie, um eine Artigkeit zu sagen. Nie kommt eine Schmeichelei über seine stolzen Lippen und seine Stimme verdirbt er mit Absicht, daß sie rauh und herzlos töne. Aber das Mädchen weiß, daß er ein grenzenlos gutes Herz hat, und wagt es dennoch nicht, an sein Herz mit einer Bitte anzuschlagen. Eine Saite tönt über das Wasser mit langen Tonwellen. Hedwig meint sterben zu sollen in dieser tönenden Luft. Der Himmel über dem Wasser ist so, wie dieser leichte, wasserfarbene Himmel ist, der jetzt über mir schwebt. Ein schwebender, hängender See da oben, das paßt gut. Die Parkbäume im Bilde entsprechen den hohen, schwankenden Bäumen in dieser Gegend. Sie haben etwas Parkartiges, Herrschaftliches. Im Bilde jedoch ist alles gedrängter und zusammengesetzter, und ich schweife jetzt wieder darein hinüber, ohne den stillen Zusammenhang mit mir und dieser Gegend weiter zu würdigen. Der Mann erfaßt nun das Ruder und gibt damit dem Nachen einen rücksichtslosen Stoß. Hedwig fühlt, daß er seiner eigenen Wärme und Liebe in solcher Weise entgegenhandeln könnte. Wenn er Liebe und Zärtlichkeit in sich spürt, ist er beleidigt und er straft sich unbarmherzig, daß er sich erlaubt hat, ein weiches Gefühl in der Brust gehegt zu haben. So unnatürlich stolz ist er. Kein Mann, sondern eine Mischung von Knabe und Riese. Einen Mann verletzt es nicht, sich von Empfindungen überwältigt zu finden, aber einen Knaben, der mehr sein will als ein aufrichtig fühlender Mann, der ein Riese sein will, der nur stark sein will und nicht auch zuweilen schwach. Ein Knabe besitzt Tugenden der Ritterlichkeit, die der vernünftig und reif denkende Mann immer zur Seite wirft als unnütze Beigaben zum Feste der Liebe. Ein Knabe ist weniger feige als ein Mann, weil er weniger reif ist, denn die Reife macht leicht niederträchtig und selbstisch. Man muß nur die harten, bösen Lippen eines Knaben betrachten: der ausgesprochene Trotz und das bildliche Versteifen auf ein einmal sich selber im stillen gegebenes Wort. Ein Knabe hält Wort, ein Mann findet es passender, es zu brechen. Der Knabe findet Schönheit an der Härte des Worthaltens (Mittelalter) und der Mann findet Schönheit darin, ein gegebenes Versprechen in ein neues aufzulösen, das er männlich verspricht zu halten. Er ist der Versprecher, jener ist der Vollstrecker des Wortes. Locken um die jugendliche Stirne und einen Todestrotz auf den geschwungenen Lippen. Augen wie Dolche. Hedwig zittert. Die Parkbäume sind so weich, sie verschwimmen in der hellblauen Luft. Dort unter den Bäumen sitzt der Mann, den sie verachtet. Den, der bei ihr ist und der lieblos ist, muß sie lieben, trotzdem er nichts verspricht. Er hat noch den Mund zu keinem Versprechen aufgetan, hat sich erlaubt, sie zu entführen, ohne ihr zum Ersatz auch nur eine Zärtlichkeit ins Ohr hineinzuflüstern. Flüstern, das ist des andern Sache, der da versteht es nicht. Und wenn er es auch verstünde, so würde er es doch nie tun, oder zu einer Gelegenheit tun, wo andere nicht mehr daran denken, noch etwas zu äußern. Aber sie gibt sich ihm, ohne zu wissen, warum. Sie hat nichts davon, darf sich keine Hoffnungen machen, wie Weiber sie sich gerne machen, sie darf nur auf schonungslose Behandlung gefaßt sein, auf die wilden Launen, womit ein Herrscher mit seinem Besitztum umzugehen pflegt. Aber sie fühlt sich beglückt, wenn er mit einer Stimme zu ihr spricht, barsch und achtlos, als ob sie schon die Seinige wäre. Sie ist es ja, und das weiß dieser Mann. Er achtet nicht mehr, was schon sein ist. Ihre Haare sind ihr aufgegangen, es sind wundervolle Haare, die an ihren schmalen, rötlichen Wangen wie flüssige Stoffe niederstürzen. »Binde sie,« befiehlt er, und sie bemüht sich, seinem Befehl zu gehorchen. Sie gehorcht mit Entzücken, und er sieht es natürlich, auch wenn er die Augen schlösse; denn dann würde er einen Seufzer von ihr hören wie ihn nur Glückliche ausstoßen können, und solche, die dabei hastig eine Arbeit verrichten, die ihren Händen vielleicht beschwerlich fällt, aber ihren Herzen schmeichelt. Sie steigen aus dem Nachen hinaus und treten ans Land. Das Land ist weich und senkt sich leicht unter den Tritten, wie ein Teppich, oder wie mehrere aufeinandergelegte Teppiche. Das Gras ist das gelbliche, dürre vom Vorjahre, wie es hier, wo ich meine Pfeife rauche, zu sehen ist. Da erscheint plötzlich ein Mädchen, ein ganz kleines, blasses, düster blickendes Mädchen auf der Szene. Es scheint eine Prinzessin zu sein; denn ihre Kleider sind prachtvoll und in die Breite gebauscht in einem schweren Bogen, aus dem die Brust wie eine kleine, prangende Knospe herausspringt. Die Kleider sind dunkelrot, sie haben das getrocknete Rot des Blutes. Ihr Gesicht ist von einer durchsichtigen Blässe, es hat die Farbe des Winterabendhimmels in den Gebirgen. »Du kennst mich!« Mit diesen Worten wendet sie sich an den betroffenen Mann, der starr dasteht. »Du wagst es, mich noch anzublicken? Geh, töte dich. Ich befehle es dir!« So spricht sie zu ihm. Der Mann macht Miene zu gehorchen. Was für eine Miene? Ja, eine solche Miene, die man macht, wenn etwas Unabänderliches getan werden soll. Man pflegt dabei eine Grimasse zu schneiden. Das Gesicht zuckt und man muß es zerbeißen und einkneten mit der ganzen Willenskraft. Es will auseinanderreißen. Ein Stück Nase will abfallen. Ähnliches geschieht jedenfalls bei solchen Gelegenheiten. Aber weiter mag ich mit dem tollen Mann nicht Miene machen, mich zu töten; denn es müßte mit einem langen Messer geschehen, und ich glaube, ich habe nur eine Tabakspfeife und kein Messer. Mein Traum hat mir im Anfang gefallen, aber jetzt, merke ich, will er ausarten und das paßt nicht zu Hedwig; denn Hedwig ist sanft und wenn sie leidet, leidet sie auf schönere und stillere Weise. Meinen Mann da im struppigen Bart würde sie schön auslachen, wenn er ihr so frech käme. Die Landschaft, die ich da gemalt habe, war indessen sehr nett, aber auch nur deshalb, weil ich sie in den großen Zügen dieser natürlichen Gegend hier herum entnommen habe. Man darf beim Träumen nie den Boden des Natürlichen aufgeben, auch bei Menschen nicht, denn sonst gelangt man sehr leicht zu dem Punkt, wo man eine der Figuren sprechen läßt: »Geh, töte dich.« Und dann muß einer Miene machen, und das Machen einer Miene ist lächerlich und ist geeignet, den schönsten Traum zu verderben!« –
Simon ging nach Hause. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag gegen Abend zu einer bestimmten Zeit nach Hause zu schlendern, den Blick meist zu der braunen, schwärzlichen Erde gesenkt, um zu Hause den Tee zu kochen, und hatte im Teekochen eine Handfertigkeit bekommen, die stets das richtige Maß traf, denn es kam darauf an, nicht zu wenig und nicht zu viel von der feinen, wohlriechenden Pflanze für einmal zu gebrauchen, das Geschirr stets ziemlich sauber zu halten und es in appetitlicher und anmutiger Art auf den Tisch zu stellen, das Wasser auf der Weingeistflamme nicht zerkochen zu lassen und es mit dem Tee in vorgeschriebener Weise zu vermischen. Für Hedwig war das eine kleine Erleichterung, da sie jetzt nur schnell aus der Schulstube hinaus zum Tee zu eilen brauchte, um wieder zur Arbeit zu gehen. Am Morgen, nach dem Aufstehen, brachte Simon sein Bett in Ordnung, ging dann in die Küche und bereitete den Kakao, und zwar zu Hedwigs Vergnügen sehr schmackhaft; denn er lauerte auch bei dieser Arbeit auf den richtigen Kniff, der immer einer Verrichtung, und wäre sie noch so geringfügig, die nötige Vollendung gibt. Auch übernahm er es, und zwar ganz wie von selbst, ohne jede Vorstudien oder Anstrengungen, den Ofen zu feuern und das Feuer zu unterhalten, Hedwigs Zimmer zu reinigen, wobei ihm die Gewandtheit, mit der er einen langen Besen zu handhaben wußte, sehr zustatten kam. Die Fenster öffnete er, um frische Luft in die Stube hineinzulassen, aber er schloß sie, wenn es ihm Zeit schien, auch gehörig wieder zu, damit er eine warme und zugleich angenehm duftende Stube bekäme. Überall im Zimmer, in kleinen Töpfen, blühten die Blumen weiter, die der Natur draußen entrissen wurden, und verbreiteten Duft in die Enge der vier Wände. Die Fenster hatten einfache aber zierliche Gardinen die zu der Helligkeit und Freundlichkeit im Zimmer vieles beitrugen. Am Boden lagen warme Teppiche, die Hedwig aus zusammengerafften Stoffresten von armen Zuchthäuslern hatte verfertigen lassen, die dergleichen Arbeiten vortrefflich ausführten. Ein Bett stand in einer Ecke und in der andern ein Piano, dazwischen ein altes Sofa mit geblümtem Tuchüberzug, ein genügend großer Tisch davor, Stühle daneben; und dann befand sich im Zimmer noch ein Waschtisch, ein kleiner Schreibtisch mit Schreibunterlage und Büchergestell, das vollbesetzt mit Büchern war, eine kleine umgestürzte Kiste am Boden, mit weichem Tuch überzogen zum Sitzen und Lesen, da manchmal beim Lesen das Bedürfnis entstand, nahe am Boden zu sein und sich orientalisch vorzukommen, weiter ein Nähtischchen mit Nähkörbchen, in denen sich all das wunderliche Zeug befand, das einem Mädchen mit häuslichen Sitten unentbehrlich ist, ein runder merkwürdiger Stein mit Poststempel und Marke versehen, ein Vogel, ein Haufen Briefe und Ansichtskarten und an der Wand ein Horn zum Blasen, ein Becher zum Trinken, ein Stock mit einem großen Hacken, ein Rucksack mit Feldflasche und eine Schwanzfeder von einem Falken. An den Wänden hingen außerdem noch Bilder, die Kaspar gemalt hatte, darunter eine Abendlandschaft mit Wald, ein Dach, von einem Fenster aus gesehen, eine neblige, graue Stadt (besonders schön für Hedwig), eine Flußpartie in üppigen Abendfarben, ein Feld im Sommer, ein Ritter Don Quichote und ein Haus, das so an einen Hügel gedrückt war, daß man wohl mit einem Dichter sprechen konnte: »Da hinten liegt ein Haus.« Auf dem Piano, dessen Deckel mit einem Seidentuch überdeckt war, befand sich eine Büste von Beethoven in grünlichem Bronceton, einige Photographieen und ein kleines, feines Schmuckkästchen ohne Inhalt, eine Erinnerung an die Mutter. Ein Vorhang, der wie ein Bühnenvorhang aussah, trennte beide Zimmer voneinander und beide Schlafenden. Am Abend sah das Zimmer der Lehrerin besonders traulich aus, wenn die Lampe angezündet wurde und die Läden zugedrückt wurden; und am Morgen weckte die Sonne dort eine Schläferin, die nicht gern aus dem Bett herauswollte und doch am Ende mußte.
Die Notare ließen Simon im Stich, keiner ließ etwas von sich hören. Infolgedessen sah er sich gedrängt, auf andere Weise etwas Geld zu verdienen, womit er hoffte, seiner Schwester den guten Willen zu zeigen, auch etwas zum Haushalte mitzusteuern. Er nahm ein Blatt Papier zur Hand und schrieb darauf:
Landleben.
Ich bin hier mit dem Schnee in ein Haus auf dem Lande gekommen, und obschon ich nicht der Herr dieses Hauses bin, noch die Absicht hege, es zu werden, kann ich mich doch als solcher fühlen und bin vielleicht glücklicher als der Besitzer einer Staatswohnung. Nicht einmal das Zimmer, in dem ich wohne, gehört mir, sondern einer sanften, lieben Lehrerin, die mich beherbergt und mir, wenn ich hungrig bin, zu essen gibt. Ich bin gerne ein solcher Kerl, der von anderer Menschen freundlicher Gnade abhängt, weil ich überhaupt gerne von jemandem abhängig bin, um den Jemand lieb zu haben und aufzuhorchen, ob ich seine Güte noch nicht verscherzt habe. Man muß ein eigenes Betragen für diesen Zustand der holdesten aller Unfreiheiten annehmen, ein Benehmen zwischen Frechheit und zarter, leiser, natürlicher Aufmerksamkeit, und ich verstehe das vortrefflich. Man darf vor allen Dingen den Gastgeber nie fühlen lassen, daß man ihm dankbar ist; damit zeigte man eine Schüchternheit und Feigheit, die den Gebenden beleidigen müßte. Im Herzen betet man den Gütigen an, der einen unter das Dach ruft, aber es spräche von wenig Empfindung, wollte man ihm so vorlaut den Dank zeigen, den er gar nicht empfangen will, da er nicht gegeben hat und noch gibt, um irgend etwas Bettelhaftes dafür einzuheimsen. Dank unter gewissen Umständen ist einfach Bettel. Weiter nichts. Und dann noch eines: Auf dem Lande ist der Dank mehr schweigend und still als geschwätzig. Der zum Dank Verpflichtete hat seine Art Betragen, weil er sieht, daß sein Gegenstück ebenfalls so eine Art hat. Feine Geber sind beinahe noch schüchterner als der Nehmer, und sie sind froh, wenn die Nehmer unbefangen hinnehmen, damit sie, die Geber, mit Anstand und ohne viel Federlesens geben können. Meine Lehrerin ist übrigens meine Schwester, aber dieser Umstand hinderte sie nicht daran, mich Tagedieb fortzujagen, wenn sie den Wunsch dazu in sich verspürte. Sie ist tapfer und aufrichtig. Sie hat mich mit einem Gemisch von Liebe und Mißtrauen empfangen, freilich, denn sie mußte denken, daß der Lump von Bruder nur daher gesegelt und gewackelt komme, zu ihr, der seßhaften Schwester, weil er in Gottes Welt nicht mehr wußte, wohin! Das mußte etwas Störendes und Verletzendes für sie haben, der ich, wenn es darauf ankam, monate-, ja jahrelang keinen Brief geschrieben habe. Sie mußte ja denken, daß ich nur komme, um meinen eigenen Leib zu pflegen, für den es wahrhaftig zeitweise nicht schade wäre, wenn er geprügelt würde, und nicht deshalb, um mit Sorgen eine Schwester aufzusuchen. Das hat sich indessen geändert, die Empfindlichkeiten sind gestorben und wir leben jetzt nicht mehr wie Blutsverwandte, sondern wie Kameraden zusammen, die trefflich miteinander auskommen. Ach, auf dem Lande ist es zwei Menschen leicht, gut miteinander auszukommen. Es gibt da eine Art, schneller alle Heimlichkeiten und alles Mißtrauen abzuwerfen und eine Art, sich heller und lustiger zu lieben, als in der gedrängten Stadt voll drängender Menschen und Tagessorgen. Auf dem Lande kennt selbst der Ärmste weniger Sorgen, als der viel weniger Arme in der Stadt; denn dort wird alles am Gerede und Tun der Menschen gemessen, während hier die Sorge ruhig weitersorgt und der Schmerz in Schmerzen seinen natürlichen Untergang findet. In der Stadt geht alles darauf los, reich zu werden, deshalb sind so viele, die sich bitter arm vorkommen, aber auf dem Lande wird, wenigstens zum großen Teil, der Arme nicht durch den immerwährenden Vergleich mit dem Reichtum verletzt. Er kann ruhig mit seiner Armut weiteratmen; denn er hat einen Himmel, zu dem er aufatmen kann. Was ist in der Stadt der Himmel! – Ich selbst besitze nur noch ein kleines Silberstück an Geld, und das muß für die Wäsche reichen. Auch meine Schwester, die vor mir keinerlei Geheimnisse, als ganz unsagbare, hat, gesteht mir, daß ihr Geld ausgegangen sei. Nun, wir sind ganz ruhig. Wir bekommen saftiges Brot und frische Eier und duftenden Kuchen, soviel wir nur wollen. Die Kinder bringen uns das alles, denen es die Eltern für die Lehrerin mitgeben. Auf dem Lande weiß man noch zu geben, daß es denjenigen ehrt, der nimmt. In der Stadt muß man sich nachgerade vor dem Geben fürchten, weil es den Nehmer zu schänden angefangen hat, ich weiß wahrhaftig nicht aus welchen Gründen, vielleicht, weil man in der Stadt unverschämt wird dem gütigen Geber gegenüber. Man hütet sich da, ein edles Mitempfinden für den Darbenden an den Tag zu legen und gibt nur verstohlen, oder unter unschönen Reklamen. Welch eine heillose Schwäche, sich vor den Armen zu fürchten und seinen Reichtum so selbst zu verzehren, statt ihm den Glanz zu verleihen, den eine Königin bekommt, wenn sie ihre Hand einer schlechten Bettlerin entgegenstreckt. Ich halte es für ein Unglück, in der Stadt arm zu sein, weil man nicht bitten darf, da man fühlt, daß das Geben voll Güte nicht an der Tagesordnung ist. Eines bleibt wenigstens wahr: Lieber nicht geben und gar kein Mitleiden mehr fühlen, als es unwillig tun, mit dem Bewußtsein, sich einer Schwäche hingegeben zu haben. Auf dem Lande ist man nicht schwach, wenn man gibt, sondern man will geben und gibt sich manchmal geradezu eine Ehre, geben zu dürfen. Wer sich vor dem Geben hütet, wird sicherlich einmal, wenn der Fall eintritt, daß er niedergeworfen von Schicksalen aller Art wird, und bitten muß, schlecht bitten und ungraziös und verlegen, also wirklich bettelhaft in Empfang nehmen. Wie abscheulich von den mit Gütern Gesegneten, die Armen ignorieren zu wollen. Besser, man peinige sie, zwinge sie zu Fronen, lasse sie Druck und Schläge fühlen, so entsteht doch ein Zusammenhang, eine Wut, ein Herzklopfen und das ist auch eine Art Verbindung. Aber sich in eleganten Häusern, hinter goldenen Gartengittern verkrochen zu halten und sich zu fürchten, den Hauch warmer Menschen zu spüren, keinen Aufwand mehr treiben zu dürfen, aus Furcht, er könnte von den erbitterten Gedrückten wahrgenommen werden, drücken und doch den Mut nicht besitzen, zu zeigen, daß man ein Unterdrücker ist, seine Unterdrückten noch zu fürchten, sich in seinem Reichtum weder wohl zu fühlen, noch andere wohl sein zu lassen, unschöne Waffen zu gebrauchen, die keinen echten Trotz und Mannesmut voraussetzen, Geld zu haben, nur Geld, und doch damit keine Pracht: Das ist gegenwärtig das Bild der Städte, und es scheint mir ein unschönes, der Verbesserung bedürftiges Bild zu sein. Auf dem Lande ist es noch nicht so. Hier weiß der arme Teufel besser, woran er ist; er darf mit einem gesunden Neid zu den Reichen und Wohlhabenden emporblicken und man gestattet ihm das, denn das vermehrt die Würde desjenigen, der von solchen Blicken betroffen wird. Die Sehnsucht, ein eigenes Heim zu besitzen, ist auf dem Lande eine tiefbegründete und reicht bis zu Gott hinauf. Denn hier, unter dem geöffneten weiten Himmel, ist es eine Wonne, ein schönes geräumiges Haus zu besitzen. Das ist in der Stadt nicht so. Dort kann der Emporkömmling neben dem Grafen aus uraltem Geschlecht wohnen, ja, das Geld kann Wohnungen und heilige alte Gebäude wegreißen, wie es will. Wer möchte in der Stadt Besitzer eines Hauses sein? Das ist dort bloß ein Geschäft, nicht ein Stolz und eine Freude. Die Häuser sind bis oben hinauf von den verschiedenartigsten Menschen bewohnt, die alle aneinander vorübergehen, ohne sich zu kennen, ohne den Wunsch zu äußern, sich kennen lernen zu dürfen. Ist das ein Haus? Und lange, lange Straßen sind dort voll solcher Häuser, denen man, um sie richtig zu bezeichnen, einen merkwürdigen neuen Namen geben müßte. Auf dem Lande geschieht im Grunde genommen auch mehr, als in der Stadt; denn dort liest man die Geschehnisse kalt und gelangweilt aus der Zeitung, während sie hier von Mund zu Mund fieberisch und atemlos erzählt werden. Vielleicht kommt auf dem Lande jedes Jahr einmal etwas vor, aber dann war es ein Miterlebnis für alle. Ein Dorf in allen seinen versteckten Winkeln ist überhaupt fast immer belebter und mit Intelligenz gefüllter, als der Städter meist anzunehmen beliebt. Wie manche alte Frau mit Gesichtszügen, die für eines jeden Menschen Großmutter vielleicht passen würden, sitzt nicht hinter der weißen Gardine eines Fensters und könnte Dinge von innigem Zauber erzählen, und manches Dorfkind ist viel weiter vorgeschritten in der Bildung des Gemütes und Verstandes als man gerne voraussetzen möchte. Schon oft ist es vorgekommen, daß ein solches Dorfkind, wenn es in die Stadtschule versetzt wurde, seine neuen Kameradinnen in Erstaunen ob seines gut entwickelten Geistes gesetzt hat. Aber ich will die Stadt nicht schmähen und das Land nicht über Gebühr preisen. Hier sind die Tage nur so schön, daß man leicht die Stadt vergessen lernt. Sie wecken eine stille Sehnsucht in die Weite, aber man möchte doch nicht weitergehen. Es ist ein Gehen in allem und ein Kommen in allem. Wenn die Tage Abschied nehmen, so geben sie die wundervollen Abende dafür, an denen man spazieren geht, auf Wegen, die der Abend scheint entdeckt zu haben, und die man entdeckt für den Abend. Die Häuser treten weiter hervor, und die Fenster glänzen. Selbst wenn es regnet, bleibt es schön; denn da denkt man, es ist gut, daß es regnet. Seit ich hierher gekommen bin, ist es beinahe Frühling geworden und es wird immer mehr Frühling, die Türen und Fenster dürfen offen gelassen werden, wir fangen an, den Garten umzustechen, die andern haben es alle schon getan. Wir sind die Spätesten, und das schickt sich auch für uns. Ein ganzes Fuder schwarzer, feuchter, teurer Erde hat man bei uns abgeladen, diese Erde muß mit der bereits vorhandenen Gartenerde vermengt werden. Das wird eine Arbeit für mich geben, auf die ich mich, so unwahrscheinlich es klingt, wenn ich es sage, freue. Ich bin kein geborner Faulenzer, nein, ich bin nur ein Tagedieb, weil mich verschiedene Amtstuben und Notare nicht beschäftigen wollen, weil sie keine Ahnung davon haben, was ich ihnen nützen könnte. Ich klopfe alle Sonnabende die Teppiche aus, auch eine Arbeit, und bin befleißigt, das Kochen zu lernen, auch ein Streben. Nach dem Essen trockne ich das Geschirr ab und plaudere mit der Lehrerin; denn es gibt vieles zu sagen und zu erörtern zwischen uns und ich plaudere gern mit einer Schwester. Am Morgen kehre ich die Stube aus und trage Pakete auf die Post, komme heim und sinne darüber nach, was weiter zu tun ist. Gewöhnlich ist nichts zu tun und so gehe ich in den Wald hinunter und sitze dort solange unter den Buchen, bis es Zeit ist, oder bis ich glaube, daß es Zeit ist, wieder nach Hause zu gehen. Wenn ich die Menschen arbeiten sehe, so schäme ich mich unwillkürlich, keine Beschäftigung zu haben, aber ich finde, daß ich nicht mehr tun kann, als das eben empfinden. Der Tag kommt mir vor wie mir zugeworfen von einem gütigen Gott, der gern einem Taugenichts etwas hinwirft. Mehr als arbeiten wollen und eine Arbeit ergreifen, sobald ich eine vor mir sehe, verlange ich nicht von mir, da ich sehe, daß es so ganz gut geht. Das paßt nämlich wundervoll zum Leben auf dem Lande. Man darf hier nicht allzuviel tun, sonst verlöre man den Überblick über das schöne Ganze, verlöre den Anstand des Zuschauenden, der nun einmal auch in der Welt sein muß. Der einzige Schmerz wird mir von meiner Schwester bereitet, der ich die Schuld nicht abzahlen kann und die ich mühsam ihre saure Pflicht erfüllen sehe, während ich träume. Die spätesten Zeiten werden mich strafen für diese Schlenderei, wenn es die früheren nicht tun, aber ich glaube, ich bin meinem Gott angenehm so; Gott liebt die Glücklichen, er haßt die Traurigen. Meine Schwester ist niemals lange traurig; denn ich heitere sie fortwährend auf und gebe ihr zu lachen, indem ich mich vor ihr lächerlich mache, worin ich Talent habe. Aber es ist auch nur meine Schwester, die über mich lacht, in deren Augen ich eine freundliche Komik besitze, den andern gegenüber benehme ich mich mit Würde, wenn auch nicht steif. Man hat die Pflicht, nach außen hin sein Dasein durch ein ernsthaftes Betragen zu rechtfertigen, wenn man nicht als Gauner gelten will. Das Landvolk ist sehr empfindlich für das Benehmen junger Leute, die es gerne gesetzt, zuvorkommend und bescheiden sehen will. Ich schließe ab und hoffe, mit diesem Aufsatz einiges Geld verdient zu haben, wenn nicht, so hat es mich doch lebhaft interessiert, ihn zu schreiben, und einige Stunden sind mir über dem Schreiben dahingeflossen. Einige Stunden? Jawohl! Denn auf dem Lande schreibt man langsam, man wird öfters unterbrochen, die Finger sind ungelenkiger geworden und die Gedanken wollen auch in ländlicher Weise denken. Lebt wohl Städter!
Simon trug den Brief zur Post. Am nächsten Sonntag erschien Klaus, der ältere Bruder, zu Besuch. Es war ein regnerischer Tag, es fror einen, zu sehen, wie die kalten Regentropfen die schon erwachten Blüten peitschten. Klaus machte ein ziemlich erstauntes Gesicht, als er bei seiner Schwester den Simon eingerichtet sah, den er irgendwo im Ausland vermutet hatte, doch blieb er so freundlich, als er nur vermochte; denn er mochte den Sonntag nicht verderben. Sie blieben alle drei ziemlich still, standen sich oft gegenüber, ohne zu sprechen, und schienen nach Worten zu suchen. Mit Klaus kam eine gewisse nachdenkliche Befremdung in die Wohnung Hedwigs hinein. Man drehte und fand allerlei, das allerdings nicht am Platze war. Der Gegenstand war natürlich Simons Hiersein. Klaus wollte heute keine Vorwürfe machen, obgleich es ihn wahrlich lebhaft genug dazu antrieb, aber er vermied die entzweiende Bemerkung. Er sah seinen Bruder fragend und bedeutsam an, als wolle er sagen: »Ich bin erstaunt über dein Betragen. Sollte man glauben, daß du ein erwachsener Mensch bist. Ist es ehrenhaft für dich, die Lage deiner Schwester dazu zu benutzen, um den Müßiggänger zu spielen? Wahrlich, keine Ehre, das! Ich würde es dir auch offen heraussagen, aber ich schone Hedwig, die ich dadurch verletzte. Ich will nicht den Sonntag verderben!« Simon verstand ihn schon. Er wußte ganz genau, was dieser Blick, diese steife, unnatürliche Wärme beim Wiedersehen, dieses Schweigen und Verlegensein bedeuteten. Er war nur froh, daß Klaus schwieg; denn er hätte antworten müssen, was ihm längst zuwider war, als Rechtfertigung vorzubringen. Freilich, freilich! Verdammenswert war seine Lage für einen jungen Mann, wie er war, und sein Betragen gewiß nicht zu entschuldigen. Aber schön war es auch, hier zu sein, schön, schön. Plötzlich von Weichheit ergriffen, sagte er zu Klaus: »Ich weiß wohl, was und wie du denkst über mich, aber ich schwöre dir, daß es bald aufhört. Ich glaube, du kennst mich ein wenig. Glaubst du mir?« Klaus reichte ihm die Hand und der Sonntag war gerettet. Es wurde bald zu Mittag gegessen, und Hedwig merkte wohl, heimlich lächelnd, die veränderte Lage zwischen den Brüdern. »Er ist doch gut, Klaus! Klaus ist gut,« dachte sie und sie trug das wohlschmeckende Essen mit größerem Vergnügen auf. Es gab eine herrliche Suppe, auf deren feine Zubereitung sich Hedwig trefflich verstand, dann Schweinefleisch mit Sauerkohl und zuletzt einen mit Speck gespickten Braten. Simon plauderte unbefangen über Welt und Menschen, zog seinen Bruder in Gespräche von der verschiedensten Art und lobte mit komischer Begeisterung wieder das herrliche Essen, was Hedwig jedes Mal, wenn er es tat, so zum Lachen brachte, daß sie ganz fröhlich wurde und alles vergaß, was etwa noch hätte eine Sorge genannt werden können. Am Nachmittag, trotz des trüben Wetters, wurde ein kleinerer Spaziergang gemacht. Das Feld, durch das man langsam ging, war naß, so daß man bald wieder zurückkehrte. Alle waren wieder still am Abend. Simon versuchte eine Zeitung zu lesen, Klaus sprach wie absichtlich von den nebensächlichsten Dingen, worauf Hedwig zerstreut antwortete. Vor dem Abschiednehmen sagte Klaus zu dem Mädchen, das er in die Küche rief, ein paar Worte, auf die der Drinnenstehende nicht horchen mochte. Was mochte es denn sein. Mochte es sein, was es wollte. Dann ging Klaus. Als die beiden, nachdem sie ein Stück Weges den zu Gast Dagewesenen auf den Heimweg begleitet hatten, wieder allein zu Hause saßen, war ihnen unwillkürlich wieder froher ums Herz, wie Schülern, die den gestrengen Inspektor wieder fort wissen. Sie atmeten freier und fühlten sich wieder als die Alten. Hedwig sprach, und eine Besorgnis um dessen, was sie jetzt sprechen wollte, machte ihre Stimme inniger und höher klingen: »Klaus ist doch immer derselbe. Man hat immer eine kleine Angst auszustehen, wenn er da ist. Seine Gegenwart macht einen unwillkürlich zur schuldbewußten Schülerin, die eine Strafrede erwartet, weil sie leichtsinnig gewesen ist. Man ist immer leichtsinnig gewesen in seinen Augen, wenn man noch so ernsthaft meint gehandelt zu haben. Seine Augen sehen ganz anders, sehen die Welt so seltsam besorgniserregend an, als müßte man sich beständig vor irgend etwas fürchten. Er schafft sich selber und andern immer Sorgen. Aus seinem Munde kommt solch ein Ton heraus, der aus tausend rücksichtsvollen Bedenken zusammengesetzt ist, so wenig vertrauensvoll ist er zur Welt und zu den Fäden, die einen an die Welt spannen, ganz von selber. Er sieht aus, als ob er schulmeistern möchte, und sieht doch wieder so genau ein, daß er schulmeistert, ohne es zu wissen: er möchte nicht schulmeistern und tut's doch, wider seinen Willen, aus seiner Natur heraus, wofür man ihn nicht schuldig machen darf. Er ist so über alle Bedenken gut und zart, aber er bedenkt immer, ob es wohl angebracht sei, gut und milde zu sein. Die Strenge steht ihm absolut nicht, und doch glaubt er, mit der Strenge etwas erreichen zu sollen, was er glaubt, mit Güte verfehlt zu haben. Er meint: Güte sei unvorsichtig, und ist doch so gütig. Er verbietet sich, harmlos und gütig zu sein, was er doch am liebsten sein möchte, weil er immer fürchtet, dadurch etwas zu verderben, dadurch in den Augen der Welt als leichtsinnig dazustehen. Er sieht nur Augen, die ihn betrachten, und nicht Augen, die ruhig in seine sehen möchten. Man kann nicht ruhig in seine Augen blicken, weil man fühlt, daß ihn das beunruhigt. Er denkt immer, man denke etwas über ihn, und er möchte heraus haben, was man denkt. Wenn er nicht irgend einen Fehler an einem bemerkt, den er tadeln kann, scheint ihm nicht wohl zu sein. Und er ist doch so gut! Er ist nicht glücklich. Wenn er das wäre, würde er anders reden, im Nu, ich weiß es. Er neidet anderer Glück nicht gerade, aber es reizt ihn doch beständig, das Glück und die Unbefangenheit anderer zu bekritteln, was ihm doch sicher nur weh tut. Er mag nicht von Glück reden hören, ich begreife, warum nicht. Das liegt auf der Hand, und jedes Kind kann es verstehen: Selbst nicht froh, haßt man die Fröhlichkeit anderer. Wie muß ihn das oft schmerzen, ihn, der edel genug ist, um zu fühlen, daß er damit ein Unrecht begeht. Er ist durchaus edel, aber, wie soll ich sagen, ein bißchen verdorben in seinem Innern, ein ganz klein wenig, durch das Zurückgesetztsein und durch das Bemühen, sich nichts aus diesem Zurückgesetztsein zu machen. Ach, freilich ist er zurückgesetzt vom Schicksal, für dessen Launen und Kälten er viel zu wertvoll ist. So möchte ich es sagen; denn er tut mir weh! Zum Beispiel du, Simon! Ach Gott. Für dich empfindet man ganz anders, du ewig lustiger Bruder! Weißt du, über dich denkt man immer: Er sollte Prügel bekommen, so recht scharfe Prügel, das verdiente er! Man erstaunt über dich und begreift nicht, daß du noch nicht in einen Abgrund gefahren bist. Mitleid für dich empfinden, käme einem nie in den Sinn. Man hält dich allgemein für einen sorglosen, frechen, glücklichen Burschen. Ist das wahr?« –
Simon lachte laut auf, und damit war ein Ton angeschlagen, der eine Stunde lang anhielt. Da klopfte es draußen an der Türe. Die beiden erhoben sich, Simon ging, um zu sehen, wer draußen sei. Es war die Nachbarslehrerin. Sie kam verweint dahergelaufen. Ihr Mann, ein roher, rücksichtsloser Mensch, hatte die Frau wieder einmal geprügelt. Man suchte sie zu trösten, und es gelang.
Das Wetter wurde nun immer wärmer und die Erde üppiger, sie war mit einem dicken, blühenden Teppich von Wiesen überzogen, die Felder und Äcker dampften, die Wälder boten in ihrem schönen, frischen, reichen Grün einen entzückenden Anblick dar. Die ganze Natur bot sich dar, zog sich hin, dehnte, krümmte, bäumte sich, sauste und summte und rauschte, duftete und lag still wie ein schöner, farbiger Traum. Das Land war ganz dick, fett, undurchsichtig und satt geworden. Es streckte sich gewissermaßen aus in seiner üppigen Sattheit. Es war grünlich, dunkelbraun, schwarz gefleckt, weiß, gelb und rot und blühte mit einem heißen Atem, kam fast um vor Blühen. Es lag wie eine verschleierte Faulenzerin da, unbeweglich und zuckend mit seinen Gliedern und duftend mit seinen Düften. Die Gärten dufteten in die Straßen und hinaus ins Feld, wo Männer und Frauen arbeiteten; die Fruchtbäume waren ein helles, zwitscherndes Singen, und der nahe, runde, gewölbte Wald war ein Chorgesang von jungen Männern; die hellen Wege kamen kaum durch das Grün hindurch. In Waldlichtungen betrachtete man den weißen, verträumten, trägen Himmel, den man meinte herabsinken zu sehen und jubilieren zu hören, wie Vögel jubilieren, kleine Vögel, die man nie sah und die so natürlich paßten in die Natur. Man bekam Erinnerungen und man mochte sie doch nicht zergliedern und ausdenken, man vermochte es nicht, es tat einem süß weh, aber man war zu träge, um einen Schmerz ganz zu durchfühlen. Man ging so und blieb wieder so stehen und drehte sich so nach allen Seiten um, schaute in die Ferne, hinauf, hinweg, hinab, hinüber und zu Boden und fühlte sich betroffen von all der Mattigkeit dieses Blühens. Das Summen im Wald war nicht das Summen in der nackteren Lichtung, es war anders und erforderte wieder neue Stellungnahme zu neuen Träumereien. Man hatte immer zu kämpfen damit, zu trotzen, leise abzulehnen, zu sinnen und zu schwanken. Denn ein Schwanken war alles, ein Bemühen, und Sich-schwach-Finden. Aber es war süß so, nur süß, ein bißchen schwer, und dann wieder ein bißchen knauserig, dann scheinheilig, dann listig, dann nichts mehr, dann ganz dumm; zuletzt wurde es ganz schwer, noch irgend etwas schön zu finden, man konnte sich gar nicht mehr dazu veranlaßt finden, man saß, ging, schlenderte, trieb, lief und säumte so, man war ein Stück Frühling geworden. Konnte das Summen über sein Summen und Girren und Singen entzückt sein? War es dem Gras gegeben, seine eigenen schönen Schwankungen zu betrachten? Wäre es der Buche möglich gewesen, sich in ihren eigenen Anblick zu vergaffen? Man wurde nicht müde und stumpf, aber man ließ es so sein, so gehen, so hin und her schwanken. Die ganze Natur, so wie sie aussah, war eine Säumerin, ein Harren und Hangen! Die Düfte hingen und die ganze Erde harrte und wartete. Die Farben waren der selige Ausdruck davon. Man konnte etwas Frühmüdes und Ahnungsvolles im blühenden Strauch finden. Es war eine Art Nicht-mehr-weiter-Wollen, ein einziges Lächeln. Die blauen, verhauchten Waldberge klangen wie ferne, ferne Hörner, man fühlte die Landschaft ein wenig englisch, es war wie ein üppiger, englischer Garten, die Üppigkeit und das Weben und das Wogen der Stimmen führte die Sinne auf diese Verwandtschaft. Man dachte, so könnte es nun da und da auch aussehen, wie jetzt hier, die Gegend rief alle andern Gegenden einem ins Herz herbei. Es war komisch und weithintragend, forttragend und herbeibringend: Ein Bringen, wie junge Knaben bringen, ein Darbieten wie Kinder darbieten, ein Gehorchen und Aufhorchen. Man konnte sagen und denken, was man wollte, es blieb immer dasselbe Unausgesprochene, Unausgedachte! Es war leicht und schwer, wonnig und schmerzhaft, dichterisch und natürlich. Man begriff die Dichter, nein, eigentlich begriff man sie nicht, denn man wäre doch, indem man so ging, viel zu träge gewesen, um zu denken, daß man sie begriffe. Man hatte nicht nötig, irgend etwas zu begreifen, es begriff sich nie, und wieder begriff es sich ganz von selbst, indem es sich in das Horchen nach einem Klang auflöste, oder in das Sehen in die Ferne hinein, oder in die Erinnerung, daß es jetzt eigentlich Zeit sei, nach Hause zu gehen und eine, wenn auch ganz geringfügige Pflicht zu erfüllen, denn Pflichten wollen auch im Frühling erfüllt sein.
Die Nächte wurden herrlich. Der Mond verliebte sich in das Weiß der blühenden Gebüsche und Bäume und in die langen Windungen der Straßen, die er blenden machte. In den Brunnen spiegelte er sich und im fließenden Flußwasser. Den Kirchhof mit den stillen Gräbern machte er zu einem weißen Feenort, so daß man die Toten vergaß, die dort begraben lagen. Er drängte sich zwischen das Gewirr der herabfallenden, schmalen, haarähnlichen Äste und machte, daß man auf den Denksteinen die Inschriften lesen konnte. Simon ging um den Kirchhof herum, einige Male, dann schlug er einen weiteren Weg ins erhöhte, flache Feld hinein, drang durch niedriges, erleuchtetes Buschwerk, kam auf eine kleine abstürzende Wiese mitten in den Büschen und setzte sich da auf einen Stein, um darüber nachzudenken, wie lange er wohl dieses Leben des bloßen Beschauens und Sinnens noch weitertreiben werde. Bald mußte es gewiß ein Ende nehmen, denn es konnte nicht weitergehen. Er war ein Mann und gehörte einer strengen Pflichterfüllung an. Es mußte bald wieder gehandelt werden, das wurde ihm klar. Als er nach Hause kam, sagte er das in passenden Worten seiner Schwester. Er solle doch gar nicht an das denken, wenigstens jetzt noch nicht, sagte sie. Gut, erwiderte er, ich will noch nicht daran denken. Es war auch zu verlockend, noch ferner hier zu bleiben. Was wollte er denn eigentlich, und wonach trieb es ihn? Er würde kaum Reisegeld haben, irgendwohin zu reisen, und dort, wohin er gehen sollte, was erwartete ihn dort? Nein, er blieb gerne noch auf eine unbestimmte kleine Zeit da. Wahrscheinlich würde er sich toll zurücksehnen, wenn er fort wäre, und was wäre dann das? Nein, mit dem Sehnen müßte dann natürlich aufgeräumt werden; denn das würde sich ihm nicht ziemen. Aber machte man denn nicht oft Unziemliches? Übrigens, er blieb ja, und weiter wollte er sich den Gedanken die ihn belästigten, nicht hingeben.
So kamen wieder ein paar Tage und schwanden wieder. Die Zeit kam so geräuschlos und entfernte sich, ohne daß man es merkte. Auf diese Art verging sie eigentlich schnell, obgleich sie lange zauderte, ehe sie ging. Die beiden, Simon und Hedwig, schlossen sich jetzt noch lebhafter aneinander. Sie verbrachten plaudernd die Abende bei der Lampe und wurden nie des Redens müde. Sie sprachen während des Essens über das Essen, dessen Einfachheit und Delikatesse sie mit gesuchten Worten priesen, und während der Arbeit über die Arbeit, die sie mit Worten begleiteten, und während des Spazierens über die Freude und den Genuß des Spazierens. Sie vergaßen längst, daß sie nur Geschwister waren, sie kamen sich mehr durch das Schicksal als durch das gleiche Blut verbunden vor und verkehrten miteinander ungefähr wie zwei angeschlossene Gefangene, die sich bemühen, das Leben über der Freundschaft zu vergessen. Sie vertändelten viel Zeit, aber sie wollten sie so vertändelt wissen, weil jedes fühlte, daß der Ernst nur dahinter sich verborgen hielt, und daß jedes sehr wohl ernsthaft zu handeln und zu reden verstände, wenn es nur wollte. Hedwig empfand, daß sie sich ihrem Bruder immer mehr zu erkennen gab, und verhehlte sich den Trost nicht, den diese Empfindung ihr bereitete. Es schmeichelte ihr, daß er es nicht nur für klug und seiner Lage angemessen hielt, mit ihr zusammenzuleben, sondern auch für interessant, und sie dankte ihm dafür, indem sie ihn inniger, als früher, in das Herz schloß. Beide kamen sich so vor, als ob sie jedes für das andere bedeutend genug wären, um mit Stolz miteinander ein Stück Leben zu verbringen. Sie sprachen und dachten viel in Erinnerungen und versprachen sich, alles aufzutischen, was ihnen aus der frühen, entschwundenen Zeit, wo sie beide noch klein waren, noch einfiel. Weißt du noch! So fingen öfters ihre Gespräche an. So versanken sie in die köstlichen Bilder der Vergangenheit und waren immer bemüht, was es auch sein mochte, ihr Gefühl und ihren Verstand daran zu belehren, auch ihr Lachen daran zu wetzen und bei traurigen Anlässen heiter zu bleiben, wie es sich auch ziemte. Die Vergangenheit selbst machte ihnen wiederum die Gegenwart deutlicher und empfindlicher, und diese empfundene Gegenwart war, wie von einem Spiegel verdoppelt und verdreifacht, inhaltsreicher und lebhafter und zeigte auch gerader und sichtbarer den Weg in die Zukunft, die sie sich oft ausmalten, um sich daran auf eine leichte Art zu berauschen. Eine erträumte Zukunft war immer eine schöne, und die Gedanken, die sie dachten, heitere und leichte.
Hedwig sagte eines Abends: »Ich möchte bald meinen, daß ich wie durch eine leichte, aber undurchsichtbare Scheidewand vom Leben getrennt bin. Aber ich kann nicht traurig darüber sein, sondern ich kann nur darüber nachdenken. Andern Mädchen geht es vielleicht ebenso, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich meinen Lebensberuf verfehlt, als ich meinte, einen Beruf für das Leben lernen zu sollen. Wir Mädchen lernen ja doch nur halb, es ist uns nicht um das Lernen zu tun. Wie sonderbar mir das jetzt vorkommt, daß ich Lehrerin geworden bin. Warum bin ich nicht Modistin geworden oder sonst etwas? Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, welche Gefühle mich dazu getrieben haben, einen solchen Beruf zu ergreifen, wie diesen. Was war es denn so Wunderbares, so Verheißungsvolles, das mich damals erfaßte? Glaubte ich gar, eine Wohltäterin zu werden, und glaubte ich, es werden zu müssen, die Verpflichtung, die Sendung spüren zu müssen, es zu werden? Man glaubt so Vieles, wenn man unerfahren ist, und die Erfahrungen machen einen wieder an anderes glauben. Wie merkwürdig. Es liegt eine Härte gegen sich selbst darin, das Leben so ernst aufzufassen, wie ich es aufgefaßt habe. Ich muß es dir sagen, Simon: ich habe es zu ernst und zu heilig aufgefaßt; ich habe nicht daran gedacht, daß ich ein Mädchen bin, als ich unternahm, was nur Männer unternehmen sollten. Niemand hat mir gesagt, daß ich ein Mädchen bin. Niemand hat mir geschmeichelt mit einer solchen Bemerkung. Es hat niemand meiner so gedankenvoll gedacht, als es wäre nötig gewesen, mir eine solche einfache Bemerkung zu machen, auf die ich gehorcht hätte, wenn ich im ersten Augenblick auch die Empörte gespielt hätte. Ich würde darauf gehorcht haben, wenn der Ton aus einem Herzen gekommen wäre. Aber ich hörte nur Worte, oberflächliche und leicht hingesprochene: »Tu das, tu das. Das ist gut, daß du einen Beruf ergreifen willst. Macht dir alle Ehre.« Und so weiter. Eine sonderbare Ehre, ein unglückliches, innerlich armes und sehnsüchtiges Mädchen zu sein, wie jetzt ich mit dieser Ehre von Beruf. Ein Beruf ist eine Last durchs Leben für einen Mann mit starken Schultern und vorwärtsstrebendem Willen, ein Mädchen wie mich erdrückt er. Habe ich Freude an meinem Beruf? Gar keine Spur, und ich bitte dich, erschrick nur nicht über dieses Geständnis, das ich dir mache, weil du einer bist, dem man mit einer Art Lust Geständnisse macht. Du verstehst mich, ich weiß es. Andere würden mich vielleicht ebensogut verstehen, aber nicht gern, aus diesem oder jenem Grunde. Du verstehst gern, weil du keine Gründe hast, über einfache und offene Geständnisse zu erschrecken. Du lebst mein ganzes Leben in dir mit, mit mir, deiner Schwester. Du bist eigentlich zu gut dazu, nur mein Bruder zu sein. Es ist schade, daß du mir nicht mehr sein kannst: Auch das würdest du gerne sein; denn du nickst mit deinem Kopfe. Laß mich weiter erzählen. Wenn man dich als Zuhörer hat, erzählt man gerne. So höre denn weiter, daß ich entschlossen bin, meine Schulkarriere aufzugeben, und zwar bald; denn meine Kräfte halten dies Leben nicht lange mehr aus. Ich glaubte, es wäre ein schönes Leben, Kinder in die Welt hineinzuführen, sie zu unterrichten, ihnen die Seelen für die Tugenden zu öffnen, sie zu überwachen und zu belehren. Es ist ja auch eine ganz schöne Aufgabe, aber sie ist viel zu schwer für mich Schwache; ich bin ihr nicht gewachsen, lange nicht. Ich glaubte, ich wäre es, aber ich sehe das Gegenteil ein: mich zusammensinken sehe ich unter meiner Aufgabe, die mir eine tägliche Erholung sein sollte und die mir nur eine Last ist, die ich als ungebührlich und ungerecht empfinde. Das, was einen niederdrückt, empfindet man als ungerecht. Unrecht, dieses zu empfinden, sollte ich haben? Liegt nicht in meiner Empfindung das Maß für mir zugefügtes Unrecht? Und was kann ich denn dafür, daß das Unrecht in seiner Art unschuldig und süß ist: die Kinder? Die Kinder! Ich kann sie nicht mehr ertragen. Ich freute mich in der ersten Zeit über alle ihre Gesichter, über ihre kleinen Bewegungen, über ihren Eifer und selbst über ihre Fehler. Ich freute mich über den Gedanken, mich dieser jungen, schüchternen und hilflosen Menschenschar gewidmet zu haben. Aber kann ein solcher einziger Gedanke über ein Leben hinwegtäuschen, kann man ein ganzes Leben mit einer Idee hinwegdenken? Wehe, wenn diese Idee und dieses Opfer einem eines Tages gleichgültig werden, wenn man den Gedanken, der einem alles ersetzen soll, nicht mehr mit so inniger Leidenschaft zu denken vermag, als es nötig ist, um den Tausch in der Seele zu rechtfertigen. Wehe, wenn man überhaupt einen Tausch merkt. Dann fängt man an zu grübeln, zu unterscheiden, abzuschätzen, mit Wehmut und Zorn zu vergleichen, und ist unglücklich, so wankelmütig und untreu geworden zu sein, und ist froh, wenn nur immer ein Tag zu Ende ist, um in der Stille weinen zu können. Einmal nur mit einem Hauch treulos, will man mit dem Lebensgedanken, der nur auf vollkommener Hingabe beruht, nichts mehr zu tun haben und sagt sich: Ich tu meine Pflicht, weiter denke ich an nichts mehr! Die Kinder blieben mir immer lieb, sie sind mir immer lieb geblieben. Wem könnten Kinder nicht lieb sein? Aber wenn ich unterrichte, denke ich an anderes, an ferneres und weiteres, als ihre kleinen Seelen sind, und das ist der Verrat, den ich an ihnen begehe, den ich nicht mehr mit ansehen will. Eine Schullehrerin muß in den kleinen Dingen mit ihrer ganzen Liebe untergehen, sonst vermag sie nicht Gewalt auszuüben, und ohne Gewalt bleibt sie wertlos. Vielleicht ist das übertrieben gesprochen, und ich bin auch fest davon überzeugt, daß alle, oder die meisten Menschen, zu denen ich so spräche, diese Sprache übertrieben finden würden. Diese Sprache aber entspricht meiner Auffassung vom Leben; da ist es wohl unmöglich, daß ich anders sprechen könnte. Ich habe es noch nicht gelernt, eine Zufriedenheit, eine Genugtuung, ein Wohlbefinden zu lügen, das ich nicht empfinde, und ich glaube, man irrt sich, wenn man annimmt, daß ich das je lernen werde. Ich bin zu schwach, um täuschen und heucheln zu können, und ich erblicke, so scharf ich auch nachdenke, keine Gründe, die das Vorlügen rechtfertigten. Wenn ich mit dir jetzt so rede, so ist das nur die Ausnutzung eines Augenblickes, nach dem ich mich schon lange gesehnt habe, um meine ganze Schwäche einmal entladen zu können. Es tut einem so wohl, seine Schwäche eingestehen zu dürfen, nach den Monaten der peinigenden Zurückhaltung, die eine Stärke verlangte, deren ich nicht fähig bin. Ich bin der Pflichterfüllung, die mir nicht schmeichelt, auf die Dauer nicht fähig, und ich suche jetzt nach einer Arbeit, die meinem Stolz und meiner Schwäche zusagen wird. Ob es mir gelingen wird? Ich weiß es wahrhaftig nicht, aber ich weiß nur, und das bestimmt, daß ich suchen muß, bis ich die Überzeugung gefunden habe, daß es ein Glück und eine Pflicht gibt, beides eines! Ich will Erzieherin werden und habe bereits einer reichen, italienischen Dame brieflich meine Dienste angeboten, in einem vielleicht zu langen Briefe, in welchem ich ihr geschrieben habe, daß ich imstande sei, zwei Kinder, ein Mädchen und einen Knaben, in allem Wünschenswerten zu unterrichten. Ich habe in dem Briefe, ich weiß nicht, was alles, gesagt, daß ich die Schulstube gerne mit der Kinderstube vertauschen möchte, daß ich die Kinder liebe und achte, daß ich Klavier spielen und schöne Sachen sticken könne und daß ich ein Mädchen sei, dem man nur mit Strenge zu begegnen brauche, um ihm eine Wohltat zu erweisen. Ich habe mich sehr stolz in dem Schreiben ausgedrückt, habe der Dame gesagt, daß ich zu lieben, zu gehorchen verstände, aber nicht zu schmeicheln, daß ich wohl schmeicheln könnte, aber nur dann, wenn ich es selber mir beföhle; daß ich mir meine zukünftige Herrin lieber stolz und streng, als nachgiebig vorstelle, daß es mir Schmerz und Enttäuschung bereiten würde, wenn ich sie so fände, daß man sie, wenn man die Absicht hätte, leicht und frech hintergehen könnte; daß ich nicht die Absicht hätte, zu ihr zu kommen, um bei ihr auszuruhen, sondern daß ich hoffe, Arbeit für mein Herz und auch für meine Hände zu bekommen. Ich habe ihr das Geständnis gemacht, daß ich schon jetzt, in der Vorausahnung, ihre beiden Kinder innig liebe, daß es mir an der nötigen Achtung vor Kindern nicht fehle, um dieselben streng und zugleich hingebungsvoll zu erziehen, daß ich erwarte, daß man mich gewähren lasse, ihr, der Dame, in diesem Sinn zu dienen, daß ich eine zugleich heftige und gelassene Auffassung vom Dienen hätte und daß ich nicht dazu zu bewegen wäre, von meiner Auffassung abzuweichen. Zu glattem und speichelleckerischem Dienst sei ich nicht zu gebrauchen, ebensowenig hätte ich das Talent, auf eine unzarte, unstolze Weise zuvorkommend zu sein. Daß ich aber auf eine milde Behandlung zu Gunsten einer kalten und strengen, wenn es nur zugleich keine beleidigende sei, gern verzichtete, daß ich meinen Stand sehr wohl und zu jeder Zeit von dem ihrigen abzumessen verstände, daß ich keine Gerechtigkeit aber Stolz verlange, der ihr verbieten würde, mir ungerecht zu begegnen und daß ich in meiner Seele entzückt wäre, wenn sie mir, wenn auch nur einmal im Jahr, ein Zeichen gütiger Zufriedenheit gäbe, das ich mehr zu schätzen wüßte als Vertraulichkeit, die für mich erniedrigend und keine Gnade wäre, daß ich hoffe, eine Dame zu finden, an der ich emporblicken könne, um zu lernen, wie man sich in allen Fällen zu benehmen habe und daß sie nicht zu fürchten brauche, in mir eine Schwätzerin in ihren Dienst zu nehmen, der es ein Vergnügen wäre, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Ich sagte ihr, daß ich nicht imstande sei, zu sagen, wie gern ich sie bewundern und ihr gehorchen möchte und ihr zeigen möchte, in welcher Weise ich es verstünde, ihr niemals lästig zu fallen. Ich sprach dann die Befürchtung und zugleich die Hoffnung aus, daß ich die Sprache ihres Landes, obwohl ich sie noch gar nicht kenne, doch sicher bald lernen würde, wenn man mir nur zeigte, wie ich mich dabei zu verhalten habe. Sonst wisse ich nichts, was mich nicht dazu berechtige, in ihr Haus zu treten, sagte ich zum Schluß, als vielleicht die Schüchternheit, die meinem Auftreten noch anklebe, die ich aber zu überwinden hoffe; das Linkische und Unbeholfene sei sonst nicht meine Natur – –«
»Hast du den Brief schon abgeschickt?« fragte Simon.
»Ja,« fuhr Hedwig fort »was hätte mich daran sollen verhindern können. Ich werde vielleicht bald von hier fortgehen, und die Abreise macht mir Kummer; denn ich verlasse viel und werde vielleicht nichts dafür bekommen, das mich das Weggeworfene und im Stich Gelassene vergessen ließe. Trotzdem bin ich fest entschlossen wegzugehen; denn ich mag nicht mehr allein sein mit meinen Träumen. Auch du gehst ja bald fort, und was sollte ich dann noch hier? Du lassest mich wie einen Brocken, wie einen schlecht gewordenen Gegenstand zurück, oder vielmehr so: der ganze Ort, das Dorf, alles hier ist dann der Brocken, der verlassene, unbeachtete und weggeworfene Gegenstand, und ich dann noch mitten drin? Nein, ich habe mich zu sehr daran gewöhnt, das Leben, das wir hier führen, mit Hilfe deiner Augen anzusehen, es schön zu finden, so lange du es schön fandest; und du fandest es schön, und so fand ich es auch noch schön. Aber weiter würde ich es nicht mehr schön und groß genug für mich finden, ich würde es verachten, weil es eng und stumpf wäre, und es wäre auch eng und stumpf durch meine gleichgültige Verachtung. Ich kann nicht leben und mein Leben verachten. Ich muß mir ein Leben suchen, ein neues, und wenn das ganze Leben auch nur in einem einzigen Suchen nach Leben bestehen sollte. Was ist das: geachtet zu sein, gegen das andere: glücklich zu sein und den Stolz des Herzens befriedigt zu haben. Auch unglücklich zu sein ist noch schöner als geachtet zu sein. Ich bin unglücklich, trotz der Achtung, die ich genieße; ich verdiene vor mir diese Achtung also nicht; denn in meinen Augen ist nur das Glück achtenswert. Infolgedessen muß ich versuchen, ob es möglich ist, glücklich zu sein, ohne Achtung zu beanspruchen. Vielleicht gibt es ein Glück dieser Art für mich und eine Achtung, die man der Liebe und der Sehnsucht zollt, nicht der Klugheit. Ich will nicht deshalb unglücklich sein, weil mir der Mut fehlte, mir einzugestehen, daß man unglücklich werden kann, weil man versuchte, glücklich zu werden. Solches Unglück ist achtenswert, das andere nicht; denn Mangel an Mut kann man nicht achten. Wie kann ich länger zusehn, daß ich mich zu einem solchen Leben verdamme, das nur Achtung einbringt und nur Achtung von Andern, die einen immer so haben wollen, wie es ihnen am besten paßt! Warum soll es das? Und warum muß man die Erfahrung machen, daß das, was es einem eingebracht hat, zum Schluß nichts wert ist? Da hat man dann gesorgt und gehütet und gewartet und ist nur genarrt worden. Es ist bitter unklug, auf etwas warten zu wollen; es kommt nicht zu uns, wenn wir nicht hingehen und es uns holen. Freilich, es wird einem so viel Furcht eingejagt von Fürchtlingen, die um einen besorgt scheinen. Ich hasse sie jetzt beinahe, die den Kopf schütteln, sobald man nur etwas Mutiges sagt. Wie würden die sich erst betragen, wenn sie hörten, daß man das Mutheischende zur Ausführung gebracht hat. Wie diese vielen Ratgeber schwinden vor der Herzensgewalt einer frei vollbrachten Tat! Und wie sie einen knechten mit ihrer süßlichen Liebe, wenn man diesen Mut nicht findet und sich ihnen ausliefert. Man wird mich hier mit vielem Bedauern wegziehen sehen und es nicht verstehen wollen, warum ich einen so angenehmen und ersprießlichen Platz verlasse; und auch ich verlasse das Land mit einem Gefühl, das mich noch immer überreden möchte, hier zu bleiben. Ich habe geträumt, Bäuerin zu werden, einem Mann anzugehören, einem einfachen und zarten Menschen, ein Heim zu besitzen mit einem Stück Land und Stück Garten, wozu ein Stück Himmel gehört hätte, zu bauen und zu pflanzen, keine weitere Liebe als Achtung zu verlangen und das Entzücken zu haben, meine Kinder aufwachsen zu sehen, womit ich mich für allen Verlust einer tieferen Liebe entschädigt gefunden hätte. Der Himmel würde die Erde berührt haben, ein Tag hätte den andern in die Zeiten hinuntergerollt, und ich wäre unter Sorgen eine alte Frau geworden, die an sonnigen Sonntagen unter der Haustüre gestanden und die Vorübergehenden beinahe schon verständnislos angeblickt hätte. Ich würde dann nie wieder nach Glück gestrebt und heißere Empfindungen vergessen haben, hätte meinem Manne und seinen Geboten und dem gehorcht, was mir als Pflicht würde vorgeschwebt haben. Und ich hätte gewußt, was einer Bäuerin Pflicht wäre. Meine Träume wären mit den Tagen wie Abende eingeschlafen und würden nie mehr wieder etwas gefordert haben. Ich würde zufrieden und heiter gewesen sein, zufrieden, weil ich nichts anderes gewußt, und heiter, weil es sich nicht geziemt hätte, meinem Manne eine unmutige Stirne mit dunklen Sorgen zu zeigen. Mein Mann würde vielleicht den Takt besessen haben, in der ersten Zeit, da noch vieles heißer gedrängt und gepocht hätte, mich zu schonen und mich sanft für meine kommende Aufgabe zu erziehen, was ich dankbar würde haben geschehen lassen mit mir; dann wäre es auch gegangen, und eines Tages würde ich verwundert an mir die Beobachtung gemacht haben, daß ich innerlich Frauen von heftiger und sehnsüchtiger Gemütsart, das heißt, solche von meinem eigenen früheren Schlag, nicht mehr dulden mochte, weil ich sie für gefährlich und schädlich hielte. Mit einem Wort: ich würde geworden sein wie die andern und würde das Leben verstanden haben, wie die andern es verstehen. Doch das alles blieb nur ein Traum. Einem andern als dir würde ich mich hüten, so etwas zu sagen. Vor dir werden Träumende nicht lächerlich, auch verachtest du niemanden, weil er träumt, denn du verachtest überhaupt niemanden. Ich bin auch sonst gar nicht ein so überspanntes Mädchen. Wie käme ich dazu! Ich habe jetzt nur ein wenig zu viel gesprochen, und wenn ich so spreche, spreche ich leicht etwas zu viel. Man möchte alle seine Gefühle erläutern und kann es doch nie, man redet sich nur in eine Heftigkeit hinein. Komm, gehen wir zu Bett.« –
Sie sagte sanft und ruhig Gute Nacht.
»Ich bin doch froh,« sagte sie am andern Morgen, »daß ich noch hier bin. Wie kann man sich nur so stürmisch von einer Stelle wegwünschen. Als ob es hierauf ankäme! Ich muß beinahe lachen und schäme mich ein wenig, gestern so mitteilsam gewesen zu sein. Und doch bin ich froh; denn einmal muß man sich aussprechen. Wie du gestern mir nur so geduldig zuhören konntest, Simon! So beinahe andächtig! Und doch bin ich auch darüber froh. Am Abend ist man nicht wie am Morgen, nein, so ganz anders, so verschieden im Ausdruck und im Empfinden. Eine einzige Nacht ruhig geschlafen zu haben, das kann, habe ich gehört, einen Menschen ganz verändern. Ich glaube es wohl. Gestern so gesprochen zu haben, kommt mir heute am hellen Morgen wie ein ängstlicher, übertriebener, trauriger Traum vor. Was war es denn nur! Soll man denn die Dinge so reizbar schwernehmen? Denke gar nicht mehr daran! Ich muß gestern müde gewesen sein, so wie ich immer des Abends müde bin, aber jetzt bin ich so leicht, so gesund, so frisch, wie neu geboren. Ich habe ein so gelenkiges Gefühl, als hebe mich jemand empor, als trüge mich etwas, wie man jemand trägt in einer Sänfte. Mach die Fenster auf, indes ich noch im Bett liege. Es ist so schön, im Bett zu liegen, wenn die Fenster aufgemacht werden, so wie du es jetzt tust. Wo nehme ich nur all die Fröhlichkeit her, die mich jetzt ganz einhüllt. Draußen scheint mir die schöne Gegend zu tanzen, die Luft dringt zu mir hinein. Ist es heute Sonntag? Wenn nicht, so ist es ein Tag wie geschaffen zum Sonntag. Siehst du die Geranien? Sie stehen so schön vor dem Fenster. Was wollte ich gestern? Glück? Habe ich es denn nicht schon jetzt? Soll man erst suchen müssen in der unbekannten Ferne, unter den Menschen, die gewiß gar keine Zeit haben, an das Glück zu denken? Es ist gut, wenn man für Vieles nicht Zeit hat, recht gut, denn, hätte man Zeit, so würde man ja sterben vor lauter Anmaßung. Wie hell ist mir jetzt im Kopf. Nicht ein einziger Gedanke mehr, der nicht, wie seine Herrin, nämlich ich, froh und leicht daläge, ganz ebenso wie ich. Willst du mir das Frühstück ans Bett bringen, Simon? Es würde mir Spaß machen, mich von dir bedienen zu lassen, wie wenn ich eine portugiesische Noblesse wäre und du ein Mohrenkind, das meinen leisesten Wink verstände. Natürlich bringst du mir das Verlangte. Warum solltest du dich weigern, mir eine Aufmerksamkeit zu erweisen? Seit wie lange bist du jetzt bei mir? Warte einmal, es war Winter, als du ankamst, der Schnee fiel, ich weiß es noch so gut, und seitdem, wie viele schöne und regnerische Tage sind schon vorbeigegangen. Jetzt wirst du bald gehen; aber mir das Vergnügen stehlen, dich noch ein paar weitere Tage bei mir zu haben, das darfst du nicht. Nach drei Tagen werde ich zu dir sagen: »Bleib noch drei«, und du wirst dich ebensowenig widersetzen können, als jetzt, da du mir das Frühstück an mein Bett bringst. Du bist ein merkwürdig widerstandsloser und skrupelloser Mensch. Was man von dir verlangt, das tust du. Du willst alles, was man will. Ich glaube, man könnte von dir viel Ungebührliches verlangen, ehe du es einem übel nähmest. Man kann sich eines gewissen verächtlichen Gefühles dir gegenüber nicht enthalten. Ein ganz klein wenig verachte ich dich, Simon! Aber ich weiß, es macht dir nichts wenn man so zu dir spricht. Ich halte dich übrigens für einer Heldentat fähig, wenn es dir darauf ankommt. Sieh, ich denke doch ganz gut von dir. Dir gegenüber erlaubt man sich alles. Dein Betragen erlöst anderer Betragen von jeder Art Unfreiheit. Ich habe dir früher Ohrfeigen gegeben, ich habe dich stets der Mutter zur Bestrafung angezeigt, wenn du Übeltaten verrichtetest, jetzt bitte ich dich, mir einen Kuß zu geben, oder so: laß mich dir lieber einen geben. Auf die Stirn, ganz behutsam! So! Ich bin wie eine Heilige heute am Tag gegen gestern am Abend. Ich habe ein Gefühl für kommende Zeiten und lasse nun alles kommen. Lache nur nicht! Es würde mich übrigens freuen, wenn du lachtest; denn das ist für den frühen, blauen Morgen der passendste Laut. Nun bitte ich dich, aus dem Zimmer zu gehen und mir die Freiheit zu lassen, mich anzukleiden.« –
Simon ließ sie allein.
»Ich bin immer daran gewöhnt gewesen,« sagte Hedwig im Laufe des Tages zu Simon, »dich als etwas mir Unterlegenes zu behandeln. Vielleicht halten es andere Menschen mit dir auch so. Du machst wenig den Eindruck der Klugheit, viel mehr den der Liebe, und du weißt, wie man diese Empfindung ungefähr einschätzt. Ich glaube nicht, daß du je mit deinem Tun und Trachten Erfolg haben wirst unter den Menschen, aber du wirst dir sicher auch nie deswegen einen kummervollen Gedanken machen, was dir, so wie ich dich kenne, wenigstens nicht ähnlich sähe. Nur die dich kennen, werden dich tieferer Empfindung und kühner Gedanken für fähig erachten, die andern nicht. Das ist der Schwerpunkt und die Ursache, weshalb du sehr wahrscheinlich im Leben erfolglos bleibst: Man muß dich immer erst kennen lernen, ehe man dir glaubt, und das nimmt Zeit in Anspruch. Der erste Eindruck, der den Erfolg macht, wird dir immer versagen, aber du wirst deswegen deine Ruhe keineswegs verlieren. Dich werden nicht viele Menschen lieben, aber es wird etliche unter ihnen geben, die sich alles von dir versprechen. Das werden einfache und gute Menschen sein, denen du gefallen wirst; denn deine Blödigkeit kann sehr weit gehen. Du hast etwas Blödes an dir, etwas Unzurechnungsfähiges, etwas, wie soll ich sagen, Unbekümmert-Läppisches. Das wird Viele beleidigen, man wird dich frech nennen, und du wirst viele unfeine, früh mit ihrem Urteil über dich fertige Feinde haben, die dir zu schwitzen geben können; doch wird dir das nie Angst einjagen. Andere werden dir immer unzart und du wirst andern immer unverschämt vorkommen; das wird Reibereien geben, sieh dich vor! In einer größeren Gesellschaft von Menschen, wo es doch darauf ankommt, daß man sich zeigt und beliebt macht durch hervorragendes Sprechen, wirst du immer stumm bleiben, weil es dich nicht reizt, den Mund noch aufzutun, wo schon so viele durcheinanderschwatzen. Man wird dich infolgedessen übersehen: du wirst dann trotzig und benimmst dich unschicklich. Dagegen werden es manche Menschen, die dich kennen gelernt haben, für einen Vorzug halten, mit dir allein ein herzliches Gespräch zu führen; denn du verstehst es, zuzuhorchen, und das ist im Gespräch vielleicht wichtiger, als selbst das Sprechen. Man wird gern einem verschwiegenen Menschen, wie dir, Geheimnisse und Seelenangelegenheiten anvertrauen, und du wirst dich im diskreten Verschweigen und Aussprechen meist als Meister erweisen, unbewußt, meine ich, nicht als ob du dir irgendwelche Mühe dabei gäbest. Du sprichst ein bißchen schwerfällig, hast einen etwas plumpen Mund, der sich zuerst öffnet und offen bleibt, ehe du zu sprechen anfängst, als erwartetest du die Worte von außen aus irgend einer Richtung her, daß sie dir in den Mund hineinflögen. Du wirst den meisten Menschen eine uninteressante Erscheinung sein, fade für die Mädchen, unbedeutend für Frauen, absolut unvertrauensvoll und unenergisch für Männer. Ändere dich doch da ein wenig, wenn es in deiner Macht steht! Gib etwas mehr acht auf dich und sei eitler; denn ganz und gar nicht eitel sein, das wirst du bald selbst für einen Fehler halten müssen. Zum Beispiel, Simon, sieh dir doch einmal wieder deine Hosen an: Unten zerfetzt! Allerdings, und ich weiß schon: es sind nur Hosen, aber Hosen sollen ebensogut in Stand gesetzt sein wie Seelen, denn es zeugt doch von Nachlässigkeit, zerrissene und zerfetzte Hosen zu tragen, und die Nachlässigkeit kommt aus der Seele. Du mußt also auch eine zerfetzte Seele haben. Was ich dir noch sagen wollte: Du glaubst doch nicht etwa, daß ich dies im Scherz gesagt habe? Da lacht er. Hältst du mich nicht für ein bißchen erfahrener als dich? Doch nein! Du bist erfahrener, aber indem ich sage, daß dir noch vieles zu erfahren bevorsteht, beweise ich doch sicher auch wiederum Erfahrung. Oder etwa nicht?« –
Sie dachte eine Weile nach, und fuhr dann fort:
»Wenn du nun, was ja bald geschehen muß, von mir fort bist, so schreibe mir nicht. Ich will es nicht. Du sollst nicht meinen, du müßtest verpflichtet sein, mir von deinem ferneren Treiben eine Nachricht zukommen zu lassen. Vernachlässige mich, wie du es früher auch getan hast. Was sollte uns beiden das Schreiben nützen? Ich werde hier weiter leben und es als einen Genuß empfinden, öfters daran zu denken, daß du drei Monate lang da warst. Die Gegend wird mich emportragen und mir dein Bild zeigen. Ich werde alle die Orte aufsuchen, die wir zusammen schön gefunden haben, und ich werde sie noch schöner finden; denn ein Fehler, ein Verlust macht die Dinge noch schöner. Mir und der ganzen Gegend wird etwas fehlen, aber diese Lücke und selbst dieser Fehler werden meinem Leben noch innigere Empfindungen aufdrücken. Ich bin nicht aufgelegt, einen Mangel als einen Druck zu empfinden. Wie käme ich dazu! Im Gegenteil: etwas Befreiendes, Erleichterndes liegt darin. Und dann: Lücken sind dazu da, um mit etwas Neuem gefüllt zu werden. Am Morgen werde ich, wenn ich im Begriffe bin aufzustehen, glauben, deinen Schritt und deinen Kopf und deine Stimme zu vernehmen, und lächeln über die Täuschung. Weißt du was: ich habe die Täuschungen lieb, und du mußt sie ebenfalls lieb haben, ich weiß es. Merkwürdig, wie viel ich zusammenrede in diesen Tagen. Diese Tage! Ich meine, die Tage müßten jetzt selber fühlen, wie kostbar sie mir sind und müssen, aus Rücksicht auf mich, langsamer, gedehnter, träger und verweilerischer auftreten, auch leiser! Sie tun es auch. Ich spüre ihr Nahen wie einen Kuß und ihr dunkles sich Entfernen wie einen Händedruck, wie ein Winken mit einer lieben, bekannten Hand. Die Nächte! Wie viele Nächte hast du bei mir geschlafen, schön geschlafen; denn du verstehst zu schlafen, da drüben in der Kammer, im Strohbett, das bald nun herrenlos und schlaflos sein wird. Die Nächte, die jetzt noch kommen, werden nur schüchtern herankommen zu mir, wie kleine, schuldbewußte Kinder mit gesenkten Augen zum Vater oder zur Mutter kommen. Die Nächte werden weniger still sein, Simon, wenn du fort bist und ich will dir sagen warum: du warst so still in der Nacht, du vermehrtest mit deinem Schlaf die Stille. Wir waren zwei stille, ruhige Menschen während allen diesen Nächten; nun werde ich allein still sein müssen, etwas gezwungen, und es wird weniger still sein; denn ich werde mich öfters im Dunkel im Bett aufrichten und auf irgend etwas aufhorchen. Dann werde ich fühlen, daß es viel weniger still mehr ist. Vielleicht werde ich dann weinen, gar nicht etwa wegen dir, und ich bitte dich, dir nichts darauf einzubilden. Seh einer doch, da will er sich gleich etwas vormachen. Nein, nein, Simon, wegen dir wird niemand weinen. Wenn du fort bist, bist du fort. Das ist alles. Glaubst du, um dich könnte man weinen? Keine Rede. Das darf dir nie in den Sinn kommen. Man spürt, daß du fort bist, man merkt es sich, aber weiter? Etwa Sehnsucht, oder dergleichen? Nach einem Menschen von deinem Schlag empfindet niemand Sehnsucht. Du weckst keine. Kein Herz wird dir je nachzittern! Dir einen Gedanken weihen? I, was! Ja, nachlässig, so wie man eine Nadel aus der Hand fallen läßt, wird man gelegentlich deiner gedenken. Mehr verdienst du auch nicht, und wenn du hundert Jahre alt würdest. Du hast nicht das mindeste Talent, Andenken zu hinterlassen. Du hinterlässest auch gar nichts. Ich wüßte nicht, was du hinterlassen könntest; denn du besitzest ja gar nichts. Du hast keine Ursache, so frech zu lachen, ich spreche im Ernst. Geh mir aus den Augen! Marsch!« –
Während der folgenden Tage war schlechtes, regnerisches Wetter, auch das war wiederum ein Anlaß zum Dableiben. Simon konnte doch nicht bei diesem Wetter seine Reise antreten. Er hätte gekonnt, ja, aber mußte es denn gerade bei schlechtem Wetter sein? So blieb er noch. Einen oder zwei Tage, mehr nicht, dachte er. Er saß beinahe den ganzen Tag in dem leeren, großen Schulzimmer und las in einem Roman, den er noch fertig zu lesen wünschte, ehe er ging. Manchmal lief er zwischen den Reihen von Bänken auf und ab, immer das Buch in der Hand, dessen Inhalt ihn so sehr fesselte, daß er mit seinen Gedanken nicht davon wegkam. Er kam nicht vorwärts mit seinem Lesen; denn immer blieb er stecken in Gedanken. Ich lese noch so lange, als es noch regnet, dachte er; wenn es schönes Wetter wird, muß ich fortfahren, aber nicht mit Lesen, sondern fortfahren, und zwar wirklich.
Hedwig sagte am letzten Tag zu ihm:
»Nun gehst du wohl, nun ist es wohl abgemacht. Leb wohl. Komm ganz in meine Nähe und gib mir die Hand. Ich werde mich vielleicht in kurzer Zeit einem Mann hinwerfen, der mich nicht verdient. Ich werde das Leben verspielt haben. Ich werde viel Achtung genießen. Man wird sagen: das ist eine tüchtige Frau. Eigentlich habe ich nicht den Wunsch, jemals wieder etwas von dir zu hören. Versuche ein braver Mann zu werden. Mische dich in öffentliche Angelegenheiten, mach von dir reden, es würde mir Vergnügen machen, aus der Leute Mund von dir zu hören. Oder lebe dahin, wie du es kannst und verstehst, bleibe im Dunkel, kämpfe im Dunkel mit den vielen Tagen, die noch kommen werden. Ich mute dir nie Schwächlichkeiten zu. Was soll ich noch sagen, um dir Glück mit auf deine Reise zu wünschen? Bedanke dich doch. Ja, du! Denkst du nicht daran, mir zu danken für das Hiersein, das ich dir gewährt habe? Nein, laß es, denn es stünde dir nicht gut an. Du verstehst nicht, eine Verbeugung zu machen und zu sagen, daß du gar nicht wüßtest, wie du danken solltest. Dein Betragen war deine Dankbarkeit. Ich habe mit dir die Zeit gejagt und getrieben, daß es ihr heiß wurde vor uns. Hast du wirklich nicht mehr Sachen, als da in diesen kleinen Koffer hineingehen? Du bist wirklich arm. Ein Reisekoffer ist das ganze Haus, das du in der Welt bewohnst. Das hat etwas Hinreißendes aber auch etwas Erbärmliches. Geh jetzt. Ich werde dir aus dem Fenster nachschaue. Wenn du oben auf dem Hügelrand bist, wende dich um und blicke noch einmal nach mir. Was sollten wir noch mehr Zärtlichkeiten tauschen? Du Bruder zu mir Schwester? Was hat es zu sagen, wenn eine Schwester ihren Bruder auch nie mehr wiedersieht? Ich entlasse dich ziemlich kalt, weil ich dich kenne und weiß, daß du die Wärme beim Abschied hassest. Zwischen uns bedeutet das nichts. So sage mir denn adieu und geh denn.« –
Es war ungefähr zwei Uhr am Nachmittag, als Simon in der großen Stadt, die er vor ungefähr drei Monaten verlassen hatte, mit der Eisenbahn wieder ankam. Der Bahnhof war voll Menschen und ganz schwarz, mit jenem Geruch angefüllt, der nur in kleinen, ländlichen Bahnhöfen nicht anzutreffen ist. Simon zitterte, als er aus dem Wagen ausstieg, er war hungrig, steif, matt, traurig und mutlos und konnte eine gewisse Beklemmung nicht los werden, obschon er sich sagte, daß es eine dumme Beklemmung sei, die er da empfand. Er gab, wie es die meisten Reisenden tun, sein Gepäck am Gepäckschalter ab und verlor sich unter die Menschen. So wie er freie Bewegung bekam, fühlte er sich auch sofort besser und wurde wieder auf seine leichte Gesundheit aufmerksam, die vom Landaufenthalt her in vollkommen gutem Zustand war. Er aß etwas in einem jener seltsamen Volkslokale. Da aß er nun wieder, ohne vielen Appetit; denn das Essen war mager und schlecht, ganz gut für einen armen Städter, aber nicht für einen verwöhnten Landbewohner. Die Menschen betrachteten ihn aufmerksam, als ahnten sie, daß er vom Lande herkomme. Simon dachte: »Diese Menschen müssen sicher fühlen, daß ich gewöhnt bin, besser zu speisen; denn es liegt so etwas in der Art, wie ich mit diesem Essen umgehe.« In der Tat, er ließ die Hälfte davon stehen, bezahlte und konnte nicht umhin, der Kellnerin leichthin zu bemerken, wie wenig es ihm gemundet habe. Diese schaute den Spötter nur so verächtlich an, freundlich verächtlich, ganz leicht, als hätte sie es nicht nötig, deswegen empört zu sein, da es doch so einer gesagt hatte und nicht ein anderer. Eines andern wegen, ja, dann schon, aber eines solchen! – Simon trat hinaus. Er war doch glücklich, trotz dem minderwertigen Essen und der beleidigenden Miene des Mädchens. Der Himmel war leicht blau. Simon schaute ihn an: ja, er hatte hier doch auch einen Himmel. In dieser Beziehung war es doch dumm, so sehr zu Ungunsten der Städte für das Land eingenommen zu sein. Er nahm sich vor, jetzt nicht mehr an das Land zurückzudenken, sondern sich an die neue Welt zu gewöhnen. Er sah, wie die Menschen vor ihm her gingen, viel schneller als er; denn er hatte sich auf dem Lande einen schlenderischen, bedächtigen Schritt angewöhnt, als fürchtete er, zu rasch vorwärts zu kommen. Nun, für heute wollte er es sich noch gestatten, bäuerisch zu gehen, von morgen ab sollte es dann anders vorwärts gehen. Aber er betrachtete die Menschen mit Liebe, ganz ohne jede Scheu, sah ihnen in die Augen, an die Beine, um zu sehen, wie sie die Beine bewegten, an die Hüte, um den Fortschritt der Mode zu beobachten, an die Kleider, um die seinen immer noch gut genug zu finden im Vergleich mit den vielen unschönen, die er emsig studierte. Wie sie eilig gingen, diese Menschen. Er hätte Lust gehabt, einen von ihnen aufzuhalten und ihn mit den Worten anzureden: Wohin so schnell? Aber er hatte doch nicht den Mut zu einer so törichten Handlung. Er fühlte sich wohl, sonst aber ein wenig matt und gespannt. Eine kleine, nicht zu verhehlende Trauer hielt ihn gefangen, aber sie harmonierte mit dem leichten, glücklichen, etwas getrübten Himmel. Sie harmonierte auch mit der Stadt, wo es beinahe unschicklich ist, ein allzusonniges Gesicht zu machen. Simon mußte sich gestehen, daß er da ginge und absolut nichts suche, aber er hielt es für angebracht, wie alle andern solch eine Sucher- und Vorwärtsdrängermiene zu machen, um nicht den eben angekommenen, beschäftigungslosen Menschen darstellen zu müssen. Er mochte nicht auffallen und es tat ihm wohl, zu bemerken, daß er weiter keinem Menschen durch sein Betragen auffiel. Er schloß daraus, daß er noch immer befähigt sei, in der Stadt zu leben, trug sich ein wenig strammer noch, als zuvor, und tat, als trüge er eine kleine, elegante Absicht mit sich, die er gleichmütig verfolge, die ihm keine Sorgen, nur Interesse entlocke, die seine Schuhe nicht beschmutzen und seine Hände nicht anstrengen würde. Eben ging er jetzt durch eine schöne, reiche Straße, die auf beiden Seiten mit blühenden Bäumen besetzt war, in der man, da sie breit war, den Himmel freier vor Augen hatte. Es war wirklich eine herrliche, lichte Straße, die einem das angenehmste Leben vorgaukeln konnte und jeden Traum gestatten durfte. Simon vergaß jetzt sein Vorhaben, durch diese Straße mit gesetzten, gezierten Bewegungen zu gehen, völlig. Er ließ sich gehen und tragen, schaute bald zu Boden, bald hinauf, bald zur Seite in eines der vielen Schaufenster, vor deren einem er endlich stehen blieb, ohne eigentlich etwas zu betrachten. Er fand es angenehm, den Lärm der schönen, lebhaften Straße hinter seinem Rücken und doch in seinen Ohren zu haben. Er unterschied in seinen Sinnen die Schritte der einzelnen Passanten, die wohl alle denken mußten, er stehe da, um etwas so recht ins Auge zu fassen, das im Schaufenster liege. Plötzlich hörte er sich von jemand angesprochen. Er drehte sich um und erblickte eine Dame, die ihn aufforderte, ein Paket, das sie ihm hinstreckte, bis in ihr Haus zu tragen. Es war keine besonders schöne Dame, aber in diesem Augenblick hatte Simon sich nicht lange zu besinnen, ob sie schön war oder nicht, sondern hatte, wie ihm eine innere Stimme zurief, ihrer Aufforderung lebhaft nachzukommen. Er ergriff das Paket, das gar nicht schwer war, und trug es der Dame nach, die quer über die Straße mit kleinen, gemessenen Schritten ging, ohne sich nur einmal nach dem jungen Manne umzudrehen. Vor einem, wie es schien, prachtvollen Hause angekommen, befahl ihm die Frau, mit hinauf zu kommen, und er tat es. Er sah keinen Grund, warum er nicht hätte gehorchen sollen. Mit dieser Dame in deren Haus zu gehen, das war etwas ganz Natürliches, und der Stimme der Dame zu gehorchen war seiner Lage, die ihm nichts vorschrieb, durchaus angemessen. Er würde vielleicht jetzt noch vor dem Schaufenster stehen und gaffen, dachte er, indem er die Treppen hinaufstieg. Oben angekommen, hieß ihn die Frau eintreten. Sie ging voran und ließ ihn nachkommen und in ein Zimmer hineingehen, dessen Türe sie öffnete. Simon schien es ein prächtiges Zimmer zu sein. Die Frau kam wieder hinein, setzte sich in einen der Stühle, räusperte sich ein wenig, sah den vor ihr Stehenden an und fragte ihn dann, ob er sich entschließen könne, bei ihr in Dienste zu treten. Er mache ihr, fuhr sie fort, den Eindruck eines müßig in der Welt stehenden Menschen, dem man eine Wohltat erweise, wenn man ihm Arbeit gebe. Im übrigen gefalle er ihr soweit und er möchte ihr sagen, ob er gewillt sei, das Anerbieten, das sie ihm mache, anzunehmen.
»Warum nicht,« antwortete Simon.
Sie sagte: »Ich scheine mich also nicht geirrt zu haben, wenn ich von Ihnen gleich im ersten Augenblick angenommen habe, daß Sie ein junger Mensch sind, der froh ist, irgendwo unterzukommen. Sagen Sie mir einmal, wie heißen Sie, und was haben Sie bis jetzt getan in der Welt?«
»Ich heiße Simon, und ich habe bis jetzt nichts getan!«
»Wie kommt das?«
Simon sagte: »Ich habe von meinen Eltern ein kleines Vermögen bekommen, das ich soeben bis auf den letzten Heller verzehrt habe. Ich habe es nicht für nötig gefunden, zu arbeiten. Etwas zu lernen hatte ich keine Lust. Ich habe den Tag als zu schön empfunden, als daß ich den Übermut hätte besitzen können, ihn durch Arbeit zu entweihen. Sie wissen, wie viel durch tägliche Arbeit verloren geht. Ich war nicht imstande, mir eine Wissenschaft anzueignen und dafür den Anblick der Sonne und des abendlichen Mondes zu entbehren. Ich brauchte Stunden, um eine Abendlandschaft zu betrachten, und habe Nächte durch, statt am Schreibtisch oder im Laboratorium, im Grase gesessen, während zu meinen Füßen ein Fluß vorüberfloß und der Mond durch die Äste der Bäume blickte. Sie werden befremdend auf eine solche Aussage herabblicken, aber, sollte ich Ihnen eine Unwahrheit berichten? Ich habe auf dem Lande und in der Stadt gelebt, aber ich habe bis jetzt noch keinem Menschen auf der Welt einen einigermaßen bemerkenswerten Dienst erwiesen. Ich habe Lust, das zu tun, jetzt, wo es scheinen will, daß ich Gelegenheit dazu habe.«
»Wie konnten Sie so liederlich leben?«
»Ich habe das Geld nie geachtet, gnädige Frau! Dagegen könnte es mir, wenn ich dazu veranlaßt würde, einfallen, ja, sogar am Herzen liegen, anderer Menschen Geld für wertvoll zu erachten. Es will den Anschein haben, daß Sie den Wunsch hegen, mich in Ihre Dienste zu nehmen: Nun, in diesem Fall würde ich Ihre Interessen natürlich streng beobachten; denn in einem solchen Falle hätte ich dann keine andern Interessen mehr, als die Ihrigen, die die meinen wären. Meine eigenen Interessen! Wo wäre ich je dazu gekommen, eigene Interessen zu haben! Wann hätte ich je eigene ernstliche Angelegenheiten gehabt. Ich habe mein Leben bis jetzt vertändelt, weil ich es so wollte, da es mir immer ganz als wertlos erschien. In fremden Interessen würde ich aufgehen, es versteht sich von selber; denn wer keine eigenen Ziele hat, lebt eben für die Zwecke, Interessen und Absichten Anderer.« –
»Sie müssen doch irgend eine Zukunft vor Augen haben wollen!« –
»Habe noch keinen Augenblick daran gedacht! Sie sehen mich etwas besorgt und ziemlich unfreundlich an. Sie mißtrauen mir und trauen mir keine ernstliche Absicht zu. Ich muß gestehen, ich habe bis zum heutigen Tage auch noch nie irgend welche Absicht mit mir herumgetragen, weil mich bis jetzt noch niemand zu der Pflege einer Absicht aufgefordert hat. Ich trete zum ersten Mal einem Menschen gegenüber, der meine Dienste in Anspruch nehmen will; das schmeichelt mir und veranlaßt mich, Ihnen kühn die Wahrheit zu sagen. Was schadet es, daß ich bis dahin ein liederlicher Mensch gewesen bin, wenn ich nun ein besserer werden will? Können Sie glauben, ich möchte nicht den Wunsch haben, mich Ihnen dankbar dafür zu erweisen, daß Sie mich von der offenen Straße weg in Ihr Zimmer ziehen, um mir ein Menschenlos zu geben? Ich habe nicht eine Zukunft vor Augen, nur die Absicht, Ihnen zu gefallen. Ich weiß auch, daß man gefällt, wenn man seine Pflicht erfüllt. Nun, diese Zukunft habe ich vor Augen: meine Pflicht, die Sie mir aufgeben werden, zu erfüllen. Ich mag nicht gern in eine viel weitere, als in die ganz nächste Zukunft hineindenken. Meine Laufbahn interessiert mich nicht, die mag ausfallen, wie sie will, wenn ich nur den Menschen gefalle.« –
Die Dame sagte hierauf: »Obschon es eigentlich eine Unvorsichtigkeit ist, einen Menschen, der nichts ist und nichts kann, in Dienst zu nehmen, will ich es doch tun; denn ich glaube, Sie haben den Wunsch, zu arbeiten. Sie werden mein Diener sein und tun, was ich Ihnen auftragen werde. Sie können es als ein besonderes Glück betrachten, Gnade gefunden zu haben, und ich will hoffen, daß Sie sich Mühe geben werden, sie zu verdienen. Sie haben ja keinerlei Zeugnisse bei sich, sonst stände es mir an, Sie nach Ihren Zeugnissen zu fragen. Wie alt sind Sie?« –
»Zwanzig Jahre und etwas darüber!«
Die Dame nickte mit dem Kopf: »Das ist ein Alter, wo der Mensch daran denken muß, sich für das Leben eine Aufgabe zu stellen. Nun, ich will vieles, das mir an Ihrem Wesen nicht recht paßt, vorläufig übersehen und Ihnen Gelegenheit geben, ein zuverlässiger Mann zu werden. Wir werden sehen!« –
Damit war diese Unterredung beendigt.
Die Dame führte Simon durch eine Flucht eleganter Zimmer, bemerkte, indem sie ihrem jungen Begleiter voranschritt, daß es eine seiner Aufgaben sei, die Zimmer zu reinigen, fragte, ob er imstande sei, einen Zimmerboden mit Stahlspänen aufzureiben, ohne jedoch seine Antwort abzuwarten, als wüßte sie schon, daß er das könne, als ob sie das nur gefragt hätte, um irgend eine Frage an ihn zu richten, daß es ein bißchen ausforscherisch und hochmütig um seine Ohren herum sause, öffnete eine Türe, ließ ihn in ein kleineres, warm mit Teppichen aller Art ausgefüttertes Zimmer treten, wo sie ihn einem Knaben, der im Bett lag, mit kurzen Worten vorstellte: Diesen kleinen Herrn, der krank sei, werde er bedienen, wie, das werde ihm noch gesagt werden. Es war ein blasser, hübscher, wenngleich von der Krankheit entstellter Knabe, der seine Augen kalt auf diejenigen Simons richtete, ohne etwas zu sprechen. Man ahnte, daß er nicht sprechen, vielleicht etwa nur lallen konnte, wenn man seinen Mund ansah, der unbehilflich in dem Gesicht lag, als gehörte er gar nicht dazu, als klebe er dort nur an und sei nicht immer dagewesen. Die Hände des Knaben indessen waren sehr schön, sahen so aus, als trügen sie den ganzen Schmerz und die ganze Schmach der Krankheit, als hätten sie es übernommen, den ganzen Umfang, die ganze schöne Last weinender Trauer zu tragen. Simon konnte nicht umhin, diese Hände einen Moment länger, als ihm gestattet war, liebend zu betrachten; denn schon wurde er aufgefordert, der Dame zu folgen, die ihn durch einen Korridor in die Küche führte, wo sie sagte, daß er der Köchin, wenn keine wichtigere Arbeit für ihn vorliege, behülflich zu sein hätte. Das tue er sehr gern, entgegnete Simon, wobei er das Mädchen anblickte, das die Herrin in der Küche zu sein schien. Darauf, am nächsten Morgen nämlich, trat er seinen Dienst an, das heißt, der Dienst trat an ihn heran und verlangte von ihm dieses und jenes und ließ ihm keine Zeit mehr übrig, zu denken, ob es ein netter Dienst sei oder nicht. Die Nacht hatte er bei dem Knaben, seinem jungen Herrn, zugebracht, schlafend und immer wieder aufwachend; denn es war ihm befohlen worden, nur ganz leicht, leise und oberflächlich, also absichtlich schlecht zu schlafen, damit er sich daran gewöhne, schnell, bei jedem nur geflüsterten Ruf des Kranken, aus dem Bett zu springen und nach des Knaben Befehle zu fragen. Simon glaubte der Mann zu einem solchen Schlaf zu sein; denn wenn er gelinde nachdachte, verachtete er den Schlaf und nahm gerne die Gelegenheit wahr, die ihn nötigte, sich aus einem dichten und tiefen Schlaf nichts zu machen. Am nächsten Morgen sodann spürte er nicht im geringsten, daß er schlecht geschlafen habe, konnte aber auch nicht nachzählen, wie oftmals er aus dem Bett aufgesprungen sei, und ging munter an die Arbeit. Vorerst hatte er mit einem weißen, dicken Topf in der Hand auf die Straße zu springen, um denselben dort von einer Frau mit frischer Milch füllen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit konnte er einen Augenblick lang den erwachenden, feuchtglänzenden Tag betrachten, seine beiden Augen damit trunken und feurig machen und wiederum die Treppe hinaufspringen. Er machte die Beobachtung, daß ihm seine Glieder gut und geschmeidig gehorchten, wenn er hinauf und hinunter eilte. Alsdann hatte er, bevor die Frau noch aus ihrem Schlafe erwachte, mit dem Mädchen gemeinschaftlich diejenigen Zimmer aufzuräumen, die ihm vorgeschrieben waren: das Eßzimmer, den Salon und das Schreibzimmer. Der Boden mußte mit einem Besen abgekehrt, die Teppiche abgebürstet, Tisch und Stühle abgewischt, Fenster angehaucht und abgeputzt und alle im Zimmer befindlichen Gegenstände angerührt, in die Hand genommen, gesäubert und wieder an Ort und Stelle gelegt werden. Das alles mußte blitzschnell vor sich gehen, aber Simon dachte, wenn er das dreimal gemacht habe, würde er es mit geschlossenen Augen tun können. Nachdem diese Arbeit getan war, bedeutete ihm das Mädchen, daß er jetzt ein Paar Schuhe reinigen könne. Simon nahm die Schuhe in die Hand, wahrhaftig, es waren der Dame ihre Schuhe. Schöne Schuhe waren es, zierliche Schuhe mit Pelzbesatz und von so zartem Leder wie Seide. Simon hatte immer für Schuhe geschwärmt, nicht für alle, nicht für grobe, aber für so seine immer, und nun hielt er solch einen Schuh in der Hand und hatte die Pflicht, ihn zu säubern, obgleich er eigentlich nichts daran zu säubern bemerkte. Immer schienen ihm Füße von Frauen etwas Heiliges zu sein, und Schuhe glichen in seinen Augen und Sinnen Kindern, glücklichen, bevorzugten Kindern, die das Glück hatten, den feinbeweglichen, empfindlichen Fuß zu bekleiden und zu umschließen. Welch eine schöne Erfindung der Menschen, solch ein Schuh, dachte er, indem er daran mit einem Tuch herumwischte, um so zu tun, als ob er putzte. Da wurde er von der Frau selber überrascht, die in die Küche kam und ihn mit einem strengen Blick maß; Simon beeilte sich, ihr Guten Tag zu sagen, worauf sie nur mit ihrem Kopf nickte. Simon fand das allerliebst, ja entzückend, sich Guten Morgen sagen zu lassen und nur so mit dem Kopf zu nicken als Erwiderung, als wolle man sagen: ja, lieber Bursche, ja, ich danke dir, ich habe es gehört, es war sehr nett gesagt, es hat mir gefallen!
»Sie müssen meine Schuhe besser putzen, Simon,« sagte die Frau.
Simon war sehr glücklich über ihren Tadel. Wie oft, wenn er durch heiße, verbrannte, menschenleere Gassen geschlendert, absichtslos herumgewandert war, empfand er in seinem Herzen Sehnsucht nach einem bösen, bissigen Tadel, nach einem Schimpfwort, nach einem Fluch und beleidigenden Ausruf, nur um die Gewißheit zu haben, nicht ganz allein, nicht ganz ohne Teilnahme zu sein, und wenn die Teilnahme auch eine rohe und verneinende gewesen wäre. »Wie lieb klingt dieser Tadel aus ihrem Frauenmund,« dachte er, »wie bindet mich das an sie, wie sehr verbindet und verknüpft und fesselt es, man fühlt solch einen Tadel wie eine kleine, gar nicht sehr schmerzende Ohrfeige, eines Fehlers wegen, den man begangen hat«; und Simon nahm sich im stillen vor, nur noch Fehler zu begehen, nein, nicht gerade ausschließlich, denn das würde ihn zum Tölpel gestempelt haben, aber regelmäßig kleinere Versehen, schön beabsichtigt, um den Genuß zu haben, eine empfindliche und an Ordnung gewöhnte Dame entrüstet zu sehen. Entrüstung, nein, nicht gerade Entrüstung, sondern mehr ein Fragen, ein Staunen über seine, Simons Ungeschicklichkeit. Dann hätte man Gelegenheit, in andern Punkten zu glänzen, und so durfte man das Vergnügen haben, zu beobachten, wie sich ein strenges und ärgerliches Gesicht in ein freundlicheres und befriedigtes verwandelte. Welche Freude, sich einen Menschen zur Zufriedenheit innig umzustimmen, wenn man ihn vorher gekränkt gesehen hat. »Heute morgen bereits einen lieben Tadel geerntet,« dachte Simon, und weiter: »wie angenehm ist es, der Getadelte zu sein, es ist gewissermaßen ein reiferer, überlegener Zustand. Ich bin wie geschaffen dazu, getadelt zu werden; denn ich empfinde den Tadel dankbar, und nur solche verdienen freundschaftlich getadelt zu werden, die dafür durch entsprechende Körperhaltung, die sie anzunehmen haben, zu danken wissen.«
Simon stand wirklich entsprechend da, und er fühlte: »Nun erst bin ich der Diener dieser Frau; denn sie tadelt mich, weil sie ein Recht in sich fühlt, mich ohne viel Überlegen zurechtzuweisen, und dabei von mir ein korrektes Schweigen erwartet. Wenn man einen untergebenen Beamten tadelt, so schmerzt man ihn, und man trägt immer die geheime Absicht, ihm auch wirklich weh zu tun durch das Merkenlassen der höheren Stufe, die man einnimmt. Einen Diener tadelt man nur in der Absicht, ihn zu belehren und zu erziehen, so wie man ihn haben will; denn ein Diener gehört einem, während man mit einem untergebenen Beamten, wenn die Feierabendstunde schlägt, menschlich weiter nichts mehr zu tun hat. Ich zum Beispiel jetzt bin mit der Wärme des Herzens getadelt worden, dazu kommt noch, daß der Tadel von einer Frau kommt, die zu den Frauen gehört, die immer lieblich sind, wenn sie sich so etwas herausnehmen. In der Tat, Damen muß man einen Tadel aussprechen hören, um zu der Überzeugung zu gelangen, daß sie es besser verstehen als die Männer, ohne kleinliche Kränkung einen Fehler zu rügen. Vielleicht ist das aber falsch, und ich sehe, was, wenn es von einem Mann kommt, mich verletzt, von Damen herkommend, nicht für beleidigend, sondern für aufmunternd an. Einem Mann gegenüber empfinde ich immer die stolze Gleichstellung, einer Dame gegenüber niemals, weil ich ein Mann bin, oder weil ich mich darauf vorbereite, einer zu werden. Vor Frauen muß man sich entweder überlegen oder unterlegen fühlen! – Einem Kinde zu gehorchen, wenn es reizend befiehlt, ist mir etwas Leichtes, dagegen einem Mann: Pfui! Nur Feigheit und geschäftliche Interessen mögen einen Mann dazu veranlassen, vor einem andern Mann zu kriechen: Niedrige Gründe, das! Aus diesem Grunde bin ich froh, daß ich einer Frau zu gehorchen habe; denn das ist natürlich, weil es niemals ehrverletzend sein kann. Eine Frau kann die Ehre eines Mannes niemals verletzen, es sei denn beim Ehebruch, aber da benimmt sich der in Frage kommende Mann meist als ein schwacher Tölpel, den es gar nicht entehrt, wenn er betrogen wird, da ihn schon die Möglichkeit des Betruges längst vorher in den Augen derer entehrt hat, die ihn kannten. Unglücklich können Frauen machen, aber entehren können sie niemals; denn das wirkliche Unglück ist keine Schande und kann nur auf rohe Gemüter und Sinnesarten komisch wirken, auf solche Menschen, die sich allerdings ihrerseits dann eine Unehre antun, es zu verlachen.«
Mit diesem Wort riß die Dame ihren Diener aus seiner anmaßlichen Gedankenreihe und befahl ihm, nun den kranken Knaben ankleiden zu gehen. Er gehorchte und tat, was sie verlangte. Er trug ein Becken voll frischen Wassers an das Bett und wusch mit einem Waschschwamm sorgsam das Gesicht des Knaben, reichte ihm ein Glas, halbgefüllt mit klarem Wasser, und ließ ihn den Mund damit wässern, was der Knabe mit seinen schönen Händen sehr hübsch tat, nahm dann eine Bürste und einen Kamm zur Hand, brachte das Haar des im Bett Liegenden in Ordnung und reichte ihm zum Schluß das Frühstück auf einem silbernen Tablett dar, schaute zu, wie es bedächtig, mit vielem Absetzen, verzehrt wurde, ohne müde oder gar ungeduldig zu werden; denn wie häßlich und unpassend würde Ungeduld hier gewesen sein; trug das Geschirr wieder hinaus und kam wieder, um nun den Kranken, der sich nicht selbst anziehen konnte, anzukleiden. Er hob den leichten, dünnen Körper mit einiger Scheu zum Bette heraus, nachdem er schon vorher den Füßen und Beinen die Strümpfe übergezogen hatte, steckte an die Füße kleine Hausschuhe, nahm die Beinkleider zur Hand, um sie anzuziehen, schnallte den Gurt der Hose zu, warf die Hosenträger, wie es sich schickte, von hinten über, alles schnell, alles geräuschlos, und so, daß jede Bewegung auch wirklich gleich etwas tat, legte dem Hals des Knaben jetzt den Kragen um, einen breiten, umgelegten Knabenkragen, befestigte mit gutem Geschick eine Krawatte an den Hemdknopf; das Hemd war natürlich längst übergeworfen worden; reichte jetzt die Weste, ließ die Arme hineinschlüpfen, ebenso den Rock und die paar Gegenstände, die der Knabe bei sich zu tragen pflegte, als Uhr, Uhrgehänge, Messer, Taschentuch und Notizbuch, und das Werk war fertig. Nun mußte Simon des kleinen Herrn Bett in Ordnung bringen, sowie das ganze Schlafzimmer in der Weise, wie es ihm die Dame zeigte, aufräumen, die Fenster öffnen, die Kissen, Bettdecke und das Laken ans Fenster legen und alles so machen, wie es getan wird und wie er merkte, daß es getan werden mußte. Die Dame verfolgte alle seine Bewegungen, wie ein Fechtmeister den Bewegungen seines Schülers folgt, und fand, daß er sich mit Talent in die Arbeit schickte. Sie sagte nicht etwa ein Wort der Anerkennung. Würde ihr nicht von ferne eingefallen sein. Außerdem mochte ihr Diener an ihrem Schweigen merken, daß sie seine Art und Weise billige. Es freute sie, wie zart er mit ihrem Sohn umgegangen war, da sie bemerkt hatte, wie jede Bewegung Simons beim Ankleiden dessen Achtung für den Kranken aussprach. Sie mußte lächeln, als sie gewahrt hatte, mit welcher Scheu er zuerst angefaßt, und wie er dann später die Scheu überwunden hatte und mit seinem Tun kräftiger, ruhiger und gleichmäßiger geworden war. Dieser junge Mann gefiel ihr vorläufig, mußte sie sich sagen. »Wenn er fortfährt, wie er angefangen hat, so will ich ihn dafür lieb haben, daß er mich nicht in meinem Gefühl, das ich mir gleich von Anfang an von ihm machte, betrogen hat,« dachte sie. »Er ist sehr still und anständig und scheint das Talent zu besitzen, sich mit jeder Lage gleich vertraut machen zu können. Und da er, wie ich glaube aus seinen Manieren schließen zu dürfen, aus gutem Hause herstammt, will ich ihn, um seiner Mutter willen, die vielleicht noch lebt, und um seiner Geschwister willen, die vielleicht geachtete Stellungen einnehmen und besorgt sind um sein Schicksal, zu einem klugen und schönen Betragen anhalten und will Freude haben, wenn ich sehe, daß er einschlägt und sich so benimmt, wie man es von ihm erwartet. Vielleicht darf ich ihn in kurzem etwas zutraulicher behandeln, als man gezwungen ist, mit seinen Dienstboten zu verkehren. Aber ich will acht geben und ihm keinen Anlaß geben, durch zu frühes freundliches Entgegenkommen, mir unverschämt zu begegnen. In seinem Charakter sitzt eine leise Beigabe von Unverschämtheit und Trotz, und diese darf nicht geweckt werden. Ich werde immer mein Gefallen, das ich an ihm habe, unterdrücken müssen, wenn ich will, daß er immer die Lust hat, mir zu gefallen. Ich glaube, er liebt mein strenges Gesicht, ich erriet so etwas, als er vorhin lächelte, wo ich ihn doch ziemlich unfreundlich getadelt habe. Die Menschen muß man erraten, wenn man sie von ihrer schönen Seite haben will. Er hat Seele, dieser junge Mann, man muß ihm deshalb auch seelenvoll und seelenbewußt entgegentreten, um etwas bei ihm zu erreichen. Man nimmt Rücksicht, und tut doch so, als ob man keine nähme, wie man ja auch wirklich keine zu nehmen nötig hätte. Aber es ist besser und klüger, man nimmt, wenn man mit Ruhe kann.« – Sie beschloß, den Simon ein bißchen abenteuerlich zu nehmen, und schickte ihn jetzt aus, um Einkäufe zu machen.
Das war nun wieder etwas ganz Neues für Simon, durch die Straßen zu eilen, mit einem Korb oder mit einer ledernen Tragtasche in der Hand, Fleisch und Gemüse zu kaufen, in die Läden zu treten und dann wieder nach Hause zu springen. In den Straßen sah er die Menschen ihren verschiedenartigen Geschäften nachgehen, jeder trug sich mit einer Absicht und er selber auch. Es schien ihm, daß die Leute sich über seine Gestalt verwunderten. Sollte sein Gang etwa nicht zu dem gefüllten Korbe, den er leicht trug, passen? Waren seine Bewegungen zu frei, als daß sie zu seinem Auftrage, nämlich zum Botenlaufen, gestimmt hätten? Aber es waren freundliche Blicke, die er bekam; denn man sah ihn eilig und geschäftig, und er mußte den Eindruck eines pflichteifrigen Mannes machen. »Wie schön ist es doch,« dachte Simon, »so mit einer Pflicht im Kopf durch die Straßen neben den wimmelnden Menschen her zu laufen, von einigen überholt zu werden, die längere Beine haben, und andere wieder zu überflügeln, die träger gehen, als wenn sie Blei in ihren Schuhen hätten. Wie hübsch ist es, von den sauberen Mägden für ihresgleichen angeblickt zu werden, zu beobachten, welchen Scharfblick diese einfachen Wesen haben, zu sehen, daß sie beinahe Lust hätten, bei einem schnell stehen zu bleiben, um zehn Minuten lang plaudern zu können. Wie die Hunde auf der Straße laufen, als wären sie hinter dem Wind her, wie Greise noch geschäftig sind mit ihren gebeugten Nacken und Rücken! Und da möchte man noch schlendern! Wie entzückend sind die einzelnen Frauen, an denen man, ohne beachtet zu werden, vorüberrennen darf. Was sollte man von ihnen beachtet werden. Wäre noch schöner! Es genügt doch, selber Beobachteraugen zu haben. Hat man etwa die Sinne nur, daß sie gestachelt werden, und nicht, damit man sie selber stachle? Die Augen der Frauen an einem solchen Straßenmorgen, wie dieser, wenn sie so in die Ferne blicken, sind etwas Herrliches. Augen, die an einem vorbeisehen, sind schöner, als solche, die einen ansehen. Es ist, als verlören sie dadurch. Wie man rasch denkt und fühlt, wenn man so rasch läuft. Nur den Himmel nicht betrachten! Nein, lieber nur empfinden, daß da oben, über dem Kopf und über den Häusern etwas Schönes und Weites schwebt, etwas Schwebendes, vielleicht Blaues, ganz gewiß Duftiges. Man hat Pflichten, und das ist auch etwas Schwebendes, Fliegendes, Hinreißendes. Man trägt etwas mit sich, das man nachzählen und abliefern muß, um als zuverlässiger Mensch dastehen zu können, und ich bin gegenwärtig so, daß es mir mein einziges Vergnügen ist, als zuverlässiger Mensch dazustehen. Die Natur? Mag sie sich einstweilen verstecken. Ja, es ist mir, als ob sie sich verborgen hielte, da, hinter den langen Häuserreihen. Der Wald, er reizt mich vorläufig nicht mehr, soll mich nicht reizen. Immerhin, es hat etwas Schönes, zu denken, daß alles doch noch da ist, während ich flüchtig und geschäftig durch die blendende Straße eile, mich um nichts bekümmere, als um das, was ich mit meiner Nase denken könnte, so einfach ist es.« – Er zählte das Geld in der Westentasche mit fühlenden Fingern nach, ohne es heraus zu nehmen, und ging nach Hause.
Nun hatte er den Tisch zu decken.
Er mußte ein sauberes, weißes Tischtuch über den Tisch breiten, daß die Falten nach oben zu liegen kamen, dann die Teller hinlegen, so, daß der Tellerrand nicht über den Tischrand hinausragte, dann Gabel, Messer und Löffel hinlegen, Gläser aufstellen und eine Karaffe mit frischem Wasser, Servietten auf die Teller legen und das Salzgefäß auf den Tisch stellen. Stellen und legen, hinlegen und anfassen und hinstellen, zart anfassen, dann wieder gröber, Tücher mit Fingerspitzen anfassen und Teller nur mit Vorsicht berühren, ausbreiten und ausrichten, nämlich die Bestecke, keinen Lärm dabei verursachen, schnell sein und doch wiederum behutsam, vorsichtig und kühn, steif und glatt, ruhig und doch energisch, Gläser nicht aneinanderklirren, und Teller nicht klappern lassen, aber über ein vorkommendes Klappern und Klirren auch nicht erstaunt sein, sondern es begreiflich finden, dann der Herrschaft melden, daß der Tisch gedeckt sei, und dann die Speisen auftragen und dann zur Tür hinausgehen, um wieder hineinzugehen, wenn geklingelt wurde, zusehen, wie gegessen wurde und Freude dabei empfinden, sich zu sagen, daß es hübscher sei, zu sehen, wie gegessen werde, als selber zu essen, dann den Tisch wieder abräumen, das Geschirr hinaustragen, einen Rest Braten in den Mund stecken und dabei eine frohlockende Miene machen, als wäre es etwas, um dabei eine frohlockende Miene machen zu müssen, dann selber essen und finden, daß man jetzt wirklich verdiene, selber etwas zu essen: das alles mußte Simon. Er mußte nicht alles, zum Beispiel mußte er nicht gefrohlockt haben, wenn er stahl, aber es war sein erster, zarter Diebstahl, und deswegen mußte er frohlocken; denn es erinnerte ihn lebhaft an die Kindheit, wo man stiehlt, irgend etwas aus dem Speiseschrank, und dabei frohlockt.
Nach dem Essen hatte er dem Mädchen zu helfen, das Geschirr zu säubern, abzuwaschen und abzutrocknen, und das Mädchen war nicht wenig erstaunt, zu sehen, wie behend er das machte. Wo er das gelernt hätte? »Ich war doch auf dem Lande,« antwortete Simon, »und auf dem Lande tut man dergleichen. Ich habe dort eine Schwester, die Lehrerin ist, der habe ich beim Geschirrtrocknen immer geholfen.«
»Das war hübsch von Ihnen.«
Simon kam es ganz wunderbar vor, in dieser stillen Küche, mitten in einer großen Stadt, zu handwerken. Wer hätte das je gedacht. Nein, der Mensch kam doch nie dazu, sich eine Zukunft zu malen. Er, der früher frei über die Bergweiden streifte, wie ein Jäger unter dem offenen Himmel schlief und die Luft zu eng fand, wenn er Ausblicke genoß, die die vor ihm liegende Erde auseinanderbreiteten und dehnten, der die Sonne heißer, den Wind stürmischer, die Nacht dunkler und die Kälte grimmiger wünschte, wenn er draußen, zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung, suchend, händereibend und atempustend herumlief, er steckte jetzt in einer kleinen Küche und trocknete einen tropfenden Teller warm ab. Er war froh. »Ich bin froh, so gehemmt, so eingesteckt, so eingeengt zu sein,« sagte er zu sich, »was will der Mensch nur immer die Weite haben, und dazu doch Sehnsucht, die doch so was Beengendes ist! Hier bin ich eng eingeklemmt zwischen vier Küchenwände, aber mein Herz ist weit und erfüllt von der Lust an meiner bescheidenen Pflicht.«
Es war ein wenig erniedrigend für ihn, sich in einer Küche zu wissen, mit einer Arbeit beschäftigt, die sonst nur Mädchen verrichten. Ein wenig erniedrigend und ein wenig lächerlich war es, aber es war entschieden geheimnisvoll und absonderlich. Kein Mensch konnte sich jetzt diese Lage von ihm austräumen. Dieser Gedanke hatte wiederum etwas Genugtuerisches und Stolzes. Man konnte bei diesem Gedanken lächeln. Das Mädchen fragte ihn, was er denn früher in seinem Leben gewesen sei, und er antwortete: »Schreiber!« Sie konnte nicht begreifen, wie man so wenig Ehrgeiz besitzen könne, das Schreibpult aufzugeben, um in eine Haushaltung hineinzukriechen. Simon sagte darauf, es gäbe in diesem Falle erstens nichts zu kriechen, wie sie sich da so lieblich ausdrücke, und zweitens sei es noch eine Frage, was besser wäre: ein Sitz hinter einem Pult oder der Zustand eines Geschirrabwischers. Er zöge bei weitem die freie, luftige, heiße, dampfige, interessante Küche dem öden Bureau vor, in dem die Luft meist schlecht und die Laune eine verbitterte sei. Hier sei kein Anlaß, bitter zu sein, hier, wo der Braten in der Pfanne schmore, das Gemüse koche, die Suppe dampfe, das Kupfer so lieblich herabblinke vom Gestell und die Teller so freundlich klängen, wenn man sie aneinanderschlüge. Aber Diener sein, das sei doch nicht viel, das bedeute doch gar nichts, meinte das muntere Mädchen. Er wolle nichts bedeuten, erwiderte Simon sanft. Sie ließ es dabei bewenden, doch fand sie, daß er ein kurioser, schwer begreiflicher Mensch sei. Aber sie dachte: »er ist anständig,« und fühlte, »er dürfte sich viel erlauben!« Simon war eben fertig geworden mit seiner Arbeit, als die Dame in die Küche trat und zu ihm sagte, er möge hineinkommen, sie habe eine Beschäftigung für ihn. »Was für eine schöne Beschäftigung hat sie wohl für mich,« dachte Simon, und er folgte der Voranschreitenden. »Sie haben jetzt, während des Nachmittages, weiter nichts zu tun, da können Sie meinem Knaben und mir aus einem Buche vorlesen. Verstehen Sie vorzulesen?«
Und dann las er eine volle Stunde lang vor, mit etwas gepreßtem Atem, aber mit richtiger, scharfer, schöner Aussprache und mit einer warmen Stimme, die anzeigte, daß der Leser miterlebte, was er las. Der Dame schien es zu gefallen, und der Knabe war ganz nur Ohr bis zum Schluß, wo er sich anmutig für den Genuß bedankte. Simon, dessen Wangen hochrot vor Bewegung glühten, fand es schön, daß man ihm dankte. Er verfügte sich, da er weiter vorläufig nichts zu treiben wußte, in das Domestikenzimmer, das die Abendsonne rötlich beleuchtete, und fing an, zum Fenster hinaus zu rauchen.
»Ich sehe es unlieb, wenn Sie hier rauchen,« sprach die hereintretende Frau.
Er rauchte aber weiter, und sie ging wieder, etwas ärgerlich, hinaus. »Ich begreife allerdings, daß es ihr nicht lieb ist, aber, muß ihr denn alles lieb an mir sein? Das Rauchen gebe ich nicht auf. Nein! Zum Teufel, nein! Und wenn zwanzig Damen kämen und eine nach der andern es mir verböten.« Er war wütend, aber er wurde sofort wieder sanft und sprach zu sich: »Ich hätte die Zigarette wegwerfen sollen; das war unverschämt!«
In diesem Augenblick, den er dazu benutzen wollte, ein Selbstgespräch zu führen, tönte im Korridor ein Schrei und unmittelbar darauf ein heftiger Knall von einem zu Boden stürzenden Geschirr. Simon öffnete die Tür und erblickte die Frau, wie sie mit wehklagendem, stummem und betrübtem Gesicht zu Boden sah, wo die Scherben einer ihr gewiß teuer gewesenen Porzellanplatte herumlagen. Sie hatte die Platte mit einem Stück Torte drauf vom Eisschrank weg in ihr Zimmer tragen wollen und dieselbe fallen lassen, sie konnte selber nicht sagen, wie. Es brauchte ja nur eine kleine Täuschung der Sinne gewesen zu sein, oder sonst etwas, und das Unglück war eben geschehen. Als die Frau den Simon bemerkte, der hinter ihrem Rücken stand, verwandelte sich sogleich ihr betrübtes Gesicht in ein zürnendes und anklagendes, und sie sagte zu ihm, in einem Tone, der genug sagte, was sie empfand: »Lesen Sie zusammen!« Simon bückte sich zu Boden und las die Scherben zusammen. Während er es tat, streifte seine Wange das Kleid seiner Herrin und er dachte: »Verzeih mir, daß ich gerade dastehen mußte, um zu sehen, daß du dich ungeschickt benommen hast. Ich begreife deinen Zorn. Ich bekenne mich schuldig, die Platte, die du hast fallen lassen, zerbrochen zu haben. Ich habe sie zerbrochen. Wie muß es dir doch weh tun. Eine so schöne Platte. Gewiß war sie dir lieb. Du tust mir leid. Meine Wangen streifen dein Kleid. Jede Scherbe, die ich zusammenlese, sagt mir: »Elender,« und der Saum von deinem Rock sagt mir: »Glücklicher!« Ich lese absichtlich langsam zusammen. Versetzt es dich nicht in neuen Zorn, dies bemerken zu müssen? Es macht mir Spaß, der Übeltäter gewesen zu sein. Du gefällst mir, wenn du mir zürnst. Weißt du, warum mir dein Zorn gefällt? Weil er so zart ist, dein Zorn! Nur weil ich dich sah, wie du dich ungeschickt benahmst, zürnst du mir. Du mußt einige Achtung vor mir haben, da es dich kränken kann, wenn du dich vor mir blamierst. Du Hohe, vor mir Niedrigem. Wie entzückend zornig befahlst du mir, die Scherben zusammenzulesen. Und ich beeile mich damit gar nicht; denn ich möchte, daß du recht ärgerlich und böse würdest, weil ich so lange bei den Scherben verweile, die mir doch sagen müssen, wie ungeschickt du warst, die es dir auch sagen müssen. Du stehst immer noch da? Es muß jetzt eine Mischung von seltsamen Empfindungen in dir sein: Scham, Schmerz, Zorn, Ärger, Gleichmut, Gereiztheit, Gelassenheit, Überraschung und Hoheit und so viel kleines, nebenherschleichendes Unsagbares, das der Moment wegnimmt, ehe man es nur recht hat empfinden können, das da war wie ein Nadelstich oder wie ein Duft oder wie ein Blinzeln von einem Augenpaar. – Dein seidenes Kleid ist schön, wenn man denkt, daß es einen Frauenleib einhüllt, der vor Aufregung und vor Schwäche zittern kann. Deine Hände sind schön, die so lang zu mir herabhängen. Ich hoffe, daß du mir einmal eine Ohrfeige damit gibst. Jetzt gehst du schon weg, ohne mich gescholten zu haben. Wenn du gehst, kichert und flüstert dein Kleid auf dem Boden. Vorhin verbotest du mir zu rauchen. Aber ich werde die Frechheit besitzen, zu rauchen, wenn ich hinter dir auf den Markt gehe, um mit dir Einkäufe zu machen. Da sollst du mich rauchen sehen, weiße, blendende Zigaretten, und ich will hoffen, daß du alsdann die Geistesgegenwart besitzest, sie mir aus dem Mund zu schlagen. Jetzt eben mußte ich dich mit allen meinen mir zu Gebote stehenden Gebärden dafür um Verzeihung bitten, daß du eine Platte zerschlagen hast. Ich wollte, ich könnte Gelegenheit haben, etwas zu verüben, das dich veranlassen würde, mich zum Teufel zu jagen. O nein, nein! Was denke ich da. Ich bin schon verrückt. Wahrhaftig, diese Scherbenangelegenheit hat mich verrückt gemacht. Jetzt wird es Abend sein draußen auf der Straße. Die Laternen werden hellgelb brennen in den verlöschenden Tag hinein. Jetzt möchte ich auf die Straße. Es geht nicht anders, ich muß auf die Straße hinunter.« –
»Ich möchte einen kleinen Ausgang machen,« sagte er, in ihr Zimmer tretend, »darf ich?«
»Ja! Aber daß Sie mir nicht zu lange bleiben!«
Simon stürzte hinaus, die Treppe hinunter, wo ihm eine verschleierte Frauengestalt staunend nachblickte, zum Haus hinaus, auf die Straße, an die Luft, in die bewegliche, feuchte, glitzernde, abendliche Freiheit. Seltsam sei doch, dachte er, dieses Gehören an ein Haus, wo man recht wie ein Gefangener lebe. Seltsam sei es, ein erwachsener Mensch zu sein und als ein erwachsener Mensch hingehen zu müssen, zu einer Dame, in ein dunkles Zimmer, wo man die Frau nur halb im Dunkel sähe, und sie um Erlaubnis zu fragen, ausgehen zu dürfen. Als ob man ein Möbel von ihr wäre, ein Gegenstand, ein gekauftes Stück, ein Etwas, ein irgend Etwas, und als ob dieses Etwas nichts wäre, oder nur insofern etwas, als es sich dazu eigne, so ein Etwas zu sein, ihres zu sein! Seltsam sei es auch, daß man trotzdem diesen Zustand als eine Art Heimat und Zuhausesein fühle. Man liefe jetzt eigentlich zehnmal gehobener auf der Straße umher, weil jemand, den man darum bitten mußte, es einem erlaubt habe. Ein Erlaubnisbekommen, das sei allerdings etwas Schülerhaftes, aber es müßten, dachte er, selbst Greise oft noch, und unter kränkenderen Umständen, um eine Erlaubnis fragen. So sei alles wunderbar im Leben, und man müsse sich in das Wunderbare schicken, wenn es oft auch seltsam aussähe.
Er ging die Straße hinunter und verliebte sich in das süße Straßenbild mit den aufgehenden Sternen, mit den dichten Bäumen, die in langer, gerader Reihe davonliefen, mit den ruhiger gehenden Menschen, mit der Pracht des Abends, mit der tiefen, beweglichen Ahnung der Nacht. Auch er ging ruhig, beinahe träumerisch. Am Abend war es keine Schande, ein träumerisches Aussehen zu machen, wo unwillkürlich alle träumen mußten in dieser Atmosphäre voll von dem Duft des Frühsommerabends. Viele Frauen spazierten umher, mit kleinen, eleganten Täschchen in der behandschuhten Hand, mit Augen, in denen das Licht des Abends fortleuchtete, in engen Kleidern von englischem Schnitt oder in faltigen, schleppenden Röcken und Roben, die sich wundervoll breit in der Straße bewegten. Die Frau, dachte Simon, wie verherrlicht sie das Bild der städtischen Straße. Sie ist wie geschaffen zum promenieren. Man fühlt, sie promeniert, sie genießt ihr eigenes, wiegendes, schönes Gehen. Am Abend geben die Frauen den Ton des Abends an, dazu passen ihre Figuren mit diesen Armen voll Wehmut und Fülle und diesen Brüsten voll atmender Beweglichkeit. Ihre Hände in Handschuhen sehen wie Kinder in Masken aus, mit denen sie winken, in denen sie immer etwas halten. Ihre ganze Haltung setzt die abendliche Welt in tönende Musik um. Wenn man jetzt, so wie ich es tue, hinter ihnen hergeht, so gehört man schon zu ihnen, in Gedanken, in fühlenden Schwankungen, in schlagenden Wellen, die an das Herz schlagen. Sie winken nicht, und doch winken sie einem. Obschon sie keine Fächer tragen, sieht man in einer ihrer Hände einen Fächer und er blitzt und blendet wie getriebenes Silber in dem verlorenen, verschwommenen Abendlicht. Die reifen, üppigen Frauen passen besonders schön zum Abend, so wie Greisinnen in den Winter und blühende Mädchen in den eben erwachten Tag hineinpassen, wie Kinder in den dämmernden Morgen und junge Ehegattinnen in den heißen Mittag, wo die Sonne der Welt am glühendsten scheint.
Es war neun Uhr, als Simon wieder nach Hause kam. Er hatte sich verspätet und mußte Vorwürfe anhören, wie dieser: wenn das noch einmal, noch ein einziges Mal vorkomme, so – – dann –. Er hörte eigentlich nicht, sondern vernahm nur den Klang des Vorwurfes, innerlich lachte er, äußerlich schien er betrübt, das heißt, er setzte ein dummes Gesicht auf und fand es nicht für notwendig, den Mund aufzutun, um etwas zu erwidern. Er zog den Knaben aus, legte ihn in das Bett und zündete ein kleines Nachtlicht an.
»Dürfte ich um ein Licht für mich bitten,« fragte er die Dame.
»Was wollen Sie mit dem Licht?«
»Einen Brief schreiben.«
»Kommen Sie zu mir herein, da können Sie schreiben!« sagte die Dame.
Und er durfte sich an ihren Schreibtisch setzen. Sie gab ihm einen Briefbogen, einen Briefumschlag für die Adresse, eine Marke, eine Feder und erlaubte ihm, ihre Briefmappe als Unterlage zu benutzen. Sie saß dicht daneben, in einem Sessel, eine Zeitung lesend, während er schrieb:
Lieber Kaspar. Ich bin wieder in der dir bekannten Stadt und sitze an einem schönen, dunkelgefärbten Schreibtisch in einem hellerleuchteten Zimmer, während unten in der Straße, in der Sommernacht, unter den Bäumen voll herunterhängender Blätter die Menschen lustwandeln. Ich kann leider nicht mitpromenieren, denn ich bin an ein Haus gefesselt, nicht gerade mit Händen und Füßen, aber mit dem Pflichtbewußtsein, das ich nach und nach ausbilde, und das auch schließlich einmal da sein will. Ich bin der Diener einer Frau geworden, die einen kranken, kleinen Knaben hat, den ich pflegen muß, nicht viel anders, als wie eine Mutter ihren Sohn pflegt, denn seine Mutter, meine Herrin, wacht über jeder meiner Bewegungen, als wäre ihr Auge der Leiter meines Tuns und als flöße sie mir ihre eigene Sorgfalt ein, wenn ich mit dem Knaben beschäftigt bin. Sie sitzt jetzt, während ich an dich schreibe, neben mir, in einem Sessel, denn es ist ihr eigenes Kabinett, in dem ich sitze durch ihre Erlaubnis. Die Dinge liegen jetzt so, daß ich jedesmal, wenn mich eine persönliche Sache hinaustreibt, zuerst fragen muß, darf ich ausgehen?, wie ein Lehrjunge, der seinen Meister fragen muß. Immerhin, es ist doch wenigstens eine Dame, die ich um so etwas bitten muß, und das versüßt ein wenig die Sache. Unter Dienen versteht man das Aufpassen auf Befehle, die Vorausahnung der Wünsche, die fertige Fixheit und fixe Fertigkeit im Tafeldecken und Teppichabbürsten, mußt du wissen, wenn du es noch nicht weißt. Ich habe bereits eine gewisse Vollkommenheit darin erlangt, meiner Frau, die ich schlechthin meine Frau heiße, die Schuhe zu putzen. Es ist nur ein kleines, geringes Geschäft, und doch verlangt es auch Streben nach Vollendung, wie das Größte. Mit dem kleinen, jungen Herrn werde ich, wenn es schönes Wetter ist, in Zukunft spazieren gehen müssen. Dazu ist ein braunes Wägelchen da, in dem ich den Knaben ausfahren kann, worauf ich mich, wenn ich recht nachdenke, eigentlich wenig freue, da es langweilig sein wird. Du lieber Gott, ich werde es tun müssen. Meine Herrin gehört zu der Sorte von Weibern, an denen das Hervorstechende und Markante das Bürgerliche ist. Sie ist durch und durch Hausfrau, aber in so strengem und schlichtem Sinn, daß man sagen kann: es ist vornehm. Zu zürnen versteht sie meisterlich und ich wiederum bin Meister darin, ihr dazu Anlaß zu geben. Zum Beispiel heute zerschlug sie einen reichen Porzellannapf aus Gedankenlosigkeit und ward böse auf mich, daß ich es nicht war, der ihn zerschlug. Sie zürnte mich an, weil ich der unangenehme Zeuge ihrer Ungeschicktheit war und sie machte ein Gesicht, wie es die Fliegenden Blätter öfters in ihren Darstellungen bringen. Ein reines Fliegende-Blätter-Gesicht. Ich habe die Scherben recht zärtlich-langsam aufgehoben, um die Frau zu ärgern, denn ich muß sagen, ich ärgere sie gern. Sie ist reizend im Ärger. Schön ist sie nicht, aber solche strenge Frauen atmen, wenn sie in lebhafte Bewegung kommen, einen tiefen Zauber aus. Die ganze sittsame Vergangenheit solcher Frauen zittert in ihren Erregungen, die deshalb köstlich anzuschauen sind, weil sie aus so zarten Ursachen entflammen. Für mich ist das nun einmal so, ich muß solche Weiber lieb haben, denn ich bewundere und bemitleide sie zu gleicher Zeit. Hochmütig können solche Frauen sein in Sprache und Gebaren, daß die Wangen beinahe platzen und sich der Mund zu schmerzendstem Hohn zuspitzt. Ich liebe solchen Hohn, denn er macht mich zittern, und ich bin gern voll Scham und Wut: das treibt zu Höherem, das reizt zu Taten. Aber meine Frau da, die höhnische, ist doch nur ein gutes, sanftes Weib, ich weiß es, und das ist die Schurkerei an der Sache: daß ich es weiß. Wenn ich ihr, auf ihren befehlenden Ton hin, gehorche, so muß ich dabei lachen, denn ich bemerke, es freut sie, zu sehen, wie gern und schnell ich gehorche. Wenn ich sie nun um etwas bitte, so schnauzt sie mich an und gewährt doch gütig, vielleicht mit ein wenig Ärger darüber, daß ich in solch einer Art und Weise bitte, der man gewähren muß. Ich tu ihr immer ein bißchen weh, und denke: ganz recht! Tu das! Tu ihr immer ein bißchen weh. Das ist amüsant für sie. Das will sie. Das erwartet sie nicht anders! Frauen sind so leicht erkennbar, und doch haben sie so viel Unerkennbares. Nicht wahr, das ist seltsam, lieber Bruder! Sie sind jedenfalls das Belehrendste, was es auf der Welt für einen Mann gibt. – Wenn die wüßte, die neben mir sitzt, was ich schreibe! Einer meiner brennendsten Wünsche ist, so bald wie möglich von ihr eine Ohrfeige zu erhalten, aber ich muß leider zu meinem Schmerz daran zweifeln, daß sie dazu imstande ist. Eine klatschende Ohrfeige ins Gesicht: ich möchte alle Küsse, die ich noch erwarten darf, dafür weggeben. Dieses mit der Ohrfeige ist nun eigentlich eine abscheuliche, aber dafür eine echt bourgeoise Empfindung: sie lenkt in die Kindheit zurück, und wann hätte man nicht öfters Sehnsucht nach dem Weit-zurückliegenden? Meine Frau hat so etwas Zurückliegendes, etwas, bei dessen Anschauen man weit, weit zurückdenkt, an eine vielleicht noch frühere Zeit als die Kindheit ist. Ich werde ihr wahrscheinlich einmal die Hand küssen und dann wird sie mich zum Kuckuck jagen, zum Tempel hinaus, wie man sagt. Mag ich's und mag sie's dann. Was wird daran liegen. – O ich verteufle hier, kann ich dir nur sagen, ich merke es schon jetzt. Mein Geist gibt sich mit Serviettenfalten und Messerputzen ab und das Schiefe ist, es gefällt mir. Kannst du dir eine größere Versimplung denken! Wie geht es dir? Ich war drei Monate lang auf dem Land, aber es ist mir, als sei diese Zeit schon weit hinter mir zurück. Ich habe alle Aussicht, ein Mensch zu werden, der sich völlig dem Tag hingibt, ohne seiner Verwandtschaft mit schwebenderen Dingen mehr zu gedenken. Manchmal bin ich sogar zu faul, an dich zu denken, und das scheint mir schon eine große Trägheit zu sein. Klara hoffe ich bald einmal wieder zu sehen. Vielleicht hast du sie bereits vergessen, und dann habe ich nicht an diesen Gegenstand zu rühren. Ich tue es auch nicht. Adieu, mein Bruder.
»An wen haben Sie geschrieben,« fragte die Frau, ermüdet vom Zeitungslesen, als sie sah, daß Simon den Brief beendet hatte.
»An einen Freund von mir, der jetzt in Paris lebt.«
»Was ist er?«
»Er war zuerst Buchbinder, da er aber mit diesem Beruf nicht reüssierte, ist er Restaurationskellner geworden. Ich liebe ihn sehr, er ist mit mir in die Schule gegangen, und dort habe ich mich ihm angeschlossen, weil er unglücklich war schon als Knabe. Ich habe eines Tages gesehen, wie er von seinen Klassengenossen verhöhnt, und dann eine steinerne Treppe hinuntergeworfen wurde, wobei ich gerade in seine schönen, erschreckten, gramvollen Augen sehen mußte. Seit diesem Tage bin ich sein innigster Freund geworden, und wenn das Mitleid wirklich bindet, so muß ich mich ihm verbunden fühlen, auch ohne darüber nachzudenken, für immer! Er ist ein Jahr älter als ich, aber mir um Jahre vorgeschritten in Sitte und Lebensart, denn er hat immer in Weltstädten gelebt, wo der Mensch schneller reif wird. Früher hat er viel von der Malerei geschwärmt, hat oft auch, während der Ausübung seines Buchbindergewerbes, versucht, Bilder zu malen, ist aber damit zu seinem Schmerz nicht vorwärtsgekommen, und hat mir eines Tages schamhaft zugestanden, daß er sich entschlossen habe, sich ganz in den Strudel der Welt zu werfen, die Kunst, seine Träumerei, zu vergessen, und ist Kellner geworden. Welch ein Absturz, und zugleich: welch ein bewundernswerter Aufschwung! Ich habe ihm gesagt, daß ich ihn dafür liebe und bewundere, um ihn zu trösten, wenn er in stillen, einsamen Stunden sich dem Weh der Erinnerung verfallen sehen mußte. Das ist klar, daß er oft Sehnsucht nach jenem Besseren empfinden muß, während um ihn das Leben lärmt. Aber sehen Sie, gnädige Frau, dieser Mensch ist stolz und gut. Zu stolz, um einem verpaßten Leben nachzutrauern, und zu gut, um es ganz beiseite lassen zu können. Ich kenne jede seiner Empfindungen. Einmal hat er mir geschrieben, er sterbe wohl bald vor Öde und Langeweile. Das war seine Seele. Und ein anderes Mal schrieb er mir: »Die dumme Träumerei! Das Leben ist das Süße. Ich trinke Absinth und bin selig!« Das war sein Mannesstolz. Sie müssen wissen: Die Frauen schwärmen für ihn, denn er hat etwas Herzenherausforderndes an sich und wieder etwas Eisig-Kaltes. Seine ganze Erscheinung, trotz des Kellnerfrackes, atmet Liebe und Takt.«
»Wie heißt er, dieser verunglückte Mensch,« fragte die Frau.
»Kaspar Tanner.«
»Wie? Tanner? So heißen ja Sie auch. Er ist also Ihr Bruder und Sie sagten vorhin, er sei Ihr Freund.«
»Freilich, mein Bruder, aber viel mehr mein Freund! Solch einen Bruder muß man Freund nennen, wenn man die richtige Bezeichnung haben will. Wir sind nur zufällig Brüder, aber Freunde sind wir mit Bewußtsein, und das ist viel wertvoller. Was ist Bruderliebe? Als wir noch Brüder waren, packten wir uns eines Tages am Halse, beidseitig, und wollten uns den Garaus machen. Hübsche Liebe! Unter Brüdern ist der Neid und der Haß nichts Außerordentliches. Wenn Freunde sich hassen, gehen sie auseinander, wenn Brüder sich hassen, denen das Geschick das Zusammenleben unter einem Dache vorschreibt, geht es nicht so gelinde zu. Aber das ist eine alte und unschöne Geschichte.«
»Warum schließen Sie Ihren Brief nicht zu?«
»Ich möchte Sie bitten, von dem, was ich geschrieben habe, Kenntnis zu nehmen.«
Die Frau lächelte:
»Nein, das tu ich nicht.«
»Ich habe unziemlich von Ihnen gesprochen in dem Brief.«
»Es wird nicht so schlimm sein,« bemerkte sie und stand auf: »Gehen Sie zu Bett.«
Simon tat, was sie befahl, und dachte, indem er hinausging:
»Ich werde immer frecher. Bald jagt sie mich noch zum Haus hinaus!« –
Nach Verlauf von drei Wochen befand sich Simon, frei aller Verpflichtungen, in einer engen, steilen, heißen Gasse und überlegte, ob er in ein Haus treten solle, oder nicht. Die Mittagssonne brannte hinunter und preßte alle üblen Dünste aus den Mauern heraus. Kein Lüftchen wehte. Wo hätte ein Lüftchen in diese Gasse eindringen können. Draußen in den modernen Straßen mochte es wehen, aber hier schien schon seit Jahrhunderten kein Windzug mehr getrieben und gefegt zu haben. Simon hatte eine kleine Summe Geld in der Tasche. Sollte er in die Eisenbahn steigen und in die Berge reisen? Es reiste jetzt alles in die Berge. Seltsame, fremde Menschen, Männer und Frauen, zogen einzeln, paar- oder gruppenweise durch die weißen, hellen Straßen. Von den Hüten der Damen flatterten lustige Schleier herab und die Männer gingen in Kniehosen, und gelben Sommerschuhen. Sollte sich nicht Simon dazu entschließen, diesen Fremden in die Berge nachzureisen? Kühl wäre es sicher dort oben, und in einem hochgelegenen Hotel würde er sicher Arbeit finden. Er konnte ja den Führer spielen, stark war er genug dazu, und auch klug genug, um bei Gelegenheit sagen zu können: »Sehen Sie, meine Damen und Herren, diesen Wasserfall, oder diesen Bergsturz, oder dieses Dorf, oder diese Felswand, oder diesen blauen, schimmernden Fluß.« Er würde das Zeugs dazu haben, um den reisenden Herrschaften mit Worten eine Landschaft zu schildern. Auch könnte er ja, wenn der Fall einträte, eine ermüdete und ängstliche Engländerin in seinen Armen tragen, wenn es gälte, einen Paß von drei Schuh Breite zu überschreiten. Lust dazu hätte er ja. Überhaupt, die Amerikanerinnen und die Engländerinnen: er würde englisch sprechen lernen, und das war nach seinen Begriffen eine süße Sprache, die so gelispelt und gehaucht klang, so schroff und weich zugleich.
Aber er ging nicht in die Berge, sondern in das alte, hohe, dicke, finstere Haus in der Gasse, klopfte an eine Türe, und fragte eine Frau, die herauskam, um zu sehen, wer klopfe, ob hier ein Zimmer zu vergeben sei.
»Ja, es sei eines.«
»Ob er es wohl ansehen könne, und ob es wohl ein Zimmer sei, nicht zu groß, nicht zu teuer, für einen ärmeren Menschen?«
Nachdem sie ihm das Zimmer gezeigt hatte, fragte die Frau:
»Was sind Sie?«
»O, ich bin nichts. Stellenlos bin ich. Aber ich werde mir eine Stelle suchen. Seien sie unbesorgt. Ich bezahle Ihnen diese Summe hier zum voraus, damit Sie einigermaßen ruhig sein können. Hier, bitte!«
Und er gab ihr ein größeres Geldstück als Vorausbezahlung in die Hand. Es war eine fette Frauenhand, und die Frau, die zufrieden war, sagte:
»Leider ist das Zimmer nicht sonnig, es geht auf die Gasse.«
»Das ist mir sehr lieb,« erwiderte Simon, »ich liebe den Schatten. Ich würde jetzt die Sonne im Zimmer nur hassen, bei dieser warmen Jahreszeit. Das Zimmer ist sehr hübsch, und ich muß sagen, sehr billig. Es ist für mich wie geschaffen. Das Bett scheint gut zu sein. O ja. Bitte. Untersuchen wir es nicht erst lange. Hier ist auch ein Kleiderschrank, der mehr Kleider fassen könnte, als ich besitze, und hier bemerke ich zu meinem freudigen Erstaunen einen Lehnsessel zum bequemen Sitzen. In der Tat, wenn das Zimmer solch einen Sessel aufweist, so ist es in meinen Augen überreich ausgestattet. Dort hängt sogar ein Bild an der Wand: ich liebe das, wenn nur ein einziges Bild im Zimmer hängt, man kann es um so inniger betrachten. Einen Spiegel sehe ich auch, um mein Gesicht darin zu betrachten. Es ist ein gutes Glas und gibt die Züge deutlich wieder. Es gibt viele Spiegelgläser, die die Züge verzerrt wiedergeben, wenn man hineinschaut. Dieser Spiegel ist ganz vortrefflich. Hier an diesem Tisch werde ich meine Offertschreiben abfassen, die ich an verschiedene Geschäftshäuser absenden will, um eine Anstellung zu erlangen. Ich hoffe, es wird mir glücken. Ich sehe gar nicht ein, warum es mir nicht glücken sollte, da es mir schon so oft geglückt ist. Sie müssen wissen, ich habe öfters die Stellen gewechselt. Das ist ein Fehler, den ich hoffe beiseite legen zu können. Sie lächeln! Ja, das ist aber sehr ernst. Mit dem Zimmer haben Sie mir sozusagen eine Gnade erwiesen, denn es ist ein Zimmer, worin sich ein Mensch, wie ich bin, glücklich fühlen kann. Ich werde mich immer bemühen, meinen Verpflichtungen Ihnen gegenüber prompt nachzukommen.«
»Ich glaube es auch,« sagte die Frau.
»Ich wollte,« fuhr Simon fort, »zuerst in die Berge gehen. Aber dieses schattige Zimmer ist schöner als selbst die weißesten Berge. Ich fühle mich ein bißchen matt und möchte mich eine Stunde hinlegen, darf ich das?«
»Ei, freilich! Es ist doch jetzt Ihr Zimmer!«
Und dann legte er sich schlafen.
Er hatte einen sonderbaren Traum, der ihn noch lange nachher beschäftigte:
Es war in Paris, aber warum es in Paris war, das wußte er nicht mehr. Zuerst ging er durch eine Straße, die war ganz mit grünem, saftigem Laub bedeckt, so daß die Schleppen der Damen das Laub rauschend hinter sich nachzogen. Immer fiel ein leiser grüner Regen von kleinen, flüsternden Blättern, und ein unaussprechlich sanfter Wind wehte daher, wie ein Hauch von Wolken. Die Häuser waren wunderbar hoch, bald grau, bald gelblich, bald schneeweiß. Die Männer, die auf der Straße dahergingen, trugen die Locken lang herunter, wo sie über die Schultern fielen, auch Zwerge mit schwarzen Fräcken und roten Hüten liefen, sie konnten den anderen zwischen den gekreuzten Beinen durchschlüpfen. Die Damen in ihren Schleppen waren herrliche Figuren, groß, viel größer als die Männer, die doch auch schlank erschienen. An den schlanken Büsten der Damen hingen Lorgnetten bis zum Leib hinunter und ein Bogen von schweren, üppigen Haaren überspannte ihre lieblichen Köpfe. Obenauf saßen winzige Hütchen mit noch winzigeren Federchen, aber einzelne trugen große, weit und herrlich herunterfallende Federn, die den ganzen Kopf zurückzubiegen schienen. Etwas Wundervolles waren die Hände und die Arme der Frauen, die mit langen, schwarzen Handschuhen bis über die zierlichen Ellbogen hinaus bedeckt waren. Es schien überhaupt, so weit man blickte, alles wundervoll. Die großen Häuser wollten sich immer auf und nieder bewegen wie seltsame natürliche Kulissen in einem Theater. Das Licht gehörte halb dem Tag und halb wieder der vorgerückten Nacht. Jetzt gelangte man zu einem Haus, das ganz mit wildem Grün überdeckt war. »Dort wohnen die schönsten Frauen von Paris«, wurde einem gesagt, wenn man frug. Auf einmal bog sich eine duftige, weiße Wolke in die Straße herunter. Wenn man erstaunt fragte: »Was ist das?« wurde geantwortet: »Sie sehen, es ist eine Wolke. Eine Wolke ist in den Pariserstraßen keine seltene Erscheinung. Sie aber sind wohl Ausländer, daß Sie sich noch darüber verwundern können.« Die Wolke blieb als ein weißer Schaum, ähnlich einem großen Schwane, auf der Straße liegen. Viele Damen liefen zu ihr hin und rupften kleine Stücke davon ab und setzten sie sich, unter wundervollen Armbewegungen, auf die Hüte oder warfen sie einander scherzend zu, daß sie an den Kleidern hängen blieben. Man dachte: »Seht doch, diese Pariser! Da lächeln sie leicht über den Ausländer, der sich wundert. Aber wundern sich die Pariser nicht selber jeden neuen Tag über die Schönheiten ihrer Stadt!« Dann kamen die bösen Pariser-Gassenjungen und kitzelten die Wolke mit brennenden Streichhölzchen, da flog die Wolke wieder auf, leicht und majestätisch in die Höhe, bis sie über den Häusern verschwand. Wieder beobachtete man die Straße. In den schönen, vorspringenden Restaurants servierten die Kellner in hellgrauen Fräcken und die Damen tranken Kaffee und plauderten mit ihren entzückenden Stimmen. Poeten standen auf erhöhten Brettern und sangen die Lieder, die sie zu Hause gedichtet hatten. Sie waren in braunen, edlen Samt gekleidet. Es waren keine lächerlichen Erscheinungen, nichts weniger als das. Man amüsierte sich mit dem, was sie zum besten gaben, ohne ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, was in Paris unmöglich wäre. Schöne, schlanke Hunde liefen hinter den Menschen her und betrugen sich so, als wüßten sie, daß man sich in Paris gut aufführen muß. Jegliche Figur und Erscheinung schien mehr zu schweben, als zu gehen, mehr zu tanzen, als zu schreiten, mehr zu fliegen als zu laufen. Und doch lief, ging, sprang, schritt und marschierte alles ganz natürlich. Die Natur schien sich in dieser Straße niedergesetzt zu haben. Ganze Schafherden durchzogen mit Geläute, das immer bim-bim machte, die Straße wie ein abendliches Tal, den dunkelgekleideten Hirten voran. Dann kamen Kühe mit großen Glocken: bim-bam und: bum-bum! Und doch war es eine Straße und gar keine Bergweide, mitten in Paris war es, im Herzen der europäischen Eleganz. Allerdings, die Straße war breit wie ein großer, breiter Strom. Jetzt auf einmal wurden die Lichter angezündet, von kleinen, behenden Jungen, die lange Anzünderstäbe trugen. Mit diesen machten sie die Hähne oben an den Laternen auf, daß das Gas herausströmte aus den Leitungen und zündeten dann an. So sprangen sie von einer Laterne zur andern, bis alle angezündet waren. Nun schimmerten die Lichter überall hervor und schienen zu wandern mit den beweglichen Menschen. Was war das für ein zauberhaftes, weißes Licht, und diese Teufelsjungen, die es entzündeten, wo sprangen sie her, wo hin, wo weg, wo hinaus? Wo waren sie zu Hause, hatten sie auch Eltern, Brüder, Schwestern, gingen sie auch zur Schule, konnten sie auch groß werden, Frauen heiraten, Kinder erzeugen, alt werden und sterben? Sie waren alle in blaue kurze Röcke gekleidet gewesen und schienen Gummischuhe getragen zu haben, denn man hörte sie nur huschen, nicht gehen. Weg waren sie. Nun sah man, so wie es Abend wurde, wunderbar-merkwürdige Frauengestalten auf der wandelnden Straße. Sie trugen übergroße Haarfüllen, mit hellgelben und tiefschwarzen Haaren. Ihre Augen glänzten und schimmerten, daß es einem weh tat. Das Herrlichste an ihnen waren die Beine, die nicht von Schleppen oder Röcken bedeckt waren, sondern sich zeigten bis zur Kniehöhe, von wo an eine spitzenrauschende Hose sie umhüllte. Die Füße, bis hinauf beinahe zu den biegsamen Knieen, waren mit hohen, aus feinstem Leder geschaffenen Schuhen bekleidet. Die Schuhe selbst waren das Zarteste, was sich dazu eignen konnte, einen bewegsamen Frauenfuß zu umschließen. Man mußte nur sehen und aus dem Herzen heraus lachen. Der Gang dieser Frauen hatte etwas zum Jubeln Schwebendes, wieder Schweres und wieder Tanzendes. Wie die gingen, das war zum Nachzeichnen und Mitfühlen, das hob einen mit, und zog einen nach, machte einen mit den Augen das Süße anträumen, machte die Seele erwachen und nachdenken darüber, wie es komme, daß Gott die Frauen so schön erschaffen. Man fühlte lebhaft: »Wenn die Götter irgendwo heimisch sein könnten auf der Erde, was zwar nicht denkbar, so müßte dieser Ort Paris sein.« Auf einmal, ohne daß er es sich versah, befand sich Simon auf einer aus dunklem Holz gezimmerten und geschnitzten Treppe, die ihn in ein Zimmer hinaufführte, wo auf einem Diwan ein schlafendes Mädchen lag. Wie er näher zusah, war es Klara. Ein Kätzchen schlummerte neben ihr, und die Schlafende hielt es mit dem Arm umschlungen. Ein Diener, ein Neger, trug ein Abendessen herein, und Simon setzte sich an den Tisch, während aus der Zimmerdecke hernieder, wie das Geplätscher eines kostbaren, erfinderischen Brunnens, eine leise, gedämpfte Musik rauschte, die bald in der Ferne und bald neben seinem Ohr erklang. »In Paris wird seltsam serviert,« dachte Simon, indem er es sich, wie in einem Märchen von Gebrüder Grimm, wohlschmecken ließ. Da erwachte die Schlafende. »Komm, ich will dir etwas zeigen,« lispelte sie ihm zu. Er erhob sich, und sie öffnete mit einem Zauberstab, wie es schien, eine Flügeltüre, wenigstens sah man nicht, daß sie eine ihrer Hände dazu gebrauchte. »Ich bin jetzt eine Zauberin geworden,« lächelte sie den erstaunten Simon an, »zweifle nicht daran, aber laß es dich auch keineswegs erschrecken. Ich zeige dir nichts Abstoßendes.« Er ging mit ihr in das andere Zimmer, sie hauchte ihn mit ihrem duftenden, warmen Atem an, und auf einmal erblickte er seinen Bruder Klaus, wie er dasaß und an seinem Schreibtische schrieb. »Er ist fleißig und schreibt an seinem Lebenswerke,« sprach Klara mit leiser, hindeutender Stimme. »Siehst du, wie er ein gedankenvolles Gesicht macht. Er geht in seinen Betrachtungen über den Lauf der Flüsse, die Geschichte und das Alter der Berge, die Windungen der Täler und der Erdschichten unter. Aber dazwischen denkt er jetzt seines Bruders, er denkt an dich! Sieh, wie seine Stirne sich faltet. Du scheinst ihm Sorgen zu machen, du Böser! Er kann leider nicht sprechen, sonst würden wir beide hören, wie er denkt über dich und was er zu deinem Tun meint, das ihn bekümmert. Er liebt dich, sieh ihn nur an! Ein solcher Mensch liebt seinen Bruder und möchte ihn in der Welt als braven, geachteten Mann wissen. Aber das Bild löst sich, wie ich sehe, schon auf. Komm. Ich zeige dir jetzt etwas anderes.« – Indem sie das sagte, öffnete sie zugleich eine zweite, etwas kleinere Türe mit ihrem Stäbchen, das sie wirklich in der Hand trug, und Simon erblickte seine Schwester Hedwig ausgestreckt auf einem mit weißen Linnen bedeckten Lager. Es duftete wundervoll nach Kräutern und Blumen in diesem Gemach. »Sieh sie an,« sagte Klara, und ein Zittern ließ ihre klare, leise Stimme erbeben, »sie ist gestorben. Das Leben tat ihr zu weh. Weißt du, was es heißt, Mädchen sein und leiden? Ich habe ihr einen Brief geschrieben, einen langen, heißen, sehnsuchtsvollen Brief, damals, du weißt, und sie hebt nie mehr die Hand, um mir zu antworten. Sie geht, ohne auf die Frage der Welt: »Warum kommst du nicht?« geantwortet zu haben. Wie sie wortlos scheidet: so mädchen- und blumenhaft! Wie lieb sie war. Du als Bruder empfindest das lange nicht so, wie ich als Freundin. Siehst du, wie sie lächelt! Wenn sie noch reden könnte, würde sie sicher freundlich reden. Sie redete streng. Sie hat sich jammernd auf die Lippen gebissen. Das siehst du aber ihrem Mund nicht an. Der Tod muß sie geküßt haben, daß sie immer noch lächeln kann, im Tode! Es war ein tapferes Mädchen. Wie eine Blume ist sie gestorben, die stirbt, wenn sie welkt. Laß uns weiter gehen. In meinem Zauberreich darf man nicht gaffen. Habe ich dir weh getan, sag mal? Nein doch: was ist Schmerzendes an einem so schönen Tod? Ihr ließt sie leiden, das, das war schmerzhaft. Ich will dir nicht weh tun. Komm, jetzt wirst du noch etwas anderes sehen.« Und mit diesen Worten ließ sie eine dritte Tür aufspringen, und Simon schaute in ein geräumiges Maleratelier. Er spürte den Geruch von Ölfarben, und an den Wänden sah er seines Bruders Bilder herumhängen, er selber, Kaspar, arbeitete, den Rücken zeigend, an einer Staffelei, ganz versunken, wie es schien, in die Arbeit. »Still, störe ihn nicht, er arbeitet,« sagte Klara, »man darf Schaffende nicht stören. Ich wußte immer, daß er nur für die Kunst lebte, schon damals, als ich noch glaubte, ihm zu folgen, ihm folgen zu können. Nein, es ist besser so. Ich würde ihn nur aufgehalten und gehindert haben. Er muß alles um sich her vergessen, selbst das Liebste, wenn er will, daß er schaffen kann. Solch ein Schaffen verlangt Abtötung alles Lieben und Innigen, um eine Liebe und eine Innigkeit ganz auf das Schaffen zu übertragen. Das verstehst du nicht, das versteht nur er. Wenn du mich ihn so sehen siehst, glaubst du da nicht, daß es mich drängt, mich ihm in die Arme zu werfen? Zu hören, was er mir sagt, wenn ich ihn flüsternd und voll Bangen frage: »Liebst du mich, Kaspar?« Er würde mich dann sicher streicheln, aber ich würde voll Ahnung einen Zug des Mißmutes auf seiner schönen Stirne entdecken. Und diese Entdeckung würde mich, wie eine für immer Verdammte, tausend Höhen vor ihm in einen unwürdigen, schmutzigen Abgrund hinunterwerfen. Nein, das macht Klara nicht. Sie ist mir zu gut zu so etwas, und er ist mir zu gut und zu lieb, so, wie er ist. So stehe ich hinter seinem Rücken, und darf ruhig ahnen, wie er schafft, wie er die große, feurige, dampfende Kugel, die Kunst, vorwärtswälzt, einem herrlichen Ringer gleich, der seinen letzten Atemzug hergibt, um zum Siege über den Gegner zu gelangen. Siehst du, wie es ihn hinreißt, den Pinsel zu führen, womit er an der tausendtönigen Glocke seiner Farben läutet, jede Linie linienhafter, jede Farbe farbiger, jeden Druck bestimmter, und jede Sehnsucht sehnsuchtsvoller hinzumalen. Sein Blick, den ich so liebte, war von jeher in den Formen, und er bedarf hier in Paris nur einer einfachen Stube, um die Welt in Bildern zu erfassen. Die Natur hat er wie eine üppige Geliebte in seine Arme gefaßt und drückt nun Küsse um Küsse auf ihren Mund, daß beiden der Atem vergeht, ihm und der Natur. Es will mir beinahe scheinen, als sei die Natur, echten Künstlern gegenüber, machtlos und ohnmächtig vor Hingebung, wie eine solche Geliebte, von der man alles verlangt, was man will. Auf jeden Fall, und du siehst es, hat Kaspar zu tun, mit Kopf, Gefühl und mit beiden Händen; wie ein wildes, ungebändigtes Pferd zerrt und arbeitet er, und wenn er nachts schläft, so arbeitet er in wilden Träumen noch immer fort; denn die Kunst ist hart und scheint mir die schwerste Aufgabe, die sich ein ehrenhafter und aufrichtiger Mensch stellen kann. Störe ihn nie an seiner heiligen Aufgabe; denn er schafft für die Lust späterer Geschlechter. Wenn ich ihm nun so meine schwache, arme Liebe aufdrängen wollte, was wäre das für eine unschöne, verdammenswerte Sache. Eine Frau mag auch nicht gerne da küssen, wo sie fühlen muß, daß verletzte Gedanken zwischen den Küssen zucken, die sterben, die von den Küssen erwürgt werden. Welch eine unüberlegte Mörderin wäre man! So aber ist alles schön; ein bißchen weh tut es einem, hinter einem Rücken und hinter Schultern und Locken stehen zu sollen, aber man hört in seiner Seele dafür Glocken läuten und empfindet die süße Berechtigung und Makellosigkeit seiner Stellung in der Welt. Irgendwo müssen die Gefühle gedämpft und geordnet werden und Stellung behaupten. Selbst eine schwache Frau wird genau wissen, was sie in einem solchen Fall zu tun hat. Einem Künstler zuzuschauen, jeder seiner Bewegungen gedankenvoll zu folgen, ist schöner, als ihn beeinflussen zu wollen, als ob man gierig wollte, daß man auch etwas abbekäme, etwas bedeutete für ihn und die Welt. Jede Stellung hat ihre Bedeutung, aber das unbefugte Dreinreden und Einmischen niemals! Vieles müßte ich dir noch sagen. Aber komm jetzt.« – Wieder tönte eine wundersame, unbegreifliche Musik, aus allen Zimmern, zu allen Decken und Wänden heraus, wie ein fernes, aus einem kleinen Wäldchen kommendes, tausendstimmiges Vogelgezwitscher, als Simon von Klara weggeführt wurde. Sie traten wieder in das erste Gemach und sahen das schwarze Kätzchen mit seiner Pfote in einen dünnhalsigen Milchkrug hineingreifen. Als es aber die beiden Menschen sah, sprang es fort und kauerte sich hinter einen Stuhl, wo es mit seinen brennend-gelben Augen aufmerksam hervorguckte. Klara öffnete ein Fenster, und: wunderbarer Anblick! Es schneite in der sommerlichen, grünen Straße, und zwar so dicht, so sehr Flocke an Flocke, daß ein Hindurchschauen unmöglich war. »Das ist hier in Paris keine Seltenheit,« sagte Klara, »es schneit hier mitten im heißen Jahr, es gibt hier keine bestimmten Jahreszeiten, so wie es auch keine bestimmten Redensarten gibt. In Paris muß man auf alles schnell gefaßt sein. Wenn du längere Zeit hier wohnst, wirst du es auch lernen und wirst dir das Staunen, das nicht am Platz ist, abgewöhnen. Hier ist alles ein schnelles, graziöses, bescheidenes Erfassen. Achtung vor der Welt: das gilt hier als das Höchste und Feinste. Du wirst es schon lernen. Zum Beispiel, dieser Schnee: Was glaubst du wohl; wirst du dir denken können, daß er bis über die hohen Häuser hinaufkommen wird? Es ist so, und aller Wahrscheinlichkeit nach liegen wir jetzt einen Monat lang im Schnee begraben. Was tut es viel: wir haben Beleuchtung und eine warme Stube. Ich werde meistens schlafen; denn eine Zauberin muß eben viel schlafen; du wirst mit dem Kätzchen spielen oder ein Buch lesen, ich habe die schönsten Pariserromane hier in meiner Bibliothek. Die Pariserdichter schreiben entzückend, du wirst sehen. Und dann nach einem Monat, apropos: wir haben ja auch Musik, nicht wahr, und dann, wie gesagt, nach einem Monat ist Frühling in den Pariserstraßen. Da wirst du sehen, wie nach der langen Eingeschlossenheit sich die Menschen auf offener Straße umhalsen und Tränen der Wiedersehensfreude weinen werden. Es wird alles ein Umschlingen sein. Die Lust, die lange zurückgehaltene, wird zu den glänzenden Augen, zu den Lippen und Stimmen herausbrechen, und geküßt wird werden im Mai, aber du wirst es an dir selber erfahren. Stelle dir vor, die Luft wird ganz blau und warmfeucht in die Straßen hinuntersinken, der Himmel geht dann in Paris spazieren und mischt sich unter die entzückten Menschen. Die Bäume blühen an einem Tag empor und duften wunderbar, Vögel werden singen, Wolken werden tanzen und Blumen durch die Luft schwirren wie ein Regen. Und das Geld wird sich in den Taschen, selbst in den ärmsten und zerrissensten vorfinden. Aber ich will jetzt schlafen. Siehst du, wie ich schon schläfrig werde. Benutze du indessen die Zeit und studiere eines der Werke, das du finden wirst und das geeignet ist, dich einen ganzen Monat lang zu fesseln. Es gibt solche Bücher. Gute Nacht!« – Und damit schlief sie ein. Die Katze aber wollte sich zu ihr hinauf legen, Simon sprang ihr nach, sie entfloh, er ihr nach, und immer entwischte sie ihm aus den Händen, wenn er sie schon erfaßt hatte. Er sprang sich in eine furchtbare Atembeklemmung hinein, aus der er schließlich erwachte.
»Ich habe da einen wehmütigen Traum gehabt,« dachte er, als er sich vom Bette erhob.
Es war inzwischen Abend geworden. Er ging an das Fenster und schaute zum ersten Mal in die Gasse hinunter, die tief unter ihm lag. Zwei Männer gingen dort unten, sie hatten gerade Platz zwischen den hohen Mauern, um bequem nebeneinander herzugehen. Sie sprachen, und der Klang ihrer Worte drang seltsam deutlich zu seinen Ohren hinauf, die Mauern entlang die den Klang weitertrugen. Der Himmel war von einem goldenen, tief-satten Blau, das eine unbestimmte Sehnsucht erweckte. Simon gerade gegenüber tauchten jetzt im Fenster des andern Hauses zwei Weibergestalten auf und berührten ihn mit ihren ziemlich frechen, lachenden Blicken. Es war ihm, als würde er mit unsauberen Händen angerührt. Die eine der Gestalten sagte zu ihm hinüber, mit ganz gewöhnlich-lauter Stimme, – denn es war, als säße man zusammen zu Dritt in einem Zimmer, in dem sich nur zufällig ein schmales Band freier Himmelsluft befände: »Sie sind wohl sehr einsam!«
»O ja! Aber es ist hübsch, einsam zu sein!«
Und er schloß das Fenster, während die beiden Weiber in ein Gelächter ausbrachen. Was konnte er mit ihnen reden, was nicht unflätig gewesen wäre. Heute war er nicht aufgelegt. Die Veränderung, die wieder in sein Leben eingerissen war, hatte ihn ernst gestimmt. Er zog die weißen Vorhänge vor, zündete die Lampe an, und las in dem Roman von Stendhal weiter, den er auf dem Land, bei Hedwig, nicht hatte fertig lesen können.
Nachdem er eine Stunde gelesen hatte, löschte er die Lampe aus, öffnete das Fenster, ging zum Zimmer hinaus, zu der Haustüre hinaus, auf die steile Straße. Eine schwere, warme Dunkelheit empfing ihn. Das alte Stadtviertel war voll von kleinen Wirtschaften, so daß einem beim Gehen die Wahl schwer werden konnte. Er ging noch einige Schritte in der lebhaft von Menschen erfüllten Straße und trat dann in eine Kneipe ein. Um einen runden Tisch herum war eine kleine, fröhliche Gesellschaft versammelt, deren Mittelpunkt ein kleiner Spaßmacher sein mußte; denn alles lachte, sowie er nun den Mund auftat. Es mußte einer jener Menschen sein, die, was sie auch sagen mochten, stets komisch und lachmuskelerregend wirkten. Simon setzte sich zu zwei noch jungen Männern an den gleichen Tisch und horchte unwillkürlich auf das, was sie sprachen. Sie sprachen ernsthaft und in ziemlich klugen Ausdrücken miteinander. Der Gegenstand ihrer Auseinandersetzung schien ein junger, unglücklicher Mann zu sein, den sie beide mochten näher gekannt haben. Jetzt aber ließ der eine von ihnen den andern, ohne ihn zu unterbrechen, erzählen, und Simon hörte folgendes:
»Ja, er war ein prachtvoller Kerl! Schon als Knabe, als er noch langes Haar und kurze Hosen trug und an der Hand eines Kindermädchens durch die Straßen der kleinen Stadt spazieren ging. Die Leute sagten, indem sie sich nach ihm umsahen: »Welch ein bildhübscher, kleiner Kerl!« Seine Aufgaben hat er mit viel Talent gemacht, ich meine seine Schüleraufgaben. Seine Lehrer haben ihn geliebt; denn er war sanft und gut zu erziehen. Seine Klugheit machte es ihm spielend leicht, seine Pflichten in der Schule zu erfüllen. Er hat prachtvoll geturnt, gezeichnet und gerechnet. Wenigstens weiß ich, daß ihn die Lehrer den später nachkommenden Schülergenerationen und sogar den weiter vorgeschrittenen Klassen als ein Muster gepriesen haben. Seine weichen Gesichtszüge mit den wundervollen Augen voll männlicher Ahnung bestrickten alle, die mit dem Knaben zu tun hatten. Er genoß eine gewisse Berühmtheit, als ihn seine Eltern auf die höhere Schule schickten. Von der Mutter verzärtelt, was jedermann begriff, und von allen bewundert, mußte sein Geist frühzeitig jene Weichheit der Bevorzugten und Anerkannten erhalten, jenes Gehenlassen, jene schöne Sorglosigkeit, die dem jungen Menschen gestattet, sich der Genüsse des Lebens spielend zu bemeistern. In die Ferien brachte er glänzende Zeugnisse und eine Schar junger Kameraden mit nach Hause und berauschte das Ohr seiner Mutter mit Erzählungen von seinen mannigfachen Erfolgen. Natürlich verschwieg er seiner Mutter die Erfolge, die er schon damals begann, bei den leichtfertigen Mädchen zu machen, die ihn schön und liebenswürdig fanden. Die Ferien benutzte er zu Wanderungen im Tiefland; auf den ausgedehnten, hohen Bergen, die ihn lockten, weil sie so hoch hinauf und so weit in die unbestimmteste Ferne sich hineindehnten, verbrachte er Tage, nicht nur Stunden, mit der ausgelassenen Gesellschaft von gleich schwärmerisch Gesinnten wie er selber. Er bannte und bezauberte sie alle. – Er glich in seiner Gesundheit und Schmiegsamkeit, sowohl seelisch wie körperlich, einem Gott, der nur zum Vergnügen eine Zeitlang auf dem Gymnasium zu studieren schien. Wenn er ging, sahen ihm die Mädchen nach, als würden sie von seinen zurückgeworfenen Blicken an ihn herangezogen. Auf seinem blonden, schönen Kopf trug er kokett die blaue Studentenmütze. Er war entzückend leichtsinnig. Einmal, es war gerade Jahrmarkt, und der große Platz, wo sonst das Vieh zusammengetrieben wird, stand voller Buden, Hütten, Karussells, Rutschbahnen und Reitbahnen, schoß er mit einem scharf geladenen Vogelgewehr, statt mit einer der üblichen, unschädlichen Flinten, in eine Schießbude hinein, vor der er immer zu sehen war, da ihn das Mädchen, das dort die Gewehre darreichte, entzückte. Die kleine Kugel drang durch die Leinewand der Bude hindurch, in den Wagen hinein, der dicht dahinter stand, und soll dort um ein Haar ein in einer Wiege schlafendes, kleines Kind verletzt haben. Es war der Wagen, den diese herumziehenden Leute als Familienwohnung benutzten. Der Streich kam natürlich aus, mehrere andere Streiche kamen zu dem einen, und das nächste Mal, als wieder Ferien waren, stand in dem Zeugnis des jungen Studenten eine bissige Bemerkung des Rektors, der gleichzeitig den Eltern einen Brief, großzügig und voll Feierlichkeit, schrieb, worin er ihnen ans Herz legte, ihren Sohn freiwillig aus der Schule zu nehmen, da sonst die Notwendigkeit bevorstünde, denselben auszuweisen. Gründe: sinnloses Betragen, Ansteckung, böse Einwirkung, Unverantwortlichkeit, hohe Verantwortung, Pflichten und doch Rücksichten und alles jenes, was eben für einen solchen Fall immer Gründe sind: die Sittlichkeit in Gefahr und: Schutz der noch Unverdorbenen, und so weiter.« –
Der erzählende Mann schwieg eine Weile.
Diese Gelegenheit benutzte Simon, um sich bemerkbar zu machen und sagte:
»Ihre Erzählung interessiert mich aus manchem Standpunkt. Bitte, gestatten Sie mir, daß ich Ihnen ferner zuhören darf. Ich bin ein junger, eben aus seiner Lebensstellung herausgetretener Mann und lerne vielleicht einiges aus Ihrer Erzählung; denn mir scheint, daß man immer gewinnt beim Anhören einer wahrhaften Geschichte.« –
Die beiden Männer sahen sich Simon aufmerksam an, doch schien er ihnen keinen unguten Eindruck zu machen, vielmehr bat ihn der, der erzählt hatte, nur zuzuhören, wenn es ihm Spaß machen könne, und jener erzählte weiter:
»Die Eltern des Jünglings gerieten natürlich ob dieser Ausweisung in große Bestürzung und in noch größeren Kummer; denn wo gäbe es Eltern, die so gleichgültig wären, daß sie sich in einem so betrübenden Fall, wie dieser war, in alltäglicher Weise benehmen könnten. Sie meinten zuerst, daß es am besten sei, den Schlingel ganz aus der gelehrten Laufbahn fortzunehmen, und ihn einen harten Beruf, wie Mechaniker oder Schlosser, lernen zu lassen. Das Wort und Land Amerika kam ihnen schon in den Sinn, es mußte ihnen angesichts der Lage ihres Sohnes beinahe von selbst zufliegen. Aber es kam anders. Wiederum siegte die Zärtlichkeit der Mutter, wie schon so oft, wenn der Vater energisch einzuschreiten gesonnen war, so auch bei dieser Gelegenheit. Der junge Mann wurde in ein entlegenes, einsames Seminar geschickt, wo er sich auf den Lehrerberuf vorzubereiten hatte. Es war ein französisches Seminar, wo der Junge gar nicht anders konnte, als sich, wie es sich geziemte, aufzuführen. Wenigstens ging er von da aus, nach Ablauf seiner Zeit, als praktischer, jugendlicher Lehrer in die Welt. In der Nähe seiner Heimatstadt bekam er eine vorläufige Stelle als Lehrer. Er unterrichtete die Kinder so gut, als er nur vermochte, las, wenn es ihm die Zeit erlaubte, zu Hause die französischen und englischen Klassiker in ihrer Sprache; denn er hatte für Sprachen ein wahrhaft wunderbares Talent, dachte heimlich an eine andere Karriere, schrieb Briefe nach Amerika zwecks einer Anstellung als Hauslehrer, die indessen erfolglos blieben, und trieb ein Leben zwischen Pflicht und scheuer Ungebundenheit. Da es Sommer war, ging er mit seinen Schülern öfters im tiefen, reißenden Kanal baden. Er badete dann selber mit, um seinen Schülern zu zeigen, wie man es anzustellen hatte, wenn man schwimmen lernen wollte. Eines Tages aber riß ihn der Wasserstrudel derart fort, daß es aussah, wie wenn er jetzt ertrinken mußte. Die Schüler rannten schon in das Städtchen zurück, wo sie schrieen: »Unser Lehrer ist ertrunken.« Aber der junge, kräftige Mann arbeitete sich aus den Wirbeln des tückischen Wassers heraus und kam wieder nach Hause. Nach einiger Zeit befand er sich indessen an einem anderen Ort, und zwar mitten in den Bergen, in einem kleinen, aber doch reichen Dorf, wo er angenehme Menschen fand, die ihn weniger als Lehrer wie vielmehr als Menschen respektierten. Er war ein vorzüglicher Klavierspieler und flotter Geselle überhaupt, der in einer Gesellschaft von einigen Menschen den Zauberfaden der Unterhaltung ganz nur um sich herum zu drehen verstand. Ein sehr liebes, aber schon nicht mehr junges Fräulein verliebte sich in den Lehrer, derart, daß sie ihm alles nur Mögliche an Bequemlichkeit und Komfort zukommen ließ und ihn mit den ersten Leuten im Dorf bekannt machte. Sie stammte aus einer alten Offiziersfamilie, deren Vorfahren einst in fremden Ländern Kriegsdienste verrichtet hatten. So schenkte sie ihm denn eines Tages zum Andenken einen zierlichen Galanterie-Degen, der immerhin eine nicht ungefährliche Waffe gewesen sein mochte und der vielleicht gar zu seiner Zeit einmal in Blut getaucht worden war. Es war ein feines Stück, und das gute, liebe Fräulein überreichte ihm den Zierrat mit niedergeschlagenen Augen, wobei sie vielleicht einen tiefen Seufzer unterdrückte. Sie hörte ihm zu, wenn er, in romantisch edler Haltung, am Klavier saß und darauf spielte, und konnte kein Auge von seiner Gestalt abwenden. Oft fuhr sie mit ihm zusammen, da es Winter war, auf dem hochgelegenen, kleinen Bergsee Schlittschuh, und beide freuten sich dieses schönen Vergnügens. Aber der junge Mann wünschte bald wieder abzureisen, um so mehr, da er nur zu lebhaft die warmen, verlockenden Bande fühlte, die ihn so gern für immer an das Dorf gefesselt hätten, denen er aber entfliehen mußte, wenn er irgendwie noch den Wunsch besaß, nach etwas Großem in der Welt zu streben. Er reiste, und zwar mit dem Gelde des Fräuleins, die reich war, und die sich eine wehmütige und kummervolle Freude daraus machte, es ihm ohne jeden Vorbehalt zu geben. So ging er nach München, wo er ein ziemlich flottes Leben führte, nach Art der dortigen Studenten, kam wieder heim, sah sich nach einer Stelle um, und erhielt eine solche in einem Privatinstitut, das am Fuße einer tannenwaldgeschmückten Bergkette lag. Dort mußte er junge Bürschlein aus allen Erdteilen, reicher Leute Kinder, unterrichten, tat es eine Zeitlang mit großer Liebe und viel Interesse, bekam Händel mit seinem Vorgesetzten, dem Inhaber des Institutes, und reiste wieder weg. Dann kam Italien an die Reihe, wohin er sich als Hauslehrer begab, und dann England, wo er auf einem Gutsitze zwei aufwachsende Mädchen unterrichtete, mit denen er indessen nur Tollheiten trieb. Er kam wieder heim, wilde Ideen spukten in seinem Kopf, und in seinem leer gewordenen Herzen brannten nur noch hilflose Phantasieen, die keine Rechte auf die Wirklichkeit besaßen. Seine Mutter, in deren Schoß sich zu werfen es ihn verlangte, starb zu dieser Zeit. Er war leer und trostlos. Er bildete sich ein, sich jetzt auf die Politik werfen zu sollen, aber er besaß für dieses Fach weder die genügende Übersicht und Ruhe, noch auch nur den nötigen Schliff und Takt mehr. Er schrieb auch Börsenberichte, aber ohne Sinn; denn er dichtete sie, und zwar aus einem bereits zerstörten Geiste heraus. Er verfaßte Gedichte, Dramen und musikalische Kompositionen, malte, zeichnete, aber dilettantisch und kindlich. Inzwischen hatte er wiederum Stellung genommen, freilich nur für kurze Zeit, und dann wieder Stellung, und dann wieder! An einem halben Dutzend Orten trieb er sich herum, glaubte und sah sich überall betrogen und verletzt, verlor den Anstand vor den Schülern, lieh Geld von ihnen; denn er besaß nie Geld. Noch war er ein schlanker, schöner Mensch, sanft und vornehm von Ansehen und immer noch edel in seinem Betragen, solange er mit seinem Kopf oben war. Aber das war nur noch selten der Fall. Nirgends in der Welt konnte man ihn lange gebrauchen, man schickte ihn fort, sowie man hinter sein Wesen kam, oder er ging von selber aus ganz absonderlichen, selbst zusammengedichteten Ursachen. Das mattete und lähmte ihn natürlich vollends herunter. Aus Italien hatte er noch begeisterungsfrohe, ideale Briefe an seinen Bruder geschrieben. In London, wo er Not litt, war er einmal in das Kontor eines sehr reichen Seidenhändlers, eines Onkels von ihm, mit der Bitte getreten, man möchte ihm in seiner elenden Lage beistehen, und bat um Geld, vielleicht nicht gerade mit Worten, aber man merkte, was er wollte, und schickte ihn achselzuckend fort, ohne ihm etwas zu geben. Wie mußte sein schöner, sanfter Menschenstolz schon gelitten haben, wenn er den Mut fand, Unwürdige anbetteln zu gehen. Doch was mußte er nicht tun, da er Not litt! Man kann von Stolz sprechen, man muß aber auch all der Zufälle des Lebens gedenken, wo es unmenschlich ist, von einem Menschen noch Stolz zu verlangen. Und der, der gebeten hatte, war weich! Er hatte von jeher ein kindlich weiches Herz, und dem Schmerz und der Reue über ein verlornes Leben war es ein Leichtes, dieses Herz zu zerstören. Eines Tages, nach all den Umherwanderungen, erschien er wieder zu Hause, blaß, matt, müde und in seinen Kleidern heruntergerissen. Sein Vater empfing ihn wahrscheinlich herzlos, seine Schwester so gut, als sie durfte vor des entrüsteten Vaters Augen. Er gedachte, einen kleinen Redakteurposten zu erhalten, und trieb sich inzwischen in der Stadt herum, wo er allen Mädchen Ringe schenkte und zu ihnen sagte, er wolle sie heiraten. Er war ganz offenbar schon kindisch. Man munkelte natürlich und lachte. Dann ging er noch einmal fort, in eine Lehrerstelle, aber dort erwies es sich, daß er für die Welt unmöglich geworden war. Er kam eines Tages mit einem nackten Fuß in die Schulstunde, Schuh und Strumpf fehlten an dem einen seiner Füße. Er wußte nicht mehr, was er tat, oder er tat eben das, was sein anderer, irrer Geist ihm zu tun befahl. Zu derselben Zeit radierte er in seinem militärischen Dienstbuch die dort notierte Degradation aus, die ihm eines begangenen, schweren Fehlers wegen schon früher zudiktiert worden war. Infolgedessen wurde er, da dieses kühne Vergehen ans Licht kam, ins Gefängnis gesperrt. Von dort wurde er, da man über seinen Geisteszustand zur Klarheit gelangte, in ein Irrenhaus gebracht, wo er heute noch ist. Ich weiß das alles, da ich oft mit ihm zusammen gewesen bin, in vielen Jahren, im Zivil sowohl wie beim Militär, und auch geholfen habe, ihn dahin abzuführen, wo er sich jetzt befindet und wohin er leider gebracht werden mußte.«
»Traurig!« sprach der andere der beiden Männer.
»Wir wollen austrinken und gehen,« sagte der Erzähler und fügte noch hinzu: »Manche wollen behaupten, daß die leichtfertigen Weiber, zu denen er Beziehungen hatte, ihn zugrunde gerichtet hätten, aber ich glaube es nicht, da ich überzeugt bin, daß man den schlimmen Einfluß, den diese Weiber auf einen Mann ausüben, meistens überschätzt. So schlimm ist das alles nicht, aber vielleicht liegt es in der Familie.«
Simon sprang auf, lebhaft angeregt und mit der Röte des Unwillens auf den Wangen:
»Was da? In der Familie? Da irren Sie sich, mein edler Herr Erzähler. Sehen Sie mich, bitte, einmal gründlich an. Entdecken Sie an mir vielleicht auch so etwas, das in der Familie liegen könnte? Muß ich auch ins Irrenhaus kommen? Das müßte ich ohne Zweifel, wenn es in der Familie läge, denn ich bin auch aus der Familie. Der junge Mann ist mein Bruder. Ich schäme mich durchaus nicht, einen nur unglücklichen und keineswegs verderblichen Menschen offen meinen Bruder zu nennen. Heißt er nicht Emil, Emil Tanner? Könnte ich das wissen, wenn er nicht mein leiblicher lieber Bruder wäre? Ist sein Vater, der auch der meinige ist, etwa nicht Mehlhändler, der auch in Burgunderweinen und Provencer-Öl einen ganz stattlichen Handel treibt?«
»In der Tat, das stimmt alles,« sagte der Mann, der vorhin erzählt hatte.
Simon fuhr fort: »Nein, in der Familie kann es nicht liegen. Ich leugne das, solange ich lebe. Es ist einfach das Unglück. Die Weiber können es nicht sein. Da haben Sie recht, wenn Sie sagen, die Weiber seien es nicht. Müssen daran die armen Weiber immer schuld sein, wenn die Männer ins Unglück geraten? Warum denken wir darüber nicht etwas einfacher? Kann es nicht im Charakter, in einem Stäubchen der Seele liegen? So und immer so: und deshalb so? Schauen Sie, bitte, was ich jetzt für eine Art von Handbewegung mache: So, so! Darin liegt es. Der Mensch fühlt so, und dann handelt er so, und alsdann stößt er an mancherlei Mauern und Unebenheiten so an. Die Menschen denken immer gleich an grausige Vererbung und so weiter. Mir erscheint das lächerlich. Und welche Feigheit und welche Unehrerbietung, den Eltern und Voreltern an seinem Unglück Schuld geben zu wollen. Mangel an Anstand und Mut und noch etwas: unziemliche Weichherzigkeit ist das! Wenn das Unglück über einen herbricht, so bringt man eben die erforderliche Manier mit, die es dem Schicksal bequem macht, daraus ein Unglück zu formen. Wissen Sie, was mein Bruder mir war, mir und Kaspar, dem andern Bruder, uns Jüngeren? Gelehrt hat er uns auf gemeinschaftlichen Spaziergängen Schönes und Hohes zu empfinden, zu einer Zeit, da wir noch die wüstesten Schlingel waren, die nur auf schlechte Streiche ausgingen. Aus seinen Augen tranken wir das Feuer der Begeisterung für die Kunst. Können Sie sich denken, was für eine herrliche, verständnissuchende, streberische, im schönsten und kühnsten Sinn streberische Zeit das war? Wir wollen noch eine Flasche Wein trinken, ich will sie bezahlen, ja, ich, obschon ich ein lumpiger Stellenloser bin. Heda! Herr Wirt, ein Flasche Wadtländer. Und zwar vom besten, den Sie haben. – Ich bin ein ganz mitleidloser Mensch. Meinen armen Bruder Emil habe ich schon längst vergessen. Ich komme auch gar nicht dazu, an ihn zu denken, denn sehen Sie, ich bin einer, der so in der Welt steht, daß er sich mit Händen und Füßen wehren muß, um aufrecht zu stehen. Umfallen mag ich nur dann, wenn ich nicht mehr den Gedanken ans Aufstehen habe. Ja, dann habe ich vielleicht Zeit, an die Unglücklichen zu denken, und Mitleid zu haben, wenn ich selber des Mitleids würdig geworden bin. Noch bin ich es aber nicht, und ich gedenke noch zu lachen und Scherz zu treiben angesichts meines Todes. Sie sehen in mir einen ziemlich unverwüstlichen Menschen, der allerhand Mißgeschick zu ertragen versteht. Das Leben, es braucht mir gar nicht so sehr zu glänzen, so glänzt es doch schon in meinen Augen. Es ist mir meistens schön und ich verstehe die Menschen nicht, die es unschön nennen und es damit beschimpfen. Jetzt kommt der Wein. Ich komme mir immer ganz vornehm vor, wenn ich Wein trinke. Mein armer Bruder lebt noch! Ich danke Ihnen, mein Herr, daß Sie mein Gedächtnis heute auf einen Unglücklichen gestoßen haben. Und nun: ganz ohne jede Weichherzigkeit: stoßen Sie an, meine Herren: Es lebe das Unglück! –«
»Warum, wenn ich fragen darf?«
»Sie übertreiben!«
»Das Unglück bildet, deshalb bitte ich Sie, es mit diesem funkelnden Glase Wein hochleben zu lassen. Noch einmal! So. Ich danke Ihnen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, daß ich ein Freund des Unglücks bin, und zwar ein sehr inniger Freund, denn es verdient die Gefühle der Vertrautheit und Freundschaft. Es macht uns besser, und das ist ein großer Dienst, den es uns da erweist. Es ist ein echter Freundschaftsdienst, der erwidert werden muß, will man anständig heißen. Das Unglück ist der etwas mürrische, aber desto ehrlichere Freund unseres Lebens. Es wäre ziemlich frech und ehrlos von uns, das zu übersehen. Im ersten Augenblick verstehen wir das Unglück nie, deshalb hassen wir es im Moment seines Kommens. Es ist ein so feiner, leiser, unangemeldeter Geselle, der uns immer überrascht, wie wenn wir nur Tölpel wären, die man immer überraschen kann. Wer das Talent hat, zu überraschen, der muß schon, was er auch sei und woher er auch komme, etwas ganz außerordentlich Feines sein. Nichts von sich ahnen lassen, und auf einmal da sein, nicht den leisesten neugierigen, vorauseilenden Geschmack und Duft an sich haben, und dann einem so plötzlich vertraulich auf die Achsel klopfen, »Du« zu einem sagen und dazu lächeln und einem in ein blasses, mildes, alleswissendes, schönes Gesicht blicken lassen: dazu gehört mehr als Brotessen, dazu gehören andere Apparate als nur Flugapparate, mit deren halber Erfindung wir Menschen schon zum voraus in großtönenden, schicksalumwerfenden Worten prahlen. Ja, das Schicksal, das Unglück ist schön. Es ist gut; denn es enthält auch das Glück, sein Gegenteil. Es erscheint mit beiderlei Waffen bewaffnet. Es hat eine zornige und vernichtende, aber auch eine sanfte und liebliche Stimme. Es weckt neues Leben, wenn es altes erschlagen hat, das ihm nicht gefallen hat. Es reizt zum Besser-Leben. Alle Schönheit, wenn wir noch hoffen, Schönes zu erleben, verdanken wir ihm. Es läßt uns Schönheiten überdrüssig werden und zeigt uns mit seinen ausgestreckten Fingern neue! Ist eine unglückliche Liebe nicht die gefühlvollste und deshalb zarteste, feinste und schönste? Tönt nicht noch das Verlassensein in weichen, schmeichelnden und wohltuenden Tönen? Ist das alles neu, was ich Ihnen da sage, meine Herren? Freilich ist es neu, wenn man es sagt; denn es sagt es selten einer. Den meisten mangelt der Mut, das Unglück zu begrüßen, als etwas, worin man die Seele baden kann, wie Glieder im Wasser. Man sehe sich doch nur einmal an, wenn man sich nackt ausgezogen hat und jetzt nackt dasteht: Welch eine Pracht: ein nackter, gesunder Mensch! Welch ein Glück: das mit nichts mehr bekleidet-Sein, das nackt-Dastehn! Ein Glück ist es schon, auf die Welt zu kommen, und kein weiteres Glück zu haben, als gesund zu sein, ist ein Glück, das die edelsten Steine, alle schönen Teppiche und Blumen, die Paläste und die Wunder überglitzert und überstrahlt. Das Wundervollste ist die Gesundheit, es ist ein Glück, zu dem kein weiteres, ähnliches hinzugefügt werden kann, es sei denn, daß der Mensch im Laufe der Zeiten roh genug geworden ist, um zu wünschen, daß er doch nur krank sein möchte und dafür einen Geldbeutel voll Geld besitzen. Zu dieser Fülle von Pracht und Glück, wenn man wirklich geneigt ist, das nackte, straffe, bewegliche, warme, mit auf das Erdenleben gekommene Glied als eine solche Fülle zu betrachten, muß eine Art Gegengewicht treten: das Unglück! Es kann uns hindern überzuschäumen, es schenkt uns die Seele. Es bildet unsere Ohren dafür aus, den schönen Klang zu vernehmen, der tönt, wenn Seele und Körper, ineinandervermischt, ineinanderübergetreten, zusammen atmen. Es macht aus unserem Körper etwas Körperlich-Seelenvolles und die Seele bringt es zu einem festen Dasein mitten in uns, daß wir, wenn wir wollen, unseren ganzen Körper als eine Seele empfinden, das Bein als eine springende, den Arm als eine tragende, das Ohr als eine horchende, die Füße als eine edel gehende, das Auge als die sehende und den Mund als die küssende Seele. Es macht uns erst lieben, denn wo liebte man, mit nicht auch ein wenig Unglück? In den Träumen ist es noch schöner als in der Wirklichkeit, denn wenn wir träumen, verstehn wir auf einmal die Wollust und entzückende Güte des Unglücks. Sonst ist es uns meist hinderlich, namentlich, wenn es in Form eines Geldverlustes zu uns kommt. Aber kann das ein Unglück sein? Wenn wir auch einen Kassenschein verlieren, was verlieren wir? Recht unangenehm freilich ist das, aber es ist kein Grund zu längerer Trostlosigkeit, als es braucht, um einzusehen, daß es kein wirkliches Unglück ist. Und so weiter! Man könnte viel reden darüber. Zuletzt wird man es doch müde. –«
»Sie sprechen wie ein Dichter, mein Herr,« bemerkte lächelnd einer der Männer.
»Das kann sein. Der Wein macht mich immer dichterisch reden,« entgegnete Simon, »so wenig ich sonst Dichter bin. Ich pflege mir Vorschriften zu machen und bin im allgemeinen wenig geneigt, mich von Phantasieen und Idealen hinreißen zu lassen, da ich das für äußerst unklug und für anmaßend halte. Glauben Sie mir nur, ich kann ein sehr trockener Mensch sein. Es ist auch keineswegs statthaft, jeden Menschen, den man einmal von Schönheit reden hört, gleich für einen schwärmenden Dichter zu halten, wie Sie es zu tun scheinen; denn ich denke, daß es sogar einmal einem sonst ganz kalt überlegenden Pfandleihhändler oder Bankkassier einfallen kann, über anderes nachzudenken, als über Sachen seines geldzusammenkratzenden Berufes. Man nimmt in der Regel zu wenig gefühlsinnige und der Nachdenklichkeit fähige Menschen an, weil man sie nicht anders beobachten gelernt hat. Ich mache es mir zur Aufgabe, mit einem jeden Menschen ein kühnes, herzliches Gespräch zu führen, damit ich am schnellsten sehe, mit wem ich es zu tun habe. Man blamiert sich mit einer solchen Lebensregel des öftern, und manchmal kriegt man dafür sogar, beispielsweise von einer zarten Dame, eine Ohrfeige, aber was schadet das! Mir macht es Vergnügen, mich bloßzustellen, und ich darf immer überzeugt sein, daß die Achtung von solchen, bei denen man sich mit dem ersten freien Wort etwas vergibt, nicht gar so sehr viel wert ist, als daß man deshalb Ursache zum Betrübtsein hätte. Menschenachtung muß immer leiden unter der Menschenliebe. Das wollte ich Ihnen auf Ihre etwas spöttische Bemerkung sagen, womit Sie mich zu treffen meinten.«
»Ich wollte Sie keineswegs verletzen.«
»So war es hübsch von Ihnen,« sagte Simon und lachte dazu. Dann sagte er plötzlich nach einigem Stillschweigen: »Was übrigens Ihre Erzählung von meinem Bruder betrifft, so hat diese mich allerdings getroffen. Er lebt noch, mein Bruder, und kaum ein Mensch denkt jetzt an ihn; denn wer sich wegstiehlt, namentlich an einen so düsteren Ort, wie er, der wird gestrichen aus den Gedächtnissen. Armer Kerl! Sehen Sie, ich könnte sagen, daß es nur einer kleinen Änderung in seinem Herzen, vielleicht eines Pünktchens mehr in seiner Seele bedurft hätte, um ihn zum schaffenden Künstler zu machen, dessen Werke die Menschen entzückt hätten. So wenig braucht es, um stark zu werden, und so wenig wiederum, um sein Unglück zu vollenden. Was will man reden. Er ist krank und steht auf der Seite, wo keine Sonne mehr ist. Ich werde jetzt mehr an ihn denken, denn sein Unglück ist doch ein zu grausames. Es ist ein Elend, das zehn Verbrecher nicht einmal verdienen, geschweige denn er, der solch ein Herz hatte. Ja, das Unglück ist manchmal nicht schön, jetzt bekenne ich es gerne. Sie müssen wissen, mein Herr, ich bin trotzig und behaupte gern etwas wild in die Welt hinein, was gar keine Art hat. Mein Herz ist zuweilen ganz hart, besonders hart ist es, wenn ich andere Menschen voll Mitleid sehe. Da möchte ich immer so hineinwettern, hineinlachen in das warme Mitleid. Sehr schlecht von mir, sehr, sehr schlecht! Ich bin überhaupt noch lange kein guter Mensch, aber ich hoffe es noch zu werden. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen haben reden zu dürfen. Das Zufällige ist immer das Wertvollste. Ich scheine etwas viel getrunken zu haben, und es ist hier so heiß im Lokale, mich verlangt hinaus. Leben Sie wohl, meine Herren. Nein! Nicht auf Wiedersehen. Durchaus nicht. Das habe ich nicht im Sinne. Mich verlangt durchaus nicht darnach. Viele Menschen habe ich noch kennen zu lernen, da darf ich nicht so frivol sagen: auf Wiedersehen. Das hieße nur lügen; denn ich begehre Sie nicht wiederzusehen, außer zufällig, und dann wird es mir eine Freude sein, wenn auch eine maßvolle. Ich mache nicht gern Umstände, und bin gern wahr, und das zeichnet mich vielleicht aus. Ich hoffe, daß es mich auch in Ihren Augen auszeichnet, wiewohl Sie mich jetzt ziemlich erstaunt und dumm ansehen, als wären Sie beleidigt. Gut, seien Sie es. Zum Teufel noch einmal, womit habe ich Sie beleidigt. Sie?«
Der Wirt trat herzu und mahnte Simon zur Ruhe:
»Gehen Sie lieber, es ist Zeit mit Ihnen.«
Und er ließ sich sanft in die dunkle Gasse hinausbefördern.
Es war eine tiefe, schwarze, schwüle Nacht. Es war, als schleiche sie als etwas Schleichendes die Wände entlang. Bisweilen stand ein hohes Haus ganz dunkel da, und dann war wieder eines, das gelblich und weißlich leuchtete, als besäße es den besonderen Zauber, in einer so dunklen Nacht zu leuchten. Die Mauern der Häuser rochen so seltsam. Es war etwas Feuchtes und Dumpfiges, das ihnen entströmte. Einzelne Lichter erhellten zuweilen einen Fleck der Gasse. Oben ragten die kühnen Dächer über die glatte, hohe Wand der Häuser hinaus. Die ganze weite Nacht schien sich in dieses kleine Gassengewirr gelegt zu haben, um hier zu schlafen, oder um hier zu träumen. Es gingen noch einzelne späte Menschen umher. Hier taumelte einer und sang dabei, ein anderer fluchte, daß es den Himmel zerreißen mochte, ein dritter lag schon am Boden, während der Tschako eines Polizisten hinter einer Hausecke hervorblitzte. Wenn man schritt, tönten einem die Schritte unter den Füßen. Simon begegnete einem alten, betrunkenen Mann, der in der ganzen Breite der Gasse hin und her schwankte. Es war ein elendes und zugleich fröhliches Bild: wie die dunkle, plumpe Gestalt so hin und her geschleudert wurde, als bekäme sie Stöße von einer geschmeidigen, unsichtbaren Hand. Da ließ der alte, weißbärtige Mann seinen Stock fallen, wollte denselben vom Boden wieder aufheben, was ja für den Betrunkenen eine schreckliche Aufgabe sein mußte, und schien infolgedessen selber zu Boden stürzen zu wollen. Aber Simon, von einem lächelnden Erbarmen ergriffen, eilte auf den Mann und auf den Stock zu, hob diesen auf und drückte ihn dem Mann in die Hand, der einen Dank in der merkwürdigen Sprache der Betrunkenen murmelte, in einem Ton, als hätte er Grund, noch beleidigt zu sein. Dieser Anblick wirkte sofort ernüchternd auf Simon, und er bog aus dem alten Stadtviertel ab in die neuere, elegantere Gegend. Als er über eine Brücke, die beide Stadtteile voneinander trennte, hinüberging, sog er den seltsamen Duft des fließenden Flußwassers ein. Er schritt die Straße hinunter, in der er vor drei Wochen von jener Dame vor dem Schaufenster angesprochen wurde, sah in dem Haus seiner früheren Herrin noch Licht brennen, dachte daran, daß sie noch gestern seine Herrin gewesen war, schritt weiter unter den Bäumen, bis er zu dem breit und dunkel liegenden See kam, der zu schlafen schien in seiner ganzen, herrlichen Ausdehnung. Ein solcher Schlaf! Wenn so ein ganzer See schlief mit all seinen Abgründen, das machte Eindruck. Ja, das war doch etwas Seltsames, kaum zu Verstehendes. Simon schaute noch eine Zeitlang hinaus, bis er Sehnsucht bekam, selber zu schlafen. O, er würde jetzt herrlich schlafen. So ruhig würde es über ihn kommen, und morgen würde er lang im Bett bleiben, morgen war ja Sonntag. Simon ging heim.
Am nächsten Morgen erwachte er erst, als die Glocken klangen. Er bemerkte von seinem Bette aus, daß ein herrlicher, blauer Tag draußen sein mußte. In den Fensterscheiben blitzte so ein Licht, das auf einen wunderbaren Morgenhimmel hoch über der Gasse schließen ließ. Etwas Hellgoldenes ließ sich ahnen, wenn man die gegenüberliegende Hausmauer länger ansah. Man mußte bedenken, wie schwarz und düster diese fleckige Wand bei beflecktem Himmel aussehen mußte. Man sah lange dahin und stellte sich vor, wie jetzt der See, mit den Segeln darauf, sich ausnähme, in dem goldenen, blauen Morgenwetter. Gewisse Waldwiesen, gewisse Aussichten und gewisse Bänke unter den grünen, üppigen Bäumen, der Wald, die Straßen, die Promenaden, die Wiesen auf dem Rücken des breiten Berges, vollbesetzt mit Bäumen, die Abhänge und Waldschluchten, in denen das Grün nur so wucherte, die Quelle und der Waldbach mit den großen Steinen und dem leise singenden Wasser, wenn man daran saß und sich davon einschläfern ließ. Das alles war zu sehen, deutlich, wenn Simon auf die Wand hinüberblickte, die doch nur eine Wand war, aber die heute das ganze Bild eines seligen Menschensonntages widerspiegelte, nur weil etwas wie ein Hauch von blauem Himmel darauf auf und ab schwebte. Dazu klangen ja die Glocken in den bekannten Tönen, und Glocken, ja, die verstanden es, Bilder aufzuwecken.
Er nahm sich, immer noch im Bett liegend, vor, von jetzt ab fleißiger zu sein, etwas zu studieren, zum Beispiel eine Sprache, und überhaupt geregelter zu leben. Wie viel hatte er versäumt! Das Lernen mußte einem doch viel Freude machen. Es war so schön, sich das vorzustellen, recht innig und lebhaft, wie das wäre, wenn man emsig lernte und lernte, und gar nicht aus dem Lernen herauskäme. Er fühlte eine gewisse menschliche Reife in sich: nun wohl, um so schöner müßte das Lernen werden, wenn mit der ganzen, bereits erworbenen Reife gelernt würde. Ja, das wollte er nun tun: lernen, sich Aufgaben stellen, und einen Reiz darin finden, Lehrer und Schüler in eigener Person zu sein. Zum Beispiel, wie würde es mit einer fremden, wohlklingenden Sprache sein, etwa mit der französischen? »Ich würde Wörter lernen und sie meinem Gedächtnisse fest einprägen. Wie käme mir da meine allezeit lebhafte Einbildungskraft zu Hilfe. Der Baum: l'arbre. Ich würde in meinem ganzen Gefühl den Baum sehen. Klara käme mir in den Sinn. Ich würde sie in einem weißen, weitgefalteten Kleid unter einem breiten, schattigen, dunkelgrünen Baum sehen. So käme mir wieder vieles, beinahe schon ganz vergessenes in den Sinn. Der Sinn würde stärker und lebhafter im Erfassen. So, wenn man nichts lernt, stumpft man zusammen. Wie süß ist gerade die Kleinheit, das Anfängerische! Ich erblicke jetzt einen hohen Reiz darin und begreife nicht, wie ich so lange, so lange trotzig und träge sein konnte. O, die ganze Trägheit liegt nur im Trotz des Mehrwissen-wollens und des vermeintlichen Besser-wissens. Wenn man nur recht weiß, wie wenig man weiß, kann es noch gut kommen. Ich würde mir bei dem Klang des fremden Wortes das deutsche inniger denken und mir seinen Sinn weiter ausbreiten in Gedanken, so würde mir auch die eigene Sprache ein neuer, reicherer Laut voll ungekannter Bilder werden. Le jardin: der Garten. Hier würde ich an den ländlichen Garten Hedwigs denken, den ich doch mitgeholfen habe, anzupflanzen, als es Frühling wurde. Hedwig! Alles würde mir wieder einfallen, blitzschnell, was sie gesagt, getan, gelitten und gedacht hat, während all der Tage, die ich bei ihr verbracht habe. Ich habe keine Ursache, so schnell Menschen und Dinge zu vergessen und meine Schwester erst recht nicht. Damals, als wir den Garten schon bepflanzt hatten, schneite es nachts wieder, und wir hatten großen Kummer, es würde uns nichts wachsen in unserem Garten. Für uns bedeutete das viel; denn wir versprachen uns aus dem Garten recht viel schönes Gemüse. Wie schön ist es doch, mit einem Menschen den gleichen Kummer teilen zu können. Wie müßte es erst sein, wenn man die Schmerzen und das Ringen eines ganzen Volkes mitlitte und mitkämpfte. Ja, das alles würde mir einfallen beim Lernen einer Sprache, und noch so viel mehr, so vieles, das ich mir jetzt noch gar nicht ausdenken kann. Nur lernen, nur lernen, gleichviel, was! Ich will mich auch in die Naturgeschichte versenken, ich ganz allein, ohne Lehrer, an Hand eines billigen Buches, das ich gleich morgen kaufen werde, denn heute ist Sonntag, da sind freilich alle Läden geschlossen. Das geht alles, ganz gewiß. Wozu ist man auf der Welt. Bin ich mir etwa seit einiger Zeit gar nichts mehr schuldig? Aufraffen muß ich mich endlich, es ist wahrlich die höchste Zeit.«
Und er sprang aus dem Bett, als wenn es ihm ein Bedürfnis wäre, gleich jetzt mit den neuen Plänen anzufangen. Rasch kleidete er sich an. Der Spiegel sagte ihm, daß er wirklich ganz nett aussähe, das befriedigte ihn.
Wie er eben die Treppe hinuntergehen wollte, begegnete ihm Frau Weiß, seine Wirtin und Zimmervermieterin. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und trug ein kleines Gebetbuch in der Hand, sie kam soeben aus der Kirche. Sie lachte, als sie den Simon erblickte, recht munter, und fragte ihn, ob er denn nicht auch zur Kirche hätte gehen mögen.
Er sei schon seit Jahren in keiner Kirche mehr gewesen, erwiderte er.
Die Frau erschrak über ihr ganzes, gutes Gesicht hinweg, als sie solche Worte vernahm, die ihr ungebührlich erschienen zum Munde eines jungen Mannes heraus. Sie wurde nicht böse; denn sie war durchaus keine unduldsame Frömmlerin, aber sie mußte doch zu Simon sagen, da täte er doch nicht ganz recht. Sie glaube es übrigens gar nicht. Er sähe ihr durchaus nicht so aus. Aber wenn es wahr wäre, so möchte er bedenken, daß er nicht gut handle, niemals in die Kirche zu gehen.
Simon versprach ihr, um sie bei guter Laune zu erhalten, nächstens in die Kirche zu gehen, worauf sie ihn ganz freundlich anschaute. Er indessen ging die Treppe hinunter, ohne sich weiter bei ihr aufzuhalten. »Ein liebes Weib,« dachte er, »und ich gefalle ihr, ich merke es immer, wenn ich einer Frau gefalle. Wie lustig sie mit mir wegen der Kirche geschmollt hat. So übers ganze Gesicht ein Schmollen: das kleidet eine Frau immer. Das sehe ich sehr gern. Sie hat außerdem Respekt vor mir. Ich werde mir den ferner zu erhalten wissen bei ihr. Aber ich werde nicht viel und nicht oft zu ihr reden. Sie wird dann wünschen, ein Gespräch mit mir anzufangen, und wird froh über jedes Wort sein, das ich mit ihr spreche. Ich mag gern solche Frauen, wie sie eine ist. Das Schwarz steht ihr herrlich. Wie lieb das kleine Gebetbuch aussah, das sie in ihrer üppigen Hand trug. Eine Frau, die betet, erhält eigentlich einen sinnlichen Reiz mehr. Wie schön diese blasse Hand aus dem Schwarz des Ärmels heraustrat. Und ihr Gesicht! Nun, schon gut! Es ist jedenfalls sehr angenehm, etwas Liebes für die Reserve zu haben, so gleichsam im Hinterhalt. Man besitzt dann eine Art Heim, ein Zuhausesein bei jemandem, einen Rückhalt, einen Zauber, da ich doch einmal ohne einen gewissen vorhandenen Zauber nicht leben kann. Sie hatte noch den Wunsch, vorhin, auf der Treppe, weiter mit mir zu sprechen. Ich habe aber abgebrochen; denn ich hinterlasse bei Frauen gern unerfüllt gebliebene Wünsche. So setzt man seinen Wert nicht herab, sondern schraubt ihn in die Höhe. Die Frauen wollen das übrigens selber, daß man so handelt.«
Die Straße wimmelte von sonntäglich geputzten Menschen. Die Frauen gingen alle in hellen, weißen Kleidern, die Mädchen trugen an ihren weißen Röcken farbige, breite Schleifen, die Männer waren einfach gekleidet in hellere Sommerstoffe, Knaben trugen Matrosenkleider, Hunde liefen hinter ein paar Menschen her; im Wasser, in ein Drahtgitter eingeschlossen, schwammen Schwäne herum, etliche junge Leute beugten sich über das Geländer der Brücke und sahen ihnen aufmerksam zu, wieder andere Männer gingen ziemlich feierlich zur Urne und gaben dort ihre Stimmzettel zu den Wahlen ab, die Glocken läuteten zum zweiten oder zum dritten Mal, der See schimmerte blau und die Schwalben flogen hoch oben in der Luft, über die Dächer hinweg, die in der Sonne strahlten; die Sonne war zuerst eine Sonntag-Vormittagsonne, dann eine Sonne schlechthin und dann noch eine Extrasonne für ein paar Künstleraugen, die wohl mit unter der Menge sein mochten; dazwischen grünten und breiteten sich die Bäume der städtischen Parkanlagen aus; unter der dunkleren Baumschattenwelt spazierten wieder andere Frauen und andere Männer; Segelschiffe flogen im Wind auf dem blauen, fernen Wasser, und träge, an Fässer angebundene Boote schaukelten am Ufer; hier flogen wieder andere Vögel und Menschen standen hier still, die die blaue, weißliche Ferne und die Berggipfel betrachteten, die am fernen Himmel wie köstliche, weiße, beinahe unsichtbare Spitzen herunterhingen, als ob der ganze Himmel eine hellblaue Morgenmantille gewesen wäre. Alles hatte etwas zu betrachten, zu plaudern, zu empfinden, zu zeigen, hinzuweisen, zu bemerken und zu lächeln. Aus einem Pavillon klangen jetzt die Töne einer Musikkapelle wie flatternde, zwitschernde Vögel aus dem Grün heraus. Dort im Grün spazierte auch Simon. Die Sonne warf durch das Blätterwerk helle Flecken auf den Weg, auf den Rasen, auf die Bank, wo Kindermädchen Kinderwägelchen hin und her rollten, auf die Hüte der Damen und auf die Achseln der Männer. Alles plauderte, schaute, blickte, grüßte und promenierte durcheinander. Die vornehmen Karossen rollten auf der Straße, die elektrische Straßenbahn sauste ab und zu vorbei, und die Dampfschiffe pfiffen und man sah durch die Bäume ihren Rauch dick und schwer davonfliegen. Draußen im See badeten junge Menschen. Die sah man allerdings, unter dem Grün auf und ab spazierend, nicht, aber man wußte es, daß dort nackte Leiber im flüssigen Blau herumschwammen und herausleuchteten. Was leuchtete eigentlich heute nicht? Was flimmerte nicht? Alles flimmerte, blitzte, leuchtete, schwamm in Farben und verschwamm zu Tönen vor den Augen. Simon sagte mehrere Male hintereinander zu sich: »Wie schön ist ein Sonntag!« Er sah den Kindern und allen Menschen in die Augen, er sah alles selig und verwirrt an, bald erhaschte er eine schöne, einzelne Bewegung, und bald trat ihm das Ganze vor die Augen. Er setzte sich zu einem anscheinend noch jungen Manne auf eine Bank und blickte dem Mann in die Augen. Es entspann sich ein Gespräch zwischen ihnen, denn es war so leicht, mit reden anzufangen, wo alles so glücklich war.
Der andere Mann sprach zu Simon:
»Ich bin Krankenwärter, aber gegenwärtig bin ich nichts als Bummler. Ich komme aus Neapel, wo ich im Fremdenhospital die Kranken pflegte. Vielleicht werde ich schon in zehn Tagen irgendwo in Inner-Amerika sein, oder in Rußland; denn man schickt uns überall da hin, wo ein Wärter verlangt wird, sei es auch auf den Südseeinseln. Man sieht auf diese Weise die Welt, das ist wahr, aber die Heimat wird einem so fremd, ich kann mich da nicht genügend ausdrücken. Sie zum Beispiel leben wahrscheinlich immer in Ihrer Heimat, sie umgibt Sie immerwährend, Sie fühlen sich von den Bekannten umschlossen, Sie schaffen hier, Sie sind hier glücklich und erleben sicher hier auch Ihr Mißgeschick, gleichviel, Sie dürfen wenigstens an einen Boden, an ein Land, an einen Himmel, wenn ich es so sagen darf, gebunden sein. Es ist schön, an etwas gefesselt zu sein. Man fühlt sich wohl, hat ein Recht, sich wohl zu fühlen und darf auf das Verständnis und die Liebe seiner Mitmenschen hoffen. Aber ich? Nein! Sehen Sie, ich bin zu schlecht geworden für meine engere Heimat, vielleicht auch zu gut, zu alles verstehend. Ich kann nicht mehr mitempfinden mit meinen Landsleuten. Ihre Vorliebe verstehe ich ebensowenig mehr wie ihren Zorn und ihre Abneigung. Jedenfalls bin ich fremd. Und ich fühle, es wird einem übel genommen, daß man fremd geworden ist. Und gewiß hat man recht, das zu tun; denn ich habe unrecht getan, mich zu entfremden. Was nützt es mir, wenn auch meine Ansichten über Vieles weltmännischer und klüger sind, wenn ich mit meinen Ansichten nur verletze? Dann sind es schlechte Ansichten, wenn sie verletzen. Eines Landes Sitten und Anschauungen sind etwas, das man heilig halten muß, wenn man nicht eines Tages ein Fremdling darin werden will, wie es mit mir geschehen ist. Nun, ich reise ja sehr bald wieder weg, zu meinen Kranken.«
Er lächelte und fragte Simon: »Was sind Sie?«
»Ich bin in meinem eigenen Lande ein sonderbarer Geselle,« antwortete Simon, »ich bin eigentlich Schreiber, und Sie können sich leicht denken, was ich da für eine Rolle in meinem Vaterlande spiele, wo der Schreiber so ziemlich der letzte Mensch ist, den es in der Rangordnung der Klassen gibt. Andere junge Handelsbeflissene reisen, um sich auszubilden, in das ferne Ausland, und kommen dann mit einem ganzen Sack voller Kenntnisse wieder heim, wo ihnen ehrenvolle Stellen offen gehalten werden. Ich nun, müssen Sie wissen, bleibe immer im Lande. Es ist gerade so, als fürchte ich, daß in anderen Ländern keine oder nur eine minderwertige Sonne scheine. Ich bin wie festgebunden und sehe immer Neues im Alten, deshalb vielleicht gehe ich so ungern fort. Ich verkomme hier, ich sehe es wohl, und trotzdem, ich muß, so scheint es, unter dem Himmel meiner Heimat atmen, um überhaupt leben zu können. Ich genieße natürlich wenig Achtung, man hält mich für liederlich, aber das macht mir so nichts, so gar nichts aus. Ich bleibe und werde wohl bleiben. Es ist so süß, zu bleiben. Geht denn die Natur etwa ins Ausland? Wandern Bäume, um sich anderswo grünere Blätter anzuschaffen und dann heimzukommen und sich prahlend zu zeigen? Die Flüsse und die Wolken gehen, aber das ist ein anderes, tieferes Davongehen, das kommt nie mehr wieder. Es ist auch kein Gehen sondern nur ein fliegendes und fließendes Ruhen. Ein solches Gehen, das ist schön, meine ich! Ich blicke immer die Bäume an, und sage mir, die gehen ja auch nicht, warum sollte ich nicht bleiben dürfen? Wenn ich im Winter in einer Stadt bin, so reizt es mich, sie auch im Frühling zu sehen, einen Baum im Winter, ihn auch im Frühling prangen und seine ersten, entzückenden Blätter ausbreiten zu sehen. Nach dem Frühling kommt immer der Sommer, unerklärlich schön und leise, wie eine glühende, große, grüne Welle aus dem Abgrund der Welt herauf, und den Sommer will ich doch hier genießen, verstehen Sie mich, mein Herr, hier, wo ich den Frühling habe blühen sehen. Da ist zum Beispiel dieses kleine Wiesen- oder Rasenbord. Wie süß ist das im Vorfrühling anzusehen, wenn der Schnee eben unter der Sonne darauf zerronnen ist. Aber um diesen Baum und um dieses Bord und um diese Welt handelt es sich: ich glaube, ich würde an anderen Orten den Sommer nicht bemerken. Die Sache ist die: ich habe eine recht verteufelte Lust, hier am Fleck zu bleiben und eine ganze Menge unlustiger Gründe, die mir das Reisen ins Ausland verbieten. Zum Beispiel: hätte ich etwa Reisegeld? Sie werden wissen, man braucht Geld, um mit der Eisenbahn oder mit dem Schiff zu fahren. Ich habe noch Geld für etwa zwanzig Mahlzeiten; aber ich habe kein Reisegeld. Und ich bin froh, daß ich keines habe. Mögen andere reisen und klüger heimkommen. Ich bin klug genug, eines Tages hier im Lande mit Anstand zu sterben.«
Nach einem kurzen Stillschweigen, während dessen der Krankenwärter ihn unverwandt anblickte, fuhr er fort:
»Und dann habe ich auch gar kein Verlangen darnach, Karriere zu machen. Was andern das meiste ist, ist mir das mindeste. Ich kann das Karrieremachen in Gottes Namen nicht achten. Ich mag leben, aber ich mag nicht in eine Laufbahn hineinlaufen, was so etwas Großartiges sein soll. Was ist Großartiges dabei: frühzeitig krumme Rücken vom Stehen an zu kleinen Pulten, faltige Hände, blasse Gesichter, zerschundene Werktagshosen, zittrige Beine, dicke Bäuche, verdorbene Mägen, kahle Platten auf den Schädeln, grimmige, anschnauzige, lederne, verblaßte, glutlose Augen, abgemergelte Stirnen und das Bewußtsein, ein pflichtgetreuer Narr gewesen zu sein. Ich danke! Ich bleibe lieber arm aber gesund, verzichte auf eine Staatswohnung, zugunsten eines billigen Zimmers, wenn es auch auf die dunkelste Gasse hinausgeht, lebe lieber in Geldverlegenheiten als in der Verlegenheit, wo ich sommers hinreisen soll, um meine verdorbene Gesundheit aufzuputzen, bin allerdings nur von einem einzigen Menschen geachtet, nämlich von mir selber, aber das ist einer, an dessen Achtung mir am meisten liegt, bin frei und kann jedesmal, wenn es die Notwendigkeit verlangt, meine Freiheit für einige Zeitlang verkaufen, um nachher wieder frei zu sein. Es lohnt sich, um der Freiheit willen arm zu bleiben. Ich habe zu essen; denn ich besitze das Talent, mit ganz Wenigem satt zu werden. Ich werde rasend, wenn man mir mit dem Wort und mit der Zumutung kommt, die in dem Worte »Lebensstellung« liegt. Ich will Mensch bleiben. Mit einem Wort: ich liebe das Gefährliche, das Abgründige, Schwebende und das Nicht-Kontrollierbare!«
»Sie gefallen mir,« sagte der Krankenwärter.
»Ich wollte durchaus nicht Ihr Gefallen erwecken, aber es freut mich trotzdem, wenn ich Ihnen gefalle, da ich einigermaßen von der Leber wegrede. Übrigens hätte ich nicht nötig gehabt, heftig auf andere zu werden. Das ist immer dumm, und man hat kein Recht, Verhältnisse zu beschimpfen, weil sie einem nicht behagen. Man kann ja fortgehen, ich kann ja fortgehen! Aber nein, es behagt mir eben. Meine Lage gefällt mir. Die Menschen gefallen mir, so wie sie sind. Ich meinesteils suche auch mit allen Mitteln meinen Mitmenschen zu gefallen. Ich bin fleißig und arbeitsam, wenn ich einen Auftrag zu erfüllen habe, aber meine Lust an der Welt opfere ich niemandem zu Gefallen, höchstens würde ich sie dem heiligen Vaterlande hinopfern, wozu bis jetzt die Gelegenheit noch immer ausgeblieben ist und wohl auch ausbleiben wird. Mögen sie immerzu Karriere machen, ich begreife sie, sie wollen bequem leben, sie wollen sorgen, daß ihre Kinder auch etwas haben, sie sind vorsehende Väter, deren Tun nur achtenswert ist, mich mögen sie eben auch machen lassen, sie mögen mich auf meine Weise dem Leben seinen Reiz abzureißen versuchen lassen, das versuchen alle, alle, nur nicht alle auf die gleiche Art. Es ist ja so wundervoll, reif genug zu sein, um alle machen zu lassen in ihrer Art, so wie es jeder versteht. Nein, wenn einer dreißig Jahre lang sein Amt treu verwaltet hat, ist er am Ende seiner Lebensbahn durchaus kein Narr gewesen, wie ich vorhin in der Heftigkeit sagte, sondern ein Ehrenmann, der verdient, daß man ihm Kränze aufs Grab legt. Sehen Sie, ich will keine Kränze auf mein Grab bekommen, das ist der ganze Unterschied. Mein Ende ist mir gleichgültig. Sie sagen mir immer, jene andern, ich werde meinen Übermut noch schwer büßen müssen. Nun wohl, dann büße ich und erfahre dann doch, was büßen heißt. Ich erfahre gern alles und deshalb fürchte ich nicht so viel, wie die, die um eine glatte Zukunft besorgt sind. Ich habe immer Angst, es möchte mir eine einzige Lebenserfahrung entgehen. Darauf bin ich ehrgeizig wie zehn Napoleone. Doch jetzt bin ich hungrig, ich möchte essen gehen, kommen Sie mit? Es würde mich freuen.«
Und sie gingen zusammen.
Nach dem etwas wilden Gerede war Simon plötzlich weich und sanft geworden. Er sah mit entzückten Augen die schöne Welt an, die runden, üppigen Kronen der hohen Bäume und die Straßen, wo die Menschen gingen. »Die lieben, geheimnisvollen Menschen!« dachte er bei sich und gestattete es, daß sein neuer Freund ihm die Schulter mit der Hand berührte. Er sah es gerne, daß der andere so vertraulich wurde, es paßte, es verband und löste auf. Er sah alles mit lachenden, glücklichen Augen an, wobei er wieder dachte: »Wie sind doch Augen schön!« Ein Kind hatte zu ihm den Blick erhoben. Mit so einem Kameraden zu gehen, wie der Krankenwärter war, erschien ihm als etwas ganz Neues, noch nie Erlebtes, als etwas jedenfalls Angenehmes. Auf dem Wege kaufte derselbe bei einem Gemüsehändler ein Gericht frischer Bohnen und in einer Metzgerei Speck und lud Simon zu sich zum Mittagessen ein. Gerne wurde das Angebot angenommen.
»Ich koche immer selbst,« sagte der Krankenwärter, als sie beide in dessen Wohnung anlangten, »ich habe mir das angewöhnt. Es macht Spaß, glauben Sie es mir nur. Passen Sie auf, wie vortrefflich Ihnen die Bohnen mit dem schönen Speck schmecken werden. Ich stricke mir zum Beispiel auch selber meine Strümpfe und wasche meine Wäsche selber. So erspart man viel Geld. Ich habe das alles gelernt, und warum sollten sich solche Arbeiten nicht auch ausnahmsweise einmal für einen Mann schicken, wenn er ausgesprochenen Sinn dafür hat. Ich sehe nicht ein, was in einer solchen Beschäftigung Beschämendes liegen sollte. Ich fertige mir auch selber Hausschuhe, wie diese hier sind, an. Einige Aufmerksamkeit erfordert schon solch eine Arbeit. Pulswärmer für den Winter zu stricken oder Westen zu machen, bietet mir keine besonderen Schwierigkeiten. Wenn man immer so allein ist, und auf Reisen, wie ich, kommt man auf wunderliche Sachen. Machen Sie es sich, oder, mach es dir bequem, Simon! Sollte ich mir nicht gestatten dürfen, dir das »Du« anzutragen?« –
»Warum nicht? Gern!« Und Simon errötete auf ihm ganz unbegreifliche Weise.
»Ich habe dich sehr lieb vom ersten Augenblick an gewonnen,« sprach der Wärter, der sich Heinrich nannte, weiter, »man braucht dich nur anzusehen, um überzeugt zu sein, daß du ein lieber Kerl bist. Ich hätte Lust, dich zu küssen, Simon.« –
Simon wurde es schwül in dem Zimmer. Er stand vom Stuhle auf. Er ahnte, was es für einer sei, der ihn so merkwürdig zärtlich ansah. Aber was schadete das. »Ich will es gehen lassen,« dachte er. »Ich mag dem Heinrich, der sonst nett ist, deswegen nicht grob kommen!« Und er gab seinen Mund her und ließ sich darauf küssen.
Was war es denn weiter!
Übrigens fand er es hübsch und dem Zustand von Weichheit, in dem er sich befand, angemessen, sich so zärtlich behandeln zu lassen. Wenn es auch diesmal nur ein Mann war! Er fühlte deutlich, daß dessen seltsame Neigung zu ihm der schonenden und vorläufig dahin gehen lassenden Rücksicht bedurfte, und er hätte es nie vermocht, die Hoffnungen des Mannes zu zerstören, wenn es nun einmal auch unwürdige Hoffnungen waren. Mußte er denn deswegen empört tun? »Keine Rede,« dachte sich Simon, »ich lasse ihn einstweilen gewähren, es paßt zu allem, was jetzt um mich herum vorgeht!«
Den Abend verbrachten beide mit einer Wanderung von Kneipe zu Kneipe; denn der Wärter war ein ziemlich leidenschaftlicher Trinker, weil er mit seiner freien Zeit nicht viel anderes anzufangen wußte. Simon fand es für passend, in jeder Beziehung mitzumachen. Er lernte dort in den kleinen, dumpfigen Wirtschaften Menschen kennen, die mit unglaublicher Ausdauer Karten spielten. Das Kartenspiel schien solchen eine ganz eigene Welt zu sein, in der sie sich nicht gern stören ließen. Andere saßen den ganzen Abend da und klemmten einen spitzen, langen Zigarrenstengel zwischen den Zähnen herum, ohne sich weiter bemerkbar zu machen, als etwa dadurch, daß sie den Zigarrenrest, wenn er zu kurz geworden war, um zwischen den Lippen noch weiter gepreßt zu werden, an die Spitze ihres Sackmessers steckten, um ihn bis zu der kleinsten Kürze herunterrauchen zu können. Eine abgemagerte, wüste Klavierspielerin erzählte ihm, daß ihre Schwester eine schlechte Schwester aber eine berühmte Konzertsängerin sei, mit der sie längst aufgehört habe, familiär zu verkehren. Simon fand es begreiflich, aber er benahm sich zart und sagte ihr nicht, daß er es begreiflich fände. Er hielt die Person mehr für unglücklich als verdorben, und das Unglück ehrte er immer, während er die Verdorbenheit für die Folge des Unglückes hielt, das wenigstens Anstand erforderte. Er sah dicke, kleine, furchtbar lebhafte Wirtinnen, die sich den Gästen unter allerhand Zutraulichkeiten nahten, während ihre Männer auf Sofas und in Lehnstühlen schliefen. Oft wurde ein gutes, altes Volkslied gesungen, von einem, der im Singen solcher alter Lieder, was die Tonart und den Wechsel der Stimme betraf, Meister war. Diese Lieder klangen schön und wehmütig, man spürte unwillkürlich, wie manche rauhe und helle Kehle sie schon, einstmals und viel früher, gesungen haben mußte. Einer riß beständig Witze, es war ein kleiner, junger Mensch in einem alten, großen, breiten, hohen, tiefen Hut, den er irgendwo beim Trödler erstanden haben mußte. Sein Mund war schmierig und seine Witze nicht minder, aber sie zwangen zum Lachen, ob man wollte oder nicht. Einer sagte ihm: »Ich bewundere Ihren Witz, Sie!« Aber der Witzige lehnte die dumme Bewunderung mit gut gespielter Verwunderung ab, und das war ein wirklicher Witz, der jeden Gebildeten hätte freuen können. Der Wärter erzählte allen Menschen, die neben ihn zu sitzen kamen, er sei im Grunde genommen zu schlecht und wieder, wenn er es recht bedenke, zu gut für seine Heimat. Simon dachte: »Wie dumm!« Aber von Neapel stattete der Krankenpfleger weit hübscheren Bericht ab, so sagte er zum Beispiel, daß dort in den Museen wundervolle Überreste von antiken Menschen zu sehen seien, und man könne daran sehen, daß die früheren Menschen uns an Größe, Breite und Dicke weit übertroffen hätten. Arme hätten diese Menschen gehabt wie wir Beine etwa! Das müsse ein Geschlecht von Weibern und Männern gewesen sein, das! Was wir dagegen seien? Einfach eine heruntergekommene, verkrüppelte, verkümmerte, zugespitzte, in die Länge und Dünne gesprungene und zerrissene und zerfetzte und abgemagerte Generation. Auch den Golf von Neapel wußte er in anmutigen Worten zu schildern. Viele hörten ihm aufmerksam zu, aber viele schliefen und weil sie schliefen, konnten sie nichts hören.
Simon kam sehr spät nach Hause, fand die Haustüre verschlossen, hatte aber keinen Schlüssel bei sich und klingelte an der Hausglocke ziemlich unverschämt; denn er war in einem Zustand, in welchem man stets rücksichtslos zu sein pflegt. Ein Fenster öffnete sich sogleich auf den heftigen Schall, den die Glocke verursachte, und eine weiße Gestalt, ohne Zweifel die Frau in ihrer Nachtjacke, warf den in dickes Papier gewickelten Schlüssel hinunter.
Am nächsten Morgen lächelte sie ihm, statt erzürnt über ihn zu sein, in der freundlichsten Weise »Guten Morgen« entgegen, und erwähnte mit keinem Wort die Störung in der Nacht. Simon fand es deshalb auch nicht am Platz, ein Wort darüber zu sagen und entschuldigte sich, halb aus Zartheit und halb aus Bequemlichkeit, nicht.
Er ging weg und suchte den Wärter auf. Der Montagmorgen war wiederum prachtvoll. Die Menschen waren alle an ihrer Arbeit, die Gassen waren infolgedessen leer und hell, er trat in das Zimmer, wo der Wärter noch schläfrig im Bette lag. Simon bemerkte an den Wänden des Zimmers heute, was er gestern nicht beobachtet hatte, eine Menge ziemlich süßlicher, christlicher Wanddekorationen: Engelchen mit rötlichen Köpfchen aus Papier geschnitten und Tafeln mit Sprüchen, die in geheimnisvolle, trockene Blumen gerahmt waren. Er las sämtliche Sprüche, es waren tiefe darunter, die zum Nachdenken reizten, Sprüche, die vielleicht älter waren als acht alte Menschen miteinander, aber auch glättliche, neue Sprüche, die sich so lasen, als ob sie zu Tausenden in einer Fabrik fabriziert worden wären. Er dachte: »Wie seltsam ist das! Überall, in vielen einzelnen Zimmern und Zimmerchen, wohin man auch kommen mag, und was man auch gerade verüben mag, sieht man solche Stücke alter Religionen an Wänden hängen, die teils viel sagen, und teils wieder weniger, teils auch gar nichts mehr. Was glaubt der Wärter? Sicher nichts! Vielleicht ist die Religion bei vielen, heutigen Menschen nur noch so halbe, oberflächliche und unbewußte Geschmackssache, eine Art Interesse und Gewohnheit, wenigstens bei den Männern. Vielleicht hat eine Schwester des Wärters dieses Zimmer auf diese Weise ausgeschmückt. Ich glaube es; denn die Mädchen haben innigeren Grund zur Frömmigkeit und zum religiösen Nachsinnen als die Männer, deren Leben immer mit der Religion gestritten hat, von jeher, wenn es nicht gerade Mönche waren. Aber ein protestantischer Pfarrer in schneeweißen Haaren, mit mildem, geduldigem Lächeln und edlem Gang, wenn er durch einsame Waldlichtungen schreitet, ist und bleibt etwas Schönes. In der Stadt ist die Religion weniger schön als auf dem Land, wo Bauern leben, deren Lebensart schon an und für sich etwas Tiefreligiöses hat. In der Stadt gleicht die Religion einer Maschine, was etwas Unschönes ist, auf dem Lande dagegen empfindet man den Gottesglauben als dasselbe wie ein blühendes Kornfeld, oder wie eine ausgedehnte, üppige Wiese, oder wie das entzückende Anschwellen leicht gebogener Hügel, auf deren Höhe ein verstecktes Haus steht, mit stillen Menschen, denen das Nachsinnen wie ein Freund ist. Ich weiß nicht, mir kommt vor, als ob in der Stadt der Pfarrer zu dicht neben dem Börsenspekulanten und dem glaubenslosen Künstler wohne. Es mangelt in der Stadt dem Gottesglauben an der gehörigen Entfernung. Die Religion hat hier zu wenig Himmel und zu wenig Geruch von Erde. Ich kann es nicht so gut sagen, und was kümmert es mich überhaupt. Religion ist nach meiner Erfahrung Liebe zum Leben, inniges Hangen an der Erde, Freude am Moment, Vertrauen in die Schönheit, Glauben an die Menschen, Sorglosigkeit beim Gelage mit Freunden, Lust zum Sinnen und das Gefühl der Verantwortungslosigkeit in Unglücksfällen, Lächeln beim Tode und Mut in jeder Art Unternehmungen, die das Leben bietet. Zuletzt ist tiefer, menschlicher Anstand unsere Religion geworden. Wenn die Menschen voreinander den Anstand bewahren, bewahren sie ihn auch vor Gott. Was will Gott mehr wollen? Das Herz und die feinere Empfindung können zusammen einen Anstand hervorbringen, der Gott wohlgefälliger sein dürfte, als finsterer, fanatischer Glaube, der den Himmlischen selbst beirren muß, so daß er am Ende noch wünschen wird, keine Gebete mehr zu seinen Wolken hinaufdonnern zu hören. Was kann ihm unser Gebet sein, wenn es derart anmaßlich und plump zu ihm hinaufdringt, als ob er schwerhörig wäre? Muß man ihn sich nicht mit den allerfeinsten Ohren vorstellen, wenn man ihn überhaupt denken kann? Ob ihm die Predigten und die Orgeltöne recht angenehm sind, ihm, dem Unaussprechlichen? Nun, er wird eben lächeln zu unsern immer noch so finsteren Bemühungen und er wird hoffen, daß es uns eines Tages einfällt, ihn ein wenig mehr in Ruhe zu lassen.«
»Sie sind ja so nachdenklich, Simon,« sagte der Wärter.
»Gehen wir?« fragte Simon.
Der Krankenwärter war fertig geworden, und beide gingen zusammen die steilen Wege den Berg hinauf. Die Sonne schien glühend heiß. Sie traten in einen kleinen, üppig verwachsenen Biergarten hinein und ließen sich einen Frühschoppen reichen. Als sie indessen gehen wollten, ermunterte sie die Wirtin, eine hübsche Frau, zum Dableiben, und sie blieben, bis es Abend wurde. »So vertrinkt man, ehe man es denkt, den hellen Sommertag,« dachte Simon mit einem Gefühl, das mit taumelnder Lust und mit einem sanften, schönen, melodiösen Weh gemischt war. Die Farben des Abends im Grün machten ihn trunken. Sein Freund schaute ihm tief und verlangend in die Augen und schlang den Arm um seinen Hals. »Eigentlich ist das häßlich,« dachte Simon. Auf dem Wege wurden alle Weiber und Mädchen in der auffallendsten Weise von den beiden angesprochen. Die Arbeiter kamen von der Arbeit heim, Menschen, die noch rüstig gingen, die Schultern seltsam wiegten, als atmeten sie jetzt befreit auf. Simon entdeckte prachtvolle Gestalten unter ihnen. Als sie in den heißen, aber schon dunkel gefärbten Wald kamen, der den Berg krönte, sank unten in der fernen Welt die Sonne unter. Sie lagerten sich in grüne Blätter und Gesträuch hinein und schwiegen und atmeten nur so. Dann kam, was Simon jetzt erwartete, die Annäherung seines Kameraden, die ihn aber durchaus erkältete.
»Es hat keinen Sinn,« sagte er, »hören Sie auf oder so: höre doch auf.«
Der Wärter ließ sich beschwichtigen, aber er war unmutig geworden, Leute kamen vorbei, sie mußten aufstehen und den Platz verlassen. Simon dachte: »Warum verbringe ich den Tag mit einem solchen Menschen?« Aber er gestand sich gleich darauf, daß er eine gewisse Freude an ihm habe, trotz seiner seltsamen, unschönen Neigungen. »Ein anderer würde den Wärter verachten,« dachte er weiter, indem sie den Rückweg einschlugen, »aber ich bin so einer, der einen jeden Menschen in seiner Art und Unart interessant und liebenswert findet. Ich komme nicht bis zur Menschenverachtung, oder ich verachte eigentlich nur die Feigheit und Leblosigkeit, aber ich finde an der Verdorbenheit sehr leicht etwas Interessantes. Und in der Tat, sie klärt über vieles auf, läßt tiefer in die Welt blicken und macht einen erfahrener und macht milder und treffender urteilen. Man muß mit allem bekannt werden, und man lernt es nur kennen, wenn man es tapfer berührt. Irgend jemandem ausweichen, aus Furcht, das würde ich meiner für unwürdig halten. Überdies: einen Freund haben, ist unschätzbar! Was schadet es, wenn es ein etwas merkwürdiger Freund ist.« –
»Bist du mir böse, Heinrich?«
Der aber sprach nichts mehr. Sein Gesicht hatte einen finsteren Ausdruck angenommen. Wieder langten sie an dem Biergarten an, der jetzt in seinen zierlichen Umrissen dunkel war. Farbige, schimmernde Lampions erleuchteten das dunkle Grün an einigen Stellen, Geräusch und Gelächter drang heraus, und die beiden, angelockt von dem lustigen, feurigen Leben, gingen wieder hinein, wo sie von der Wirtin freundschaftlich begrüßt wurden.
Der rote, dunkle Wein funkelte in den hellen Gläsern, die Lichtschimmer vermengten sich mit den erhitzten Gesichtern, die Blätter von dem Gebüsch berührten die Kleider der Frauen, es schien so selbstverständlich, daß man die heiße Sommernacht in einem lispelnden Garten mit Trinken, Singen und Lachen verbrachte. Aus dem tief gelegenen Bahnhof drang das Gelärm der Eisenbahnen herauf an die Ohren der Schwärmenden. Ein reicher, langer, rotbäckiger Weinhändlerssohn machte sich mit Simon in einem kühnen, philosophierenden Gespräch zu schaffen. Der Wärter widersprach in allem, weil er unmutig und ärgerlich war. Die Kellnerin, ein schlankes, brünettes Mädchen, setzte sich zu Simon und ließ es sich gefallen, daß er sie eng an sich heranzog, um sie zu küssen. Sie ertrug den Kuß gern, mit stolzen, geschwungenen Lippen, die wie dazu geschaffen schienen, Wein zu schlürfen, zu lachen und zu küssen. Der Wärter wurde noch böser und wollte aufbrechen, woran man ihn aber verhindern konnte. Da sang einer, ein junger, braungefärbter, dunkler Bursche mit grünem Jägerhut ein Lied, während sein Mädchen, das sich, an seine Brust angeschmiegt, eng an ihn lehnte, in leisen, glücklichen Tönen mitsang. Das klang so berauschend, dunkel und südlich. Simon dachte: »Lieder sind doch immer wehmütig, wenigstens die schönen. Sie mahnen ans Aufbrechen!« Aber er blieb noch lange in dem nächtlichen Garten.
Noch die ganze Woche lang verkehrte Simon in dieser müßiggängerischen Weise mit dem Krankenwärter, mit dem er sich bald stritt und dann wieder versöhnte. Er spielte Karten, wie einer, der es schon jahrelang trieb und rollte die Billardkugeln, mitten am heißen Tag, während alles, was Hände hatte, arbeitete. Er sah die sonnenbeschienenen Straßen und die Gassen im Regenwetter, aber durch ein Fenster und mit einem Glas Bier in der Hand, führte lange, nutzlose, wilde Reden nachts, mittags und abends mit allerhand unbekannten Menschen, bis er sah, daß er nichts mehr zum Leben besaß. Und eines Morgens ging er nicht mehr zu Heinrich, sondern trat in eine Stube hinein, wo verschiedene junge und alte Männer an Pulten saßen und schrieben. Es war die Schreibstube für Stellenlose, wo diejenigen hinkamen, die durch irgend einen Umstand in die Lage geraten waren, wo es ein Ding der Undenkbarkeit geworden ist, noch in einem Geschäfte Anstellung zu erhalten. Diese Sorte von Menschen schrieb dort im kargen Tagelohn mit hastigen Fingern, unter der strengen Aufsicht eines Aufsehers oder Sekretärs, Adressen, meist geschäftliche Adressen zu Tausenden, die von großen Firmen in dieser Schreibstube bestellt wurden. Schriftsteller gaben dort ihre hingesudelten Manuskripte und Studentinnen ihre beinahe unleserlichen Doktorarbeiten ab, um sie entweder mit der Schreibmaschine abtypen, oder mit der geläufigen, sauberen Feder abschreiben zu lassen. Des Schreibens unkundige Leute, die irgend etwas zu schreiben hatten, brachten ihre Schreibereien dorthin, wo sie in Kürze befriedigt wurden. Büffetdamen, Kellnerinnen, Plätterinnen und Kammerzofen ließen sich ihre Zeugnisse dort ins Reine schreiben, um sie präsentieren zu können. Wohltätigkeitsvereine gaben tausende von Jahresberichten ab, die adressiert und in die umliegende Welt versandt werden mußten. Der Naturheilverein ließ dort die Einladungen zu volkstümlichen Vorträgen ins Mehrfache schreiben, und Professoren hatten Arbeit genug für die Schreiber, die wiederum froh waren, wenn sie Arbeit hatten. Das ganze Schreibergeschäft wurde von der Gemeinde mit jährlichen Beiträgen unterstützt und von einem Verwalter geleitet, einem ehemals ebenfalls Stellenlosen, für den man diese Stelle schuf, um dem Mann in seinen alten Tagen eine passende Beschäftigung zu geben. Er stammte gewissermaßen aus einer alten, patrizischen Familie, hatte reiche Verwandte im Stadtrat, die nicht gern mitansehen mochten, wie eines ihrer Familienglieder auf schmachvolle Weise verdarb. So ward der Mann der König und Beschützer aller Vagabunden, verlorenen Menschen und traurigen Existenzen, und er versah dieses Amt mit lässiger Würde, als ob er niemals in seinem wilden Leben, das ihn auch eine Zeitlang in Amerika herumschweifen ließ, die Bitternisse der Not geschmeckt hätte.
Simon machte eine Verbeugung vor dem Verwalter der Schreibstube.
»Was wollen Sie?«
»Arbeit!«
»Heute ist nichts los. Kommen Sie morgen früh wieder, da wird sich vielleicht etwas für Sie Passendes finden. Schreiben Sie vorläufig heute Ihren Namen, Wohnort, Heimatort, Beruf und Ihr Alter sowie Ihre Adresse auf dieses Blatt Papier, und kommen Sie morgen pünktlich um acht Uhr, sonst wird keine Arbeit mehr da sein,« sagte der Verwalter.
Er pflegte immer zu lächeln und zu näseln, wenn er sprach. Gegenüber Stellenlosen nahm er außerdem immer einen sanftmütig-höhnischen Ton an, ganz ohne jegliche Absicht, es kam einfach so und nicht anders aus des Mannes Mund heraus. Sein Gesicht war eingefallen und vermergelt, hatte die Farbe des kalten, weißen Kalkes und endete in einem zerzausten grauen Spitzbart, als ob der Bart der herunterhängende und spitzige Gesichtsfetzen gewesen wäre. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen und des Mannes Hände zeugten von Krankheit und leiblicher Verwüstung.
Simon arbeitete schon am nächsten Tag, frühmorgens um acht Uhr, in der Schreibstube, und nach ein paar Tagen hatte er sich an die Gesellen, die dort arbeiteten, gewöhnt. Es waren Menschen, die sich im Leben einmal irgend eine Liederlichkeit zuschulden kommen ließen und den Boden dann unter ihren schwankenden Füßen verloren hatten. Es waren Menschen da, die um eines begangenen, schweren Vergehens willen früher einmal im Gefängnis gesessen hatten. Von einem alten, sehr gut aussehenden Manne wußte man, daß er jahrelang im Zuchthaus gesessen hatte, eines schweren sittlichen Verbrechens wegen, das er an seiner eigenen, leiblichen Tochter verübte, die ihn dem Richter verklagte. Er verzog, so lange Simon ihn sah, nie eine Miene seines stillen, sonderbaren Gesichtes, als ob das Schweigen und Horchen dort in dem Gesicht einheimisch und zur Notwendigkeit geworden wäre. Er arbeitete ruhig, friedlich und langsam, sah gut aus, blickte einen ruhig an, wenn man ihn anschaute, und schien sich einer quälenden Erinnerung nicht im leisesten bewußt zu sein. Sein Herz schien so still zu schlagen, wie seine alte Hand arbeitete. Nichts von Verzerrung eines einzigen Zuges war in seinem Gesicht zu bemerken. Alles schien er gebüßt, alles abgewaschen zu haben, was ihn je verunzierte und beschmutzt hatte. Seine Kleider waren ordentlicher als die des Verwalters, obschon er arm sein mußte. Merkwürdig gepflegt waren seine Zähne und seine Hände, seine Schuhe und seine Kleider. Seine Seele schien ruhig und außerordentlich rein zu sein. Simon dachte über ihn: »Warum nicht? Ist denn eine Sünde nicht abzuwaschen und soll eine Strafe das ganze Leben vernichten? Nein, diesem Manne sieht man weder eine begangene Sünde noch eine erduldete Strafe an. Er scheint beides völlig vergessen zu haben. Es mußte Güte und Liebe in dem Mann stecken, und viel, sehr viel Kraft. Aber immerhin: wie sonderbar!« –
Unterschlagung, Diebstahl, Hochstapel und Landstreichertum hatten in der Schreibstube ihre Vertreter. Daneben gab es nur Unglückliche, Ungeschickte, die das Leben übertölpelte, und Fremde aus dem Ausland, die einfach brotlos dastanden, weil sie sich in ihren Hoffnungen betrogen sahen. Notorische Faulenzer und ewig Unzufriedene waren gewiß auch da. Jede Mischung von Selbstschuld und Pech war vorhanden, nicht minder die Frivolität, die sich ein Vergnügen daraus machte, so heruntergekommen zu sein. Simon konnte hier den Mann in seinen verschiedenen Charakteren kennen lernen, doch dachte er selber nicht so sehr ans Beobachten, weil er auch einer der anderen war, der eben auch ausfüllte und in dem Leben und Treiben der Schreibstube, in deren Sorgen, Mühen und kleinen Fragen und Vorkommnissen wie in einem Strom untersank. Als ein selber in die Sache Versunkener dachte er nicht so sehr an die Sache, als an das leibliche Bedürfnis, wie alle andern. Alle verdienten hier mit Schreiben, was sie auch sogleich wieder vertrinken und veressen mußten, wenn sie leben wollten. Der Verdienst floß in die Kehlen hinunter, von der Hand in den Mund. Simon kam dazu, sich außerdem noch einen Strohhut und ein Paar billige Schuhe zu kaufen. Aber wenn er an die Zimmermiete dachte, so mußte er sich gestehn, daß er nicht imstande sein würde, auch das Geld für diese noch flüssig zu machen. Jeweilen abends, wenn er fertig geschrieben hatte, war er müde und glücklich. Er ging dann, in Gesellschaft eines seiner Schreibgesellen, mit hocherhobenem Kopf durch die Straßen und lächelte mit Gedankenlosigkeit die vorübergehenden Menschen an. Er brauchte sich gar nicht einer schönen und stolzen Haltung zu befleißigen, es kam von selber, die Brust dehnte sich und reckte sich ihm wie ein gespannter Bogen, wenn er zur Schreibstubentür hinaus an die Luft trat. Über seine Glieder fühlte er sich auf einmal als geborner Herr und Meister und er achtete auf seine Schritte mit Bewußtheit. Die Hände hielt er jetzt nicht mehr in der Hosentasche, das würde ihm würdelos vorgekommen sein. Überhaupt schlenderte er sich nicht mehr, sondern spazierte mit gemessenem Bewußtsein, als übe er erst jetzt, in seinem einundzwanzigsten Lebensjahre, die Glieder an einem schönen, festen Gange. Man sollte ihm keinerlei Armut anmerken, aber man sollte spüren, daß er ein junger Mann sei, der eben von der Arbeit herkomme und nun sich einen Abendspaziergang gönne. An der emsigen, beweglichen Straßenwelt hing sein Auge mit Entzücken. Wenn eine Karosse mit einem Paar tanzender, zierlicher Pferde vorbeikam, so musterte er mit scharfem Blick nur den Gang der trabenden Tiere und verschmähte es, den Herrschaften im Wagen einen Blick zuzuwerfen, so, als hätte er nur Interesse für die Pferde, weil er ein Kenner sei. »Das ist angenehm,« dachte er, »und man muß lernen, seine Blicke zu beherrschen und sie dahin zu führen, wo es anständig und männlich ist, sie hinzulenken.« Viele Damen streifte er mit Seitenblicken und mußte innerlich lachen, zu bemerken, welchen Eindruck das machte. Und er träumte dabei, wie immer! Nur daß er jetzt auf die Zähne biß beim Träumen und sich keine träge, müde Haltung mehr gestattete: »Wenn ich auch einer der ärmsten Teufel bin, so fällt es mir doch nicht ein, mir das merken zu lassen, im Gegenteil, die Geldverlegenheit verpflichtet gewissermaßen zu einem stolzen Benehmen. Wäre ich reich, so dürfte ich mir vielleicht den Schlendrian noch erlauben. So aber nicht, weil der Mensch auf ein Gleichgewicht bedacht sein muß. Ich bin hundemüde: aber ich muß immer denken: andere haben auch Ursache, müde zu sein. Man lebt nicht für sich allein, sondern für alle. Man hat die Verpflichtung, eine musterhafte, stramme Erscheinung zu sein, so lange man beobachtet wird, so daß sich weniger Mutige ein Beispiel daran nehmen können. Man soll den Eindruck der sorglosen Festigkeit machen, wenn einem auch die Kniee dabei zittern und der Magen einem in die Kehle hinauf singt vor Leere. Solches kann einem heranwachsenden Manne Vergnügen machen! Die Glocke hat noch nicht zwölfe geschlagen, für keinen; denn jeder hat jedesmal, wenn er arm daniederliegt, die Aussicht, hoch zu kommen. Eine Ahnung sagt mir, daß eine freie, stolze Haltung schon allein das Lebensglück an sich zieht wie ein elektrischer Strom, und in der Tat, man fühlt sich gehobener und reicher, wenn man anständig einhergeht. Ist man in Begleitung eines andern schlecht gekleideten, armen Teufels, wie es hier der Fall ist, so hat man umsomehr Veranlassung, kopfhoch zu gehen, indem man damit gewissermaßen des anderen schlechte Frisur und Haltung sanft und energisch entschuldigt, vor Menschen, die darüber verwundert sind, zwei so ungleich sich betragende Gesellen miteinander innig verbunden, auf Du und Du, in der eleganten Straße spazieren zu sehen. So etwas bringt Achtung ein, wenn auch nur flüchtige. Reizend ist es ja, zu denken, daß man angenehm absticht von einem Begleiter, der das Zeug noch nicht so los hat oder nie los haben wird. Übrigens ist mein Geselle ein älterer, unglücklicher Mann, ehemaliger Korbflechtereibesitzer, heruntergekommen durch allerlei Mißgeschick und jetzt Schreiber im Taglohn, wie ich, nur daß ich nicht ganz wie ein Schreiber und Taglöhner aussehe, sondern eher wie ein toller Engländer, während mein Kamerad aussieht wie einer, der sich schmerzlich zurücksehnt nach einstigen besseren Tagen. Sein Gang und sein immerwährendes, liebes, rührendes Kopfnicken erzählen sein Unglück mit ganz schamloser Sprache. Er ist ein älterer Mann und will nicht mehr imponieren, nur noch sich ein bißchen aufrecht halten. Mir imponiert er; denn ich kenne seinen Schmerz und weiß, welche drückende Last er mit sich trägt. Ich bin stolz darauf, mit ihm so durch ein schönes Straßenviertel zu gehen und drücke mich ganz unverschämt nahe an ihn an, um meine ungenierte Vorliebe für seinen geringen Anzug zu demonstrieren. Ich erhalte viele erstaunte Blicke, manches wundervolle Auge sieht mich seltsam fragend an, das muß mir Spaß machen, der und jener soll's holen! Ich spreche laut und mit Nachdruck. Der Abend ist so schön geeignet zum Sprechen. Ich habe gearbeitet den Tag über. Etwas Herrliches ist es, den Tag über gearbeitet zu haben und dann am Abend so schön müde und ausgesöhnt mit allem zu sein. So gar keine Sorgen, kaum einen Gedanken zu haben. So leichtfertig spazieren zu dürfen, mit dem Gefühl, keinem Menschen weh getan zu haben. Sich umzusehen, ob man vielleicht jemandem gefalle. Zu fühlen, daß man jetzt ein bißchen liebenswerter und achtenswerter sei, als früher, da man ein Tagedieb war, dessen Tage wie in einen Abgrund dahinsanken und verrauchten wie Rauch vertrieben wird. Viel zu fühlen, viel, an so einem geschenkten Abend! Den Abend wie ein Geschenk zu empfinden, denn das ist er denen, die den Tag für die Arbeit hergeben. So schenkt man und wird beschenkt.« –
Simon machte immer mehr die Beobachtung, daß die Schreibstube eine kleine Welt für sich war, in der großen. Neid und Streberei, Haß und Liebe, Übervorteilung und Ehrlichkeit, heftiges und bescheidenes Wesen machten sich hier im Kleinen, um ganz lumpiger Vorteile willen, ebensogut und scharf bemerkbar, wie überall, wo es dem Kampf um das tägliche Auskommen galt. Jede Empfindung und jeder Drang konnte hier seine Betätigung finden, wenn auch in geringfügigem Maßstab. Glänzende Kenntnisse nützten allerdings in der Schreibstube nicht viel. Ein Träger von solchen konnte sie hier höchstens improvisatorisch zum besten geben, es half ihm zum Ansehen, aber es half ihm nicht dazu, sich dafür einen besseren Anzug anschaffen zu können. Es gab etliche unter den Schreibstubenburschen, die drei Sprachen perfekt sprachen und schrieben. Diese wurden zum Übersetzen verwendet, aber sie verdienten damit nicht mehr als die plumpen Adressenschreiber und die Abschreiber von Manuskripten; denn die Schreibstube ließ keinen einzigen hochkommen, sonst würde sie ja ihre Zwecke und ihren ganzen Sinn verfehlt haben. Bestand sie doch immer nur, um Stellenlosen ein kümmerliches Leben zu gestatten, und nicht deshalb, um hohe, unverschämte Löhne auszubezahlen. Wenn einer überhaupt des Morgens um acht Uhr nur Arbeit fand, so mußte er froh sein. Oft kam es vor, daß der Verwalter zu einer Gruppe von Wartenden die Worte sprach: »Tut mir sehr leid. Heute leider nichts da. Kommen Sie um zehn Uhr wieder. Möglich, daß dann Aufträge eingelaufen sind!« und um zehn Uhr: »Es ist besser, Sie fragen morgen früh wieder nach. Heute wird wohl kaum noch etwas einlaufen!« Diese Abgewiesenen, unter denen sich auch Simon mehr als einmal befand, gingen dann langsam, Mann für Mann, trübselig die Treppe hinunter, wieder auf die Straße, wo sie einstweilen, als ob sie sich erst besinnen müßten, in einer runden, hübschen Gruppe stehen blieben und sich dann, einer nach dem andern, in alle Richtungen zerstreuten. Es war kein Vergnügen, ohne Geld in den Straßen der Stadt zu bummeln, jeder wußte das, und ein jeder dachte: »Wie wird das erst im Winter werden?«
Manchmal kamen ganz fein gekleidete Leute von eleganten Manieren in die Schreibstube, um nach Arbeit zu fragen. Denen pflegte der Verwalter zu sagen: »Wie es mir den Anschein macht, passen Sie besser in das Getriebe des Weltlebens als in die Schreibstube. Hier muß einer den ganzen Tag still sitzen, den Rücken krümmen und fleißig arbeiten, wenn er eine Kleinigkeit verdienen will. Ich spreche so offen zu Ihnen, weil ich die Empfindung habe, daß Ihnen das doch nicht passen würde. Und dann machen Sie mir auch nicht den Eindruck der trübseligen, notdürftigen Armut. Ich aber bin verpflichtet, zu allererst die Armen zu beschäftigen, das heißt solche, an denen man die Kleider womöglich in Fetzen herunterhängen sieht als Beweis ihrer Verkommenheit. Sie dagegen sehen mir zu stattlich aus, so daß es eine Sünde wäre, Ihnen hier Arbeit geben zu wollen. Mischen Sie sich unter die feine Welt, rate ich Ihnen. Es scheint, daß Sie die Düsterkeit der Schreibstuben verkennen, wenn Sie mit so munterem Gesicht hierherkommen, um nach Arbeit zu fragen, als wollten Sie auf den Tanzboden gehen. Hier pflegt man linkische, trotzige Verbeugungen zu machen, meistens aber gar keine, Sie aber verbeugten sich vorhin vor mir wie ein vollendeter Weltmann. Das geht nicht, ich kann Sie nicht gebrauchen, ich habe weder eine Arbeit, die Ihnen genügen könnte, noch eine Welt, in die Sie hineinpassen, für Sie. Sie werden als Verkäufer oder als Hotelsekretär jede Stunde Anstellung finden, wenn Sie es nicht nur darauf abgesehen haben, in dieser Stadt nach Abenteuern zu suchen, wie es mir beinahe den Anschein hat. Hier erlebt ein junger Mann nur Entmutigung, aber sonst weiter kein Abenteuer. Wer hierherkommt, der weiß, warum er gekommen ist. Sie scheinen es sicherlich nicht gewußt zu haben. Ihre ganze Erscheinung ist beleidigend für meine Arbeiter, das müssen Sie zugeben, wenn Sie nur einen Blick in die Stube werfen. Sehen Sie mich an: ich habe auch die Welt gesehen, kenne alle Großstädte der Welt, ich würde auch nicht hier sitzen, wenn ich nicht müßte. Wer hierher kommt, hat schon Unglück und mannigfaches Mißgeschick erlitten. Hierher kommen die Taugenichtse, Bettler, Schelme und Schiffbrüchigen: mit einem Wort, die Unglücklichen. Nun frage ich Sie: sind Sie ein solcher? Nein, und deshalb verlassen Sie jetzt, bitte, dieses Lokal, das keine Luft enthält, die Sie imstande wären, auf die Länge einzuatmen. Ich kenne die Figuren, die hierher gehören! Und zur Genüge! Leben Sie wohl!«
Und mit einer Handbewegung pflegte er solche für die Schreibstube nicht passende Menschen lächelnd zu entlassen. Der Verwalter besaß Schliff und Bildung, und er zeigte beides gelegentlich gerne vor solchen hereingeschneiten und hergewehten Besuchern, die mehr der Neugierde, als der Not wegen hierherkamen.
An der Schreibstube vorüber floß ein stiller, grüner, tiefer und alter Kanal, ehemaliger Festungsgraben und Bindemittel zwischen dem See und dem fließenden Fluß, dem man das Seewasser auf solche Weise auf die Reise in die fernen Meere mitgab. Es war überhaupt die stillste Stadtgegend, die etwas Zurückgezogenes und Dörfliches an sich hatte. Wenn nun die Abgewiesenen die Treppe hinuntertrampelten, so setzten sie sich gerne noch eine Weile auf das Geländer am Bord dieses Kanals, was dann aussah, als wenn eine Reihe von großen, seltsamen, ausländischen Vögeln darauf säße. Etwas Philosophisches hatte das, und in der Tat, manch einer schaute hinab in die grüne, tote Wasserwelt und grübelte ebenso vergeblich über die Unerbittlichkeit des Schicksals nach, wie ein Philosoph in seinem Studierzimmer zu tun pflegt. Der Kanal hatte etwas, das zum Träumen und Nachsinnen aufforderte, und dazu hatten die Stellenlosen reichlich Gelegenheit.
Die Schreibstube war zugleich ein Arbeitsmarkt für Kaufleute. Es kam zum Beispiel ein Herr oder eine Dame in die Stube, trat zu dem Verwalter ins Kabinett und wünschte auf einen oder auf ein paar Tage einen Mann, das heißt, eine Kraft zur Aushilfe ins Haus hinein. Dann kam der Verwalter in die Türeinrahmung, musterte seine Gesellen, und rief nach einiger Überlegung einen Mann beim Namen: dieser hatte dann eine kleine, acht-, ein-, zwei- oder vierzehntägige Anstellung gefunden. Das war immer ein neiderweckendes Ereignis, wenn einer beim Namen aufgerufen wurde, denn auswärts arbeitete ein jeder gern, weil der Verdienst größer und die Arbeit kurzweiliger war. Außerdem bekam solch ein Mann bei gutherzigen Leuten vormittags und nachmittags einen schönen Imbiß zum Frühstück und zur Vesper, was unter keinen Umständen zu verachten war. Da bestand nun immer ein Streben nach solchen Stellen und ein Liebäugeln mit dem Aufgerufenwerden. Viele glaubten sich stets ungerechterweise zurückgesetzt, und andere glaubten wieder, dem Verwalter und seinem Unterbeamten recht hofieren und schmeicheln zu sollen, um das Ersehnte zu erlangen. Es war ungefähr dasselbe, wie wenn ein Rudel abgerichteter Hunde nach einer an einem Bindfaden immer wieder hochgezogenen Wurst springt, wo auch einer immer glaubt, der andere hätte nicht das Recht, nach der Wurst zu schnappen, ohne indessen Gründe dafür angeben zu können. So knurrte auch hier einer den andern um des erschnappten Vorteiles willen an, ganz wie in der großen Handels-, Gelehrten-, Künstler- und Diplomatenwelt, wo es auch nicht viel anders, nur etwas geriebener, hochfahrender und kultivierter zugeht.
Simon arbeitete auch einige Male auswärts, wie es in der abgekürzten Schreibstubensprache hieß, aber er hatte kein Glück damit. Das eine Mal wurde er von seinem Prinzipal, einem pfiffigen und ziemlich brutalen Liegenschafts- und Rechtsagenten, der sich beinahe als der liebe Gott selber vorkam, zum Teufel gejagt, weil er in einer Zeitung las, statt mit der Feder zu arbeiten, und das andere Mal warf er selber seinem Chef, einem Frucht- und Gemüsehändler en gros die Feder vor die Nase und sagte ihm nur die Worte: »Machen Sie's selber!« Die Frau des Fruchthändlers wollte Simon allerhand Vorschriften machen; da brach er einfach ab; denn, nach seinem Gefühl, wollte ihn das Weib nur verletzen und demütigen, was er aber schließlich doch nicht nötig hatte sich bieten zu lassen; so empfand er wenigstens.
So vergingen einige Wochen in dem wundervollen Sommer. Simon hatte den Sommer noch nie so sehr als Wunder empfunden, wie dieses Jahr, wo er vielfach auf der Straße arbeitsuchend lebte. Es kam nichts dabei heraus, trotz den Bemühungen, aber es war wenigstens schön. Wenn er abends durch die modernen, blätterzitternden, schattenhaften, lichterzuckenden Straßen lief, war er immer daran, Menschen ohne weiteres mit törichten Worten anzusprechen, nur um zu erfahren, wie es ihm dabei erginge. Aber die Menschen zeigten alle nur ein verblüfftes Gesicht, weiter sagten sie nichts. Warum sprachen sie den Gehenden und Herumstehenden nicht an, forderten ihn nicht auf, mit dunkler Stimme, mitzukommen, in ein seltsames Haus hineinzutreten, und dort etwas zu tun, was nur müßige Menschen tun, Menschen, die keinen weiteren Lebenszweck im Sinne haben, so wie er, als den Tag vorübergehen und es Abend werden zu sehen, um am Abend Wunderdinge voll Taten zu erwarten? »Ich wäre zu jeder Tat bereit, wenn es nur eine kühne Tat wäre, die eines Unerschrockenen bedürfte,« sagte er zu sich. Stundenlang saß er auf einer Bank und hörte der Musik zu, die aus irgend einem vornehmen Hotelgarten herausrauschte, als ob die Nacht zu leisen Tönen sich umgewandelt hätte. Die nächtlichen Weibsbilder gingen an dem Einsamen vorüber, aber sie brauchten ihn nur schärfer zu beobachten, um sogleich zu wissen, wie es mit des jungen Mannes Kasse stand. »Wenn ich nur einen einzigen Menschen wüßte, den ich um eine Geldsumme angehen könnte,« dachte er. »Meinen Bruder Klaus? Das wäre nicht ehrenhaft; denn ich bekäme das Geld, aber zugleich einen leisen, traurigen Verweis. Es gibt Menschen, die man nicht anbetteln kann, weil sie zu schön denken. Wenn ich nur einen wüßte, an dessen Achtung mir nicht gar so sehr viel läge. Nein, ich kenne keinen. Es liegt mir an der Achtung aller. Ich muß warten. Eigentlich braucht man ja im Sommer nicht viel, aber es wird Winter! Ich habe ein wenig Furcht vor dem Winter. Ich zweifle nicht daran, daß es mir im kommenden Winter schlecht gehen wird. Nun, dann laufe ich im Schnee herum, wenn auch mit nackten Füßen. Was kann daran liegen. Ich laufe solange, bis mir die Füße brennen. Im Sommer ist das Ruhen so schön, das Liegen auf einer Bank unter den Bäumen. Der ganze Sommer ist wie eine erwärmte, duftende Stube. Der Winter ist ein Fensteraufreißen, der Wind und der Sturm blasen und sausen hinein, das macht einen dann sich bewegen. Da wird mir das Faulenzen vergehen. Es soll mir recht sein, was auch immer kommen mag! Wie der Sommer mir lang vorkommt. Erst einige Wochen lebe ich jetzt doch im Sommer, und schon so lang scheint er mir. Ich glaube, die Zeit schläft und dehnt sich im Schlafe aus, wenn man immer denken muß, was machen, um einen Tag lang mit seinem bißchen Geld auszukommen. Auch glaube ich, die Zeit schläft und träumt im Sommer. Die Blätter an den hohen Bäumen werden immer größer, in der Nacht lispeln sie, und am Tage schlafen sie unter dem heißen Sonnenschein. Ich zum Beispiel, was tue ich? Ich liege ganze Tage, wenn ich keine Arbeit habe, bei geschlossenen Läden im Bett, in meinem Zimmer, und lese beim Schein einer Kerze. Kerzen riechen so entzückend, und wenn man sie ausbläst, fließt ein feiner, feuchter Rauch durch das dunkle Zimmer, und es ist einem dann so ruhig zumute, so neu, wie einem Auferstandenen. Wie komme ich dazu, meine Miete zu bezahlen? Morgen müßte ich es tun. Die Nächte sind so lang im Sommer, weil man den Tag verbummelt und verschläft, und, sobald es Nacht wird, aus allerlei Sumsum und Wirrwarr aufwacht und zu leben anfängt. Es würde mir jetzt wie eine Sünde vorkommen, wenn ich nur eine einzige Sommernacht verschliefe. Überdies ist es zu schwül zum Schlafen. Im Sommer sind die Hände feucht und blaß, als spürten sie die Kostbarkeit der duftenden Welt, im Winter sind sie rot und dick, als wären sie über die Kälte zornig. Ja, es ist so. Der Winter macht einen zornig umherstampfen, im Sommer wüßte man nicht, worüber man zornig sein sollte, als vielleicht über den Umstand, daß man seine Miete nicht zu bezahlen imstande ist. Aber das hat mit dem schönen Sommer nichts zu tun. Ich bin auch nicht mehr zornig, ich glaube, ich habe das Talent verloren, mich zu erzürnen. Es ist Nacht, und der Zorn, das ist etwas so Taghelles, Rotes, Feuriges, wie nur irgend etwas sein kann. Morgen werde ich mit meiner Wirtin reden.« –
Am nächsten Morgen schob er seinen Kopf in die Türe des Zimmers, wo seine Wirtin wohnte und fragte sie in absichtlich scharfer Betonung, ob er ein Wort mit ihr reden dürfe, ob sie dazu Zeit habe.
»Freilich! Was es denn sei?«
Simon sprach: »Ich kann Ihnen den Mietzins für diesen Monat nicht bezahlen. Ich versuche gar nicht, Ihnen begreiflich machen zu wollen, wie peinlich mir das ist. Das kann ein jeder sagen in einem derartigen Fall. Dagegen setze ich voraus, daß Sie mir das Bestreben zutrauen, Mittel und Wege zu ersinnen, um zu einer ansehnlichen Summe Geldes zu gelangen, damit ich meine Schuld so bald wie möglich tilgen kann. Ich wüßte Menschen, von denen ich Geld bekäme, wenn ich nur wollte, aber mein Stolz verbietet mir, von Menschen, die ich mir verbunden wissen will, Geld auf Darlehn anzunehmen. Von einer Frau nähme ich es indessen an, sehr gerne sogar; denn Frauen gegenüber habe ich ganz besondere, nach einer anderen Ehre abzumessende Empfindungen. Wollen Sie mir, Sie, Frau Weiß meine ich, das Geld vorstrecken, erstens das Geld für die Miete, und dann noch eine kleine Zugabe zum Weiterexistieren? – Haben Sie nun das Gefühl, daß ich Ihnen unverschämt komme? Sie schütteln den Kopf. Ich glaube, daß Sie Zutrauen zu mir haben. Sie sehen, wie ich bei einer solchen Zumutung erröte, Sie erblicken mich nicht ohne Verlegenheit in diesem Moment. Aber ich pflege etwas rasch Entschlüsse zu fassen und sie prompt auszuführen, müßten sich mir dabei auch die Lungen zusammenschnüren. Von einer Frau nehme ich gern auf Vorschuß an, weil ich einer Frau gegenüber keiner Betrügereien fähig bin. Männer kann ich, wenn es die Lage erfordert, belügen, ohne Erbarmen, glauben Sie mir das. Frauen niemals. Wollen Sie mir wirklich so viel Zuschuß geben? Damit lebe ich einen halben Monat lang. Bis dahin wird sich Vieles verbessern in meiner jetzigen Lage. Ich danke Ihnen noch gar nicht einmal. Sehen Sie, so einer bin ich. Ich habe noch selten einmal im Leben einem Menschen die Gefühle meiner Dankbarkeit ausgedrückt. Ich bin Stümper im Danken. Nun, ich muß da allerdings sagen, Wohltaten habe ich auch, wo nur möglich, immer verschmäht. Eine Wohltat! Ich empfinde es wahrhaftig in diesem Moment, was eine Wohltat ist. Ich sollte eigentlich das Geld nicht annehmen.«
»Sie sind einer, Sie!«
»Nun, ich behalte es auch. Besorgen Sie nur nicht, daß es Ihnen nicht zurückgegeben wird. Ich bin vorläufig ganz glücklich durch das Geld. Geld ist doch eine Sache, die nur Strohköpfe verachten können.«
»Wollen Sie schon wieder gehen?«
Simon war bereits wieder zur Türe hinausgegangen und hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen. Es war ihm unangenehm, oder er tat so, als ob es ihm unangenehm wäre, weiter über diesen Gegenstand zu reden. Übrigens hatte er ja erreicht, was er wollte, und er liebte es nicht, sich lange zu entschuldigen, oder Versprechungen zu geben, wenn er jemand um einen Dienst gebeten hatte, der ihm erwiesen wurde. Er würde, falls er einmal der Geber wäre, auch keine Exküsen und Beteuerungen verlangen; fiele ihm niemals ein. Entweder habe man Vertrauen und Sympathie und gebe, oder man drehe dem Bittenden einfach kalt den Rücken, weil er einem widerlich sei. »Ich bin ihr keineswegs widerlich gewesen, denn ich habe bemerkt, daß sie mir mit einer Art schneller Freude das Geld gegeben hat. Es kommt alles auf das Benehmen an, wenn man seine Zwecke erreichen will. Es machte dieser Frau Vergnügen, mich ihr zu verpflichten, weil ich wahrscheinlich in ihren Augen ein passabler Mensch bin. Unangenehmen Menschen will man nichts geben, weil man sie sich nicht gern verbindet; denn eine Verpflichtung, wie das Abbezahlen einer Schuld ist, verbindet, bringt in Berührung, nähert, traut sich heran, muß nahe sein und ist beständig nahe. Wie wenig beneidenswert ist es, widerliche Schuldner zu haben. Solche Menschen sitzen förmlich auf dem Nacken der Gläubiger, man möchte ihnen die Schuld erlassen, nur um sie von sich abzuschütteln. Es ist ganz reizend, zu sehen, wie unbedenklich und behende einem gegeben wird; denn das ist das beste Zeugnis dafür, daß man noch Menschen um sich hat, denen man angenehm ist.« –
Er trat, indem er das erhaltene Geld in die Westentasche gleiten ließ, an das Fenster und bemerkte unten in der engen Gasse eine schwarzgekleidete Dame, die irgend etwas zu suchen schien; denn sie bog öfters ihren Kopf gegen die Höhe hinauf, wobei einmal ihre Augen diejenigen Simons trafen. Es waren große, dunkle Augen, echte Frauenaugen, und Simon mußte unwillkürlich an Klara denken, die er schon so lang nicht mehr gesehen, ja beinahe schon vergessen hatte. Aber es war Klara nicht. Die schöne Erscheinung in der tiefen Gasse mit ihrem vornehmen, üppigen Kleid bildete einen sonderbaren Gegensatz zu den finstern und schmutzigen Mauern, zwischen denen sie langsam dahinschritt. Simon hätte ihr zurufen mögen: »Bist du's, Klara?« Aber schon verschwand die Gestalt um eine Ecke herum, und nichts blieb von ihr in der Gasse zurück als ein Duft von Wehmut, den Schönes an finsteren Orten immer hinterläßt. »Wie schön wäre es gewesen, und wie passend in dem Moment, als sie hinaufschaute, ihr eine große, dunkelrote Rose hinabzuwerfen, daß sie sich darnach gebückt und sie aufgehoben hätte. Sie würde dazu gelächelt haben und würde sehr erstaunt gewesen sein, in einer so armseligen Gasse einem so freundlichen Gruß zu begegnen. Eine Rose würde zu ihr gepaßt haben, wie ein bittendes und weinendes Kind zu seiner Mutter. Aber woher teure Rosen nehmen, wenn man eben erst die Güte Anderer hat in Anspruch nehmen müssen, und wie vorausmerken, daß gerade um neun Uhr vormittags eine schöne Frauengestalt durch die Gasse kommt, die doch die dunkelste aller Gassen ist, während diese Frau das Vornehmste zu sein scheint, was ich je an Frauen erblickt habe?«
Er träumte noch lange Zeit der Dame nach, die ihn so seltsam an die vergessene und verschwundene Klara erinnert hatte, und verließ dann das Zimmer, eilte die Treppen hinunter, lief die Straßen entlang, verbrachte den Tag mit Nichtstun und befand sich gegen Abend in einem äußersten Viertel der weit sich erstreckenden Stadt. Hier wohnten die Arbeiter in verhältnismäßig schönen, hohen Häusern; wenn man aber die Häuser schärfer betrachtete, so fiel einem eine gewisse kahle Verwahrlostheit auf, die die Wände hinauflief, zu den eintönigen, kalten Fenstervierecken hinausschaute und auch auf den Dächern saß. Die hier beginnende Wald- und Wiesenlandschaft bildete einen sonderbaren Gegensatz zu den hohen und doch armseligen Baukästen, die diese Gegend eher verunzierten als schmückten. Daneben bemerkte man noch etliche, liebenswürdig gebaute, niedere, alte Landhäuser, die in der Gegend lagen wie Kinder im warmen Mutterschoß. Hier bildete das Land einen waldbedeckten Hügel, unter dem die Eisenbahn durch einen Tunnel durchfuhr, nachdem sie eben das Häusergewirr verlassen hatte. Der Abend beleuchtete die Wiesen, man fühlte sich hier schon auf dem Lande, die Stadt mit ihrem Geräusche lag hinten. Simon empfand die Unschönheit der Arbeiterhäuser nicht, denn er empfand das ganze Gemisch von Stadt und Land, das hier ein sonderbares, anmutvolles Bild darbot, als schön. Wenn er durch eine kahle, steinerne Straße ging und dicht daneben die warme Wiese spürte, so war ihm das eigenartig, und wenn er gleich darauf einen schmalen, erdigen Weg durch Wiesen hindurchschritt, was schadete es dann, zu wissen, daß es eigentlich Stadtboden, nicht Landboden war. »Die Arbeiter wohnen hier sehr schön,« dachte er, »sie haben durch jedes ihrer Fenster waldige, grüne Aussicht und wenn sie auf ihren kleinen Balkonen sitzen, so genießen sie eine gute, starke, würzige Luft und eine unterhaltende Rundsicht über Hügel und Rebberge. Wenn die neuen, hohen Häuser auch die alten erdrücken und schließlich vom Boden verjagen, so muß man bedenken, daß die Erde nie still steht, und daß sich die Menschen immer regen müssen, sei es auch in einer für den Moment nicht gerade lieblichen Form. Eine Gegend ist immer schön, weil sie immer von der Lebendigkeit der Natur und der Baukunst Zeugnis ablegt. So in eine hübsche Wiesen- und Waldgegend hineinzubauen, scheint zuerst etwas barbarisch, aber jedes Auge findet sich am Ende mit der Vereinigung von Haus und Welt ab, findet allerhand reizvolle Durchsichten an Hauswänden vorbei und vergißt das ärgerlich-kritische Urteil, das doch nie Besseres stiftet. Man braucht die alten Häuser nicht wie ein Baugelehrter mit den neuen zu vergleichen und kann an beiden Arten seine Freude haben, an dem Demutvollen und am Hochmütigen. Wenn ich ein Haus stehen sehe, so muß ich nicht meinen, es, weil es mir nicht schön genug vorkommt, umblasen zu können; denn es steht doch ziemlich fest da, beherbergt viele fühlende Menschen und ist deshalb immerhin eine respektable Erscheinung, an deren Erstehen zahlreiche fleißige Hände gearbeitet haben. Die Schönheitssucher müssen vielfach empfinden, daß es allein mit dem Suchen nach Schönheit in der Welt noch lange nicht getan ist, daß da noch anderes zu finden ist, als das Glück, vor einer reizenden Antiquität stehen zu bleiben. Das Ringen der armen Leute nach ein bißchen Frieden, ich meine die sogenannte Arbeiterfrage, ist doch sozusagen auch etwas Interessantes und muß einen wackeren Geist mehr beleben als die Frage, ob ein Haus schlecht oder gut in der Landschaft steht. Was gibt es nur für müßige, schönredende Köpfe auf der Welt. Gewiß: jeder denkende Kopf ist wichtig und jede Frage kostbar, aber es dürfte anständiger und für die Köpfe ehrender sein, zuerst Lebensfragen zu erledigen, bevor die zierlichen Kunstfragen erledigt werden. Nun sind aber allerdings Kunstfragen bisweilen auch Lebensfragen, aber Lebensfragen sind in noch weit höherem und edlerem Sinne Kunstfragen. Ich denke jetzt natürlich so, weil für mich das Weiterexistieren zu allererst in Frage kommt, weil ich Adressen schreibe im kargen Tagelohn, und ich kann mit der hochnäsigen Kunst nicht sympathisieren, weil sie mir im Augenblick als das Nebensächlichste in der Welt vorkommt; und in der Tat, man denke einmal, was ist sie gegen die sterbende und immer wieder erwachende Natur. Was hat die Kunst für Mittel, wenn sie einen blühenden, duftenden Baum darstellen will, oder das Gesicht eines Menschen? Gut, ich denke jetzt ein bißchen frech, von oben herab, nein, eher ein wenig wütend von unten herauf, aus der Tiefe, wo einem das Geld fehlt. Das ganze ist, ich bin kritisch und zugleich wehmütig, weil ich kein Geld habe. Ich muß zu Geld gelangen, das ist ganz einfach. Geliehenes Geld ist kein Geld, man muß es verdienen oder stehlen oder geschenkt bekommen. – Und dann ist noch eines: der Abend! Am Abend bin ich meist müde und mutlos.«
Während er auf diese Weise dachte, war er eine ziemlich ansteigende, kurze Straße hinaufgegangen, und blieb jetzt vor einem Hause stehen, aus dem ihn, zu einem geöffneten Fenster hinaus, ein Frauenkopf anschaute. Simon meinte in die Augen der Frau wie in eine ferne, versunkene Welt zu blicken, als ihm schon eine wunderbar bekannte Stimme zurief: »Ach, Simon, du bist es! Komm doch herauf!«
Es war Klara Agappaia.
Er erblickte sie, als er hinaufgesprungen war, in einem schweren, dunkelroten Kleid am Fenster sitzen. Die Arme und die Brust waren nur halb von dem herrlichen Stoff bedeckt. Das Gesicht war blasser geworden, seit der Zeit, da er sie zum letzten Mal gesehen. In ihren Augen brannte ein tieferes Feuer, aber der Mund war zugekniffen. Sie lächelte und gab ihm die Hand. In ihrem Schoße lag ein geöffnetes Buch, offenbar ein Roman, den sie zu lesen angefangen hatte. Zuerst vermochte sie nicht zu reden. Es schien ihr Scham und Mühe zu bereiten, zu fragen, zu erzählen. Sie schien bemüht zu sein, eine Fremdheit abzuschütteln, die sie in sich fühlen mochte vor ihrem jungen, einstigen Freund. Ihr Mund schien zu weinen, sobald er sich öffnen und weicher werden wollte. Ihre schönen, langen, üppigen Hände schienen die Sprache übernommen zu haben, wenigstens so lange, bis ihr Mund sich aus der Befangenheit löste. Sie musterte Simon absolut nicht, so wie man lange nicht Gesehene zu beobachten pflegt, sondern sah nur in seine Augen, deren ruhiger Ausdruck ihr wohltat. Sie ergriff wieder seine Hand und sagte endlich:
»Gib mir die Hand, laß mich zu dir sein, wie zu meinem Knaben, der mich schon versteht, so wie er nur das Rauschen meines Gewandes aus dem Nebenzimmer nahen hört, der mich mit dem Blick seiner Augen erfaßt, dem ich nichts zu sagen, nicht einmal etwas in die Ohren zu flüstern brauche, um ihm Geheimnisse zu verstehen zu geben; dessen Dasitzen, Kommen, Gehen, Stehen und Liegen mir sagt, daß er sein ganzes Gefühl nur hat, um seine Mutter zu verstehen; zu dem man sich herabneigt, zur Erde, vor seine Füße, um ihm die Schuhe besser zu binden, wenn die Bändel sich gelockert haben; dem man einen Kuß gibt, wenn er mutig und brav gewesen ist; für den man alles Geheime offen hat; vor dem man nicht wüßte irgend noch Geheimes zu haben; dem man alles gibt, auch wenn er ein kleiner Verräter ist und seine Mutter lange, lange hat vernachlässigen können, so wie du, auch wenn er sie hat vergessen können, wie du. Nein, du konntest mich nie vergessen. Du hast mich wohl öfters im Trotz abschütteln wollen, aber wenn dir eine Frau begegnete, die mir nur in einem kleinen Härchen ähnlich sah, so glaubtest du mich zu sehen und gefunden zu haben. Hast du da nicht gezittert, ist dir nicht gewesen, bei solch einem täuschenden Begegnen, als wenn sich dir plötzlich über einer hellen, in Stein gehauenen, herrlichen Treppe Flügeltüren geöffnet hätten, um dich in ein Gemach voll Wiedersehenslust einzulassen? Was ist Wiedersehen für eine Freude! Wenn man sich verloren hat, auf der Straße oder auf dem Lande, und nach einem Jahr sich dann, so ohne weiteres, so still wiederfindet, an einem solchen Abend, wo schon die Glocken die Ahnung des Wiedersehens in die Welt hinausläuten, so gibt man sich die Hände und denkt nicht mehr an die Trennung und an die Ursache der langen Abschweifung. Laß mir deine Hände! Deine Augen sind noch eben so gut und schön. Du bleibst dir gleich. Jetzt kann ich dir erzählen:
Als wir alle, Kaspar, ich und du, im letzten Sommer aus dem Waldhaus, weißt du noch, herausgehen mußten, und ihr Brüder dann verschwandet, wohin, wußte ich nicht, mietete ich mir unten in der Stadt ein elegantes Zimmer, sehnte mich nach euch und blieb eine Zeitlang trostlos. Gegen den Winter schien alles um mich herum in ein rotes Licht getaucht zu sein, ich vergaß alles, und warf mich in das Gewirr der Vergnügungen; denn ich besaß noch einen kleinen, aber für die hiesigen Verhältnisse ziemlich großen Rest meines Vermögens. Ich verbrauchte ihn und bekam dafür die Erkenntnis, daß man oft des Rausches bedarf, um sich über den Wellen des Lebens einigermaßen hoch zu halten. Ich hatte eine Loge im Theater, aber das Theater interessierte mich weit weniger, als die Bälle, wo ich zeigen konnte, daß ich schön und voll Laune war. Die jungen Männer schwärmten um mich herum, und ich erblickte nichts, das mir hätte verbieten können, sie alle zu verachten und sie meine Launen fühlen zu lassen. Ich dachte an euch beide und wünschte oft mitten unter all den Anschwärmungen, die so sehr aller Männlichkeit entbehrten, eure ruhigen Gesichter und offenen Manieren herbei. Da kam ein dunkler, schwarzer Mann auf mich zu, Student am Polytechnikum, schwer und täppisch von Ansehen, Türke, große, bezwingende Augen, und tanzte mit mir. Nach dem Tanze besaß er mich mit Seele und Leib, ich war sein. Es gibt für uns Frauen, wenn wir in Vergnügungen dahinrauschen, eine Art Männer, die uns nur im Tanzsaal bezwingen können. Wäre er mir an einem andern Ort begegnet, ich hätte ihn vielleicht ausgelacht. Er benahm sich vom ersten Augenblick an mir gegenüber als mein Herr und ich wußte nur zu erstaunen über seine Frechheit, nicht, mich zu wehren. Er befahl mir: so: und jetzt so! Und ich gehorchte. Im Gehorchen können wir Frauen, wenn es uns danach hinzieht, Außerordentliches leisten. Wir nehmen dann alles hin und wünschen uns, vielleicht aus Scham und Zorn, den Geliebten noch brutaler, als er ist. Er kann uns dann nicht grausam genug entgegentreten. Dieser Mann sah mein letztes Geld absolut als das seine an, ich auch, und ich gab es ihm, ich gab ihm alles. Als er mich genug gedrückt, tyrannisiert, ausgesogen und ausgebeutet hatte, ging er eines Tages fort, in sein Heimatland, nach Armenien zurück. Seine Knechtin, ich, versuchte nicht, ihn daran zu verhindern. Ich fand alles, was er tat, in der Ordnung. Auch wenn ich ihn weniger geliebt hätte, als wie es der Fall war, so hätte ich ihn ziehen lassen; denn dann würde mein Stolz es mir verboten haben, ihn aufzuhalten. So hatte ich ihm einfach zu gehorchen, als er mir befahl, ihm zur Abreise behülflich zu sein: meine Liebe gehorchte gern. Es erniedrigte mich nicht, ihn zum Abschied zu küssen, ihn, der mich kaum noch eines Blickes würdigte. Er sprach die Hoffnung aus, mich später, wenn seine Verhältnisse es ihm erlauben würden, mit in seine Heimat zu nehmen, um mich zu seiner Ehefrau zu machen. Ich empfand, daß es eine Lüge war, aber ich fühlte keine Bitterkeit. Gegen diesen Mann war jede unschöne Empfindung in mir ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe von ihm ein Kind, ein Mädchen, es schläft dort im Nebenzimmer.«
Klara hielt einen Augenblick inne, lächelte Simon an, und fuhr dann fort:
»Ich war gezwungen, eine Stelle zu suchen, und fand sie bei einem Photographen als Empfangsdame. Die Bewerbungen und Heiratsanträge, die man mir vielfach entgegenbrachte, da ich mit einem großen Publikum zu tun bekam, schlug ich alle lächelnd ab. Alle Männer dachten von mir: »Sie hat etwas so Zartes, Hausmütterliches, das wäre eine!« Aber ich wurde für keinen eine! Meine Stellung gestattete mir noch einen ziemlichen Aufwand, wenigstens konnte ich die schönen Kleider alle behalten, was mir jetzt noch zustatten kommt. Mein Prinzipal war ein Mann, den ich achten durfte, das erleichterte mir um vieles meine Arbeit, die ich, wie in einem leisen, angenehmen Traum befangen, verrichtete. Ich hatte mir für das Publikum ein ganz bestimmtes, zuckendes Lächeln angewöhnt, ich machte mich damit beliebt, allen erschien ich liebenswürdig und ich lockte Kunden heran, was meinen Chef zu einer Salär-Erhöhung veranlaßte. Damals war ich beinahe glücklich. Alles schwand mir in schöne, süße Erinnerungen dahin. Ich fühlte das Herannahen des Mutterschmerzes, und das trug zu einer wehmutvoll-glücklichen Stimmung bei. Es schneite, daß die Straße ganz in Flocken eingehüllt wurde. Und wenn ich abends durch die verschneiten Straßen hinging, dachte ich an euch Brüder, an dich und an Kaspar und viel, sehr viel an Hedwig, der ich in Gedanken und Gefühlen dankbare Huldigungen darbrachte. »Ich hab ihr doch ein einziges Mal schreiben dürfen. Sie hat nicht geantwortet. Aber es ist doch schön so,« dachte ich. Dann kam ich mir selber so schön vor, wenn ich so dachte. Ich wurde immer mehr erfüllt von allem, und ging immer in ganz langsamen Schritten, jeden Schritt fühlte ich als Menschenwohltat. Ich gab indessen das elegante Zimmer im Zentrum der Stadt auf und mietete mich hier ein, da, wo du mich jetzt siehst. Ich fuhr morgens und abends mit der »Elektrischen« hin und zurück und lenkte immer die Blicke aller Mitfahrenden auf mich. Es war etwas Seltsames an mir, ich fühlte es selber. Viele fingen unbewußt mit mir zu sprechen an, einige, nur um ein Wort mit mir zu wechseln, andere, um meine Bekanntschaft zu machen. Aber das letztere hatte wenig Reiz mehr für mich. Ich glaubte alles von vornherein kennen zu sollen, ich hatte ein so bestimmtes, ablehnendes, aber zugleich sanftes, mir selber wohltuendes Gefühl dabei. Die Männer! Wie oft wurde ich von ihnen angesprochen. Sie glichen neugierigen Kindern, die wissen wollten, was ich machte, wo ich wohnte, wen ich kannte, wo ich zu Mittag aß und was ich abends zu treiben pflegte. Sie erschienen mir wie unschuldige, etwas vorwitzige Kinder; so war ich damals. Nie begegnete ich einem einzigen grob, ich hatte es nicht nötig; denn es wurde mir gegenüber kein einziger unverschämt: ich war ihnen eine Dame, die zugleich verlockte und erkältete. Einmal sprach mich ein kleines, geistreich aussehendes Mädchen an, es war Rosa, du kennst sie ja. Sie enthüllte mir ihr ganzes Leiden und Leben, wir wurden Freundinnen, und jetzt hat sie sich verheiratet, obschon ich ihr davon abgeraten hatte. Sie besucht mich öfters, mich, die Königin der Armen!« –
Wieder schwieg Klara einen Augenblick, während sie Simon kindlich-lustig anblickte, und sprach dann weiter:
»Die Königin der Armen! Ja, das bin ich. Siehst du nicht, wie deine Klara fürstlich angezogen ist? Das ist noch ein Stück aus meiner Ballgarderobe: hinten ausgeschnitten! Ich bin meinem Stand als Fürstin schon etwas Aufwand schuldig. Das sehen meine Angehörigen gerne, sie haben Sinn für Hoheit, die Pracht eines Ballkleides nimmt sich in dieser Gegend der fleckigen, grauen Frauengewänder einzig aus. Man muß abstechen, lieber Simon, wenn man beeinflussen will, doch höre der Reihe nach ruhig weiter. Was bist du für ein flotter, angenehmer Zuhörer. Das verstehst du, einem zuzuhören, wie keiner! Das ist einer deiner Vorzüge! Es erzählt sich dir so natürlich, so schön: Ich lernte, als ich hier in dieses entlegene Viertel hinauszog, langsam aber immer wachsend, die Armen lieben, die auf die andere, dunkle Seite der Welt Gedrängten, das Pack, wie der Titel lautet, mit dem man eine Welt voll Sehnen und Mühsal tituliert. Ich sah, daß ich hier nötig sein konnte, und ich richtete mich, ganz ohne Zwang und Aufsehen, so ein, daß ich nötig geworden bin. Wenn ich sie heute verlasse, so jammern diese Leute, diese Weiber, Kinder und Männer. Im Anfang hatte ich Abscheu und Ekel vor ihrem Schmutz, aber ich sah, daß dieser Schmutz gar nicht so garstig in der Nähe war, als wie er aus der steifen, hochtrabenden Entfernung aussieht. Ich lehrte meine Hände, ja, meinen Mund sogar, wie man diese Kinder zu berühren hatte, deren Gesichter nicht die saubersten waren. Ich gewöhnte mich daran, die rauhen Hände der Arbeiter und Taglöhner zu drücken, und bemerkte rasch die Zartheit, womit diese Leute einem die Hand reichen. Ich fand vieles in dieser Welt, was mich an euch, an dich und Kaspar, erinnerte. Es war jedenfalls viel Feinheit und viel Verborgenes, das mich lockte, mich zur Herrin und Bevormundin dieser Menschen zu machen. Es war leicht und schwer zugleich zu machen. Da waren die Weiber! Wie viel Mühe brauchte es, sie von ihren Gebrechen und abscheulichen Fehlern so zu überzeugen, daß sie allmählich Lust bekamen, sich von ihrer Schmach zu befreien. Ich gewöhnte sie an den Segen und an die Lust der Reinlichkeit, und ich sah, daß sie nach langem, mißtrauischem Zaudern endlich Freude dabei empfanden. Die Männer erwiesen sich als lenksamer; denn ich war schön: so gehorchten sie mir besser, waren talentvoller im Erfassen meiner so einfachen Lehren. Simon! Wenn du wüßtest, wie es mich glücklich macht, diesen Armen eine innige Erzieherin zu werden! Wie wenig braucht man zu wissen, um an Kenntnissen noch Ärmere zu finden, die man leiten kann. Nein, die Wissenschaft macht es nicht allein aus. Hier bedarf es des Mutes und der Lust, energisch Stellung zu nehmen, sich die Stellung durch Stolz und Milde zu sichern und leidenschaftlich aufzutreten. Ich gewöhnte mir eine Sprache an, die alle Bildung, die ich besaß und die ich schenken konnte, leicht faßlich erklärte, in Ausdrücken, wie das niedrige, erniedrigte Volk sie liebt. So wurde ich ihre Herrscherin, indem ich mich ihren Gedanken und Gefühlen, oft gegen meinen Geschmack, anpaßte. Aber nach und nach wurde es mein Geschmack. Wenn ein Mensch beeinflußt, hat er zugleich auch die Gabe, sich unmerklich ebenfalls von den Beeinflußten beeinflussen zu lassen. Das Herz und die Gewohnheit besorgen das leicht. Als ich dann eines Tages im Bett lag, um mit Schmerzen das Kind zu erwarten, das dort nebenan schläft, kamen sie zu mir, die Frauen und Mädchen, besorgten und pflegten mich und taten mir Gutes, bis ich wieder aufstehen konnte. Ihre Männer fragten voll Kummer nach mir, während der Zeit, und als sie mich wieder sahen, schienen sie beglückt zu sein, mich noch schöner als früher zu finden. So ehrten sie ihre Fürstin. Das war im Frühling. Ich saß, noch etwas schwach von der Geburt, in meinem Zimmer wie unter Blumen; denn sie brachten mir alle Blumen, soviel sie nur bringen konnten. Ein junger reicher Mann aus der Nachbarschaft besuchte mich oft und ich litt es, wenn er mir zu Füßen saß; denn ich empfand darin eine Ehrung, und von ihm war es zart. Eines Tages flehte er mich an, ich möge seine Frau werden, ich wies auf das Kind, doch das ermunterte ihn nur, seine Anträge, die mich auf einmal seltsam berührten, an den folgenden Tagen zu wiederholen. Er erzählte mir sein ganzes, leeres, umhergejagtes Leben, ich fühlte Mitleid mit ihm und habe ihm versprochen, seine Frau zu werden. Er ist mit einem Wink, einem Blick von mir zufrieden und liebt mich so, daß ich es jeden Augenblick fühlen muß. Wenn ich ihm sage: »Artur, es ist unmöglich,« so erbleicht er, und ich muß ein Unglück erwarten. Er steht unvergleichbar hilflos vor mir in der Welt da. Ich habe nicht die Kraft, ihn unglücklich zu machen. Außerdem ist er reich, und ich brauche Geld für mein Volk, er wird es dazu hergeben. Er tut alles, was ich will. Er erlaubt mir nicht, zu bitten, er bittet mich, ihm zu gebieten. So steht es mit ihm. Er wird jetzt gleich kommen, dann werde ich dich ihm vorstellen. Oder willst du gehen? Du machst Miene dich zu entfernen. Dann geh! Es ist vielleicht besser. Ja, es ist besser. Er würde mißtrauisch werden. Er ist schrecklich in dieser Hinsicht. Er ist imstande und schlägt sich den Kopf an der Wand blutig, wenn er einen jungen Mann bei mir sieht. Außerdem will ich niemanden bei mir sehen, wenn du da bist. Und wenn andere da sind, sollst du nicht da sein. Ich will dich allein, ganz allein für mich haben. Ich muß dir noch vieles sagen, wie alles kam. Die Menschen sagen so viel, aber das richtige? – Geh jetzt. Ich weiß, daß du bald wiederkommst. Übrigens werde ich dir schreiben. Hinterlasse mir deine Adresse. So, leb wohl!«
Auf der Treppe, als er hinunterstieg, begegnete Simon einer dunklen, fliegenden Gestalt: »Das wird wohl dieser Artur sein,« dachte er und ging seines Weges weiter. Es war Nacht geworden. Er schlug einen kleinen, schmalen Feldweg ein und drehte sich, nachdem er ein paar Schritte gegangen war, zurück, das Fenster war jetzt geschlossen, dunkelrote Vorhänge hinter demselben waren vorgezogen, die seltsam düster leuchteten im Lichte einer Lampe, die wohl eben angezündet wurde. Ein Schatten bewegte sich hinter der Gardine, es war Klaras Schatten. Simon ging weiter, langsam, in tiefen Gedanken. Er hatte es durchaus nicht eilig, in die Stadt zu gelangen. Dort wartete niemand auf ihn. Morgen würde er wieder in der Schreibstube schreiben. Es war höchste Zeit, nun endlich stramm ins Zeug zu gehen, zu arbeiten, etwas Geld zu verdienen. Vielleicht bekäme er auch endlich wieder einmal einen Posten. Er lachte, als er das Wort »Posten« ausdachte. Als er in der Stadt ankam, war es bereits sehr spät geworden. Er trat in eine noch offene Singspielhalle ein, um sich zu zerstreuen, bekam aber nicht viel Gutes zu sehen. Ein Komiker trat auf, den er wünschte, als ganz gewöhnlichen Menschen unter dem zuschauenden Publikum verschwinden zu sehen, der eigentlich für das, was er darbot, verdient hätte, geohrfeigt zu werden. Doch nein! Simon empfand bald das lebhafteste Mitleid mit diesem armen Schlucker, der die Beine, die Arme, die Nase, den Mund, die Augen und sogar die armseligen, knochigen Wangen verrenken mußte, um nicht einmal, nach solchen Qualen, zu erzielen, was sein Ziel war: Komik! Er hätte »Pfui« ausrufen mögen und doch wieder nur »Ach«! Man sah dem Manne deutlich an, daß er ein ehrlicher, braver und nicht besonders geriebener Mann sein mußte: um so abscheulicher wirkte sein Tun auf der Bühne, das nur für Menschen paßt, die eben so geschmeidig wie liederlich sein müssen, wenn sie ein abgerundetes, wohltuendes Bild darbieten wollen. Eine Ahnung sagte Simon, daß dieser Komiker vor kurzem vielleicht noch einen stillen, festen Beruf ausgeübt hatte, von dem er wohl wegen irgend eines Versehens oder Vergehens verdrängt worden war. Ihm war der ganze Mann tief beschämend und widerlich. Dann trat eine kleine, junge Sängerin auf, in der knappen, anschließenden Tracht eines Husarenoffiziers. Das war besser; denn es streifte an Kunst, was das Mädchen darbot. Alsdann zeigte sich ein Jongleur, der aber besser daran würde getan haben, Korke aus Flaschen zu ziehen, als Flaschen auf seiner Nasenspitze balancieren zu lassen, was er überaus kindisch und geschmacklos verrichtete. Er stellte eine brennende Lampe auf seinen flachen Kopf und stellte an die Zuschauer die Zumutung, das als ein Kunstwerk aufzufassen. Simon hörte noch einen Knaben ein Lied singen, das gefiel ihm, und er verließ alsogleich das Lokal mit diesem guten Eindruck. Er trat wieder auf die Straße.
Es gingen nur noch spärlich Menschen umher. In einer Seitengasse schien Streit zu sein, und in der Tat, als Simon näher heranging, sah er eine wüste Szene: zwei Mädchen schlugen, die eine mit der Faust, die andere mit dem roten Sonnenschirmchen, aufeinander los. Den Kampf beleuchtete eine einsame, melancholische Laterne, die die Gesichter teilweise erhellte. Die Kleider und Hüte der Mädchen waren nur noch Fetzen, und dabei schrieen sie beide, nicht so sehr aus Wut, als aus Schmerz und zwar auch nicht wegen der Hiebe, sondern aus einem Rest von Schamgefühl heraus, sich so tierisch elend benehmen zu sehen. Es war ein schrecklicher aber nur kurzer Kampf, dem ein erscheinender Schutzmann ein Ende machte. Er führte beide Mädchen ab, sowie einen elegant gekleideten Herrn ebenfalls, der die Ursache des Streites zu sein schien. Ein Briefbote hatte den Anzeiger gespielt und bildete sich jetzt viel darauf ein. Die Mädchen kehrten ihre ganze Wut nun dem Briefträger zu, der sich infolgedessen aus dem Staube machte.
Simon ging nach Hause. Als er aber in seiner Gasse ankam, bemerkte er einen Trupp Menschen, die lachten und schrieen, und zwar war es ein Weib, das die Aufmerksamkeit der nächtlichen Käuze auf sich lenkte. Sie hieb nämlich mit einer Gerte auf einen betrunkenen Mann los, der wohl ihr eigener sein mochte und den sie aus irgend einer kleinen Kneipe herausgeschleppt hatte. Dabei schrie sie in einem fort, und als Simon in die Nähe kam, klagte sie diesem in lauten, schreienden Worten vor, was sie für einen Lump von Mann hätte. Mit einem Male schoß aus der Höhe des Hauses, unter welchem die Gruppe stand, ein Strahl Wasser herunter und netzte die Köpfe und Kleider der Untenstehenden auf eine boshafte Weise. Es war Sitte in diesem Viertel der Altstadt, auf Nachtschwärmer, die Lärm verübten, Wasser hinunterzuleeren. Die Sitte mochte schon ein ehrwürdiges geheiligtes Alter besitzen, aber es war doch jedesmal für die Betroffenen eine empörend neue und überraschende Sache. Alles fluchte gegen die Weibsperson hinauf, die in weißer Nachtjacke oben im Fensterrahmen stand und wie ein übelwollender, böser Geist hinunterschaute. Simon vor allen andern schrie hinauf: »Was fällt Ihnen ein da oben, Sie Weib oder Mann im Fensterrahmen? Wenn Sie zu viel Wasser haben, so gießen Sie's doch auf Ihren eigenen Kopf, statt auf die Köpfe anderer. Ihr Kopf dürfte es vielleicht nötiger haben. Was ist das für eine Manier, in der Nachmitternacht die Straße zu bespritzen und Leute hinterrücks in ein Bad, samt den Kleidern, zu stürzen. Wären Sie nicht so hoch oben und ich nicht so tief unten, ich wollte in Ihren Apfel von Kopf beißen, daß es Ihnen um den Mund herum wässern sollte. Bei Gott, wenn es eine Gerechtigkeit gäbe, Sie müßten mir für jeden Tropfen, der meine Schulter bespritzt hat, einen Taler geben, da ich vermute, daß Ihnen dann der Spaß verleiden müßte. Ziehen Sie sich nur zurück, Gespenst da oben, oder Sie machen mich noch die Hauswände hinaufklettern, um zu untersuchen, ob Sie Weibs- oder Mannshaare haben. Gleich könnte man zum Teufel werden vor Wut über eine solche Spritzerei.«
Simon berauschte sich selber an seinem schlechten Gerede. Es tat ihm wohl, schreien und wettern zu können. Einen Augenblick später würde er doch im Bett liegen und schlafen. Wie langweilig war das, immer dasselbe zu tun. Von morgen ab müßte er entschieden ein anderer Mensch werden. Am nächsten Tag, in der Schreibstube, erfüllt und zerstreut von Gedanken an Klara, machte er viele Flüchtigkeitsfehler, so daß der Sekretär der Schreibstube, ein ehemaliger Hauptmann des Stabes, sich veranlaßt fühlte, ihm Vorwürfe zu machen und ihm zu drohen, daß er keine Arbeit mehr erhalte, wenn er sie nicht gewissenhafter, als nur so, erledigen wolle.
Der Herbst kam. Simon war noch oft durch die nächtliche heiße Gasse gegangen, und er ging auch jetzt noch, aber die Jahreszeit war rauher geworden. Man wußte, daß draußen in den Wiesen die Bäume sich entblättern mußten, wenn man auch nicht selber hinging und zusah, wie die Blätter fielen. In der Gasse spürte man es auch. An einem sonnigen Herbsttag war Klaus angekommen, eine wissenschaftliche Arbeit und Absicht hatte ihn für einen Tag in diese Gegend geführt. Sie waren zusammen hinaus auf das erhöhte, hügelige Feld gegangen, angelockt von der schönen Sonne, ziemlich schweigsam und allzu intime Gespräche vorsichtig vermeidend. Der Weg führte sie durch Wald und wieder über langgestreckte Wiesen, deren spätes, saftiges Gras Klaus bewunderte, ebenso die braungefleckten Kühe, die hier weideten. Es war hübsch gewesen für Simon, ein wenig gedankenvoll, aber doch sehr hübsch, so mit Klaus ohne viel Gerede und viel Wesens, durch die herbstliche Niederung zu wandern, die Glocken der Kuhherden läuten zu hören, ein paar Worte zu sagen, aber doch mehr in die Ferne zu schauen, als zu sprechen. Alsdann waren sie einen waldigen Hügel emporgegangen, sachte und wohlig; denn Klaus wollte alles, jeden Zweig und jede Beere, liebevoll betrachtet wissen, und waren dann zu der Höhe gekommen, an einen schönen Waldrand, wo eine unsäglich milde und liebkosende abendliche Herbstsonne sie empfing, und wo ihnen die Freiheit des Blickes wiedergegeben war, eine Aussicht in ein Tal hinunter, in welchem ein weißlich schimmernder Fluß sich dahinschlängelte, zwischen gelben Baumkronen und vorspringenden Waldungen hindurch, wo ein anmutiges, rotdächiges Dorf inmitten der braunen Rebhügel lag, das anzuschauen eine Herzenslust sein mußte. Hier hatten sie sich auf die Matte geworfen, waren lange still, ohne ein Wort zu sprechen, geblieben, hatten mit den Augen an der weit sich ausbreitenden Gegend und mit den Ohren an den Tönen der Glocken gehangen und hatten beide gefunden, daß immer irgendwie und wo Töne in allen Landschaften zu vernehmen seien, ohne gerade Glocken zu hören, und hatten dann eines jener stillen, mehr empfundenen als geradezu gesprochenen Gespräche miteinander geführt, die nicht aufgeschrieben werden können, die keinen weiteren Zweck als das Wohlwollen haben, die nichts sagen wollen, deren Duft nur und Ton und Absicht unvergeßlich bleiben. Klaus hatte gesagt: »Gewiß, wenn ich mir denken darf, daß noch alles mit dir gut kommen kann, so darf ich auch wieder mehr frohen Mut haben. Zu denken, daß du ein nützlicher, zweckerfüllter Mensch würdest, das hat immer in meinem Herzen ein besonders schönes Getön verursacht. Du bist so sehr darauf angelegt, die Achtung der Menschen zu genießen, wie nur irgend einer, und mehr noch, da du Eigenschaften hast, nur eigentlich zu viel wollende und zu flammende, die andere nicht besitzen. Du mußt nur nicht zu vieles wollen und mußt nicht allzu reizbar sein im Forderungen an dich stellen. Das schadet und reibt ab und macht schließlich kalt, glaube es mir nur. Weil du nicht alles, jede kleine Sache in der Welt, so vorfindest, wie du es wünschest, so darfst du deswegen noch lange nicht grollen. Anderer Meinungen und Neigungen herrschen eben auch, und zu gute Vorsätze vergiften viel eher das Herz eines Mannes als das Gegenteil, was freilich ein Übel ist. Du hast, wie mir scheint, zu sehr Springlust. Dich nach einem Ziele außer Atem zu laufen, macht dir Vergnügen. Das taugt nicht. Laß doch jeden Tag in seiner ruhigen, natürlichen Abrundung nur bestehen und sei ein bißchen mehr stolz darauf, es dir bequem, wie schließlich einem Menschen auch ziemt, gemacht zu haben. Wir haben die Pflicht, uns vor den Mitmenschen das Leben mit Anstand und einiger Würde leicht zu machen; denn wir leben in einer Fülle von stillen, gedankenvollen Kultursorgen, die mit dem grollenden, heißen Atem der Raufer nichts zu tun haben. Du hast, ich muß es dir sagen, etwas zu Wildes an dir, und dann, im Handumkehren, springst du in eine Zartheit über, die wieder viel zu viel Zartheit von den Menschen fordert, um bestehen zu können. Vieles, das dich verletzen sollte, kränkt dich in keiner Weise, und verletzen läßt du dich von ganz selbstverständlichen, aus Welt und Leben herausgewachsenen Dingen. Du mußt versuchen, Mensch unter Menschen zu werden, dann wird es dir sicher gut gehen; denn im Erfüllen von allerhand Anforderungen kennst du keine Ermattung, und einmal die Liebe der Menschen gewonnen, wird es dich dann reizen, ihnen zu zeigen, daß du sie verdient hast. So, wie du jetzt bist, drückst du dich um die Ecken herum und gehst in Sehnsuchten unter, die eines Bürgers, Menschen und vor allem eines Mannes nicht recht würdig sind. Wie viel habe ich schon gedacht, das du tun und unternehmen könntest, um dich zu befestigen, aber ich muß dir doch am Ende die Arbeit an dem Herausformen deines Lebens selbst überlassen; denn Ratschläge taugen selten etwas.« – Simon sagte dann: »Warum bist du sorgenvoll an einem so schönen Tage, wo das Hinschauen in die Ferne einen in Glück zerfließen macht?« –
Dann hatten sie über die Natur geplaudert und das Schwere vergessen.
Am andern Tag war Klaus wieder abgereist.
Es wurde Winter. Merkwürdig: die Zeit ging über alle guten Vorsätze ebenso sicher hinweg wie über die schlechten Eigenschaften, deren man nicht Herr werden konnte. Es lag etwas Schönes, Hinwegnehmendes und Verzeihendes in diesem Gehen der Zeit. Sie ging über den Bettler wie über den Präsidenten der Republik hinweg, über die Sünderin und über die Anstandsdame. Sie ließ vieles als klein und unbedeutend empfinden; denn sie allein stellte das Erhabene und Große dar. Was war denn das ganze Treiben und Leben, was all das Sich-Rühren, was das Vorwärtsstreben gegen die Höhe, die sich keineswegs darum bekümmerte, ob einer ein Mann wurde oder ein Simpel, der es gleichgültig war, ob man das Rechte und Gute wünschte oder nicht? Simon liebte dieses Rauschen der Jahreszeiten über seinem Kopf, und als eines Tages Schnee in die dunkle, schwärzliche Gasse hinabflog, freute er sich des Fortschrittes der ewigen, erwärmenden Natur. »Sie schneit, das ist der Winter, und ich Törichter habe geglaubt, den Winter nicht mehr erleben zu sollen,« dachte er. Es kam ihm wie ein Märchen vor: »Es waren einmal Schneeflocken, die flogen, weil sie nichts Besseres zu tun wußten, auf die Erde nieder. Viele flogen aufs Feld und blieben dort liegen, andere fielen auf die Dächer und blieben dort liegen, wieder etliche und andere fielen auf Hüte und Kapuzen von schnell vorwärtseilenden Menschen und blieben dort liegen, bis sie abgeschüttelt wurden, einige und wenige flogen einem Pferd, das vor einem Karren angebunden stand, ins treue, liebe Antlitz und blieben auf den langen Wimpern der Pferdsaugen liegen, ein Schneeflocken flog in ein Fenster hinein, aber was er dort machte, ist nicht erzählt worden, jedenfalls blieb er dort liegen. In der Gasse schneit's, im Wald oben, o, wie schön muß es jetzt im Wald sein. Da könnte man hingehen. Hoffentlich schneit es noch bis in den Abend, wenn die Laternen angezündet werden. Es war einmal ein Mann, der war ganz schwarz, da wollte er sich waschen, aber er hatte kein Seifenwasser. Als er nun sah, daß es schneite, ging er auf die Straße und wusch sich mit Schneewasser und davon wurde sein Gesicht weiß wie Schnee. Da konnte er prahlen damit, und das tat er. Aber er bekam den Husten, und nun hustete er immer, ein ganzes Jahr lang mußte der arme Mann husten, bis zum nächsten Winter. Da lief er den Berg hinauf, bis er schwitzte, und noch immer hustete er. Das Husten wollte gar nicht mehr aufhören. Da kam ein kleines Kind zu ihm, es war ein Bettelkind, das hatte einen Schneeflocken in der Hand, der Flocken sah aus wie eine kleine zarte Blume. »Iß den Schneeflocken,« sprach das Kind. Und nun aß der große Mann den Schneeflocken, und weg war der Husten. Da ging die Sonne unter, und alles war dunkel. Das Bettelkind saß im Schnee und fror doch nicht. Es hatte zu Hause Schläge bekommen, warum, das wußte es selber nicht. Es war eben ein klein Kind und wußte noch nichts. Seine Füßchen froren ihm auch nicht, und doch waren sie nackt. In des Kindes Auge glänzte eine Träne, aber es war noch nicht gescheit genug, um zu wissen, daß es weinte. Vielleicht erfror das Kind in der Nacht, aber es spürte nichts, spürte gar nichts, es war zu klein, um etwas zu spüren. Gott sah das Kind, aber es rührte ihn nicht, er war zu groß, um etwas zu spüren.« –
Simon spornte sich in dieser Zeit an, trotz der Winterkälte, die in seinem Zimmer herrschte, früh aus dem Bett zu springen, wenn er auch weiter nichts zu tun hatte. Er würde dann einfach dastehen, sich auf die Zähne beißen, und das Anspannende würde schon kommen müssen. Irgend etwas gäbe es immer zu tun. Er könnte sich ja zum Zeitvertreib die Hände oder den Rücken reiben, oder versuchen, auf den Händen am Boden zu gehen. Irgend eine Willensübung, sei es auch die allerlächerlichste, müßte er stets treiben, das vertriebe die Gedanken und stählte und ermunterte den Körper. Er wusch sich alle Morgen mit kaltem Wasser ab, von oben bis unten, bis ihm heiß wurde, und verschmähte es, den Mantel anzuziehen, wenn er ausging. Er wollte sich jetzt lehren, zu parieren in dieser Jahreszeit! Den Mantel benutzte er als Fußumhüllung, wenn er am Tische saß und las. Ein Paar breite, grobe Schuhe, wie sie die Rekruten beim Militär tragen, schaffte er sich an, um zu jeder Zeit über den Berg im tiefen Schnee zu waten. Das sollte ihn lehren, jetzt noch auf elegante Schuhe zu sehen. Mit so einem derben Schuhpaar mochte man um eins noch so fest in der Welt dastehen. Es kam jetzt darauf an, oberhalb zu bleiben und festen Fuß zu fassen. Wenn er nur den Nacken nicht beugte, mußte sich sicher, ja, von selbst, etwas für ihn zeigen, das er ergreifen konnte. Wieder anfangen, von vorne, seinetwegen fünfzig Mal, was schadete das jetzt. Er mußte nur gespannten Blicks und gespannten Sinnes bleiben, dann würde es schon kommen, was er haben mußte.
Er glich in dieser Zeit einem Menschen, der Geld verloren hat und der seinen ganzen Willen einsetzt, es wieder zu gewinnen, der aber zur Wiedergewinnung weiter nichts tut, als nur eben den Willen einsetzen, und sonst nichts macht.
Um die Weihnachtszeit herum ging er den breiten Berg hinauf. Es war gegen Abend und furchtbar kalt. Ein beißender Wind pfiff den Menschen um die Nasen und Ohren, die gerötet und von der Kälte entzündet wurden. Simon schlug unwillkürlich den Weg ein, der einstmals zu Klaras Waldhaus hinaufführte und der jetzt gangbarer gemacht worden war. Überall zeigte sich eine Spur von umwandelnden Menschenhänden. Er sah ein großes, doch nicht unzierliches Haus vor sich stehen, an der Stelle, an der früher das Chalet aus Holz stand, in das er so oft hineingegangen war, als noch Kaspar hier malte, zu der lieben merkwürdigen Frau, die es bewohnte. Jetzt war hier ein Kurhaus für das Volk errichtet worden, und es wurde, wie es den Anschein hatte, fleißig besucht; denn etliche wohlgekleidete Menschen gingen aus und ein. Simon besann sich eine Weile, ob er ebenfalls hineingehen sollte, aber schon die grimmige Kälte machte ihm den Gedanken an einen erwärmten, menschenerfüllten Saal angenehm. So trat er hinein. Ein warmer, scharfer Duft von Tannenzweigen schlug ihm entgegen, das ganze große, helle Zimmer, eigentlich ein Saal, war mit Tannengrün geziert und ausgefüttert, gleichsam tapeziert. Nur die Sprüche, die an die weißen Wände gemalt waren, befanden sich frei, und man konnte sie lesen. An allen Tischen saßen heitere und ernste Menschen, viele Frauen, aber auch Männer und Kinder, einzeln an einem runden Tischchen sitzend oder zu Gesellschaften um einen länglichen Tisch herum vereinigt. Der Duft von Getränken und Speisen vermischte sich mit dem weihnachtlichen Tannenduft. Hübsch gekleidete Mädchen gingen umher, und bedienten die Gäste auf eine freundliche und zugleich überaus gelassene Weise, die nichts Kellnerinnenhaftes an sich hatte. Es sah aus, als ob diese zierlichen Mädchen nur, um ein lächelndes Spiel aufzuführen, hier bedienten, oder so, als ob sie nur ihren Eltern, Verwandten, Brüdern, Schwestern oder ihren Kindern diesen Dienst erwiesen: so elterlich und kindlich zugleich sah es aus. Eine kleine, ebenfalls dicht mit Tannenzweigen umrahmte Bühne befand sich an einem anderen Ende des Saales, vielleicht zur Aufführung irgend eines Weihnachtsstückes oder eines Stückes mit sonst irgend einem lieblichen Inhalt. Auf jeden Fall war es ein warmer, freundlicher, gastlich aussehender Raum, und Simon setzte sich, als einzelner, an ein rundes Tischchen nieder, wartend, ob eines der Mädchen zu ihm herankäme, um zu fragen, was er wünsche. Aber es kam vorläufig keines. So blieb er denn eine geraume Zeit still, das Kinn in die Hand gestützt, wie es junge Männer zu machen pflegen, an dem Tischchen sitzen, als mit einem Mal eine schlankgewachsene Dame auf ihn zukam, ihm freundlich entgegennickte und dann, zu einem der Mädchen gewendet, ausrief und frug, wie man nur den jungen Herrn so lange ohne Bedienung lassen könne. Dieser Vorwurf war eher lachend und liebenswürdig geschehen, als ernsthaft, aber jedenfalls war diese Dame hier im Hause eine Art Direktorin oder Leiterin oder wie man das nennen konnte.
»Entschuldigen Sie, daß man Sie sitzen läßt,« wandte sie sich wieder zu Simon.
»O, ich wüßte nicht, was da zu entschuldigen wäre. Vielmehr ich habe mich zu entschuldigen, daß ich der Anlaß bin, daß Sie einem von Ihren Mädchen einen Vorwurf machen müssen. Ich sitze hier übrigens ganz gern, ohne daß man sich um mich bekümmert; denn offen gestanden: was ich an Bestellungen für das bedienende Mädchen aufzuwenden habe, ist blutwenig.« –
»Essen und trinken Sie nur so viel, als Sie wollen. Sie brauchen nichts zu bezahlen,« sagte die Dame.
»Gilt das für mich allein oder gilt das hier für alle?«
»Natürlich nur für Sie allein, und nur deshalb, weil ich die bezügliche Ordre erteilen werde, daß man Ihnen nichts abfordern soll.«
Sie setzte sich zu ihm an den kleinen, braunen Tisch:
»Ich habe einen Augenblick Zeit, mit Ihnen zu plaudern, und sehe nicht ein, warum ich es nicht tun sollte. Sie scheinen ein vereinsamter junger Mann zu sein, das sagen mir Ihre Augen, und sie sagen mir auch, und das deutlich genug, daß der, dem sie gehören, den Wunsch fühlt, mit Menschen in Berührung zu kommen. Ich weiß nicht, wie es kommt, daß ich Sie für einen wohlgebildeten Menschen halten muß. Als ich Sie sah, reizte es mich schon, mit Ihnen zu sprechen. Wenn ich Sie mit der scharfen Lorgnette hätte betrachten wollen, würde ich vielleicht entdeckt haben, daß Sie ziemlich verwahrlost aussehen, aber wer wollte Menschen erkennen lernen und sich dazu des Augenglases bedienen? Als Vorsteherin dieses Hauses habe ich ein Interesse daran, möglichst genau zu erfahren, wer alles meine Gäste sind. Ich habe mich daran gewöhnt, die Menschen nicht nach einem schäbigen Filzhut, sondern nach ihren Bewegungen, die ihr Wesen besser erklären, als gute oder schlechte Kleidungsstücke, zu beurteilen, und habe im Laufe der Zeit gefunden, daß ich den richtigen Weg nehme. Gott soll mich doch, wenn er es je gut mit mir meint, daran verhindern, hochnäsig und hochmütig zu werden. Eine Geschäftsfrau, die nicht Menschenkennerin ist, macht mit der Zeit schlechte Geschäfte, und was lehrt denn die zunehmende Menschenkenntnis? Das Einfachste von der Welt: Alle mit Freundlichkeit zu behandeln! Sind wir nicht alle zusammen, wir Menschen auf diesem einsamen, verlorenen Planeten, Geschwister? Brüder und Schwestern? Brüder zu Schwestern, Schwestern zu Schwestern und wieder Schwestern zu Brüdern? Ganz zart kann ja das sein und muß es wohl auch immer sein: in Gedanken vor allem! Aber dann muß es auch anschwellen und getan werden. Kommt mir ein roher Mann vor oder ein einfältiges Weib, was kann ich da tun? Muß ich mich sogleich abgeschreckt und unsympathisch berührt fühlen? O, noch lange nicht. Ich denke dann: nein, ganz angenehm ist mir dieser Mensch nicht, er stößt mich ab, er ist ungebildet und anmaßend, aber ich muß ihn und mich das nicht in so allzudeutlicher Weise merken lassen. Ich muß mich ein wenig verstellen, er verstellt sich dann vielleicht auch ein wenig, wenn auch nur aus Trägheit oder Dummheit. Wie lieb ist es, Rücksichten zu nehmen. Ich bin innerlich heilig und mit Flammen davon überzeugt, daß es lieb ist, weiter weiß ich über diesen Punkt nichts zu sagen. Oder dieses noch: ein Bruder muß ja nicht gerade zu den feinsten und erlesensten Menschen gehören und kann doch, vielleicht aus, sagen wir, etwas abgemessener Entfernung, Bruder sein. So mache ich es mir zum Gesetz, und ich stehe ordentlich gut dabei. Viele Menschen gewinnen mich lieb, die vordem die Schultern gezuckt und mir ihr Gesicht verzogen haben. Warum sollte ich nicht, was eine so reizende Lehre, wie das Üben der liebenden und beobachtenden Geduld ist, betrifft, ein klein wenig Christin sein? Wir alle haben das Christentum jetzt vielleicht wieder nötiger als je zuvor; aber das ist dumm gesprochen. Sie lächelten, und ich weiß ganz gut, warum Sie lächeln. Sie haben recht, weshalb habe ich mit Christentum zu kommen, wo nur einfache, kluge Freundlichkeit in Frage kommt. Wissen Sie was? Ich denke mir so manchmal: Christenpflicht, das geht jetzt in unseren Tagen leise und kaum spürbar in Menschenpflicht über, und das ist viel einfacher und ist besser auszuführen. Doch ich muß gehen. Man ruft mich. Bleiben Sie sitzen, ich komme wieder.« –
Damit ging sie fort.
Nach einigen Minuten kam sie wieder und fing schon aus der Entfernung von ein paar Schritten das Gespräch von neuem an, indem sie ausrief: »Wie doch hier alles von Neuheit umspannt ist. Sehen Sie sich doch um: alles ist neu, frisch und erst eben geboren. Keine einzige Erinnerung an Altes! Sonst befindet sich in jedem Hause und in jeder Familie wohl irgend ein altes Möbel, ein Hauch und Stück aus alten Zeiten, das man noch immer liebt und ehrt, weil man es schön findet, wie man eine Abschiedsszene oder einen wehmutvollen Sonnenuntergang schön findet. Erblicken Sie hier etwas Ähnliches, auch nur eine Andeutung davon? Es kommt mir wie eine schwindelnde, gebogene, leichte Brücke in die noch unerklärliche Zukunft vor. O, in die Zukunft zu blicken, ist schöner, als der Vergangenheit nachzuträumen. Man träumt auch, wenn man in eine Zukunft hineindenkt. Hat das nicht etwas Wunderbares? Sollte es nicht klüger von den feindenkenden Menschen sein, ihre Wärme und ihre Ahnungen den noch kommenden, als den vergangenen Tagen zu schenken? Kommende Zeiten sind uns wie Kinder, die eher der Aufmerksamkeit bedürfen als die Gräber der Gestorbenen, die wir vielleicht nur mit etwas zu übertriebener Liebe schmücken: die vergangenen Zeiten! Der Maler wird jetzt gut daran tun, Kostüme für ferne Menschen zu entwerfen, die die Grazie besitzen werden, sie mit Anstand und Freiheit zu tragen, der Dichter träumt Tugenden aus für starke, von keiner Sehnsucht angefressene Menschen, der Baumeister erfindet, so gut es geht, Formen, die dem Stein und dem Bauen einen entzückenderen Schwung verleihen, er geht in den Wald und merkt sich da, wie hoch und edel die Tannen aus dem Boden herauswachsen, um sie als Muster für künftige Bauten zu nehmen, und der Mann im allgemeinen wirft, in der Vorausahnung des Kommenden, viel Gemeines, Unedles und Undienliches ab und flüstert seiner Gattin, wenn sie ihm den Mund zum Kuß darreicht, seine Gedanken ins Ohr, so gut er es versteht, und die Frau lächelt. Wir verstehen es, euch Männer mit einem Lächeln zu Taten anzuspornen, und wir bilden uns ein, unsere Aufgabe getan zu haben, wenn wir es dahin gebracht haben, euch die eurige ganz lebhaft und reizvoll vor die Sinne zu lächeln. Wir sind froher über das, was ihr gemacht habt, als über Selbst-Vollbrachtes. Wir lesen die Bücher, die ihr schreibt, und denken: wenn sie doch nur etwas mehr tun und etwas weniger schreiben wollten. Im allgemeinen wissen wir nicht viel Ersprießlicheres, als uns euch zu unterwerfen. Was können wir anderes! Und wie gern tun wir es. Aber von der Zukunft zu reden, habe ich natürlich vergessen, von diesem kühnen Bogen über einem dunklen Gewässer, von diesem Wald voller Bäume, von diesem Kind mit den strahlenden Augen, von diesem Unsagbaren, das einen immer reizt, es in Worte wie in ein Netz zu fangen. Nein ich glaube, die Gegenwart ist die Zukunft. Finden Sie nicht, daß hier herum alles nur Gegenwart atmet?«
»Ja,« sagte Simon.
»Und draußen ist jetzt furchtbar strenger Winter, und hier drinnen ist es so warm, so eben recht, daß man Gespräche führen kann, und ich sitze hier bei Ihnen, einem ganz jungen, scheinbar etwas verkommenen Menschen, und versäume am Ende noch meine Pflichten. Ihr Benehmen hat etwas Fesselndes, wissen Sie das? Man möchte Ihnen gleich eine Ohrfeige geben, aus heimlicher Wut darüber, daß sie so dumm dasitzen, und einen in so sonderbarer Weise verführen können, die kostbare Zeit mit Ihnen Hereingeschneitem zu verlieren. Wissen Sie was: Sie könnten trotzdem noch eine Weile dasitzen. Es kommt Ihnen gewiß nicht drauf an. Ich werde dann noch einmal einen Anlauf nehmen auf Ihre Ohren. Jetzt hab' ich Pflichten.« –
Und fort war sie.
Simon betrachtete seine Umgebung, während die Dame fortblieb. Die Lampen gaben ein helles und warmes Licht. Die Menschen plauderten unbefangen miteinander. Einzelne, da es schon Nacht war, gingen jetzt fort, weil sie noch den Berg hinuntergehen mußten, um in die Stadt zu kommen. Zwei alte Männer, die gemütlich an einem Tische saßen, fielen ihm durch ihre Ruhe auf. Sie hatten beide weiße Bärte und ziemlich frische Gesichter und rauchten aus ihren Pfeifen, was ihnen etwas Altväterisches verlieh. Sie sprachen nicht miteinander, sie schienen das für überflüssig zu halten. Ab und zu trafen sich ihre gegenseitigen Augenpaare und dann zuckten sie so mit ihren Pfeifen und Mundwinkeln, aber ganz ruhig und wahrscheinlich ganz gewohnheitsmäßig. Es schienen Müßiggänger zu sein, aber berechnende, ausgedachte und überlegene Müßiggänger, aus dem Wohlstand heraus müßig. Gewiß hatten sie sich beide angeschlossen, nur deshalb, weil sie dieselben Gewohnheiten betrieben: Pfeife rauchen, Spaziergängchen machen, Vorliebe für Wind, Wetter und Natur, das Gesundsein, das gerne lieber Schweigen als Plaudern und endlich das Alter und die mit demselben verbundenen Spezialsächelchen. Simon erschienen die beiden nicht ohne Würde. Man mußte ein wenig lächeln bei ihrem abgezirkelten, hübschen Anblick, aber dieser Anblick schloß die Ehrfurcht nicht aus, die schon das Alter allein für sich herausfordert. Etwas Zielbewußtes sprach aus ihren ruhigen Mienen, etwas Fertiges und in keiner Weise mehr Anzufechtendes. Beirren ließen sich diese Alten gewiß nicht mehr in ihrer Sache, die vielleicht ein Irrtum war. Aber was war denn eigentlich Irrtum? Wenn man sich mit sechzig und siebzig Jahren noch einen Irrtum als Leitstern anschaffte, so war das eine unantastbare Sache, die dem Jüngling Achtung abringen mußte. Diese beiden Käuze, denn etwas Kauzartiges hatten sie immerhin an sich, mußten irgend ein Verfahren, ein System haben, nach welchem sie sich schworen zu leben bis ans Lebensende; so sahen sie aus, so wie zwei, die für sich etwas gefunden hatten, das ihnen diente und das sie veranlaßte, ruhig ihrem Ende entgegenzusehen. »Wir zwei haben's herausgefunden, euer Geheimnis,« so drückten sich ihre Mienen und Haltungen aus. Es war lustig und rührend und des Nachdenkens wohl wert, ihnen zuzuschauen und sich zu bestreben, ihre Gedanken zu erraten. So erriet man unter anderem sogleich, so wie man sie eine Weile betrachtet hatte, daß diese zwei immer würden zusammen gesehen werden können, nie anders, nie einzeln, sondern zu zweien! Immer! Das war der Hauptgedanke, den man ihnen aus ihren weißen Köpfen ablauschte. Zu zweien durchs Leben, womöglich zu zweien hinunter in den Abgrund des Todes: das schien ihr Prinzip zu sein. In der Tat, sie sahen auch aus wie zwei lebendige, alt gewordene, aber immer noch lustige und muntere Prinzipien. Wenn es wieder Sommer würde, so würde man sie draußen auf der schattigen Terrasse sitzen sehen, aber eben so geheimnisvoll Pfeifen stopfend und das Schweigen dem Reden bevorzugend. Wenn sie fortgingen, gingen immer zweie fort, nicht erst einer und dann der andere: das schien undenkbar. Ja, gemütlich sahen sie aus, das mußte Simon ihnen lassen: gemütlich und eigensinnig, dachte er, indem er von ihnen weg, wo andershin, blickte.
Er ließ über verschiedene Menschen seine Blicke streifen, entdeckte eine englische Familie mit sonderbaren Gesichtern, Männer, die Gelehrte zu sein schienen und andere, denen man nur schwer ein Amt oder eine Berufsart zudichten konnte, sah Frauen mit weißen Haaren und Mädchen mit ihrem Bräutigam, bemerkte Leute, denen man ansah, daß sie sich hier nicht recht wohlfühlten, und wieder andere, die wie zu Hause im Familienkreis hier saßen. Aber der Saal leerte sich zusehends. Draußen pfiff der Winter, und man konnte die Tannen aneinanderächzen hören. Der Wald lag nur zehn Schritte weg vom Hause entfernt, das wußte Simon aus alten Tagen genau.
Indem er sich so seinen Gedanken überließ, erschien die Vorsteherin wieder.
Sie setzte sich zu ihm.
Es schien eine stille Veränderung mit ihr vorgegangen zu sein. Sie erfaßte Simons Hand: das war etwas Unerwartetes. – Darauf sprach sie leise, von niemandem gehört und von niemandem beobachtet:
»Jetzt wird man mich wohl kaum noch stören, bei Ihnen zu sitzen, die Leute entfernen sich allmählich. Sagen Sie mir, wer sind Sie, wie heißen Sie, woher kommen Sie? Sie sehen so aus, als ob man das fragen müßte. Ein Fragen und ein Verwundern geht von Ihnen aus, nicht ein Verwundern, das Sie selbst haben, sondern der, der Ihnen gegenübersitzt, und über Sie. Man fragt sich und verwundert sich über Sie, und dann bekommt man eine Sehnsucht darnach, Sie reden zu hören, und stellt sich vor, daß es etwas sein müßte, was da aus Ihnen herausspräche. Man macht sich unwillkürlich Kummer wegen Ihnen. Man geht von Ihnen fort, macht seine Arbeit, und plötzlich erbarmt man sich Ihrer, indem man an Sie denkt. Mitleid ist es nicht, denn das fordern Sie absolut nicht heraus, und Erbarmen schlechtweg ebenfalls nicht. Ich weiß nicht, was es sein kann: Neugierde vielleicht? Lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Neugierde? Ein Begehren, etwas über Sie zu wissen, nur etwas, nur einen Ton oder einen Laut. Man glaubt Sie bereits zu kennen, findet Sie nicht sehr interessant und lauscht und lauscht doch, ob Sie da etwas gesagt haben, was vielleicht wert gewesen wäre, noch einmal zu Ihrem Mund heraus vernommen zu werden. Wenn man Sie anblickt, bedauert man Sie unwillkürlich leichthin, obenhin, von oben herab. Sie müssen etwas Tiefes an sich haben, und das scheint niemand zu bemerken, weil Sie sich keinerlei Mühe geben, es hervortreten und leuchten zu lassen. Ich möchte Sie erzählen hören. Haben Sie noch Eltern, und haben Sie Geschwister? Von Ihnen vermutet man, wenn man Sie bloß erblickt, daß Sie bedeutende Menschen zu Geschwistern haben müssen. Sie selbst aber hält man und muß man für unbedeutend halten. Wie kommt das? Man fühlt sich Ihnen gegenüber leicht als Überlegener. Und doch, wenn man sich mit Ihnen eingelassen hat, sieht man, daß man einen jener Fehler begangen hat, der deshalb vorkam, weil man es mit einem durchaus gelassenen Menschen zu tun gehabt hat, der es nur verschmähte, sich in Position zu werfen, und nicht wollte besser und gefährlicher aussehen, als er ist. Sie sehen wenig interessant und noch weniger gefährlich aus, und die Frauen, das ist so ein Gemengsel von Zartheitsbedürfnis und Lust an der rohen Gefahr, die sie beständig bedrohen soll. Sie nehmen natürlich nicht übel, was ich Ihnen soeben gesagt habe, denn Sie nehmen nichts übel. Man weiß nicht, wie man mit Ihnen dran ist. Möchten Sie mir erzählen, ich bin so gespannt darauf! Wissen Sie, ich möchte gerne Ihre Vertraute sein, wenn auch nur für eine Stunde, meinetwegen in der Einbildung bloß. Als ich oben war, eben vorhin, hatte ich einen solchen Drang darnach, zu Ihnen hinunterzueilen, als wären Sie gar eine Persönlichkeit von Belang, die man unter keinen Umständen warten lassen darf, vor der man froh sein muß, in Gnade und in einiger herablassender Achtung zu stehen. Und sitzt da einer, dessen Wangen höher glühen, wenn ich daher zu springen komme! Welch eine Verwechslung, aber ist es nicht seltsam? So, jetzt will ich still sitzen und Ihnen zuhören.« –
Simon erzählte:
»Ich heiße Tanner, Simon Tanner, und habe vier Geschwister, von denen ich der Jüngste bin und derjenige, der zu den wenigsten Hoffnungen berechtigt. Ein Bruder ist Maler, der lebt in Paris, und er lebt dort stiller und zurückgezogener als in einem Dorf; denn er malt. Jetzt muß er sich schon ein wenig verändert haben, es ist über ein Jahr her, daß ich ihn zuletzt gesehen habe, aber ich denke, wenn Sie ihm begegnen würden, bekämen Sie den Eindruck von einem bedeutenden und in sich abgeschlossenen Menschen. Es ist nicht ohne Gefahr, mit ihm zu tun zu haben, er bestrickt, und das in einer Weise, daß man um seinetwillen Torheiten begehen kann. Er ist ganz und gar Künstler, und wenn ich, sein Bruder, etwas von der Kunst verstehe, so ist er daran schuld, nicht mein Verständnis, das sich nur, angezogen von ihm, einigermaßen entfalten konnte. Ich glaube, er trägt jetzt lange Locken, aber die Locken stehen ihm so natürlich, wie einem Offizier der kurzgeschorene Kopf, man findet es nicht auffällig. Unter den Menschen verschwindet er, und er begehrt auch, unter ihnen zu verschwinden, um ruhig arbeiten zu können. Früher einmal hat er mir in einem Briefe etwas von einem Adler geschrieben, der seine Schwingen breite über Felsenkanten und der sich über Abgründen am wohlsten fühle, und ein anderes Mal schrieb er mir, der Mensch und Künstler müsse arbeiten, wie ein Pferd, umsinken sei noch gar nichts, umsinken müsse er und sogleich wieder aufstehen und frisch ans Werk gehen. Er war damals noch ein Knabe, und jetzt malt er Bilder. Wenn er nicht mehr wird malen können, wird er auch kaum noch leben. Er heißt Kaspar und ist als Schulknabe in der Schule und im elterlichen Hause fortwährend für einen faulen Bengel angesehen worden, glauben Sie das nur, und nur deshalb, weil sein ganzes Wesen ein gelassenes und mildes war. Er wurde früh aus der Schule genommen, weil er darin nicht reüssierte, und mußte Schachteln und Kisten herumschleppen, und dann kam er aus der Heimat fort und lernte dort draußen, den Menschen die Achtung, die er verdiente, abzunötigen. Das ist einer meiner Brüder, ein anderer heißt Klaus. Dieser ist der Älteste, und ich halte ihn für den besten und bedachtsamsten Menschen auf der Welt. Die Nachsicht, das Bedenkentragen und das Nachdenken schauen ihm zu den Augen heraus. Er ist ein tüchtiger Mensch, so tüchtig, daß niemand jemals hinter seine bescheidene, verborgene Tüchtigkeit kommen wird. Er hat uns Jüngere aufwachsen und uns unsern Begierden und Leidenschaften nachhängen sehen, er hat geschwiegen dazu und gewartet, bisweilen ein Wort der Sorge und des Rates gesprochen, aber er hat immerfort eingesehen, daß jeder seinen eigenen Weg gehen muß, er hat nur Schlimmes zu verhüten gesucht, und das Gute an einem hat er stets mit sonderbarem Scharfblick herausgefunden. Dieser Bruder macht sich wegen mir stille Sorgen, ich weiß das ganz genau; denn er liebt mich, er liebt überhaupt die Menschen und hat eine sonderbar schüchterne Achtung vor ihnen, die wir Jüngere nicht besitzen. Obschon er eine bedeutende Stellung in der Gelehrtenwelt einnimmt, bin ich doch überzeugt, daß nur seine Gewissenhaftigkeit, die immer mit Schüchternheit verbunden ist, daran schuld ist, daß er eine nicht noch höhere bekleidet; denn er verdiente die höchste und verantwortungsreichste. Nun habe ich noch einen dritten Bruder, der nur unglücklich ist, weiter nichts, und der nur noch das ist, was die Erinnerung von ihm an seine früheren Tage einem erzählen kann. Er ist im Irrenhaus. – Sollte ich das vielleicht vor Ihnen nicht offen haben heraussagen dürfen? Sie haben sicher ein Interesse daran, wenn Sie nun schon dasitzen und mir mit so aufmerksam lauschendem Ohr zuhören, alles der Wahrheit gemäß zu erfahren, sonst lieber gar nichts, nicht wahr! Sie nicken und sagen mir damit, daß ich Sie schon ziemlich kenne, wenn ich den Mut habe, von Ihnen anzunehmen, daß Sie eine tapfere und zugleich herzensgütige Frau sind. Hören Sie weiter. Dieser unglückliche Bruder war wohl, ich darf es ruhig sagen, das Ideal eines jungen schönen Mannes, und Talente besaß er, die eher in das galante, zierliche achtzehnte Jahrhundert hineingepaßt haben würden, als in unsere Zeit mit den viel härteren und trockneren Anforderungen. Lassen Sie mich über sein Unglück schweigen; denn erstens würde ich Sie damit verstimmen, und zweitens und drittens und meinetwegen auch sechstens schickt es sich nicht, die Falten des Unglücks auseinander zu ziehen, alle Feierlichkeit wegzunehmen, alle schöne, verschleierte Trauer, die nur dann ist, wenn man schweigt über solches. Ich habe Ihnen nun leise und skizzenhaft meine Brüder gezeigt, es tritt jetzt ein Mädchen auf, eine einsame, in einem Dörfchen mit Strohdächern vergrabene Schullehrerin, meine Schwester Hedwig. Möchten Sie sie kennen lernen? Sie würden mit Ihrer ganzen Empfindung Freude an dem Mädchen haben. Es gibt kein stolzeres Geschöpf als sie auf der Erde. Ich lebte drei volle Monate lang als Müßiggänger bei ihr auf dem Lande, sie hat geweint, als ich ankam und mich ausgelacht, als ich, mit dem Reisekoffer in der Hand, zärtlich Abschied nehmen wollte. Fortgejagt hat sie mich und mir zugleich einen Kuß gegeben. Sie hat mir gesagt, daß sie für mich nur eine leise, nicht abzuwehrende Verachtung hege, aber sie hat es so schön gesagt, daß ich mich wie geliebkost geglaubt habe. Denken Sie, sie hat mich bei ihr geduldet, als ich zu ihr kam, bettelhafter und frecher als ein aufdringlicher Landstreicher, der sich nur seiner Schwester einmal erinnerte, weil er dachte: »da kannst du hingehen, bis du wieder auf zwei Füßen stehst«. – Aber wir haben die drei Monate hindurch wie in einem heiteren Lustgarten voll Laubengänge zusammen gelebt. So etwas kann man niemals vergessen. Wenn ich ausging und im Walde spazierte und nicht wußte vor Trägheit, ob ich mich am Kinn oder hinter den Ohren kratzen sollte, träumte ich von ihr, nur von ihr, als von dem Nächsten und dem Fernsten zugleich. Sie war mir fern aus Ehrfurcht und nahe aus Liebe. Sie war so stolz, wissen Sie, daß sie mich niemals fühlen ließ, wie lumpig ich ihr vorkommen mußte. Sie hat sich nur gefreut, als ich mich bei ihr wohlgefühlt und eingenistet hatte. Das dauerte bis zu der letzten Stunde, den Abschied schnitt sie mir einfach vom Munde weg, in dem Vorausgefühl, daß ich nur Kränkendes und Dummes sagen würde. Als ich, schon weggegangen, hinter mich den Hügel herabblickte, sah ich sie mir mit der Hand nachwinken, so freundlich und einfach, als ginge ich nur bis zum nächsten Dorfschuhmacher und käme nach einer Stunde wieder zurück. Und doch wußte sie, daß sie allein in der Verlassenheit zurückbleiben und die Aufgabe vorfinden würde, sich eines Gesellschafters zu entwöhnen, was immerhin eine Aufgabe und ein Stück innerlicher Arbeit war. Wir haben uns, wenn wir abends zusammensaßen, das Leben erzählt und haben die Flügel der Kindheit wieder rauschen hören, wie das Kleid unserer Mutter auf dem Zimmerboden rauschte, wenn sie den Kindern entgegenkam. Meine Mutter und meine Schwester Hedwig ergeben in meinem Kopf immer ein innig verbundenes und zusammengewobenes Bild. Hedwig hat die Mutter, als diese krank wurde, besorgt und gepflegt, wie man ein kleines Kind pflegen muß. Denken Sie: ein Kind sieht seine Mutter zum Kinde werden und wird Mutter an der Mutter. Welche seltsame Verschiebung der Gefühle. Meine Mutter war eine hochgeachtete Frau, und die Hochachtung, die man ihr allgemein entgegenbrachte, war rein und kam aus dem Herzen heraus. Sie hat immer den Eindruck des Ländlichen und zugleich Vornehmen gemacht. Demutvoll und zugleich abweisend, wußte sie jeden Ungehorsam und jede Lieblosigkeit zu dämpfen. Der Ausdruck ihres Gesichts bat und gebot zu gleicher Zeit. Wie scharten sich die Damen in unserer Stadt um sie, und wenn sie spazieren ging, wie viele Herrenhüte wurden vor ihr gelüftet. Dann, als sie krank wurde, fiel sie in Vergessenheit und wurde der Gegenstand der Sorge und der Scham. Man schämt sich eben kranker Familienglieder wegen und ist beinahe zornig, wenn man der Tage gedenkt, wo man die Gesunde und ringsumher Achtunggebietende gesehen hat. Kurz vor ihrem Tode, ich war damals vierzehn Jahre alt, schrieb sie eines Mittags einen Brief: »Mein lieber Sohn!« Aber glauben Sie, sie wäre mit ihrer wunderlich-schlanken Handschrift weiter gekommen als über die Anrede hinaus? Nein, sie lächelte müde und irr, murmelte etwas und war gezwungen, die Feder wieder wegzulegen. Da saß sie, da lag der angefangene Sohnesbrief, da die Feder, die Sonne schien draußen, und ich beobachtete das alles. Eines Nachts dann klopfte Hedwig an meiner Kammertüre: ich solle aufstehen, Mutter sei gestorben! Ein dünner Lichtstrahl fiel durch die Türritze zu mir hinein, während ich zum Bett hinaussprang. Meine Mutter war als Mädchen unglücklich und schlecht bestellt gewesen. Sie kam aus dem abgelegenen Gebirge zu ihrer Schwester, meiner Tante, in die Stadt, wo sie beinahe Magdsdienste verrichten mußte. Als Kind ging sie einen weiten, tief mit Schnee bedeckten Weg in die Schule, und ihre Schulaufgaben machte sie in einer kleinen Stube, bei einem armseligen Lichtstümpfchen, daß ihr die Augen weh taten, weil sie die Buchstaben im Buch kaum lesen konnte. Ihre Eltern waren nicht gut zu ihr, so lernte sie früh die Schwermut kennen und stand, als sie Mädchen war, eines Tages an ein Brückengeländer angelehnt und dachte darüber nach, ob es nicht besser wäre, in den Fluß hinab zu springen. Man muß sie vernachlässigt, hin und her geschoben und auf diese Art mißhandelt haben. Als ich als Knabe einmal von ihrer bösen Jugend hörte, schoß mir der Zorn ins Gesicht, ich bebte vor Empörung und haßte von nun an die unbekannten Gestalten meiner Großeltern. Für uns Kinder hatte die Mutter, als sie noch gesund war, etwas beinahe Majestätisches, vor dem wir uns fürchteten und zurückscheuten; als sie krank im Geist wurde, bemitleideten wir sie. Es war ein toller Sprung, so von der ängstlichen, geheimnisvollen Ehrfurcht ins Mitleid überspringen zu müssen. Was dazwischen lag: die Zärtlichkeit und Vertraulichkeit zu ihr, war uns unbekannt geblieben. So kam es, daß unser Mitleid mit einem unsäglichen Bedauern über das Nie-Empfundene stark gemischt wurde, was uns dann eigentlich sie um so inniger bemitleiden ließ. Alle Flegeleien fielen mir wieder ein und alles unehrerbietige Betragen, und dann die Stimme der Mutter, mit der sie einen schon aus der Entfernung strafte, so daß die nachher erfolgende, handliche und wirkliche Abstrafung nur noch süßes, lächerliches Zuckerzeug dagegen war. Sie hat solch eine Stimme anzuschlagen gewußt, die einen im Nu den begangenen Fehler bereuen und einen wünschen ließ, die heftig Gekränkte so schnell wie nur möglich wieder besänftigt zu sehen. Ihre Sanftheit hatte etwas wunderbar Sanftes für uns, es war ein Geschenk; denn wir sahen es selten. Gereizt und allzu empfindlich war meine Mutter immer. Unsern Vater fürchteten wir alle lange nicht so, wie die Mutter, wir fürchteten nur immer, daß er etwas gesagt oder getan haben mochte, worüber Mutter in Zorn geraten konnte. Er war ihr gegenüber machtlos, eine Natur, die das Energische nicht so sehr liebte wie das Sich-wohl-sein-lassen. Als munterer Gesellschafter war er gerne gesehen, aber zu schweren Geschäften war er nicht der Mann. Jetzt ist er achtzig Jahre alt, und wenn er sterben wird, so stirbt ein Stück Stadtgeschichte mit ihm; die alten Leute werden ihren Kopf bedenklicher und müder schütteln, wenn sie den alten Mann nicht mehr sehen seinen Geschäften nachgehen, was er immer noch, und mit ziemlich rüstigen Beinen, tut. In seiner Jugend war er ein ziemlich wilder Geselle gewesen, den das Stadtleben allmählich abschliff, aber auch zum Wohlleben verführte. Beide Eltern, Mutter sowohl wie Vater, kamen aus rauhen, stillen Gebirgsgegenden her, in eine Stadt, die schon damals ihrer Großzügigkeit und Lebensfreude wegen im ganzen Lande einen gemischten Ruhm genoß. Die Industrie blühte damals wie eine feurige Pflanze auf und gestattete ein leichtes, gedankenloses Leben, viel Geld wurde verdient, viel ausgegeben. Wenn in der Woche fünf bis sechs Tage gearbeitet wurde, so galt das als fleißiges Wesen. Der Arbeiter lag tagelang am sonnigen Flußufer und angelte Fische, wenn er nichts Schlimmeres trieb. Sobald er Geld nötig hatte, zum Weiterleben, arbeitete er ein paar Tage und verdiente soviel, daß er wieder müßig gehen konnte. Der Handwerker verdiente vom Arbeiter, denn wenn die armen Leute Geld haben, so kann es den Wohlhabenden um so weniger fehlen. Die Stadt schien in einer Nacht zehntausend Einwohner mehr bekommen zu haben, alles strömte aus dem umliegenden Lande herbei, in die Häuser, die schon besetzt und bewohnt wurden, sobald sie nur äußerlich das fertige Aussehen hatten, mochten sie innen feucht und schmutzig sein, so viel sie wollten. Die Bauunternehmer hatten eine prachtvolle Zeit, sie brauchten nur immer bauen zu lassen, und sie taten es so liederlich, als es nur anging. Die Fabrikanten ritten zu Pferd und ihre Damen fuhren in Kaleschen, während der alte Stadtadel die Nase dazu rümpfte. An Festtagen tat sich die Stadt, wie keine andere, hervor und entfaltete bei solcher Gelegenheit alles, was ihr zu Gebote stand, um sich überall als die beste Feststadt rühmen zu lassen. Die Kaufleute konnten unter solchen Umständen nicht klagen, die Schulkinder ebensowenig, nur einige Einsichtsvolle, die nicht den Mut fanden, sich auf dem schwankenden, rosenbestreuten Boden der Lust und Oberflächlichkeit mit fortzubewegen. In solche Verhältnisse hinein kamen meine Eltern, Mutter mit ihrer empfindlichen Reizbarkeit und mit ihrem Sinn für das Einfach-Vornehme, und Vater mit seinem Anpassungstalent an alles Bestehende. Für Kinder ist eine jede Gegend lieblich und reizvoll, aber diese, die uns empfing, war ihrer Lage nach für Kinder, die gerne Schlupfwinkel, wie Felsen, Höhlen, Flüsseufer, Weiden, Niederungen, Schluchten und Waldstürze zu ihren Spielen haben, wie geschaffen. So genoß man die ganze Gegend spielend und Spiele erfindend, bis man aus der Schule kam. Ich wurde, als die Mutter starb, in eine Bank als Lehrling gegeben. Im ersten Jahr hielt ich mich vortrefflich; denn das Neue, das mir begegnete in dieser Welt, jagte mir Furcht und Scheu ein. Das zweite Jahr sah mich als Muster-Lehrling, aber im dritten Lehrjahr jagte mich der Direktor in Forma zum Teufel und behielt mich nur gnadenshalber aus Rücksicht auf meinen Vater, dem er seit vielen Jahren ein guter Bekannter war. Ich war unlustig geworden zu jeder Arbeit und frech zu den Vorgesetzten, die ich nicht für würdig befand, mir Befehle zu erteilen. Es war etwas mir jetzt Unbegreifliches in mir. Ich besinne mich, daß mir alles, jedes Möbel, jeder Gegenstand, jedes Wort weh tat. Ich war so scheu geworden, daß es Zeit war, mich fortzuschicken, und man tat es. Man suchte mir eine Stelle in einer entfernten Stadt, nur um mich loszuwerden, mit dem doch nichts anzufangen war. So kam ich fort. – Aber jetzt will ich nicht mehr an all das Frühere denken, auch nicht mehr sprechen davon. Es ist etwas Wunderbares, der frühen Jugend entronnen zu sein; denn sie ist nicht das gar nur Schöne, Liebliche und Leichte, sondern oft schwerer und gedankenvoller als manches alten Mannes Leben. Je mehr man gelebt hat, desto sanfter lebt man. Wer heftig in der Jugend gelebt hat, der mag sich später nur noch selten, am liebsten nie mehr wieder heftig gebärden. Wenn ich so denke, wie wir Kinder, immer eines dem andern nach, so durch mußten, durch den Irrtum und durch die jähe, schnelle Empfindung hindurch, und daß das alle Kinder der Erde müssen, mit so viel jugendlicher Gefahr, so möchte ich die Kindheit nicht so voreilig als etwas Süßes preisen, und doch preisen; denn sie ist doch eine kostbare Erinnerung. Wie schwer wird es oft Eltern gemacht, gute und behütende Eltern zu sein; und ein artiges, folgsames Kind zu sein, das ist für die meisten Kinder nur eine billige, oberflächliche Phrase. Sie wissen das übrigens besser; denn Sie sind eine Frau. Was mich betrifft, so bin ich bis jetzt noch der untüchtigste aller Menschen geblieben. Ich besitze nicht einmal einen Anzug am Leibe, der von mir aussagen könnte, daß ich einigermaßen mein Leben geordnet hätte. Sie erblicken nichts an mir, das auf eine bestimmte Wahl im Leben hindeutete. Ich stehe noch immer vor der Türe des Lebens, klopfe und klopfe, allerdings mit wenig Ungestüm, und horche nur gespannt, ob jemand komme, der mir den Riegel zurückschieben möchte. So ein Riegel ist etwas schwer, und es kommt nicht gern jemand, wenn er die Empfindung hat, daß es ein Bettler ist, der draußen steht und anklopft. Ich bin nichts als ein Horchender und Wartender, als solcher allerdings vollendet, denn ich habe es gelernt, zu träumen, während ich warte. Das geht Hand in Hand, und tut wohl, und man bleibt dabei anständig. Ob ich meinen Beruf etwa verfehlt habe, darnach frage ich mich nicht mehr, das fragt sich der Jüngling, aber der Mann nicht. Ich wäre mit jedem Beruf so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Was kümmert mich das! Ich bin mir meiner Tugenden und Schwächen bewußt und verhüte es, mit der Tugend sowohl, als mit der Schwäche zu prahlen. Ich biete einem jeden mein Wissen, meine Kraft, meine Gedanken, meine Leistungen und meine Liebe an, wenn er einen Gebrauch davon machen kann. Streckt er den Finger aus und winkt mir, so ist einer, der vielleicht in einem solchen Falle heranhumpeln würde, ich aber springe, sehen Sie, so wie der Wind pfeift, und überschlage und trete achtlos auf alle Erinnerungen, nur um noch ungehinderter laufen zu können. Die ganze Welt saust mit, das ganze Leben! So ist es schön. Nur so! Nichts in der Welt ist mein, aber ich sehne mich auch nach nichts mehr. Ich kenne keine Sehnsucht mehr. Als ich noch eine bestimmte Sehnsucht trug, waren mir die Menschen gleichgültig und hinderlich, und ich verabscheute sie bisweilen, jetzt liebe ich sie, weil ich sie brauche und weil ich mich zum Verbrauchen ihnen anbiete. Dazu ist man da. Es kommt einer und sagt zu mir: »Du da! Komm! Ich brauche dich. Ich kann dir Arbeit geben!« Der macht mich glücklich. Dann weiß ich, was Glück ist! Glück und Schmerz sind vollständig verändert, sie sind mir deutlicher und ersichtlicher geworden, sie erklären sich mir, sie gestatten mir, in Liebe und Weh mit ihnen zu buhlen, um sie zu werben. Wenn ich jemandem eine Dienst-Offerte einzureichen habe, so weise ich immer auf meine Brüder und deute an, daß, wenn diese sich als nützliche und schaffensfreudige Menschen erwiesen haben, ich vielleicht auch noch zu gebrauchen sei, worüber ich jedesmal lachen muß. Es ist mir keineswegs bange, daß aus mir nicht auch noch eine Form wird, aber mich endgültig formen möchte ich so spät als nur möglich. Und dann sollte das besser von selber, ohne, daß man es gerade beabsichtigte, kommen. Nun habe ich mir vorläufig ein paar grobe, breite Schuhe anmessen lassen, um fester aufzutreten und den Menschen schon mit meinen Schritten zeigen zu können, daß ich einer bin, der etwas will und wahrscheinlich auch etwas kann. Erprobt zu werden, das ist mir eine Lust! Kaum eine höhere kenne ich. Daß ich augenblicklich arm bin, was heißt das? Das will gar nichts heißen, das ist nur eine kleine Verzeichnung in der äußeren Komposition, der mit ein paar energischen Strichen abgeholfen werden kann. Es setzt höchstens einen gesunden Menschen in Verlegenheit, in einigen Kummer vielleicht, aber in keine Aufregung. Sie lachen. Nein? Sie wollen nicht gelacht haben? Dann wäre es schade; denn Ihr Lachen ist etwas Schönes. Eine Zeitlang war es immer mein Gedanke, unter die Soldaten zu gehen, aber ich traue diesem romantischen Gedanken nicht mehr recht. Warum nicht bleiben, wo man ist! Kann sich mir hier im Lande etwa keine Gelegenheit bieten, wenn ich Gelegenheit haben will, unterzugehen? Ich kann hier einen würdigeren Anlaß finden, meine Gesundheit, Kraft und Lebenslust aufs Spiel zu setzen. Zunächst bin ich meiner Gesundheit froh, der Lust, meine Beine und Arme nach Belieben zu gebrauchen, dann meines Geistes, der mir immer noch sehr munter erscheint, dann endlich des aufreizenden Bewußtseins, daß ich der Welt gegenüber als tief belasteter Schuldner dastehe, der alle Ursache hat, den Atem endlich anzuspannen, um sich in der Liebe der Welt hinaufzuarbeiten. Ich bin gern Schuldner! Wenn ich mir sagen müßte, daß mich die Menschen gekränkt hätten, das wäre trostlos für mich. Da müßte ich mich ja in Stumpfheit und Abneigung und Bitternis versteifen. Nein, die Sache steht anders, sie steht glänzend, wie sie glänzender für einen angehenden Mann nicht stehen kann: ich, ich bin es, der die Welt gekränkt hat. Sie steht mir gegenüber wie eine erzürnte, beleidigte Mutter: wundervolles Antlitz, in das ich vernarrt bin: das Antlitz der Sühne fordernden, mütterlichen Erde! Ich zahle ab, was ich vernachlässigt, verspielt, verträumt, versäumt und verbrochen habe. Ich werde die Beleidigte zufriedenstellen und meinen Geschwistern dann einmal, einer schönen, traulichen Abendstunde erzählen, wie ich es gemacht habe, daß es gekommen ist, daß ich den Kopf so hoch trage. Es kann Jahre dauern, aber eine Arbeit ist mir nur um so viel entzückender, je längere und je schwerere Anspannung der Kräfte sie fordert. Jetzt kennen Sie mich einigermaßen.«
Die Dame küßte ihn.
»Nein,« sagte sie, »Sie werden nicht untersinken. Sonst, wenn das geschähe, wäre es schade, schade für Sie. Sie dürfen niemals wieder so verbrecherisch, so sündhaft über Sie selber aburteilen. Sie achten sich zu wenig und andere zu hoch. Ich will Sie davor behüten, gegen sich selber so allzustreng vorzugehen. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Sie müssen es eine Zeitlang ein bißchen wieder gut haben. Sie müssen in ein Ohr hineinflüstern und Zärtlichkeiten erwidern lernen. Sie werden sonst zu zart. Ich will Sie lehren; das alles, was Ihnen fehlt, will ich Sie lehren. Kommen Sie. Wir gehen hinaus in die Winternacht. In den brausenden Wald. Ich muß Ihnen so viel sagen. Wissen Sie, daß ich Ihre arme, glückliche Gefangene bin? Kein Wort mehr, kein Wort mehr. Kommen Sie nur.« –
Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
Anmerkungen zur Transkription:
Im folgenden werden alle geänderten Textstellen angeführt, wobei jeweils zuerst die Stelle wie im Original, danach die geänderte Stelle steht.