
Title: Die Bibliothek meines Oheims: Eine Genfer Novelle
Author: Rodolphe Töpffer
Release date: February 4, 2015 [eBook #48158]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: German
Credits: Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned
images of public domain material from the Google Print
project.)
Eine Genfer Novelle.
Von
Rudolf Töpffer.
Vollständige Deutsche Ausgabe,
mit 137 Bildern von der Hand des Verfassers.
Leipzig:
Brockhaus & Avenarius.
1847.

| Seite | ||
| I. | Die beiden Gefangenen | 3 |
| II. | Die Bibliothek | 105 |
| III. | Henriette | 171 |

Ich habe Leute kennen gelernt, die an der Schwelle des väterlichen Kramladens groß geworden sind. Dieselben hatten sich in dieser Lebensweise eine gewisse praktische Menschenkenntniß erworben, und so eine Art spießbürgerlichen Sinn, einen Philistergeschmack, eine Gewöhnlichkeit der Ansichten bei kleinstädtischer Engherzigkeit und Vorurtheilen. Man machte sie zu Advokaten, Beamten, und jeder übertrug denn von seiner Ladenschwelle weg gute oder schlechte Eindrücke, die sich nie verwischten, in diese seine Wirkungskreise.
Andere saßen dieselbe Lebenszeit, ich will sagen etwa ums funfzehnte Jahr, in einem einsamen Kämmerlein unterm Dache, über stillem Hofe. Die wurden nachdenkliche Leute, und – wie wenig sie mit den Straßenneuigkeiten bekannt waren – ein kleiner Kreis von Nachbarn genügte ihnen, reiche Beobachtungen über diese für sich anzustellen. Sie erwarben sich eine zwar minder ausgebreitete, dafür aber desto innerlichere Menschenkenntniß. Wie manche Zeit verbrachten sie, fern von jeder Zerstreuung, mit sich selbst, während jene Ersteren auf ihrer Ladenschwelle immer von neuen Gegenständen angezogen wurden und so weder Zeit noch Lust bekamen, eine Bekanntschaft ihres eigenen Innern zu machen. Ob Advokat oder Minister, muß nicht der Mann aus dem Dachstübchen andere Weisen haben, als der von Vaters Thüre!
Oder hätte das etwa keinen Einfluß, was einem vor Augen geschieht? und die Leute, die um einen herumlaufen, und das Gerede, das man hört, und die düsteren oder aufheiternden Gegenstände, die man sieht, und die Nachbarschaft und all die tausend Zufälligkeiten? Fürwahr! es ist ein eigen Ding um die Erziehung! Indeß Ihr mit klarem Bewußtsein nach den Rathschlägen eines Freundes oder Buchs Geist und Herz Eures Kindes zu dem von Euch erwünschten Ziele zu lenken sucht, kommen Dinge, Gerede, Nachbarn, Zufälligkeiten und verschwören sich gegen Euch oder helfen auch wol nach, ohne daß ihr Einfluß zu verhindern oder nur zu entbehren wäre.
Später endlich, wenn's so über zwanzig, fünfundzwanzig Jahre kommt, thut der Einfluß der Wohnung wenig mehr. Mag dieselbe düster oder heiter, bequem oder ärmlich sein: sie gleicht einer Schule, worin der Unterricht geschlossen ist. In diesem Alter baut der Mensch seine Lebensbahn; er ist bereits vor jener, die Zukunft einschließenden Wolke angelangt, die ihm eben noch so fern erschien; seine Seele ist nicht mehr träumerisch und gelehrig; die Gegenstände spiegeln sich wol in ihr ab, lassen aber keinen Eindruck mehr zurück.

Ich nun wohnte in einem einsamen Stadttheile[1], nämlich hinter der Peterskirche in der Nähe des bischöflichen Gefangenhauses. Durch das Grün einer Akazie gewahrte ich die Fensterbogen der Kirche, den Fuß des hohen Thurms, ein schmales Fenster des Gefängnisses und in der Ferne zwischen den Dächern hin den See und seine Ufer. Wie viel vortreffliche Lehren hätte ich nicht daraus gewinnen können; wie sehr hatte mich das Schicksal vor andern Knaben meines Alters begünstigt! Mag ich sie nun auch nicht recht zu benutzen gewußt haben, so rechne ich es mir doch zum Ruhme an, aus dieser Schule hervorgegangen zu sein, die edler als eine Ladenschwelle und reicher als ein einsames Stübchen war. Sicher, hätte ich nur im mindesten Anlage besessen, wäre ich darin zum Dichter geworden.
[1]: Dieser Stadttheil grenzt an die Hauptkirche Genfs, das in Rede stehende Haus ist unter dem Namen Maison de la bourse française (französisches Stift) bekannt, weil es zur Unterstützung von genfer Protestanten französischer Abkunft bestimmt war.
Indeß bei Licht besehen, ist es so besser; denn ich bezweifle gar sehr, daß es jemals einen glücklichen Dichter gegeben hat. Oder kennt Ihr etwa einen Einzigen auch unter den Glücklichsten von ihnen, der seinen Durst nach Ruhm und Ehre stillen konnte? Kennt Ihr Einen selbst unter den Größten und gerade unter diesen, der je mit seinen Arbeiten zufrieden gewesen wäre und in ihnen die himmlischen Gebilde wieder erkannte, die sein Genius ihm vorhielt? Ein Leben voll trügerischer Hoffnungen, Enttäuschungen, Ueberdruß, das ist alles! Ja, mehr noch! dies ist nur die Oberfläche, sie muß, denke ich, noch größere Schmerzen, noch bitterern Unmuth einschließen. Diese Köpfe bauen sich ein übermenschliches Glück, welches jeden Tag zerschellt oder zusammenbricht. Sie strecken ihr Haupt hoch in die Himmel und sind an die Erde gefesselt; sie lieben Göttinnen und finden nur Sterbliche. Tasso, Petrarca und du, Racine, ihr empfindsamen, kranken Seelen, ihr nimmer ruhigen, ewig blutenden, klagereichen Herzen, sagt einmal, um welchen Preis ihr unsterblich geworden!

Das ist Ursache und Wirkung. Weil sie Dichter sind, leiden sie solche Qualen und weil sie solche Qualen leiden, sind sie Dichter. Aus dem Kampfe in ihrem Innern springt, wie ein Blitz aus der Wolke, der Strahl, welcher aus ihren Versen uns anglänzt; das Leiden enthüllt ihnen die Freude, die Freude lehrt sie das Leiden; an der Seite ihrer Enttäuschungen blühen ihre Hoffnungen. Aus diesem reichen Chaos, aus diesen fruchtbaren Schmerzen entstehen ihre erhabenen Lieder. So entlockt der Sturm der einsamen Aeolsharfe die süßesten Töne.
Ich wundere mich darum gar nicht mehr, daß ich einmal einen gescheiten Mann sagen hörte: lieber ein Winkelkrämer als weltberühmter Dichter, lieber der namenlose Giraud als Dante Alighieri.

Diese Vorstellung, die ich mir vom Dichter mache, ist ganz wahr, denn man sehe nur, wonach diejenigen ringen, welche nach diesem Berufe streben. Ist es nicht, wenn irgend möglich, nach dieser Verwirrung, diesen Schmerzen, diesem reichen Chaos? Gleich wie man die Tugend durch fromme Redensarten nachäfft, so äffen sie die Poesie durch Worte der Klage, der Angst und unaussprechlichen Schmerzes nach. Sie leiden in ihren Versen, sie seufzen in ihren Versen, sie schleppen darin mit zwanzig Jahren das ersterbende Alter eines verbitterten Lebens, sie vergehen darin! Fast Alle beginnen damit. Ach! Freundchen, es ist nicht so leicht als du denkst, traurig, unglücklich, betrübt sein; von Wünschen gefoltert, von Entzücken gegeißelt zu werden, sein Leben verbittern, sterben wie Millevoye! Darum die Maske herunter und zeige dein Antlitz heiter. Warum, du dicker Freund, o warum deiner Natur nicht folgen? Was für einen Vorzug erblickst du darin, seufzend und klagend zu erscheinen, für todt und doch nicht im Grabe vergessen zu gelten?
Wenn ich übrigens von fruchtbaren Schmerzen rede, so will ich damit keinesweges sagen, daß jeder große Dichter in seinen Versen nothwendig seufzen und weinen müsse; im Gegentheil, die reizendsten Phantasien überdecken seinen bittern Unmuth. Selbst wenn er uns in ein entzückendes Elysium zaubert oder uns die Schönheit mit den himmlischsten Farben malt, so ist es die Leere der Erde, die ihn zur Flucht in glücklichere Höhen bewog. Er malt die Gesundheit, weil er krank ist, den Sommer, weil er auf Eisfeldern irrt, frische Quellen, weil ringsum Dürre schmachtet. Der Unglückliche kostet einige Minuten lang entzückenden Rausch und läßt uns aus der Schale mittrinken; wir bekommen den Nektar, ihm bleiben die Hefen.

Aber da ertappe ich einen häßlichen Gedanken, der hinter einer Falte meines Gehirnes hervorguckt, nämlich den Gedanken, daß ich meiner Lust willen es wol zufrieden bin, daß solche duldende Seelen gelebt haben,... daß Unglückliche sich lange Jahre in Kummer hinschleppten, um einige Gedanken, einige Verse zu hinterlassen, die mich entzücken, die mich einen Augenblick erregen!... Der entsetzlichen Selbstsucht des Herzens, der grausamen Lust, die sich selbst ganz sich selber opfert! Aber dennoch... Racine, ein Dütenkrämer, Virgil, ein Ellenhändler;... Nein, ich bin noch nicht gescheit genug, über meinen grauen Schädel sind noch nicht Jahre genug gezogen. Es wird ein Tag kommen, und nur zu bald, wo ich gescheiter, wenn auch nicht minder selbstsüchtig, den jungen Leuten dies zu Gemüth führen will. Und wenn so ein alberner Gedanke, wie ich ihn da eben ertappe, in ihrem Gehirn aufsteigt, so soll er ihre Stirne umziehen und ihnen auf den Lippen sitzen bleiben.
Es gibt viele solcher schmählichen Gedanken in dem Gehirn, die sich vor Scham verbergen, die aus Furcht, verhöhnt zu werden, schweigen, und die, wenn sie zuweilen einmal aus ihrem Versteck hervorgucken, die Schamröthe bis hoch auf die Stirn treiben. Einstmals hat ein Mann eine Haussuchung in seinem eigenen Gehirn angestellt; er durchforschte alle Falten desselben, suchte zu unterst und zu oberst und ließ auch nicht das kleinste Titelchen unbeschauet. Was er so fand, daraus machte er ein Buch voll Lebensregeln, einen treuen Spiegel, in dem sich der Mensch weit häßlicher sieht als er zu sein glaubte.

Der Herzog[2], der dies that, befolgte darin die Lehre des Sokrates, welcher den Menschen ermahnt, in sein eigenes Gehirn zu schauen. Γνῶθι σεαυτόν (ist griechisch) will nichts weiter sagen. Ich wenigstens zweifle sehr, ob bei so einer beständigen Selbstbetrachtung viel zu gewinnen ist; in gar vielen Dingen ist es besser, sich nicht zu kennen. Manche werden, je besser sie sich kennen lernen, je schlechter; ein anderer, der einsieht, daß auf seinem Acker kein gutes Korn gedeihen will, faßt gar den Entschluß, mit dem Unkraut zu wuchern.
[2]: Franz, Herzog von Larochefoucauld.

Darum schaue ich nicht mehr so viel in mein Gehirn, dagegen ist es mir der angenehmste Zeitvertreib, Anderen hineinzulugen. Ich nehme die Lupe dazu, das Vergrößerungsglas, und ihr glaubt nicht, wie viel kleine, sonderbare Eigenthümlichkeiten ich entdecke, der großen, die man mit bloßen Augen sieht, und der ungeheuern, welche von weitem schon auffallen, gar nicht zu erwähnen. Gall war gewiß ein Narr, daß er den Inhalt nach der Schale, den Geschmack der Frucht nach ihrem Aussehen, den Balsam nach der Büchse beurtheilen will. Ich mache auf und koste, ich öffne den Deckel und rieche.
Denkt, alle Gehirne sind aus einerlei Stoff gemacht; ich begreife es, daß sie alle dieselbe Anzahl Zellen haben, dieselben Knötchen enthalten, gleichwie in jeder Orange dieselbe Anzahl Kerne in derselben Zahl gleicher Zellen sich befindet; allein von diesen Knötchen misrathen einige, andere gedeihen übermäßig und daraus kommen Misverhältnisse, welche jene Unterschiede in den Charakteren bilden, wodurch die Menschen einander unähnlich werden.
Sonderbar ist es, daß eines dieser Knötchen niemals misräth; daß es sich von Nichts wie von Vielem ernährt, eines der ersten seinen Wachsthum nimmt und als letztes von allen abstirbt, so daß man, wenn dies gestorben ist, sicher sein kann, daß der ganze Mensch aufgehört hat zu leben. Dies ist die Eitelkeit. Ich habe dies von einem Todtenbeschauer, der hat mir anvertraut, daß er sich lediglich an dies Zeichen hielte und es als das sicherste von allen andern ansehe; riefe man ihn zu einem Verstorbenen, so überzeuge er sich vor allen Dingen, ob derselbe nicht noch nach irgend einem Schein strebe, ob nicht irgend eine Sorgsamkeit in seiner Miene oder seiner Haltung, nicht irgend eine Besorgniß vor fremdem Blicke vorhanden sei. In diesem Falle gab er, ohne nur nach dem Puls zu fühlen, die Erlaubniß zur Bestattung, und wiewol er dieses Verfahren immer beobachtet hatte, war er doch überzeugt, noch niemals einen Lebenden unter die Erde gebracht zu haben, was, wie er sagte, seinen Amtsgenossen öfterer passire, die auf den Puls, den Athem und andere unzureichende Anzeichen etwas gäben. Er behauptete, dieser Todtenbeschauer nämlich, daß nicht so sehr Umstände, Vermögen und Beschäftigung diese Knötchen entfalten, sondern wenn irgend etwas Einfluß übe, so sei es das Alter. In der Kindheit ist es just nicht das erste, das sich zeigt, in der Jugend eben nicht das stärkste, aber von zwanzig Jahren an ist's eine gewaltige, gefräßige Knolle, welche ihre Nahrung aus Allem saugt.
Ich vergesse aber, daß ich von meiner Wohnung sprechen wollte. Ich verbrachte die heitern Tage meiner ersten Jugendzeit in tiefer Stille, lebte wenig mit meinem Lehrer zusammen, mehr mit mir selber und viel mit Eucharis, Galathea und vorzugsweise mit Estella.

Es gibt ein Alter; aber in der That nur eines und das dauert nicht lange: wo die Schäferromane Florians einen eigenthümlichen Reiz üben; in diesem Alter befand ich mich. Mir schien nichts liebenswürdiger als diese jungen Schäferinnen, nichts naiver als ihre zierlichen Redensarten und ihre Rosenwassergefühle, nichts ländlicher, bäurischer als ihre schmucken Mieder und die hübschen Hirtenstäbe mit winkenden Bändern; bei den hübschesten Mädchen der Stadt fand ich kaum halb so viel Anmuth, Schönheit, Geist und namentlich Gefühl als bei meinen lieben Schäfermädchen. Darum hatte ich ihnen mein Herz ohne Rückhalt gegeben und meine junge Phantasie gelobte, es ihnen treu zu bewahren.
Kindische Liebe, erster Glanz jenes Feuers, das später alles ergreifend und verheerend auflodert! ...... Welchen Reiz, welch' heitere reine Lust gewährt die unschuldige Vorempfindung eines Gefühls, das so reich an Stürmen ist!
Das Unglück bei meiner Leidenschaft war, daß ich mich nicht so recht sicher ihr hingeben durfte, und dies einer höchst ernsthaften Unterredung wegen, die ich ganz kürzlich mit meinem Lehrer gehabt hatte. Die Veranlassung gab Telemachs schönes Benehmen auf der Insel der Kalypso, als er in seiner Tugendhaftigkeit Eucharis verließ; wir übersetzten dies Benehmen zusammen in schlechtes Latein:
Und er stürzte Telemach in das Meer...
Et Telemachum in mare de rupe praecipitavit, hatte ich eben übersetzt, als es Herrn Ratin, so hieß mein Lehrer, einfiel, mich zu fragen, was ich von dem Benehmen Mentors hielte.
Die Frage setzte mich sehr in Verlegenheit, denn so viel wußte ich schon, daß man in Gegenwart seines Lehrers den Mentor nicht tadeln darf. Im Grunde genommen fand ich aber, daß Mentor sich bei dieser Gelegenheit etwas grob benommen habe. – Ich meine, versetzte ich, daß Telemach froh sein konnte, mit einigen Zügen Meerwasser davongekommen zu sein.

Du begreifst meine Frage nicht, versetzte Herr Ratin; Telemach war in die Nymphe Eucharis verliebt; die Liebe aber ist die unseligste, die verächtlichste, der Tugend feindlichste Leidenschaft. Wenn ein junger Mann verliebt ist, so verfällt er in Schlaffheit und Weichlichkeit, er taugt zu nichts mehr, als bei den Frauen zu schmachten, wie Herkules zu den Füßen der Omphale. Dies Benehmen des weisen Mentor, den Telemach vom Rande des Abgrundes zu retten, war daher das Bewundernswürdigste von Allem. So, setzte Herr Ratin hinzu, hättest du mir antworten sollen.
Auf diese mittelbare Weise wurde es mir klar, daß ich mich in einem schwierigen Falle befand und bereits weit von der Tugend abgewichen sei, denn die Estella liebte ich in meinen Augen offenbar eben so sehr als Telemach die Eucharis. Ich beschloß also, ein so frevelhaftes Gefühl zu bekämpfen, welches, der Bewunderung nach zu urtheilen, mit der Herr Ratin das Benehmen Mentors erhob, früher oder später zum Schlimmen führen mußte.
Herrn Ratins Worte hatten übrigens einen großen Eindruck auf mich gemacht; wol weniger weil ich sie begriff, als darum, weil sie dunkel und geheimnißvoll erschienen. Um weise zu sein und nicht in den Abgrund zu stürzen, unterdrückte ich ein unschuldiges Feuer, meine Einbildung heftete sich an die unheilkündenden Worte Ratins, um deren Sinn zu erforschen und große Offenbarungen daraus zu ziehen.
Das war meine erste Liebe; wenn sie auch, ihrer durchaus eingebildeten Natur gemäß, keine Folgen hatte, so drückte doch die Weise, wie sie durch Herrn Ratins Belehrung verscheucht wurde, jeder meiner andern Liebe einen eigenthümlichen Stempel auf, wie man aus den nachfolgenden Erzählungen sehen kann.
Das schon erwähnte Gefängniß hatte nur ein einziges Fenster nach meiner Seite her. Gefängnisse sind überhaupt nicht reich an Fenstern.
Dieses Fenster nun sitzt in einer schwarzen düstern Mauer. Eiserne Stangen wehren dem Gefangenen den Kopf herauszustecken und eine Vorkehrung draußen beraubt ihn der Aussicht auf die Straße und läßt nur wenig Himmelslicht in die Tiefe seiner Klause dringen. Ich erinnere mich, daß der Anblick dieses Mauerlochs mir damals nichts als Schrecken und Zorn einflößte. Ich bildete mir ein, daß die ganze Welt voll ehrlicher Leute sei, und darum schien es mir ruchlos, daß ein Einzelner darin sich herausnahm, Dieb oder Mörder zu sein, und die Gerechtigkeit, welche ehrliche Leute gegen dergleichen Ungeheuer beschirmte, erschien mir als eine heilige, strenge Matrone, deren Urtheile nicht zu streng sein konnten. Später änderte ich diese Ansicht: die Gerechtigkeit erschien mir nicht mehr so heilig, die ehrlichen Leute sanken in meiner Achtung und in jenen Ungeheuern fand ich allzuoft nur Opfer des Elendes, der Verführung, der Ungerechtigkeit.... Da kam das Mitleid und milderte meinen Zorn.
Der Geist eines Kindes ist entschieden, weil sein Auge beschränkt ist. Alle Fragen sind ihm einfach, weil es nur eine Seite derselben sieht, und deshalb scheint seinem minder aufgeklärten als geraden Sinne die Lösung eben so einfach als klar. Aus diesem Grunde sagen die Sanftesten unter ihnen zuweilen Hartherzigkeiten und die Aeußerungen der Zartfühlendsten sind grausam. Ohne daß ich darum gerade diesen Zartfühlendsten angehört hätte, begegnete mir dies oft. Wenn ich einen Menschen nach dem Gefängniß bringen sah, so sprach meine ganze Theilnahme für die Gendarmen, mein ganzer Abscheu gegen den Gefangenen. Dies war weder Grausamkeit, noch Gemeinheit, sondern Rechtlichkeitssinn. Bei minder kindlichem Gemüthe hätte ich die Gendarmen verabscheut und den Gefangenen beklagt.

Eines Tages sah ich einen solchen vorüberziehen, der meine ganze Entrüstung erregte. Es war ein Mitschuldiger an einem grausamen Morde; sie hatten zu zweien einen Greis getödtet, um das Geld desselben zu bekommen, und dann hatten sie sich eines unschuldigen Zeugen, eines Kindes, das bei dem Morde anwesend war, durch einen zweiten Mord entledigt. Der Genosse dieses Menschen war zum Tode, er aber durch die Geschicklichkeit seines Vertheidigers oder durch sonst mildernde Gründe blos zu lebenslänglichem Kerker verurtheilt. In dem Augenblick, wo er ins Gefängniß treten sollte, ging er unter meinem Fenster vorüber, er sah die benachbarten Häuser neugierig an, seine Augen begegneten den meinigen; er lächelte, als ob er mich kennte! Dies Lächeln machte einen tiefen, widerwärtigen Eindruck auf mich. Den ganzen Tag konnte ich es nicht mehr aus den Gedanken bringen. Ich beschloß, meinem Lehrer es mitzutheilen, und dieser ergriff die Gelegenheit, mir eindringliche Vorstellung über die viele Zeit zu machen, die ich durch das Schauen auf die Straße verlöre.
Mein Lehrer war doch, wenn ich es recht bedenke, ein drolliger Mann: brav und pedantisch, ehrbar und komisch, ernst und lächerlich, so daß er auf mich zu gleicher Zeit einen Ehrfurcht und Lachen erregenden Eindruck machte. Die Gewalt strenger Ehrbarkeit, der Einfluß strenger Grundsätze ist aber, wenn das eigene Benehmen ihnen nicht widerspricht, so groß, daß Ratin trotz des wahrhaft lächerlichen Eindruckes, den er auf mich machte, eine weit größere Gewalt über mich übte, als mancher weit geschicktere oder tüchtigere Lehrer, bei dem ich aber den geringsten Zwiespalt zwischen den Vorschriften, die er mir aufstellte, und denen, die er selbst befolgte, bemerkt hätte.
Er war ein Ausbund von Tugend. Wir überschlugen ganze Seiten im Telemach, weil sie den guten Sitten gefährlich wären, und mit der größten Sorgsamkeit suchte er mich vor jeder Neigung zu der verliebten Kalypso zu bewahren, wobei er mir bemerklich machte, daß ich in der Welt noch eine Menge gefährlicher Weiber antreffen würde, die ihr ähnlich wären.
Diese Kalypso verabscheute er, Kalypso, obwol eine Göttin, war ihm ein Gräuel. Die lateinischen Klassiker lasen wir übrigens nur nach dem gesäuberten Texte des Jesuiten Juventius und dennoch sprangen wir über eine Menge Stellen hinweg, die der strenge Jesuit für ungefährlich gehalten hatte. Hieraus war die entsetzliche Vorstellung, die ich mir von vielen Dingen machte, entsprungen, wie nicht minder die entsetzliche Furcht, dem Herrn Ratin meine unschuldigsten Gedanken merken zu lassen, wenn sie auch nur den leichtesten Anflug von Liebe hatten, oder im entferntesten mit Kalypso in Berührung standen, diesem Gespenste Ratins.
Es ließe sich Vieles hierüber sagen. Diese Methode entzündet weit mehr, als sie löscht; sie läßt nicht zum Ausbruch kommen, aber sie beugt nicht vor. Sie erzeugt viel eher Vorurtheile als Grundsätze. Ihre erste Wirkung ist namentlich, daß sie sonst unfehlbar immer die Unschuld, diese zarte Blume, die ein Lächeln beugt, die nichts wieder aufrichten kann, in Gefahr bringt.
Uebrigens war Herr Ratin ganz vollgepfropft von Latein und alten Rom, sonst aber ein guter Kerl, der nicht so streng war, als gern er Strafpredigten hielt. Beim Dintenfleck citirte er den Seneca, bei einem Schelmenstreich den Cato von Utika als Beispiel. Eines aber konnte er mir nimmer vergeben, und das war mein unsinniges Lachen. Der Mann sah in meinem albernen Gelächter die sonderbarsten Dinge: den Zeitgeist, eine frühzeitige Verderbtheit, das sichere Vorzeichen einer bejammernswerthen Zukunft. Ueber diesen Punkt redete er leidenschaftlich und ohne Aufhören. Ich schreibe dies einer Warze zu, die er auf der Nase hatte.

Diese Warze war von der Dicke einer Kichererbse und mit einer kleinen Anzahl sehr feiner und sehr hygrometrischer Haare besetzt; denn ich hatte bemerkt, daß sie mit der Veränderung der Witterung bald steifer, bald schlaffer dastanden. Nun kam es zuweilen, daß ich während meiner Stunden auf die unschuldigste Weise von der Welt, aus bloßer Neugierde und ohne einen Gedanken an Spott die Warze betrachtete. Dann fuhr er mich heftig an und kanzelte mich über meine Zerstreuung tüchtig ab. Ein anderes Mal, freilich seltener, wollte eine Fliege sich durchaus, trotz des ungeduldigen Zorns meines Lehrers, darauf setzen. Er beschleunigte alsdann die Erklärung unsers Autors, damit ich über der Arbeit diesen sonderbaren Kampf nicht bemerken sollte. Allein das war für mich eben ein Zeichen, daß etwas vorgehe, und eine unwiderstehliche Neugierde trieb mich an, meinen Blick verstohlen auf sein Gesicht zu werfen. Je nachdem, was es nun eben gab, faßte mich meine närrische Lachlust, und je eigensinniger die Fliege war, desto unwiderstehlicher wurde es bei mir und ich platzte heraus. Herr Ratin schien dann durchaus in der Welt nicht die Ursachen eines solchen Scandals zu begreifen; er donnerte gegen das unsinnige Lachen im allgemeinen und führte mir die schrecklichen Folgen desselben zu Herzen.
Nichts desto weniger ist das tolle Lachen eins der herrlichsten Dinge, die ich kenne. Es ist eine verbotene Frucht und darum vortrefflich. Mich haben nicht so sehr die Strafpredigten meines Lehrers davon geheilt, als das Alter. Um so recht mit Herzenslust unsinnig zu lachen, muß man Schüler sein und wo möglich einen Lehrer haben, der auf der Nase eine Warze mit drei spaßhaften Härchen besitzt.

Beim Nachdenken über diese Warze ist mir die Ansicht gekommen, daß alle reizbaren Leute irgend eine physische oder moralische Schwäche haben, eine sichtbare oder unsichtbare Warze, welche sie auf die Meinung bringt, daß man über sie spotte. Vor solchen Leuten lache man nicht: das hieße über sie lachen; man rede niemals von Lupe und Warze: das sind Anspielungen; nimmer von Cicero und Scipio Nasica, sonst hat man es mit ihnen zu thun.
Es war die Zeit der Maikäfer; sie hatten mir bis dahin ungemein viel Vergnügen gemacht, aber ich verlor den Spaß daran. Wie man doch altert!
Indeß, wenn ich allein in meiner Kammer saß und unter tödtlich langer Weile meine Aufgaben arbeitete, so verschmähte ich die Gesellschaft von einem oder einem Paar solcher Thiere nicht. Ich muß übrigens bemerken, daß sie nicht mehr an einen Faden gebunden, um sie fliegen zu lassen, oder an einen kleinen Wagen gespannt wurden, zu dergleichen kindischen Spielereien war ich schon zu alt geworden. Wenn man aber meint, daß sich weiter nichts mit einem Maikäfer anfangen ließe, so irrt man gewaltig. Zwischen den Kinderspielen und den ernsten Studien des Naturforschers liegen noch viele Stufen.
Ich hatte einen unter einem umgekehrten Glase sitzen; das Thier quälte sich ab, die Wände desselben hinanzuklettern, um im Augenblick wieder herunterzufallen, und das ging endlos so weiter; zuweilen fiel es auf den Rücken, das ist bekanntlich für einen Maikäfer ein großes Unglück; ehe ich ihm zu Hilfe kam, bewunderte ich seine Langmüthigkeit, mit der er seine sechs Arme in der leeren Luft herumstreckte, in der immer fehlschlagenden Hoffnung, an irgend einen Körper anzuhaken, obgleich keiner da war. – Die Maikäfer sind doch dumme Thiere, sprach ich bei mir.
In der Regel half ich ihm dadurch aus der Noth, daß ich ihm die Spitze meiner Feder hinhielt; dies führte mich zu der größten, glücklichsten Entdeckung. Ich kann in diesem Betracht mit Berquin sagen, daß eine gute Handlung niemals unbelohnt bleibt. Mein Maikäfer hatte sich an den Bart der Feder angeklammert, und während er sich erholte, schrieb ich eine Zeile, wobei ich mehr auf ihn und seine Thaten achtete, als auf die des Julius Cäsar, den ich eben übersetzte. Wird er davonfliegen oder die Feder herunterklettern? Von welchen Zufällen hängen doch alle Dinge ab! Hätte er sich zu dem ersten entschlossen, so wäre es um meine Entdeckung geschehen gewesen, ich hätte sie nicht einmal geahnt; glücklicherweise kletterte er bergab. Als er sich der Dinte näherte, empfand ich eine Vorahnung; ich fühlte, daß große Dinge geschehen würden. So ahnte Columbus, ohne die Küste zu sehen, sein Amerika. Wirklich netzt mein Maikäfer, als er an dem Ende des Schnabels angekommen ist, seine Schwanzspitze mit Dinte. Schnell ein weißes Blatt...... ein Augenblick der höchsten Spannung.
Die Schwanzspitze kommt auf's Papier, die Dinte hinterläßt Spuren und wunderbare Zeichnungen entstehen. Zuweilen hob der Maikäfer, ob aus Verstand oder weil der Vitriol seine Nerven angriff, im vollen Gange den Schwanz in die Höhe und ließ ihn erst später wieder nieder. Daraus entsteht eine Reihe von Punkten, eine Arbeit von wunderbarer Zartheit. Dann wieder änderte er seine Richtung und bog ab; jetzt ändert er den Plan noch einmal und kommt wieder zurück: es ist ein S!... Bei dieser Entdeckung durchzuckte mich ein Lichtstrahl.

Ich versehe dem staunenden Thiere die Schwanzspitze wohl mit Dinte und setze es auf die erste Seite meines Heftes. Dann nehme ich einen Strohhalm, um seine Arbeit zu leiten, um seine Pfade zu lenken, und zwinge den Maikäfer sich so zu bewegen, daß er meinen Namen schreibt. Es bedurfte zweier Stunden; aber welch' Meisterwerk!
»Die edelste Eroberung, welche der Mensch je gemacht hat, sagt Buffon, ist.... sicherlich der Maikäfer!«

Um die Arbeit zu leiten, hatte ich mich dem Fenster genähert, eben wurde der letzte Buchstabe fertig, da rief eine Stimme leise: Freundchen! Ich sah schnell auf die Straße. Da war niemand. – Hier! rief dieselbe Stimme. – Wo? fragte ich. – Im Gefängnisse.
Jetzt merkte ich, daß die Worte aus dem Kerkerfenster gekommen und von dem Verbrecher, dessen abscheuliches Lächeln mich so heftig erschreckt hatte, an mich gerichtet waren. Ich fuhr bis an die andere Wand meines Zimmers zurück.
– Fürchten Sie nichts, fuhr die Stimme fort; ein braver Mensch spricht mit Ihnen... – Schurke! rief ich, wenn Sie mich noch länger anreden, so rufe ich die Wache!
Er schwieg einen Augenblick. – Als man mich neulich durch die Straße brachte, hub er darauf wieder an, sah ich Ihr Gesicht und schloß daraus, daß Sie ein mitleidiges Herz hätten und ein unglückliches Opfer der Ungerechtigkeit beklagen könnten.... – Schweigt! rief ich aufs Neue, Bösewicht! Ihr habt einen Greis und ein Kind ermordet!....
– Ach! ich sehe wol, Sie sind verblendet wie Alle. Noch so jung und doch schon das Schlimmste glauben! Er schwieg, denn er hörte jemand die Straße kommen. Es war ein schwarzgekleideter Mann, ein Leichenträger, wie ich nachher erfuhr.
Als der Mann vorüber war, fuhr er fort: – Ach! der ehrwürdige Gefängnißprediger ist ganz anders. Der weiß, Gottlob! daß mein Herz rein und meine Seele ohne Flecken ist! Er schwieg wiederum. Diesmal ging ein Gendarm vorüber. Ich trug Bedenken, ihn anzurufen und ihm die Reden des Gefangenen mitzutheilen; allein diese Worte selbst hatten schon zu sehr auf meine Leichtgläubigkeit eingewirkt, als daß ich diese Regung wieder unterdrücken konnte. Außerdem schien es mir ein Verrath zu sein, da doch der Gefangene der Ehrlichkeit meines Gesichts vertraut hatte. Meine Eigenliebe fühlte sich zu sehr geschmeichelt, als daß ich ein solches Lob Lügen strafen konnte. Ich habe ja eben gesagt, daß diese Leidenschaft sich von Allem nährt, es ist keine Hand so schmutzig, daß sie sich nicht gern davon streichen ließe.
Nach der Unterhaltung, die mich zum Fenster gelockt hatte, blieb der Gefangene ruhig und ich kehrte zu meinem Maikäfer zurück.
Welches Entsetzen! das Unheil war groß, unverbesserlich! schnell ergriff ich den Urheber und warf ihn zum Fenster hinaus, dann betrachtete ich mit Schrecken die verzweifelte Geschichte.

Ein langer schwarzer Streifen lief vom vierten Kapitel de bello gallico gerade durch zum linken Rande; da war dem Thiere der Schnitt zu steil gewesen, um hinabzuklettern, und es hatte sich wiederum nach dem rechten Rande umgedreht. Jetzt war es nördlich gewandelt und hatte beschlossen, mittelst des Dintenfasses das Buch zu verlassen, war aber dabei den sanften, glatten Abhang hinuntergeglitten in den Abgrund, in die Gehenna, in die Dinte, zu seinem Verderben und meinem.
Jetzt hatte der Maikäfer leider zu spät bemerkt, daß er nicht auf der rechten Straße sei, und den Weg zurückzugewinnen versucht: von Kopf bis zu den Füßen in Schwarz gehüllt, war er wieder aus der Dinte gekrochen und zum vierten Kapitel de bello gallico zurückgekehrt, wo ich ihn, der keinen Begriff davon hatte, fand.
Das waren entsetzliche Flecken; Seen, Flüsse, eine ganze Kette von Kreuz- und Querstrichen, ohne Geschmack, ohne Genie.... ein schwarzes, abscheuliches Bild!!
Ach! das Buch, das Buch war eine Elzevir-Ausgabe meines Lehrers, ein Elzevir in Quarto, ein seltener, kostbarer, unersetzlicher Elzevir, der mir aufs eindringlichste auf die Seele gebunden war. Ich war unrettbar verloren.
Ich fing die Dinte mit Löschpapier auf, ich trocknete das Blatt und dann begann ich meine Lage zu überdenken.
Ich empfand mehr Angst als Gewissensbisse; am meisten fürchtete ich mich, daß ich den Maikäfer bekennen mußte. Wie schlimm mußte nicht mein Lehrer diesen schändlichen Zeitvertreib ansehen, für einen Knaben von meinen Jahren, wie er zu sagen pflegte, diesen so kindischen und wahrscheinlich höchst unmoralischen Zeitvertreib. Das machte mich zittern.
Satan, dessen ich mich in dem Augenblicke nicht versah, trat heran und bot mir Auswege dar. Satan fehlt niemals zur Stunde der Versuchung; er gab mir eine ganz kleine Lüge an die Hand. Während meiner Abwesenheit wäre die verwünschte Katze des Nachbars ins Zimmer gekommen und hätte das Dintenfaß auf das vierte Kapitel de bello gallico geworfen. Da ich nun aber während der Arbeitsstunden nicht ausgehen durfte, so wollte ich meine Abwesenheit dadurch rechtfertigen, daß ich eine Feder hatte kaufen müssen. Da aber in einem Schranke noch genug Federn zu meiner Verfügung lagen, so hatte ich gestern beim Baden den Schlüssel verloren. Und da ich nun gestern keine Erlaubniß gehabt hatte, baden zu gehen und wirklich auch nicht dort gewesen war, so setzte ich voraus, daß ich ohne Erlaubniß dort gewesen und durch das Geständniß dieses Fehlers meiner kunstreichen Erfindung ungemein viel Wahrscheinlichkeit verlieh, wie sich auch zu gleicher Zeit meine Gewissensangst verminderte, da ich mich ja offenherzig eines Fehlers anklagte, was mich in meinen Augen fast....

Schon war der sinnreiche Plan ganz fertig, als ich Herrn Ratins Schritte auf der Treppe vernahm.
In meiner Verwirrung schlug ich das Buch zu, öffnete es wieder, schlug es nochmals zu und öffnete es rasch aufs neue, damit der Flecken selber spräche, und mir wenigstens die Unannehmlichkeit des ersten Geständnisses ersparte....
Herr Ratin kam, um mir Stunde zu geben; er legte den Hut ab, rückte den Stuhl an, setzte sich und schnaubte sich, ohne das Buch zu sehen. Um Fassung zu bekommen, schnaubte ich mich ebenfalls. Auf diese Bewegung hin sah Herr Ratin mich groß an; es war ja die Nase dabei im Spiel.
Anfangs merkte ich nicht, daß Herr Ratin eine Absicht darin vermuthete, daß ich zu gleicher Zeit mit ihm das Schnupftuch zog. Ich bildete mir also ein, er habe den Flecken gesehen und schlug die Augen nieder. Sein forschendes Schweigen brachte mich weit mehr außer Fassung, als seine Fragen, auf welche ich Antworten bereit hatte, vermocht hätten. Endlich sprach er mit feierlichem Tone: Julius! ich lese auf Deinem Gesichte... – Nein, Herr... – Ich lese, sage ich Dir... – Nein, Herr, es ist die Katze... unterbrach ich ihn.
Hier wechselte Herr Ratin die Farbe. Meine Antwort schien ihm im höchsten Grade alle denkbaren Grenzen der Ehrerbietigkeit zu übersteigen, und er begann bereits sich zu ereifern: da fielen seine Blicke auf den entsetzlichen Flecken. Dieser Anblick übte einen gewaltigen Schlag auf ihn, der in Wechselwirkung auf mich überging.

Jetzt war es Zeit, den Sturm zu beschwören. – Herr, als ich ausgegangen war... die Katze... um eine Feder zu kaufen... die Katze... weil ich den Schlüssel verloren... gestern beim Baden... die Katze... Je weiter ich sprach, desto heftiger wurde Herrn Ratins Blick, so daß ich ihn zuletzt nicht mehr ertragen konnte, ich wurde verwirrt und bekannte gleich von vornherein mein Vergehen. – Ich lüge... Herr Ratin... ich selbst habe das Unheil angerichtet!
Und nun entstand eine große Stille.
Wundere Dich nicht, sagte Herr Ratin endlich mit feierlicher Stimme, wenn das Uebermaß meines Unwillens die Gewalt desselben zusammenpreßt und seinen Ausbruch verzögert. Ja, es fehlen mir sogar die Worte, um auszusprechen... hier kam eine Fliege... ein Kitzel von Lachen durchzuckte mein Gesicht.
Es entstand aufs Neue ein tiefes Schweigen.

Endlich stand Herr Ratin auf. – Du wirst zwei Tage das Zimmer hüten, um über Deine Aufführung nachzudenken, unterdeß werde ich überlegen, welche Maßregeln ich in einem so ungewöhnlichen Falle zu treffen habe...
Damit ging Herr Ratin, schloß das Zimmer zu und nahm den Schlüssel mit.
Das offene Bekenntniß meiner Schuld hatte mich erleichtert, die Entfernung des Herrn Ratin ersparte mir die Scham; so schienen mir die ersten Augenblicke meiner Gefangenschaft eine wonnige Freiheit zu sein; ohne die Verbindlichkeit, zwei Tage lang an meinen Fehltritt zu denken, würde ich mich sehr gefreut haben, wie man es nach einem entscheidenden Augenblicke zu thun pflegt.

Ich ging also ans Bedenken, aber die Gedanken wollten mir nicht recht kommen. Als ich meinen Fehler so recht gründlich erkennen wollte, fand ich daran nichts übles als die Lüge, und die hatte ich ja augenblicklich durch mein Geständniß wieder gut gemacht; noch obendrein hatte ich dies aus freien Stücken gethan. Indessen der guten Ordnung willen bestrebte ich mich Reue zu empfinden, und als ich merkte, wie viel Mühe es mir machte wirklich dazu zu gelangen, begann ich zu fürchten, daß mein Herz wirklich schon sehr schlecht und verdorben sei, wie Herr Ratin behauptete, und ich faßte ganz zerknirscht den Entschluß, in Zukunft nicht mehr zu lachen.

Wie ich eben im besten Zuge war, kommt just der Pastetenmann über die Straße; es war dies seine Stunde. Natürlicherweise trat der Gedanke, Pasteten zu essen, sogleich vor meine Seele; ich machte mir jedoch ein Gewissen daraus, in einem Augenblicke, wo ich mich mit meiner Seele beschäftigen sollte, einem fleischlichen Gelüste nachzugeben. Also ließ ich den Burschen harren und schreien und blieb ruhig in meinem Stübchen sitzen.
Man muß aber so einen Pastetenmann kennen, um zu wissen, wie hartnäckig er seine Kunden verfolgt. Der meinige sah mich durchaus nicht, ließ sich aber dadurch nicht irre machen, sondern fuhr mit unverwüstlichem Vertrauen auf meine Leckerei fort zu rufen. Blos ein einziges Wörtchen setzte er seinen Pasteten noch hinzu, die dringende Mahnung: ganz frisch; aber dieser Zusatz brachte eine gewaltige Verwirrung in meine Moralität. Glücklicherweise ertappte ich mich noch und brachte alles wieder in Ordnung.
Um indeß den ehrenwerthen Handelsmann draußen nicht länger im Irrthum zu lassen und um seine kostbare Zeit zu bringen, trat ich an's Fenster, um ihm zu sagen, daß ich heute keinen Kuchen nehmen würde.

– Geschwind! rief er, ich hab's eilig... Ich hab' ja schon gesagt, daß er mehr Glauben an mich hatte als ich selber.
Nein, versetzte ich, ich habe kein Geld.
's thut nichts.
Und dann habe ich auch keinen Hunger!
Nicht wahr!
Und bin auch sehr beschäftigt.
D'rum schnell!
Ja, ich bin auch eingeschlossen.
Ach, Sie haben mich zum Besten, sprach er und nahm den Korb, als wolle er gehen.
Diese Bewegung übte einen wunderbaren Eindruck auf mich. – Halt, rief ich ihm zu.
Einige Augenblicke darauf wandelten zwei Pasteten.... ganz frische!... in einer Mütze, die kunstreich an einem Bindfaden befestigt war, in die Höhe.
Dummes Thier von Maikäfer, dachte ich und verzehrte meinen Kuchen, – hat vier Flügel zum Fliegen und fällt in ein Dintenfaß! Ohne diese unbegreifliche Dummheit hätte ich meine Aufgaben ruhig gemacht, wäre artig gewesen, Herr Ratin zufrieden und ich auch; keine Lüge, keine Einsperrung... Dummkopf von Maikäfer.

Ha! kein übler Gedanke das! Ich hatte den Sündenbock gefunden, dem ich einen nach dem andern alle meine Fehltritte auflud, und mein Gewissen nahm wieder eine glückliche Ruhe an. Nicht wenig, bilde ich mir ein, trug dazu bei, daß die Entrüstung des Herrn Ratin so stark gewesen war, um ganz und gar zu vergessen, mir Arbeiten aufzugeben. Ach! zwei Tage und keine Arbeiten!... Das war vielleicht unter allen Strafen mir die willkommenste!

Einmal mit meinem Gewissen abgefunden und zwei Festtage vor mir, wollte ich einige Veränderungen vornehmen, die mir zur Verschönerung meines Zimmers vorzüglich schienen. Die erste war, daß ich den Elzevir, das Wörterbuch und alle Bücher und Arbeitshefte aus dem Gesichte räumte. Als dies geschehen, empfand ich ein so herrliches als neues Gefühl, und es war, als hätte man mich von Banden befreit. In meiner Gefangenschaft also sollte ich zum ersten Male den ganzen Reiz der Freiheit kennen lernen.
Welch' herrliches Gefühl! Mit vollem Rechte schlafen, nichtsthun, träumen zu können... und dies in einem Alter, wo uns unsere eigene Gesellschaft so süß, unser Herz so reich an entzückenden Unterhaltungen, unser Geist in seinen Genüssen so leicht befriedigt ist; wo Luft, Himmel, Land, Mauern, Alles etwas hat, das zu uns spricht, uns bewegt; wo eine Akazie eine Welt, ein Maikäfer ein Kleinod ist! Ach! daß ich diese glücklichen Stunden nicht wieder zurückrufen, diese bezaubernde Lust nicht wiederfinden kann! Wie bleich ist heut' zu Tage die Sonne! Wie langweilig sind die Stunden, wie undankbar die Mußezeit!
Ich begegne meiner Feder alle Augenblicke über diesen Gedanken. Jedes Mal, wenn ich schreibe, drängt es mich, denselben auszusprechen; ich hab' es tausendmal gethan und werde es ferner thun. Umsonst hat das Glück mich geleitet, umsonst haben die Jahre mir jegliches seinen Zoll an Gütern gebracht, umsonst gehen die Tage rein und klar auf: diese Erinnerungen von einst verwischt nichts aus meinem Herzen. Je älter ich werde, desto jugendfrischer erscheinen sie mir und desto mehr find' ich eine Ursache schwermüthiger Betrübniß darin. Ich besitze mehr, als ich je begehrte, allein das Alter, wo man begehrt, sehne ich zurück: die wirklichen Güter erscheinen mir bei weitem nicht so genußreich, als die leere aber funkelnde Wolke, welche mich damals umhüllte und mich in stetem Freudenrausche erhielt.
Frische Maimorgen, blauer Himmel, lieblicher See, ich sehe euch noch, aber.... wo ist euer Glanz geblieben, was ist aus eurer Klarheit geworden, wo ist jener unbeschreibliche Zauber von Freude, Geheimniß, Hoffnung geblieben! Ihr gefallt meinen Augen, aber ihr füllet meine Seele nicht mehr; ich bleibe kalt bei eurem lachenden Entgegenkommen; um euch noch ferner zu lieben, bedarf's, daß ich in die Jahre zurücksteige, daß ich in eine Vergangenheit zurückfliehe, die nimmer wiederkehren wird! O Traurigkeit, o bitteres Gefühl!
Dies Gefühl findet man im Grunde aller Poesie, wenn es nicht die Hauptquelle derselben ist. Kein Poet lebt von der Gegenwart, alle sehnen sich zurück: ja mehr noch: durch die Täuschungen des Lebens zu jenen Erinnerungen hingezogen, werden sie darin verliebt; sie umkleiden dieselben mit einem Reize, den die Wirklichkeit nicht hatte, sie verwandeln ihr Sehnen in Schönheit, womit sie dieselben schmücken, und indem sie sich nach Herzensgelüst ein herrliches Traumbild schaffen, weinen sie, daß sie verloren, was sie nimmer besaßen.
In diesem Sinne ist die Jugend das Alter der Poesie, die Zeit, wo dieselbe ihre Schätze sammelt, nicht aber, wie Einige glauben, die, wo sie davon Gebrauch machen kann. Sie weiß nichts mit dem lautern Golde anzufangen, welches um sie herum gehäuft ist. Aber laßt die Zeit kommen und ihr Stück um Stück entreißen, dann fängt sie eben, indem sie derselben die Beute streitig macht, an zu begreifen, was sie besaß; aus dem Verluste erkennt sie ihren Reichthum, aus dem Schmerze die entschwundenen Freuden. Dann schwillt das Herz, die Einbildungskraft entflammt sich, der Gedanke reißt sich los und schwingt sich zu den Wolken... dann singt Virgil!
Doch was soll man zu jenen unbärtigen Poeten sagen, die in jenem Alter singen, wo, wenn sie wahrhaft Poeten waren, ihr ganzes Sein nicht zureichte, um zu empfinden, sich in der Stille an jenen Düften zu berauschen, die sie einzig und allein später in ihre Verse ausströmen können.
Es gibt frühreife Mathematiker, wie Pascal beweist; aber Poeten, nein. Ein sechzigjähriger Homer ist weit denkbarer als ein Lafontaine als Kind. Vor zwanzig Jahren können wol einzelne Schimmer durchbrechen, allein vor diesem Alter und noch drüber hinaus hat kein poetischer Genius seine Reife erreicht. Viele freilich strecken ihre Flügel weit eher aus: schwacher Aufflug, rascher Fall; dafür, daß sie zu zeitig den Flug unternahmen, liegen sie bald auf dem Boden. Zeitungen, Coterien, das ist euer Werk, hebt sie nun auch wieder auf!
Lafontaine verkannte sich sehr spät noch, vielleicht gar sein ganzes Leben; doch ist das nicht eben sein Geheimniß? Leset, ich bitte euch, seine Vorreden. Kann er's glauben, daß er ein besserer ist, als alle Welt? Und das ist keine Bescheidenheit; er hatte einzig und allein nicht Eitelkeit genug, um bescheiden zu sein; es ist einfache, ungekünstelte Natur, reine Gutmüthigkeit. Er singt, weil's ihm Vergnügen macht, nicht weil er sich den Beruf beilegt, nicht weil er's sich zur Aufgabe gemacht hat; er singt und von seinen Lippen fließt der Strom der Poesie.
Er war dumm, wie man weiß. Er überredete sich, daß Phädrus sein Meister wäre; er vergaß Ludwig den Großen zu loben; ohne daran zu denken, beleidigte er die Marquis und blieb deshalb ohne Unterstützungen. In der That, ein großer Tropf im Vergleich mit so vielen geistreichen Poeten!
Als ich Bücher und Hefte hatte verschwinden lassen, kam ich doch ein wenig in Verlegenheit, was denn nun beginnen? Indem ich darüber nachsann, ließ sich seitwärts im Zimmer ein Geräusch vernehmen. Ich sah durch's Schlüsselloch: es war die Katze aus der Nachbarschaft, welche mit einer ungeheuern Ratte Krieg führte.
Anfangs nahm ich Partei für die Katze, die zu meiner Freundschaft gehörte, und ich erkannte, daß der Beistand meiner Wünsche ihr nicht unnütz sein dürfe, denn schon war sie an der Schnauze verwundet und griff ihren beherzten Gegner nur noch zaghaft an. Als ich indeß einige Minuten lang dem Kampfe zugeschauet hatte, begann der Muth und die Gewandtheit der Schwächern angesichts eines so schrecklichen Feindes meine Theilnahme zu erregen, so daß ich beschloß, durchaus parteilos zu verharren.
Allein bald erfuhr ich, daß es gar schwer ist, parteilos zu bleiben, das heißt, gleichgiltig zwischen Katze und Ratte; zumal als ich bemerkte, daß Ratte und ich in Betreff der Elzevirs eines Sinnes waren. Traun! das Thier hatte sich in dasselbe Loch verschanzt, welches seine Zähne im Schooße eines dicken auf der Erde liegenden Folianten gegraben hatten. Ich beschloß die Ratte zu retten und that einen gewaltigen Fußtritt gegen die Thüre, um den Kater zu erschrecken; dies gelang mir so vortrefflich, daß das Schloß aufsprang und die Thür sich öffnete.

Es gab nichts mehr drinnen als den Folianten: der Feind verschwunden, von meinem Schützling keine Spur. Ich aber befand mich nichts desto weniger in bedenklicher Lage.
Dies Zimmer enthielt einen Theil der Bibliothek meines zur Zeit abwesenden Oheims; eine stäubige Rumpelkammer, ringsum mit alten Scharteken angefüllt. In der Mitte eine zerfallene Elektrisirmaschine und einige Kasten voll Mineralien, gegen das Fenster zu ein alterthümlicher Lehnstuhl. Der Bücher wegen hielt man dies Zimmer stets verschlossen, nämlich damit ich nicht hineingeriethe. Mußte Herr Ratin davon reden, so geschah's geheimnißvoll und wie von einem verrufenen Orte. Unter solchen Umständen kam der Zufall meiner Neugierde ausgezeichnet zu Hilfe.
Ich wollte Physik treiben, aber die Maschine ging nicht und ich machte mich über die Mineralogie; von hier aus gerieth ich auf den Folianten. Die Ratte hatte großartig darin gearbeitet; vom Titel las man nichts mehr als Dictio... Ein Dictionnaire! dachte ich, nun das Buch ist doch eben nicht gefährlich. Was für ein Wörterbuch?... Ich öffnete den Band. Oben auf der Seite stand der Name eines Frauenzimmers; darunter krauses Zeug mit Latein dazwischen; unten Anmerkungen. D'rin war von Liebe die Rede.
Auf den ersten Blick war ich sehr überrascht. In einem Wörterbuch! wer hätte das gedacht! Von Liebe in einem Wörterbuch! Ich konnte gar nicht davon abkommen. Die Folianten haben aber ihr Gewicht, ich ging also und setzte mich in den Lehnsessel neben das Fenster und kümmerte mich für den Augenblick nicht im mindesten um die prächtige Landschaft, welche der Fensterrahmen einschloß.
Der besagte Name war Heloise. Sie war eine Frau und schrieb Latein, sie war eine Aebtissin und hatte einen Liebhaber! Meine Gedanken verwirrten sich bei diesen sonderbaren Widersprüchen. Eine Frau und auf lateinisch lieben! Eine Aebtissin und einen Geliebten haben! Ich sah es ein, daß ich's mit einem abscheulich schlechten Buche zu thun hatte, und der Gedanke, daß ein Lexicon sich mit dergleichen Geschichten befassen könne, verringerte meine bisherige Achtung für diese Gattung gemeinlich so ehrsamer Bücher. Es war etwa, als wenn Herr Ratin, mein Lehrer, als wenn Mentor auf einmal anhübe den Wein und die Liebe, die Liebe und den Wein zu singen.
Indeß legte ich keineswegs das Buch bei Seite, wie ich hätte thun sollen, sondern im Gegentheil, von diesen ersten Angaben angezogen, las ich den Artikel, und immer mehr angezogen, las ich die Noten, las ich das Latein. Es gab wunderliche Dinge darin und mancherlei Rührendes, mancherlei Geheimnißvolles; aber ein Theil der Geschichte fehlte. Jetzt war ich nicht mehr für die Ratte, und es schien mir, daß die Sache der Katze in mancherlei Hinsicht weit eher Beistand verdiente.
In so verstümmelten Bänden ist just immer das Fehlende, was einem am wissenswürdigsten scheint. Die Lücken reizen die Neugierde weit mehr, als ganze Seiten sie zu stillen vermögen. Ich komme selten in die Versuchung einen Band zu lesen, aber ich mache die Düten immer auseinander, um sie zu lesen, und finde so, daß es weit weniger jammervoll für ein Buch ist, beim Krämer zu enden, als bei dem Buchhändler zu verkommen.
Heloise lebte im Mittelalter. Das ist eine Zeit, die ich mir voll Klöster, Zellen und Glocken denke, mit hübschen Nonnen und bärtigen Mönchen, waldigen Gegenden mit der Aussicht über Seen und Thäler, ein Bild, etwa wie von Pommiers und seiner Abtei am Fuße des Berges Salève. Ich kann mir einmal das Mittelalter nicht anders vorstellen.
Jenes Mädchen war die Nichte eines Canonicus, ein hübsches frommes Kind, in meinen Augen nicht minder reizend durch ihre angeborene Anmuth als durch das geistliche Gewand, in dem ich sie mir vorstellte. Ich hatte zu Chambéry die Schwestern vom Herzen Jesu gesehen und malte mir nach diesem Muster alle Nonnen, alle frommen Schwestern und wenn es Noth that, auch die Päpstin Johanna.
Zur Zeit da Heloise in der Stille tiefer Einsamkeit mit der züchtigen Anmuth, mit unbewußten Reizen aufblühete, sprach man allenthalben von nichts als von einem berühmten Gelehrten, Namens Abälard. Er war jung und weise, von unermeßlichem Wissen und durchdringendem Verstande. Sein Antlitz gewann eben so sehr als seine Worte, seine Schönheit kam seinem Ruhme gleich und vor seinem Namen erbleichten alle anderen. Abälard hielt in der Schule Streitreden über Fragen, die damals im Schwunge waren, und in diesen Wettkämpfen hatte er alle seine Gegner niedergeschmettert, vor den Augen der Menge, vor den Augen der Frauen, die sich auf die Bühne drängten, um die Reize des schönen Kämpfers zu schauen.
Unter dieser Menge befand sich die Nichte des Canonicus. Das Mädchen mit dem ausgezeichneten Geiste, mit dem glühenden Herzen horchte voll lebhafter Bewegung. Die Augen auf den Jüngling geheftet, verschlang sie seine Worte, begleitete sie seine Geberden, stritt sie mit ihm, siegte sie mit ihm und berauschte sich in seinen Triumphen, und ohne es zu wissen, sog sie in langen Zügen eine glühende, unverlöschbare Liebe ein. Sie glaubte, die Wissenschaft sei es, was sie liebe, und ihr Oheim, der nicht minder brannte ihre glücklichen Anlagen auszubilden, rief Abälard an ihre Seite, um sie zu leiten und zu unterweisen.... Glückliche Liebende! thörichter Canonicus!....
Hier begann die Arbeit der Ratte.

Ich schlug das Blatt um, ach, wie war alles so verändert!

Heloise hatte den Schleier genommen... Es ergriff mich tief, denn ich liebte sie, ich theilte ihren glücklichen Wahn, und schön, wie ich sie mir bereits gemalt, erschien sie mir jetzt in der Traurigkeit noch weit schöner, unter den alten Gewölben des Klosters Argenteuil weit jünger, in dem Schmerze, dem sie selbst am Fuße des Altars unterlag, weit rührender.... Das Buch erzählte das Alles in gothischem Style; von den alten Seiten wehete ein lebendiger Odem der entschwundenen Zeit und zu dem Reize lebhafter Eindrücke der Vergangenheit gesellte sich die jugendliche Frische meiner Empfindung.
Dort ins Kloster versteckt, strebte Heloise in Strömen frommer Zähren die noch helllodernde Flamme zu löschen: allein die Religion vermochte nicht dieses kranke Herz zu heilen, sie vermehrte nur die Qualen noch. Traurigkeit, bittre Reue, Gewissensbisse, eine unüberwindliche Liebe marterten die Tage der bleichen Klausnerin; die Augen netzten sich mit Thränen, sie beweinte den fernen Abälard, die Tage seines Ruhmes und ihres Glücks. Ein schuldiges, aber immer noch rührendes Weib! Eine schöne, liebevolle Sünderin, deren Leid diese ganze ferne Zeit mit poetischem Schimmer umstrahlt!....
»Abälard, übersetzte ich gerührt aus einem Briefe, in dem Heloise von dem Geliebten Kraft erfleht; Abälard, welche Kämpfe, um ein so verlornes Herz, wie das meine, zurückzubringen! Wie vielmal bereuen, um immer wieder zurückzufallen! überwinden, um sogleich wieder überwunden zu werden; abschwören, um wieder zu beginnen, mit neuem Rausche wieder zu ergreifen!«
»Glückselige Zeiten! Liebliche Erinnerungen, an ihnen scheitert meine Kraft, zerschellt mein Muth!.... Gar oft vergieße ich mit Wonnegefühl die Thränen der Reue, werfe mich vor dem Throne Gottes nieder und die siegbringende Gnade will herniedersteigen in mein Herz.... dann.... dein Bildniß erscheint mir, Abälard.... Ich will es verscheuchen, es verfolgt mich; es entreißt mich der Ruhe, zu der ich eben eingehen wollte; es stürzt mich auf's neue in jene Pein, die ich vergöttere, indem ich sie verabscheue.... Unbesieglicher Zauber! endloser Kampf ohne Sieg! Mag ich über den Gräbern weinen, oder in meiner Zelle beten, oder mag ich in der Nacht dieser Schattengänge umherirren, es ist da, immer da, dies Bild, das allein meinen Augen gefällt, das sie mit Thränen badet, das Angst und Gewissensbisse in meine Seele wirft!... Wenn ich heilige Hymnen singen höre und der Weihrauch in die Tempelwölbung steigt, wenn die Orgel mit ihren Tönen die heilige Stätte durchbraust, oder Schweigen darin herrscht.... ist es wieder da und nimmer fort, und unterbricht dies Schweigen, vernichtet die Pracht, es ruft mich, es reißt mich fort aus den Hallen! So bleibt deine Heloise inmitten der friedlichen Jungfrauen, die Gott in seiner Ruhe aufgenommen, allein eine Schuldige, von Stürmen umhergeschleudert, in einem Meer von glühenden, irdischen Leidenschaften untergehend.....«
Nachdem ich in dem mächtigen Reize dieser schwermüthigen Zeilen ausgeschwelgt hatte, wandte ich mich zu Abälard. Wo werde ich ihn wiederfinden? Ach! das Ungewitter hatte über seinem Haupte getobt; ihn, der vor kurzem so hell erglänzte, fand ich jetzt gefallen, verbannt, von Stätte zu Stätte fliehend und seine jammervollen Tage vor der Wuth des Neides und der Verfolgung flüchtend: die Frommen verriethen ihn, die Mönche gaben ihm Gift, die Concilien verbrannten seine Schriften.... Von Bitterkeit übermannt, verbarg er sich in eine Wildniß.

»In meinen glücklichen Tagen, schreibt er selbst, hatte ich einmal eine Einöde betreten, die den Sterblichen unbekannt war, der Wohnsitz wilder Thiere, wo keine Stimme ertönte, als das kreischende Geschrei der Raubvögel. Hierher flüchtete ich mich. Aus Schilfrohr bauete ich mir eine Klause und deckte sie mit Stroh, da suchte ich Heloise zu vergessen und trachtete Ruhe im Schooße Gottes zu finden...«
Hier, in der Einöde, die Abälard's Brief mir vor die Augen malte, machte ich eine Pause. Ich bewunderte die Seltsamkeit dieser alten Abenteuer, die leidenschaftliche Bewegung in Beider Leben, die poetische Vermengung von Liebe und Frömmigkeit, von Ruhm und Elend. Und, wie es zu geschehen pflegt, wenn das Herz hingerissen, die Einbildungskraft erhitzt ist – ich vergaß die Leiden der beiden Unglücklichen und dachte nur an ihre glühende, wechselseitige Liebe, um die ich sie beneidete.
Abälard betete in seiner wilden Freistätte. In der Welt vermißte man die Gewalt seiner Stimme, man beklagte sein Unglück, und das Gerücht seiner plötzlichen Flucht machte die allgemeine Aufmerksamkeit rege. Eifer und Freundschaft entdeckten endlich seine Spur, einige Pilgrimme, ehemalige Schüler, drangen bis zu ihm, und bald strömte die Menge, mit reichen Opfergaben beladen, den Pfad zur Einsiedelei entlang. Von diesen Geschenken hatte Abälard die stattliche Abtei Paraklet erbauet, auf derselben Stelle, wo eben noch die Strohklause sich erhob, als er erfuhr, daß die Mönche von St. Denis sich des Klosters Argenteuil bemächtigt und die Nonnen daraus vertrieben hatten. Da begab er sich seiner Zufluchtsstätte und rief seine theure Heloise hierher.
Die junge Aebtissin kam mit ihren Gefährtinnen. Abälard aber hatte sich bereits zurückgezogen und die Abtei St. Gildas de Ruys in dem Kirchsprengel von Vannes verbarg sein trauriges Dasein.
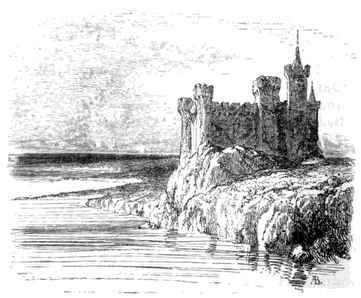
Diese Abtei erhebt sich auf einem Felsen, den die Wogen des Meeres unablässig peitschen. Kein Wald, keine Wiese ringsum; nichts als eine unendliche Ebene, wo aus unfruchtbarem Erdreich Steine umhergestreuet liegen. Die steilen Ufer mit nackten, zerrissenen Felsen bilden eine hellgraue Linie, die allein in den düstern Anblick der ganzen Gegend Abwechslung bringt. Von seiner Zelle aus sah der Einsiedler diese lange Linie in den Buchten verschwinden, an den Vorsprüngen wieder auftauchen, die fernen Gestade gürten und in den unermeßlichen Horizont sich verlieren.
Aber für Abälard war diese entsetzliche Oede nicht zu düster; seine Seele war weit mehr umdüstert. Jede Freude war hier erblichen, der Weihrauch des Ruhmes war verflogen und selbst Heloisens Bildniß haftete nur noch darin, um ein bitteres Leid, eine finstere Reue zu nähren. Doch in der Einsamkeit, welche kein Geräusch der Welt störte, wandte sich der gefeierte Büßer ohne Unterlaß zu sich selber und überschauete die Verirrungen seines Lebens; er erwog mit Muße die Eitelkeit des Ruhms, die Nichtigkeit irdischer Freuden, er überredete sich mehr und mehr von der Nichtigkeit der irdischen Dinge. Dann wendete er sich zu Heloisen, deren Unbußfertigkeit aus ihren glühenden Briefen redete, er fand den frommen Eifer wieder, ein heiliges Entsetzen erweckte seinen Muth, belebte seine erloschene Kraft aufs neue. Hier sehen wir diesen so großen als unglücklichen Mann die schwere Arbeit unternehmen, seine Seele zu läutern, die Bande zu brechen, die ihn noch an die Erde ketten, zu den himmlischen Höhen aufzustreben und seine Geliebte mit sich emporzureißen. Hier war es, wo er jenen berühmten Brief schrieb, in dem er, endlich Sieger in dem hartnäckigen Kampfe, seiner Heloise die hilfreiche Hand reicht, ihr Kraft einflößt, ihre Schritte unterstützt und durch den Staub des Grabes ihre Blicke das lebendige, tröstende Licht des Himmels schauen läßt.
»Heloise, schreibt er am Schlusse, ich werde dich auf Erden nicht wiedersehen, aber wenn der Ewige, in dessen Hand unsere Tage stehen, den Faden dieses unglückvollen Lebens zerschnitten, was allen Anzeichen nach vor dem Ende deiner Lebensbahn geschehen wird.... so bitte ich dich, wo ich auch verscheiden mag, nimm meinen Leichnam zu dir, laß ihn nach Paraklet bringen, damit ich neben dir beigesetzt werde. So, Heloise, werden wir nach so vielen Widerwärtigkeiten auf immer vereint sein, ohne Gefahr und ohne Frevel. Denn dann werden Furcht, Hoffnung, Erinnerung, Gewissenspein gleich dem verwehenden Staube schwinden, gleich dem Rauche, der in der Luft verdampft, und es wird keine Spur unserer früheren Verirrungen bleiben. Du selbst, Heloise, wirst durch das Anschauen meines Leichnams veranlaßt werden, in dich zu gehen und zu erkennen, wie thöricht es ist, in regelloser Leidenschaft ein wenig Staub, einen vergänglichen Körper, die schnöde Speise der Würmer, dem allmächtigen, unwandelbaren Gott vorzuziehen, der allein unsere Wünsche zu erfüllen und uns die ewige Glückseligkeit zu verleihen vermag!«

Lange hatte ich diese Geschichte geendet, ohne daß mein Geist sich ganz davon loszureißen vermochte. Das Buch auf den Knien, die Blicke auf die Landschaft gewendet, welche von den Gluthen der Abendsonne vergoldet wurde, befanden sich meine Gedanken in Paraklet, ich streifte um seine Mauern herum, ich sah in den düstern Laubgängen die trauernde Heloise, und ganz Gefühl für Abälard, betete ich mit ihm die unglücklich Liebende an. Diese Bilder verschmolzen alsbald mit den Gegenständen, die sich meinem Blicke darboten, so daß ich, ohne den alterthümlichen Sessel zu verlassen, mich in eine Glanz strahlende Welt versetzt fühlte, die von poetischen, reichen Gefühlen lebte und webte.
Aber außer dem Gelesenen, außer dem glühenden Abendnebel und dem glänzenden Schauspiele, welches das Dachfenster mir öffnete, mengten sich andere Eindrücke in meine Träumereien. Mitten in dem verworrenen Geräusch, welches in einer Stadt das Leben der Straßen bekundet, der Arbeit der Gewerke, dem Treiben am Hafen, trugen die Lüfte die fernen Töne einer Drehorgel sanft meinem Ohre zu. Durch den Reiz dieser fernen Melodie nahmen alle Gefühle ein stärkeres Leben, die Bilder einen mächtigern Eindruck, der Abend höhere Reinheit an. Eine unbekannte Frische durchwehete die ganze Schöpfung und meine Einbildung schwelgte in den azurnen Räumen und erquickte sich an dem Dufte von tausend Blumen, ohne bei einer zu verweilen.
Unmerklich hatte ich mich von Heloise entfernt, ich hatte ihren Schatten unter den alten Buchen, unter den gothischen Bogen verlassen, ich hatte über den Zeiten geschifft, und bald verlor ich die dunkelblauen Gipfel der Vergangenheit aus dem Gesichte und näherte mich bekannteren Ufern, verwandteren Tagen, näheren Wesen. Das Verstummen der Orgeltöne führte auch mich wieder in die Wirklichkeit, das dicke Buch, welches auf meinen Knien ruhte, war mir wieder gleichgültig geworden und ich stand, ohne etwas dabei zu denken, auf und trug es in sein Fach zurück...
Wie ist doch die Stunde, die den Erregungen folgt, so eintönig. Wie bitter ist die Rückkehr von den glänzenden Gebieten der Einbildung zu den undankbaren Gestaden der Wirklichkeit! Der Abend erschien mir düster, mein Gefängniß verhaßt, meine Muße eine Last.
Armes Kind, das du in diesem poetischen Hauche zu fühlen, zu lieben, zu leben hoffst und, unter deiner eigenen Anstrengung erliegend, zurücksinkst, wie bemitleide ich dich! viel Täuschungen erwarten dich, gar manchmal noch wird deine Seele, wie von süßem Rausche gehoben, sich von der Erde loszureißen suchen, um zu den Wolken zu schweben, aber allemal wird eine schwere Kette ihren Flug hemmen, bis sie endlich gebändigt, an's Joch gewöhnt, erlernt hat sich auf der Heerstraße des Lebens hinzuschleppen.
Glücklicherweise war ich in dieser Lage nicht; ohne die Wirklichkeit des Lebens zu verlassen, begegnete ich einem Wesen, auf welches mein Herz alle seine Empfindungen bezog und so ihren Reiz und ihre Dauer nach Gefallen verlängerte. Aus diesem Wesen verfehlte ich nicht, sogleich meine Heloise zu machen, aber nicht die unglückliche, sondern die zärtlich liebende, nicht die Sünderin, sondern eine reine, schöne, und ich richtete an sie, als wäre sie gegenwärtig gewesen, die lebhaftesten, leidenschaftlichsten Anreden...
Man sieht, ich war verliebt, ich war's seit acht Tagen, und seit sechs Tagen hatte ich den Gegenstand meiner Liebe nicht gesehen.

Wie es nun unglücklich Liebende machen: die ersten Tage wiegte ich mich in Hoffnungen, dann hatte ich Zerstreuungen gesucht, die mir aber, wie man gesehen hat, nicht zum besten gelungen waren. Hinterher war meine Gefangenschaft gekommen, und vom ersten Augenblicke dieses müßigen Lebens an war ich nicht im Stande gewesen, meine Liebe zu vergessen. Diesen Abend nun hatte die romantische Geschichte, die ich gelesen, meine Leidenschaft auf's Aeußerste angeregt, ich verzehrte mich in Sehnen, und meine Gedanken ergingen sich auf allerlei verzweifelten Wegen.
Man muß nämlich wissen, daß ich, wenn ich in die Dachkammer gelangte, die oberhalb der meinigen lag, meine Heißgeliebte sehen konnte!..... Sie befand sich allein zu dieser Stunde..... Das Dachfenster öffnete mir einen Weg, über die Dächer dahin zu gelangen.

Die Versuchung war unwiderstehlich und dies um so mehr, als ich mich seit einem Augenblicke bereits auf dem Dache befand. Ich setzte mich nieder, um Muth zu fassen und mich mit meinem Unternehmen vertraut zu machen, denn schon dieser Anfang seiner Ausführung versetzte mich in so große Aufregung, daß ich im Begriff war umzukehren. Für den Augenblick hatte ich nichts eiliger zu thun, als mich durchaus unsichtbar zu machen, indem ich mich auf das Dach legte.... Ich bemerkte Herrn Ratin unten in der Straße.
Sobald ich mich von diesem Donnerschlage etwas erholt, wagte ich es, den Kopf ein wenig in die Höhe zu heben, so daß ich über den Dachrand hinwegsehen konnte.... Keine Spur mehr von Herrn Ratin! Gewiß stieg er die Treppe herauf und ehe eine Minute verging, überraschte er mich auf meiner Reise in's Blaue. Ach! wie war ich zerknirscht, welche Gewissensbisse empfand ich. Wie leicht wurde mir die Reue, wie sehr erkannte ich die ungeheure Schuld meines Fehlers!.... Da sah ich Herrn Ratin wieder zum Vorschein kommen, weg waren Gewissensbisse und Angst, er schritt über die Straße fort, sich entfernend weiter.

Bald verlor ich ihn aus dem Gesichte; allein es wurde mir klar, daß ich auf dieser Stelle nicht bleiben konnte, ohne Gefahr zu laufen, daß man mich aus dem Fensterloche des Gefängnisses bemerke, in dessen Tiefe ich von meiner Höhe erschreckt hinabblickte. Ich machte mich also auf den Weg, um mir den Rest des Tages zu nutze zu machen, und mit wenigen Schritten war das von mir gesuchte Fenster erreicht. Es war offen....
Mein Herz pochte heftig, denn trotz der Gewißheit, die ich hatte, konnte ich mich nicht fest genug überreden, daß meine Heißgeliebte an diesem Orte allein wäre. Ich zauderte noch, da hörte ich plötzlich eine Stimme mir zurufen: Nur herein! fürchten Sie nicht, daß ich Sie verrathe, lieber junger Herr.
Es war die Stimme des Gefangenen. Beim ersten Worte verlor ich alle Geistesgegenwart, ich sprang mit raschem Satze in die Kammer, wo ich mich auf den Schultern einer schönen reichgekleideten Dame wiederfand, die mit mir zur Erde stürzte.
Ich kann nicht beschreiben, was im nächsten Augenblicke nach dem Sturze geschah, denn ich hatte alle Besinnung verloren. Das Erste was mir auffiel, als ich wieder zu mir kam, war, daß die Dame mit dem Gesicht gegen den Boden lag und weder Geschrei noch Vorwürfe hören ließ. Ich näherte mich halb kriechend und sagte zu ihr mit leiser, zaghafter Stimme: Madame!.... Keine Antwort... Madame!!!... Alles stumm.

Da befand ich mich nun in einer unseligen Geschichte. Eine achtbare Dame getödtet!... ein Schüler der Mörder! Mein Kritiker wird hier sagen, daß ich absichtlich übertreibe, um dem falschen, modernen Geschmacke zu huldigen. – Nur nicht so rasch geurtheilt, Kritikus. Die Dame war eine Gliederpuppe, ich befand mich in dem Arbeitszimmer eines Malers. Nun, klingt es anders, Kritikus?
Ich erhob mich zuerst selber und fing dann an die Dame aufzuheben. Ein einfältiges Lächeln umschwebte ihr zinnoberfarbiges Antlitz, obgleich die Nase sehr gelitten hatte. Ich besserte einigen Schaden aus, allein dies war ein zu kleiner Theil des Uebels, als daß ich mich lange dabei verweilt hätte.

Denn die Dame hatte mit der Nase an den Oelkrug gestoßen, dieser hatte das Gleichgewicht verloren, war umgefallen und hatte Pinsel, Farbenblasen, Palette herabgeworfen und Oel im Zimmer umhergeschüttet. Ich wollte dies ein wenig wieder in Ordnung bringen, allein wiederum war dieser Theil des Unglücks zu klein, als daß ich mich lange dabei aufgehalten hätte.
Denn der Oelkrug hatte im Fallen den Fuß einer erzdummen Staffelei erreicht, dieselbe hatte zu schwanken begonnen, war endlich umgefallen und hatte einen stattlichen Herrn, der an einem Nagel hing und unserm Treiben zusah, mitten auf der Brust gestreift. Der Nagel war seinem Herrn gefolgt, dieser der Staffelei und alle zusammen hatten sich über die Lampe gestürzt, die den Spiegel über dem Kamine zerschlug, indem sie ein Geschirr umwarf.
Die Verwüstung war erschrecklich, die Ueberschwemmung allgemein und die Dame lächelte immerfort.
In dem Drange dieser Ereignisse hatte meine Liebe ein wenig durch diese so heftigen, unerwarteten Unglücksfälle gelitten. Während ich so dastehe und über meine Lage nachdenke, will ich den Augenblick benutzen und erzählen, in wen ich verliebt war und wie ich es geworden.
Oberhalb meines Zimmers befand sich die Wohnung eines geschickten Portraitmalers. Dieser Maler besaß das große Talent, die Leute zu gleicher Zeit sprechend ähnlich und schön zu malen. Oh! welch' herrlicher Stand, wenn man's also versteht! Welch' wunderbarer Köder, woran sich Karpfen, Hechte, Kärpflein und sogar Ottern und Meerkälber fingen, und das aus freien Stücken und ohne sich über die Angel zu beklagen und dem Fischer noch obendrein dankbar!
Denkt an das Eitelkeits-Knötchen. Sobald man einmal wohlhäbig, reich geworden ist, ist es nicht einer der ersten Rathschläge, die man euch ertheilt, euer anziehendes, ganz eigenes und, um es mit einem Worte zu sagen, so liebenswürdiges Antlitz auf die Leinwand übertragen zu lassen; heißt es nicht, daß man diese Ueberraschung der Mutter, der Gemahlin, dem Oheim, der Tante schuldig sei? Und wenn die alle gestorben sind, heißt es dann nicht, man muß die Kunst ermuntern und einen armen Teufel verdienen lassen. Und wenn der arme Teufel reich ist, gibt es nicht tausend andere Vorwände?... eine Wand ausschmücken, ein passendes Gegenstück bekommen... Denn was will am Ende das Knötchen? Es will, daß ihr euch auf der Leinwand als hübsch, zierlich, geputzt, in feiner Wäsche, mit Glacéehandschuhen bewundert, es will vor allen Dingen, daß man euch so sehe, euch so bewundere, daß man daraus eure Züge, euern Reichthum, euern Adel, euer Talent, euer Zartgefühl, euern Geist, eure Feinheit, eure Wohlthätigkeit, eure gewählte Lektüre, euern edeln Geschmack und so viel andere vorzügliche Dinge bewundere, die aus euch ein ganz absonderliches Wesen machen, das mit tausend und einer vortrefflichen Eigenschaft begabt ist, die Fehler gar nicht einmal zu zählen, welche gleichfalls eben so viele Vortrefflichkeiten abgeben. Das alles will das Knötchen, und ist es da nicht zu verwundern, daß es euch im Namen des Vaters, der Mutter, der Gemahlin, der Kinder quält, euch malen und wieder malen und nochmals malen zu lassen? Ich würde mich übers Gegentheil weit eher wundern.
Die Kunst des Portraitirens ist also auf's genaueste mit der Lehre vom Knötchen verwandt und viele Maler sind, weil sie diese Grundsätze verkannten, im Hospital gestorben. Sie stellten den Hecht als Hecht, das Meerschweinchen eben als Meerschweinchen dar. Große Maler, schlechte Portraitisten. Die Leute sind nicht mehr zu ihnen gekommen und der Hunger hat sie aufgerieben.

Dieser Maler nun hatte alle vornehmen Gesichter zu konterfeien und es verging kein Tag, daß nicht stattliche Wagen kamen, ihre Herrschaft brachten und sie vor dem Hause erwarteten. Es war für mich ein herrlicher Zeitvertreib, die schönen Pferde zu betrachten, sie die Fliegen verscheuchen zu sehen, die Kutscher pfeifen oder mit der Peitsche klatschen zu hören. Außerdem war ich sicher, daß ich von denselben Personen, welche aus dem Wagen stiegen und deren Gesicht ich von meinem Fenster aus nicht sehen konnte, nach Verlauf von zwei oder drei Tagen mit aller Muße, so viel ich nur Lust hatte, die Züge betrachten konnte.
Der Maler hatte nämlich die Gewohnheit, zwischen den Sitzungen seine Gemälde draußen vor das Fenster an ein Paar dazu angebrachte Eisenstangen zu hängen, um sie der Sonne auszusetzen. Hingen sie einmal da, so brauchte ich nur die Augen aufzuschlagen und ich befand mich sogleich inmitten der allerschönsten Gesellschaft: Mylords und Barone, Herzoginnen und Marquisen, alle diese Leute hingen am Nagel und sahen sich an, und ich sah sie an, und wir sahen uns einander an.

Letzten Montag also war ich auf das Geräusch eines Wagens an meinen Posten geeilt. Es war eine glänzende Carosse, vier Pferde, ein prächtiges Geschirr, Diener in Livree. Der Wagen hielt und heraustrat ein schwacher Greis, dem zwei Diener ehrfurchtsvoll beisprangen. Ich merkte mir seinen kahlen Scheitel und sein Silberhaar, um ihn recht wieder zu erkennen, wenn er in die Galerie käme.
Als der Greis den Fuß auf die Erde gesetzt hatte, stieg eine junge Dame aus dem Wagen. Die beiden Diener zogen sich zurück, der Greis stützte sich auf den Arm des Mädchens und sie traten langsam in die Hausthür. Ein großer Wachtelhund folgte ihnen spielend.
Bei diesem Anblicke fühlte ich mich bewegt, nicht so sehr über den wahrhaft rührenden Anblick, ein junges schönes Mädchen als Stütze eines Greises zu sehen, sondern vornehmlich, weil die liebenswürdige Nymphe, die mit allem geschmückt war, was Anmuth und Schönheit noch zu erhöhen vermochte, mir, der ich so oft von zärtlichen Gedanken überkommen wurde, die Sterbliche zeigte, welche ich in unklaren Bildern träumte und die die unbestimmten Gefühle, die heißen Gluthen, die seit einiger Zeit mein Herz durchwogten, an sich fesselte.
Ein besonderer Umstand bei dieser jungen Person hatte mich mit unerwartetem Zauber gefesselt. Es war die große Einfachheit ihrer Kleidung. Bei so vielen Anzeichen von Reichthum sah ich an ihr nur einen einfachen Strohhut, ein weißes Gewand und dennoch so viel Herrlichkeit und Anmuth, daß es mir schien, ich würde, wenn ich sie allein in einsamen Gegenden und von aller Zuthat des Reichthums entblößt sähe, an ihrer Haltung, an ihrem Gange, an ihrem ganzen Wesen ihren Rang, ihren Reichthum und selbst die edle Hingebung erkennen müssen, womit sie sich den Huldigungen der jungen Männer zu entziehen suchte, um die Schritte eines Greises zu unterstützen.
Und dann, soll ich es nur sagen, ich war durch die Gesellschaft, die ich vor meinem Fenster sah, schon verwöhnt: Rang, Reichthum, Anmuth und guter Geschmack in Haltung und Tracht, alle diese Dinge hatten für mich einen unwiderstehlichen Reiz bekommen. Durch das Anschauen dieser Personen hatte ich alle Empfänglichkeit für das Gemeine, das Gewöhnliche, für meinen Stand und meines Gleichen verloren, und wenn schon ein junges Mädchen, in welchem Gewande sie auch erschienen wäre, mich lebhaft bewegt hätte, so mußte eine solche Erscheinung mich entflammen und zu maßloser Leidenschaft entzünden.
Dies blieb denn auch nicht aus und zwar in solchem Grade, daß ich plötzlich die heftigste Liebe zu dieser jungen Antigone fühlte. Uebrigens war meine Leidenschaft so rein und erhaben, daß ich nicht einmal daran dachte, mich zu fragen, ob sie nicht etwa eine jener Kalypsen sei, von denen Herr Ratin mir so viel geredet.
Diejenigen, welche glauben, daß eine Schülerliebe nicht lebhaft und hingebend genug sei, um hoffnungslos und ohne Ziel zu sein, täuschen sich sehr.
Solche Leute müssen niemals Schüler gewesen sein, oder sie waren Schüler, die sich vortrefflich auf Partikeln und bezügliche Fürwörter verstanden, Schüler von bewundernswerthem Gedächtniß, klugem Verstande, zahmem Herzen, regelrechtem Geiste, von gezügelter Einbildung und alle Jahre dreimal mit Prämien geschmückt.
Musterschüler, Muster nach Herrn Ratins Geschmacke, hoffnungsvolle Ratins der Zukunft. Sie sind heutzutage Minister, Advokaten, Krämer, Poeten, Lehrer, Tabakshändler und, wo sie sein mögen, mit Tabak beschäftigt oder auf der Kanzel, in ihrem Comptoir oder auf dem Parnassus, sie sind stets Musterminister, Musterkrämer, Musterpoeten, Muster, durch und durch Muster und nichts als Muster, weder mehr noch minder, und das ist doch schon ganz hübsch.
Meine Liebe sollte nicht so lebendig und hingebend gewesen sein, weil ich mir davon nichts als tolles Entzücken versprechen konnte; ich hätte für sie nicht Alles geopfert, selbst wenn ich nichts von ihr erwarten durfte? Ach! wie verrechnet man sich da! Für einen einzigen Blick des liebenswürdigen Mädchens hätte ich Herrn Ratin gegeben; für ein Lächeln hätte ich die vier Elzevire des Vatican in's Feuer geworfen.

Sie stiegen die Treppe herauf. Als sie vor meinem Zimmer vorüber waren, öffnete ich leise die Thür ein wenig; der Wachtelhund stürzte freudig, lustig, schmeichelnd herein in mein Zimmer.
Es war ein herrliches Thier! Außer der Schönheit und vorzüglichen Reinlichkeit seines wohlgeordneten Haares hatten Benehmen, Wesen und alle Geberden bei ihm etwas Elegantes und Liebenswürdiges, so daß ich den Unterschied unserer Naturen vergaß und ihn mit einem gewissen Neide anblickte, als einen Hund vornehmen Standes, als einen Hund, der mit hochstehenden Personen zu vertraut sei, um auf meine Achtungsbezeigungen nur etwas zu geben, vor allem als den Lieblingshund jenes schönen Fräuleins, für das ich – nichts war. An dem Namen, der auf das Halsband gegraben war, fand ich meine Vermuthung bestätigt, daß sie Engländerin sei.

Als der Hund fort war, hatte ich nichts besseres zu thun, als an das zu denken, was über mir vorging. Um etwas von dem Gespräche zu erlauschen, näherte ich mich leise dem Fenster. Der Maler und der Greis sprachen miteinander, aber das Mädchen blieb still.
Sie bekommen da ein trauriges Gesicht zu malen, mein Herr! sagte der Greis, und da die Copie bestimmt ist, sehr bald das Original zu überleben, so wäre es recht gut, wenn Sie so wenig als möglich Trauriges hineinlegten, denn ich möchte meinen Enkeln nicht gern zum Schreckbilde dienen. Gewiß, fuhr er mit sanftem Lächeln fort, es ist keine Eitelkeit, daß ich mich in dem Alter und Zustande, worin ich mich befinde, malen lasse, und ich glaube, daß viele Ihrer Kunden einen geeigneteren Zeitpunkt wählen.
Nicht immer, mein Herr, versetzte der Maler, ein so ehrwürdiges Antlitz als das Ihrige trifft man vielleicht weit seltener, als die Frische und Jugend selber.
Eine Schmeichelei, mein Herr, die ich annehme. Ich hab' nicht mehr viel Zeit, deren zu hören.... Lucy, ich mache dich traurig; aber, liebes Kind, kannst Du der Zukunft nicht eben so ruhig entgegensehen, wie Dein Vater; ich bitte Dich, wer wird, wenn wir uns trennen, am meisten verlieren? Ich rufe den Herrn hier als Richter auf....
Verzeihen Sie, mein Herr, es scheint mir, wie dem Fräulein, daß eine Trennung für beide Theile zu betrübend ist, als daß es nicht besser wäre, den Blick davon abzuwenden.
Das ist's ja eben, was ich Schwäche nenne, und davon wollte ich meine Tochter heilen. Ich entschuldige diese Schwäche, wenn es sich um Schläge handelt, welche erlaubte Hoffnungen vernichten, die Jugend in ihrer Blüthe treffen und ihr die schönen Jahre, die sie zu erreichen glaubte, entreißen. Aber wenn der Tod uns am vorausgesehenen Ziele unsers Lebens erreicht.... wenn er dem Schlafe gleicht, der den Mühen eines arbeitsvollen Tages folgt.... wenn ein Vater bis zum letzten Augenblicke in der Liebe einer theuern Tochter glücklich war und nichts mehr begehrt, als in ihren Armen zu entschlummern.... ist denn dies Bild so traurig, daß man die Augen abwenden muß, daß man solche Kraft bedarf, um den Anblick zu ertragen?.... Lucy, warum diese Thränen? komm, komm, mein Kind, sei wie ich.... und unsere Tage werden heiter sein und wir ihrer Lust bis zum letzten Augenblicke uns erfreuen... und jenes Unglück, das lange nicht so groß erscheint, wenn man ihm in's Angesicht schauen kann, wird nicht durch alles das vergrößert werden, was die Einbildung, blinde Furcht, vergebliches Widerstreben Unseliges und Schreckliches hinzuthun.... Verzeihung, mein Herr, setzte er hinzu, das ist mein ewiger Streit mit meiner Lucy und wenn das Portrait mich nicht auf diese Gedanken gebracht hätte, so würde ich mir die Freiheit nicht genommen haben, die Feindseligkeiten hier zu erneuern.
Voll Entzücken hörte ich diese Worte, die mich von den gesammten Verhältnissen unterrichteten und mir das Mädchen mit einem Zuge von Schwermuth und kindlicher Liebe verschönten. Wie, dachte ich, diese stolzen Rosse, diese stattlichen Diener, solch' prächtige Carosse, all' dieser Reichthum, all' diese Gegenstände der Lust oder Eitelkeit – und die Königin von all' den Dingen, die Augen voll Thränen und bekümmert, daß sie sich nicht für immer ihrem alten Vater weihen kann!
Denselben Tag noch kam das Bildnis in die Galerie. Es war ein einfacher Entwurf, in dem ich ohne Mühe den edeln Greis erkannte. Er nahm die linke Seite des Gemäldes ein; zur Rechten war ein großer Raum leer gelassen, der, meiner Meinung nach, einen schlechten Eindruck hervorbrachte.
Als aber bei der zweiten Sitzung das Gemälde aus der Galerie zurückgeholt wurde, obgleich diesmal die junge Miß allein gekommen war, wurde ich in dem Glauben bestärkt, daß der leere Raum für sie bestimmt sei und ich endlich ihre Züge würde betrachten können.
Sie haben mir versprochen, mein Fräulein, sagte der Maler, mir seine Zeichnung des Theils Ihres Parks mitzubringen, in welchen Ihr Herr Vater sich versetzt zu sehen wünscht.

Ich habe daran gedacht, mein Herr, versetzte sie; die Zeichnung ist im Wagen. Sie trat an's Fenster: John, bring me my album if you please.... Aber da sehe ich, daß John nicht mehr da ist, fügte sie lächelnd hinzu.
In der That, ihre Leute hatten einen armen Teufel bei den Pferden gelassen und sich in irgend ein benachbartes Kaffeehaus begeben. Ich werde hinabeilen, sagte der Maler.... Allein ich war ihm schon zuvorgekommen und stieg bereits die Treppe wieder hinauf, wobei ich meine Lippen auf das Album der jungen Miß drückte. Ich hoffte bis an die Thür des Arbeitszimmers zu dringen und dort ihr Angesicht zu erspähen; allein unterwegs begegnete mir der Maler. Schönen Dank! Sie sind wahrlich der wackerste Knabe, den ich gesehen. Und er nahm mir das Buch aus der Hand.
Ich kehrte ruhiger auf meinen Posten zurück als ich ihn verlassen hatte, und dazu hatte ich keinen Grund, denn es waren mir Worte entgangen, deren jedes von unsäglichem Werthe war.
.... Das artige Kind! Er versteht also Englisch. – Sehr gut. Er dient mir gewöhnlich als Dolmetscher bei Ihren Landsleuten.... Ein liebenswürdiger junger Mensch! Es ist schade, daß er nicht Künstler werden soll, wozu seine Neigung und seine Talente ihn ziehen...
Der Maler hielt inne und stand auf: Ich will Ihnen etwas zeigen... Hier! eine Skizze, die er einmal hier am Fenster machte.... der See, ein Theil des Gefängnisses.... der schlechte Hut, der auf die Straße herabhängt, um Almosen zu sammeln, deutet auf die Anwesenheit eines armen Gefangenen, für den diese herrliche Natur unsichtbar ist.
Ein reizendes Bild! sagte sie, und voll Gefühl..... Aber warum einer Neigung widerstreben, die sich so entschieden äußert?
Es sind die Vormünder, die wollen, daß er Rechtsgelehrter werde.
Seine Vormünder... Ist er denn verwaiset?
Schon lange. Er hat nur noch einen alten Oheim, der sich um seine Erziehung kümmert.
Armes Kind! sagte die junge Engländerin mit einem Ausdruck voller Mitleid.
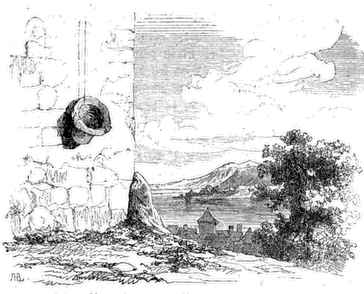
Diese Worte berauschten mich. Sie hatte mich bedauert; Grund genug, daß ich stolz war, eine Waise zu sein, daß mein größtes Unglück sich mir in Glück verwandelte.
O! wie gern hätte ich ihre Gedanken auf meiner Person weilen sehen! Doch statt dieses höchsten Glücks nahm das Gespräch eine andere Wendung und ich erfuhr aus einigen Worten, daß sie in acht Tagen nach England zurückkehren würde. Was soll dann aus mir, Herrn Ratin gegenüber, werden! Ich war trostlos.

England! reizendes Land, zu dem die Schiffe ziehen; frische Ufer, schattige Parke, wo die jungen Miß mit ihrer Schwermuth sich ergehen. Hier ist alles ohne Reiz; hier ist nichts liebenswerth. Und ich sah gleichgültig auf den See.
Wenn sie sich entfernen wird, wenn andere Gegenden sie ziehen sehen!.... wenn zur Mittagsstunde sie auf staubigen Straßen reist und den Blick auf das Grün der Bäume, der Wiesen schweifen läßt!.... daß ich doch auf diesen Wiesen, unter diesen Bäumen wäre!... Junge Miß, Du fliehst?..... daß ich nicht vor den Rossen bin, in Gefahr von ihnen zertreten zu werden. Ich würde sie in Furcht sehen, sie würde Mitleid mit mir haben! Und ich bildete mir ein, daß ohne ihr Mitleid es sich nicht der Mühe lohne zu leben.
Die Sitzung war zu Ende. Ganz in meinen Gedanken versunken, erwartete ich mit ungeduldiger Begierde, daß das Bild in die Galerie käme; aber es wurde Abend und es erschien nicht, und die nächsten Tage vergingen in der nämlichen unbefriedigten Erwartung. Da geschah es, daß ich einmal, bis an das Dachfenster gekommen, nun der Versuchung nicht widerstehen konnte, bis in das Malerzimmer selbst zu dringen, um die Züge derjenigen zu betrachten, die in meinem Herzen thronte. Der Leser weiß, welches Misgeschick daraus entstand und wie ich stehen geblieben war in meinen Träumen inmitten der allerschönsten Unordnung. Ich will nun weiter erzählen.
Diesmal hatte ich die allerklarste Empfindung meiner vollständigsten Vernichtung. Schon die böse Lüge und das Elzevir-Verbrechen, dann noch eine Thür eingerannt, verbotene Bücher gelesen, aus meinem Gefängniß entschlüpft, über die Dächer geschlichen, Verwirrung und Verwüstung in eine Werkstätte gebracht, eine Gliederpuppe umgeworfen, ein Gemälde durchlöchert!.... Entsetzliche Kette von Verbrechen, deren erstes Glied, nämlich das tolle Lachen, Herr Ratin in Händen hatte.
Was thun? Wieder ordnen, den Schaden gut machen, alles in Ordnung bringen? Unmöglich; des Uebels war zu viel. Eine Geschichte ersinnen? Diesen Augenblick hatte ich bei Gelegenheit des Maikäfers gefunden, daß es nicht so leicht sei. Bekennen? um alles in der Welt nicht! denn da hätte ich gestehen müssen, daß ich verliebt war, und bei dem bloßen Verdacht einer solchen Unsittlichkeit sah ich Herrn Ratins Gesicht sich über und über röthen und einen einzigen Blick von ihm mich vernichten.
Ich beschloß in mein Zimmer zurückzukehren, die Thür hinter mir zu schließen und mich mit mehr Eifer als je an die Arbeit zu machen, theils um meinen Geist von der beunruhigenden Furcht zu befreien, theils um Herrn Ratin für mich zu gewinnen, der ganz sicher mit meinem guten Benehmen zufrieden sein würde, wenn ich ihm einen tüchtigen Vorrath Arbeiten, sauber geschrieben, sorgsam gearbeitet, von dem vollkommensten Fleiße zeugend, vorlegte. Nur weil der Tag stark zu Ende ging, glaubte ich meine Rückkehr um einige Minuten verschieben zu müssen, damit mich die Dunkelheit vor den Blicken des Gefangenen verberge, wenn ich über das Dach zurückkehrte.
Ich benutzte diese Minuten, um meine Neugierde zu stillen. Nach kurzem Suchen fand ich das Bild an die Wand gelehnt und näherte es dem Fenster.
Es war beinahe vollendet. Die junge Miß saß in anmuthiger Haltung neben ihrem Vater und ihre zarte Hand ruhte nachlässig auf dem Halse des schönen Wachtelhundes. Alte Buchen umschatteten die Gruppe und durch eine Lichtung gewahrte man ein schönes Schloß auf einem Rasenplatze, von dem man über das Meer hinaussah.

Beim Anblick dieser ganz Anmuth athmenden, von einem rührenden Ausdruck von Milde und Schwermuth belebten Züge beseelten mich die zärtlichsten Gefühle, aber nur um augenblicklich wieder in den bittern Schmerz zu versinken, daß ich ihr nichts war, daß ich sie bald scheiden sehen würde. Aufs Seligste im Zauber ihres Blickes schwelgend, sagte ich bei mir: Warum, o warum bist du nicht meine Schwester! Was für einen guten, lieben Bruder solltest du an mir finden! Wie glücklich würde ich mit dir diesen Greis machen! Wie doch das Grün, wo ihr weilt, so schön ist.... wie reizend würden mir die Wüsten mit dir sein!.... Lucy!.... meine Lucy!.... meine Heißgeliebte!
Die Nacht war gekommen. Traurig riß ich mich von dem Bilde los und befand mich im Nu in meinem Zimmer, eben da man mir Licht und Abendessen brachte.

In dem aufgeregten Zustande, worin ich mich befand, hatte ich weder Hunger noch Schlaf; ich dachte nur daran, mich schnell an's Werk zu machen, um Herrn Ratin sichtbare Beweise meiner Arbeit und meiner gänzlichen Umwandlung in jedem Augenblick, wo er kommen möchte, vorlegen zu können.
Nach dem Cäsar Virgil, nach dem Virgil Bourdon, nach dem Bourdon drei Seiten Aufsatz, nach den drei Seiten.... schlief ich ein.

Ich war sehr überrascht, als beim Grauen des Tages mich eine Stimme weckte, die aus voller Kehle Psalmen sang. Ich horchte.... es war der Gefangene. Er fuhr in etwas gedämpfterm Tone fort und schwieg endlich ganz. Diese fromme Uebung erweckte mir von dem Menschen beinahe eine günstige Meinung. Nach einigem Schweigen hub er an:
Sie haben diese Nacht tüchtig gearbeitet?....
Singt Ihr alle Morgen so? unterbrach ich ihn.
Von Kindheit auf... Glauben Sie denn, ich könnte ohne die Tröstungen der Religion mein Misgeschick ertragen?
Nein, ich wundere mich nur, daß die Religion Euch nicht von dem Verbrechen abgehalten hat, welches Euch in's Gefängniß brachte.
Das Verbrechen – ich bin unschuldig. Gott hat zugegeben, daß meine Richter irrten, möge der Wille Gottes geschehen! Ich würde mich d'rein ergeben, setzte er hinzu, wenn ich neben der leiblichen Nahrung nur auch die Speise der Seele hätte.... aber ich besitze keine Bibel.
Wie! fiel ich ein, man versagte Euch die Bibel?
Wen man für verabscheuungswürdig hält, dem versagt man alles.
Ihr müsset eine Bibel haben!.... Ich will, daß Ihr eine habt und sollt' ich Euch meine eigene bringen!!
Edler, junger Mann! sprach er mit dankendem Tone, bis zu mir bringen? Unmöglich! Auch möchte ich es nicht einmal zugeben! Der Anblick dieses entsetzlichen Aufenthalts darf Ihre Blicke nicht betrüben.... soll ich Ihnen sagen, wie es kommt, daß ich mich an Sie wendete? Gestern, als ich die Kuchen an einer Schnur zu Ihnen hinaufziehen sah,... da sagte ich zu mir voll Neid: gibt es nicht eine mitleidige Seele, die auf gleiche Weise das Brod des Lebens zu einem armen Gefangenen gelangen ließe!
Dies war mir ein leuchtender Fingerzeig.
Habt Ihr eine Schnur?
Die Vorsehung hat zugegeben, versetzte er, daß ich eine behalten konnte, die ich zu diesem einzigen Zwecke aufbewahrte.
Ihr sollt eine Bibel haben! Ja, Ihr sollt! rief ich ihn unterbrechend aus.
Und hocherfreut bei dem Gedanken, dem Unglücklichen so wahrhaft zu nützen, suchte ich eilig meine Bibel unter den Büchern, die ich gestern in den Schrank gepackt.

Während ich so suchte, glaubte ich von der Seite des Gefängnisses her ein ersticktes Seufzen zu vernehmen.... ich horchte. Seid Ihr es? fragte ich den Gefangenen. Er antwortete nicht, aber das Seufzen währte fort und wurde vernehmlicher und klagender. Was gibt es, was fehlt Euch denn? rief ich jetzt mit bewegter, ängstlicher Stimme. – Ein entsetzliches Leiden, versetzte er, und kein Mittel dagegen! Die eine meiner Ketten war zu eng für mein Bein, sie hat eine Geschwulst verursacht, durch den Druck des Eisens.... O! o! rief er auf einmal aus –
Sagt,... sagt doch nur, armer Mann!
.... mir die grausamsten Schmerzen verursacht! D'rum konnte ich nicht schlafen, und sah Sie diese Nacht arbeiten.
Unglücklicher Mann! Und Ihr verlangt nicht, daß man dem abhilft?
Man besucht mich nur alle fünf Tage. Ach!... noch drei... da werd' ich's sagen.
O! wie dauert Ihr mich! Könnt ich denn nicht...
Nichts! nichts! Armes Kind... Man müßte... Ach! ach! ich fühle schon, wie Ihr Mitleid mir Linderung gibt... Man müßte... O! o!... Ach! ach!...
Was müßte man...?
Barmherzigkeit, Barmherzigkeit!... das Blut rinnt!... vom Eisen ein wenig abfeilen können...
Eine Feile! rief ich, eine Feile! Halt! in meine Bibel...

Ich hatte eine Feile. Ich legte sie schnell in das Buch. Doch als ich alles mit einem Bindfaden zusammengebunden hatte, fiel mir der verzweifelte Gedanke ein, daß ich eingeschlossen war. Der Gefangene fuhr indeß fort zu jammern, und jeder Klagelaut, den er von sich gab, zerriß mein Herz. Schon dachte ich das Schloß meiner Thüre zu sprengen, als mich der Anblick eines Lumpensammlers, der die Straße daherkam, mit Entzücken erfüllte:
He! rief ich ihn an; binde dies an die Schnur, die da drüben an der Mauer herabhängt, geschwind, geschwind, es gilt einen armen Mann zu trösten.
Der Lumpensammler band das Bündelchen an und rasch stieg dasselbe in die Höhe. In demselben Augenblicke that sich meine Thür auf.
Es war Herr Ratin! Er fand mich über der Arbeit.
Gestern, sprach er zu mir, hab' ich in der Entrüstung, worein Deine Aufführung mich brachte, vergessen, Dir Arbeiten für die beiden Tage zu geben...
Ich habe gearbeitet, sagte ich zitternd.
Herr Ratin musterte die Arbeiten mit einigem Mistrauen, so neu erschien ihm der Vorfall. Als er sich jedoch überzeugt hatte, daß sie während meiner Gefangenschaft gearbeitet waren, hub er an: Ich lobe Dich, daß Du aus eigenem Antriebe die Gefahren des Müssigganges flohest; ein junger müssiger Mensch gibt nichts als verabscheuungswerthe Dinge an, denn er ist allen schlechten Gedanken preisgegeben, die in einem Alter wie das Deinige seinen unthätigen Geist bestürmen. Denk' an die Gracchen, die nur deshalb ihrer Mutter so viel Freude machten, weil sie schon im frühen Alter gesetzt und fleißig waren.
Ja, Herr Ratin, sagte ich.
Du hast Dir nicht einmal Zeit genommen zu essen, sagte er, als er mein Essen von gestern unberührt sah.
Nein, Herr!
Ich will darin eine Folge des großen Kummers erkennen, den Du über Deine gestrige Aufführung empfinden mußtest.
Ja!
Hast Du darüber ernsthafte Betrachtungen angestellt?
Ja, Herr Ratin!
Hast Du eingesehen, wie Du durch Dein tolles Lachen alle Achtung vergaßest?
Ja. (In diesem Augenblicke stieg Jemand die Treppe hinauf.)
Und dann weiter in Lüge verfielst.
Ja! (Die Thür der Malerwerkstätte öffnete sich.)
Und von der Lüge...
Ja! (Ein Schrei des Entsetzens ließ sich vernehmen.)
Was für ein Lärm ist das...?
Ja, Herr!... (Es gab Ausrufungen, heftiges Geschrei, gewaltige Verzweiflungsrufe; ich war einer Ohnmacht nahe!!!)

Ich versuchte aus allen Kräften die Aufmerksamkeit des Herrn Ratin von dem Lärm oben abzulenken. Als Sie mich gestern verlassen, sprach ich...
Halt... fiel er ein und horchte immer aufmerksamer, was in der Werkstätte vorging.
Allerdings war der Lärm daselbst groß. – Verloren! Entsetzlich! Alles verloren! schrie der Maler verzweiflungsvoll. Man muß durch's Fenster hereingekommen sein!
Er trat an dasselbe heran: Julius! rief er, sind Sie von gestern Abend an zu Haus gewesen?
Ja, mein Herr, sagte Herr Ratin vortretend, und zwar auf meinen Befehl.
Zum Henker, Herr! Mein Arbeitszimmer ist durcheinander gewühlt, meine Gemälde sind verdorben, die Staffelei umgeworfen... und Ihr Zögling muß das alles gehört haben.
Wollen Sie einen armen Gefangenen anhören? sagte jetzt eine Stimme, die aus dem Fenster des Gefängnisses kam; ich habe alles gesehen, ich will Ihnen alles erzählen.
Redet, sprecht...
So wissen Sie, mein Herr, daß es gestern Abend große Gesellschaft auf dem Dache gab, just vor der Oeffnung Ihres Fensters. Es waren fünf Katzen, Sie wissen, wenn die Herren Kater Süßigkeiten sagen...

Kurz gefaßt! sagte Herr Ratin.
.... so werden sie ein wenig laut dabei. Das Kätzlein war spröde.
Kurz gefaßt! sage ich, wiederholte Herr Ratin; das gehört nicht zur Sache.
Verzeihen Sie, mein Herr, denn ohne die Sprödigkeit dieses Fräuleins und die Eifersucht der vier Liebhaber...
Julius! geh' einen Augenblick vor die Thür.
Ich ließ mich nicht bitten.
.... Alles wäre gut abgegangen, fuhr der Gefangene fort; sie miauten also auf die zärtlichste Weise, allein Mamsellchen hörte auf keinen und putzte sich das Gesicht mit ihren weichen Sammtpfoten; Sie hätten sie für Penelope unter ihren Freiern gehalten.
Nur weiter! sagte der Maler. Etwas schneller...
Ja weiter. Auf einmal nahm sich der eine Kater die Freiheit, seine Krallen über das Maul eines der Bewerber zu streichen; dieser nimmt das Ding schief, die andern mengen sich hinein, ple! pla! schallt das Signal: Krieg auf Leben und Tod! Und man sieht nichts mehr als einen wild durcheinanderfahrenden Tanz, Krallengriffe, Zähnefletschen, ein wahres Höllenkonzert. Während sie sich balgen, springt Penelope auf die Treppe, der ganze Tanz hinter her.... Ich habe nichts weiter gesehen. Allein nach dem jetzt entstehenden Gepolter zu urtheilen, mußten sie etwas umgeworfen haben, und dies auf etwas Andres gestürzt sein. Das war etwa um acht Uhr.
Ich fühlte mich durch den Dienst, den mir der Gefangene in diesem Augenblicke erwies, sehr gedehmüthigt, und dies um so mehr, als die dreiste Lüge nach so großer Frömmigkeit, dieser ausgelassene Ton nach so heftigen Schmerzen plötzlich die ganze Theilnahme, welche mir der Mann eingeflößt hatte, verscheuchten. Ich bin fest überzeugt, daß ich ohne die Anwesenheit des Herrn Ratin mich stark genug gefühlt hätte, ihn auf der Stelle Lügen zu strafen und dem Maler alles zu bekennen; aber es kam Liebe in meinem Verbrechen vor, und die große Schamhaftigkeit des Herrn Ratin erschien mir als ein unglücklicher Felsen, an dem ich unrettbar, bei dem geringsten Verdachte seinerseits, zerschellen mußte.

Mittlerweile fuhr eben der Wagen an dem Hause vor und die junge Miß und der Vater stiegen die Treppe hinan. Meine Sitzung! rief der Maler voll Verzweiflung. Gefangener, Ihr habt uns eine alberne Geschichte aufgebunden; da ist ein Bild, das hatte ich an die Wand gelehnt, und finde es jetzt auswärts gekehrt... oder drehen etwa die Katzen meine Bilder um?... Man ist eingebrochen; man ist durch's Fenster gebrochen.... Julius! was haben Sie gesehen?...
Julius! jag' den Hund hinaus, rief mir in demselben Augenblicke Herr Ratin zu.
Ich muß nämlich bemerken, daß der niedliche Wachtelhund in diesem Augenblicke den neuen Regenschirm des Herrn Ratin höchst neugierig anroch. Gleich war ich bereit, den Hund auf die Flur zu jagen und noch ein Stück weiter zu verfolgen, um dem Maler Zeit zu lassen, seine unselige Frage zu vergessen.
Als ich zurückkam, war er in der That mit dem Empfange seiner Gäste beschäftigt; er bat sie um Entschuldigung, daß er sie in einer so entsetzlichen Unordnung empfinge. Wenn Sie nicht morgen reisen wollten, bemerkte er, so würde ich Sie bitten, diese letzte Sitzung auf einen andern Tag zu verschieben. – Es ist leider unmöglich unsre Abreise zu verschieben, versetzte der Greis; aber ich bitte Sie, lassen Sie sich durch unsere Anwesenheit nicht abhalten, die augenblicklichen Nachstellungen, welche zur Entdeckung des Schuldigen unerläßlich sind, zu machen. Der Maler stieg also selbst auf das Dach, um die Wege zu untersuchen.

Glücklicherweise war Herr Ratin meilenweit von dem Verdacht entfernt, daß ich den geringsten Antheil an diesem Vorfalle haben könnte. Nachdem er seinen Schirm sorgfältig in das Futteral gesteckt hatte, trat er zu dem Tische, blätterte in meinen Büchern und bemerkte die Stellen, welche den Gegenstand meiner Arbeit bilden sollten. In Betracht der Arbeit, welche Du mir vorgelegt hast, hub er an, und in Betracht der bessern Sinnesart, worin ich Dich finde... hier trat der Maler ein und ganz und gar mit seiner Angelegenheit beschäftigt, rief er:
Haben Sie hier nicht eine Kammer.... ach! ja wohl, da! hätten Sie vielleicht die Güte, sie mir zu öffnen? Man hat nur von dort auf das Dach kommen können und wir werden entdecken, von wannen man in meine Kammer gedrungen ist. – Sehr gern, mein Herr, sagte Herr Ratin. Bei diesen Worten nahm er aus seiner Lade den Schlüssel und steckte ihn in das Schloß, das ich möglichst wieder in Ordnung gebracht hatte, indeß ich bleich vor Schrecken mit ungemeinem Eifer zu arbeiten schien.

Während die beiden Herren ihre Untersuchung anstellten, vernahm ich Lärm in dem Gefängniß. Leute redeten heftig, einige unheimliche Worte drangen zu meinem Ohre, die Schildwache stand auf der Lauer und ein paar Vorübergehende waren stehen geblieben, um den Ausgang dieses Vorfalls zu erwarten.
Da ist die Schnur! rief eine Stimme.
Die Feile! die Feile! rief eine andere Stimme; hier, schauet, unter diesem Steine.
Das ist wahrlich sein Taschentuch! sagte in demselben Augenblicke Herr Ratin. Wäre es möglich!.... Julius!

Die Thür stand offen. Vor Schrecken wankend, eilte ich hinaus, ohne eine andere Absicht, als mich für den Augenblick den schrecklichen Foltern der Furcht und der Scham zu entziehen. Kaum aber hatte ich hundert Schritte auf der Straße gethan, als ich mich umwandte und den ehrsamen Lumpenhändler bemerkte, welcher in unser Haus ging, um einem Beamten den Weg zu meiner Wohnung zu zeigen. Ich verdoppelte meine Schritte und sobald ich den Fuß um die Ecke der nächsten Straße gesetzt hatte, lief ich aus Leibeskräften bis zum Stadtthore und hier hinaus, nicht ohne die größte Furcht beim Anblick der friedlichen Gendarmen, welche hier Wacht hielten, zu empfinden.
Indem ich so hinlief, hatte ich Muße, über meine Lage nachzudenken, die mir höchst verzweifelt erschien. Wieder zurückkehren, das hieß jetzt nicht blos wieder in Herrn Ratins Hände fallen, sondern eben so gewiß mich den Gendarmen überliefern, und dieser Gedanke verursachte mir den entsetzlichsten Schrecken. Also von solchen Betrachtungen gejagt und von der Furcht aufs äußerste angespornt, lief ich in einem Zuge bis an eine Wiese bei Coppet, wo ich mich endlich auf fremdem Gebiet niedersetzte.
Und kaum hier an diesem entlegenen Orte glaubte ich mich vor den Nachstellungen der Gerechtigkeit gesichert. Ohne Unterlaß richtete ich meine Blicke nach der Heerstraße zu, und allemal wenn Kühe, ein Esel, ein Wagen den Staub etwas aufwirbelte, bildete ich mir ein, die gesammte Gendarmerie nach allen Richtungen zu meiner Verfolgung ausgesendet zu sehen. Mehr und mehr von dieser Angst gefoltert, faßte ich einen entscheidenden Entschluß: nämlich meinen Weg bis nach Lausanne fortzusetzen, wo sich mein Onkel aufhielt. Ich machte mich also wieder auf den Marsch.
In jedem Alter ist die Verbannung eine gar traurige Sache; wie erst für ein Kind, das vom Mutterherde noch nicht fortgekommen. Kaum drei Stunden trennten mich von meiner Vaterstadt, und es schien mir, als sei ich im endlosen All verlassen und hätte jegliche Stütze, jegliche Freistätte verloren. So ging ich mit schwerem Herzen an dem Ufer des Sees hin, der mir vordem von meinem Fenster aus so lachend erschien. Je weiter ich mich entfernte, desto schwächer wurde die Furcht, aber jene Gefühle bemächtigten sich meiner mit immer größerer Gewalt. Zwei oder drei Male setzte ich mich am Rand der Straße nieder, denn meine Traurigkeit war so groß geworden, daß ich mich versucht fühlte, wieder umzuwenden und meinen Lehrer um Verzeihung zu bitten.

Es war zu spät. Außerdem befand ich mich nach meinem Marsche fast eben so nahe bei Lausanne als bei Genf, bei meinem Onkel als bei Herrn Ratin. Dieser Umstand belebte meinen Muth. Die Ruhe kehrte in meine Brust zurück und schon dachte ich wieder an die junge Miß und knüpfte von neuem den Faden der süßesten Träumereien, die mich gestern um dieselbe Stunde so sehr entzückt hatten, an. Inmitten dieser bezaubernden Natur erschien mir ihr Bild unendlich süßer; die Klarheit des Himmels, der Duft, welcher die Berge färbte, die Frische der schönen Ufer gesellte sich hinzu und die Traurigkeit der Verbannung entschwand.
Was für Kraft und Drang ist in der Jugend! Bin ich wol derselbe, den ich eben schilderte? Bin ich jener Jüngling, der leichten Fußes am Ufer hineilt, voll Liebe die azurnen Fluthen betrachtet, die grünen Berge Savoyens, das alte Schloß Hermance und die Luft und die Räume mit den lebendigen Empfindungen, die ihn beseelen, erfüllt?
Bei der Abenddämmerung wendete ich mich von der Straße seitwärts, um bei Bauersleuten ein Obdach zu begehren, welche dafür das einzige Geldstück, das ich besaß, annahmen. Ich theilte ihre Suppe und ihr ländliches Lager und am folgenden Morgen mit Tagesanbruch verließ ich sie, um meine Reise fortzusetzen.
Ich war ohne Mütze fortgelaufen; die Strahlen der Morgensonne verbrannten mein Gesicht. Deshalb blieb ich unter den Thorwegen der Meiereien stehen, um etwas Kühlung zu genießen, bis die Blicke der Meier oder der Vorübergehenden mich aus meiner Zufluchtsstätte fortscheuchten; denn ich fürchtete immer, daß der Verdacht der Verbrechen, welche ich begangen hatte, der Grund ihrer Neugierde wäre, obgleich dieselbe einzig und allein aus meiner Jugend und meiner auffallenden Tracht hervorging.
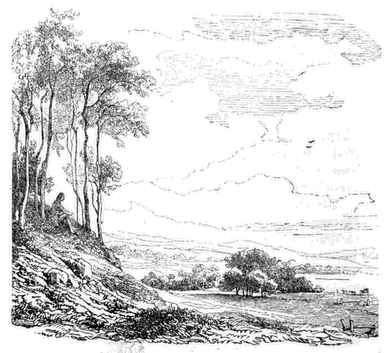
Hinter dem stillen Dorfe Allaman erblickt man rechts von der Straße prachtvolle Eichbäume, die den Saum eines großen Gehölzes bilden. Von ihrem Schatten aus streift der Blick über die ganze Fläche des Sees nach Wallis bis zu den majestätischen Gipfeln der Alpen. Oder nach Genf zu gewendet, ergeht er sich mild über eine Kette von sanften, ferngezogenen Hügeln, deren letzte sich in die Himmelsräume verlieren. Ich konnte dem Reize dieses schattigen Aufenthalts nicht widerstehen, ging hin und setzte mich nieder, um daselbst das Stück Schwarzbrod zu verzehren, womit die Bauern mich versorgt hatten.
Ich dachte an die Wonne, mich bald in die Arme meines Onkels werfen zu können; das Verlangen danach war so heftig, so ungestüm, daß mich bei dem bloßen Gedanken, dasselbe könne getäuscht werden, unbegrenzte Niedergeschlagenheit überfiel. Mein Oheim! mein theurer Oheim! rief ich aus tief ergriffenem Herzen; wenn ich dich nur sehe, mit dir spreche... mit dir beisammen bin...
In diesem Augenblicke fuhr ein Reisewagen auf der Heerstraße hin; sechs Postpferde zogen ihn, in ihrem Laufe lange Staubwolken aufwirbelnd. Der Postillon ließ seine Peitsche knallen, indeß die Dienerschaft nachlässig auf ihren Sitzen schlief. Dieser Wagen war etwa bereits zweihundert Schritte an dem Orte, wo ich saß, vorüber, als er anhielt, ein Diener niederstieg und auf mich zukam.
Ich wollte davonlaufen, da glaubte ich John, den Diener der jungen Miß, zu erkennen. Sind Sie, rief er mich an, der junge Mann, der gestern aus dem Hause an der Peterskirche verschwunden ist?
Ja, antwortete ich ihm.
Wohin?
Zu dem Wagen. Ihr Lehrer ist in schöner Besorgniß!
Wo ist denn mein Lehrer?
Er sucht Sie auf allen Kreuzwegen... kleiner Spaßvogel!

Diese Worte erweckten in mir einigen Verdacht, daß Herr Ratin sich bei den Reisenden befinden könne, so daß ich John nicht folgen wollte, als ich von weitem eine weiße Gestalt aus dem Wagen steigen sah. Schnell erhob ich mich und lief auf die junge Miß zu, damit sie nicht so weit auf der staubigen Straße zu gehen habe; doch als ich mich näherte, hemmten Scham und Aufregung meine Schritte und ich blieb in einiger Entfernung von ihr stehen.
Sie sind Herr Julius, nicht wahr? redete sie mich mit freundlicher Stimme an.
Ja, mein Fräulein.
Ach! Wie die Sonne Sie verbrannt hat. Steigen Sie mit in den Wagen. Ihr Lehrer befindet sich in großer Angst, und es macht mir viel Freude, daß wir Ihnen begegnet sind...
Kommen Sie, Freundchen, sagte der Greis, der den Kopf aus dem Schlage gesteckt hatte, kommen Sie herein, wir wollen ein wenig von Ihrer Geschichte sprechen.... Sie müssen recht müde sein?
Ich stieg ein und der Wagen fuhr weiter.
Ich befand mich in einem so aufgeregten Zustande, daß mir die Worte fehlten. Glückseligkeit, Verwirrung und Scham trieben mein Herz in heftigen Schlägen und durchglüheten mein gebräuntes Antlitz mit brennendem Feuer. Ich hielt den Rest meines Stückes Schwarzbrod noch in der Hand.
Sie haben keine gute Mahlzeit bekommen, wie es mir scheint, sagte der Greis. Sagen Sie mir doch, in welchem Gasthofe sind Sie gewesen?
Bei Landleuten, mein Herr, die mich diese Nacht beherbergten.
Und wohin dachten Sie heute Abend zu gehen?
Nach Lausanne.
Wie, so weit? fiel die junge Miß ein, und im bloßen Kopfe, wie Sie sind.
Vielleicht noch weiter! Allenthalben hin, Fräulein, bis ich meinen Onkel gefunden habe! Und Thränen traten mir in die Augen.
Er hat sonst niemand mehr! sagte sie zu ihrem Vater. Dabei warf sie einen Blick voll Mitleid auf mich, dessen Zauber die kühnsten Träume verwirklichte, welche ich an meinem Fenster gehegt hatte.
Mein Sohn, hub der freundliche Greis wieder an, Sie bleiben bis Lausanne bei uns und wir geben Sie dort in die Hände Ihres Oheims. Sie haben da einen wilden Streich gemacht. Wovor fürchteten Sie sich denn so sehr?
Ach, Herr! ich hatte ja dem Gefangenen die Feile gegeben. Er litt entsetzlich, das können Sie glauben; es war ja nur, um das eine Fußeisen etwas auszufeilen...
Nun, Freundchen, darin sehe ich nichts als das Mitgefühl eines guten Herzens. In Ihrem Alter braucht man noch nicht zu wissen, daß es immer nur zu einem Zwecke ist, wenn ein Gefangener eine Feile leiht. Aber Sie sagen ja nichts von der Werkstatt des Malers; Sie waren es doch, nicht wahr?
Ja, mein Herr. Ich hätte es dem Maler gesagt, meinem Oheim, Ihnen.... aber vor Herrn Ratin hatte ich Furcht.
Ist denn dieser Herr Ratin ein so fürchterlicher Mensch? Aber noch eins, was wollten Sie in dem Zimmer des Malers machen? Hatten Sie das Bild meiner Tochter herumgedreht?
Ich erröthete bis über die Stirne.
Er fing an zu lachen. Ah! ah! das macht die Sache ernst, denn sicher geschah es nicht, um mein Bild zu sehen. Jetzt ist es an dir, Lucy, böse zu werden.
Keinesweges, mein Vater, sagte sie, mit bezaubernder Anmuth lachend. Ich weiß, daß Herr Julius die Künste liebt: er selbst zeichnet mit Talent, also ist es sehr natürlich, daß er die Arbeit eines geschickten Künstlers sehen wollte.
Lucy, fiel der Greis mit sanftem Scherz ein, du brauchst gleichfalls nicht zu wissen, daß, wenn man ein Bild umdreht, worauf sich dein Antlitz befindet, es sehr natürlich aus dem Grunde geschieht, dasselbe zu sehen.... Da er meine Scham bemerkte, setzte er hinzu: Erröthen Sie nicht, mein Sohn, seien Sie überzeugt, daß ich Sie deshalb nicht weniger achte und daß meine Tochter Ihnen verzeiht. Nicht wahr, Lucy?
Eine leichte Verlegenheit folgte diesen Worten, die jedoch nur bei mir allein von längerer Dauer war. Bald hatte ich auf eine Menge von Fragen zu antworten, welche diese liebenswürdigen Personen an mich richteten. Nach dem obigen Gespräche bemerkte ich bei dem Greise eine zunehmende herzliche Fröhlichkeit und zu gleicher Zeit bei der jungen Miß ein wenig mehr Zurückhaltung, doch keinesweges auch geringere Theilnahme und Besorgniß für meine Lage. Ich meinestheils konnte die Augen nicht auf sie richten, ohne mich wie berauscht von ihrem Anblicke und dem süßesten Entzücken durchschauert zu fühlen.
Indeß naheten wir uns der Stadt. Wird Ihr Oheim nicht böse sein? sagte der Greis zu mir.
O nein, mein Herr!.... Und wenn auch, die Freude, ihn wiederzusehen, wird so groß sein, daß mir das wenig Kummer macht.
Liebenswürdiges Kind, sagte Lucy auf Englisch.
Ich will Sie aber doch sogleich in seine Hände abliefern. Eichenstraße, nicht wahr? John! Laß Eichenstraße Nr. 3 halten.
Meine einzige Furcht war, daß wir meinen Onkel nicht zu Hause fänden. Der Wagen hielt an, und ein kleines Kind sagte uns, daß er sich in seinem Zimmer befinde. Ruf' ihn herab, sagte ich zu dem Kinde.
Nein, wir gehen hinauf, sagte der Greis; ist es hoch?
Im ersten Stock, versetzte das Kind.
Und wie bei dem Maler faßte die junge Miß den Arm ihres Vaters und trat mit ihm in die Hausflur, während ich ihre Fußtapfen hätte küssen mögen.

Mein Oheim war eben nach Hause gekommen. Kaum erblickte ich ihn, so eilte ich auf ihn zu und warf mich in seine Arme. Du, Julius! sagte er. Ich überhäufte ihn mit Liebkosungen, ohne einer Antwort fähig zu sein.
Du kommst ohne Hut, mein Sohn, indeß in gutem Geleit, wie ich sehe. Mein Fräulein und mein Herr, haben Sie die Güte, sich zu setzen. Ich ließ seine Hand los, um Stühle herbeizuholen.
Wir wollten nur, mein Herr, bemerkte der Greis, dies Kind, das allerdings einer Unbesonnenheit schuldig, dessen Herz aber ganz brav ist, Ihren würdigen Händen übergeben; er mag Ihnen selbst erzählen, welchen Zufällen wir es verdanken, daß wir ihn zum Reisegefährten hatten und uns die Freiheit nahmen, bei Ihnen einzusprechen. Leben Sie wohl, Freundchen, sagte er und reichte mir die Hand; ich lasse Ihnen meinen Namen hier auf dieser Karte, daß Sie wissen, wer ich bin, wenn Sie jemals mir wieder das Vergnügen erweisen wollen, meine Freundschaft in Anspruch zu nehmen.
Leben Sie wohl, Herr Julius...., sagte das liebenswürdige Mädchen und reichte mir ihre Hand.
Nassen Auges sah ich sie scheiden.

Auf diese Weise fand ich meinen guten Onkel Tom wieder. Nach Verlauf etlicher Tage kehrten wir nach Genf zurück. Er erlösete mich von Herrn Ratin und nahm mich mit sich.
Also war der Anfang meiner Jugend; ich werde in der »Bibliothek« erzählen, wie ich drei Jahre später dieselbe beschloß.

Um meine Ferien nutzreich zu verbringen, hat mein Oheim mir gerathen, den Grotius zu lesen und dann den Pufendorf, um hinterher den Burlamaqui vorzunehmen, der in dem Augenblicke abhanden gekommen war. Also stehe ich morgens früh auf, gehe an meinen Tisch, lasse mich nieder, kreuze die Beine und schlage das Buch auf.... Allein dann geht es mir gar seltsam.
Nach Verlauf einer halben Stunde beginnen Geist und Augen rechts und links abzuschweifen. Anfänglich nur auf den Rand des Quartanten, wo ich einen gelben Punkt auskratze, ein Stäubchen fortblase oder ein Knötchen mit aller möglichen Sorgsamkeit aus dem Papier löse, dann geht es an den Kork meines Dintenfasses, der ganz voll kleiner sonderbarer Merkwürdigkeiten ist, deren jede einzelne mich nach der andern in Anspruch nimmt, bis ich endlich meine Feder in den Ring desselben stecke und ihn in sanftem Schwunge tanzen lasse, was mir unsägliches Vergnügen macht. Hierauf lehne ich mich mit Wohlbehagen rücklings in meinen Sessel, strecke die Beine aus und falte die Hände über dem Kopf. In dieser Lage fällt es mir sehr schwer, nicht irgend eine Arie zu pfeifen, wobei ich mit unwillkürlicher Beharrlichkeit den Bewegungen einer Fliege folge, die durch die Scheiben zu dringen versucht.

Darüber werden mir die Glieder steif und ich erhebe mich, um, mit den Händen in den Taschen, einen kleinen Spaziergang zu machen, der mich in die Tiefe des Zimmers führt. Hier stoße ich auf die finstere Wand und kehre ganz natürlich zu dem Fenster zurück, wo ich mit den Fingerspitzen einen unübertrefflich schönen Wirbel trommele. Doch da fährt ein Wagen vorbei, ein Hund bellt, oder es geschieht gar nichts; ich muß sehen, was es gibt; ich öffne.... Bin ich einmal da, so komme ich sicher nicht sobald wieder weg.
Das Fenster! das ist der echte Zeitvertreib eines Studenten; ich meine darunter einen fleißigen Studenten, das will sagen einen solchen, der weder Schenken noch Taugenichtse besucht. O, so ein wackrer junger Mann! Er ist die Hoffnung seiner Eltern, die ihn ehrsam und gesetzt wissen; seiner Lehrer, die ihn weder die Promenaden besuchen, noch durch die Straßen sprengen, oder am Kartentische sitzen sehen, und mit Wohlgefallen sagen, daß der junge Mann es weit bringen werde. In dieser Hoffnung liegt er ruhig in seinem Fenster.
Dieser er... ohne Bescheidenheit gesprochen, bin ich. Hier verbringe ich meine Tage und wenn ich's sagen soll... Nein, weder meine Lehrer, noch Grotius und Pufendorf haben mir den hundertsten Theil der Unterweisung zukommen lassen, welche ich hier schöpfte, indem ich blos auf die Straße hinabschaute.

Wie überall, so schreitet man auch hier stufenweise voran. Anfänglich ist's einfache Erholungsgafferei. Man schaut in die Luft, man faßt einen Strohhalm in's Auge, man bläst eine Feder, man betrachtet ein Spinnengewebe oder speit auf einen bestimmten Pflasterstein. Diese Dinge nehmen in Betracht ihrer Wichtigkeit ganze Stunden weg.
Ich scherze nicht. Man denke sich einen Menschen, der dies nicht getrieben hat, was ist er? was kann er sein? ein dummes Geschöpf, das rein materiell und äußerlich ist, ohne Sinn, ohne Poesie, der die Straße seines Lebens hinabschreitet, ohne jemals anzuhalten oder vom Wege abzuschweifen, die Umgebung zu betrachten oder sich etwas weiter zu verlaufen; es ist eine Gliederpuppe, die von der Wiege zum Grabe wandelt, wie eine Dampfmaschine von Liverpool nach Manchester.
Ja, die Gafferei ist wenigstens einmal im Leben eine Nothwendigkeit, vorzüglich gegen das achtzehnte Jahr, beim Abgange von der Schule. Hier fängt die auf den Bänken vertrocknete Seele wieder an sich zu beleben, sie macht einen Halt, um sich umzuschauen, sie beschließt ein erborgtes Leben, um ein eigenes anzufangen. Ja, ein ganzer Sommer in diesem Zustande verbracht, scheint mir für eine sorgfältige Erziehung nicht zu viel. Es ist sogar wahrscheinlich, daß ein einziger Sommer nicht ausreicht, einen großen Mann zu bilden. Sokrates ging Jahre lang umher gaffen, Rousseau bis zum vierzigsten Jahre, Lafontaine sein ganzes Leben.
Und dennoch habe ich eine solche Vorschrift in keinem Erziehungsbuche angetroffen.
Diese eben angeführten Beschäftigungen sind also die Grundlage aller wahren, tüchtigen Bildung. In Wahrheit, vermöge derselben erhalten die Sinne eine schuldlose Nahrung, der Geist erlangt dabei zuerst Ruhe und dann Hang zu Beobachtungen und endlich folgerecht und unwillkürlich die Gewohnheit, Begriffe zu ordnen, ihre Verwandtschaft mit einander aufzusuchen und zur Allgemeinheit zu erheben. Und so kommt er von selbst auf jenen philosophischen Weg, den Baco anempfiehlt und den Newton befolgte, welcher eines Tages beim Umherschlendern in seinem Garten einen Apfel fallen sah und die Lehre von der Schwerkraft entdeckte.

Der Student an seinem Fenster entdeckt nun zwar die Schwerkraft nicht, allein vermöge eines ganz gleichen Verfahrens kommen ihm mittelst des Schauens auf die Straße eine Menge von Gedanken in's Gehirn, die, ob an sich neu oder alt, für ihn wenigstens neu sind und deutlich beweisen, daß er seine Zeit nützlich angewandt hat.
Und diese Gedanken stoßen in seinem Hirne mit den alten erborgten Gedanken zusammen und aus dem Stoße sprühen neue Lichtfunken; denn da sein Wesen nicht gestattet, daß er zwischen allen, und besonders zwischen widersprechenden schwankt, so muß er endlich selbst über der Betrachtung eines Strohhalmes vergleichen, wählen, und wird, das ist augenscheinlich, klüger.
Und welche herrliche Weise zu arbeiten ist diese Art, seine Zeit zu vertreiben!

Allein wenn auch, streng genommen, ein Strohhalm genügt, um mit Nutzen herumzugaffen, so muß ich doch gestehen, daß ich dabei nicht stehen blieb; denn mein Fenster bot eine wunderbare Menge von Dingen dar.
Gegenüber ist das Hospital, ein gewaltiges Gebäude, wohinein nichts geht, woheraus nichts kommt, das mir nicht Zoll geben müßte. Ich erforsche die Absichten, ich errathe die Ursachen oder berechne die Folgen. Und nur selten täusche ich mich; denn wenn ich bei jedem neuen Falle die Mienen des Thürstehers befrage, so finde ich darin tausend merkwürdige Mittheilungen über die Leute. Nichts gibt über die geselligen Verhältnisse besser Auskunft als das Gesicht eines Pförtners. Es ist ein Wunderspiegel, worin sich in allen verschiedenen Abstufungen kriechende Ehrfurcht, erhabene Beschützermiene oder grobe Geringschätzung kundgeben, je nachdem der reiche Direktor, der untergeordnete Beamte oder das arme Findelkind sich in ihm abspiegelt. Ein wechselhafter Spiegel, aber treu.

Meinem Fenster gegenüber, ein klein wenig höher, befindet sich der eine Saal des Hospitals. Von dem Platze, wo ich arbeite, kann ich die dunkle Decke sehen; zuweilen steckt der widerwärtige Krankenwärter die Nase gegen die Fensterscheiben und schauet in die Straße. Wenn ich auf den Tisch steige, überblicken meine Augen den jammervollen Aufenthalt, wo Schmerzen, Sterberingen und Tod ihre Opfer auf zwei langen Reihen von Betten ausgestreckt haben. Ein grauenvoller Anblick, zu dem mich nichts desto weniger eine düstere Theilnahme hinzieht, wo bei dem Anblicke eines sterbenden Unglücklichen meine Einbildungskraft zu Häupten seines Lagers schweift, und bald sich zu dem erlöschenden Leben wendend, bald zu der sich öffnenden Zukunft zurückkehrend, sich in dem schwermuthsvollen Reize ergeht, der stets an dem Geheimnisse haftet, womit das menschliche Geschick umhüllt ist.
Links unten in der Straße ist die Kirche, einsam die Woche über, Sonntags angefüllt und von frommen Gesängen ertönend. Auch hier beobachte ich, was hineingeht, was herauskommt, ich fasse meine Muthmaßungen, jedoch mit minderer Sicherheit. Es ist ja kein Thürsteher da. Und gäbe es einen, so wäre mir damit schwerlich weiter geholfen, denn es ist ein Charakterzug des Thürstehers, sich an's Kleid zu halten; darüber hinaus ist er blind, stumm, taub und seine Mienen spiegeln nichts wider. Ich aber möchte die Seele derer kennen lernen, die die Kirche besuchen. Leider sitzt die Seele unter dem Kleide, unter dem Brusttuche, unter dem Hemde, unter dem Fleische, und oft auch ist sie nicht da, sondern schweift umher während der Predigt. Ich tappe alsdann umher, muthmaße, setze voraus und befinde mich dabei auch nicht übel; denn gerade das Schwankende, Unbestimmte, Zweifelhafte ist eben die Nahrung und der Zauber des Umhergaffens.

Rechts ist ein Brunnen, um dessen blaue Fluth Mägde, Burschen, Knechte und Frau Basen Hof halten. Beim Geplätscher des sich füllenden Eimers sagt man sich Süßigkeiten, man erzählt sich das harte Benehmen der Herrschaft, die Unannehmlichkeiten des Dienstes, die geheimen Hausgeschichten. Dies ist meine Zeitung, die um so unterhaltender ist, als ich nicht alles vernehmen kann und oftmals rathen muß.
Oben zwischen den Dächern hin erblicke ich den Himmel, der bald hoch und blau ist, bald grau und von fliegenden Wolken bezogen; zuweilen zieht dann ein langer Vögelzug hin, der zu fernen Gestaden über unsere Städte und Felder wegwandert. Durch den Himmel stehe ich mit der Außenwelt, mit dem Raume und der Unendlichkeit in Verbindung: eine gewaltige Tiefe, wo hinein ich mich, das Kinn auf die Hand gestützt, mit Blick und Gedanken stürze.
Bin ich müde höher zu fliegen, so steige ich zu den Dächern zurück. Da sind die Katzen, die mager und lechzend in der Liebeszeit miauen oder fett und träge in der Augustsonne sich dehnen. Unter dem Dache die Schwalben mit ihren Jungen, die mit dem Frühlinge wiederkommen und mit dem Herbste weiterziehen, immer im Fluge Nahrung suchend und sie der schreienden Brut zutragend. Sie sind über meinen Anblick nicht mehr erschreckt, als über das Gefäß mit Kapuzinernelken im Fenster unter mir.

Endlich die Straße, dieses immer wechselnde, immer neue Schauspiel: hübsche Milchmädchen, ehrsame Rathsherren, muthwillige Schüler; Hunde, die murren oder närrisch spielen; Zugochsen, die Heu kauen und wiederkauen, indeß ihr Herr eins trinken gegangen. Und meint ihr etwa, daß ich meine Zeit unnütz verliere, wenn's regnet? Behüte, da gibt's erst recht zu thun. Tausend kleine Ströme einen sich zu einem starken Bache, der wächst, schwillt an, rauscht dahin und reißt in seinem Laufe allerlei Gegenstände fort, die ich alle einzeln in ihren Sprüngen mit wundersamer Aufmerksamkeit begleite. Oder irgend ein alter zerbrochener Topf sammelt all diese Flüchtlinge hinter seinem weiten Bauche und unternimmt's, der Wuth des Stromes zu widerstehen: Kiesel, Knochen, Späne füllen seinen Raum an und dehnen sich seitwärts aus, es bildet sich ein Meer und der Kampf beginnt. Da wird die Geschichte im höchsten Grade romantisch, ich nehme Partei und fast allemal für den zerbrochenen Topf. Ich spähe weithin, ob ihm Verstärkung kommt, ich zittere für seinen rechten Flügel, der nachgibt, ich fürchte für den linken Flügel, durch den schon eine Lücke gebrochen ist... aber der wackere Veteran hält im Kreise seiner Kerntruppen Stand, obschon die Fluth ihm fast über den Kopf schlägt. Doch wer vermag wider den Himmel zu streiten! Der Regen verdoppelt seine Wuth und der Dammbruch.... ein Dammbruch! welche Augenblicke gehen einem Dammbruch voraus! Das ist in Betreff der unschuldigen Vergnügen das ausgezeichnetste, wie ich's kenne. Blos wenn Damen den Bach überschreiten und ihr feines Füßchen zeigen, da lasse ich den Dammbruch und folge den weißen Strümpfen bis zur Straßenecke mit den Augen. Und das ist nur der kleinste Theil der Wunder, die man von meinem Fenster aus sieht.
Ja, ich finde den Tag manchmal zu kurz, und gar viele Dinge gehen verloren, weil mir's an Zeit gebricht.

Oberhalb meines Zimmers ist das meines Onkels Tom; er sitzt auf seinem Sessel mit Rollen, den Rücken vorwärts gebeugt, und so lange ein Sonnenstrahl seine Silberlocken erhellt, liest er, merkt an, trägt zusammen, ordnet und einverleibt seinem Gehirn die Quintessenz von einigen Tausend Bänden, welche rings in seinem Zimmer herum die Wände bekleiden.
Gerade das Gegentheil von seinem Neffen, weiß mein Onkel Tom alles, was man aus Büchern lernt, und nichts von dem, was man auf der Straße lernt. D'rum glaubt er an seine Wissenschaft mehr als an die wirklichen Dinge selber. Man könnte ihn als Zweifler an seiner eignen Existenz finden, dagegen als Buchstabengläubigen in Betreff so eines dunkeln philosophischen Systems. Sonst ist er gut und unschuldig wie ein Kind, dafür, daß er nimmer mit Leuten gelebt hat.
Drei verschiedene Geräusche zeigen mir fast alles an, was mein Oheim Tom vornimmt: wenn er aufsteht, schreiet die Rolle des Lehnstuhls; wenn er ein Buch nehmen will, rollt die Leiter; hat er sich an einer Prise Tabak erfrischt, so klopft die Dose auf dem Tisch.
Diese drei Geräusche folgen gemeinlich hintereinander und ich bin so daran gewöhnt, daß sie mich in meinen Beschäftigungen wenig stören; aber eines Tages...

Eines Tages kreischt die Rolle, die Leiter rollt nicht, ich warte auf die Dose... auch nichts. Ich wache aus meiner Träumerei auf, gleich dem Müller aus dem Schlafe, wenn das Mühlrad stillsteht. Ich horche; mein Onkel Tom plaudert, mein Onkel Tom lacht... eine andre Stimme... Also doch richtig! sagte ich in großer Aufregung zu mir.
Man muß nämlich wissen, daß ich in meinen Arbeiten am Fenster durchaus nicht bei den Allgemeinheiten stehen geblieben war. Ich hatte mich seit einigen Tagen ganz besonders mit einem Gegenstande beschäftigt, der meine Theilnahme, die ich den übrigen zollte, bedeutend verringerte. Eine Folge dieser Veränderung in der Richtung meiner Arbeiten waren bestimmte Symptome.
Morgens erwarte ich. Um zwei Uhr fängt mein Herz an zu pochen; wenn sie vorüber ist, so ist mein Tagewerk zu Ende.
Früher war es mir nie in den Sinn gekommen, daß ich allein war; denn waren wir nicht, mein Oheim und ich und der Bach und die Schwalben und die ganze Welt; jetzt aber fühle ich mich allein, ganz allein, außer gegen drei Uhr, wo alles um mich herum und in mir auf's neue Leben gewinnt.
Ich habe schon gesagt, wie früher meine Stunden so leicht dahinflossen, heute weiß ich nicht, was ich anfangen soll, ich kann weder arbeiten noch müßig sein, noch auf die Straße schauen, und das ist sehr bedeutsam. Dies geht so weit, daß eines Tages eine große Feder zwei Spannen weit von meiner Nase sich drehete, ohne daß mir nur der Gedanke kam, danach zu blasen. Und solcher Fälle könnte ich hundert anführen.
Statt dessen träume ich jetzt mit wachen Augen. Ich denke, daß sie mich kennt, daß sie mir zulächelt, daß ich ihr gefalle, oder ich suche wol Mittel und Wege ihr etwas zu gelten, ich begegne ihr unterwegs, ich reise mit ihr, ich beschütze sie, ich vertheidige sie, ich rette sie in meine Arme und es betrübt mich ungemein tief, daß ich nicht mit ihr zusammen in einem finstern Walde bin, wo wir von schrecklichen Räubern angefallen werden, die ich in die Flucht schlage und wo ich bei ihrer Vertheidigung verwundet werde.

Doch ich muß wol auch sagen, wer denn dieser Gegenstand war. Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, denn die Worte sind gar ungeschickt, das Bild zu malen, unter dem uns das erste Mädchen erschien, welches unser Herz pochen machte. Das sind frische, lebendige Empfindungen, die einer ganz jugendlichen Sprache bedürfen.
Ich sage also nur, daß sie alle Tage gegen drei Uhr aus einem Nachbarhause kam, die Straße hinabging und unter meinem Fenster vorüberkam.
Ihr Kleid war blau und so einfach, daß schwerlich jemand es unter den vielen andern blauen Kleidern, die vorübergingen, herauserkannt hätte, und ich selber auch nicht, aber ich fand darin eine ganz eigene Anmuth, womit es die jugendliche Gestalt umfloß. Und diese jugendliche Gestalt schien mir ihren Reiz von dem sittsamen Wesen des liebenswürdigen Mädchens, dessen Anblick so süß war, zu empfangen, und ich konnte von dem Kleide unmöglich glauben, daß irgend ein andres, auf hundert Meilen in der Runde, von den ersten Künstlerinnen gemacht, mir besser gefallen hätte.
Sobald also dieses Kleid in meinen Gesichtskreis kam, schien mir alles ringsum ein freundliches, festliches Ansehen zu bekommen, und war dasselbe verschwunden, so bedurfte es für meine seligen Träume noch eines blauen Kleides.

Diesen Tag nun sah ich sie wie gewöhnlich erscheinen und bis unter mein Fenster kommen; meine Augen schickten sich an, ihr bis zur Straßenecke zu folgen und meine Gedanken noch viel weiter: da bog sie ein und trat gerade unter mir in die Hausthür. Ich wurde verwirrt und flog mit dem Kopfe zurück, als träte sie augenblicks in mein Zimmer.
Danach fing ich an zu bedenken, daß sie nach der andern Straße durchs Haus gegangen sei, als sich in der Bibliothek meines Oheims Tom jene bemeldeten ungewöhnlichen Dinge zutrugen, die mich so sehr bewegten. Wie! sie redet mit meinem Oheim!... Und ich strengte mein Gehör auf's unglaublichste an, einige Worte zu erhaschen, da kam ein unvorhergesehenes Ereigniß dazwischen und stürzte die Welt zusammen, die sich um mich zu gestalten begann.
Dieses so wichtige Ereigniß war in der That von höchst geringer Bedeutung: die Leiter rollte und ich hörte meinen Oheim unter fortwährendem Geplauder die Stufen hinansteigen; ich glaubte sogar aus seinem Munde das Wort: Hebräisch, zu vernehmen. Aus diesem allen ging klar hervor, daß mein Oheim Tom es in diesem Augenblicke mit irgend einem gelehrten Hebräer zu thun habe, der mit ihm über irgend eine nichtssagende Gelehrsamkeit verhandelte. Denn wer konnte sich einbilden, daß ihr junger Kopf sich mit wissenschaftlichen Dummheiten befasse, oder daß ihre schöne Hand in einem staubigen Folianten blättern wolle; kein Gedanke daran.
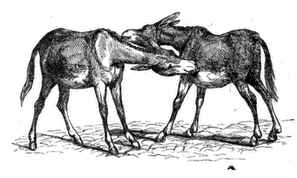
Ich begab mich maschinenmäßig, mit sehr getäuschter Hoffnung, wieder an's Fenster, wie man wol thut, wenn man einen Gedanken hat, der einen sich selber entfremdet. Indeß philosophirten gegenüber im wärmsten Sonnenschein zwei Esel, die zusammen angebunden waren. Nach einer kleinen Weile hoher Bedeutsamkeit stellte der eine Betrachtungen an, was ich aus einem unmerklichen Zucken seines linken Ohrs erkannte, dann streckte er den Kopf vor und zeigte lüstern sein altes Gebiß dem andern. Dieser verstand das Zeichen und hub alsbald eben so an und beide machten sich an's Werk und kratzten sich den Hals mit einer solchen gegenseitigen Dienstwilligkeit, mit einer so wollüstigen Nachlässigkeit, einer so süßen Trägheit, daß ich nicht umhin konnte, mich im Geiste als Dritten zu ihnen zu versetzen. Dies war zum ersten Male seit meiner Fensterträumerei der Fall. Es liegt in der Einfalt gewisser Schauspiele ein unwiderstehlicher Reiz, welcher die Seele sich selber entfremdet und sie ihren süßesten Empfindungen ungetreu macht; daher belustigte ich mich wahrlich daran, als ein blaues Gewand aus der Thür kam. Sie war es. Ha! rief ich, ohne es zu wissen.
Da das Mädchen etwas vernahm, so bog sie den Kopf ein wenig in die Höhe, so daß unter ihrem Hute hervor ihr schöner Blick mich traf, der mich mit Scham, Verwirrung und einem blitzschnellen Entzücken erfüllte. Sie erröthete und setzte ihren Weg fort.
Es ist ein eigener Zauber, daß man in diesem Alter beim Hauch des Windes, beim Rascheln eines Strohhalms erröthet: aber meinetwegen erröthen, das schien mir denn doch eine unbeschreibliche Gunst, ein Umstand, der meine Lage wesentlich veränderte, denn es war das erste Mal, daß etwas zwischen ihr und mir vorging.

Meine Freude verminderte sich übrigens sehr schnell, denn ich kam augenblicklich zu mir selber zurück; sie hatte mich »Ha!« mit aufgesperrtem Munde, mit verwirrtem Auge und mit der Miene eines Verblüfften, der seinen Hut in den Strom fallen sieht, ausrufen sehen. Der Gedanke des ersten Eindrucks, den ich damit auf sie gemacht haben mußte, war mir unbeschreiblich bitter.
Doch man rathe, was sie unter dem Arme trug? Einen Octavband in Pergament, mit silbernem Schloß versehen, eine jämmerliche Scharteke, die ich hundertmal im Zimmer meines Onkels hatte umherliegen sehen und die mir jetzt, so sanft unter ihrem Arm an die Seite gedrückt, das Buch der Bücher schien... Ich begriff zum ersten Male, daß so ein alter Schinken noch zu etwas gut sein kann. Wie weise war doch mein Oheim Tom, daß er sein ganzes Leben lang dergleichen Zeug gesammelt hatte! Ich, wie arm war ich, daß ich nicht der Besitzer dieses glücklichen Buchs gewesen war, dessen Titel ich nicht einmal kannte.

Sie ging quer über die Straße und begab sich geradeswegs zum Hospitalthore, wo sie einige Worte zu dem Pförtner sagte, der sie zu kennen schien und ihr genau so viel von seiner Gewogenheit zukommen ließ, daß sie hineinzugehen wagte. Obschon ich über dies rauhe Benehmen entrüstet war, so fühlte ich doch ein unbeschreibliches Vergnügen bei dem Gedanken, daß das Mädchen meiner Träume nicht allzu reichen oder hohen Standes war und ich mich nicht vor mir selber über die Wünsche, die in meinem Herzen zu keimen begannen, zu schämen brauchte.
Ich empfand ein großes Vergnügen, daß ich sie so nahe bei mir wußte, denn ich hatte schon gefürchtet, daß ich sie bis morgen verlieren würde. Ich brannte vor Begierde zu erfahren, was sie zu meinem Oheim geführt hatte und was sie in's Hospital führen mochte. Für den Augenblick aber fesselte mich das Verlangen, sie wieder herauskommen zu sehen; und ich legte mich in's Fenster und wartete, bis die Nacht gekommen war, da verlor ich die Hoffnung, sie heute noch zu sehen, und stieg eilig zu meinem Oheim Tom hinauf.
Er hatte bereits seine Lampe angezündet und ich fand ihn, wie er mit der größten Aufmerksamkeit eine Phiole mit bläulicher Flüssigkeit gegen das Licht beschauete. Guten Abend, Julius, sagte er, ohne sich stören zu lassen, setz dich, ich bin im Augenblicke fertig.
Ich setzte mich, voller Ungeduld, meinen Oheim zu fragen, und betrachtete die Bibliothek, die mir ein ganz andres Ansehen bekommen hatte. Mit höchster Achtung schaute ich auf die ehrwürdigen Bücher, die Geschwister jenes, welches ich unter ihrem Arme gesehen hatte, und die Gegenstände, die ich sah, die Luft, die ich athmete, erschienen mir anders, als ob der Besuch des Mädchens an diesem Orte Spuren ihrer Anwesenheit zurückgelassen hätte.
So! sagte mein Oheim; nun, Julius, du weißt nicht...
Nein, Oheim!...
Dank einem Mädchen, das hierher kam... Bei diesen Worten ging er zu seinem Tische, indeß ich mein Herz vor Erwartung klopfen hörte; jetzt kam er zurück:
Rathe... sagte er, als wolle er sich an meiner Ueberraschung weiden.
Ich war unfähig irgend etwas zu rathen.
Sie hat mit Ihnen von mir gesprochen? sagte ich mit steigenden: Spannung.
Viel Besseres, versetzte der Oheim mit schlauer Miene.
Sagen Sie, o sagen Sie, Oheim, ich bitte.
Da, schau, meinen Burlamaqui habe ich wiedergefunden!

Ich fiel vom Himmel auf die Erde und sprach im Herzen Verwünschungen gegen Burlamaqui aus, den ich's aus Ehrfurcht statt meines Onkels entgelten ließ.
Ich suchte ein Buch für sie, fuhr mein Oheim Tom fort, und da habe ich Dir dies wieder gefunden, das ich schon verloren gegeben.
Ein liebenswürdiges Kind, fuhr er fort, und ist meiner Treu mehr werth als ein Dutzend von Deinen Professoren.
Der Meinung war ich denn allerdings auch und diese Aeußerung meines Oheims Tom söhnte mich wieder etwas mit ihm aus.
Sie liest Hebräisch wie ein Engel!
Jetzt war es wieder mit mir vorbei! Sie liest Hebräisch? Aber, Onkel... Dieser Gedanke war mir unerträglich.
Es hat mir ein ausgezeichnetes Vergnügen gemacht, sie den Psalm 48 in der Ausgabe von Buxtorf lesen zu lassen; ich hab' ihr auseinandergesetzt, indem ich die Varianten mit der Ausgabe von Crösius verglich, wie sehr der Buxtorf'sche Text vorzuziehen ist.
Das haben Sie ihr in der That gesagt? ihr?
Nun, das ist doch natürlich, denn ich sprach ja mit ihr.
Sie war hier, vor Ihnen, und Sie konnten ihr so etwas sagen!
Ei ja doch; übrigens konnte ich das, was ich ihr sagte, schwerlich einer Andern, als einer Jüdin sagen.
Sie ist eine Jüdin!
Ist es Anderen auch so gegangen, wie mir? Jüdin! schön und Jüdin! Ich fand sie darum gleich zehnmal schöner und liebte sie darum zehnmal mehr.
Es ist wol nicht ganz christlich, indeß muß ich versichern, daß es dennoch so war und daß der Reiz, den ich bereits an ihr gefunden, frischer wurde, lebendiger, als wären dieselben Gegenstände, welche ich an ihr geliebt hatte, auf einmal ganz anders und neu geworden.
Ich weiß ferner, daß ich in diesem Punkte gar übel dachte und daß der schwächste Logiker mich fader Thorheit hätte zeihen können, wie viel mehr mein Oheim Tom; d'rum sagte ich ihm nichts davon, denn ich hatte ein größeres Vertrauen zu meinem Irrthum als zu seiner Logik.
Indeß war der Eindruck, so wie ich ihn beschrieben. Uebrigens... liebt man seine Schwester mit Liebe? Nein. Seine Landsmännin? Weit eher. Eine Fremde? Noch viel mehr. Und nun erst eine schöne Jüdin! Und vielleicht ist sie eine Verlassene, in den Augen der Welt übel angesehen: das war in meinen Augen ein Vorzug, als ob sie mir dadurch näher gebracht würde.
Sie will also Hebräisch treiben? fragte ich meinen Oheim Tom.
Nein, obgleich ich mein Möglichstes that, sie dazu zu bewegen. Es ist wegen eines armen Greises, der im Sterben liegt, sie wollte eine hebräische Bibel von mir leihen, um ihm einige erbauliche Sachen vorlesen zu können.

Sie kommt also nicht wieder?
Morgen um zehn Uhr wird sie mir das Buch zurückbringen.
Und mein Oheim hub auf's neue an, seine Phiole zu untersuchen, indeß ich immer mehr in Gedanken versank. Morgen, hier in diesem Zimmer! sagte ich zu mir; so nahe bei mir, und ich bin ihr nichts! nicht einmal so viel, als mein Oheim Tom und seine Phiole. Traurig stieg ich in mein Zimmer hinab.
Ich war sehr überrascht, als ich mein Zimmer von einem matten Scheine erhellt fand. Ich bemerkte, daß es der Schimmer eines Lichtes war, welches gegenüber in dem Saale des Hospitals, der gewöhnlich zu dieser Stunde finster war, brannte, und stieg auf einen Stuhl, von dem ich zuerst einen Schatten, der gegen die Rückwand des Zimmers fiel, entdeckte. Meine Neugierde wurde dadurch lebhaft angeregt, ich erhob mich zwischen Stuhl und Fenster, und konnte nun tief genug sehen, um an derselben Wand einen Frauenhut zu erblicken. Sie ist's! rief ich aus, den Stuhl auf den Tisch setzend, Grotius und Pufendorf unter den Stuhl und mich oben darauf, das war das Werk eines Augenblicks. Ich hielt den Athem an, um das Schauspiel, welches sich meinen Blicken darbot, besser zu genießen.

Zu Häupten eines bleichen, leidenden Greises sah ich sie fromm und andächtig sitzen, von allem Glanze verschönt, den ihre Jugend und Frische in dieser Umgebung von Krankheit und Alter erhielt; ihre schönen Wimpern neigten sich gegen das Buch meines Oheims, aus dem sie Worte des Trostes las. Zuweilen hielt sie ein, um dem Kranken Ruhe zu gönnen, dann rückte sie ihm die Kissen zurecht oder faßte theilnehmend seine Hand und sah ihn mit einem Mitleid an, welches mir himmlisch schien.
Glücklicher Sterbende! sagte ich, wie süß müssen ihm ihre Worte sein, wie beseligend ihre Sorgfalt!... O! könnte ich meine Jugend und Gesundheit gegen Dein Alter und Deine Gebrechen eintauschen!...
Ich weiß nicht, ob ich diese Betrachtungen mit lauter Stimme anstellte, oder ob es blos Zufall war – in diesem Augenblicke hielt das Mädchen ein, erhob das Haupt und blickte starr zu mir herüber. Ich wurde verwirrt, als hätte sie mich in der Dunkelheit, worin ich mich befand, sehen können, ich machte eine Bewegung nach rückwärts, ich fiel und mit mir stürzten Stuhl, Tisch, Grotius und Pufendorf.
Der Lärm war groß, einen Augenblick war ich betäubt von dem Falle. Eben als ich mich erhob, erschien mein Oheim Tom mit einem Lichte in der Hand.

Was gibt's, Julius? fragte er mich erschreckt.
Nichts, Onkel... ich... da oben an der Decke... (Mein Oheim kehrte den Blick nach der Decke.) Ich wollte aufhängen... (Der Onkel kehrte die Augen ringsumher, um zu sehen, was es denn aufzuhängen gäbe)... und da, als ich... da bin ich gefallen... und da... bin ich hingefallen...
Erhole dich, erhole dich, mein Sohn, sagte der Oheim Tom mit gütigem Tone. Der Fall hat wahrscheinlich deine Gehirnnerven angegriffen, darum ist deine Rede so unzusammenhängend. Er hieß mich sitzen, beeilte sich daneben die beiden Folianten aufzuheben, deren eingedrückte Ecken ihn ohne Zweifel weit mehr ergriffen, als die Unterredung mit der schönen Jüdin. Er legte sie behutsam wieder auf den Tisch und kam dann zu mir zurück: Und du wolltest etwas aufhängen? sprach er und faßte meine Hand in der Weise, daß er seinen Finger verstohlen auf meinen Puls bringen konnte.
Die Frage kam mir sehr ungelegen, denn in Wahrheit gab es in dem ganzen Zimmer auch nicht eine Spur von etwas, was aufzuhängen gewesen wäre. Da ich nun außerdem die nachsichtige Milde meines guten Oheims kannte, so wollte ich ihm alles erzählen bis auf diesen Augenblick, aber ich ließ es sein.
Ich ließ es sein; denn für das, was in meinem Herzen lebte, war Nachsicht schon nicht mehr ausreichend. Ich hätte Theilnahme verlangt und mein Oheim hätte mir keine gewähren können, als für seine abstrakten, wissenschaftlichen Ideen; dies erzeugte ein Widerstreben in mir, ihm mein Herz zu öffnen, ich fürchtete ein Gefühl zu entheiligen, das ich so sehr nach meiner Weise mir zu erhalten strebte.
Ja, ich wollte aufhängen... Ach! mein Gott! schon!
Was gibt's?
Ach! Oheim, es ist vorbei!
Was?
In diesem Augenblicke erlosch das Licht in dem Zimmer des Sterbenden und mit ihm meine ganze Hoffnung.
Meinem Oheim dagegen erschien bei diesem Ausbruche der Fall höchst bedenklich, er veranlaßte mich zu Bette zu gehen und prüfte mich daselbst mit der größten Aufmerksamkeit, indeß ich an das Mädchen dachte, deren Anblick mich entzückt hatte.

Mein Oheim Tom war weit entfernt, die Ursache meines Uebels zu ahnen. Indeß, nachdem er mich anatomisch untersucht und betastet hatte, kam er mit einer Sicherheit, die seiner Wissenschaft Ehre machte, zu der Ueberzeugung, daß meine Knochen im vollständigen Zustande sich befänden. Aller Unruhe über diesen Punkt entledigt, untersuchte er jetzt den Athem, den Umlauf des Blutes und alle Lebensthätigkeiten; darauf ging er zu ganz und gar äußerlichen Anzeichen über und schien endlich seine Wißbegierde befriedigt zu haben, denn er verließ mich mit der Miene eines Menschen, der irgend einen Gedanken zum Ueberlegen im Kopfe trägt.
Es war etwa Mitternacht. Ich blieb allein mit meinen Gedanken, in die ich mich ganz und gar verlor, als das Rollen der Leiter mich aufweckte, und bald darauf schlief ich ein.

Mein Schlaf war sehr unruhig. Tausend Bilder ohne Zusammenhang mit dem Gegenstande meiner Gedanken kreuzten sich, jagten sich vor meinem Blicke; es war weder Schlummer noch Wachen und noch weniger Ruhe. Endlich folgte auf diese Aufregung eine Erschöpfung und meine für einige Augenblicke unterbrochenen Träume kehrten wieder und nahmen eine andere Gestalt an.
Ich träumte, daß ich in einem einsamen Holze ging, leidend aber ruhig, meine Seele von, ich weiß nicht welchem, mich mit unbekanntem Entzücken erfüllenden Gefühle durchdrungen. Anfangs war niemand in meiner Nähe und nichts, was mich an die Wirklichkeit des Lebens hätte erinnern können. Ich war es wol, aber mit Schönheit, Anmuth und allen Vortheilen ausgestattet, die ich im wachen Zustande begehrte.

Ich fühlte mich ermüdet und setzte mich an einem einsamen Plätzchen nieder. Es kam eine Gestalt auf mich zu, die ich nicht kannte, deren Züge aber von dem Ausdruck schwermüthiger Güte belebt waren; ganz unmerklich nahm dieselbe ein mir bekannteres Aussehen an... und endlich war es meine geliebte Jüdin. Auch sie war ganz so begabt, als ich wünschte, und schien ein Gefallen daran zu finden, mich zu betrachten, und obgleich sie nichts sprach, hatte ihr Blick doch eine Sprache, die mich tief im Herzen auf's angenehmste berührte. Ich sah ihr schönes Haupt sich auf meine Stirn neigen, ich fühlte ihren süßen Odem und endlich fand ich ihre Hand in der meinigen. Eine steigende Bewegung durchzuckte mich, mein Traum verlor mehr und mehr seine Ruhe, die Bilder verschwammen durcheinander und wurden ungewiß, und von Antlitz zu Antlitz sah ich zuletzt nichts mehr, als das meines Oheims Tom, der meine Hand gefaßt hatte, um den Puls zu fühlen, und dessen Antlitz auf das meinige herabgebeugt war und mich durch seine Brille betrachtete.
Ja! das Angesicht meines Oheims Tom kam mir in diesem Augenblicke sehr widerwärtig vor! Ich liebe ihn, ich liebe ihn von ganzem Herzen, meinen Oheim Tom; aber von dem süßesten Gegenstande auf's Gesicht seines Onkels gerathen, von den reizendsten Träumen des Herzens zur kalten Wirklichkeit! So viel ist nicht einmal nothwendig, um Leben und Oheim verhaßt zu machen.
Beruhige dich, Julius, sprach er, ich bin deinem Uebel auf der Spur. Und damit fuhr er fort mich zu beobachten und blätterte dabei in einem alten Quartanten, wie um dem Ausspruche des Verfassers gemäß das Mittel nach den Anzeichen einzurichten.
O! ich befinde mich nicht schlecht! Sie täuschen sich, Oheim! Das einzige Uebel ist nur, daß ich aufgeweckt bin. Ach! ich war so glücklich!
Du befandest dich wohl, du befandest Dich ruhig, glücklich?
Ach! ich befand mich im Himmel, warum haben Sie mich aufgeweckt?
Hier belebte eine sichtbare Freude, von einem Schimmer von Stolz und gelehrter Genugthuung untermischt, das Antlitz meines Oheims Tom und ich glaubte ihn sagen zu hören: Schön! das Mittel wirkt.
Was haben Sie denn mit mir angefangen? fragte ich.
Du sollst es erfahren. Sieh, hier habe ich Deinen Fall im Hippokrates, Seite 64 der haager Ausgabe. Jetzt für den Augenblick bedarf es vor allem der Ruhe.
Was?
Ich wußte nicht, wie ich's anfangen sollte, um meinen Oheim darauf zu bringen, daß er mir von der jungen Jüdin erzähle, ohne ihm meine Gefühle für dieselbe merken zu lassen. Und doch hätte ich ihn so gern darauf gebracht.
Nicht wahr, morgen, sagten Sie?... Und ich schwieg.
Morgen?
Sie kommt zu uns.
Wer?
Ich fürchtete schon zu viel gesagt zu haben.
Das Fieber...
Das Fieber?...

So waren denn meine Fragen und Antworten für ihn im höchsten Grade unzusammenhängend und ich vernahm, daß er das Wort: Fieberphantasien flüsterte. Hierauf ging er fort. Gleich darauf rollte die Leiter; ich zitterte. Aber das war alles, was mir in der Lage, aus welcher ich gekommen, wieder vortheilhaft sein konnte. Ich machte unglaubliche Anstrengungen, um meinen Schlummer und den Traum wieder zu gewinnen. Umsonst. Ich konnte nicht einmal die Wirklichkeit, welche mich früher befriedigt hatte, wieder erhaschen: der Traum hatte sie verwischt, ohne daß ich sie wieder herstellen konnte; alles war leer und wüst. Nur erst als meine Gedanken sich auf den nächsten Morgen richteten, konnte ich das Bildniß meiner Jüdin, wie sie vor meinen Träumen war, wiederfinden. Ich stellte mir ihre Ankunft bei meinem Oheim in tausenderlei Weise vor und bildete die unsinnigsten Pläne, wie ich sie sehen, mit ihr reden, mich mit ihr bekannt machen könne.
Meinen Oheim entfernen... selber sie empfangen... mit Ihr sprechen... Aber was sollte ich ihr sagen? Zu wissen, was ich ihr sagen solle, war die erste Bedingung, um meinen Plan möglich zu machen; ich war darüber in großer Verlegenheit, denn zum erstenmale sollte ich von Liebe sprechen. Ich hatte als Vorbilder nichts als ein Paar Romane, welche ich gelesen hatte und in denen man mir so vortrefflich zu reden schien, daß ich daran verzweifelte, zu solcher Vollkommenheit zu gelangen.
O! wenn ich ihr nur den Zustand meines Herzens schildern könnte! rief ich aus. Ich glaube, jedes Mädchen würde die Gefühle, die ich für sie hege, entgegennehmen. Und ich sprang aus dem Bett, um zu versuchen, was ich ihr wol zu sagen vermöchte.

Das Licht wurde angezündet und mir gegenüber stellte ich einen Stuhl, und wandte mich an denselben. Ich sammelte mich einen Augenblick und hub dann folgendermaßen an:
Mein Fräulein!
Mein Fräulein? Das Wort gefiel mir nicht; ein andres? Ich konnte keins finden. Ihr Name? ich kannte ihn nicht. Ich dachte, wenn ich suchte... Ich suchte viel und lange. Nichts fiel mir ein, als »mein Fräulein.« Also gleich beim Anfange blieb ich stecken.
Aber ist sie denn ein Fräulein? Ist sie für mich ein Fräulein, wie die erste beste? Mein Fräulein! Unmöglich! Da müßte ich ja gleich hinterher den Hut ziehen und sagen: ich habe die Ehre u. s. w. Ich setzte mich höchst unzufrieden nieder.
Wol zehnmal begann ich, ohne etwas andres zu finden. Endlich beschloß ich dieser Schwierigkeit zu trotzen und dies Wort auszulassen, ich hob also mit leidenschaftlichem Tone an:
Sie sehen den vor sich, der nur für Sie leben, nur Sie lieben will.... Und von dieser Stunde.... schwöre ich Ihnen mit Herz und....
Ach! mein Himmel, das wird ja ein Vers! Ich bemerkte, daß ich auf einen schlechten Reim losrannte. Voll Verzweiflung setzte ich mich wieder.

Wie schwer ist es doch, seine Gefühle auszudrücken! dachte ich voll Bitterkeit. Was wird mir geschehen? Sie wird lachen... oder gar über meine Tölpelei mitleidig die Achseln zucken und ich bin verloren! Dieser Gedanke war mir entsetzlich und ich verzichtete bereits auf meinen Plan.
Indeß schwellten tausend Gefühle mein Herz, als suchten sie einen Ausweg, und ohne daß ich es wollte, kreuzten in meinem Kopfe eine Masse von Redensarten, Betheuerungen, leidenschaftlichen Anreden, unter deren erdrückender Last ich erlag.
Um mir Erleichterung zu verschaffen, erhob ich mich und ging im Zimmer umher. Mir entschlüpften einzelne Worte, abgebrochene Redensarten:
.... Sie wissen nicht, wer ich bin, und doch erhält mich bereits nichts mehr am Leben als Sie oder Ihr Bild... Weswegen bin ich hier? Ich habe Sie sehen wollen... Ich habe auf die Gefahr hin, Ihnen zu misfallen, Sie wollen erkennen lassen, daß es einen Jüngling gibt, dessen einziger Gedanke Sie sind... Weshalb bin ich hier? Um meine Liebe, mein Geschick, mein Leben zu Ihren Füßen zu legen. Jüdin? Was thut's! Jüdin, ich werde Sie anbeten; Jüdin, ich werde Ihnen allenthalben hin folgen! O meine theure Jüdin, werden Sie irgendwo sonst jemand finden, der Sie liebt, wie ich?... Werden Sie die Zärtlichkeit, die Ergebenheit, das Glück finden, welches mein Herz für Sie bewahrt? Ach! könnten Sie nur die Hälfte von dem, was ich empfinde, theilen, Sie würden den Tag segnen, wo Sie mich zu Ihren Füßen sahen, und noch heute würden Sie mir die Hoffnung lassen, daß ich nicht umsonst zu Ihnen geredet habe...
Erleichtert hielt ich ein; ich hatte in diese Worte einen Theil der Gefühle gehaucht, welche meine Seele durchflutheten, und in dem Feuer, womit ich meine Rede begleitete, glaubte ich das Mädchen zu sehen, wie sie erröthete, von Rührung ergriffen wurde, und wie meine Worte ihr zu Herzen drangen. Ich legte die Hand auf das meinige und fuhr fort: Ach! nein, aus Mitleid gegen einen Unglücklichen verstoßen Sie mich nicht, Sie würden mich in einen Abgrund stürzen! für mich ist Leben, wo Sie sind!... Ha!... Hol ihn der Geier! O mein Onkel! mein Onkel!
Alles war verloren, ohne Rettung verloren und ich war im Begriff, bittere Thränen zu vergießen. Die Leidenschaft hatte mir in meinen eigenen Augen höhern Adel verliehen, auf einige Augenblicke war das Mistrauen in mich selber, jener Widerwille, jene Furcht, welche mir stets die Hoffnung vergifteten, verschwunden. Ich fühlte mich als ein Ebenbürtiger vor meiner Gottheit, und indem ich die Worte aussprach, führte ich meine Hand zum Herzen, welches ich bis auf die Haut brennen fühlte, da... Nein! Ich hätte keinen größern Ekel empfinden können, wenn ich die Hand auf eine kalte Natter, auf eine feuchte Kröte gelegt hätte, ein Zugpflaster lag auf meiner Brust – ich riß das Scheusal weg und schleuderte es von mir.

In diesem Augenblicke trat mein Oheim Tom in's Zimmer, ruhig wie eine Windstille, eine Phiole in der Hand und sein Buch unter dem Arme. Verwünscht sei Ihr Hippokrates! rief ich ihm heftig entgegen, verwünscht Ihre alten Scharteken und alle die... Was haben Sie gemacht? Sagen Sie, Oheim, was haben Sie gemacht?... Zweimal die süßesten Augenblicke meines Lebens vergiftet und was haben Sie da noch? Wollen Sie mich vergiften?
Ueber diese Anrede hatte sich mein Oheim Tom keineswegs entrüstet, vielmehr setzte er die Kette seiner Folgerungen da fort, wo er stehen geblieben war, und in der Meinung bekräftigt, daß der Paroxismus fortwähre, hatte er die Haltung eines scharfen, aufmerksamen Beobachters angenommen; ohne sich im geringsten um den Sinn meiner Worte zu kümmern, forschte er scharfsinnig an meinen Geberden, an der Heftigkeit meiner Stimme, an dem Feuer meines Blicks nach der Beschaffenheit und dem Fortgang meines Uebels, und merkte sich genau alle Anzeichen bis auf die allerkleinsten, um ihnen sogleich zu begegnen.

Er hat das Zugpflaster abgerissen, sagte er ganz leise. Julius!
Was?
Leg' dich hin, mein Lieber; leg' dich, Julius, thue mir den Gefallen. Ich überlegte mir die Sache und hielt es für das Gerathenste, mich hinzulegen, da ich meinen Oheim unmöglich von dem Gedanken abbringen konnte, ich sei närrisch, vorausgesetzt, daß ich ihm mein Geheimniß nicht offenbarte, was in diesem Augenblicke alle meine Pläne vernichtet hätte, ohne daß ihm damit mein gesunder Verstand bewiesen wäre.
Und hier bringe ich ein Tränklein für dich, trink', mein Söhnchen, trink.
Ich nahm die Phiole und indem ich that, als tränke ich, ließ ich den Inhalt zwischen Bett und Mauer niederfließen. Mein Oheim umband mir den Kopf mit einem Tuche, deckte mich bis über die Ohren zu, schloß die Vorhänge und Fensterläden und zog seine Uhr hervor. Es ist drei Uhr, sprach er, er muß bis zehn Uhr schlafen, um zehn Uhr weniger zwanzig Minuten wird es Zeit sein, wieder herabzukommen. Und er verließ mich.
Von Müdigkeit erschöpft, schlief ich einige Augenblicke, allein bald trieb mich meine Aufregung wieder aus dem Bette und ich beschäftigte mich mit Vorbereitungen zu meinem Plane. Ich machte eine Puppe, die mir so ähnlich als möglich sah, band ihr das Tuch meines Onkels um den Kopf und bedeckte sie über und über. Dann schloß ich die Vorhänge, fest überzeugt, daß mein Onkel sie auf das Ansehen des Hippokrates hin nicht vor zehn Uhr öffnen werde, und stellte mich an's Fenster.

Schon gingen einzelne Milchmädchen vorüber; man machte die Fenster auf und die Schwalben waren in voller Thätigkeit. Der Anbruch des Lichts, die Frische des Morgens, der Anblick der gewohnten Gegenstände gaben mir wieder größere Ruhe und zeigten mir mein Unternehmen in einem weit ungünstigeren Lichte; ich schwankte fast. Allein als die Eindrücke meines Traumes mir wieder in's Gedächtniß kamen, da schien es mir, daß auf diesen Plan verzichten, auf alles unwiderbringlich verzichten hieße, was es Herrlichstes in der Welt gebe. Und ich fand meinen ganzen Muth wieder.
Indeß verstrich die Zeit. Ich hatte eben meine Uhr angesehen, als die Stuhlrollen sich hören ließen. Es war neun und drei viertel Uhr. Ich ging rasch davon und ließ meinen Onkel zu dem Puppenmännchen gehen, indeß ich mich leise in die öde Bibliothek begab.
Mit großer Behutsamkeit trat ich hinein und eilte zum Fenster. Als ich so aufrecht hinter den Scheiben stand, die Augen auf die Ecke der Straße gerichtet, von woher sie kommen mußte, fing ich an vor Erwartung und Beklommenheit zu zittern. Um das Unglück voll zu machen, bemerkte ich, daß meine wohlgesetzte Anrede mir aus dem Sinne entschwand und indem ich die einzelnen Stellen daraus festhalten wollte, verfiel ich in so sonderbare Aufregung, daß ich vor Bewegung fast erstickte. Ich sah mich verloren und meine Furcht wurde so heftig, daß ich zu pfeifen anfing, um mich selbst zu übertäuben. In diesem Augenblick schlug die Uhr zehn; ich hegte die Hoffnung, daß, wenn es einmal zehn geschlagen habe, sie heute nicht kommen würde, und zählte die Stundenschläge, deren jeder eine Ewigkeit auf sich warten ließ. Endlich ertönte der zehnte Schlag und ich empfand eine große Erleichterung.
Schon fing ich an, mich zu erholen, als ein blaues Gewand sichtbar wurde. Sie war es!.... Mein Herz pochte, meine Anrede flog davon. Ich hatte keine andere Empfindung, als den allersehnlichsten Wunsch, sie möchte in irgend einer andern Absicht ausgegangen sein, und erwartete mit unaussprechlicher Angst, ob sie vor unserm Hause vorbeigehen oder hineintreten würde. Indem ich so die leichtesten Schwenkungen ihres Ganges beobachtete, zog ich daraus allerlei Folgerungen, die mich abwechselnd mit Freude und Furcht erfüllten, und das Einzige, was mich etwas beruhigte, war, daß sie auf der andern Seite des Baches ging.
Sie schritt über denselben! Und weil die Fensterscheiben mich hinderten den Kopf vorzubeugen, so verlor ich sie aus dem Gesichte. Alsbald sah ich sie auch in meiner Vorstellung in die Bibliothek treten und alle Geistesgegenwart wich von mir. Ich eilte gegen die Thür, um zu entfliehen; allein indem ich durch das Vorzimmer kam, mahnte mich der Schall von ihren Schritten, welche in dem stillen Hofe widerhallten, daß ich ihr hier begegnen mußte. Ich blieb stehen. Sie war da... Beim Schall der Glocke wurden meine Augen trübe, ich schwankte, ich setzte mich hin und war fest entschlossen nicht zu öffnen.
In diesem Augenblicke kam die Katze meines Onkels von einer Dachluke herab auf die Fensterbank gesprungen. Bei diesem Geräusche durchschauerte mich kalter Schrecken, als ginge die Thür mit einem Schlage auf. Das Thier hatte mich erkannt, ich bemerkte mit entsetzlicher Angst, daß es miauen wollte: es miaute!.... da glaubte ich ganz sicher, daß meine Anwesenheit verrathen sei, und ich fühlte, wie Röthe mir über's Gesicht flog. Ein zweiter Glockenzug vollendete meine Vernichtung.

Ich stand auf, ich setzte mich wieder und stand wieder auf, die Augen stets auf die Glocke geheftet, welche ich noch einmal anschlagen zu sehen fürchtete. Ich horchte aufmerksam, in der Hoffnung, daß sie sich wieder entfernen würde; da traf ein anderes Geräusch mein Ohr: es war der Schritt meines Oheims Tom, der in mein Zimmer ging. Jetzt überfiel mich die noch größere Furcht, von ihm mit dem Mädchen zusammen getroffen zu werden, und in der Verwirrung beschloß ich, lieber der Gefahr entgegenzugehen, als sie zu erwarten. Ich zog mich also leise wieder zurück, damit es scheine, als käme ich aus der Bibliothek, hustete, und ging mit einem Schritte, dem die Furcht Festigkeit verlieh, hin und öffnete.... Ihre liebliche Gestalt zeichnete sich im Schattenriß auf dem Halbdunkel der Treppe: Ist Herr Tom zu Hause? fragte sie.
Dies waren die ersten Worte, welche ich von den Lippen der schönen Jüdin vernahm. Sie hallen noch in meinen Ohren wider, so viel Reiz hatte der Ton ihrer Stimme für mich. Obgleich die Frage überaus einfach war, so antwortete ich doch für den Augenblick nicht, jedoch weniger aus Absicht als aus Verwirrung, und schritt höchst linkisch gegen die Bibliothek zu, sie folgte mir nach.

Ohne mich umzusehen, ging ich bis an den Tisch meines Oheims. Ich wünschte, die Tafel möchte recht weit entfernt sein, so sehr fürchtete ich den Augenblick, wo ihr Blick dem meinigen begegnete. Endlich sah ich sie an, sie erkannte mich und erröthete.
Wo war meine Anrede geblieben! Ueber alle Berge. Ich schwieg und war weit röther als sie; weil wir aber so nicht länger gegenüber bleiben konnten, hub' ich folgendermaßen an:
Mein Fräulein... Und da blieb ich stecken.
Herr Tom... versetzte sie und suchte ihrer Verlegenheit Herr zu werden: Ich werde wiederkommen, da er nicht zu Hause ist. Sie verneigte sich leicht, ging davon und ließ mich in einer so übermäßigen Verwirrung stehen, daß ich nicht eher daran dachte, sie zu geleiten, bis sie bereits die Thüre der Bibliothek hinter sich hatte. Jetzt erst eilte ich ihr nach. Sie war verwirrt, ich auch; und als wir in der Dunkelheit der Hausflur beide die Thür öffnen wollten, begegneten sich unsere Hände – ein Wonneschauer durchzuckte meinen ganzen Körper. Sie ging; ich blieb allein, allein in der weiten Welt.
Kaum war sie fort, da kam meine Anrede ganz und gar wieder. Ich schalt mich über mein linkisches Wesen, meine Dummheit, meine Verlegenheit. Denn damals wußte ich noch nicht, daß diese Verlegenheit, diese Unbeholfenheit gleichfalls ihre Sprache habe, die bei vielen Frauen sehr großen Eindruck macht und weit schwieriger nachzuahmen ist, als jede andere. Indeß erinnerte ich mich bald an den Ausdruck ihrer Mienen, ihre Verwirrung, ihren Blick, und wurde dadurch weit zufriedener gestellt. Ich eilte wieder an das Fenster, um sie gehen zu sehen, da hörte ich die Thüre hinter mir sich öffnen. Kaum hatte ich Zeit, um auf das Bett meines Oheims zu springen, wo ich mich hinter den alten grünen Vorhängen, die jegliches Licht von demselben abhielten, verbarg.

Aber, mein liebes Kind, was Sie mir sagten...
Ein junger Mensch, ich versichere Sie, Herr Tom.
Ein junger Mensch! der Unverschämte! Und wie benahm er sich?
Er benahm sich gut. Er sah gar nicht unverschämt aus, Herr Tom.
Das bleibt sich gleich... denn sehen Sie, so sich hier als Herr zu benehmen...
Vielleicht ein Bekannter von Ihnen...
Ich oder mein Neffe; sonst niemand.
Ich glaube... der war's, sagte sie mit leiserer Stimme und niedergeschlagenen Augen.
Er! Eben diesen Augenblick habe ich ihn verlassen! in dem Zimmer hier unten!... Und, sagen Sie mir, kennen Sie denn auch meinen Neffen?
Hier trat eine Pause ein, eine ewig lange Pause.
Sie erröthen, hübsches Kind!... Nun, verlassen Sie sich darauf, es gibt deren genug, die nicht so brav... auch nicht so liebenswürdig... Doch sagen Sie, woher kennen Sie ihn?
Mein Herr... Sie sagten, daß er unter Ihrem Zimmer wohne. Hier habe ich zuweilen am Fenster... denselben jungen Mann gesehen, der mich hier empfing.
Unmöglich, sage ich Ihnen. 's ist allerdings mein Neffe, den Sie am Fenster gesehen haben, denn da verbringt er den ganzen lieben Tag; doch daß er hier gewesen sei, nein, daran ist er ganz unschuldig, der arme Julius. Ich will Ihnen auch sagen warum. Gestern Abend gegen neun Uhr war der Wildfang auf ein hohes Gerüst geklettert, ohne daß ich begreifen kann weshalb, es müßte denn sein, daß es wegen einer Narrethei im Hospitalsaale gegenüber gewesen. (Hier wurde die Verwirrung des Mädchens immer größer, sie wendete das Antlitz seitwärts zu mir her, um ihr Erröthen vor dem Oheim zu verbergen.) Und auf einmal krack!... ein gewaltiges Gepolter, ich laufe hinzu und finde ihn an der Erde liegen; es war so arg, daß ich ihn zu Bett brachte, wo er sich noch befindet... Doch ja, sehen Sie, was ich glaube. Einem jungen Mädchen von Ihrem Aeußern wird schon immer von jungen Leuten nachgegangen. Ein solcher nun, so ein Verwegener... verstehen Sie?... ist Ihnen voraufgegangen. Nun, nicht so schamhaft, mein Kind, nicht so schamhaft; es ist keine Sünde, wenn man hübsch ist... Lassen wir's aber, wenn es Sie in Verlegenheit setzt, ein ander Mal schließe ich meine Thüre besser. Sprechen wir von anderen Dingen. Sie bringen mir mein Buch zurück? Hm! was sagen Sie zu dem Text? Halt einmal, legen Sie das Buch da hin und warten Sie einen Augenblick. Ich will... Warten Sie ein wenig. Und er ging in ein Seitengemach, das zur Bibliothek führte. Ich zitterte, denn dies für gewöhnlich verschlossene Gemach war durch eine geheime Treppe mit meinem Zimmer verbunden.
Ich blieb allein mit ihr. Ich war der einzige Zeuge neben ihr für einige Augenblicke: das schien mir eine unschätzbare Gunst, gleich als ob Sie mir ihr Herz erschlossen hätte. In ihren Zügen, in ihrer Haltung, den geringsten Bewegungen glaubte ich ähnliche Dinge zu lesen, wie sie vor einem Augenblicke in mir vorgingen. Geheimnißsüße Augenblicke! Augenblicke wonniger Stille, wo mein Herz in der Wirklichkeit einige Bilder meines Traumes fand!
Zum ersten Male sah ich sie so nahe und konnte mich an dem Zauber weiden, den ich in ihr entdeckte. Daß ich es nicht in diese Zeilen hauchen, es nicht malen kann, wie sie mir erschien! Und die Bibliothek meines Oheims schien ein Wunderrahmen zu sein, der ihre glänzende Schönheit noch erhöhte. Die ehrwürdigen Bücher, die Reihenfolge der Alter vertretend, auf den staubigen Gestellen, der alterthümliche Duft, das studirzimmerliche Schweigen und mitten darin diese junge Blume voll Frische und Leben... das sind Dinge, die sich nicht in Worte fassen lassen.
So lange hatte sie aufrecht gestanden und ging jetzt, sich neben dem Fenster auf den Lehnsessel meines Oheims niederzusetzen. Sie stützte die Wange auf die schöne Hand und sendete den Blick nachdenklich-schwermüthig gen Himmel; ein Lächeln flog leicht wie der Odem über ihre Lippen. Dann streiften ihre Blicke nachlässig über den dicken Folianten, von dem mein Oheim aufgestanden war. Nach und nach blieben sie darauf haften, ihr bescheidenes Antlitz überzog lebhafte Röthe und eine steigende Theilnahme malte sich darauf. Ich hab' es! rief in diesem Augenblicke mein Oheim Tom; sie erhob sich, ohne jedoch die Augen von dem Folianten abzuwenden, bis mein Onkel in die Bibliothek getreten war.

Da ist es! Das hat Mühe gekostet. Ich schenke es Ihnen wegen Ihrer Liebe zu dem Hebräischen, ich behalte das andere, das für mich größern Werth hat, weil ich sehr auf den Text halte. Dieses mit dem Saffianbande paßt besser für Ihre zarten Finger; nehmen Sie es und erinnern Sie sich dabei an den Doktor Tom.
Sie sind zu gütig, mein Herr. Ich nehme Ihr schönes Buch an und werde immer Ihrer gedenken, obschon ich nicht hoffen darf, daß ich Sie wieder besuchen werde.
Ja, sagte mein Onkel lächelnd, aus Furcht vor dem bösen Neffen. Gut, daß ich darauf komme, ich hätte den meinigen fast vergessen... Leben Sie wohl, auf Wiedersehen.
Er gab ihr das Geleit. Bereits war der Foliant, welcher ihre Blicke gefesselt hatte, in meinem Besitz; allein ich zitterte, mein Oheim möchte mir nicht Zeit genug gönnen zu entschlüpfen, glücklicherweise hatte er die Thüre des Seitengemachs offen gelassen; ich stürzte hier hinein. Im Nu war mein Buch in Sicherheit; die Kleiderpuppe unter dem Bett und ich auf demselben, wo ich meinen guten Oheim Tom erwartete, der gleich darauf eintrat.
O! o! Schon auf? fragte er. Und wann aufgewacht?
Schlag zehn Uhr, lieber Onkel. Die vollständigste Genugthuung malte sich bei diesen Worten auf dem Gesichte meines Oheims Tom. Er war vergnügt, mich wiederhergestellt zu sehen, mehr aber noch war er es der Ehre willen, die seine Wissenschaft daraus erntete. Er nahm einen feierlichen Ton an: Jetzt, Julius, will ich dir sagen, was du hattest. Eine Hemicephalalgie.

Glauben Sie, Oheim?
Ich glaube es nicht, Julius, sondern ich weiß es, und weiß es ganz sicher; denn ich bin nicht ein Jota vom Hippokrates abgegangen. Durch den Fall und die Erschütterung des Gehirns entstand ein Austreten der inneren Ausscheidungen der Gehirnhaut. Und weißt du wol, in welchem Zustande ich dich gefunden habe? Uebermäßig schneller Pulsschlag, stierer Blick, vollständiges Irrereden. Ueberdies.... das Zugpflaster....
Ach! mein Oheim, reden Sie nicht mehr davon und erzählen Sie es Niemanden.
Das Zugpflaster hat ein leichtes Durchsickern erzeugt; es geht besser; indeß scheint das Fieber noch nicht verschwunden. Nun kommt mein Kühltrank.
Ja, Oheim!
Jetzt tritt ruhiger Schlaf ein...
O freilich, Onkel; ausgezeichnet.
Ein vorhergesehener, vorausgesagter, prophezeiter Schlummer von ein Uhr Nachts bis zehn Uhr Morgens. Und jetzt bist du auf dem Wege der Genesung!
Vollständig genesen, mein Oheim.
Nein; und vor allen Dingen müssen wir einen Rückfall vermeiden. Du verhältst dich ruhig, indeß ich dir ein leichtes Senfpflaster bereite; später wollen wir sehen. Ruhe dich aus und arbeite heute nicht. Versprich mir das.
Sie können darauf rechnen.
Sobald mein Onkel gegangen war, machte ich mich über den Folianten. Aber ich gerieth in eine neue Verlegenheit. Das Buch hatte zweitausend Seiten und in meiner Eile hatte ich die einzige davon, die meine Theilnahme erregte, zu bemerken vergessen. Dieses Ungeheuer durchblättern? es ist darin ein Gedanke, ein Wort vielleicht nur, welches sie anziehen konnte, und dieses Wort unter einer Million anderer zu entdecken! Und dennoch trieb mich eine unbesiegliche Begierde an, danach zu suchen, gleich, als ob mein Schicksal von dieser Entdeckung abhange.

Ich ging an's Werk. O! welch unsinniges Zeug kam mir vor Augen und welchen Eifer zum Studium hatte ich dabei! Wenn mein Onkel mich gesehen, oder nur mein Professor! Eifriger, junger Mann, zügeln Sie Ihre Hitze, hätte er mir gesagt; Sie treibens zu stark.
Es war eine Sammlung von alten Chroniken des Mittelalters, worin manch fabelhaftes, verliebtes Abenteuer berichtet war; manches Wappenstück, Anmerkungen, Urkunden; ein buntes Gemisch im Geschmacke meines Oheims. Ich fand indeß mancherlei darin, welches sie und mich ansprechen konnte, doch nicht mehr als jeden Andern; so kam ich bis zur zweihundertsten Seite.
Darüber schrien die Stuhlrollen, die Leiter rollte, eine ungemeine Bewegung gab sich in dem Zimmer meines Oheims kund. Es war klar, er suchte umsonst, indeß ich mich mit dem Nachschlagen befaßte. Mir kam ein Gedanke... Ich stieg hinauf.
Wirklich befand sich mein Oheim in einem bejammernswerthen Zustande, wie eine Löwin, welcher... Ich will sagen, er irrte umher und suchte seine Scharteke, die er von seinen Fächern, von seinem Tisch, vom Himmel wieder verlangte. Verwirrung und Unordnung war in sein stilles, ruhiges Bereich gedrungen.

Bestohlen! ich bin bestohlen, Julius... und verloren! (Er erklärte mir dies.) Das Buch ist von unbeschreiblichem Werthe, unersetzbar, und ich war gerade auf derselben Seite im Begriff... aber ich habe meinen Gewährsmann verloren! o, Libanius! du siegst!
Unmöglich! es muß durchaus... laßt nur sehen... was für eine Seite, Onkel?
Ha! weiß ich's! Drei Jahre Streit über die Bulle Unigenitus und im Hafen Schiffbruch leiden!
Die Bulle, sagen Sie?...
Unigenitus!
Unigenitus! Ja, das ist abscheulich. Und diese Seite...
Gab die Bulle mit einer Variante, die sich sonst nirgends findet.
Und weiter nichts?
Wie, Du, Du findest das nicht genug! Ich gäbe alles was ich habe für diese Seite. Aber ich werde sie wieder bekommen. Nur eine Person konnte es thun... sie soll mir schon sagen, wer der Gesell ist, der die Folianten wegholt... Geschwind!
Und der gute Onkel setzte seine Perrücke zurecht, nahm sein altes Rohr, setzte den dreieckigen Hut auf und ging. Auch ich stieg hinab und wiederholte für mich ganz leise: Bulle Unigenitus, Bulle Unigenitus, aus Besorgniß das Wort zu vergessen.
Bulle Unigenitus, Bulle Unigenitus, sagte ich und durchblätterte meinen Folianten. Bulle Unigenitus... Da ist sie! in dicken Buchstaben. Es war Latein: entsetzliche Täuschung. Seit diesem Eindrucke habe ich stets einen Widerwillen gegen das Latein empfunden, das ich, aufrichtig gesagt, vorher auch nicht liebte. Da ich indeß bemerkte, daß die Bulle mitten auf der Seite anfing, so richtete ich meinen Blick auf das Vorhergehende. Ich las:
Was massen die Kastellanen von Amgrivois
auf die Linie der Chauvin gelangte
durch Verheyratung des edlen Herrn von
Saintree mit der Henriette von Entragues.
Der edle Junkher war noch niemalen von Liebe betroffen gewest. Also geschahe es, da der Bart ihm zu keimen begunnte, dass er Henrietten in dem Schlosshofe sahe und vieles vergnügen daran fassete sie anzuschauen, fein wie sie war und von vorteillhafftem Gesichte; undt schöpfete aus solchem Beginnen ein Liebesleid, nicht vermögend ein ander Ding zu denken bei Tag- und Nachtzeiten. Wusste aber mit nichten wie es ihr kund geben, sintemahlen er noch ganz unerfahren in angelegenheiten der Liebe. Und keck und ohn forcht als er unter den Junkhern war, so war er vor dem Angesicht eines Fräuleins links und schlecht beholfen. Also fassete er sich, da er immer heftiger entbrannte, nahm sich ein Muth und stellete sich in das Gemach seines Ahns, da sie musste hinkommen, und wollete mit einem Strauss ihr ein gar glänzend Zeugniss der Flamme verleihen, darinnen er um ihre schönen Augen brannte. Und so lang als sie nicht kame, war er wundersam fertig ihr zu reden undt sein sträusslein zierlichstermassen zu überreichen. Da indessen Henriette eintrat, er eiligst selbiges unter die Tafel warf und stumm wurde, links und übler befangen, denn ein edelknabe über einem Fehler ertappet. Henriette ihren theils hatt' es wohl gesehen sammt den dichten Strauss und ward gar wundersam roth, und solche waren sie einander gegenüber roth wie ein paar Feldmohn und unvermächtig etwas zu sagen. Und sie wären da noch ohne den Ahn, der eintrat: Was machet ihr hinnen?... u. s. w.

Ich las und las tausendmal diese Seite, ich war vor Freude entzückt, denn da ich in meinem Geiste die schlichten Ereignisse dieser Geschichte mit dem verglich, was ich in den Mienen meiner Jüdin gelesen hatte, mußte ich allerdings glauben, daß meine Schüchternheit und mein unbeholfenes Wesen ihr nicht misfallen hatten, wie ich aus ihrer Unterhaltung mit meinem Onkel annehmen durfte, daß meine Aufmerksamkeit, wie mein Gesicht am Fenster ihr nicht entgangen waren! Wir hatten uns also verstanden; ich war also tausendmal weiter, als ich glaubte, und konnte mich fernerhin dem Hange meines Herzens hingeben, ohne durch die Schwierigkeiten eines ersten Schritts oder die Furcht, ihr fremd zu sein, beschränkt zu werden. Das erste, was ich that, war, daß ich eine genaue Abschrift dieser theuern Zeilen nahm; dann benutzte ich, da mir der Kummer, den ich meinem Oheim gemacht hatte, schwer auf dem Herzen lag, die Abwesenheit desselben, um das Buch wieder hinaufzutragen, wo ich es so zwischen die andern steckte, daß er glauben mußte, er habe es selber verkramt.
Ich kehrte in mein Zimmer zurück und schloß mich ein, um ungestörter allein mit meinen Gedanken zu sein, die mir heute eine wunderliebe Gesellschaft waren. Ich durchging in meinem Geiste stets dieselben Dinge, um neue Seiten an ihnen zu entdecken, bis ich endlich ermüdet von dem gethanen Schritte abließ, um zu bedenken, was weiter zu thun: denn mein Loos an das ihre ketten war von da an das einzige Ziel meines Lebens.
Ich zählte achtzehn Jahr. Ich war Student, ohne Stand, ohne andere Mittel als die Güte meines Oheims. Allein diese Schwierigkeiten kümmerten mich wenig, und ich beseitigte sie in tausenderlei Weise, wie es der Muth eingibt, den die Gewalt einer großen Liebe verleiht. Hingebung, Aufopferung, unbestimmte Ruhmbegierde schwellten mein Herz und erhoben mich zu meiner theuern Jüdin; ich erhielt ihre Hand und vermochte ihr ein Loos zu bieten, wie sie es verdiente. Oder wenn ich bedachte, wie weit ich noch von diesen glänzenden Verhältnissen entfernt sei, so wünschte ich, sie solle arm, von niederem Stande, verlassen sein, so daß sie durch eine Vereinigung mit mir nur gewinnen könne; ich dachte wieder an die geringschätzige Miene des Pförtners, die jetzt meine einzige Hoffnung wurde.
Es war Sonntag. Die Glocken riefen die Gläubigen zum Tempel; ihr eintöniger Schall brachte Ruhe in meine Seele. Sie schwiegen und die Stille der Straßen verlieh meinen Gedanken, die sich über alle Hindernisse hinaus erhoben hatten, höhern Muth. Die Melodien der Kirchengesänge, die ernsten Töne der Orgel gesellten sich sanft zu meinen Träumereien und ich sah unvermerkt mich selber in der Mitte der Gläubigen, im Genuß eines ruhigen Glücks neben meiner Gefährtin, wie wir beide aus demselben Buche ablasen, wie sie ihre schönen Wimpern auf das Blatt senkte, wie ihr Athem sich mit dem meinigen vermischte und ein süßes Glück unser Theil auf dieser Welt und unsere gemeinsame Hoffnung in der andern war.
Aber eine Jüdin in der Kirche! Nein, dieses Bedenken kam mir nicht an. Ein trunkenes Herz kleidet seine Träume nur mit seinen Wünschen und Bildern aus, mit dieser angenehmen, gefälligen Gesellschaft, welche seinem Fluge nirgends wehren. Ach! ich bin seitdem wieder auf die Erde gekommen; ich bin im Geleit der Wirklichkeit gewandelt, unter der Zuchtruthe des Verstandes und der Vernunft; sie alle zusammen, diese strengen Lehrer, haben mir nicht einen Augenblick gegeben, der sich mit den himmlischen Regungen von damals vergleichen könnte. Warum müssen doch solche Augenblicke so kurz sein und sich nicht wiederfinden!
Ich kannte den Namen, die Wohnung jener nicht, die sich meines ganzen Seins bemächtigt hatte. Ich erwartete mit steigender Ungeduld die Stunde Montags. Sie erschien nicht. Dienstag und Mittwoch vergingen eben so. Ich hörte, daß seit zweien Tagen der Kranke, den sie gepflegt hatte, todt war. Am Freitag war ich voll Ungeduld zu meinem Oheim hinaufgegangen; ein Unbekannter klopfte an die Thüre und überbrachte ihm ein Päckchen.
Mach' es auf, Julius! sagte er.
Ich öffnete. Es war das Buch in Saffianband. Auf der innern Seite des Umschlags standen die Worte zu lesen:
Wenn ich sterbe, bitte ich dies Buch an Herrn Tom zu geben, von dem ich es habe.
Wenn Herr Tom mir einen Gefallen erzeigen will, so gebe er das Buch seinem Neffen zum Andenken an diejenige, welche er in der Bibliothek empfangen hat.
Wenn sie stürbe! rief ich aus; sie, sterben!
Armes Kind, sagte mein Oheim Tom; was kann ihr zugestoßen sein?
Wo wohnt sie, Onkel?
Wir wollen zusammen gehen, um uns nach ihr zu erkundigen.
Einen Augenblick darauf befanden wir uns in der Straße. Es regnete. Wir waren fast die Einzigen, welche draußen gingen. Beim Umbiegen um eine Straßenecke sahen wir einige Leute; mein Oheim blieb stehen... Was gibt es? sagte ich; weshalb gehen wir nicht... Armer Julius, es ist zu spät! Es war der Leichenzug: vor zwei Tagen hatten die Pocken sie hinweggerafft!
Am nächsten Tage begann ich wieder zu schauen und zu sinnen: eine Träumerei voll Bitterkeit und innerer Leere, fade Muße, Widerwillen gegen die Welt, die Menschen, das Leben selber, ohne den Reiz irgend einer Erinnerung. Statt aller Gesellschaft, als einzigen Freund, hatte ich das kleine Buch, und wenn ich die Zeile gelesen, die für mich bestimmt war, drückte mir die Wehmuth das Herz, bis die Thränen mir aus den Augen strömten und mich erleichterten.

Mein zweiter Freund war mein Oheim Tom. Ich erzählte ihm alles, und als ich ihm meinen Streich, den ich ihm gespielt, erzählte, fand ich in seinem Herzen nur Nachsicht und Güte. Meine Trauer rührte ihn und auch er nahm seinen Theil daran, ohne sie ganz zu verstehen. Und wenn er am Abend mich düster sah, so rückte er leise seinen Stuhl neben den meinigen und wir saßen schweigend neben einander, beide in einem Gedanken vereint. Ein so verständiges Mädchen, sagte er in seiner treuherzigen Einfalt, in Pausen.... ein so hübsches Mädchen.... ein so junges Mädchen! Und bei dem Schimmer des Kamins sah ich eine Thräne seine alten Wimpern feuchten.
Endlich kam die Zeit auch mir zu Hülfe, sie gab mir die Ruhe wieder und andere Freuden, aber nie eine ähnliche: ich hatte meine Jugend zu Grabe getragen.


Wie ist doch das Herz treu, so lange es jung und rein ist! Wie ist es so zartfühlend und aufrichtig! Wie liebte ich diese Jüdin, welche ich kaum gesehen und so bald wieder verloren! Welch engelgleiches Bildniß ist mir von diesem zerbrechlichen Wesen, dem reizenden Verein von Anmuth, Zucht und Schönheit, geblieben!
Der Gedanke an den Tod erwacht langsam, nach und nach; in den ersten Tagen des Lebens hat sein Name keinen Sinn. Für die Kindheit ist alles in der Blüthe, im Entstehen, eine Schöpfung von gestern; für den Jüngling ist alles Kraft, Jugend, überströmendes Leben. In der That, einzelne Wesen verschwinden aus dem Gesichte, aber sie sterben nicht.... Sterben! das will sagen, für immer der Freude verloren sein; den lachenden Anblick der Fluren, des Himmels, selbst den Gedanken daran verlieren, welchen so glänzende Hoffnungen, so lebendige, wahre Gebilde erfüllen!!...
Sterben! das will sagen, die Glieder, welche von Kraft strotzen, von Leben glühen, die frisches Blut röthet, schwach werden, eisig erkalten, in entsetzliche Blässe sich auflösen sehen.
Unter die Erde dringen, das Leichentuch aufheben, dieses wurmzerfressene Fleisch anschauen, die staubzerfallenen Gebeine... der Greis kennt diese Bilder, er verscheucht sie, aber den Jüngling treten sie niemals an.
Er verliert die, welche er liebt, er weiß, daß er sie nicht wiedersehen wird, er begegnet ihrem Leichenzug, er weiß, daß sie unter diesen Bretern, unter diesem Hügel liegt... aber es ist immer noch sie, unverändert, ewig schön, rein, reizend mit dem verschämten Lächeln, dem schüchternen Blick, der ergreifenden Stimme.
Er verliert die, welche er liebt, sein Herz erstickt oder strömt glühende Seufzer aus; er sucht, er ruft die, welche ihm entrissen worden; er redet zu ihr, er legt ihrem Schatten das ihr eigenthümliche Leben, die ihr eigenthümliche Liebe bei, er sieht sie vor sich stehen.... es ist immer noch sie, unverändert, ewig schön, rein, reizend mit dem verschämten Lächeln, dem schüchternen Blicke, der ergreifenden Stimme.
Er verliert die, welche er liebt. Nein, er trennt sich von ihr, sie befindet sich an irgend einem Orte und dieser Ort ist durch ihre Gegenwart verschönt; er ist
alles ist daselbst Schönheit, Liebe, mildes Licht, keusches Geheimniß...
Und dennoch! An dem Orte, wo sie sich befindet, ist die Nacht, die Kälte, die Nässe, der Tod und seine widerwärtigen Gehilfen in vollster Thätigkeit!
Der Gedanke an den Tod erwacht langsam, nach und nach. Aber ist er einmal in die Seele des Menschen gedrungen, so verschwindet er nicht wieder. Vordem war seine Zukunft Leben; jetzt ist der Tod das Ende aller seiner Pläne, derselbe drängt sich von nun an in alle seine Unternehmungen. Er denkt an ihn, wenn er die Scheune füllt, er zieht ihn zu Rathe, wenn er Güter erwirbt, derselbe drängt sich auf, wenn er seine Pachten abschließt; er setzt sich einsam mit demselben in sein Gemach, um sein Testament zu machen, und unterzeichnet dasselbe mit ihm.
Die Jugend ist hochherzig, empfänglich, muthig... und die Greise nennen sie verschwenderisch, unüberlegt, tollkühn.
Das Alter ist haushälterisch, bedachtsam, vorsichtig... und die Jünglinge heißen es geizig, selbstsüchtig, zaghaft.
Aber warum beurtheilen sie einander, wie können sie sich beurtheilen? Sie haben keinen gemeinschaftlichen Maßstab. Die Einen berechnen alles auf's Leben, die Anderen alles auf den Tod.
Dieser Augenblick, wo der Lebenshorizont des Menschen wechselt, ist bedeutsam. Die eben noch so fern am Himmel schwebenden Gebiete ziehen näher, das phantastische, glänzende Gewölk wird dicht und regungslos, die azurnen und goldenen Räume zeigen nur noch die Nacht hinter kurzer Dämmerung... O! wie verändert sind die Verhältnisse! wie bedeutungslos erscheint dem Menschen alles, was er gethan! Er begreift nun, daß sein Vater ernst, daß sein Großvater finster war und Abends, wenn die Spiele begannen, sich zurückzog.
Er selbst fühlt sich bewegt; dieser neue Gedanke arbeitet in seinem Herzen und weckt die Erinnerung an viele Worte, viele Dinge, deren düstern Sinn oder trostreichen Zauber er früher nicht begriff....
Es war einmal in den Tagen seiner ersten Jugend, an einem Sonntage; er sah, er hörte der Zecher fröhliche Lust, wie sie in der Weinlaube saßen, das Leben feierten und dem Grabe Hohn sprachen; man lachte, man trank, man erheiterte sich das kurze Dasein und unter dem Laube heraus rauschte in fröhlicher Weise das Lied durch die Lüfte:
Und der Chor wiederholte mit vollem, wogendem Klange:
Vor Jahren, vor langen Jahren war's einmal auf steinigem Acker, ein schwacher Greis beugte sich unter der Last seiner schweren Arbeit. Im Brande der Sonne machte er eine unfruchtbare Haide urbar; der Schweiß rann ihm von der kahlen Stirne und die Hacke zitterte in seiner dürren Hand.
In dem Augenblick kam ein Reiter den Rain entlang. Beim Anblicke des Mannes zügelte er seinen Lauf: Ihr habt wol Eure liebe Noth? fragte er. Der Greis hielt ein und gab durch eine Geberde zu erkennen, daß ihm die Noth nicht fehle; dann nahm er die Hacke wieder zur Hand und sprach: Man muß sich in Geduld schicken, um den Himmel zu verdienen!
Ferne, aber gewaltige Erinnerungen, deren jede einen ganz verschiedenen Keim in sich birgt. Welcher ist's, der aufsprießen wird?....
Ist die Nacht hinter der kurzen Dämmerung ewig? Dann laßt mich anstoßen mit euch, fröhliche Kumpane! laßt mich mit euch des Lebens genießen, Trotz biete ich dir, Freund Hain!... Dann stelle ich all mein Sach' auf das Leben und auf mein Haupt: Ehre, Tugend, Humanität, Reichthum; denn mein Gott bin ich, meine Ewigkeit diese wenigen Tage, mein ganzer Antheil an der Glückseligkeit so viel ich vom Antheil Anderer erhasche, so viel ich Freuden aus meinem Körper gewinne, so viel ich meine Sinne entzücken kann! Ehrlich – wenn ich stark, reich, wohl vom Schicksale bedacht; achtbar aber auch dann, wenn schwach, ich List gebrauche, wenn ich arm, stehle; wenn ich enterbt, im Finstern wandle, um mir meinen Antheil vom Erbe zu verschaffen; denn meine Nacht nahet und ich habe ein gleiches Recht zum Genuß!
Lustiges Liedlein, wie düster erscheinst du mir! Du gleichst dem blühenden Hügel, der vermoderte Gebeine bedeckt!
Aber wenn die Nacht hinter dieser kurzen Dämmerung sich lichtet!.... Wenn sie nur ein dichter Schleier ist, der dem Auge die glänzenden, unendlichen Himmel verhüllt?...
Dann, Alter, wende ich mich zu dir; deine Lumpen ziehen mich an; ich will auf deinem Pfade wandeln.
Welcher Frieden für das Herz, welches Licht für den Geist! Eine gemeinsame Mühseligkeit, ein gemeinsamer Gott, eine gemeinsame Ewigkeit! Komm, mein Bruder, dein Elend dauert mich; dies Gold wird mich anklagen, wenn ich dir keine Linderung gewähre. Leiden und Duldung, Reichthum und Milde sind nicht mehr leere Worte, sondern süße Arzneien und führen zum Leben!
Das Ueble also ist ein Uebel und daher das Gute zu erwählen und zu verfolgen. Die Gerechtigkeit ist heilig, die Humanität segensvoll; der Schwache hat seine Rechte und der Starke beschränkende Pflichten. Mächtig oder elend, niemand ist enterbt außer durch seine Schuld... Vergnügen, Lust, Reichthümer, ihr habt eure Gebrechen und eure Pflichten. Armuth, Schmerzen, Herzeleid, ihr habt eure Tröstungen und eure Berechtigungen.... Tod! ich will dir weder Hohn sprechen noch dich fürchten; einzig und allein will ich mich bereiten, die glücklichen Reiche zu sehen, deren Eingang du aufschließest.
Alter Mann! wie weise, reich und tröstlich erscheinst du mir. Du gleichst in meinen Augen alten Ruinen, die am entlegenen Plätzchen Schätze verbergen.
So ändern sich die Dinge mit der Anschauungsweise. In diesem Sinne ist der Augenblick so bedeutsam, wo der Gedanke an den Tod die Seele des Menschen erfaßt und zwei Wege sich vor ihm öffnen.
Wäre der Mensch ein bloßes Vernunftwesen, so würde man ihn je nach dem Standpunkte seiner Ansichten durch eine gebieterische, schicksalsschwere Nothwendigkeit, von Schluß zu Schluß folgend, in dem einen oder dem andern dieser beiden Wege wandeln sehen. Glücklicherweise kennt und liebt der Mensch, unabhängig von aller Schulweisheit, die Ordnung, die Gerechtigkeit, das Gute; wenn er die Tugend gekostet, so zieht sie ihn an und er hält fest an ihr. Zudem, von Leidenschaften gepeinigt, von der Nothwendigkeit ganz und gar in Anspruch genommen, hat der armselige Vernunftmensch, der wankelmüthige Geist, das schwache Geschöpf weder Zeit noch Kraft, grausam oder erhaben zu sein... Doch man folge der Menge, man beobachte die Einzelnen, welche sich davon absonderten, um segenbringend oder verderblich zu wirken, und man wird unter denen, die nach bestimmten Grundsätzen handeln, auch die Entschlossensten antreffen und sie ohne Stolz zur Tugend schreiten sehen, und zum Verbrechen ohne Gewissensbisse.
Doch, armes Liedlein! darum hadre ich nicht mit dir; du dachtest an nichts Uebles. Trinken und Singen ist ein herrlich Ding: die Freude erweitert das Herz. Unter der Weinlaube beim Klange der Becher ziehe der Ernste, der Freudenfeind sich zurück, dann erscheinst du, auf den Flügeln der Lust und Freude heranschwebend.
Ist es deine Schuld, wenn einzelne Verse dem Laubdache entschlüpfen und an das Ohr eines Knaben schlagen, der mit seinem Oheim den Hügel hinanstieg?
Wir kehrten zurück. Mein Oheim Tom trinkt selber freilich keinen Wein, aber er sah es gern, wenn andere Leute um eine Flasche herum die Sorgen und Mühen der Woche vergaßen. Es war seine Gewohnheit nicht, an solchen Gelagen Theil zu nehmen, allein es machte ihm Vergnügen, ihnen zuzusehen, die Fröhlichkeit pflanzte sich auf ihn fort und seine Züge belebten sich mit freundlichem Lächeln. So ging ich auch Sonntag Abends mit ihm spazieren, nicht etwa an öffentliche Orte oder an einsame Stellen, sondern zwischen den Weingeländen herum, die vor der Stadt die Familien der geringen Leute versammelten.

Noch jetzt gehe ich dahin. Zuweilen bin ich mitten darunter, ich weiß nicht ob etwa, weil ich selbst ein geringer Mann geblieben bin, oder ob meine Kunst mich dahin leitete.
Da rede ich von zwei neuen Dingen zu dir, Leser! Das Erstere wird einen unangenehmen Eindruck auf dich machen, das Letztere überrascht dich, wenn du aus dem, was du bisher von meiner Geschichte gelesen, nicht errathen hast, daß Ostade und Teniers mich weit stärker anzogen, als Grotius und Pufendorf. Doch ich will diese beiden Dinge trennen, um von jedem besonders zu sprechen.
Hast du jenes Knötchen vergessen, welches dein Haupt so gut als das meinige hat? Ich erlaube mir, dich daran zu erinnern. Vernimm also, daß niemand von sich sagt, er gehöre zu dem gewöhnlichen Volke, noch darauf stolz ist, vom Volke zu sein, oder seine Freunde darunter zu haben. Oder wäre ich nicht ein wenig dein Freund? Was du auch sein magst, das Volk ist in deinem Munde das Volk auf niedrerer Stufe, als der, wo du in der Stufenleiter der bürgerlichen Gesellschaft stehst. Du, du gehörst nicht dazu und in jedem Falle, wo deine Eitelkeit (wiederum das Knötchen) ihre Rechnung nicht dabei findet, wirst du keinen Ruhm darin suchen, zum Volke zu gehören, und wärest du wirklich aus ihm. Merk dir's.
In der That, wenn bewußtes Knötchen durch die Aufgeblasenheit eines Großen sich verletzt fühlt und es gern auswetzen möchte, könnte es sich weigern unter solchen Umständen, daß du eine Ehre darein setztest, zum Volke zu gehören, und wäre es auch wirklich nicht einmal der Fall. Aber das ist nur für den Augenblick und blos deshalb, weil das Volk weit mehr Lebensart, bessere Sitten, einen weit vorzüglicheren Ton hat, als jener Große, und weil er's als unendlich tief unter ihm stehend betrachtet.
Eben so wenn besagtes Knötchen möchte, daß du einem Club vorstehst, die Seele einer Bewegung seist, das Haupt einer Partei, der Herausgeber eines Volksblatts, so würdest du wieder nur in ein Ding deinen Stolz setzen, nämlich darein, daß du zum Volke gehörst, daß du aus dem Schoose des Volks entsprossen, daß du im Schoose des Volks und, wenn möglich, für dasselbe sterben wollest. Aber deine weißen Handschuh, dein feines Kleid, deine saubere Wäsche, das Spazierstöckchen, mit dem du spielend umherfichst, die Augengläser, welche dir ein Bedürfniß geworden, zeugen wider deine Behauptung. Du nennst dich Einen vom Volk! und würdest dich beleidigt fühlen, hielte man dich beim Worte.
Du siehst, die Ausnahme bewahrheitet die Regel.
Ja, es ist wirklich so, ich bin beim Volk geblieben. Ich suche daraus weder Ruhm noch Schimpf zu ziehen, obwol ich fühle, wie ungemein schwer das ist.
Ich schreite zu dem zweiten Punkte.
Mein Oheim Tom hegte große Vorurtheile wider den Stand eines Künstlers. Er fand denselben eines denkenden Wesens nicht sehr würdig und höchst ungeeignet, ein essendes, trinkendes und besonders ein heirathendes Wesen zu ernähren. Sonderbar ist dabei, daß er, während er die Künstler geringschätzte, die Kunst ganz besonders verehrte, insoweit nämlich die Kunst in's Bereich der Gelehrsamkeit fällt, als sie ein Gegenstand zu Untersuchungen, zu Denkschriften ist. Mein Oheim hatte zwei dicke Bände über die griechische Glyptik geschrieben.

Ich hingegen ließ die griechische Steinschneiderei sein wie sie wollte; jung wie ich war, hatte das Grün der Wälder, das Blau der Berge, der Adel der menschlichen Gestalt, die Anmuth der Frauen, der weiße Bart des Greises für mich einen geheimen Zauber, der noch weit lebendiger und gewaltiger wurde, wenn ich auf Leinwand oder Papier eine Nachahmung dieser mir so reizenden Dinge sah. Tausend linkische Versuche auf meinen Heften und Büchern thaten die wundersame Lust kund, die ich in der Nachahmung meiner selbst fand, und ich erinnere mich, daß ich lange Arbeitstunden hindurch mit Wollust die reizenden Bilder niederkritzelte, welche einige, gar häufig falsch oder nothdürftig begriffene Verse Virgils in meiner Einbildung erweckten. Ich malte Dido. Ich malte Jarbas. Ich malte Venus selber:
Anfänglich hatte mein Oheim Tom zu meinen Kritzeleien gelächelt; später aber hörte er auf, eine Neigung zu ermuntern, die mich von meinen Studien abzog. Nichts desto weniger nährte er, wenn er Sonntag Abends mich mit in die Weinberge spazieren nahm, ohne es zu ahnen, diesen Hang, dem er entgegenarbeiten wollte. Unter den Laubgewinden fand ich die reizendsten Spiele von Licht und Schatten, lebendige, malerische Gruppen und jene menschlichen Antlitze, auf denen sich in tausend Zügen Freude, Trunkenheit, Friede, bange Sorgen, kindliche Freude oder verschämte Schüchternheit malten. Ich liebte eben so sehr als er diese Spaziergänge, nur daß wir auf denselben verschiedenen Gelüsten nachgingen. Als indeß in meinen Heften auf die Jarbas und Dido nach und nach gewöhnlichere, aber wahrere Figuren folgten, hörten diese Spaziergänge auf.
Nun führte mich mein guter Oheim wider seine Neigung und trotz seines hohen Alters weit von der Stadt nach entlegenen Fluren spazieren, zuweilen sogar bis zu den Orten, wo unter den Felsen des Berges Salève die Arve sich durch ein grünendes Thal schlängelt, einsame Inseln mit ihren Fluthen umschließend und in ihren Wellen den sanften Glanz der Abendsonne spiegelnd. Von dem Platze, wo wir uns niederließen, sah man eine alte Barke vorüberziehende Landleute an's andere Ufer setzen, oder auch in der Ferne eine lange Reihe von Kühen durch eine Furth von den Inseln zum festen Lande ziehen. Der Hirt folgte auf einem alten Rößlein, vor sich im Sattel ein Paar Buben; das Gebrüll ward ferner und ferner und schlug in leisem Verhallen kaum an unser Ohr, bis der lange Zug sich in den dunkelblauen Schatten der Dämmerung verlor.

Diese Schauspiele entzückten mich. Mit bewegtem Herzen, die Seele voll süßer Empfindungen, ging ich von dannen und ein geheimes Verlangen zur Nachbildung, zur Wiedergabe einiger Züge von diesen Wundern drängte mich bereits. Nach der Rückkehr verwendete ich den ganzen Abend darauf. In entzückender, stets bereitwillig aufblühender Träumerei schmückte ich meine unförmigen Gebilde mit der höchsten Farbenpracht, die in meiner Phantasie lebte, und zitterte im Gefühl der unschuldigsten, jedoch lebhaftesten Freude.
Obgleich mein Oheim über die Steinbildnerei schrieb und die Werke des Phidias sammt den drei Manieren Raphael's auswendig wußte, so verstand sich mein guter Oheim doch blutwenig auf Zeichnen- und Malerkunst. Er rühmte die schönen Zeiten der Renaissance[3], allein seine Liebhaberei richtete sich auf die Medaillons von Le Prince und die Hirtengemälde von Boucher, womit er seine Bibliothek geschmückt hatte.
[3]: Das Zeitalter aufblühender Kunst von 1453, der Einnahme Konstantinopels, bis 1610, Beginn der Regierung Ludwig's XIII., dessen Ausbildungspunkt unter Franz I. von Frankreich fällt.
Jedoch hing neben dem Bette in wurmstichigem Rahmen noch ein Bild, welches wir, mein Oheim und ich, vor allen anderen liebten, obgleich aus verschiedenen Beweggründen: er, weil dies Gemälde, das aus der Zeit vor Raphael herstammte, viel Licht auf die Erfindung der Oelmalerei warf; ich, weil es mir vor allen die geheimnißvolle Macht des Schönen offenbarte.

Es war eine Madonna mit dem Jesuskindlein auf dem Arme. Ein goldener Heiligenschein umzog die keusche Stirn der Marie, ihr Haar fiel auf die Schultern herab und ein blaues Gewand mit weiten Aermeln ließ in ihrer Haltung unschuldsvolle Anmuth und die zärtliche Besorgtheit einer jungen Mutter erblicken. Auf mich übte dies Gemälde, das ohne alle kunstreiche Erfindung war und den ausgeprägten Charakter eines Jahrhunderts des Glaubens, der Jugend und aufblühender Kunst trug, einen unwiderstehlichen Reiz. Die junge Madonna besaß meine Bewunderung, meine Liebe, meine Verehrung, und wenn ich hinauf zu meinem Oheim ging, so haftete mein erster und letzter Blick auf ihr.
Meinem Oheim aber schien das Alles mit dem Rechtsstudium gar nicht zusammenzupassen, er nahm das Gemälde herab und ließ es verschwinden.
Das Recht ging jedoch darum nicht besser; ich fand keinen Geschmack daran und als ich meine Jüdin verloren hatte, ließ ich von jeglicher Arbeit ab. Keinen Ehrgeiz fühlte ich mehr, keinen Hang zu irgend etwas, keine Zeichnungen, keine Bücher, ein einziges ausgenommen, das fast nimmer aus meinen Händen kam. Wochen, Monate verflossen so und mein armer Oheim bekümmerte sich sehr, allein er machte mir nicht den geringsten Vorwurf.
Eines Tages war ich zu ihm gegangen und setzte mich wie gewöhnlich neben seinen Schreibtisch. Er saß über seinen Büchern und beschäftigte sich, eine Belegstelle abzuschreiben. Ich bemerkte das Zittern seiner Hand, welches heute auffällig stark war; die schwankenden Buchstaben verriethen eine ungewöhnliche Unsicherheit. Diese zunehmenden Anzeichen des unmerklich sich steigernden Alters erweckten in mir eine Traurigkeit, welche meinem Gemüthe eigenthümlich zu werden begann und in Ermangelung andern Gegenstandes sich auf diese Wahrnehmungen richtete.

Und das hatte seinen Grund, denn der Oheim, welcher vor mir dasaß, war meine Vorsehung auf Erden, und so weit meine Erinnerung reichte, hatte ich keine andere Stütze als die seinige gehabt, keine väterliche Liebe als von ihm erfahren. Man hat dies bereits aus den bisherigen Erzählungen abnehmen können; wenn man aber bedenken will, daß ich diesem guten Oheime noch keine Seite widmete, um den Leser mit ihm bekannt zu machen, so wird man es entschuldigen, wenn ich mit freudiger Bereitwilligkeit jetzt von ihm rede.
Mein Oheim Tom ist unter den Gelehrten bekannt, allen denen zum Beispiel, die sich mit der griechischen Steinbildnerei oder der Bulle Unigenitus beschäftigen. Sein Name ist in den Verzeichnissen der öffentlichen Bibliotheken zu lesen, seine Werke findet man in besondern Fächern aufgestellt. Unsere Familie ist deutschen Ursprungs und ließ sich im verwichenen Jahrhunderte in Genf nieder. Gegen 1720 erblickte mein Oheim das Licht der Welt in dem alten Hause, welches am St. Petersbrunnen steht, einem alten Kloster, dessen einer Eckthurm noch zu sehen ist. Dies ist alles was ich von den Vorfahren meines Oheims und seinen ersten Lebensjahren weiß. Ich darf annehmen, daß er seine Schule durchmachte, die akademischen Grade erwarb und sich dem ehelosen Stande und den Wissenschaften widmete. Er ließ sich bald darauf in dem erwähnten Hause der französischen Stiftung nieder, gleichfalls ein altes Kloster, wo er die ganze Zeit seines langen Lebens verbrachte.
Mein Oheim lebte zwischen seinen Büchern, und da er keine Verbindungen in der Stadt unterhielt, so war sein Name wol manchem lebenden Gelehrten, besonders in Deutschland, bekannt, allein in seinem eigenen Stadtviertel fast gar nicht. Kein Geräusch in seiner Behausung, kein Wechsel in seinen Gewohnheiten, keine Aenderung in seiner alterthümlichen Tracht. Daher kam es, daß man, wie alles Eintönige und unwandelbar Gleichmäßige, als Häuser, Markzeichen, so auch ihn sah, ohne ihn zu bemerken. Zwei- oder dreimal wol redeten mich Vorübergehende an, und fragten, wer der Greis wäre; allein dies waren Fremde, welchen seine Haltung oder Tracht, die von der Anderer so wesentlich abstach, auffiel. »Es ist mein Oheim!« antwortete ich voll Stolz über ihre Neugierde.
Aus dieser Lebensweise, diesem Geschmacke entstanden auch gewisse geistige Gewohnheiten. Fremd wie mein Oheim, als Mann der Wissenschaft, der Welt war, schöpfte er in vollem Vertrauen auf seine Wissenschaft, seine Lehrsätze und Meinungen aus Büchern, wobei ihn nicht die verdächtige Unparteilichkeit eines Philosophen leitete, sondern ein ruhiger Geist, der den Leidenschaften und Triebfedern der Welt fremd war und weder Eile zum Beschließen noch Gründe zur Anhänglichkeit an eine Richtung hatte. Daher war er mit den gewagtesten Aufstellungen der Philosophie vertraut und hatte mit nicht minderer Genauigkeit in den spitzfindigsten Fragen der Theologie herumgearbeitet, ohne daß man so leicht herausbringen konnte, was denn eigentlich seine Ansicht war. Die Moral hatte er mit demselben wissenschaftlichen Geiste studirt, doch mehr um sie zu kennen als um einen Vergleich zur Anwendung darin zu ziehen. Darum war es eben so schwierig, die Grundsätze seiner Handlungsweise herauszufinden. In Betreff des Glaubens wie im Gebiete der Grundsätze erregte nichts sein Erstaunen, nichts seinen Eifer, und wenn seine Ueberzeugungen schwach waren, so war seine Duldsamkeit eine vollständige.
Dies Gemälde, das ich von meinem Oheim entwarf, wird ihm vielleicht die Liebe vieler Leser, wenn nicht gar ihre Achtung rauben. Es thut mir leid und dies um so mehr, als ich dieserhalb sich meine Freundschaft für sie verringern fühle. Ja, wenn es sich darum handelte, ob jene Art Skepticismus, die ich meinem Oheim beilege, an und für sich oder ihrer Richtung willen gut oder schlecht sei, so glaube ich, meine Ansicht würde mit jenem Theile der Leser zusammenpassen, allein ich sage mich von ihnen los, wenn sie sich um der Beschaffenheit einer Lehre willen für berechtigt halten, ihre Liebe und Achtung dem Manne, welcher ihr anhängt, zu entziehen, sobald dieser Mann gut und ehrenhaft ist.
Um aber gerecht zu sein, meine Leser sind zu entschuldigen. Ihre Ansicht entspringt aus achtbarer Quelle. In der That, der größte Theil der Menschen, ich meine diejenigen, welche ihrem Geschlechte Ehre machen, ist gewiß mehr als einmal in den Fall gekommen, an sich selbst zu erkennen, daß edle Triebe nicht ausreichen, um zum Guten zu führen, und wie oft sie unterliegen, wenn sie mit anderen minder edeln Trieben zu kämpfen haben. Deshalb sind in ihren Augen Grundsätze und Glaubensgesetze nothwendig als mächtige Hilfsleiter und allein vermögend, dem Guten den Sieg zu sichern, und deshalb sind sie gegen diejenigen mistrauisch, bei denen sie diese Bürgschaften nicht zu bemerken glauben.
Eben in dieser Meinung, die ich durchaus theile, finde ich die Erklärung und gewissermaßen den Schlüssel des Charakters meines Oheims und der scheinbaren Widersprüche, welche auf den ersten Blick zwischen seinen Ansichten und seinem Leben obwalteten. Dieser Mann war von einer so guten, ehrenhaften, wohlwollenden Gemüthsart, daß er vielleicht niemals gleich den Lesern, von denen ich redete, in die Lage gekommen ist, das Bedürfniß von Hilfsmitteln, die ihn zum Guten ermunterten, und noch weniger die ihn vom Schlechten abhielten, zu empfinden. Ein natürliches richtiges Gefühl bewahrte ihn vor allen Ausschweifungen, eine angeborne Schüchternheit und sein zurückgezogenes Leben hatten ihn in altväterlicher Einfachheit erhalten, während sein eher menschlich als empfindsam, eher edelmüthig als warm zu nennendes Herz, welches wenig von Enttäuschung und Mistrauen heimgesucht war, eine gewisse jugendliche Frische behalten hatte, die sich in allen seinen Gefühlen und Handlungen äußerte. Und dabei, was einzutreten pflegt, wenn die Tugenden keine Anstrengung kosteten, weder Stolz noch Härte, sondern echte Bescheidenheit, reine Güte und ein gewisser Zauber von Unschuld erhöheten alle liebenswürdigen Eigenschaften dieses vortrefflichen Greises.
Also trotz der mehr oder weniger sonderbaren und widersprechenden Ansichten, welche im Gemüthe meines Oheims wogen und neben einander bestehen oder unter sich im Kampfe begriffen sein mochten, trotz der moralischen oder Verhaltungs-Grundsätze, die folgerecht aus diesen Ansichten hervorgehen konnten, trugen alle seine Handlungen den Charakter der strengsten Ehrenhaftigkeit und wahrsten Güte. Wenn die Woche in den fleißigen Forschungen, die ihn ganz und gar beschäftigten, vergangen war, widmete er den Sonntag einer ehrbaren stillen Ruhe: Morgens besorgte ein alter Barbier, der einer Zeit mit ihm entsprossen, seinen Bart und ordnete seine Perrücke, dann that er einen kastanienbraunen Rock, neu, aber von altem Schnitt, an und begab sich in die Kirche seines Sprengels, auf den Rohrstab mit goldenem Knopfe gestützt und unter dem Arme einen Psalter, der sauber in genarbtes Leder gebunden und mit silbernem Schloß versehen war. Er setzte sich an seinen bestimmten Platz und hörte die Predigt mit gewissenhafter Aufmerksamkeit an, und sicherlich brachte keiner eine größere Bereitwilligkeit mit, die Ermahnungen auf sich anzuwenden. Seine unsichere Stimme ertönte beim Gesange und nachdem er seine reichliche, doch stets gleiche Gabe in den Opferstock gethan, kehrte er nach Hause zurück; wir aßen zusammen und der Abend ward den gemüthlichen Spaziergängen, wovon ich oben sprach, gewidmet.
Diese Züge, welche nur eine Lebensseite meines Oheims darstellen, genügen, um ein Bild von der ehrenhaften Einfachheit zu geben, die in allen Handlungen seines zurückgezogenen Lebens vorwaltete, obgleich sie keinen genügenden Maßstab von der eben so einfachen Güte seines Herzens geben; und ich fühle mich in Verlegenheit, dieselbe zu schildern, ohne ihren Reiz zu verwischen, ohne Gefahr zu laufen, das als Tugend hinzustellen, was bei ihm Natur, gewohnte Weise war. Soll ich erwähnen, daß er durch den Tod meiner ihm mancherlei Verpflichtungen hinterlassenden Eltern mein Beschützer geworden und geblieben war, ohne daß es ihm jemals in den Sinn kam, es nöthige ihn keine natürliche Pflicht, sein mäßiges Vermögen meinetwillen anzugreifen? Soll ich sagen, daß es ihm nie, auch nur einen Augenblick einfiel, daß ich kein Recht auf alle seine Opfer habe, ja daß er nicht einmal danach fragte, ob ich derselben würdig sei, seine Lehren befolge, oder seine Wohlthaten dankbar anerkenne? Doch in den Augen Vieler wird dies als eine sich von selbst verstehende Pflicht erscheinen und seine Güte zeigt sich am besten in seinen minder bedeutenden Handlungen.
Dies ist meine Meinung. Und darum bedauere ich, daß die alte Dienerin, die fünfunddreißig Jahre lang den kleinen Haushalt meines Oheims führte, nicht an meiner Statt die Feder führt. Besser bei Kräften als sie, fand er es weit einfacher, die Schwächen ihrer Wirthschaft selber zu verbessern als ihr eine Nebenbuhlerin zu geben, und statt darum übler Laune zu werden, ließ ihn seine natürliche Lebendigkeit die Alte mit lustigen, liebevollen Scherzworten necken. Allerdings, er zankte zuweilen mit ihr, aber nur weil sie nicht auf seine Vorschriften hörte, und indem er sie mit dem Hippokrates tyrannisirte, vertauschte der wackere Oheim gewissermaßen die Rollen und wurde ihr Diener. In den letzten Lebensmonaten dieser Frau räumte er ihr seinen lieben Lehnstuhl ein und machte jeden Tag eigenhändig das Bett der alten Dienerin, wohin wir sie zusammen hinüberbrachten, um den bleichen Lippen noch ein Lächeln zu entlocken.
Eines Abends fühlte die arme Frau ungewöhnlich heftige Schmerzen; mein Oheim ließ sich auf's genaueste alle Symptome sagen, fragte sein Buch um Rath, ersann einen helfenden Trank und ging selbst um Mitternacht, um denselben unter seinen eigenen Augen von dem Apotheker bereiten zu lassen. Seine Abwesenheit dauerte etwas lange; Margarethe rief mich und theilte mir ihre Besorgniß mit. Schnell zog ich mich an und eilte auf dem nächsten Wege zum Apotheker. Mein Oheim war vor wenigen Augenblicken hier fortgegangen. Durch diese Versicherung beruhigt, nahm ich meinen Rückweg durch dieselbe Straße, die er gegangen sein mußte; es war die Altstädter Straße.
Ich hatte die Mitte der Straße, die sehr abschüssig ist, erreicht, da gewahrte ich in einiger Entfernung einen einzelnen Mann, den ich an seinen Bewegungen nicht sogleich für meinen Onkel erkannte. Er trug unter großer Anstrengung einen schweren Gegenstand, den er zwei Mal niedersetzte, wie um Athem zu holen, und als er am obern Ende der Straße angelangt war, stellte er seine Last in die Ecke eines Häuservorsprungs, wobei er mit dem Stocke versuchte, ob der Gegenstand nicht in die Straße zurückrollen könne.
Jetzt erkannte ich meinen Oheim, der sich sehr wunderte, mich zu erblicken. Ich erklärte ihm die Veranlassung meines Nachgehens. – Ich, ich wäre schon zurück, antwortete er, wenn ich mich nicht an einen großen Stein tüchtig gestoßen hätte; und damit eilte er hinkend weiter.
Dieser Zug, glaube ich, zeichnet den edeln Mann. Alt, hinkend, trotz seiner Eile hatte er ganz allein den gewaltigen Stein an einen Ort getragen, wo er keinen Schaden mehr thun konnte, und diesen Umstand allein hatte er von seinem Begebnisse bereits vergessen.
Jetzt wird man eher begreifen, mit welcher Traurigkeit mich an jenem Tage das Zittern seiner Hand erfüllte. Ich brachte dies Zeichen mit anderen zusammen, welchen ich denselben Ursprung zuschrieb, seine mehr und mehr sich vermindernde Eßlust, die Abkürzung der Spaziergänge und Sonntags in der Kirche eine Erschöpfung, gegen die er nur mit sichtbarem Kraftaufwande ankämpfte.
Während ich mich diesen traurigen Gedanken hingab, fielen meine Augen mit einem Male auf die Madonna... sie war wieder an ihren Platz gehängt. Ich fühlte mich überrascht, denn ich glaubte, mein Oheim hätte sie an einen schon lange danach gehenden Juden verkauft. Ich erhob mich unwillkürlich, um sie zu betrachten.

Diese Madonna, sagte in diesem Augenblicke mein Oheim...
Seine Stimme zitterte vor Bewegung.
Das Einzige, worin ich gewissermaßen mit meinem Oheim im Widerspruche stand, war – und man hat gesehen, wie – mein Hang zu den schönen Künsten. Nur der unendliche Werth, den er darein setzte, den einzigen Sprößling der Familie in eine ruhmreiche wissenschaftliche Laufbahn treten zu sehen, hatte ihn einzig und allein zu jenen Kunstgriffen vermocht, die, wie unschuldig sie auch waren, seinem geraden Sinne, wie seiner Herzensgüte namenlos viel gekostet hatten. Gewiß, er hatte es sich als eine gewaltige Härte vorgeworfen, mir den Anblick der Madonna entzogen zu haben. Und das war genug, um seine reine, heitere Seele zu beunruhigen und mit Scham vor sich selber zu erfüllen.
Diese Madonna, hub mein Oheim auf's neue an, habe ich wegnehmen lassen, weil es.... Ich hätte sie sollen nicht wegnehmen... Ich schenke sie Dir. Du magst sie in Dein Zimmer bringen lassen.
Während dieser Worte hatte mein Oheim seine gewöhnliche Ruhe wiedergewonnen. Jetzt war es an mir, mich verwirrt und gerührt zu fühlen; denn diese bedauernden Worte und das sie begleitende edle Geschenk überfielen mich mitten in meiner Traurigkeit.
Aber dafür, fuhr er lächelnd fort, gibst Du mir meine Bücher wieder. Mein Grotius langweilt sich da unten... Mein Pufendorf schläft... Die Alte hat mir von Spinnen gesagt, die zwischen den beiden ihre Netze weben... Nun jeder hat seinen Hang... Das Recht bietet freilich eine ehrenhafte Laufbahn dar!... Doch was? die Kunst hat auch ihr Gutes... Man malt die schöne Natur, man stellt mannichfache Scenen dar, man macht sich einen Namen... Wird man auch nicht reich dabei, so kann man doch bescheiden davon leben... Sparsamkeit, etwas Beihülfe;... über lang oder kurz, wenn ich nicht mehr bin, mein bischen Habe...

Hier konnte ich meine Thränen nicht mehr zurückhalten; ich gab ihnen freien Lauf und überließ mich ganz der Betrübniß, welche diese Worte in mir hervorriefen.
Mein Oheim schwieg, er hatte die Veranlassung meiner Thränen misdeutet und versuchte anfänglich nicht, mich zu trösten. Jedoch nach einigem Schweigen trat er näher:
Ein so verständiges Mädchen! sagte er;... so schön!... Ein so junges Mädchen!
Nicht um sie weine ich, guter Oheim; aber Sie haben mir so betrübende Dinge gesagt!... Was soll aus mir werden, wenn Sie nicht mehr sind? Diese Worte rissen meinen Oheim aus seinem Irrthume und erleichterten sein Herz so sehr, daß er augenblicklich seine Heiterkeit wiederfand.
Ohe! mein armer Julius, darum weinst Du?...

Schön! schön! wenn's weiter nichts ist, mein Sohn, werde schon leben... Mit vierundachtzig Jahren versteht man die Kunst... und dann habe ich meinen Hippokrates... weine nicht, Kind. Es handelt sich jetzt um weiter nichts, als um die schönen Künste.... und dann um Dein Geschick. Das Alter, siehst Du, kommt bei Dir, wie bei mir... das Recht behagt Dir nicht?... nun, nach Deinem Gefallen. Also, wirf Dich auf die schönen Künste.... denn freilich, jeder muß sich in seinem Geschäfte gefallen. Du nimmst die Madonna; wir suchen für Dich eine Werkstätte. Hier magst Du beginnen, in Rom endigen; so wird's am besten sein. Ein bloßes Scheinleben zu führen, wäre ja doch am Ende das größte Uebel; hat man ein Ziel vor Augen, so arbeitet man, und erstrebt, und erreicht es, vermählt sich...
Ich unterbrach ihn: nimmer, mein Oheim!
Nimmer? gut; wie Du willst... Aber weshalb, Julius, willst Du den Hagestolz spielen?
Weil, sagte ich verlegen, weil ich mir selbst gelobt habe, seitdem...
Armes Mädchen!... So verständig!... Nun, folge Deinem Hange, Dein Wille gilt ja. Ich bin nicht daran gestorben. Die Hauptsache ist, daß Du Dir einen Stand wählest; wir wollen darüber sprechen.
Ich mußte mir alle Mühe geben, um über die Vertauschung des Rechts mit den schönen Künsten erfreut zu scheinen; allein mein Herz war von Traurigkeit und Dankbarkeit so erfüllt, daß kein andres Gefühl darin Platz fand. Nach Verlauf weniger Augenblicke zog ich mich zurück, nachdem ich meinen Oheim herzlich umarmt hatte.
Hierdurch erklärt sich meine zweite Bemerkung. Und jetzt, Leser, wirst du begreifen, da ich nun Künstler geworden und einer aus dem Volke geblieben war, daß mich ein zwiefaches Verlangen nach den Weingeländen zieht oder mich antreibt, eine Rolle mitzuspielen. Und noch ein anderer Grund kommt dazu: das Vergnügen, dieselben Orte zu besuchen, wo ich vordem mit meinem Oheim gegangen war. Selber an der langen Tafel sitzend, stelle ich mir ihn vor, wie er durch die umliegenden Büsche streift, stehen bleibt, um zu hören, um dies oder jenes zu beobachten, sein Lächeln umschwebt mich wie ein Zephyrhauch und die Erinnerung an ihn wird lebendiger.
Uebrigens gewähren diese Orte, abgesehen von der Kunst, welche dort reichliche Nahrung findet, die wahrsten und achtbarsten Vergnügungen unter denen, die man im Familienkreise hat. Die Sitte beherrscht und zügelt die Freude, wie Einfachheit den Reiz derselben erhöht. Welch unschuldige, süße Spannung gewährt nicht an den oft so unangenehmen Wochentagen die Hoffnung auf die Augenblicke, wo man seine Familie mit der eines Freundes oder Nachbars vereint, um auf die Flur hinauszugehen, unter die reizenden Schatten der Buchen oder unter die Kastanienbäume auf die Berge! Wie strahlend erscheint nicht Sonntags die Sonne, wie glänzend das Blau des Himmels! Nach den frommen Pflichten, welche diesen Tag heiligen, gehen bei Zeiten, schon um Mittag, denn die Tageshitze scheint dem nicht schwer, dessen Schritt die Freude belebt, die Familien hinaus vor die Stadt und die fröhlichen Gesichter stehen im Einklange mit dem lebendigen Aussehen der Festkleider. Der Schritt der Eltern, der des Großvaters, wenn derselbe noch Theil an den Vergnügungen nimmt, regelt den Gang; nichts desto weniger scherzt man frei nach allen Seiten hin, und das junge Mädchen, welches den Jünglingen zu gefallen sucht, wie das ihr unvermeidlicher Trieb ist, fühlt sich vor dem bewachenden Auge der Mutter nicht durch falsche Zurückhaltung oder trauriges Sprödethun gefesselt. Gelächter, Spiele, neckische Munterkeit, eine frische Laune bringen die muthwillige Truppe durcheinander und beleben sie; die Eltern plaudern im Lärm dieser Lust, und hinter ihnen verjüngt selbst der Großvater sich am Gewühle dieser Freuden des ihm entgegengesetzten Alters.
Aber das sind nur erst die Vorspiele. Man kommt unter die Buchen: die Frische, die Ruhe, eine besetzte Tafel thut Allen wohl; die Speisen mögen sein wie sie wollen, Eßlust und Glück verleihen ihnen eine kostbare Würze. Selbst die verdrießlichen Uebelstände einer ländlichen Küche sind nur eine Veranlassung zur Fröhlichkeit, ein gefundenes Willkommen für die zum Scherz gestimmte Gesellschaft. Dem Großvater aber wird jede Rücksicht gezollt, man trifft die Anordnungen, wie sie ihm bequem sind, berücksichtigt, was ihn innerlich freuet, der Lärm wird seinetwegen gemildert, jeder Jüngling macht sich eine Ehre daraus, ihm Ehrerbietung zu zollen, und schätzt es sich zum Glücke, daß er so eine Gelegenheit findet, einen Anspruch auf die Nichte des Greises zu erlangen.
Und welch' entzückende Augenblicke folgen nicht jetzt! Die Gruppen zerstreuen sich, die weißen Gewänder glänzen hier und dort auf dem Rasen ringsum. Der Einfluß des Abends erweckt heitere Gespräche, eine größre Vertraulichkeit; auf die Ausgelassenheiten des Mahles folgt ein süßes Sichgehenlassen, und des herannahenden Tages Ende macht die Augenblicke kostbarer. Ich leugne es gar nicht, daß, während die Eltern an der Tafel sitzen bleiben, um fortzuplaudern, oder an einem ruhigen Plätzchen schlummern, nicht manch' zärtliches Wörtchen ausgetauscht ward; daß das Vergnügen, sich von den Uebrigen wegzustehlen, nicht lebhaft sei, daß Wonne und Verwirrung die Pulse nicht heftig pochen machen, daß endlich nicht auch mancher sich verrechnet hatte, wenn von der Buchenlaube das Zeichen der Wiedervereinigung und des Aufbruchs erschallt.
Wo wäre da etwas Uebles daran? Wie können junge Leute sich besser kennen, sich lieben lernen und zu Gatten erkiesen? Wahrlich, die plaudernden oder schlummernden Eltern haben Recht, daß sie nicht fürchten, was sie andrerseits nicht bemerken wollen; sie haben das Gefühl gegenseitiger Ehrbarkeit zum Bürgen, daß im Schoose der Familie sich alles rein gestaltet, daß sie in ihrer Vereinigung ein Heiligthum ist, aus dem jede Unlauterkeit verbannt ist.
So waren die Belustigungen unserer Eltern; Spuren davon sind allerdings noch da, aber sie verschwinden mehr und mehr in der allgemeinen Verschmelzung der Sitten, in der sie sich allzumal so die alte Derbheit wie die alte Gutmüthigkeit verlieren; in der sich die einfachen, durch Arbeit errungenen Freuden, die Annehmlichkeiten des Brudersinns und die heiligen Bande der Familie von Tag zu Tag gegen ein zunehmendes Wohlleben, das aber ohne Würze ist, austauschen.
Aber was zu allen Zeiten am meisten verheerend in die Einfachheit und Gemüthlichkeit der Vergnügungen fällt, das ist das Knötchen, das unbezähmbare Knötchen. Das Knötchen ist's, von dem die Reihen dieser liebenswürdigen, achtbaren Spaziergänger gelichtet werden, von ihm werden diese geräuschlosen und nicht kostspieligen Vergnügungen in Acht erklärt; das Knötchen stellt an seinen Mann die Anforderung, auf irgend einem öffentlichen Platze zu paradiren; es empfiehlt ihm Bart und Sporen, die nur in der Thüre eines Kaffeehauses oder auf dem Pflaster einer Straße von gutem Tone einen Werth haben; es ist's, das ihn Sonntags seine Straße, seinen Laden, seinen Vater selber und die Orte, wo derselbe weilt, meiden läßt; es läßt ihn Vergnügen an dem Rößlein finden, welches ihn in einem Stücklein Fiaker, das gelb wie eine alte Stiefelstulpe ist, hinschleppt bis zu einer räucherigen Kneipe; es ist's eben so sehr und gar noch mehr als das Vergnügen, das ihn aus der Gesellschaft der Seinigen scheucht und ihm jenen unehrbaren Ton, jene frechen Reden eingibt, worin er sich mit den Freunden seiner Wahl belustigt.
Ja, das Knötchen ist's, welches den Menschen regiert! Ist's nicht in dieser einen Gestalt, so ist's in einer andern, und zwar wird es stets heftiger, je besser die Verhältnisse des Menschen sich gestalten. Das Knötchen ist's, welches seine Vergnügungen verflacht, seinen Geist verdummt, sein Herz verdirbt. Wenn Leidenschaften oder die Wechselfälle des Lebens, wenn persönliches oder allgemeines Unglück seine Stimme nicht übertönen, so gebietet es unumschränkt über den Menschen wie über die Gesellschaft. Die Sitten, die Gebräuche, die Empfindungen des Einzelnen und Aller richten sich nach seinem Willen oder wechseln nach der geringsten seiner Launen. Dann trennen oder einen sich die Menschen, nicht wahren Unbills oder heiliger Sache willen, sondern um elende Vortheile, wegen des falschen Glanzes, worin sie strahlen, wegen des Flitterstaats, der ihr hohles Gemüth bedeckt. Dann sieht man sie Staub auf Ihresgleichen schütten, einzig und allein in dem glühenden Begehren, die ihnen Voranstehenden einzuholen; dann tritt die Gleichgiltigkeit an die Stelle des Brudersinns, ein neidisches Begehren an die des theilnehmenden Herzens und leben heißt nicht mehr lieben, sich freuen, sondern scheinen!
Und wenn Zeiten wie die unsrigen schon durch die Verweichlichung des Wohllebens und die faden Schaubilder, die sie bieten, zur Erweiterung der Herrschaft des Knötchens geeignet sind, so sind sie es noch mehr durch die Lauheit der Gemüther, durch die Richtigkeit der Ueberzeugungen, durch jenen falschen Schimmer der Gleichheit, womit die Menschheit voll unsinnigem Begehren sich wohlgefällig brüstet. Wie viel Raum zu Wachsthum und maßloser Ausdehnung bieten nicht dem Knötchen jene Herzen dar, in denen keine Flamme lodert, kein Glaube wurzelt, keine Leidenschaft in den Tiefen rüttelt! Welch ungemeines Gebiet eröffnet ihm nicht das Prinzip der Gleichheit, so wie es ausgelegt und von denen gepredigt wird, die nicht daran glauben, noch daran halten; begierig aufgenommen von denen, die es nicht verstehen; angenommen nur als das Recht, die Pflicht, die Sucht, den Höherstehenden sich gleich zu stellen! Seht hin, wie sie sich alle in den Tummelplatz stürzen, wo, nichts destoweniger, obgleich man sich hat stoßen, erdrücken, verstümmeln lassen, die Einen immer an der Spitze stehen und die Anderen auf der untersten Stufe... Statt an ihrem Platze zu bleiben und denselben zu verbessern, verachten sie ihn voll Verdruß und Scham, daß sie denselben einnahmen, und brennen vor Ungeduld, einen andern einzunehmen, vor Begierde, auch sich zu brüsten. O ihr Einfältigen, Menschen ohne Herz, die an ihren dünnen, aber zahllosen Fäden die schmählichste aller Leidenschaften, die Eitelkeit, leitet!
Das Knötchen ist also, richtig erwogen, ein trauriger Rathgeber, ein erbärmlicher Herrscher; und wenn es auch nicht möglich ist, es mit der Wurzel auszureißen, so ist es wenigstens die Pflicht eines vernünftigen Menschen, es stets zurückzudrängen, und wo er einen Sproß desselben aufschießen sieht, ihm entgegenzuwirken.
Seit zwanzig Jahren habe ich dies ernstlich betrieben und glaube, daß ich manche Keime erstickt, manche Sprößlinge des Knötchens unterdrückt habe; aber kann ich behaupten, daß ich mein Knötchen vertilgt habe? das wäre eine Lüge. Ich fühle sein Dasein; obgleich es nicht mehr so gefräßig ist, so hat es doch noch eine beträchtliche Dicke, und ist bei der geringsten Veranlassung bereit, üppige Sprossen zu treiben und alle guten Keime zu ersticken, denen ich auf seine Unkosten ein Plätzchen angewiesen habe. Sonderbar! Ueber gewisse Grenzen hinaus schlägt unsre Kraft wider uns selbst zurück; will man das Knötchen ausrotten, so verleiht man einem andern Knötchen daneben das beste Gedeihen. Und man sagt: Ich kann mir schmeicheln, daß ich keine Eitelkeit besitze; aber das ist schon an und für sich eine Eitelkeit. Drum habe ich, weil ich das Ganze nicht vermochte, das Nothwendigste gethan. Ich habe ihm meine Gemälde, meine Bücher zum Spielplatze eingeräumt, doch dabei ihm jegliche Vorrede untersagt, obgleich es mir jedes Mal dazu rieth; aber es gibt noch weit wichtigere Dinge, die ich vor seiner Berührung in Sicherheit gebracht habe.
Und so nun sind meine Freundschaften. Ich will, daß daran gar nichts Bemerkenswerthes sei. Ich will, daß das Band derselben frei bleibe, aber stark; ich will, daß die Quelle derselben tief, stets frisch und rein sei, geschützt vor dem Zephyr und geschirmt vor dem Unwetter; es möge nicht der wilde Bach sein, der sich über jegliche Klippe stürzt, um jeden Vorsprung spaltet, und dessen bald erhitzte, bald kalte Welle jegliche Blume tränkt, sich mit jedem Dufte schwängert, nach der Farbe des Himmels oder mit dem Rande seines Bettes das Aussehen ändert. Ich will in meinem Freunde seine Zuneigung zu mir lieben, den Reiz, den ich empfinde, ihn wie mich selbst zu lieben, unsere gemeinschaftlichen Erinnerungen, unsere gegenseitigen Hoffnungen, unsere vertrauten Unterredungen, sein dem meinigen bekanntes Herz, seine Tugenden, welche meine Seele fesseln, seine Talente, aus denen mein Geist Genuß schöpft, und nicht seinen Wagen, sein Haus, seinen Rang, seine Stellung, seine Macht oder seinen Ruf will ich lieben. Ich will es, Knötchen! also schweig!
Und nun meine Freuden – die sind folgender Gestalt. Ich will sie suchen, wo mein Herz sie findet, ohne Rücksicht auf das Kleid der Leute oder die Vergoldung der Wände. Ich will einfache, wo möglich aber wahre, beständige; solche, die ihre Reize von irgend einer Würze des Herzens oder des Geistes, aus irgend einer lebendigen und anständigen Neigung, aus irgend einem unschuldigen Triumphe empfangen haben, der über Trägheit, Sünde, Eigennutz erfochten ist; ich will sie in dem Vergnügen Anderer weit eher finden, als in dem meinigen; denn das ist die beste Freude, die sich mittheilt, sich ausbreitet, im Kreise schwirrt und das Herz mit erweiternder Wärme durchzieht. Also, fort, Knötchen! Laß mich unter den Buchen bei den wackeren Leuten. – Aber man bemerkt dich! – Mir einerlei. – Aber du bist in Hemdärmeln! – Desto kühler befinde ich mich. – Aber es sieht aus, als gehörtest du zu ihres Gleichen! – Das meine ich auch. – Da, sieh ein Wagen!... – Laß ihn fahren. – Und dort Städter, die dich kennen! – Grüße sie von mir und scher' dich fort, Knötchen!
So schließlich ist meine Ansicht, meine Weise, nicht allein mich zu benehmen, sondern auch Andere zu beurtheilen, abzuwägen, was sie taugen, und sie in meiner Achtung abzuschätzen. Noch einmal, von hinnen, Knötchen! Du bist der Vater der Dummheit, wenn nicht die Dummheit selber. Von hinnen! Ich sehe, als was du dich vor mir darstellst, von wem du zu mir kommst, du triffst oft Gutes und Schönes bei dieser Außenseite, die dich verlockt, aber du triffst auch Gutes und Schönes unter dem Kittel, den du verachtest. Bevor du diese Menschen wägst, erlaube, daß ich sie, den Einen wie den Andern, entkleide. Knötchen! ich hatte einen Oheim, dessen du dich mehr geschämt als gerühmt hättest... ich habe eine Jüdin geliebt, die du nur mit Verachtung angeblickt hättest... Von hinnen! auf immer fort von mir!!
Außer meinem Oheim Tom, mir und dem bereits früher erwähnten Maler gab es noch andere Miethsleute in dem Hause. Ich will sie der Reihe nach von unten bis oben aufzählen, um so bis zu dem zu gelangen, der dem Himmel am nächsten wohnte und den Weg dahin um diese Zeit etwa einschlug, eine schöne Dachwohnung gen Norden freilassend, wo ich mich einrichtete.
Frage mich nicht, Leser, was all' diese neuen Personen mit meiner Geschichte zu thun haben. Nichts vielleicht. Allein, wenn du mir bis hierher gefolgt bist, was wird dich eine Abschweifung mehr kosten? Du bist daran gewöhnt, und ich werde diese Gestalten, die mir so theuer sind, wie jede Erinnerung des Jugendalters es ist, wieder aufleben sehen. Also herauf, ihr alten Miethsleute, Nachbarn von ehedem, die gegenwärtig vom Schauplatze der Welt verschwunden sind, deren ferne Erinnerung aber mein Herz mit Entzücken bewahrt!
Da war zuerst in demselben Stockwerke mit uns ein abgedankter Lehrer, ein alter, gutmüthiger Mann, dessen einzige Beschäftigung darin bestand, sein mit vierzig Jahren Arbeit verdientes Gnadenbrod gemächlich zu verzehren. Ein friedlicher, jovialer Epikuräer, begoß er Morgens die Blumen eines kleinen Gartens, Mittags hielt er regelmäßig sein Schläfchen. Nach dem Essen ging er, die Abendluft zu genießen, in Gemeinschaft mit einigen Kanarienvögeln, die er aufgezogen hatte und die pickend und flatternd ihm zur Seite blieben.

Er hatte indeß seinen frühern Stand nicht so gänzlich aufgeben können und sein Hauptvergnügen bestand darin, daß er allen Dingen, allen Personen ein Sprüchlein anhängte, welches seine Schulmeister-Erinnerungen ihm darboten. Ich war ehedem ihm durch die Hände gegangen und nicht ganz und gar gefühllos für den prosodischen Fluß seiner Kernsprüche; dazu hatte er mich lieb und es geschah nicht leicht, daß er mir begegnete, ohne mich in seiner Weise anzureden:
und sein dicker Bauch schüttelte sich in langem, kräftigem Lachen, um das ich ihn beneidete, wenn ich auch nicht mit einstimmte. Wenn eine alte Magd ihm aus dem Dorfe irgend ein kleines, eigennütziges Geschenk brachte:
und das Bäuchlein setzte sich in Bewegung. Aber wenn es sich um seine Gemahlin handelte, dann nahm es kein Ende
und manche andre Redensart. Madame bereitete indessen ihre Speisen und fand die Redeweise ihres Gemahls höchst abscheulich, worüber sich dieser bewogen fühlte zu murmeln:

Im Stockwerke drüber wohnte ein achtzigjähriger, brummiger, mürrischer alter Rathsherr der Republik. Sommers saß er in einem großen Sorgenstuhle und verbrachte seine Lebenszeit neben dem Fenster, um die Straße auf's Genaueste zu beobachten. In allen Dingen sah er den Verfall des Staats und die Verderbniß der Sitten. An den frisch getünchten Häusern, an den frisch beworfenen Mauern, an den runden Hüten, an der Seltenheit der Zöpfe und vor allen Dingen an der Jugend der jungen Leute
sagte der Schulmeister. Winters steckte er seine mageren Beine in Pappenstiefeln und verlebte seine Stunden am Kamin, nur einmal alle Monate verließ er dasselbe, um an die Thür zu treten, versteht sich in Pappenstiefeln, und einigen Bettlern, seinen Zeitgenossen, eine Gabe zu verabreichen. In diesen alten, verwitterten Menschenresten erkannte er noch die Spuren der guten Zeit, die wurmstichigen Reste jener alten, so veränderten, so verfallenen Republik.

Ueber diesem mürrischen Greise wohnte in stiller Zurückgezogenheit eine zahlreiche Familie, deren Haupt ein im Steuerwesen angestellter Feldmesser war. Dieser Mann saß den ganzen lieben Tag an seinem Meßtische und brachte selbst einen Theil der Nächte über seinen Zeichnungen zu. Ich erinnere mich, daß er stolz auf sein mühevolles, unabhängiges Leben war, und wenn er hin und wieder einmal sich mit seiner Familie eine Lustpartie erlaubte, so kostete er selbst die Freude mit einer ernsten stolzen Miene, die mir, dem Jünglinge, eine mit Bewunderung vermischte Ehrfurcht einflößte
sagte mit ernster Miene selbst der Schulmeister.

Bevor wir zur Dachwohnung gelangen, kommen wir noch vor der Wohnung eines Baßspielers vorbei. Dieser gab den ganzen Tag über Stunden und behielt nur die Nacht für sich, um Weisen für sein Instrument zu componiren
Rings um den Musikanten herum ging es in eine Menge von Zimmern und Kämmerchen, welche an Studenten vermiethet und veraftermiethet waren, die bei ihm in die Kost gingen; diese Herren waren starke Raucher, nahmen ihre Vorlesungen durch, sangen Lieder, bliesen Horn oder spielten Flageolet, so daß in diesem Bereiche die Musik niemals abriß.

Und nun die besagte Dachwohnung.
Diese Dachwohnung war groß und hatte ein vortreffliches Licht. Der Feldmesser wollte sie haben und ich ebenfalls. Man brach ein Fenster durch, zog eine Breterwand und so hatten wir jeder unser Dachstübchen.
Ich fand hier die Aussicht auf den See und die Berge wieder. Mein Fenster befand sich in gleicher Höhe und gar nahe bei den großen gothischen Rosen, die in der mittleren Höhe der Thürme der Hauptkirche sich befinden. Von dieser erhabenen Gegend aus beherrscht der Blick die öden Dächer, und das Geräusch der Stadt erstarb, ehe es so weit gelangte.
Aber ich begann bereits in jenes Alter zu treten, wo solche Eindrücke nicht mehr ihre gewaltige Kraft üben, und jeden neuen Tag suchte mein Herz mehr in sich selber Bewegung und Leben.
Aus demselben Grunde war auch mein Hang zur Nachahmung nicht mehr so lebendig; es bedarf zu einer solchen Neigung einer Ruhe, die ich nicht mehr besaß. Oft aufgeregt, verwirrt von den unbestimmten Regungen einer Sehnsucht ohne Gegenstand vermochte ich nicht mehr auf mein Modell zu sehen, ich betrachtete meine undankbare Nachbildung mit Widerwillen, warf den Pinsel bei Seite und überließ mich meiner Träumerei ganze Stunden lang.
Dies innere Leben hat seine Wonne und seine Bitterkeit. Wenn diese Träume süß sind, so ist das Erwachen düster, niederschlagend; die Seele tritt wieder in die Wirklichkeit, nachdem sie ihre Kraft erschlafft oder verloren hat. Drum war ich denn nach solchen Stunden zur Wiederaufnahme meiner Arbeit unfähig und nicht weniger unfähig, die Träume wieder herbeizuführen; ich verließ dann das Haus, um meinen Unmuth draußen spazieren zu tragen.
Auf einem solchen Spaziergange geschah es, daß eine zufällige Begegnung mich aus diesem Zustande der Sehnsucht und halben Müßiggangs riß.
Eines Tages wollte ich in meine Wohnung durch die Thür, die auf der Kirchenseite unter den dicken Linden sich befindet, zurückkehren. Ein prächtiger Wagen hielt davor; kaum war ich an demselben vorüber, als eine Stimme, die ich augenblicklich wiedererkannte, mich voll Ueberraschung zurückkehren ließ.... »Herr Julius!« rief diese Stimme mit großer Bewegung.
In meiner Verwirrung zögerte ich näher zu treten, als ich zu bemerken glaubte, daß man mir winke. Ich wendete wieder um; in rascher Hast öffnete sich der Schlag und ich befand mich Angesichts der liebenswürdigen Lucy! Sie war in Trauerkleidern, ihre Augen naß von Thränen... Bei diesem Anblick brachen auch mir die Thränen hervor.
Ich erinnerte mich alsbald an ihr weißes Gewand, ihre kindlichen Befürchtungen, an die Worte des Greises, an seine Güte gegen mich. O! wie sehr verdiente er noch zu leben, sprach ich nach einer Weile, der Verlust ist schmerzlich, mein Fräulein!... Erlauben Sie mir, daß ich diese Zähren dem Gedächtniß seiner herzlichen Güte, das in mir lebt, zolle. Lucy hinderten ihre Gefühle zu antworten, sie drückte mir die Hand mit einer Bewegung, deren dankbare Huld durch eine anmuthige Zurückhaltung in Schranken gehalten wurde.
Ich hoffe, sagte sie endlich, daß Sie glücklicher sind, als ich, und Ihren Herrn Oheim noch besitzen... – Er lebt, versetzte ich, aber das Alter kommt immer mehr und beugt ihn zur Erde. Wie oft, mein Fräulein, habe ich an Ihren Vater gedacht!... und jeden Tag begriff ich Ihre Betrübniß mehr.
Lucy wendete sich jetzt zu einem Herrn, der neben ihr saß, und erklärte ihm in wenigen Worten auf Englisch den Zufall, dem sie vor fünf Jahren meine Bekanntschaft und die meines Oheims verdankte, und wie mein Wiedersehen, das ihr so lebhaft einen Tag vorgeführt habe, da ihr Vater so glücklich und liebevoll war, ihr diese schmerzliche Bewegung verursachte. Sie fügte noch eine Lobeserhebung über mich und meinen Oheim hinzu, und als sie davon sprach, daß ich Waise sei, bemerkte ich in ihren Mienen und in ihren Worten dasselbe Mitleid, welches mich früher so sehr ergriffen hatte. Als sie mit ihrer Erzählung fertig war, reichte mir der Herr, welcher nicht Französisch zu sprechen schien, die Hand mit dem Ausdrucke wohlwollender Achtung.
Da wandte sich Lucy an mich: der Herr ist mein Gemahl; er ist der Beschützer und Freund, den mein Vater selbst für mich erwählt hat. Nach jenem Tage, wo Sie ihn sahen, Herr Julius, sollte ich ihn nicht mehr lange behalten... Achtzehn Monate später rief ihn Gott zu sich ab... Mehr als einmal erinnerte er sich lächelnd Ihrer Geschichte... Wenn, fügte sie hinzu, auch Sie ein dem meinigen ähnliches Leid erfahren werden, so bitte ich Sie, mich davon zu unterrichten; ich will Ihren Oheim begrüßen... wie alt ist er?
Er tritt in sein fünfundachtzigstes Jahr.
Meine Antwort machte großen Eindruck auf sie; erst nach einigem Schweigen versetzte sie: Ich bin gekommen, um mit dem Maler zu sprechen, der das Bild meines Vaters gefertigt hat... Glauben Sie, Herr Julius, daß ich ihn allein treffen kann?
Ohne Zweifel, gnädige Frau, ertheilen Sie mir Ihre Befehle, ich werde sie meinem Kunstgenossen überbringen.
Sie unterbrach mich.
O! so haben Sie Ihrer Neigung folgen können!... Schön, ich nehme Ihr Anerbieten an; ich werde die Zeit bestimmen. Allein zuvor möchten wir, mein Gemahl und ich, gern etwas von Ihren Leistungen sehen. Wohnen Sie hier im Hause?
Ja, gnädige Frau.... Obgleich es mich etwas in Verlegenheit setzt, daß ich Ihnen nichts, als einige schlechte Versuche zu zeigen vermag, so schlage ich doch aus Eigenliebe die Ehre, die Sie mir erweisen wollen, nicht aus.
Wir sprachen noch einige Worte. Ich trat zurück und der Wagen entfernte sich.
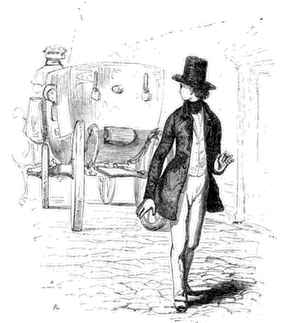
Diese unerwartete Begegnung gab alten süßen Regungen das Leben wieder und riß mich aus einem Zustande der Erschlaffung, worin ich mich seit einigen Monaten befand.
Doch darf ich's sagen? Wenn schon ich stets meine Jüdin geliebt und ihr Gedächtniß bewahrt hatte, so verlor doch nichts desto weniger mein Schmerz von diesem Tage an seine Bitterkeit, meine Seele wurde gleichsam von der Vergangenheit losgebunden und begann eine freie Erhebung nach der Zukunft, süß beladen mit einer Erinnerung, die ihr nicht mehr so schmerzlich war, ohne daß sie aufhörte, theuer und lieb zu sein.
Gleichwol war diese Begegnung nicht frei von jeglicher Wolke gewesen. Obgleich ich Lucy vergessen hatte, obgleich ich niemals, selbst nicht in den überschwänglichsten Träumen, im entferntesten den Gedanken hegen konnte, ihr etwas zu sein, so war mir doch vom ersten Augenblicke an der Anblick jenes neben ihr sitzenden Herrn beklemmend gewesen, und als ich aus Lucy's Munde vernahm, daß sie vermählt war, zuckte Verwirrung und Eifersucht durch mein Herz.
Doch war das ein Uebergang; noch ehe ich den Wagen verließ, hatte mein Herz sich mit dem Herrn ausgesöhnt und ich sah in Lucy nichts mehr als seine liebenswürdige Gemahlin, die er mir gestattete lieb zu haben.
Die nächsten Tage lebte ich in dieser Erinnerung und der Hoffnung, Lucy bald wiederzusehen; ich hatte einige Kopien verfertigt, unter anderen eine von der Madonna, zwei oder drei Portraits, so wie einige Compositionen, alles meistentheils mehr als mittelmäßig ausgeführt, jedoch nicht ohne gewisse Anzeichen von Talent. Nun, man kann denken, wie das Knötchen mir beistand, mit der größten Sorgfalt die Bilder in's vortheilhafteste Licht zu stellen, und alles war zum Empfange Lucy's bereitet, als sie in der That erschien. Ihr Gemahl begleitete sie.
Noch heute kann ich an diese junge Dame nicht denken, ohne daß mir bei der Erinnerung das Herz schwillt. Daß ich diese so wahre Güte, deren Reiz durch ihren Stand, ihren Schmuck, ihren Reichthum noch erhöht wurde, nicht schön genug malen kann; diese Einfachheit der Gefühle, welche die Manieren und Vorurtheile der großen Welt weder zu verfälschen noch zurückzudrängen vermochten! Obgleich ein schwermüthiger Zug ihr eigen war, so durchdrang doch der Hauch eines wohlwollenden Lächelns jedes ihrer Worte, und schon der freundliche Ausdruck ihres Blicks verlieh selbst ihrem Schweigen einen unwiderstehlichen Zauber. Kaum war sie in mein bescheidenes Dachstübchen eingetreten, so waren ihre ersten Worte ermuthigende Glückwünsche. Sie betrachtete meine Werke mit besonderer Theilnahme und in allem, was sie ihrem Gemahl auf Englisch sagte, athmete ein entzückendes Wohlwollen. Nur einen Augenblick redeten Beide flüsternd zu einander; allein mit einem Tone und einem Ausdruck, der nur zu geeignet war, mich in jene süße Verlegenheit zu setzen, welche die Begleiterin einer freudigen Erwartung ist.
Während ich alle meine Bilder auf Lucy's Ansuchen hervorholte, um sie ihren Blicken vorzuführen, vernahm ich den Schritt meines Oheims auf dem Vorsaal. Ich lief hin, um die Thür zu öffnen.

Lucy mußte etwas ahnen; sie stand auf. Beim Anblick meines alten Oheims ging sie ihm entgegen; dann dachte sie an sich selbst und konnte ihre Bewegung nicht verbergen. Mein Oheim, heiter wie immer und seiner alten, höflichen Sitte getreu, erfaßte die Hand der jungen Dame, neigte sich und brachte dieselbe an die Lippen. Erlauben Sie, schöne Dame, sprach er, daß ich Ihnen den Besuch erwidern darf, womit Sie mich vor fünf Jahren beehrten, als Sie den Taugenichts da mir zurückbrachten... Ich weiß, fuhr er fort, als er Lucy's Thränen rinnen sah, ich weiß, Sie sind betrübt... jener edle Greis war Ihr Vater! ich weiß auch, daß dieser Herr Ihr Gemahl ist... und würdig ist, es zu sein, da Er ihn für Sie erwählt hat.
Der Herr ergriff in diesem Augenblicke die Hand meines Oheims und lud ihn ein, sich auf einen Stuhl zu setzen, den er selber herangerückt hatte, während ich in gespanntester Aufmerksamkeit auf diese Scene hinschauete.
Verzeihen Sie meine Bewegung, sagte jetzt Lucy... als ich Sie zu Lausanne sah, Sie und meinen Vater, beide beinahe in gleichem Alter, in einem Zimmer bei einander, beide für das Glück zweier Personen so nothwendig... damals empfand ich Ahnungen, welche Ihre Gegenwart mir in diesem Augenblicke allzulebendig zurückruft... Ich danke Gott dafür, daß er Sie erhalten hat. Wenn mir nicht der Zufall Herrn Julius in den Weg führte, so war meine Absicht, Genf nicht zu verlassen, ohne Erkundigungen über Sie einzuziehen... Aber es freut mich ungemein dem Anscheine nach Sie so wohlauf zu sehen, und ich empfinde eben so viel Dank als Verlegenheit darüber, daß Sie sich so hoch heraufbemüheten, mir dieses Vergnügen zu bereiten.
Beste Dame, versetzte mein Oheim, Sie sind ein liebenswürdiges Wesen! und es ist eine Lust, Sie anzuhören... Zu Lausanne stieg er auch hoch, Ihr Vater... und er wurde dafür nicht mit einem solchen Empfange gelohnt, wie man ihn nicht ohne Ihre Stimme, ohne Ihr Wesen, ohne Ihr Herz gewähren kann.... Theuerste Dame, seien Sie glücklich... Bald, ja bald steige ich noch höher!... wenn mein armer Julius dort nichts dagegen hat.
Ach, nimmermehr, bester Oheim, rief ich aus und war tief ergriffen von der eben so traurigen, als schlagenden Aehnlichkeit, welche meine gegenwärtige Lage mit derjenigen hatte, worin sich damals Lucy befand. Und in den Mienen der jungen Dame las ich, daß ihr Gedanke in diesem Augenblicke mit dem meinigen zusammentraf.
Doch, ich will Sie nicht stören, bemerkte mein Oheim nach einigen Wechselworten. Sie besehen die Versuche meines armen Julius... ich will Sie allein lassen... Ich bitte Sie, sagen Sie dem Herrn, daß ich heute bedauere, nicht lieber Englisch zu verstehen als Hebräisch, da würde ich das Vergnügen haben, ihn unterhalten zu können.
Dann faßte er die Hand Lucy's und sprach: Leben Sie wohl, mein Kind... seien Sie glücklich... Es ist ein Recht, das dem Greise zusteht, daß er eine so junge Dame mit seinen Segenswünschen begleite... Also thue ich... Leben Sie wohl, werthester Herr, Sie sind mit einander verbunden, ich werde Sie auch in meiner Erinnerung nicht von einander scheiden. Nach diesen Worten verbeugte sich mein Oheim Tom abermals, küßte Lucy's Hand und zog sich zurück. Wir begleiteten ihn alle drei, sämmtlich von dem lebhaften Gefühle der Ehrfurcht und Zuneigung erfüllt, welches in Verbindung mit einem schwermüthigen Gedanken das liebenswürdige Greisenalter einflößt.
Als mein Oheim sich entfernt hatte, setzten wir uns. Lucy sprach von ihm, sie wollte in seinen Zügen Aehnlichkeit mit ihrem Vater finden, besonders in dieser heitern Freudigkeit, in dieser so wahren Höflichkeit unter etwas alten oder vertraulichen Formen. Und oft nach diesen Bemerkungen hielt sie inne, als würde sie von dem Gedanken an den Verlust, den eine nahe Zukunft mir drohete, trübe gestimmt. Hierauf ging sie zu einem andern Gegenstande über: Herr Julius, sagte sie und eine leichte Röthe überflog dabei ihre Wangen, wir haben das Ihnen bekannte Portrait meines Vaters mitgebracht, unser Wunsch wäre, zwei Kopien davon zu besitzen. Ich hoffe, Sie werden mir die Gefälligkeit erweisen, diese Arbeit über sich zu nehmen. Ihr Talent ist uns Bürge, daß Sie unseren Erwartungen entsprechen werden, wenn schon das Andenken, welches Sie meinem vielgeliebten Vater bewahrt haben, ein Grund ist, der mich weit mehr bestimmt.
Man denke sich meine Freude; ich mußte dieselbe zurückhalten; allein Lucy und ihr Gemahl konnten durch meine Verwirrung und Verlegenheit hindurch die ganze Lebhaftigkeit derselben ermessen. Dieselbe wurde durch die Zuversicht, welche ich hegte, daß eine solche Arbeit meine Kräfte nicht überstieg, noch vermehrt. Denselben Tag noch holte ich das Portrait ab und ging an's Werk, ich sah mich diesmal ganz entschieden in die Bahn der schönen Künste hineingeworfen.
Unter andern Umständen hätte dies Portrait mir einige Traurigkeit einflößen können, denn es lenkte meine Einbildung lebhaft auf die Vergangenheit zurück, wo ich jene beiden Wesen, die einander so theuer waren und die jetzt der Tod schied, im vollen Leben erblickte; die Jungfrau, geschmückt mit dem lachenden Glanze der Pracht und Jugend, welche ihre Thränen noch nicht getrübt hatten, und Lucy jetzt in Trauer und Klagegewänder gehüllt... Allein ich war zu sehr von der Freude und Dankbarkeit erfüllt, als daß der Eindruck dieses Gegensatzes in mir hätte vorherrschend bleiben können.
Welch' herrliche Beschäftigung! Mein Stift hatte dies theure Gesicht nachzuzeichnen, er hatte die Umrisse ihrer Gestalt, die weiche Anmuth ihrer Haltung wiederzugeben; oft blieb ich bezaubert vor meinem Modell stehen und war für einige Augenblicke zu aufgeregt, um fortarbeiten zu können.

Ein vortreffliches Weib! sagte mein Oheim, als er diese großen Ereignisse von mir erfuhr; ich bedaure, nicht lieber Englisch statt Hebräisch zu verstehen,... nun bist Du recht zufrieden, mein armer Julius!... nun sei es. Aber daß die Arbeit Dir Ehre mache! setzte er hinzu, daß man die Gesetze des Lichts und Schattens beobachtet sehe, und die beiden Perspectiven, sowol die Linear- als Luftperspective... und dann, das Kunstgefühl... und... Vortreffliche Frau! In Wahrheit eben so liebenswürdig als schön!...

Die Kalesche Lucy's hatte während ihres letzten Besuchs auf der Seite des Hauses gehalten, die dem Hospital gegenüberliegt, während die Wagen, welche die Modelle zu meinem Kunstgenossen brachten, stets an der Kirchenseite angehalten hatten.
Dieser Umstand erregte die Aufmerksamkeit der Miethsleute. Als diese endlich nach tausenderlei Muthmaßungen, in denen sie am allerwenigsten auf mich gerathen hatten, bemerkten, daß die Kalesche mit den Wappenschildern meinetwegen da anhielt, stieg der Ruf meines Ruhmes, eines funkelnagelneuen und deshalb um so glänzenderen Ruhmes von Stock zu Stock, und der alte Schulmeister that sich etwas darauf zu gute, daß er in Bezug auf seine Vorhersagungen sprach:
Was für eine schlechte Redensart führst Du da? unterbrach ihn seine Frau.
Acht auf Deine Töpfe!

Ich dächte, daß funfzig Jahre Schulmeisterei Dir diese verwünschte Sucht lateinischer Floskeln, die Dich unerträglich machen, verleidet hätten. Kannst Du diese Dummheiten nicht sein lassen und wie alle Welt Französisch sprechen?
Du weichst sehr von Horaz ab, meine Liebe, denn der sagt:
und wenn ich Dich Nachts damit verschone, kannst Du mich wol Tags über anhören.
Horaz und alle diese Leute sind große Dummköpfe, wenn sie Dir so etwas eingebildet haben. Nachts schnarchst Du, daß ich nicht schlafen kann, und am Tage machst Du mich taub mit Deinem Kauderwelsch.
Du schimpfst da auf Schönheiten, die Du nicht verstehst. Nimm doch Vernunft an, liebe Frau; wenn ich Deine Gerichte esse und sie gut finde, kannst Du doch auch meine Verse loben und ihren Duft empfinden...
Meine Gerichte sind gut, aber Dein Gebräu abscheulich!
Und ich bleibe dabei, was ich von dem jungen Manne sagte:

Andrerseits hatte der Baßspieler und seine ganze Sippschaft (ich habe schon anderswo einmal bemerklich gemacht, daß Studenten ihr Leben am Fenster verbringen) nicht ermangelt, die glänzende Kalesche zu bemerken. Wenigstens funfzehn Köpfe zeigten sich auf einmal an den Fenstern, die auf die Straße gingen, sahen neugierig die Diener herabspringen, den Schlag öffnen und die junge Dame, auf den Arm ihres Gemahls gestützt, in die Hausflur treten. Sogleich begannen die Muthmaßungen: Zu wem geht sie?... – Wär's vielleicht, dachte der Musiker, ein Dilettant, den die Vorsehung... und alle Köpfe hatten sich an die Fenster, Dachluken und Gucklöcher begeben, welche auf den Hof gingen...
Lucy stieg die Treppe hinauf, Lucy durchschritt den letzten Stock; sicher geht die schöne Dame zu dem jungen Maler!! und mein Ruhm stieg bis zu den Sternen.
Nur der Feldmesser und seine Familie hatten für diese großen Ereignisse keine Acht. Der Herr vom Hause befand sich auf den Feldern und maß seine Winkel, die Mutter befaßte sich mit den Haushaltssorgen, während die älteste Tochter, seitwärts von mir in dem Zimmer, an den Blättern ihres Vaters arbeitete. Inmitten ihres thätigen, bedrängten Lebens gab es wenig Zeit auf die Angelegenheiten der Straße zu passen oder auf den Verkehr der Nachbarn.
Indessen schritt meine Arbeit vorwärts. Mit der Morgendämmerung stand ich auf und stieg in meine Werkstatt, um daselbst mit Eifer bis zur Tagesneige zu arbeiten. Diesen anhaltenden Beschäftigungen verdanke ich's, daß ich auch in etwas die Bekanntschaft des Feldmessers machte. Auch er verließ mit der Morgenröthe nebst seiner Tochter seine Wohnung; wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und während er in sein Arbeitszimmer trat, um dem jungen Mädchen Arbeiten für den Tag anzuweisen, ging ich meinerseits in meine Werkstatt, um mich einzurichten. Die Nachbarschaft und diese Gleichförmigkeit der Gewohnheiten brachten uns allmälig etwas näher, so daß, trotz des Werthes, den der Mann auf die Benutzung seiner Zeit legte, es bereits dahin gekommen war, daß er eine oder zwei Minuten zum Plaudern auf der Thürschwelle verwendete, wenn der Gegenstand, den wir beim Hinaufsteigen besprochen hatten, durchaus noch ein Paar kurze Worte mehr heischte. Während wir hinaufstiegen, ging seine Tochter, mit dem Schlüssel des Arbeitszimmers in der Hand, vor uns her. Sie war von anziehendem Wuchs und einem mehr edeln als hübschen Gesichte. Immer in bloßem Kopfe und äußerst einfach angezogen, waren ihre schönen an der Stirne anliegenden Haare bei ihrer Jugend und Frische ihr schönster Schmuck.

Der Einfluß einer strengen Erziehung gibt sich bei denen, welche so glücklich waren, eine solche zu genießen, in jedem Alter kund. Obgleich unterwürfig und schüchtern, trug das junge Mädchen doch auf ihrer Stirn den Ausdruck jenes etwas rauhen Stolzes, welcher sich weit kräftiger in dem Gesichte ihres Vaters aussprach. Unbekannt mit den Sitten der Welt, hatte sie ihre eigenen, edeln, zurückhaltenden, so, daß sie, einfach, wie ihr Stand, durchaus nicht den gemeinen, gewöhnlichen Ausdruck zeigte.
Aber es war doch eine höchst eigenthümliche und anziehende Sache, dieses junge Mädchen in dem Alter der Lust so fleißig zu sehen, ohne Rast und fast ohne Erholung sich Arbeiten widmend, die gewöhnlich ihrem Geschlechte fremd sind, und so jung wie sie war, gemeinschaftlich mit dem Vater für den Unterhalt der Familie sorgend.
Ich verfehlte nicht, mich Morgens regelmäßig einzustellen, damit ich nicht nöthig hätte, allein in meine Werkstatt steigen zu müssen. Nur geschah es einige Mal, daß der Feldmesser Tags zuvor die Arbeit angewiesen hatte und Henriette allein hinaufstieg. Das waren unglückliche Tage für mich; denn ich fürchtete, daß ich ihr dieselbe Verlegenheit bereiten möchte, die ich selber bereits empfand, und ich wußte nichts Besseres zu thun, als meinen Schritt zu beflügeln, wenn ich mich vor ihr befand, oder langsamer zu gehen, wenn ich sie vor mir hinaufsteigen hörte.
Saß ich einmal in meiner Werkstatt, so gewährte mir die Anwesenheit meiner unsichtbaren Genossin einen seltsamen Reiz. Ich fand eine angenehme Zerstreuung in dem geringsten Geräusche, das mir ihren Schritt, ihr Verhalten oder ihre verschiedenen Bewegungen vergegenwärtigte. Und wenn dann die Mittagsstunde sie hinabrief, so empfand ich eine Einsamkeit und Langeweile, so daß ich mich nach und nach daran gewöhnte, mich zu derselben Stunde, wie sie, zu entfernen.
Inmitten meiner neuen Zerstreuungen fiel mir oft ein Umstand ein. Die ersten Tage vor meinem regelmäßigen Morgeneintreffen hatte sie zuweilen während der langen Arbeitsstunden ein Liedlein gesungen, dann aber hatte der Gesang plötzlich aufgehört, und just eben, als ich begann, demselben mit größerm Vergnügen zu lauschen. War es Zufall? Geschah es meinetwegen? War ich ihr schon genugsam aufgefallen, daß sie sich diesen Zwang anlegte? Bedeutete dieses Schweigen, daß sie sich mit mir beschäftigte, wie ich mich mit ihr?
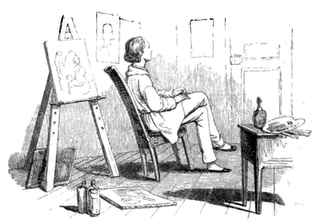
Das waren hundert Fragen und eine Menge anderer dazu, die mir unendlich viel zu denken und sinnen gaben. Nach Vollendung meiner Kopien unternahm ich nichts mehr; meine Leinwand blieb leer, meine Pinsel lagen zerstreut umher. Nichts hatte Reiz für mich, neben dem Gefühle, welches meine Tage erfüllte.
Und es waren nicht mehr wie sonst Träumereien, deren Leere und Hohlheit ich mir selbst gestand. Dieses Mal vielmehr kam der Gedanke an Heirath von vorn herein in meinen Sinn, und als er einmal da war, wollte er nicht wieder fort.
Glückliches Alter, in dem ich mich damals noch befand! letzte schöne Tage, die bald das Alter der Erfahrung und Reife abschließen soll! Ehe ich noch ein Wort mit dem Mädchen gesprochen hatte, nahm ich mir vor, sie zu heirathen. Bevor ich noch über diesen beschwerlichen Stand einmal nachgedacht, den die Dichter uns als das Grab der Liebe malen und die Moralisten als ein heiliges aber fesselschweres Joch, steuerte ich darauf los wie zu einem Gestade voll Blumen und Duft. Bevor ich mich darum kümmerte, wie oder wovon ein Haus besteht, oder eine Familie aufblüht, beschäftigte ich mich bereits und vorzugsweise, gewisse Anordnungen herauszuklügeln, deren leichte Möglichkeit meinen Wünschen allen Reiz naher Wirklichkeit verlieh.
In der That, mein ganzes Streben ging darauf hin, eine Thür in die Breterwand zu brechen; dann wurde Henriettens Dachstübchen unsere Hochzeitskammer, das meinige unser Arbeitszimmer, wo, sie an ihren Schreibereien, ich an meiner Leinwand, uns die Tage in Frieden, Glück und Liebe gesponnen, dahinflossen.
Eines Morgens dachte ich, in mein Fenster gelehnt, an dergleichen Dinge und schaute gewohnheitsmäßig dem alten Schulmeister zu, welcher die Tulpen seines Gärtleins begoß; da erschien auf einmal Henriette an ihrem Fenster.

Sie suchte mich nicht, wie ich an der lebhaften Röthe, die plötzlich ihre Wangen färbte, erkennen konnte. Indeß, um nicht merken zu lassen, daß meine Anwesenheit einen größern Eindruck auf sie mache, als ihr Stolz zu gestehen erlaubte, so konnte sie nicht sogleich wieder zurückgehen. Sie blieb also; nur um ihre Verlegenheit zu verbergen, blickte sie auf die entgegengesetzte Seite nach den Wolken in der Luft.
Die Gelegenheit war vortrefflich, um endlich mit derjenigen, die ich zu meiner Frau machen wollte, ein Gespräch anzuknüpfen. Ich raffte also meine Kräfte zusammen, um meine lebhafte Unruhe zu überwinden.
Diese Tulpen... sagte ich zum Schulmeister...
Kaum hatte ich die beiden Worte ausgesprochen, da zog Henriette ihren Kopf zurück, ehe noch der Schulmeister den seinigen emporgehoben hatte, und mit der Unterredung blieb es dabei.

Ah! ah! Sie schauen mir zu? sagte der Schulmeister; Schalk! Ich ahne, was Sie denken:
Erstlich, junger Herr, sind dies Tulpen:
Sehen Sie, diese gesprenkelte, die in Holland zwanzig Dukaten werth wäre, habe ich meiner Gemahlin bestimmt:
Der Schulmeister citirte noch, als ich verwirrt und ärgerlich bereits mein Fenster wieder geschlossen hatte.
Der schlechte Erfolg dieses Versuchs benahm mir die Lust, ihn zu erneuern, so daß ich während mehrer Wochen mich begnügte, bescheidentlich die vorerwähnten Gewohnheiten weiter zu verfolgen.

Henriette bekam zuweilen einen Besuch. Wenn die Sorgen der Haushaltung der Mutter einige Augenblicke erlaubten, so kam sie herauf, um neben ihr zu arbeiten. Sogleich näherte ich mich der Zwischenwand und hielt meinen Athem an, um ihre Worte besser zu vernehmen.
Dein Vater, sprach die Mutter, wird gegen sechs Uhr zurück sein; ich habe Deine Brüder bereits angekleidet, damit wir zusammen ausgehen können.
Ihr werdet wol ohne mich gehen müssen, Mutter, denn ich sehe nicht ab, wie diese Arbeit morgen fertig sein soll, wenn ich nicht dabei bleibe. Donnerstag, weißt Du, ist der Hauszins fällig.
Du bist der Familie höchst unentbehrlich, mein liebes Kind, ich freue mich, daß Deine Brüder Dir werden Beistand leisten können.
Ich freue mich des Vaters willen darüber.
Dein Vater ist, gottlob, stark und noch jung; ich fürchte für ihn nichts als Krankheit und Alter... Da könntest Du uns wol fehlen, Henriette.
Ich bin auch stark und hoffe am Leben zu bleiben.
Ich hoffe das auch, liebes Kind; allein Du kommst in die Jahre, wo Du Dich verheirathen könntest.
Meine Mutter, ich bleibe bei Euch; lieber will ich in dieser Bedrängniß, die wir zusammen theilen, bleiben, als sie gegen eine andre, in der ich Euch entfremdet wäre, vertauschen.
Also einen reichen Mann begehrst Du, Henriette?
Nein, meine Mutter; denn ich wäre ihm nicht gleich. Aber ich will Euch nicht meine Arbeit entziehen, um sie einem Herrn zuzubringen, dem ich sie nicht schuldig bin.
Du hast Recht, Henriette, keinen Reichthum zu begehren, allein bedenke, mein Kind, daß Deine Mutter sich in ihrer Bedrängniß recht glücklich fühlt und daß all ihr Glück ihr von ihrem Herrn und ihren Kindern herkommt. Eine noch größere Armuth, aber mit einem achtbaren Manne, ist besser, als Mädchen bleiben, Henriette. Das Unglück kommt vom Laster und nicht von der Armuth.
Meine Mutter, es gibt wenig Männer, wie mein Vater.
Das hieß sich mir bedeutend nähern, ohne im geringsten Arg von mir zu haben; das Gefühl, welches mir dieses tugendsame, stolze Mädchen einflößte, war der Art, daß ich einen sehr bittern Verdruß darüber empfand. Uebrigens war die Unterhaltung durchaus nicht nach meinem Sinne. Henriettens Worte verkündeten zwar ein wirklich freies Herz, aber auch ein starkes, das über sich selbst verfügte, und wenn es auch geschaffen war, sich ohne Wiederkehr zu geben, doch nicht jene zarten, leicht entzündbaren Seiten darbot, durch welche allein ein junger Mann meiner Art den Zugang zu finden sich schmeichelt. Das Einzige, was meine Hoffnungen ermuthigte, waren die Worte der Mutter. Die gute Frau schien mir, indem sie die Achtbarkeit der Armuth pries, wahrhaft göttlich und ganz zu meinen Gunsten zu reden. Denn ich war ehrenhaft, aber vor allen Dingen war ich arm.
Unglücklicherweise hing Henriette nicht von ihrer Mutter allein ab. Es war ein auffallender, jedoch natürlicher Zug, daß jener Charakter des Stolzes und der Unabhängigkeit, welcher bei den Mitgliedern dieser Familie so sichtbarlich hervorsprang, sich bei jeglichem mit einer gänzlichen Unterwürfigkeit unter den Willen des Familienhaupts, der die Seele Aller bildete, vereinigte. Der Feldmesser, ein fester, strenger, arbeitsamer Mann, übte, wenn er auch in seinem Wesen nicht sehr gesprächig und in seinen Formen nicht übermäßig höflich war, auf alle die Seinigen die mächtige, einflußreiche Gewalt des guten Beispiels, der Aufopferung, untadelhaften Wandels. Seine Frau liebte ihn bis zur Verehrung, und seit ein selbständigeres Urtheil Henrietten gestattete, ihren Vater mit andern Männern zu vergleichen, gewöhnte sie sich, ihn höher als die Mehrzahl derselben in ihrer Achtung zu stellen; so, daß ihre mehr tiefe als zärtliche, mehr ehrerbietige als mittheilende kindliche Liebe dem Urheber ihrer Tage einen unbedingten Gehorsam zollte. Weder ihr Herz noch ihre Person konnten einem Andern angehören, als dem der Vater, der in ihren Augen so würdig war, ihre Wahl zu leiten, den Vorrang ertheilte.
Ich habe seitdem Gelegenheit gehabt wahrzunehmen, und zwar oft mit jenem Gefühle der Bewunderung, welches die Augen mit heißen Thränen füllt, wie anziehend und ehrwürdig diese bescheidene Familie, wie wahrhaft groß dieser geringe Mann war. Allein damals erschienen mir diese Strenge, diese Unterwürfigkeit, diese Tugendhaftigkeit als eben soviel Hindernisse meiner Wünsche. Was kümmerte es mich denn auch, daß die Frauen unterwürfig waren, da ich meinerseits nicht wußte, wie ihrem Herrn und Meister zu nahen? Was lag mir daran, daß der Feldmesser streng, entschieden, arbeitsam war, wenn diese Eigenschaften, die er zweifelsohne in seinem Schwiegersohne wiederfinden wollte, just mir gebrachen? Zwar konnte er dafür die guten Eigenschaften, welche ich zum Ersatz für die seinigen bieten konnte, mir zu gute rechnen; allein ich hegte wenig Hoffnung, in diesem Punkte viel Glück zu erfahren. In der That, die rauhe Unzugänglichkeit des Mannes, sein stolzes, empfindliches Auge, seine abgemessene Rede und der Einfluß seines Charakters verursachten mir, ihm gegenüber, eine Linkheit, welche alle meine Lichtseiten in den Schatten stellte.
Also stand alles mir entgegen, und wie das zu gehen pflegt, jedes Hinderniß machte meine Wünsche nur glühender; jemehr ich daran dachte, wie schwer, ja unmöglich es sei, Henriettens Hand zu erlangen, destomehr vereinigte sich all' mein Begehren in einen sehnlichen, in einen einzigen Wunsch, den, diese Hand zu erlangen.
Dies verleitete mich nun zu einem ritterlichen, aber verzweifelten Beginnen; nämlich: den ersten Schritt mit Gewalt zu thun, indem ich meiner Zukünftigen das leidenschaftliche Geständniß meiner Gefühle machte. Es handelte sich in der That auch nur darum, eine günstige Gelegenheit zu erspähen. Ich erspähete also, und so lange und so vortrefflich, daß eine Gelegenheit um die andere mir entschlüpfte, ohne daß ich zu einer Erklärung gelangte.
Es war Anfangs des Morgens. Wir stiegen zuweilen allein hinauf, und ich war mit Henrietten schon zu dem Grade der Vertraulichkeit gekommen, daß ich nach dem Gruße mich an sie wendete, um nach ihrem Vater zu fragen und meine Ansicht über das langweilige Regenwetter oder die schönen Tage auszusprechen. Zehnmal wenigstens ermunterte mich meine Kühnheit, weiter zu gehen und ein entscheidendes, zärtliches Geständniß auszusprechen; doch stieg mir in dem entscheidenden Augenblicke das Blut in die Wangen, die Verwirrung raubte mir die Sprache und ich verschob es auf einen Augenblick, wo ich ohne Erröthen und ohne Verwirrung sein würde. Während ich so auf den günstigen Augenblick wartete, mischte sich der Feldmesser unmerklich wieder in's Spiel, und Henriette stieg nicht wieder allein zum Dachstübchen hinauf.
Aber die Liebe ist so erfinderisch! Zur Stunde des Mittagessens ging und kam Henriette, ohne begleitet zu sein; ich richtete mich also ein, daß ich mit ihr zusammenging. Das Ding gelang vortrefflich. Mir fehlte nichts mehr, als mich zu erklären, da verlegte die Familie auf einmal plötzlich ihre Essenszeit und ich mußte Mittags wie Abends allein die Treppen auf und ab wandeln.
Nun blieb noch ein letztes Mittel, allerdings sehr gewagt, aber unfehlbar. Dies war nämlich, unter irgend einem Vorwande mich zu Henriette zu begeben und daselbst meinen Gefühlen freie Sprache zu verleihen. Gar manches Mal machte ich mich auf den Weg, allein jedes Mal blieb mir nichts übrig, als wieder umzukehren, denn die Mutter Henriettens fing nach und nach an, ihr bei der Arbeit Gesellschaft zu leisten.
Ich verdanke es den Lehren des Herrn Ratin und seinen zuchtreichen Reden, daß ich während des ganzen Verlaufs einer Jugend, worin ich kaum etwas anderes that als lieben, niemals an eine Frau das mindeste zärtliche Wort richtete. Diese dumme Schüchternheit ist ein Gut, dessen Werth ich gegenwärtig erkenne. Sie ist's, die dem Jüngling jene angeborene Verschämtheit, welche, einmal verloren, nicht wiederkehrt, erhält und ihn dieselbe bis in die Ehe hinein behaupten läßt; sie bewahrt sein Herz jung und rein; sein Herz füllt sich mit tausend regen, zärtlichen Gefühlen, deren Trieb er unterdrückt, doch nur, um den reinsten und reichsten Zoll derjenigen darzubringen, welche die Gefährtin seines Lebens sein wird.
Allein damals dachte ich anders. Ich war unwillig über mich selber und überlegte, wie oft bereits diese unheilbare Schüchternheit meine Zunge gebannt hatte, wo alles mich zum Sprechen einlud, und ich begann bereits zu glauben, daß ich vermöge dieses angeborenen linkischen und blöden Wesens ewig Junggeselle bleiben müßte, blos weil ich meine Gefühle nicht auszusprechen vermochte. Glücklicherweise kam der Zufall mir zu Hilfe.
Als ich so eines Morgens meinen entmuthigenden Gedanken nachhing, klopfte es an meine Thür. Ich eilte zu öffnen: es war Lucy. Der Besuch dieser Dame erfüllte mich mit heitrer Stimmung, denn ich wußte im Voraus, wie schmeichelnd verbindlich ihre Rede war, und bildete mir fest ein, daß jenseit der Scheidewand Henriette kein Wort verlor.

Lucy kehrte von einem Ausfluge in die Schweiz zurück und kam, um nach ihren Kopien zu fragen. Sie war allein, ich zeigte ihr dieselben; sie war so freundlich, davon entzückt, bezaubert zu scheinen und mich mit Lobeserhebungen über meine Talente zu überschütten. Auch war ich außer mir vor Freude, als sie auf einmal abbrach und mich fragte: Sie waren gestern nicht zu Hause?
Hatten Sie sich bemüht, bis zu meinem Zimmer zu steigen, gnädige Frau? Gerade gestern Morgen ließ mich mein Oheim zu einem Spaziergange mit ihm abrufen.
Dies sagte mir eben eine junge Person, die in dem Zimmer nebenan arbeitet und bei der ich mich einige Augenblicke erholte. Können Sie mir nicht sagen, wie sie heißt?
Bei dieser Frage erröthete ich bis über die Stirne. Lucy bemerkte es und verbesserte sich nicht ohne einige Verlegenheit: Ich habe Ihnen da eine dumme Frage gethan, die etwas zudringlich sein kann, entschuldigen Sie, Herr Julius... Mein einziger Beweggrund war das Verlangen, den Namen des jungen Mädchens zu wissen, deren Miene, Haltung und Benehmen meine Theilnahme erweckt haben.
Sie heißt Henriette... versetzte ich, noch in größter Verwirrung. Es ist dies ein Name, den ich nicht ohne Bewegung ausspreche, obgleich ich mir ihn unaufhörlich wiederhole... Aufgemuntert durch die Miene, womit Lucy mich anhörte, vorzüglich aber aufgemuntert von dem Gedanken, das große Wort meines Geständnisses zu fördern, vielleicht sogar zu Stande bringen, fuhr ich fort: Da ich gewagt habe, soviel zu sagen, glaube ich noch mehr sagen zu müssen... Dies junge Mädchen, alle Tage sehe ich sie, ich arbeite neben ihr, ich liebe sie!... und Ihre Frage hat mich so bestürzt, als hätten Sie ein Geheimniß überrascht, welches bisher in der Tiefe meines Herzens verborgen war!... Nun wissen Sie genug, um meine Empfindungen zu begreifen und die Wünsche, welche sie in mir erwecken, wenn ich mich überreden könnte, daß sie günstig aufgenommen würden...
In diesem Augenblicke wurden wir unterbrochen; es war der Gemahl Lucy's. Wir kamen wieder auf die Kopien zu sprechen; bald darauf verließen sie mich.
Nach diesen Vorgängen fühlte ich das Bedürfniß, allein zu sein. Freudestrahlend, entzückt, erleichtert, bewunderte ich, was ich zu sagen gewagt hatte, und so vortrefflich, so zur rechten Zeit. Und wie leicht es ist, dachte ich.
Und was mich am meisten entzückte, war, daß Henriette, der es doch jeden Augenblick freistand, ihren Unwillen dadurch kund zu geben, daß sie sich entfernte, das Dachstübchen erst nach der Ankunft von Lucy's Gemahl verlassen hatte.
Auf diesen Umstand bauete ich eine Welt von Seligkeit. Henriette hatte meine Erklärung angehört, also gut aufgenommen; sie hatte dieselbe gern gehört, weil ihr Herz mir gehörte. Kurz, da sie um ein Uhr nicht, wie gewöhnlich, wieder heraufkam, so überredete ich mich alsbald, daß sie als gehorsame, zärtliche Tochter meine Wünsche ihrer Familie vorgetragen habe und diese sich jetzt darüber berathe.

Ich empfand daher die süßesten Qualen der Erwartung, bis ich gegen drei Uhr nach Mittag jemand die Treppe heraufkommen hörte. Die Person ging festen Schritts auf meine Thür zu und öffnete ohne Umstände. Es war... es war... der Feldmesser!

Mein Gesicht mußte sich wol nicht im gehörigen Zustande der Ruhe befinden, denn der Feldmesser sprach barsch: Mein Besuch macht Sie erbleichen, und doch hätten Sie sich desselben wol versehen können.
In der That, mein Herr, stotterte ich, ich schmeichelte mir...
Fassen Sie sich, setzen wir uns.
Wir setzten uns. Ich pflege in allen Dingen geradeaus zu gehen, hub der Feldmesser an; deshalb sehen Sie mich hier. Er warf einen von Stolz funkelnden Blick auf mich: seit längerer Zeit, mein Herr, misfällt mir Ihr Benehmen. Ich glaubte genugsam dagegen vorgebeugt zu haben... aber heute Morgen haben Sie im Beisein einer dritten Person meine Tochter compromittirt!... Was soll dies Benehmen bedeuten?
Werthester Herr, stammelte ich zur Antwort, Sie mögen meine Unerfahrenheit schelten, aber verdächtigen Sie meine Absichten nicht...
Ehrliche Absichten gehen offen zu Werk. Aber Ihre Handlungsweise ist zweideutig, zumal schon Ihre Lage, wenigstens so weit ich sie kenne, mich keineswegs über Ihr Benehmen beruhigen kann...
Sie beleidigen mich, Herr! unterbrach ich ihn, mit lebhafter Geberde auffahrend.
Das ist möglich, versetzte der Feldmesser mit einer Ruhe, die mich fürchten machte; ich bin aber auch bereit, Ihnen Genugthuung zu geben. Mag sein, daß ich Sie zu streng beurtheile. Mag sein, daß Sie bei Ihrem schüchternen, unerfahrnen, linkischen Wesen fest und ehrenhaft in Ihren Absichten sind. Es liegt an Ihnen, mir den Beweis zu geben, daß Ihre auf jeden Fall unschicklichen Aeußerungen wenigstens ehrlich sind. Sie sollten wissen, wohin sie führen können, nothwendig führen müssen, wenn sie nicht jeder Rechtfertigung entbehren sollen!... Zeigen Sie mir also, daß Sie wirklich im Stande sind, sich zu vermählen, so will ich Ihren Absichten augenblicklich Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Was verdienen Sie, jahrein, jahraus gerechnet?
Diese entsetzliche Frage, welche ich bereits eine Weile über meinem Haupte schweben sah, brach mit Blitzesgewalt auf mich herein; ich verdiente noch nichts, ich besaß keinen Heller im Vermögen, aber daran zu denken, hatte ich vergessen. Wenn Henriette mich liebte, wenn Henriette mit mir vereint war, was bedurfte es da weiter?... Eine Thür durch den Verschlag brechen, so war alles abgethan. Aber so rechnete der Feldmesser nicht.

Ich verdiene, versetzte ich todtenbleich, mein Herr, ich verdiene... allerdings weniger, als ich ohne Zweifel in der Folge verdienen werde;... aber ich habe einen Stand...
Er unterbrach mich: drum eben, weil Sie einen Stand haben, und weil dieser Stand Maler ist, stelle ich meine Frage. Es wird Ihnen das Sprichwort nicht unbekannt sein. Ihr Stand bringt zuweilen Ruhm ein, aber nicht immer Brod. Meine Tochter hat nichts. Was haben Sie? Oder besser, um auf meine Frage zurückzukommen: wie viel verdienen Sie durchschnittlich im Jahr?
Ich verdiene...
Es gab kein anderes Mittel, ich mußte lügen oder die Frage nicht verstehen... da klopfte es an meine Thüre.
Wer liebt eine plötzliche Umwandlung? Aristoteles rühmt die Knotenschürzung und ihre plötzliche Lösung; es lebe Aristoteles! Was in der Welt ist nicht eine gute, glückliche Lösung werth! Lucy, mein guter Engel, meine Vorsehung!!
Ich hatte geöffnet. Ein Livreebedienter trat ein und trug zwei große Beutel Geld. In meinem Entzücken ließ ich ihn gewähren. Er legte dieselben auf den Tisch und öffnete den einen, Haufen blanker Thaler fielen daraus hervor und er stapelte sie auf, damit ich sie nachsehen konnte. Dann reichte er mir ein Papier dar: hier ist die Rechnung: Funfzehnhundert Francs für die beiden Kopien. Milady hat mir aufgetragen, sie sammt dem Originale mitzubringen, wenn Sie erlauben.
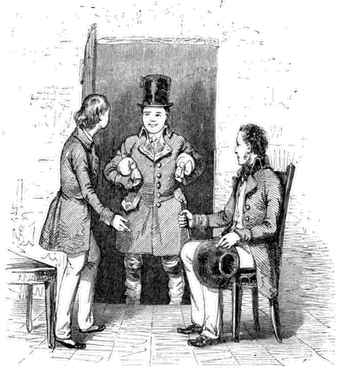
Nun war alle Verlegenheit weg! Es ist gut, versetzte ich. Ich will Ihnen die Kopien geben. Hiernach wendete ich mich wieder zu dem Feldmesser, der sich erhoben und seinen Hut bereits genommen hatte: wie ich die Ehre Ihnen zu sagen hatte, ich verdiene durchschnittlich...
Er unterbrach mich: Sie haben Ihre Geschäfte, ich die meinigen. Der Mann hier wartet. Auf ein ander Mal. Und er verließ mich in dem Augenblicke, da ich voll Zuversicht mit aller Beredtsamkeit eines feurigen Liebhabers sprechen wollte, den der Himmel selbst begünstigt und beisteht... Zum Henker die Feldmesser! rief ich, als er gegangen war.

Um mich zu beruhigen, heftete ich meine Blicke auf die Thaler. Es war selbst bei meiner Verstimmung ein behaglicher Anblick. Die Stapel erhoben sich in geschlossenen Reihen und ich entdeckte eine wunderbare Schönheit in dieser Bauart. Noch niemals hatte mein Auge so große Schätze beisammen gesehen, und als ich an Lucy dachte, von der mir alles dies Gute kam, konnte ich nicht umhin zu wiederholen: edle Lucy, mein guter Engel! In Ermangelung eines Geldschranks verbarg ich bis dahin, daß sich ein Plätzchen zum Anlegen meines Reichthums gefunden hätte, die ganze Summe in den Ofen und verließ mein Zimmer, um allein, in freier Natur die Freude zu genießen, welche nach Augenblicken so großer Beängstigung in mein Herz gekommen war. Uebrigens waren meine Angelegenheiten seit dem Morgen tüchtig vorgeschritten, und ich fühlte das Bedürfniß, sobald als möglich hinlängliche Ruhe zu gewinnen, um über die Schritte nachzudenken, welche mir zu thun übrig blieben.
Das Erste war, meinem Oheim, welcher noch von nichts wußte, alles zu offenbaren. Daß ich ihm bisher meine Pläne verborgen hielt, daran war die feste Ueberzeugung schuld, daß er sich von keinem andern Gedanken leiten lassen würde, als dem, mich glücklich zu machen, und daß er meine Verheirathung durch neue Opfer von seiner Seite erleichtern würde. Gerade diese Gewißheit, in Verbindung mit meiner Kenntniß seiner beschränkten Mittel und mancher Aufopferungen, die er sich in jüngster Zeit meiner kleinen Künstlerausstattung wegen auferlegt hatte, machte es mir zur heiligen Pflicht, seinen allzubereitwilligen Edelmuth nicht ferner auf die Probe zu stellen. Alle diese Gedanken aber verscheuchte der Reichthum, den ich der Freigebigkeit Lucy's verdankte, so daß ich ihn nur noch von dem Vorgefallenen zu unterrichten und ihn zu bitten hatte, er möge seiner Güte die Krone aufsetzen und nächsten Tags hingehen und um Henriettens Hand für seinen Neffen anhalten. Es unterlag keinem Zweifel, daß, wenn er mir diese Gunst erzeigte, die Würde seines Alters, das Gewicht seiner Zustimmung und die einnehmende Herzlichkeit seines Wesens den Erfolg eines Schrittes sicherten, von dem die Ruhe meines Lebens abhing. Ich beschloß noch denselben Abend mit ihm zu reden.
Spät kam ich wieder, und es war zur Stunde des Nachtessens: Zu Tisch! zu Tisch, lieber Oheim!... ich bringe wichtige Neuigkeiten!
Ich weiß, ich weiß, mein Kind. Die Alte unterrichtete mich von allem... Es ist von Thalern die Rede... ein großer Sack... der Pactolus hat sich ganz und gar über meinen armen Julius ausgeströmt...
Der Pactolus in leibhaftiger Person, lieber Oheim. Er ist in meinem Ofen eingesperrt... doch setzen wir uns zuvörderst zu Tisch, denn ich habe noch ganz andere Dinge mitzutheilen!
Ich bemerkte, daß mein Oheim, statt die letzten Worte heiter aufzufassen und, wie es seine Gewohnheit war an meiner Freude Theil zu nehmen, sich mit nachdenklicher Miene, wie wenn ihm etwas im Kopfe herumginge, dem Tische näherte und einen Blick seitwärts auf die Alte warf, deren Anwesenheit ihm sichtbarlich unbequem war, ohne daß er es über sich gewinnen konnte, sie fortzuschicken. Ich gab Margarethen ein Zeichen und sie zog sich zurück.
Als wir an unserm gewohnten Platze saßen, hub mein Oheim an: Ich habe Dir auch etwas mitzutheilen. Und er hustete, wie es ihm wol geschah, wenn er sich sehr anstrengte, um einen peinlichen Vorwurf auszusprechen.

Du weißt... Er hielt inne und hub anders an: diese gute Dame ist wirklich großmüthig, edel in ihrem Verfahren!... Es ist eine Ehre, die Gunst einer Person von so würdigem Herzen zu genießen... eine Ehre, mein Kind, die verdient sein will... Du bist nun auf einmal auf dem besten Wege... Nun aber Ordnung, gute Aufführung, Arbeit, und alles geht gut.... Aber, fuhr er mit festerm Tone fort, ehrenhaft für und für!... Schaden wollen, nimmerdar! Hüte Dich, ein junges Mädchen ist etwas Heiliges!... nur für den Bösewicht nicht.
Ich verstehe Sie nicht, bester Oheim! rief ich in großer Aufregung aus.
Das junge Mädchen... da oben...
Und was ist's mit der?...
Du liebst sie?...
Aus Herzensgrund!
Das ist's eben, Julius, das taugt nicht!
Diese Worte sprach mein Oheim mit feierlichem Ernste; ich fühlte mich – ich muß es gestehen – versucht zu lachen, denn ich nahm an, daß seine Bekümmerniß um meine Ehrenhaftigkeit von irgend einem Dienstbotengeklatsche herrührte, welches die Alte ihm vertrauen zu müssen geglaubt hatte. Dieses Mal, entgegnete ich, weiß ich wirklich nicht, was Sie meinen. Das junge Mädchen – ich liebe sie wirklich, und ich wollte Sie bitten, morgen zu den Eltern derselben zu gehen, um im Namen Ihres Neffen um ihre Hand anzuhalten. Wo ist da etwas Böses, liebster Oheim?

Du!... rief mein Oheim erstaunt; wie sagtest Du? Du willst Dich verheirathen?... Und bist Schuld daran, sagte er in heftiger Bewegung aufstehend, daß ich ihrem Vater gerade das Gegentheil versichert habe!...
O weh! rief ich aus. Wie unglückselig! Bester Oheim, was haben Sie gemacht!
Aber, ich that... was die Rechtlichkeit verlangte... Höre... so höre doch. Eben, vor einer Stunde, kommt dieser Teufelskerl auf einmal zu mir gerannt, sagt, Du machtest seiner Tochter den Hof... sagt, Du habest seine Tochter compromittirt... fragt, was seine Tochter thun solle und ob Du an Ehe dächtest?... Da hab' ich ihm versetzt, im Gegentheil, Du habest Dir selber gelobt...
Ich bin verloren! unterbrach ich ihn und überließ mich allen Ausbrüchen der Verzweiflung.
Kaum hatte mein Oheim Tom vernommen, daß meine Absichten lauter und meine Ehre unangetastet war, da unterdrückte das heftige Bedauern, wider seinen Willen meine Hoffnungen gefährdet zu haben, bei ihm fast jenes kluge Bedenken, welches den Greisen eigen ist, und er dachte augenblicklich weit mehr daran, wie er meinen Kummer schnell abhelfen solle, als die Rathsamkeit oder Rücksichten der Heirath zu erwägen, von der ich ihm eben zum ersten Male gesprochen hatte.
Indeß ich mich trostlos meinem Schmerze überließ, ging er im Zimmer auf und ab und sprach vor sich hin: Ja, ja!... was ist da zu machen... Lieber Himmel! wenn ich das hätte ahnen können... dergleichen Schwüre... man macht sie in Deinem Alter... das mag hingehen... Man besinnt sich anders, auch gut... der Fehler steckt darin, daß man in meinem Alter alle solche Verwicklungen vergessen hat... Dann trat er näher an mich heran: Muth gefaßt! mein armer Julius!... Muth gefaßt!... Ich gehe morgen... ich erkläre alles, ich thue ihnen zu wissen...
Morgen! sagte ich erschrocken. Heute Abend!... Abend noch, lieber Oheim! in diesem Augenblicke! Sie finden sie Alle beisammen. Morgens da geht er aus.
Aber... meine Güte! diesen Abend... Und dann ist das junge Mädchen dabei!
Was thut das! sie lassen sie hinausgehen, wenn es nothwendig ist. Diesen Abend, ich beschwöre Sie, bester Oheim!
Nun! so sei es drum! ich gehe heute Abend!... Freilich schon zehn Uhr. Rufe die Alte, daß ich mich ein wenig ankleide.

Ich benutzte diese Augenblicke, um meinen Oheim von allem Vorgefallenen zu unterrichten. Bald hatte er die Pantoffeln abgelegt und gegen Schnallenschuhe vertauscht; ich rückte ihm die Perrücke zurecht, nachdem ich dieselbe sorgsam gepudert hatte; Margarethe und ich halfen ihm den schönen kastanienbraunen Rock auf die Schultern, dann gab ich ihm den Rohrstock in die Hand, alles indem ich ihn unterrichtete, was vorgegangen war und was er zu sagen und was zu antworten habe. Schon gut! schon gut! sagte mein Oheim, den mein Geschwätz ganz betäubte. Und er ging.
Ich unterrichtete jetzt die alte Margarethe von Allem. Mit Thränen in den Augen hörte sie mich an und in den Augenblicken lebhafter Spannung war sie ganz Seele mit mir und theilte meine Angst und meine Wünsche, als wären es ihre eigenen. Jeden Augenblick öffneten wir die Thüre, um auf der Treppe nach der Rückkehr des Oheims zu lauschen, oder wir gingen in die Bibliothek und suchten etwas von dem, was über uns vorging, zu erhaschen.

Nach Verlauf einer Viertelstunde öffnete sich die Thüre des Feldmessers; ich erkannte den Gang meines Oheims.
So bald! rief ich aus. So bin ich ausgeschlagen, Margarethe.
Müssen bis morgen warten! sagte mein Oheim hereintretend; sie sind nicht zu Hause.
Diese Antwort verursachte mir eine lebhafte Bekümmerniß.
Sie haben also auf sie gewartet?...
Ja, ich wartete... aber sie kommen erst gegen Mitternacht heim, hat mir die Tochter gesagt.
Sie haben sie also gesehen?...
Ja! meiner Treu! ein reizendes Wesen, oder ich verstehe nichts davon.
Ich konnte meine Freude nicht fassen: doch was hat sie Ihnen gesagt, lieber Oheim? Alles, ich bitte Sie, erzählen Sie mir alles.
Laß mich erst den Rock ablegen... und mich setzen... Ein reizendes, braves Mädchen!... Meine Pantoffeln, Margarethe!...
Was hat sie denn gesagt, bester Oheim?
Sie hat mir gesagt... Da, stell' den Stock 'mal hin... daß sie bei einem Freunde zur Taufe gegangen sind...
Aber sonst, aber sonst? Sie sind doch neunzehn Minuten bei ihr geblieben?
Ja, ja, nur Geduld... es fällt mir schon bei. Zuerst also, sie machte mir die Thüre auf... Wenn ich ein Gespenst gewesen wäre, so hätte sie keinen größern Schrecken haben können, als da sie mein Gesicht erblickte... (Er fing an zu lachen und ahmte Henriettens Geberde nach.) – Fürchten Sie sich nicht, schönes Kind, sagte ich und nahm ihre Hand... Lassen Sie uns hineintreten.... Da bedeckten sich ihre Wangen mit dunkler Röthe, sie ging voraus, ohne meine Hand loszulassen, weil sie mich in dem Gange führen wollte, siehst Du, wie man's einem Greis thut... Ein artiges gesittetes Kind...
Das Sie liebt, das Sie schätzt, wie alle Welt, bester Oheim.
Ja wohl! sagte Margarethe leise im Dunkel des Vorzimmers.
... So kamen wir in das Wohnzimmer, wo sie beim Nähen saß und über eine Schwester und zwei kleine Brüder wachte, welche zu ihrer Seite schliefen... Bei unserm Eintreten wachte der Eine davon auf: – Sehen Sie danach, sagte ich da zu ihr, und wenn Sie fertig sind, so gehen Sie und rufen Sie Ihre Eltern: ich habe mit ihnen zu sprechen.
Sie sind nicht zu Hause, mein Herr, entgegnete sie und wiegte das Kind. Ich sage Dir Alles, wie Du siehst... oder soll ich mich kürzer fassen?
O nein, nein! Oheim!... Spotten Sie meiner nicht.
Das ist mir nicht lieb, versetzte ich... oder vielmehr das wird der Person nicht lieb sein, die mich herschickt... das arme Mädchen erröthete hier so, daß sie aufstand und sich abwendete, um auf's neue ihr Brüderchen zu wiegen, obgleich es diesmal sich nicht gerührt hatte. Als sie sich so meinem Anblicke entzogen, versetzte sie:
Sie werden erst gegen Mitternacht zurückkommen, Herr Tom; ich sage Ihnen das, damit Sie nicht zu lange vergeblich warten...
Freilich, es ist schon spät... Ich will also meinen Auftrag bis morgen verschieben... und wenn Sie, mein schönes Kind, erfahren haben, was es ist, so bitte ich um Ihre gütige Fürsprache... vorausgesetzt, daß... daß Sie uns geneigt sind und mir insbesondre... mir, der ich ruhiger stürbe, wenn ich zuvor das Geschick meines Julius mit dem Ihrigen verbunden sähe: sein Glück unter Ihrer Obhut und seine Jugend unter dem Schutz Ihrer verehrten Familie...
Bei diesen Worten erhob ich mich und stürzte mich in die Arme meines Oheims. Ich überhäufte ihn mit Liebkosungen, ohne Worte für die Gefühle, welche mein Herz überströmte, zu finden...
Nun, nun!... mein armer Julius... o, meine Perrücke!... meine Perrücke geht verloren!... laß mich doch ausreden... Du weißt ja noch nichts... da!... setz Dich ruhig hin... so... so...
Das junge Mädchen also erholte sich, sobald ich etwas deutlicher geredet hatte, vollständig: – Mein Herr, sagte sie zu mir mit fester Stimme, Sie werden keinen Zweifel hegen, daß ich Sie ehre und liebe... Ich bin von Ihren Worten tief ergriffen, aber in großer Verlegenheit, was ich antworten soll... Ich denke eben nicht an die Heirath, denn ich sehe gar mancherlei Hindernisse... (Na, entsetze Dich nur nicht gleich!) Ich gehöre meinen Eltern, ich bin ihnen nothwendig, ich will sie weder verlassen noch ihnen zur Last fallen... (So erschrecke doch nicht!) .... Ich werde mich nur mit einem Manne verbinden, der mich für Seinesgleichen achtet und meine Familie als die seinige annimmt, der mir sein Herz ganz und ungetheilt darbringt, wie ich ihm das meinige schenken werde. – Ich hätte mich nimmer versehen, daß ich dergleichen Dinge gegen jemand äußern würde; allein Ihr Alter und die Achtung, die ich vor Ihnen hege, ermuthigen mich. Uebrigens steht die Antwort meinen Eltern zu... Ich werde sie, wenn Sie es wünschen, von Ihrem Besuche unterrichten...
Wollen die Güte haben, theures Kind: morgen um zehn Uhr... Wie freut es mich, so viel Verstand und Tugend bei so jungen Jahren zu finden... und ich wünsche um so lebhafter, daß mein Neffe unter solchen Bedingungen, die ihm nicht schwer erscheinen werden, Ihnen gefallen möge... Eine große Ehre, mein liebes Kind... eine sehr große Ehre, in eine Familie einzutreten, wo so viele Tugenden zu Hause sind... und bereits in so zartem Alter... sein ganzes, ganzes Herz... (da hätte ich ihr können die Geschichte von der Jüdin erzählen) und zwar ein recht ehrliches Herz, dafür bürge ich Ihnen, mein Kind... das wohl begreift, welches Kleinod ihm anvertraut wird, unter welchen Bedingungen es das Glück empfängt, und wie daraus nur gegenseitige Liebe, gegenseitige Treue, gegenseitiger Eifer für alle Pflichten, die der Ehestand mit sich bringt, hervorgehen können... Hier ahmte mein guter Oheim mit aller Heiterkeit die Eheformel aus der Liturgie nach: Nicht wahr, Julius, das versprichst Du!!
Ja, ja, rief ich aus, und das vor Gott! vor Dir! mein vielgeliebter Oheim... vor Dir! Und ich überhäufte ihn auf's neue mit Liebkosungen, indeß die Alte sich die Augen trocknete. Er allein, der glücklich in dem Glücke war, das er stiftete, aber heiter wie stets, behauptete seine Ruhe und mischte in meine Freudenthränen einige liebevolle Scherzworte.
So wärest Du also vermählt, fuhr mein Oheim fort.
Wollte es der Himmel, guter Oheim! Und haben Sie sonst nichts mit ihr gesprochen?

Nichts Erhebliches mehr, ich stand danach auf und wollte die Püppchen sehen, die da lagen und schliefen... Sie schickte sich lächelnd an, sie mir zu zeigen. Was ich am meisten bewunderte, war die Sauberkeit, die Sorgfalt, die Ordnung, die inmitten der größten Einfachheit von einer gewissen Zierlichkeit begleitet war. – Sie machen da den Kleinen Kleider, sprach ich... – Meine Mutter, werther Herr; allein während ihrer Abwesenheit arbeitete ich etwas daran. Nun nahm ich ihre Hand zum Kusse und sie faßte die meinige wie vorhin, um mir das Geleit zu geben. In der Thür hab ich ihr ganz leise den Rath gegeben, nicht weiter mitzugehen, wenn sie sich nicht der Gefahr aussetzen wolle, Dir zu begegnen. Eiligst flüchtete sie wieder zurück, das ist alles. Aber da ist's schon eilf Uhr; laß uns nun schlafen gehen.
Die Alte lächelte. Hast Recht, Margarethe. Nicht alle Welt wird diese Nacht schlafen können; aber wir Beide, meine Alte, wir werden für alle Welt schlafen.

Gegen Mitternacht kamen die Eltern zurück. Ich horchte, ich konnte bemerken, daß ein ernsthaftes, lebendiges Gespräch unter den Mitgliedern der Familie stattfand. Gegen zwei Uhr standen sie von ihren Sitzen auf, gingen auseinander und ich hörte die beiden Gatten noch lange in ihrer Kammer sich unterhalten, bis endlich allgemeine Stille eintrat. Ich legte mich nicht zu Bette; einer heftigen Aufregung zur Beute, erwartete ich voll Ungeduld den Tag.
Sobald mein Oheim Tom erwacht war und während er sich ankleidete, ließ ich mir alle Umstände seines gestrigen Besuchs noch einmal erzählen. Um mir gefällig zu sein, erzählte der gute Greis sie einen nach dem andern von neuem, mit dem Tone süßer Zuversicht, die meine Einbildung belebte, meine Hoffnung neu erweckte und mein Entzücken wieder anfachte. Indessen fand ich doch ein wenig zu viel Zurückhaltung in den Worten Henriettens, und wenn ich an die schrecklichen Vorstellungen dachte, welche mein Benehmen und die Aeußerungen meines Oheims in den reizbaren Geist des Feldmessers geschleudert haben mußten, so verlor ich alle Hoffnung, die mir eben aufgegangen war, auf's neue.
Endlich schlug es zehn Uhr. Mit steigender Beklemmung wiederholte ich meinem Onkel alles, was er sagen sollte, und wir verabredeten, daß, sobald er seinen Antrag vorgebracht, er geradesweges nach meinem Arbeitszimmer gehen solle, wo ich ihn erwarten wollte.
Wenige Minuten war ich oben, als jemand in Henriettens Zimmer trat. Ich unterschied den Schritt zweier Personen und aus verschiedenen Anzeichen erkannte ich bald, daß sie und ihre Mutter es waren.

Durch diese Gewißheit fand ich mich so sehr in meinen Erwartungen getäuscht, daß ich alles für verloren hielt. Seit der Unterredung, welche ich erwähnt habe, bildete ich mir beständig ein, daß die gute Frau als Vertraute der geheimsten Gedanken Henriettens geneigt wäre, mich in Gunst aufzunehmen, und daß sie bei ihrem Wunsche, vor allen Dingen ihre Tochter einem jungen ehrenhaften Manne zu vertrauen, bei dem Feldmesser mein bester Anwalt gewesen wäre, wenigstens der einzige, auf den ich zählen konnte. Als ich nun sie und ihre Tochter in einem so entscheidenden Augenblicke das Feld räumen und meinen Oheim mit dem Feldmesser allein gelassen sah, welcher ganz und gar von Vorurtheilen beherrscht wurde, welche sie sicher nicht in einem gleichen Grade theilen konnten, erachtete ich meinen Antrag von vorn herein für abgelehnt. In dieser verzweifelten Lage beschloß ich den Augenblick zu benutzen, um mir eine letzte Zuflucht zu eröffnen. Ich wollte mich nämlich zu den beiden Frauen begeben und mich überwinden, ihnen alle Gluth und Aufrichtigkeit meiner Gefühle zu zeigen, um sie zu meinen Gunsten zu gewinnen. Ich klopfte an ihre Thüre; Henriette öffnete mir.
Nur die eigne Bestürzung des jungen Mädchens, die sich so lebhaft auf ihrem Gesicht malte, stand mir bei, daß ich die meinige überwand.
Darf ich, sprach ich mit bewegter Stimme, einige Augenblicke zu Ihnen kommen?... – Treten Sie ein, Herr Julius, sagte die Mutter hierauf. Nach diesen Worten schwieg sie und betrachtete mich schweigend, Thränen begannen aus ihren Augen zu rollen... Was haben Sie uns zu sagen? hub sie auf's neue mit trauriger, vom Weinen bewegter Stimme an.

Ich wollte, ehe Ihre Familie über mein Schicksal entscheidet, Sie einmal sehen... Sie einmal sprechen... und fühle mich zu verlegen dazu... Ich wollte Fräulein Henriette sagen, daß seit langer Zeit es mein einziges Glück ist, sie zu lieben, sie zu bewundern, die Ehre, mein Geschick an das ihrige zu ketten, höher als alles in der Welt zu schätzen... und Ihnen, daß ich Sie lieben werde wie meine Mutter, die ich nicht mehr habe, daß Sie mir Ihre Tochter vertrauen würden, ohne sie zu verlieren... ach, was weiß ich? Theuerste Frau! Ihr Anblick erfüllt mich mit Rührung und Ehrfurcht, ich verstehe die Sprache dieser Thränen, die Sie vergießen... ich glaube, daß ich Ihnen versichern kann...
Während ich so redete, betrachtete mich die minder aufgeregte Henriette, während sie meine Worte aufmerksam anhörte. –
Henriette, sprach die Mutter, rede Du mit dem jungen Herrn, Dich verlieren, mein Kind! nein, ich kann den Gedanken nicht fassen... Du bist mein Leben. – Nimmer, sagte Henriette mit einer Entschlossenheit, welche durch einen Ausdruck von Bescheidenheit gemäßigt wurde; nimmer, Mutter, werde ich einem Andern angehören, als dem, der ganz Euer Sohn wird!... Mein Herr, ich bin noch verlegener um ein Wort, als Sie... Ich kenne Sie wenig... Ich kenne Ihren Antrag, aber ich kenne Ihren Charakter nicht... Ich habe viele Männer gefunden, die für preiswürdige Gatten gelten und denen ich keine Achtung zollen kann... Und dann, meine Eltern verlassen!... Hier stockte Henriettens Stimme und ihre Thränen flossen. Nein! ohne sie zu verlassen, ohne sie jemals zu verlassen, mein Fräulein, wenn sie mich der Aufnahme würdigen...
Ich gehöre ihnen an, Herr Julius, fuhr Henriette mit mehr Ruhe fort. Ich habe keine Erfahrung, sie aber haben dieselbe. Ich weise Sie durchaus nicht ab, sie mögen entscheiden, ich werde thun, wie sie beschließen...

In diesem Augenblicke öffnete sich die Thür.
Hier suchte ich Sie nicht! sprach der Feldmesser, zu mir gewendet. Uebrigens, bleiben Sie; ich wollte Sie eben rufen lassen.
Guten Tag, mein liebes Kind, sagte mein Oheim Tom und nahm Henriettens Hand zum Küssen. Dann wendete er sich gegen die Mutter: Und Sie, theure Frau, fassen Sie Muth... Wenn Sie den Burschen da, wie ich, seit einundzwanzig Jahren kennten, so hätten Sie Zutrauen... wie ich Zutrauen und Freude darin finde, da ich ihn um dieses liebenswürdige Wesen werben sehe, das ein wahres Kleinod ist... doch lassen wir den sprechen, dem sie angehört.
Mein Oheim setzte sich. Ich blieb neben Henriette stehen und wir hörten auf den Feldmesser.
Um zehn Uhr, sprach dieser, empfing ich den Besuch des Herrn Tom. Herr Julius, der Aufrichtigkeit Ihrer Gesinnungen und der Redlichkeit Ihrer Absichten lasse ich Gerechtigkeit wiederfahren; allein Sie haben ein schwaches, schwankendes Gemüth, wo Sie offen sein sollten; das ist ein Fehler, der den redlichen Absichten die Offenheit nimmt, welche man bei ihnen sucht. Ich weiß, daß Sie nichts besitzen als die Summe Geldes, welche ich gestern gesehen habe. Ihre Hilfsquellen laufen also auf Hoffnungen hinaus, und in dieser Hinsicht entbehren Ihre Verhältnisse der Sicherheit, die meine Pflicht zu fordern heischt. Ich wollte mit Euch Frauen darüber reden; allein, da alle Betheiligte hier beisammen sind, so will ich meine Meinung frei heraussagen.
Meine Herren, ich habe niemals auf einen reichen Schwiegersohn gerechnet, ja ich habe ihn nicht einmal gewünscht. In dieser Hinsicht wären die Umstände des Herrn Julius, wie mir dieselben mitgetheilt sind, kein Hinderniß, ihm meine Einwilligung zu dieser Verbindung zu geben, im Falle die Frauen auch ihre Zustimmung ertheilen... Aber, fuhr er mit gehobener Stimme fort, eins geht mir über alles, dies ist das Glück meiner Tochter! und dies setze ich in treue Liebe, in gegenseitiges Vertrauen, in Arbeit, gutes Benehmen, in ein rechtschaffenes tadelloses Leben.... und in nichts anders. Ich weiß, meine Herren, wie viel mein Kind werth ist! und derjenige, welcher ihr nicht alle die genannten Güter mitbringt, wäre unwürdig sie als Gattin zu besitzen, so wie er für mich ein Gegenstand des Hasses und der Verachtung sein würde...
Der Feldmesser schwieg einige Sekunden, doch nicht von Zärtlichkeit übermannt, sondern im tiefsten Herzen erschüttert; dann fuhr er ruhiger wieder fort: Jetzt werden Sie begreifen, liebe Herren, warum ich nicht auf Reichthum sehe... Die Güter, die Bürgschaften, welche ich verlange, welche ich fordere, sind weit schwerer anzutreffen als das Gold. Herr Julius hat einen Stand, ist jung, wird arbeiten, wir werden ihn unterstützen; da ist also kein Hinderniß.... Wenn er wohl aufschaut was er thut, und wozu er sich verpflichtet; wenn er, nur den unschätzbaren Werth einer tugendhaften Gattin erkennt, so gebe ich ihm gern die Hand Henriettens. Also, auf seine Rechtlichkeit vertrauend, daß er seine Versicherungen halte, wage ich ihn unsrer elterlichen Liebe zu versichern, so wie seines eignen Glücks.
Mein Herr, versetzte ich jetzt, so ruhig, als meine aufgeregte Stimmung nur immer gestattete, ich bestätige alle Worte meines Oheims, ich begreife sehr wohl die Ihrigen und mein Herz wird sie nie vergessen... Ich spreche zu Ihnen hier, nicht etwa von der Liebe, die ich zu Fräulein Henriette hege, hingerissen, sondern gekräftigt und bestärkt durch die Achtung, die ich für ihre Tugenden hege, und durch den Anblick des vollen und so zu verehrenden Glückes, zu dem Ihre Grundsätze führen... Möchte Fräulein Henriette und ihre Mutter Ihrer Einwilligung beipflichten, so schwöre ich hier, daß Ihre Familie um einen Sohn bereichert sein soll, der Ihre Erwartungen nicht täuschen wird!
Henriette sagte nichts; aber sie wendete sich gegen mich und reichte mir, innig bewegt, die Hand. Als mein Oheim das sah, verließ er seinen Sessel, eilte vor Alter und Freude schwankend auf uns zu und umarmte uns beide. Die Zähren waren ihm in die Augen getreten und die Liebkosungen Henriettens lockten dieselben in mildem leichten Fluß hervor. Der Feldmesser allein behauptete seine ganze Festigkeit, er näherte sich seiner Frau und hielt deren Fassung durch vorstellende, freundliche Worte aufrecht.
Als mein Oheim wieder nach seinem Lehnstuhl zurückgekehrt war, sprach er: Meine Freunde, ich danke Ihnen Allen... Dieser Tag erfüllt meinen letzten Wunsch. Dies liebenswürdige Kind (jetzt das meinige) wird glücklich sein... das ist ausgemacht... denn Sie werden in meinem Julius ein rechtschaffenes, liebendes Herz finden... bereit, alle seine Pflichten zu erkennen und zu erfüllen... wenn schon seine Laune munter und sein Kopf von den schönen Künsten eingenommen ist.

Ich wiederhole also, daß ich Ihnen Allen danke. Jetzt will ich Ihnen meine Gedanken sagen und wie die Dinge stehen. Dies Bürschlein wird in meine Stelle treten. Mein bischen Gut gehört ihm. Es gehört ihm seit einundzwanzig Jahren, laut meinem Testament... Er hat mich also seit einundzwanzig Jahren unterhalten... hier hielt er lächelnd inne.
In diesem Betracht, fuhr mein Oheim fort, werde ich ihm nicht lange mehr beschwerlich fallen, so daß die Zukunft keineswegs stockfinster ist... Diese kleine Habe ist eine Rente von hundert und siebenundzwanzig Pistolen, deren Kapital auf den besten Weinberg im Kanton Waadt angelegt ist... unter dem Schutz des Bacchus also sehen Sie... Es hat da gut gelegen, so daß seit fast vierundfunfzig Jahren die Rente auch nicht ein einziges Quartal ausgeblieben ist.
Ich sagte also, daß dies Hundert und siebenundzwanzig Pistolen sind... Außerdem funfzig, die mir der Bursch da kostet, sie sind ihm von heute an zugesichert... dieselben sollen in Terminen ausgezahlt werden, doch nicht an ihn... sondern an dies Fräulein, welche mir gestern als eine geschickte, treue Wirthschafterin erschienen ist.
Ein Gemurmel unterbrach meinen Oheim. Ei... so hört mich doch an... ich bitte Euch... es fehlt mir ja ohnehin an Kraft... die funfzig Pistolen sollen zur Einrichtung der kleinen Wirthschaft sein... denn es heißt ja, ohne Topf keine Suppe... nun, mein Neffe ist nicht reich an Töpfen... so muß ich wol für ein Hausgeräth sorgen... also wollen wir und werden unsre Kessel, unsre Speiseschränke, unsre Geräthe haben, und diese junge Dame empfangen, wie es ihrer würdig ist... Nun hört wie:
Ich habe in meinem langen Lebenslaufe viel alte Scharteken zusammengescharrt... ich sehe ein, daß ein Künstler, wie Julius, nicht viel damit anfangen kann... und ich, ich muß nun anfangen, an den Rückzug zu denken... Ich kenne einen Juden, der mir mit Vergnügen dabei hilft, und zwar ohne mich zu betrügen, denn ich kenne den Werth meiner Siebensachen... Ich habe bereits einen Theil der Summe aufgenommen; damit können wir die Kinder einrichten... Keine Umstände, keine Entgegnung: jedes Widerstreben würde mir schmerzlich sein. Zudem die Sache gewährt mir Erholung, der Jude leistet mir Gesellschaft dabei... wir lesen Hebräisch... wir vergleichen die Ausgaben... und ich sage einem nach dem andern meiner alten Bände Lebewohl... bis ich Euch endlich insgesamt Lebewohl sagen werde, meine Freunde.
Ich zerfloß in Thränen. Henriette, ihre Mutter und selbst der Feldmesser hörten ihn mit Erstaunen, das Herz voll Bewunderung und Liebe für den guten Greis. Weit entfernt, einzuwilligen, widersprachen wir auch nicht, sondern eilten Alle auf ihn zu und umringten ihn mit unsrer Liebe und den Bezeigungen der herzlichsten Dankbarkeit.
Also erhielt ich die Hand Henriettens. Die Zukunft hat die Voraussagungen meines Oheims wie die Verheißungen des Feldmessers erfüllt. Ich trat in eine Familie, wo Einigkeit, Innigkeit, Anhänglichkeit für das gemeinschaftliche Wohlergehen Aller herrschte; kein anderer Kreis hätte meinen Charakter besser ausbilden können, denn ich lernte hier kennen, von welcher Beschaffenheit die allerdings einfachen, aber wahrhaften und zuverlässigen Güter sind, von denen uns so oft ein romanhafter Sinn, eine Einbildungskraft entfernt, die sich allzuwillig verführen läßt.
Lucy erfuhr von mir vor ihrer Rückkehr nach England meine bevorstehende Verbindung. Dies diente ihr zur Veranlassung, mir noch einen Auftrag zu ertheilen, durch den meine Wirthschaft für lange Zeit flott gehalten wurde. Der Schutz dieser jungen Dame war also für mich eben so nützlich, als er anhaltend war. Vermöge ihrer Verbindung mit den vornehmsten Familien ihres Landes schickte sie mir oft einige von ihren Landsleuten zu, welche unsere schöne Gegend jährlich heranlockte, und selten war ihre Empfehlung unfruchtbar. Der Besuch dieser Fremden verlieh mir einen Ruf, welcher auch andere Besucher, andere Aufträge herbeiführte, und so hatte ich nach Verlauf weniger Jahre eine Wohlhabenheit erworben, die meinen Ehrgeiz befriedigte und die Erwartungen des Feldmessers beiweitem übertraf. Schwiegervater, sagte ich ihm zuweilen, der Stand ist gut; aber Ihr Sprichwort taugt nichts.
Man erinnert sich vielleicht, daß Lucy mir eines Tages mit Thränen in den Augen sagte: wenn einmal Sie dasselbe Unglück, wie das meinige, betrifft, Herr Julius, so bitte ich Sie, mich davon zu benachrichtigen. Ungefähr zwei Jahre nach meiner Verheirathung traf dies Unglück ein und sobald ich meinem Oheim die letzten Pflichten erwiesen hatte, schrieb ich an die Dame folgenden Brief:
Gnädige Frau!
Eingedenk des Befehls, den Sie mir vor zwei Jahren ertheilten, zeige ich Ihnen das Hinscheiden meines Oheims an. Es war dies ohne Zweifel ein Trost, den mir Ihre Güte im voraus bereitete, denn wenn Sie irgend einen Werth darein setzten, mich nach dem Tode Ihres Herrn Vaters noch einmal zu treffen, so wissen Sie, gnädige Frau, welcher Trost es für mich ist, zu wissen, daß ich bei Ihnen einige Theilnahme für den Schmerz und die noch größere Leere finde, welche mein Herz fühlt.
Ich habe einen unermeßlichen Verlust erfahren; mein Oheim hatte mich auferzogen, mich in's Leben eingeführt, mich verheirathet; vor allen aber hatte er über mich den Fittig jener vollkommenen Güte ausgebreitet, die ich nirgends wiederfinde. Ich habe diese heitere Seele verloren, die über mein Leben schützend wachte; dieses liebenswürdige Gemüth, dessen sanfte, schlichte Herzlichkeit täglich einige Stunden mich erheiterte; ich habe alle diese Güter verloren, als ich kaum sie zu würdigen, zu erkennen begann... Wie, gnädige Frau, begreife ich jetzt erst die Betrübniß, worin ich Sie damals sah! Lassen Sie mich dieselbe jetzt theilen! Wie viele von den Thränen, die ich jetzt vergieße, gehören nicht Ihrem Schmerze und dem meinigen gemeinschaftlich an! Jedoch sind die Ihrigen fern von Bitterkeit; ich habe selber gehört, welch glänzende Anerkennung Ihr Vater Ihrer kindlichen Liebe zollte, während mein armer Oheim hingeschieden ist, bevor ich ihm Gelegenheit gab, mir gleiches Lob zu ertheilen.
Wie traurig ist es doch, gnädige Frau, so ausgezeichnete Wesen zu verlieren, das süße Band zerrissen zu sehen, das nur jenseit der Erde neu geknüpft werden kann. Ich erstaune, ich mache mir Vorwürfe, daß dergleichen Bedenken meine Stunden nicht eher trübten; ich erinnere mich, daß Ihre Augen sich lange vorher netzten, durchdrungen, wie Sie waren, von dem Gedanken eines über lang oder kurz hereinbrechenden, aber auf jeden Fall unersetzlichen Verlustes. Und ich war so unbekümmert um die Zukunft, ich erfreuete mich fast ohne alle Unruhe an jenen zahlreichen seltenen Eigenschaften, die das Alter gleichsam mit verehrungswürdigem, heiligem Zauber umkleidete.
Mein guter Oheim verschied, wie er gelebt hat, ruhig, heiter, beinahe fröhlich. Er sah den Tod herankommen, seine Glieder umfangen, sie nach und nach erkalten und schien gleichsam mit dem Tode zu spielen. So lange es ihm möglich war, hat er nicht das Geringste an seinen Gewohnheiten geändert; nur als er sich genöthigt sah, seine Arbeiten aufzugeben, behielt er uns längere Zeit bei sich. Seine Leiden, wie danke ich dem Himmel dafür! waren nie sehr groß, und er ertrug sie ohne Bitterkeit, wie einen unwillkommenen Gast, den man aber nichtsdestoweniger aufnehmen und fast mit Achtung behandeln muß. Wir saßen um sein Bett herum und hielten unsre Thränen zurück, die ihn mehr als seine eigenen Leiden betrübt haben würden; wir mußten sogar zuweilen bei den Einfällen, die er inmitten seines Leidens äußerte, lachen, weil immer noch einige Züge von Fröhlichkeit mit unterliefen. Und dennoch war es ein Schauspiel des tiefsten Mitgefühls würdig. Es kommt einem vor, als wäre für Wesen von solcher Güte das Leiden eine Beleidigung und das Herz empört sich gegen ein barbarisches Uebel, welches keinen Unterschied zwischen seinen Opfern macht.
Vergangenen Sonntag ist er in meinen Armen verschieden. Als er die Morgenglocken läuten hörte, sagte er: dies ist wol der letzte Klang, den ich höre, dies Mal... Diese Worte preßten unsere Thränen hervor... Gewiß, fuhr er fort... Ihr wollt mich überreden, meine Kinder, ich hätte noch nicht genug gelebt;... ich bin so zufrieden... Vergeßt meine alte Margarethe nicht... Sie hat immer viel Sorge getragen um meine Bücher... und um mich... Julius, wenn Du der lieben, guten Dame schreibst (so nannte er Sie immer), meinen Segen, bitte, ihr und ihren Kindern... ich hoffte ihren Vater in der Wohnung edler Seelen zu treffen... heißt das, wenn man mir den Zutritt gestattet.
Nach einigem Schweigen hub er auf's neue an: der Tod findet mich zäher, als er wol gedacht hat... ich werde ihm Stand halten, bis zum letzten Augenblicke... Das Testament liegt dort links in der Schublade... Meine gute Henriette, welche Lust war's, mit Ihnen zu leben... Ihren werthen Eltern meinen besten Gruß... und zeigen Sie mir noch einmal das Püppchen her... Sie wissen ja, da oben werden sie mich mit Fragen bestürmen, mein Bruder, meine Schwägerin... Gute Botschaften, werde ich ihnen zurufen, gute Botschaften.
Unterdessen wurde sein Blick matter, sein Athem kürzer und aus mehren Anzeichen konnte man das Nahen des Todes erkennen. Seine Rede war jedoch noch deutlich, sein Verstand ungetrübt und die milde Wärme seines Herzens erlosch nicht eher als mit seinem Leben. Gegen Mittag rief er mich: Sieh doch, ob Herr Bernier (so heißt unser Pfarrer) kommen kann, ich glaube, es wird Zeit... (Ich schickte zu dem Pfarrer.) Ich habe ein langes Leben gehabt... und habe einen glückseligen Tod... Ich bin unter Euch... Wo ist Deine Hand, mein armer Julius... Einige Augenblicke später meldete ich ihm die Ankunft des Pfarrers.
Willkommen, mein lieber Herr Bernier... Ich bin bereit, erfüllen Sie Ihren Beruf... Ich habe den Hippokrates verkauft... Es thut sich jetzt der Jude mit ihm gut... aber, wenn ich meinen alten Körper dem Knochenmann überlasse, so thue ich dies doch nicht mit meiner Seele... Ich empfehle sie Ihrer Fürbitte, mein lieber Herr Bernier. Geschwind, geschwind, sie möchte enteilen, der Faden hält nur noch schwach.
Der Pfarrer sprach ein salbungsvolles, rührendes Gebet. Amen! wiederholte mein Oheim... leben Sie wohl, theurer Herr, auf Wiedersehen... Ich empfehle Ihnen hier diese Kinder. Der Pfarrer, auch bereits ein bejahrter Mann, drückte ihm mit jener ruhigen Wärme die Hand, welche nur die Ueberzeugung, daß man sich bald anderswo wiedertrifft, verleiht, und entfernte sich alsdann. Mein Onkel fiel hierauf in Schlummer. Nach einer Stunde etwa fuhr er auf und rief mit schwacher Stimme: Julius!... Henriette! (er hielt unsere Hände gefaßt)... dies waren seine letzten Worte, gleich darauf hörte sein Odem auf.
Dies ist die einfache Erzählung der letzten Augenblicke eines unbeachteten, der Welt fremden Mannes, der selbst seinen eigenen Nachbarn unbekannt blieb, den ich aber nicht anders als unter die besten Sterblichen zählen kann. Sein langes Leben scheint mir dem Laufe eines Bächleins vergleichbar, das unbekannt, aber segenspendend rinnt, die bescheidenen Ufer wässert, welche es bespült, und in dem sich die milde Heiterkeit eines lachenden, wolkenlosen Himmels spiegelt. Der einzige Zeuge, jedoch nicht der einzige Gegenstand dieser alle Tage, alle Augenblicke sich erneuenden Güte, scheint mir mein Herz nicht auszureichen, um sein Gedächtniß würdig zu feiern, genugsam zu begehen. Das Bedürfniß, darin noch einen Genossen, wenigstens einigermaßen, zu haben, drängte mich, Sie von diesen Dingen zu unterhalten. Erlauben Sie mir, gnädige Frau, ein offenes Geständniß. Sie waren von großem Einflusse auf mein Geschick. Ihr Anblick, Ihre Traurigkeit ergriff mich gleich beim ersten Male; Ihre Güte hat meine Laufbahn geebnet, wenn ich nicht sagen soll geschaffen; ich liebe Sie aus diesen Gründen allen so sehr, als ich Sie achte; allein, was mich noch mit einem süßern, tiefern Gefühle durchdringt, dies ist der gemeinschaftliche Punkt, worin unser beider Leben sich gleicht, diese beiden vortrefflichen, uns beiden so lieben, als nothwendigen Menschen, die wir beide beweinen und deren Andenken, o lassen Sie es mich hoffen, gleichsam ein Band bilden wird zwischen Ihnen, gnädige Frau, und Dem, der sich glücklich schätzt, sich zu nennen Ihren achtungsvollen und dankbaren Diener
Julius.
Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
Das Originalbuch ist in Frakturschrift gedruckt. In dieser Transkription werden gesperrt gesetzte Schrift sowie Textanteile in Antiqua-Schrift hervorgehoben.
Eine auf den Halbtitel folgende ganzseitige Illustration wurde hinter die Titelseite verschoben, und der Halbtitel entfernt.
Der Text des Originalbuches wurde grundsätzlich beibehalten, mit folgenden Ausnahmen,
Seite 22:
"närrrische" geändert in "närrische"
(faßte mich meine närrische Lachlust)
Seite 26:
"«" verschoben von "ist«" nach "Maikäfer!«"
(je gemacht hat, sagt Buffon, ist.... sicherlich der Maikäfer!«)
Seite 79:
"gekomnen" geändert in "gekommen"
(Die Nacht war gekommen. Traurig riß ich mich von dem Bilde los)
Seite 94:
"," geändert in "."
(belebte meinen Muth. Die Ruhe kehrte)
Seite 111:
"ausgesteckt" geändert in "ausgestreckt"
(ihre Opfer auf zwei langen Reihen von Betten ausgestreckt haben)
Seite 237:
"In nit en" geändert in "Inmitten"
(Inmitten ihres thätigen, bedrängten Lebens)
Seite 248:
"mch" geändert in "mich"
(Dies verleitete mich nun zu einem ritterlichen)