F. M. Dostojewski
Literarische Schriften

R. Piper & Co. Verlag, München
Title: Sämtliche Werke 12
Literarische Schriften
Author: Fyodor Dostoyevsky
Contributor: Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky
N. Strakhov
Editor: Arthur Moeller van den Bruck
Translator: E. K. Rahsin
Release date: January 24, 2022 [eBook #67240]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: German
Original publication: Germany: Piper, 1921
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net. This book was produced from images made available by the HathiTrust Digital Library.
F. M. Dostojewski: Sämtliche Werke
Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkowski
herausgegeben von Moeller van den Bruck
Übertragen von E. K. Rahsin
Zweite Abteilung: Zwölfter Band
F. M. Dostojewski

R. Piper & Co. Verlag, München
R. Piper & Co. Verlag, München, 1921
5. bis 9. Tausend
Copyright 1921 by R. Piper & Co., G. m. b. H.,
Verlag in München.
| Seite | |
| Zur Einführung. Über Dostojewskis Leben und literarische Tätigkeit. Von N. N. Strachoff (1882) | 3 |
| Vorbemerkung | 101 |
| Erster Teil. Die russische Literatur | |
| Puschkinrede (August 1880) | 105 |
| (Zur Puschkinrede S. 105. Puschkin S. 124) | |
| Bei gebotener Gelegenheit einige Vorlesungen über verschiedene Themata auf Grund einer Auseinandersetzung, die mir Herr A. Gradowskij gehalten hat | 155 |
| (Dostojewskis Erläuterungen der Puschkinrede) | |
| Der Byronismus (Dezember 1877) | 213 |
| Über russische Literatur (Januar 1861) | 219 |
| Über Tolstois Roman „Anna Karénina“ (August 1877) | 243 |
| Zweiter Teil. Der russische Nihilismus | |
| Das Milieu (1873) | 291 |
| Der Büßer (1873) | 303 |
| Selbstmord und Unsterblichkeit (1876) | 319 |
| Dritter Teil. Notierte Gedanken | |
| Notierte Gedanken (1880) | 337 |
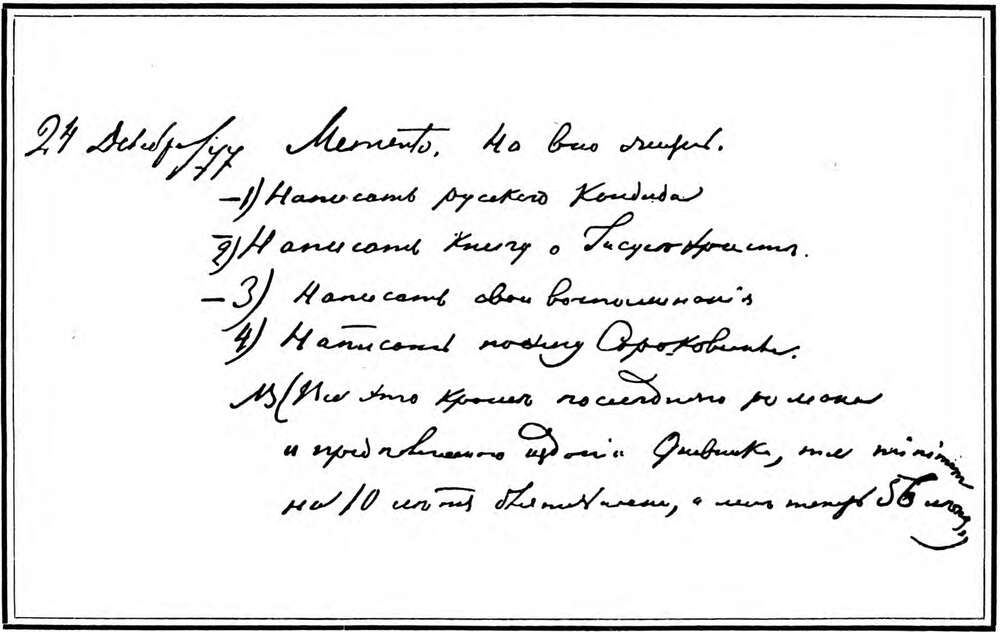
Tagebuchblatt Dostojewskis
24. XII. 77.
Memento für das ganze Leben.
| 1) | Den russischen Candide schreiben. |
| 2) | Ein Buch über Jesus Christus schreiben. |
| 3) | Meine Memoiren schreiben. |
| 4) | Ein Poem „Die Ssorokowin’s“ schreiben. |
NB. (Dies alles außer dem letzten Roman und der beabsichtigten Ausgabe des „Tagebuchs“ erfordert minimum 10 Jahre Arbeit, ich bin jetzt aber 56 Jahre alt.)
Ich halte es für meine Pflicht, alles Bedeutungsvolle, das sich in meiner Erinnerung an Fjodor Michailowitsch Dostojewski erhalten hat, ferner alle seine Gedanken und Gefühlsäußerungen, so gut ich kann und wie ich sie verstehe, für die Öffentlichkeit niederzuschreiben. Ich stand ihm vor Jahren sehr nahe, namentlich während meiner Mitarbeiterschaft an den Zeitschriften, die er leitete, weshalb ich nicht nur seine Anschauungen und deren Entwicklungsgeschichte, sondern auch die Entwicklungsgeschichte dieser Zeitschriften selbst von allen noch Lebenden am besten zu kennen glaube. Gleichzeitig will ich mich bemühen, mit aller Aufrichtigkeit und Genauigkeit wiederzugeben, was ich von seinen persönlichen Eigenschaften und seinen Beziehungen zu anderen Menschen kennen zu lernen oder zu hören Gelegenheit hatte. Doch mein Hauptthema wird seine literarische und journalistische Tätigkeit sein.
Die journalistischen Arbeiten F. M. Dostojewskis sind, alles in allem genommen, recht umfangreich. Er hatte die größte Vorliebe gerade für diese Art Tätigkeit. Die letzten Zeilen, die er schrieb, sind die Artikel der letzten Nummer seines „Tagebuchs“.
Die Zeitschriften, an denen er als Journalist, d. h. als Redakteur, Publizist und Kritiker arbeitete, waren folgende:
1. „Die Zeit“ – eine umfangreiche Monatsschrift, die unter der Redaktion seines älteren Bruders, Michail Michailowitsch Dostojewski, vom Januar 1861 bis zum April 1863 erschien[1].
2. „Die Epoche“ – eine Monatsschrift wie die vorhergehende, die seit dem Anfang des Jahres 1864 bis zum Februar 1865 erschien, in den ersten Monaten gleichfalls unter der Redaktion Michail Michailowitschs, später, nach seinem Tode am 4. Juni, unter der Redaktion A. U. Porezkis.
3. „Der Bürger“ – eine Wochenschrift, die im Jahre 1872 vom Fürsten W. P. Meschtscherski[2] gegründet wurde. Im ersten Jahr war G. K. Gradowskij ihr Redakteur, im zweiten, 1873, F. M. Dostojewski. In dieser Wochenschrift begann er bereits, Feuilletons unter dem Titel „Tagebuch eines Schriftstellers“ zu veröffentlichen, die somit der Anfang der folgenden Zeitschrift sind.
4. „Tagebuch eines Schriftstellers.“ Dasselbe erschien einmal monatlich in den Jahren 1876 und 1877. Im Jahre 1880 erschien nur eine Nummer im August, und 1881 das letzte Heft kurz nach dem Tode Dostojewskis.
Der Geist und die Richtung dieser Zeitschriften verfolgten einen besonderen Weg, im Gegensatz zu allen anderen Petersburger Zeitschriften, die sich ja bekanntlich in ihren Zielen durch große Gleichartigkeit auszeichnen, vermutlich infolge der gleichen Bedingungen, unter denen sie sich entwickeln. Die Tätigkeit F. M. Dostojewskis war dieser allgemeinen Petersburger Geistesart gerade entgegengesetzt, und so war vornehmlich er derjenige, der durch die Kraft seines Talentes und den Eifer seiner Überzeugungen der anderen Richtung, nicht der Petersburger, sondern der breiteren, sagen wir, der russischen, einen so bedeutenden Erfolg verschaffte.
Meine Bekanntschaft mit F. M. Dostojewski begann auf journalistischem Gebiet und noch bevor die erste Dostojewskische Zeitschrift herausgegeben wurde. Der Hauptmitarbeiter einer neuen Zeitschrift, A. P. Miljukoff, damals mein Kollege an einem der Petersburger Unterrichtsinstitute, hatte meinen ersten größeren Artikel angenommen und mich gleichzeitig zu seinen Dienstagen eingeladen, an welchen Tagen sich bei ihm ein bestimmter Literatenkreis zu versammeln pflegte. Seit dem ersten Abend, den ich in dem Kreise verbrachte, betrachtete ich mich gewissermaßen als in diese Gesellschaft aufgenommen und alles interessierte mich sehr. Die hervorragendsten unter den Gästen A. P. Miljukoffs waren die beiden alten Freunde des Hausherrn – die Brüder Dostojewski, die man gewöhnlich zusammen sah. Außer ihnen erschienen noch die Dichter Maikoff, Krestoffski, Minajeff und andere. Den ersten Platz in diesem Kreise nahm natürlich F. M. Dostojewski ein. Alle sahen in ihm bereits einen hervorragenden Schriftsteller, doch beherrschte er den Kreis nicht etwa infolge seiner Berühmtheit, sondern auf eine ganz natürliche Weise: durch seinen Gedankenreichtum und die Lebhaftigkeit, mit der er seine Gedanken aussprach. Der Kreis war nicht groß und seine Mitglieder standen einander sehr nahe, so daß von einer Gezwungenheit, wie sie sonst in russischen Gesellschaften so oft herrscht, hier nicht die Rede sein konnte. Schon damals hatte Dostojewski eine besondere Art zu sprechen. Oft unterhielt er sich längere Zeit nur halblaut, fast nur flüsternd mit einem von uns, bis ihn dann irgend etwas erregte und hinriß und er plötzlich die Stimme erhob. Übrigens konnte man ihn zu jener Zeit, was seine Gemütsverfassung betrifft, ziemlich heiter nennen; es war in ihm damals noch sehr viel Weichheit, im Gegensatz zu den letzten Lebensjahren, wo er sie nach allem Ausgestandenen langsam eingebüßt hatte. Seines Äußeren erinnere ich mich noch lebhaft: er trug damals nur einen Schnurrbart und hatte, ungeachtet der mächtigen Stirn und der prachtvollen Augen, ein ganz soldatisches Aussehen, d. h. Gesichtszüge, wie man sie unter dem einfachen Volke findet. Auch erinnere ich mich seiner ersten Frau, die ich nur einmal ganz flüchtig sah. Sie machte auf mich einen sehr angenehmen Eindruck durch ihre bleichen, zarten Züge, obgleich dieselben unregelmäßig waren; überdies konnte man ihr die Neigung zu der Krankheit, die sie ins Grab brachte, schon ansehen. Sie starb an der Schwindsucht.
Die Gespräche in diesem literarischen Kreise interessierten mich außerordentlich. Das war für mich eine neue Schule, in die ich hier geriet, eine Schule, die in vieler Hinsicht meinen Ansichten und meiner Geschmacksrichtung widersprach. Ich hatte bis dahin einem anderen Kreise angehört, einem Kreise, in dem man die Wissenschaft sehr hoch hielt, Dichtkunst und Musik, Puschkin und den Komponisten Glinka verehrte.
Damals beschäftigte ich mich viel mit Naturwissenschaft und Philosophie und so studierte ich natürlich fleißig die Deutschen, in denen ich die Führer der Aufklärung sah. Bei den Literaten verhielt es sich anders: die lasen alle sehr eifrig die französischen Schriftsteller, während die deutschen ihnen gleichgültig waren. Alle wußten, daß der ältere der Brüder Dostojewski, Michail Michailowitsch, eine Ausnahme bildete, da er die deutsche Sprache so weit beherrschte, daß er deutsche Bücher lesen und aus dem Deutschen übersetzen konnte. Fjodor Michailowitsch hatte zwar gleichfalls Deutsch gelernt, doch ganz wie die anderen das Gelernte vergessen, und so las er bis an sein Lebensende von fremden Sprachen nur Französisch. Während seiner Verbannung in Sibirien hat er zwar einmal, wie aus einem Brief hervorgeht, den Vorsatz gefaßt, sich ernstlich an die Arbeit zu machen. Er bat den Bruder, ihm Hegels Geschichte der Philosophie in deutscher Sprache zu senden; aber das Buch blieb ungelesen und bald nachdem er mich kennen gelernt hatte, schenkte er es mir.
So hatten sich denn die Anschauungen dieses Literatenkreises unter dem Einfluß der französischen Literatur entwickelt. Politische und soziale Fragen spielten hier die erste Rolle und verdrängten die ausschließlich künstlerischen Interessen. Ein Künstler mußte nach ihrer Auffassung die Entwicklung gewisser sozialer Ideale verfolgen und verfechten, in die Tagesfragen eingreifen, das entstehende Gute oder Schlechte der Gesellschaft zu Bewußtsein bringen, überhaupt Leiter und Erläuterer, d. h. im Grunde genommen ein Politiker und Publizist sein. So wurde fast unumwunden verlangt, daß der Künstler die ewigen und allgemeinen Interessen den zeitweiligen und gewissermaßen parteilichen unterordnen solle. Von der Notwendigkeit dieser publizistischen Tätigkeit war Fjodor Michailowitsch unerschütterlich überzeugt und blieb es bis zu seinem Tode.
Die Aufgabe des Schriftstellers und Künstlers sah man hauptsächlich in der Beobachtung und Schilderung verschiedener Menschentypen, vornehmlich geringer und mitleiderregender, und in der Auslegung, wie sie unter dem Einfluß ihres Milieus, ihrer Verhältnisse, sich zu dem entwickelt hatten, was sie schließlich geworden waren. Deshalb war es bei den Literaten Sitte, gelegentlich in die schmutzigsten und verrufensten Lokale zu gehen und dort freundschaftliche Gespräche mit Leuten anzuknüpfen, die selbst der Krämer und niedrigste Subalternbeamte verabscheut hätte, und auch das Abstoßendste wurde von ihnen mit Mitleid und Nachsicht beurteilt.
Ich sage offen, daß dieses Prinzip schädlich war. Schädlich nicht etwa, weil es falsch ist, sondern weil die Ergebnisse nicht vollständig sind und mit Zusätzen vervollständigt werden müssen, die wichtiger sind als das Prinzip selbst. Man sollte meinen, was kann es besseres geben, als Humanität? Oder was könnte interessanter sein als ein Kunstwerk, das den gegenwärtigen Augenblick wiederspiegelt? Indessen führt Humanität ohne leitende Grundsätze zum Verfall der Sitten, wie das unter den Cäsaren und im achtzehnten Jahrhundert der Fall war. Denn Nachsicht und bloßes Mitleid mit den Leiden der Menschen besagt wenig, man muß auch noch wissen, wofür man die Menschen liebt, und muß verstehen, worin die Schönheit und Würde der Menschenseele besteht. Deshalb vermag ein Künstler nur dann dem Augenblick zu dienen, wenn seinem Geiste Anschauungen zugrunde liegen, denen die Zeit nichts anhaben kann. Andernfalls wird er, wie wir das schon oft gesehen haben, nicht der Beherrscher, sondern der Sklave des Augenblicks sein.
Waren die Literaten dieses Kreises unter sich, so kam das Gespräch beständig auf das Thema der verschiedenen Typen jener Art, und man bewies viel Geist und Beobachtungsgabe bei Gelegenheit dieser physiologischen Erörterungen. Anfangs wunderte ich mich sehr, wenn das Urteil über menschliche Eigenschaften oder Handlungen nicht von der Höhe des sittlichen Standpunktes und seiner feststehenden Anforderungen gefällt wurde, sondern unter dem Gesichtswinkel der unvermeidlichen Übermacht der verschiedenen Einflüsse und der unvermeidlichen Unterlegenheit der menschlichen Natur. Die besondere Art, wie Fjodor Michailowitsch über diese Dinge dachte, die über dieser Physiologie stand, offenbarte sich mir erst in der Folge mit ganzer Klarheit. In der ersten Zeit aber gewahrte ich sie gar nicht in dem allgemeinen Strom der mir ganz neuen Ansichten.
Diese Gedankenrichtung, die man zweifellos auf den Einfluß der französischen Literatur zurückführen muß, war eine der Richtungen der vierziger Jahre, jener fruchtbaren Zeit, als Europa mit seinem ganz besonders regen geistigen Leben auf uns Russen einen großen Einfluß ausübte und in Rußland eine Saat säte, die erst lange nachher aufging. Diese bei uns fortwährend sich wiederholende Erscheinung, daß wir hinter Europa zurückbleiben, hat mir oft zu denken gegeben und erst spät habe ich mich mit ihr ausgesöhnt. Offenbar stehen wir Europa immer deshalb nach, weil wir nicht sein Leben leben, sondern von ihm nur seine Gedanken nehmen, die wir dann auf immer behalten, während wir für andere neue Lehren unserer Lehrerin taub und stumm bleiben. Nach dem Jahre 1848 trat in Westeuropa ein Umschwung in der allgemeinen Stimmung ein: die frohen Hoffnungen verblaßten, das sittliche Niveau sank, es brach gleichsam eine furchtbare Krankheit aus und überall verbreitete sich Schwermut und begann Pessimismus zu herrschen. Der feinfühlige Alexander Herzen[3], der dies alles mit eigenen Augen sah, äußerte sich darüber in wahrer Verzweiflung. 1859 war Europa schon längst wieder in seine unschöpferische Periode eingetreten, während bei uns gerade damals die erste Saat aufzugehen begann. Es hat wohl kaum jemals in unserer Literatur eine so frohe und belebte Stimmung geherrscht wie in der Zeit von 1856 bis zu den Petersburger Brandstiftungen im Jahre 1862. Wir waren noch in keiner Beziehung enttäuscht und ein jeder gab sich unbehindert seinen Lieblingsgedanken hin und predigte das, was in Europa seinen Wert schon verloren oder bereits eine ganz andere Bedeutung erhalten hatte. Was mich betrifft, so gehörte ich in literarischer Beziehung gleichfalls zu einer der Richtungen der vierziger Jahre, jedoch zu einer noch älteren, als es diejenige war, zu der sich der Literatenkreis, von dem hier die Rede ist, bekannte – nämlich zu der Richtung, für die der Gipfel der Bildung nichts anderes bedeutete, als Hegel zu verstehen und Goethe auswendig zu kennen. Deshalb, und noch aus Gründen bestimmter Meinungsverschiedenheiten, fiel mir die so ganz andere Stimmung des Literatenkreises besonders auf.
Dieser Stimmung lag, wie bereits erwähnt, ein an sich gewiß herrliches Gefühl zugrunde: Humanität, Mitleid mit Menschen, die in einer schwierigen Lage sind, und ein Verzeihen ihrer Schwäche. In der Tat, man kann sich leicht einer gewissen Grausamkeit schuldig machen, wenn man seinen Mitmenschen die unerfüllte Pflicht vorhält – selbst wenn es sich dabei um eine sittliche Pflicht handelt. So war denn der literarische Kreis, in den ich eintrat, für mich in vieler Hinsicht eine Schule der Humanität. Doch ein anderer Zug, der mich besonders frappierte, stellte an sich eine weit größere Abweichung von meinen Ansichten dar. Zu meiner größten Verwunderung bemerkte ich, daß man in diesem Kreise Ausartungen, ja Ausschweifungen im Sinnlichen gar keine Bedeutung beimaß. Dieselben Menschen, die in sittlicher Beziehung von so ungeheurer Feinfühligkeit waren, die den höchsten Gedankenflug hatten und selber sogar größtenteils jeder physischen Ausschweifung fernstanden, dieselben Menschen sahen indessen mit vollkommenem Gleichmut auf alle Extravaganzen, sprachen von ihnen wie von spaßigen Narreteien oder nichtssagenden Lappalien, denen sich in einer freien Minute hinzugeben durchaus statthaft sei. Geistige Unanständigkeit wurde streng und scharf gerügt, fleischliche Unanständigkeit dagegen überhaupt nicht beachtet. Diese sonderbare Emanzipation des Fleisches wirkte geradezu verführerisch, und in einigen Fällen hatte sie Folgen, an die zu denken schmerzlich und furchtbar ist. Von denen, die ich während meiner literarischen Mitarbeiterschaft, namentlich in den sechziger Jahren, kennen lernte, habe ich einige infolge dieser physischen Sünden, die sie für so belanglos hielten, sterben und wahnsinnig werden gesehen.
Fjodor Michailowitsch suchte stets den letzten und neuesten Charakterzug des Lebens zu erhaschen, aber ungeachtet dessen, daß er sich beständig in die Zeiterscheinungen hineindachte und stolz war auf ihre richtige Wiedergabe in seinen Werken, stellte er doch gleichzeitig als Künstler die strengen Forderungen der Kunst über alles andere. Zwar suchte er in der Kunst immer irgendeine zeitliche oder nationale Bedeutung, aber die Kunst an sich entzückte ihn auch ohne alle Bedingungen und in der letzten Zeit begann er sogar, unumwunden die berühmte Formel „die Kunst für die Kunst“ zu verteidigen. Dieser Widerspruch lebte beständig in ihm, gleich vielen anderen Widersprüchen in seinen Gedanken und Handlungen, die aber in der Tiefe seiner Seele ihren natürlichen Ausgleich fanden und ihn in vielen Fällen vor falschen und unnormalen Wegen zurückhielten. Indem er sich über diese Widersprüche stellte, erhob er sich auf die Höhen, die seiner ganzen Tätigkeit ihre so wunderbare Stimmung geben.
Diese seine Tätigkeit läßt sich in zwei deutlich zu unterscheidende Hälften teilen: die erste Hälfte (von seinem ersten Werk „Arme Leute“ bis zu „Rodion Raskolnikoff“) verrät, was das Milieu und die Aufgaben betrifft, den Einfluß Gogols; die zweite Hälfte, die selbständigere (von Rodion Raskolnikoff bis zum Schluß) widmet sich ausnahmslos der damals in unserer Gesellschaft auftretenden Erscheinung, unserer größten inneren Krankheit – dem Nihilismus.
Hier dürfte die Bemerkung erforderlich sein, daß in diesen meinen Aufzeichnungen nicht etwa Versuche, den verstorbenen Schriftsteller vollkommen zu erklären, zu sehen sind. Das lehne ich mit aller Entschiedenheit ab. Dazu ist er mir viel zu nah und unverständlich. Wenn ich an ihn denke, so frappiert mich zunächst die unermüdliche Beweglichkeit seines Geistes und die unerschöpfliche Fruchtbarkeit seiner Seele. Es war in ihm gleichsam noch nichts endgültig Ausgebildetes, in solchem Überfluß entstanden in ihm Gedanken und Gefühle, soviel Unbekanntes und Unausgesprochenes blieb noch hinter dem verborgen, was ihm auszusprechen gelang. Deshalb wuchs und erweiterte sich auch seine literarische Tätigkeit wie in Ausbrüchen, jedenfalls auf eine der gewöhnlichen Entwicklungsart ganz fremde Weise. Nach einer gleichmäßigen Fortdauer und sogar einem scheinbaren Schwächerwerden seines Talentes offenbarte er plötzlich neue Kräfte, zeigte er sich wieder von einer neuen Seite. Natürlich ist er überall derselbe Dostojewski. Nur kann man leider nicht sagen, daß er sich ganz ausgesprochen habe; der Tod verhinderte ihn, sich in neuem und letztem Aufschwunge zu erheben, und hat uns gewiß vieles vorenthalten.
Mit ganz ungewöhnlicher Deutlichkeit zeigte sich in ihm eine besondere Art von Dualismus, der darin bestand, daß der Mensch, selbst wenn er sich äußerst lebhaft gewissen Gedanken und Gefühlen hingibt, in seiner Seele dennoch ein ununterjochbares und unerschütterliches Bewußtsein behält, von dem aus er auf sich selber, auf seine Gedanken und Gefühle sieht. Ich habe ihn mehrmals über diese seine Eigenschaft sprechen hören, und er nannte sie „Reflexion“. Die Folge eines solchen Dualismus ist, daß der Mensch immer die Möglichkeit behält, darüber zu urteilen, was seine Seele erfüllt, daß die verschiedenen Gefühle und Stimmungen sich nie restlos seiner Seele bemächtigen können, und daß aus diesem tiefen seelischen Zentrum eine Energie hervorgeht, die die ganze Tätigkeit und den ganzen Geist und Inhalt des Schaffens belebt und gestaltet.
Doch wie dem auch sei, jedenfalls überraschte mich Fjodor Michailowitsch immer durch die Ungebundenheit seines Denkens, durch seine Fähigkeit, verschiedene und sogar entgegengesetzte Auffassungen zu verstehen. Als ich ihn kennen lernte, zeigte er sich als größter Verehrer Gogols und Puschkins und war von ihrer Kunst über alle Maßen entzückt. Ich erinnere mich noch heute, wie ich ihn zum erstenmal Puschkins Gedichte lesen hörte. Er wurde von Michail Michailowitsch dazu aufgefordert, der ihn mit Genugtuung lesen hörte und offenbar mit größter Bewunderung zum Bruder aussah. Fjodor Michailowitsch las allerdings sehr gut, aber mit jener etwas unfreien, klanglosen Stimme, mit der in der Regel Ungeübte ein Gedicht vortragen. Ich erwähne dies nur deshalb, weil er in den letzten Lebensjahren tatsächlich wundervoll vortrug und das Publikum durch seine Kunst mit Recht begeisterte.
Gogol war gegen Ende der fünfziger Jahre bei allen noch in frischer Erinnerung, besonders bei den Literaten, die in ihren Gesprächen fortwährend seine Ausdrücke und Redewendungen zu gebrauchen pflegten. Ich erinnere mich, wie Fjodor Michailowitsch sehr feine Bemerkungen über die richtig zu Ende gezeichneten Charaktere und die Lebenswahrheit aller Gestalten Gogols machte. Überhaupt hatte die Literatur zu jener Zeit noch eine Bedeutung, die sie heutzutage nicht mehr hat. Fjodor Michailowitsch war ihr mit ganzem Herzen ergeben, und Puschkin und Gogol hatten ihn nicht nur erzogen, er schöpfte auch später noch beständig aus ihnen. Als seine Rede zur Puschkinfeier alle anderen Reden in den Schatten stellte und ihm einen Triumph eintrug, wie sich schwerlich jemand einen ähnlichen vorstellen kann, wenn er diesen nicht miterlebt hat, da sagte ich mir, daß dieser Lohn ihm allein in Wahrheit gebührte, denn von der ganzen Schar der Lobredner und Verehrer hatte wahrlich niemand Puschkin so geliebt wie Dostojewski.
Seine literarische Arbeit kam ihm teuer zu stehn. Einmal sagte er mir, die Ärzte hätten von ihm als erste Bedingung einer Heilung seiner Krankheit verlangt, daß er das Schreiben ganz und gar aufgäbe. Das war ihm natürlich nicht möglich, selbst wenn er sich zu einem solchen Leben hätte entschließen können – zu einem Leben ohne die Erfüllung dessen, wozu er sich berufen fühlte. Aber er hatte noch nicht einmal die Möglichkeit, sich ein bis zwei Jahre wenigstens gut zu erholen. Erst kurz vor seinem Tode gestalteten sich seine Verhältnisse – hauptsächlich dank der Sorge Anna Grigorjewnas, seiner zweiten Frau – soweit günstig, daß er sich eine zeitweilige Erholung hin und wieder gestatten konnte; doch andererseits war er gerade vor seinem Tode weniger denn je zu einem Ausspannen und Stehenbleiben auf seinem Wege geneigt.
Die epileptischen Anfälle wiederholten sich ungefähr einmal in jedem Monat; das war der gewöhnliche Verlauf der Krankheit. Bisweilen aber, wenn auch nur sehr selten, kamen die Anfälle öfter, sogar zweimal wöchentlich. Im Auslande, wo er mehr Ruhe hatte und wohl auch infolge des milderen Klimas sich besser fühlte, sollen manchmal ganze vier Monate in Ruhe vergangen sein. Er hatte stets ein Vorgefühl des Anfalls, doch es konnte auch täuschen.
Einmal – es war, wenn ich nicht irre, im Jahre 1863 am Ostersonnabend – kam er ziemlich spät, etwa gegen elf Uhr, zu mir und wir gerieten in ein lebhaftes Gespräch. Ich erinnere mich nicht mehr, über welchen Gegenstand wir gerade sprachen, aber jedenfalls war es ein sehr wichtiges abstraktes Thema. Fjodor Michailowitsch war sehr angeregt und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, während ich am Tische saß. Er sagte irgend etwas Großartiges, Frohes, und als ich seinem Gedanken mit einer Bemerkung beistimmte, da wandte er sich mit begeistertem Gesicht zu mir, mit einem Ausdruck, der deutlich verriet, daß seine Begeisterung ihren höchsten Grad erreicht hatte. Für einen Augenblick blieb er stehen, als suche er nach Worten für seinen Gedanken, und öffnete schon den Mund. Ich sah ihn mit Spannung an, denn ich fühlte, daß er etwas Außergewöhnliches sagen, daß ich vielleicht eine Offenbarung hören würde. Plötzlich drang aus seinem offenen Munde ein seltsamer, gezogener, sinnloser Schrei, und er fiel bewußtlos mitten im Zimmer hin.
Der Anfall war nur von mittlerer Stärke. Infolge der Krämpfe streckte sich der ganze Körper und an den Mundwinkeln trat Schaum hervor. Nach Verlauf einer halben Stunde kam er wieder zu sich, und ich begleitete ihn zu Fuß nach Haus, da er sehr nah wohnte.
Ich habe mehrmals von Fjodor Michailowitsch gehört, daß er vor dem Anfall Augenblicke der größten Verzückung und Begeisterung erlebe. „In diesen wenigen Augenblicken,“ sagte er, „empfinde ich ein Glück, wie man es in normalem Zustande niemals empfindet, und von dem die anderen Menschen sich gar keine Vorstellung machen können. Ich fühle vollständige Harmonie in mir und mit der ganzen Welt, und dieses Gefühl ist so stark und süß, daß man für die wenigen Sekunden einer solchen Seligkeit zehn Jahre seines Lebens, ja sogar das ganze Leben hingeben könnte.“
Als Folge der Krämpfe stellten sich bei ihm nach einem Anfalle Schmerzen in den Muskeln ein, abgesehen von den Schmerzen der Verletzungen, die er sich manchmal beim Fall zuzog. Bisweilen zeigte das Gesicht eine auffallende Röte oder auch nur rote Flecke. Doch das Schlimmste war, daß der Kranke die Erinnerung verlor und für zwei bis drei Tage sich wie zerschlagen fühlte. Sein Gemütszustand war dann ein sehr bedrückter, – er konnte seinen Kummer und eine gewisse gesteigerte Sensibilität kaum überwinden. Das Wesen dieses Kummers bestand nach seinen Worten darin, daß er sich als Verbrecher empfand und den Wahn nicht abschütteln konnte, eine unbekannte Schuld, ein ungeheures Verbrechen laste auf ihm.
Es läßt sich hiernach leicht denken, wie schädlich für ihn alles war, was einen Blutandrang in den Kopf hervorruft, also besonders das Schreiben. Dies ist übrigens nur eine der vielen Qualen, die die Schriftsteller im allgemeinen zu ertragen haben. Ich glaube, man kann diejenigen unter ihnen Ausnahmen nennen, bei denen die schriftstellerische Arbeit nicht mit einer Aufhebung des Gleichgewichts in ihrem Organismus, nicht mit einer Empfindsamkeit und Anspannung verbunden ist, die an Krankheit grenzen und deshalb unvermeidlich Qual verursachen. Die Freuden des Schaffens, der geistigen Befriedigung haben gleichfalls ihre Schattenseiten. Eine feine Sensibilität wird oft nur durch qualvolle Verhältnisse ausgebildet, jedenfalls aber werden durch sie sogar gewöhnliche Verhältnisse qualvoll.
Auch über seine Art, zu schreiben, sei hier einiges gesagt. Gewöhnlich mußte er sich sehr beeilen, mußte zu einem Termin soundsoviel Druckbogen liefern, weshalb er sich in der Arbeit überhastete und nicht selten dennoch nicht fertig wurde. Da er nur von dem Honorar seiner literarischen Arbeiten lebte und fast bis zu seinem Lebensende, oder doch wenigstens bis zu den letzten drei oder vier Jahren sich immer irgendwie durchschlagen mußte, war er gezwungen, beständig um Vorschuß zu bitten und auf Bedingungen einzugehen, denen er nur schwer nachkommen oder die er überhaupt nicht erfüllen konnte. Hinzu kam, daß er im Geldausgeben weder Einteilung noch Vorsicht in demjenigen Maße besaß, wie sie vonnöten sind für einen, der ausschließlich von literarischer Arbeit lebt, die ja doch nichts Regelmäßiges und Bestimmtes einbringt. So kam es denn, daß er sein Leben lang in seinen Schulden und Verpflichtungen wie in einem Netz gefangen saß und sein Leben lang gehetzt und überanstrengt arbeitete. Diese Mißstände hatten noch einen anderen Grund, der sogar viel schwerwiegender war.
Fjodor Michailowitsch schob das Arbeiten immer bis zur letzten Möglichkeit auf; erst wenn ihm nur noch knapp so viel Zeit bis zum Termin übrigblieb, daß er, wenn er eifrig schrieb, das Manuskript fertigstellen konnte – erst dann machte er sich an die Arbeit. Das war eine gewisse Faulheit, die sogar sehr groß sein konnte; doch war es immerhin keine gewöhnliche, sondern eine besondere, eben eine Künstlerfaulheit. Die tiefere Ursache freilich war, daß in ihm eine ununterbrochene Arbeit, eine rastlose Bewegung und ein Anwachsen der Gedanken vor sich ging, weshalb es ihm immer sehr schwer fiel, sich von dieser inneren Arbeit loszureißen und mit der äußeren, dem Schreiben, zu beginnen. Während er scheinbar müßig war, arbeitete er in Wirklichkeit unaufhörlich. Menschen, in denen diese innere Arbeit sich nicht vollzieht, oder nur in geringem Maße, langweilen sich gewöhnlich ohne eine äußere Beschäftigung, der sie sich darum auch meist mit Freuden widmen.
Fjodor Michailowitsch dagegen langweilte sich infolge dieses Überflusses von Gedanken und Gefühlen, die in ihm wogten, niemals, und schätzte den äußeren Müßiggang über alles. Man kann sagen, daß in seinem Geist fortwährend neue Gestalten, Pläne neuer Werke entstanden, indes die alten Pläne reiften und sich entwickelten.
Er schrieb nahezu ausnahmslos in der Nacht. Nach elf Uhr, wenn alles im Hause zur Ruhe ging, blieb er allein mit dem Samowar in seinem Zimmer und schrieb bis fünf oder sechs Uhr morgens, wobei er zwischendurch nicht sehr starken und fast kalten Tee trank. Infolgedessen stand er dann auch erst um zwei, ja sogar erst um drei Uhr nachmittags auf, und der Tag verging für ihn mit Empfang von Gästen und, nach einem Spaziergang, mit Besuchen bei Bekannten.
Gerade an Fjodor Michailowitsch konnte man deutlich beobachten, welch eine Riesenarbeit das Schreiben für Schriftsteller von seinem Inhaltsreichtum ist.
Was die Flüchtigkeit und Unfertigkeit seiner Werke betrifft, so war sich Fjodor Michailowitsch ihrer Mängel durchaus bewußt und gab sie auch ohne alle Beschönigungen zu. Und nicht nur das. Es tat ihm zwar leid um diese „unvollendeten Werke“, aber er bereute nicht nur nicht seine Eile in der Arbeit, sondern hielt sie sogar für notwendig und nützlich. Für ihn war die Hauptsache nicht das Werk an sich, sondern der Augenblick und der Eindruck, wenn auch letzterer nicht vollständig fehlerfrei sein mochte. In diesem Sinne war er ganz Journalist und ein Verleugner der Theorie der reinen Kunst. Seine Pläne und Absichten waren zahllos und so trug er sich immer mit mehreren Themen, die er alle bis zur Vollendung auszuarbeiten gedachte – jedoch später irgend einmal, wenn er mehr Muße haben werde, wenn die Zeiten ruhiger geworden seien! Vorläufig aber schrieb und schrieb er halb ausgearbeitete Sachen – einerseits, um sich die Mittel zum Lebensunterhalt zu verdienen, andererseits, um fortwährend seine Stimme durchzusetzen, in der öffentlichen Meinung, in den Debatten und Erörterungen der Tagesfragen, und um das Publikum nicht in Ruhe zu lassen, sondern immer wieder mit seinen Gedanken aufzurütteln.
Eine große und bedeutungsvolle Eigenheit unserer Literatur sind von jeher die Zeitschriften, deren Kennzeichen Eile und Flüchtigkeit zu sein pflegen. Die Mitarbeiter haben sich selbst und auch die Leser an ein inhaltleeres Wortgepräge gewöhnt, an seichte Räsonnaden und formlose Betrachtungen, die gedanklich höchstens einen Anfang, doch weder ein Ende noch eine Mitte haben, und die fast ausnahmslos den Inhalt der Zeitschriften bilden. Die Tatsache, daß die Literatur von dieser Art ist, hängt natürlich damit zusammen, daß das Publikum nur Neues, nur eben Geschehenes liest, im Neuen aber nicht Befriedigung seiner Wißbegier oder seiner ästhetischen Neigungen sucht, sondern nur Angaben der im Augenblick gerade neuesten Anschauungen des Westens oder wenigstens unserer tonangebenden Literatenkreise. Unsere Leser sind nicht Richter, sondern nur Schüler, nicht Menschen, die bereits ihre festen Anschauungen haben, sondern Menschen, die anderen, die in ihren Anschauungen fortgeschrittener sind, nicht nachstehen wollen. Sie bedürfen einer Autorität, und sie verlangen nach einer leichten Lektüre, die ihnen gleichzeitig die beruhigende Gewißheit gibt, daß sie den Geist und die Richtung der allerneuesten, allerletzten Erscheinungen in der Weltliteratur kennen. So hat sich denn diese riesige Zeitschriftenliteratur entwickelt, deren Schreibmethode bis zur größten Nachlässigkeit sinken kann. Da die Literatur nur eine dienende Rolle spielte und folglich der Selbständigkeit entbehrte, mußte sie natürlich verflachen und die Strenge sowohl in der Ausdrucksform wie im Gedankeninhalt einbüßen.
Nichtsdestoweniger war diese Literatur weder unnütz noch unwürdig. Immerhin verstand sie es, die Leser zu erziehen, und größtenteils war sie sogar von ehrlichem Eifer für ihre Ziele erfüllt. Deshalb ist es auch begreiflich, daß Fjodor Michailowitsch die Journalistik liebte und ihr gern diente, wobei er sich selbstverständlich vollkommen dessen bewußt war, was er tat und worin er von der strengen Form des Gedankens und der Kunst abwich. Von Jugend auf an die Journalistik gewöhnt, von ihr halbwegs sogar erzogen, blieb er ihr bis zuletzt treu, ja er schloß sich ganz rückhaltlos, schloß sich vollkommen dieser Literatur an, die ihn umgab, und stellte sich niemals abseits von ihr.
Seine regelmäßige Lektüre bildeten russische Zeitschriften und Zeitungen, und seine Aufmerksamkeit war beständig auf seine Kollegen in der schönen Literatur, auf alle Kritiker seiner eigenen wie auch fremder Werke gerichtet. Es lag ihm sehr viel an jedem Erfolg, an jedem Lob, während ihn Angriffe äußerst betrübten. Im Literarischen lagen nun einmal seine hauptsächlichsten geistigen Interessen – doch übrigens auch seine materiellen. Er lebte, wie gesagt, ausschließlich von seiner literarischen Arbeit und dachte nicht einmal an eine andere Beschäftigung, ja er verfiel überhaupt nicht auf den Gedanken, sich durch einen Staatsdienst oder Privatdienst materiell sicherzustellen. War er in Geldverlegenheit, so wandte er sich ganz ungeniert an die betreffenden Redaktionen oder Verleger. So traf es sich bisweilen, daß ich während seines Aufenthalts im Auslande auf seine Bitte hin mit verschiedenen Verlegern zu unterhandeln hatte, gewöhnlich wegen einer Summe, die er für eine noch ungeschriebene Novelle zu erhalten wünschte. Oft endeten die Unterhandlungen mit einer Weigerung des Verlegers, und mir tat es bisweilen sehr weh, zu denken, wem er diese Vorschläge machte und dazu noch vergeblich. Er aber betrachtete diese Fälle als unvermeidliche Unbequemlichkeit seines Berufes, denn er begriff nur zu gut, daß man ihm deshalb keineswegs etwa Vorwürfe machen konnte. Die Abhängigkeit von Redaktionen und Verlegern sind wie jedes Angebot mit Unterhandlungen ein gütlicher Vertrag, eine Abmachung unter Gleichgestellten, und können deshalb niemals so peinlich sein wie andere Beziehungen.
So waren auch die Schattenseiten der Literatur für ihn nichts Fremdes; er hatte sie nun einmal zu seinem Beruf erwählt und äußerte sich nicht selten in dem Sinne, daß er stolz auf ihn sei. Denn er liebte die Literatur, namentlich in der ersten Zeit, als jener Unterschied, der ihn später zur Opposition gegen die allgemeine Petersburger Journalistik veranlaßte, noch nicht scharf hervortrat. Und diese Liebe war der wichtigste Grund, weshalb er nicht sogleich zu den Slawophilen überging. Er empfand doch lebhaft die Feindseligkeit, mit der sich diese von jeher ihren Prinzipien gemäß zur zeitgenössischen Literatur verhielten.
Der Vollständigkeit halber muß ich auch meine Stellungnahme ein wenig erläutern. Da ich mich für die wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet hatte und erst spät in den Literatenkreis geriet, verhielt ich mich zur Journalistik mit einer gewissen Skepsis und Geringschätzung. Nach Möglichkeit vermied ich Vielschreiberei und bemühte mich, meine Artikel auch wirklich auszuarbeiten. Diese Sorgfalt meinerseits rief gewöhnlich Fjodor Michailowitschs Spott hervor. „Sie arbeiten immer für die Gesamtausgabe Ihrer Werke!“ sagte er. „Die wird es nie geben,“ sagte ich. Bald aber hatte ich mich doch so in die Literatur hineinziehen lassen, daß ich ihre Interessen viel mehr zu Herzen zu nehmen begann. An die Stelle der früheren Geringschätzung der Journalistik trat ein ernsteres Verhältnis zu ihr, als sich zeigte, daß auf der Unterlage dieser Räsonnaden solche Erscheinungen wachsen konnten wie der Nihilismus. Die Feindschaft, die ich gegen diesen empfand, bemühte ich mich auch Fjodor Michailowitsch einzuimpfen.
Seine Vorliebe für den Feuilletonstil hat Dostojewski nie ganz verlassen. Ja er zwang sich selbst oft zu diesem Stil, um seine Gedanken allgemeinverständlich auszudrücken, auf eine dem Leser vertraute Weise. Dennoch wurde seine Schreibart mit den Jahren immer strenger, und auch in seinen früheren Feuilletonartikeln finden sich manche Seiten von einer künstlerischen Kraft und Strenge, die die Aufgaben eines Feuilletons weit überragen.
Die Geistesrichtung Fjodor Michailowitschs war eine besondere Art Slawophilismus. Das geht bereits deutlich aus dem Prospekt hervor, der im September 1860 das Erscheinen der „Zeit“ für das folgende Jahr ankündigte und den zweifellos Fjodor Michailowitsch ganz allein ausgearbeitet hat. So enthält dieser Prospekt bereits einzelne Gedanken und Bestrebungen, die für seine ganze fernere Tätigkeit charakteristisch sind. Es ist, wie gesagt, eine Art Slawophilismus, denn Fjodor Michailowitsch fußt geradezu auf der Erkenntnis, daß es zwischen dem Volk und der Intelligenz einen durch die Reform Peters hervorgerufenen Zwiespalt gibt. Und aus diesem Grunde behauptet er – zum erstenmal 1860 in der Rede zur Puschkinfeier –, daß uns Russen eine eigene, selbständige Entwicklung bevorstehe, weshalb er eine Rückkehr zum Nationalen, zum Volklichen verlangt. Doch wem die Ansichten unserer literarischen Parteien bekannt sind, für den dürfte es unschwer zu erkennen sein, daß dies noch nicht der echte Slawophilismus ist.
Erstens ist der Ausgangspunkt offenbar ein anderer. Der Gedanke Dostojewskis besteht darin, daß man die gebildeten Kreise mit dem Volk derart aussöhnen und vereinigen müsse, daß dabei weder die ersteren sich von ihrer Bildung und der Wissenschaft, noch die letzteren sich von ihrem Grundwesen loszusagen brauchen. Es wäre also eine gewisse Synthese erforderlich, die sowohl die einen wie die anderen Prinzipien in sich aufnimmt. An der Möglichkeit dieser Synthese hat Dostojewski nie gezweifelt. Ja er ging sogar noch weiter, denn er glaubte, daß dem russischen Volk geistige Kräfte gegeben seien, mit denen es eine universale Synthese, d. h. die Auflösung und Versöhnung aller Widersprüche, die sich in der historischen Menschheit gezeigt, zustande bringen könne. Der Gedanke, daß das russische Volk diese Eigenschaft habe und zur Verwirklichung dieser Aufgabe ausersehen sei, bildet den Inhalt der Rede Fjodor Michailowitschs zur Puschkinfeier, somit hat er diesen Glauben bis zuletzt gehabt.
Diese Auffassung ist für ihn äußerst charakteristisch. Sie ist vor allem ein Beweis der Breite der Basis seiner Sympathien. Er hätte zwar seine verschiedenen, oft entgegengesetzten Sympathien logisch nicht in Einklang zu bringen vermocht, wie er auch die Widersprüche, zu denen sie in weiteren Folgerungen führen, nicht entdeckte und wie er auch die Formel nicht gefunden hat, die diese Widersprüche beseitigen könnte; aber er versöhnte sie psychologisch und ästhetisch in seinem Inneren. Diese Veranlagung spielte in seinem ganzen Schaffen eine große Rolle und wurde für ihn sehr fruchtbar. Der auffallendste Zug war dabei wohl das vollständige Fehlen von Haß und Verachtung in seinem Verhalten zu unserem großen Streit zwischen der westlichen und der russischen Idee. Dieser Zug war die Ursache der geradezu elektrischen Wirkung seiner Rede zur Puschkinfeier. Und derselbe Zug charakterisiert auch seine Romane und sein „Tagebuch“.
Der zweite charakteristische Zug in diesem Prospekt wie in der Puschkinrede, ist die Unbestimmtheit der Prinzipien, auf die er sich stützt. Das war aber bei dem Ausgangspunkt und der gedanklichen Richtung Dostojewskis auch nicht anders zu erwarten. Er sah seinen Gedanken vorläufig nur in den Umrissen. Während die Slawophilen von vornherein gewisse sehr bestimmte religiöse, philosophische und politische Auffassungen vertraten, suchte Dostojewski erst die Prinzipien, die zu der erwünschten Versöhnung führen sollten. Nichtsdestoweniger sprach er aber von diesen noch gesuchten Prinzipien mit großer Bestimmtheit und Beharrlichkeit. Das ist gleichfalls eine seiner charakteristischen Eigenschaften. Die abstraktesten Gedanken, ganz im allgemeinen ausgesprochen, wirkten überaus stark auf ihn und er ließ sich nicht selten von ihnen einfach hinreißen. Überhaupt war er ein in hohem Maße begeisterungsfähiger und empfindsamer Mensch. Manch ein einfacher Gedanke, ja mitunter sogar irgendein schon allen bekannter, ganz gewöhnlicher Gedanke konnte ihn plötzlich ungeheuer begeistern, wenn er ihm einmal in seiner ganzen Bedeutung aufging. Der Grund hierfür war wohl der, daß er, man kann sagen, ungemein lebhaft die Gedanken fühlte. Darum sprach er seinen Gedanken in verschiedenen Formen aus, gab ihm bisweilen einen sehr scharfen plastischen Ausdruck, obschon er ihn nicht logisch erklärte, nicht seinen Inhalt auseinandersetzte. Denn in erster Linie war er doch Künstler, dachte in Bildern und ließ sich von Gefühlen leiten.
Der dritte bemerkenswerte Zug ist natürlich seine lebhafte Zuversicht, mit der er auf die Schnelligkeit und Möglichkeit der Verwirklichung jener Aufgaben vertraute, der Glaube, daß jene Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen seien. Das ist gleichfalls auf die Lebhaftigkeit des Gefühls, das ihn erfüllte, zurückzuführen. Während die Slawophilen, die die Aufgabe in ihrer ganzen Tiefe erkannt hatten, die ganze Schwierigkeit ihrer Ausführung begriffen und, je lauter der Lärm der literarischen und gesellschaftlichen Bewegung war, um so klarer sahen, daß die Verwirklichung ihrer geliebten Wünsche durch ebendiese Bewegung hinausgeschoben wurde – erhob Dostojewski, indem er sich von der herrschenden Erregung hinreißen ließ, und da er in ihr nicht die Elemente sah, die seinem Ideal vollkommen feindlich waren, kühn die Fahne seiner Idee in dem festen Glauben, die erregte Masse mitreißen zu können. Diese Fähigkeit, glühend zu glauben und zu hoffen, verblieb ihm bis zu seinem Tode. Er ließ sich stets von der Gewalt seiner Gedanken hinreißen und war nahezu fest überzeugt, daß das, was sein geistiger Blick schon so klar sah, unfehlbar und bald sich auch verwirklichen werde.
Übrigens konnte damals, zu Anfang der sechziger Jahre, kaum jemand der allgemeinen Begeisterung widerstehen. Es war eine Zeit so voll von Hoffnung und Unternehmungslust. Alle Geister waren angeregt, alles war im Brodeln, so daß man in der Tat glauben konnte, das Unglaublichste werde geschehen. Das Gefühl für die Wirklichkeit war uns abhanden gekommen und man dachte: was wir wollen, das können wir auch vollbringen ...
Um diese Stimmung, in der wir uns alle befanden und unter deren Einfluß die Ansichten der Brüder Dostojewski sich entwickelten, zu verstehen, muß man sich den Geist jener Zeit vergegenwärtigen. Es war im Jahre der Bauernbefreiung, 1861, in der lichtesten Zeit der Regierung Alexanders II. Es hatte den Anschein, als müsse in ganz Rußland ein neues Leben beginnen, etwas ganz Außergewöhnliches müsse kommen! Wenigstens fiel uns der Glaube an die baldige Verwirklichung selbst der kühnsten Hoffnungen leicht und erschien uns nur natürlich. Alle wußten, daß die vorbereitenden Arbeiten zur Aufhebung der Leibeigenschaft sich bereits ihrem Ende näherten, und schon die dritte Nummer der „Zeit“ enthielt den Wortlaut des Manifestes vom 19. Februar, das am 5. März offiziell bekanntgegeben wurde.
Leider folgten dieser frohen Zeit bald schwere Stunden, gegen Ende desselben Jahres die Studentenunruhen, im folgenden Jahre die unzähligen Brandstiftungen in Petersburg, zu Anfang 1863 der polnische Aufstand. Im Gegensatz zu dieser schweren Zeit hatte sich bis dahin, vom Jahre 1855 an, die frohe Erwartung in der Gesellschaft und in der Literatur unausgesetzt gesteigert. Nach dem Regierungswechsel waren fortwährend verschiedene Erleichterungen, Befreiungen und Reformen eingeführt worden, die Zensur wurde mit jedem Jahre nachsichtiger, die Zahl der Zeitschriften und neuen Bücher wuchs schnell. In dieser Zeit wurden nun die Meinungen und Stimmungen, die in der Periode des Schweigens bis 1855 entstanden und erstarkt waren, ausgesprochen. Jetzt, in der Freiheit und inmitten der allgemeinen Belebung erging man sich kühn in der Anwendung und Entwicklung seiner Prinzipien, doch die alte Gewöhnung an die Zensur und der immerhin nicht ganz aufgehobene Einfluß derselben, verliehen allem ein sowohl sehr gediegenes wie auch recht verführerisches Aussehen. So bildeten sich denn in diesen sieben Jahren die Richtungen aus, die heute noch herrschen. Die letzte Erscheinung dieser Art war die Richtung der „Zeit“, die Fjodor Michailowitsch angab.
Es war das seiner Ansicht nach eine absolut neue, besondere Richtung, die dem neuen Leben, das nun augenscheinlich in ganz Rußland einsetzte, entsprechen und die Richtungen der alten Parteien, der Westler und der Slawophilen, ersetzen oder verdrängen sollte. Die Unbestimmtheit des Gedankens an sich machte ihm weiter keine Sorgen, da er an der Entwicklung desselben nicht den geringsten Zweifel hegte. Hinzu kam, daß die damalige Literatur einen Charakter hatte, der ihm zu glauben erlaubte, daß die zwei alten literarischen Parteien, die Westler und die Slawophilen, ausgestorben oder im Aussterben begriffen seien und daß etwas Neues zu erstehen beginne. Dieser Charakter beruhte darauf, daß die Parteien damals nicht schroff hervortraten und die gesamte Literatur wie ein einiges Ganzes zusammenhing. Ich erinnere mich noch gut jenes fast freundschaftlichen Gefühls, das damals unter den Schriftstellern herrschte. Man hatte erst kurz zuvor die Möglichkeit erhalten, seine Gedanken auszusprechen, mußte immer noch den allgemeinen Aufseher, die einst so strenge Zensur, im Auge behalten: so sahen denn die Literaten es für ihre Pflicht an, sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen. Überhaupt war man der Ansicht, daß die Literatur eine gewisse gemeinsame Sache sei, vor der die einzelnen Meinungsverschiedenheiten zurücktreten müßten. In der Tat, alle standen in gleichem Maße für die Aufklärung ein, für die Freiheit des Wortes, die Aufhebung mannigfacher Bedrückungen und Belästigungen usw., mit einem Wort, für die ersten liberalen Forderungen, die man in einer Weise abstrakt auffaßte, daß sie sich mit den verschiedensten, ja sogar mit entgegengesetzten Anschauungen vereinen ließen. Natürlich kannten die Anhänger der verschiedenen Richtungen die Grenzen zwischen sich und den anderen. Aber für die gewöhnlichen Leser und selbst für die Mehrzahl der Schreibenden war die Literatur ein ungeteiltes Ganzes. Im Grunde aber war sie ein Chaos, ein formloses und doch vielgestaltiges, und deshalb konnte leicht der Wunsch entstehen, diesem Chaos eine Form zu geben, oder wenigstens einen gewissen bestimmteren Weg einzuschlagen. Der Träger dieses Wunsches war Fjodor Michailowitsch, und von ihm persönlich kann man bezüglich seiner ganzen journalistischen Tätigkeit sagen, daß er erreicht hat, was er wollte. Inmitten der Petersburger Literatur ertönte seine Stimme oft laut und machtvoll, namentlich in den letzten Jahren seines Lebens, wo sie sogar alle anderen Stimmen übertönte, wenn sie protestierte und den neuen Weg wies.
Außer in Fjodor Michailowitsch fand dieser Gedanke in Apollon Grigorjeff einen überzeugten Anhänger, der nach dem Erscheinen der ersten Nummer der „Zeit“ ihr eifriger Mitarbeiter wurde. Ich erinnere mich noch, wie es zum Teil durch meine Vermittlung dazu kam. Man wünschte damals von mir literarische Kritiken; ich weigerte mich, solche zu schreiben und empfahl dringend Grigorjeff, in dem ich unseren besten Kritiker sah und auch jetzt noch sehe. Zu meiner Freude erklärte Fjodor Michailowitsch, daß Grigorjeff ihm sehr gefalle und seine Mitarbeiterschaft ihm sehr erwünscht wäre. Seit der Zeit sahen wir alle in Grigorjeff unseren Führer auf dem Gebiet literarischer Kritik. Leider verloren wir ihn bald. Er starb 1864.
Der erste Artikel Grigorjeffs, den er für die zweite Nummer der „Zeit“ schrieb, begann mit der kategorischen Erklärung, daß es die beiden Richtungen, die sich vor zehn Jahren feindlich gegenüberstanden, die westliche und die östliche, bereits nicht mehr gäbe. Und diese Tatsache zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, sei jetzt die höchste Zeit, „denn für die Erkenntnis der einzelnen, für die Erkenntnis eines jeden von uns schreibenden und denkenden Menschen ist sie schon längst erwiesen.“
Eine so feste Überzeugung, daß die zwei Hauptrichtungen unserer Literatur endgültig abgetan seien, wurde dem Verfasser natürlich nur durch den Wunsch, daß es sich so verhalten möge, eingegeben. Zum besseren Verständnis der Situation sei hier ein wenig an Grigorjeffs literarische Herkunft erinnert. Er gehörte zur sogenannten jungen Redaktion des „Moskwitjänin“, den Pogodin[4] in Moskau herausgab und zu dem ein ganzer Kreis bekannter Namen gehörte. Dieser Kreis, wie auch Pogodin selbst, hielt sich im Grunde zu den Slawophilen, war aber in seinen Sympathien doch sehr frei und entfernte sich denn auch allmählich vom reinen Slawophilismus. Pogodin, der seinerzeit auf Puschkin und die ersten Slawophilen Einfluß gehabt, wurde auch von der „jungen Redaktion“ wegen seines glühenden Patriotismus und seiner lebhaften, echt russischen Sympathien überaus geachtet, obschon er seinen früheren Überzeugungen treublieb und sich die alte Redaktion nannte. Dennoch räumte er in seiner Zeitschrift „Moskwitjänin“ dem jungen Kreise volle Freiheit ein. Das Charakteristische dieses Kreises war eine begeisterte Verehrung der poetischen Literatur; in ihr sahen sie den besten Ausdruck des Volksgeistes und des Zeitgeistes zugleich, und in ihr suchten sie Offenbarungen und Gesetze. In diesem Kreise wurde Ostrowski verehrt, wurde von ihm gesagt, er bringe ein „neues Wort“; hier wurden Gogol und Puschkin verehrt und hier kämpfte man gegen die „realistische Schule“ und die Petersburger.
Zu dieser Partei der „jungen Redaktion“ gehörte nun Apollon Grigorjeff, und mit seinem Wunsch, sich von den Slawophilen abzusondern, unterstützte er in bedeutendem Maße Fjodor Michailowitschs Gedanken, eine neue Richtung zu gründen. Die Autorität Apollon Grigorjeffs war für uns alle in dieser Frage von entscheidender Bedeutung. So entstand dann jene Partei, die in der Petersburger Literatur lange Zeit unter einem besonderen Namen bekannt war: man nannte sie die Partei der „Bodenständigen“. Ausdrücke, wie z. B. „wir sind von unserem Boden getrennt“ oder „wir müssen unseren Boden suchen“ waren geradezu Lieblingsausdrücke Fjodor Michailowitschs, und finden sich schon in seinem Einführungsartikel. Dieser Ausdruck, der übrigens sehr plastisch und lebendig ist, hatte auch noch den Vorteil, daß er zugleich sehr allgemein war und kein bestimmtes Prinzip aussprach. Unter ihm konnte man natürlich auch Slawophilismus verstehen, aber die „Zeit“ ließ doch beständig durchblicken, namentlich anfangs, daß sie damit eine andere, wenn auch verwandte Richtung meinte.
Das Verhältnis zu den Slawophilen war ungefähr folgendes. Apollon Grigorjeff sprach von ihnen sowohl mündlich wie schriftlich stets mit der größten Hochachtung. Von ihm lernten auch wir diese Hochachtung, die aus der Petersburger Literatur unmöglich zu lernen gewesen wäre, da diese die Slawophilen nie ohne Spott und Verachtung erwähnte. Auch heute noch verhält es sich nicht viel anders. Die Brüder Dostojewski aber waren unmittelbar aus der Petersburger Literatur hervorgegangen – das muß man bei einer Beurteilung ihrer literarischen Art und ihrer Ansichten immer im Auge behalten. Michail Michailowitsch stand natürlich mehr unter ihrem Einfluß und verhielt sich den Slawophilen gegenüber kühl oder sogar voreingenommen. Fjodor Michailowitsch dagegen, der zwar damals die Slawophilen fast noch gar nicht kannte, war doch nicht geneigt, Grigorjeff zu widersprechen, und überdies fühlte er bereits, wer von ihnen recht hatte. Doch wie dem auch sein mochte, jedenfalls schloß sich die Richtung der „Zeit“, eben durch Apollon Grigorjeff, an den einen Zweig des Pogodinschen Slawophilismus an, und Grigorjeff gebührt das Verdienst, daß er die große, wesentliche Bedeutung des reinen Slawophilismus in unserem geistigen Leben erkannte.
Dennoch spielte die größte und fruchtbarste Rolle in dieser ganzen Angelegenheit Fjodor Michailowitsch. Er war es, der bewußt und ohne zu zögern anfangs A. Grigorjeff und später den Slawophilen entgegenkam. Bei der Schnelligkeit und Geschmeidigkeit seines Auffassungsvermögens begriff er leicht diese Anschauungen in ihren Grundlagen; doch das Entscheidende wird hierbei wohl gewesen sein, daß er schon infolge der ganzen Art seiner Ansichten, seiner Annäherung an das Volk und der dadurch hervorgerufenen inneren Wandlung seiner Gedanken, ein unbewußter Slawophile war. Der Slawophilismus ist doch nicht eine vom Leben losgelöste Theorie; er ist eine vollkommen natürliche Erscheinung, sowohl von seiner positiven Seite – als Konservatismus – wie von seiner negativen Seite – als Reaktion, d. h. als Wunsch, das geistige wie moralische Joch des Westens abzuwerfen. So ist es denn erklärlich, daß sich in Fjodor Michailowitsch eine ganze Reihe von Ansichten und viele Sympathien entwickelt hatten, die vollkommen slawophil waren, und daß er mit ihnen hervortrat, ohne zunächst seine Übereinstimmung mit der schon längst existierenden Partei zu bemerken, um dann später unmittelbar und offen sich zu ihr zu bekennen. Gerade solche Parteigänger sind aber die wertvollsten. Sie sind nicht Schüler, die sklavisch die Worte der Lehrer wiederholen, sondern selbständige Träger der Idee, die sie auch weiter zu entwickeln fähig sind. Mit größter Feinfühligkeit erriet Fjodor Michailowitsch die richtige Anwendung seiner Prinzipien und entdeckte ihre verschiedenen Seiten.
Zur Vervollständigung des Bildes füge ich noch ein paar Worte über mich hinzu. Der Gedanke, eine neue Richtung zu gründen, interessierte mich anfänglich nicht wenig, was ich dem Einfluß Grigorjeffs zuschreibe. Bald jedoch gewann ich die Überzeugung – vielleicht infolge meiner Abneigung gegen alles Unbestimmte –, daß man sich einfach für einen Slawophilen ausgeben mußte, auch wenn man nur die Grundprinzipien dieser Lehre teilte. Deshalb stimmte ich eine Zeitlang mit der Richtung der „Zeit“ nicht überein, doch kann ich nicht sagen, daß ich diese Differenz jemals besonders betont hätte.
Anders verhielt es sich mit den jüngeren Mitarbeitern der Zeitschrift, die sich alle eng um A. Grigorjeff scharten, der sie sowohl durch seinen Verstand, wie durch seine kindliche Schlichtheit und Gutmütigkeit anzog. Diese jungen Menschen trugen sich lange mit dem Gedanken, eine neue Richtung zu gründen. Es handelte sich dabei natürlich vor allem darum, der slawophilen Anschauung größere Freiheit zu geben, in ihren Horizont auch die Erscheinungen einzubeziehen, die sie konsequent mied und verneinte, wie z. B. die zeitgenössische Literatur oder die verschiedenen westlichen Einflüsse. Hierbei gab es endlose Dispute und es wurde täglich versucht, die eigene Weltanschauung zu verbessern, oder womöglich von Grund aus umzubauen.
So hatte denn die Richtung der „Bodenständigen“ ihre eifrigsten Anhänger und auch eine gewisse Existenzberechtigung. Wenigstens war sie eine russische, patriotische Richtung, die vorläufig ihre Formulierung suchte und, wie das die Logik verlangte, sich zuletzt doch dem Slawophilismus anschloß. In der ersten Zeit aber hatte die Redaktion der Zeitschrift doppelte Ursache, sich ihm nicht anzuschließen: erstens vertraute sie auf die eigenen Kräfte und wollte selbständig sein und zweitens wollte sie ihre Ideen möglichst schnell verbreiten, das Publikum interessieren, fesseln und vor allem Zusammenstöße mit den Vorurteilen der Leser vermeiden. Deshalb wäre eine offizielle Berufung auf die Slawophilen unklug gewesen, selbst wenn die Redaktion sich zu einer solchen bereit gefunden hätte.
„Die Zeit“ hatte einen entschiedenen und schnellen Erfolg. Die Abonnentenzahl, die für uns alle von so großer Wichtigkeit war, stieg in den zweieinhalb Jahren von 2300 auf 4302. Die Ursache dieses schnellen und großen Erfolges lag erstens im Namen Fjodor Michailowitschs, der bereits sehr bekannt war – von seinen Sträflingsjahren in Sibirien wußte ein jeder; – zweitens war der Roman „Erniedrigte und Beleidigte“, der in der ersten Nummer begann, trotz all seiner Mängel ein Werk, das die durch den Namen Dostojewski gewonnenen Abonnenten in würdiger Weise belohnte; drittens spielte hierbei wohl auch noch die allgemeine Stimmung des Publikums eine Rolle, denn weder vorher noch nachher hat es eine Zeit gegeben, wo man mit solchem Interesse nach literarischen Neuerscheinungen griff, wie damals. Mit dem schnellen Erfolg wuchs unser Selbstvertrauen, was unter günstigen Verhältnissen der Sache sehr dienlich war, dagegen unter ungünstigen ihr sehr schadete.
Damals, 1861, waren wir nach diesem schnellen Erfolge sehr optimistisch und machten uns eifrig an die Arbeit. Ich gab meine Lehrtätigkeit auf und Michail Michailowitsch Dostojewski wollte seine Tabakfabrik schließen, von der er in der Zeit nach 1849 gelebt hatte, als der Literatur jede Freiheit genommen war.
Die Mitarbeiter der „Zeit“ teilten sich in zwei Gruppen: die eine hatte zum Mittelpunkt Apollon Grigorjeff, um den sich, wie gesagt, die Jugend scharte, die andere bildeten Fjodor Michailowitsch und ich. Wir hatten eine ganz besondere Freundschaft geschlossen und kamen an jedem Tage mindestens einmal zusammen. Im Sommer des Jahres 1861 zog ich aus dem Universitätsviertel auf dem Wassili Ostroff in die Nähe der Kleinen Meschtschanskaja, wo sich die Redaktion und die Wohnung Michail Michailowitschs befanden. Fjodor Michailowitsch wohnte an der Mittleren Meschtschanskaja und Apollon Grigorjeff, sowie die ganze junge Kompagnie wohnte am Wosnessenski Prospekt in möblierten Zimmern. Ich erwähne das nur, um zu sagen, wie nah beieinander und in welcher Gegend wir lebten. Ich erinnere mich noch gut des damaligen Charakters dieser ziemlich schmutzigen Straßen mit den zum Teil niedrigen Häusern, die alle dicht bevölkert waren von Petersburger kleinen Leuten dritter Kategorie. Fjodor Michailowitsch hat in mehreren Erzählungen und Romanen, vor allem in „Rodion Raskolnikoff“, die Physiognomie dieser Straßen und ihrer Bewohner bewunderungswürdig erfaßt und wiedergegeben.
Inmitten dieser Umgebung, die die Seele bedrückt und Ekel einflößt, verlebten wir sehr glückliche Jahre. Es gibt nichts Interessanteres und Anregenderes als journalistische Arbeit – wenn die Sache gut geht. Hierbei vereint sich die ganze Anregung eines Lebens in der Öffentlichkeit mit der ganzen Schönheit einsamen Nachdenkens und stiller Arbeit. Seiten, die man in der Stille sorgfältig durchdacht hat, treten plötzlich vor das Publikum, werden von zahllosen Menschen gelesen und werden zum Gegenstand der Dispute und Kritiken, von denen viele sogleich, wie Antworten auf Fragen, zu einem zurückkehren. Gerade damals war es üblich, daß jede Zeitschrift von allen anderen Zeitschriften sprach, so daß der Eindruck eines Artikels sich sehr bald feststellen ließ. Dostojewski, Grigorjeff und ich konnten überzeugt sein, daß wir in jeder neuen Nummer der literarischen Zeitschriften unsere Namen finden würden. Der Wettkampf der verschiedenen Redaktionen, die Spannung, mit der man die verschiedenen Richtungen, ihre Ideen, die Polemik, verfolgte – all das machte die journalistische Tätigkeit zu einem so fesselnden Spiel, daß, wer einmal an ihm teilgenommen hat, dem Wunsch nicht widerstehen kann, wieder an ihm teilzunehmen.
Gewöhnlich trafen wir uns gegen drei Uhr nachmittags in der Redaktion, Fjodor Michailowitsch nach seinem Morgentee, ich nach meiner Morgenarbeit. Hier sahen wir die Zeitungen und Zeitschriften durch, nahmen Kenntnis von allen Neuigkeiten, und machten dann meist zusammen einen Spaziergang bis zum Mittagessen um fünf, worauf er nicht selten – etwa gegen sieben Uhr – wieder zu mir zum Tee kam und die Zeit bis zum Abendessen bei mir verbrachte. Überhaupt war er häufiger bei mir als ich bei ihm, denn ich war Junggeselle, folglich konnte man mich zu jeder Zeit besuchen, ohne befürchten zu müssen, daß man andere störe. Hatte ich einen Artikel beendet oder auch nur einen Teil eines Artikels geschrieben, so bestand er gewöhnlich darauf, daß ich das Geschriebene vorlas. Es ist mir, als hörte ich noch seine Stimme, die dann aus dem Stimmengewirr der anderen ungeduldig drängend und bittend erklang:
„Lesen Sie, Nikolai Nikolajewitsch, lesen Sie!“ Damals begriff ich übrigens noch nicht ganz, wieviel Schmeichelhaftes für mich in dieser Ungeduld lag. Er widersprach mir nie. Ich erinnere mich eigentlich nur eines einzigen Streites zwischen uns, zu dem es infolge eines Artikels von mir kam. Aber er sagte mir ebensowenig ein Wort des Lobes und äußerte nie eine besondere Anerkennung.
Unsere damalige Freundschaft hatte zwar einen vornehmlich geistigen Charakter, aber wir standen uns auch als Menschen sehr nahe. Das Einander-Nahestehen hängt bei den Menschen von ihrer Natur ab und überschreitet oft auch unter den günstigsten Verhältnissen nicht eine gewisse Grenze. Ein jeder von uns zieht gleichsam einen Strich um sich herum, den er niemanden überschreiten läßt, oder richtiger – nicht überschreiten lassen kann. So fand auch unsere Annäherung ein Hindernis in unseren persönlichen Veranlagungen, doch will ich durchaus nicht sagen, daß der kleinere Teil dieses Widerstandes auf meiner Seite war. Fjodor Michailowitsch hatte bisweilen Augenblicke argwöhnischer Vermutungen. Dann sagte er mißtrauisch: „Strachoff hat keinen, mit dem er sprechen kann, deshalb hält er sich an mich.“ Aber dieser flüchtige Zweifel zeigt ja nur, wie fest wir an die Gegenseitigkeit unserer Zuneigung glaubten. In den ersten Jahren war es ein Gefühl, das zu einem unbeschränkten Zutrauen wurde. Wenn Fjodor Michailowitsch einen epileptischen Anfall gehabt hatte, so befand er sich nach der Bewußtlosigkeit anfangs in einer unerträglich schweren Stimmung. Alles reizte oder schreckte ihn und selbst durch die Anwesenheit der Nächsten fühlte er sich bedrückt. Dann schickte sein Bruder oder seine Frau nach mir; in meiner Gegenwart fühlte er sich leichter, und es wurde ihm allmählich besser. Indem ich mich dieser Vergangenheit erinnere, leben in meinem Gedächtnis einige meiner besten Gefühle wieder auf und ich denke, daß ich damals wohl ein besserer Mensch gewesen sein muß, als ich es jetzt bin.
Unsere Gespräche waren endlos, und es waren die schönsten Gespräche, die mir in meinem Leben beschieden gewesen sind. Er sprach in jener schlichten, lebendigen, anspruchslosen Art, die den Reiz und die Schönheit der russischen Gespräche ausmacht. Dazwischen scherzte er oft, namentlich in jener Zeit, aber sein Witz gefiel mir nicht sonderlich; es war häufig nur ein äußerlicher Humor, ähnlich dem französischen, also ein Spiel mehr mit Worten und Bildern, als mit Gedanken. Beispiele dieser Witzchen finden sich zumeist in seinen kritischen und polemischen Artikeln. Doch was mich in der Hauptsache fesselte und sogar frappierte, das war sein ungewöhnlicher Verstand, die Schnelligkeit, mit der er jeden Gedanken, schon nach dem ersten Wort, der ersten Andeutung, erfaßte. In dieser Leichtigkeit des Verstehens liegt der größte Reiz eines Gesprächs, wenn man sich unbehindert dem eigenen Gedankengang hingeben kann, nicht zu wiederholen und zu erklären braucht, wenn man auf eine Frage sofort die richtige Antwort erhält und wenn die Entgegnung gerade auf den zentralen Gedanken erfolgt, die Zustimmung gerade zu dem Gedanken gegeben wird, zu welchem man sie hören möchte, und es keine Mißverständnisse und Unklarheiten gibt. So sind mir unsere damaligen Gespräche in der Erinnerung geblieben, die Gespräche, die für mich eine große Freude und mein Stolz waren. Der Gesprächsstoff stand natürlich zumeist mit der Zeitschrift in Zusammenhang, doch außerdem sprachen wir noch über alle nur möglichen Themen, sehr oft über die abstraktesten Fragen. Fjodor Michailowitsch liebte diese Fragen nach dem Wesen der Dinge und den Grenzen des Wissens, und ich weiß noch, wie es ihn amüsierte, wenn ich seine Anschauungen nach den Lehren der verschiedenen Philosophen, die die Weltgeschichte kennt, klassifizierte. Es zeigte sich, daß es schwer hielt, sich etwas Neues auszudenken und er tröstete sich scherzend damit, daß er in seinen Anschauungen wenigstens mit dem einen oder anderen der großen Denker übereinstimmte.
Ich will mich hier nicht über seine Ansichten, nicht über seine eigene Stellung zu seiner Arbeit und die Dinge, mit denen er sich abgab, ausführlich verbreiten. Den besten Teil seiner Seele hat er uns in seinen Werken offenbart. Ich will nur sagen – was vielleicht manche unerfahrene Leser nicht vermuten: daß er einer der aufrichtigsten Schriftsteller war, daß alles, was er geschrieben, von ihm selbst erlebt und empfunden worden ist, und zwar mit großer Leidenschaft und Hingabe. Ja, Dostojewski ist der subjektivste aller Schriftsteller, er hat in den Personen seiner Romane fast ausnahmslos sich selbst geschildert. Nur selten hat er volle Objektivität erreicht. Für mich, der ich ihm so lange nahe stand, war die Subjektivität seiner Darstellungen nur zu erkennbar, und deshalb ging mir immer die Hälfte des Eindrucks verloren, des Eindrucks der Werke, die auf andere Leser verblüffend wirkten, da sie in seinen Gestalten vollkommen objektive Schilderungen sahen.
Sehr oft wurde mir für ihn bange, wenn ich las, wie er gewisse dunkle, krankhafte Stimmungen wiedergab. So schilderte er z. B. im „Idiot“ ausführlich die Stimmung vor einem epileptischen Anfall, obgleich die Ärzte Epileptikern stets vorschreiben, sich nicht diesen Erinnerungen hinzugeben, da sie unter Umständen ebenso einen Anfall herbeiführen können, wie der Anblick eines epileptischen Anfalls bei einem anderen. Doch Dostojewski schreckte vor nichts zurück, und was er auch schilderte, er blieb fest überzeugt, daß er seinen Gegenstand in voller Objektivität gebe. Häufig habe ich von ihm gehört, daß er sich für einen vollständigen Realisten halte, daß jene Verbrechen, Selbstmorde und alle anderen Ausschreitungen und Entartungen, die in der Regel das Thema seiner Romane bilden, in der Wirklichkeit häufige und gewöhnliche Erscheinungen seien, denen wir bloß keine Beachtung schenken. Auf Grund dieser Überzeugung schilderte er dann dreist das Dunkelste und Schmutzigste; niemand ist in der Schilderung der verschiedenen Verkommenheiten der Menschenseele so weit gegangen wie er. Und er erreichte, was er wollte: es gelang ihm, seinen Geschöpfen so viel Realität und Objektivität zu verleihen, daß die Leser aus anfänglicher Betroffenheit in Entzücken gerieten. In seinen Bildern war so viel Wahrheit, psychologische Richtigkeit und Tiefe, daß sie selbst solchen Leuten, denen die Sujets vollkommen fremd waren, verständlich wurden. Oft ging es mir durch den Sinn, daß er, wenn er erkennen würde, wie stark subjektiv seine Bilder gefärbt sind, sich im Schreiben beengt fühlen müßte, und wenn er die Art seines Schaffens bemerkte, nicht mehr schaffen könnte. So war für ihn eine gewisse Dosis Selbstbetrug erforderlich, wie fast für jeden Schriftsteller.
Doch jeder Mensch hat bekanntlich nicht nur die Mängel seiner Vorzüge, sondern mitunter auch den Vorzug seiner Mängel. Dostojewski schildert seine elenden und bedauernswerten, gemeinen und furchtbaren Menschen, alle die seelischen Krankheiten und Pestbeulen, weil er über sie das höhere Urteil zu fällen verstand oder zu verstehen glaubte. Er sah den göttlichen Funken selbst im verkommensten Menschen; er verfolgte und beobachtete das geringste Aufblitzen dieses Funkens und erspähte Züge seelischer Schönheit in Menschen, zu denen wir mit Verachtung, Spott oder Abscheu uns zu verhalten gewöhnt sind. Wegen dieser Schönheit, die Dostojewski unter der scheußlichen und abstoßenden Äußerlichkeit durchschimmernd entdeckte, verzieh er den Menschen und liebte er sie. Eine feine und hohe Menschenliebe könnte man seine Muse nennen; und sie war es auch, die für ihn das Maß bildete, nach dem er Gut und Böse abwog, das Maß, mit dem er in die tiefsten und schrecklichsten Abgründe der Menschenseele hinabstieg. Sein Glaube an sich und den Menschen war unerschütterlich, und deshalb war er auch so aufrichtig und nahm er so ohne weiteres sogar seine Subjektivität für vollkommen objektiven Realismus. – Unter dem Wort „Muse“ verstehe ich jenen idealistischen Charakter, jene Art des Verstandes und Herzens, die der Mensch annimmt, wenn er zu schreiben und Gestalten zu schaffen anfängt. Die Muse und der Mensch selbst sind zwei verschiedene Wesen, obschon sie aus einer Wurzel hervorgehen und enger als die siamesischen Zwillinge zusammengewachsen sind. Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Mensch Dostojewski und seine „Muse“ ungemein eng miteinander verbunden waren.
Von seinen persönlichen, rein menschlichen Zügen wäre noch zu sagen, daß an ihm nicht die geringste Spur einer Verbitterung oder Kränkung durch die von ihm ausgestandenen Leiden zu bemerken war und nie auch nur der Schatten des Wunsches, die Rolle eines Märtyrers zu spielen. Er war absolut frei von jedem gehässigen Gefühl der Regierung gegenüber und tat so, als sei in seiner Vergangenheit nichts Besonderes vorgefallen, zeigte sich weder enttäuscht noch irgendwie seelisch getroffen, sondern war heiter und guter Dinge, wenn die Gesundheit es ihm erlaubte. Ich erinnere mich, wie ihm einmal eine Dame, die ihn mit großer Aufmerksamkeit betrachtet hatte, plötzlich sagte: „Wenn ich Sie betrachte, glaube ich, in Ihrem Gesicht die Leiden zu sehen, die Sie zu ertragen hatten ...“ Diese Bemerkung war ihm sichtlich unangenehm. „Was für Leiden!“ ... unterbrach er sie fast schroff, um dann sofort über ganz nebensächliche Dinge zu scherzen. Desgleichen erinnere ich mich noch eines anderen ähnlichen Falles. Er sollte sich an einem literarischen Vortragsabend, wie sie damals sehr in Mode waren, beteiligen und irgend etwas aus seinen Werken vorlesen. Die Wahl fiel ihm schwer. „Es muß etwas Neues, Interessantes sein,“ sagte er zu mir. – „Aus dem ‚Totenhause‘ vielleicht?“ schlug ich vor. – „Daraus habe ich schon oft vorgelesen, und ich möchte eigentlich nicht ... Es scheint mir dann immer, daß ich vor dem Publikum klage, mich immer beklage ... Das ist nicht gut.“
Überhaupt kehrte er nicht gern zu der Vergangenheit zurück, als habe er sie ganz und gar abgetan, oder wenn er sich einmal Erinnerungen hingab, dann gedachte er irgendwelcher froher Erlebnisse, auf die er gleichsam stolz war. Deshalb hätte ein Uneingeweihter schwerlich vermuten können, wenn er ihn so sah und hörte, was in seinem früheren Leben vorgefallen war.
In seinem Verhältnis zur Regierung stand er fest auf dem Standpunkt, der für alle echten Russen so selbstverständlich ist. Jeder Gedanke an Auflehnung war ihm fern, obschon er sich bisweilen tief bekümmert oder mit ehrlichem Unwillen über manche Leute und Maßregeln äußerte. Er selbst ertrug die unbequemen herrschenden Zustände nicht nur stillschweigend, sondern sogar mit vollkommenster Ruhe, wie etwa eine allgemeine Lebensbedingung, die keineswegs ihn persönlich anging. So entsinne ich mich nicht, ihn jemals über die Zensoren aufgebracht gesehen zu haben, obgleich diese Herren – im allgemeinen sehr liebenswürdige Leute, die sich zumeist mit Respekt zur Literatur verhielten – nicht selten ein Überflüssiges taten, und, wenn sie nicht viel Verfängliches fanden, wenigstens kleine Korrekturen anbrachten, um doch nicht ganz umsonst gelesen zu haben. Übrigens gehörte Fjodor Michailowitsch zu den Schriftstellern, die, ohne an die Zensur zu denken, unwillkürlich in den Grenzen bleiben, einfach weil sie viel zu ernst sind, um sich Schroffheiten und persönliche Ausfälle zu erlauben.
Im Grunde waren wir sehr abstrakte Politiker, sprachen nur von allgemeinen Fragen und Auffassungen, in der Praxis aber blieben wir beim „reinen Liberalismus“, also bei dem Glauben, daß man in der inneren Organisation eines Staates ohne Zwangsmaßregeln am weitesten komme, daß die verschiedenen Interessen sich dann am deutlichsten äußern und am besten ausgleichen könnten. Mit einem Wort, es waren die Grundsätze, an die sich alle Anhänger der Gedanken-, Preß- und Handelsfreiheit usw. halten, Grundsätze, die natürlich längst nicht die ganze Frage erschöpfen, an die man sich aber in all den Fällen halten muß, wo zu anderen Grundsätzen keine Veranlassung vorliegt. In der Wirklichkeit freilich erwiesen sich gerade die liberalen Grundsätze als unfähig, unsere Gesellschaft zu regieren, eben als zu schwerverständlich und noch zu unerfüllbar, und überdies als durchaus ungeeignet, die Entwicklung anderer, ihnen entgegengesetzter Grundsätze zu paralysieren. So kam es unter den Anhängern des „reinen Liberalismus“ zu einer schnellen und entsetzlichen Ernüchterung, und das Ende der liberalen Epoche war, daß plötzlich Proklamationen auftauchten, die zum Aufstand, zur Revolution aufforderten. Den Proklamationen folgten die Brandstiftungen, diesen der polnische Aufstand und drei Jahre später das erste Attentat auf das Leben des Zaren.
Ich führe dies hier an, um den Liberalismus unserer Zeitschrift und folglich denjenigen, zu dem sich Fjodor Michailowitsch bekannte, zu kennzeichnen. Leider herrschen bei uns trotz aller historischen Erfahrungen und Debatten, sowohl schriftlicher wie mündlicher, noch die größten Mißverständnisse in den Begriffen: und die wahre Bedeutung des Liberalismus ist fast vergessen. Denn daß ein Liberaler dem Wesen der Sache nach in der Mehrzahl der Fälle ein Konservativer und nicht ein Progressist sein muß und schon in keinem Fall ein Revolutionär – das wissen oder begreifen jetzt wohl nur sehr wenige. Diesem wahren Liberalismus ist Fjodor Michailowitsch denn auch bis zu seinem Tode treu geblieben. Wir standen keiner von den Parteien nahe, die praktische Aufgaben und praktische Interessen hatten; wir sahen ein, daß wir in der Sphäre allgemeiner abstrakter Fragen bleiben mußten, und da wir glühende Patrioten und Russophile waren, so sahen wir auch unter diesen Umständen eine Menge Arbeit vor uns, sowohl auf dem Gebiet der literarischen Kritik wie auf dem der Auslegung der russischen Geschichte und des russischen Lebens; ferner galt es, über den Westen zu schreiben, über die europäischen geistigen und politischen Ereignisse, die bei uns von so großem Einfluß sind. In allen diesen Beziehungen ist nicht zu leugnen, daß die „Zeit“ eifrig arbeitete und in keiner Hinsicht von der Verfolgung ihrer allgemeinen Aufgabe abwich.
Ein nicht zu umgehender Teil dieser Aufgabe war die Polemik, da die übergroße Mehrzahl der Literaten zur Partei der Westler gehörte und der entscheidende Einfluß von Zeitschriften ausging, die direkt zum Nihilismus neigten. So wurde der Kampf mit dem Nihilismus gewissermaßen eine Spezialität der „Zeit“, wenigstens ließ sie ihn nie aus dem Auge und analysierte ihn von allen Seiten. In dem Zeitraum bis zum Erscheinen des Romans „Väter und Söhne“ von Turgenjeff (1862) hatte sie seine wesentlichen Züge bereits festgestellt, dieselben Züge, die Turgenjeff in lebendigen Bildern so treffend darstellte.
Den Kampf gegen die nihilistische Richtung eröffnete Fjodor Michailowitsch, indem er gegen die grobmaterialistische Auffassung der Kunst schrieb, nur begnügte er sich mit recht schwachem, nachsichtigem Widerspruch. Da hielt ich es nicht aus und verfocht bei der ersten Gelegenheit offen und kategorisch eine den nihilistischen Lehren entgegengesetzte Richtung. Ich kann wohl sagen, daß in mir beständig eine gewisse organische Abneigung vor dem Nihilismus vorhanden war und daß ich seit dem Jahre 1855, als er zuerst sich bemerkbar zu machen begann, mit wachsendem Unwillen sein Hervortreten in der Literatur wahrgenommen hatte. Schon in den Jahren 1859 und 60 hatte ich gegen die Absurditäten, die da so unzweideutig und ungeniert ausgesprochen wurden, geschrieben, doch selbst befreundete Redakteure wiesen mich mit aller Entschiedenheit ab und nahmen mir sogar alle Hoffnung, jemals meine Artikel veröffentlicht zu sehen. Damals begriff ich, welch eine Autorität die Blätter dieser Richtung hatten. Um so größer war meine Freude, als die Redaktion der „Zeit“, natürlich nur dank Fjodor Michailowitsch, meinen Artikel „Über die Petersburger Literatur“ für die Juninummer 1861 annahm. Daraufhin schrieb ich fast für jede Nummer in diesem Geiste. Ich erzähle dies alles nur zur Charakteristik der Literatur jener Zeit.
Ich bemühte mich um die größte Gewissenhaftigkeit, suchte meine Angriffe durch ein wirkliches Urteil zu begründen und scheute in der Beziehung keine Mühe; um so mehr interessierte Fjodor Michailowitsch die in ihnen enthaltene Klarlegung der Frage. Ich erwähne das deshalb, weil dieselbe so überaus wichtige Folgen hatte: sie führte zunächst zum vollständigen Bruch der „Zeit“ mit dem „Zeitgenossen“, dem angesehensten Petersburger Journal, und später zur allgemeinen Feindschaft fast des gesamten Petersburger Literatentums gegen die „Zeit“.
Das Problem der bei uns in Rußland sich äußernden Verneinung wurde für unsere Literatur, für das öffentliche Bewußtsein erst durch den Roman Turgenjeffs „Väter und Söhne“ klargestellt, durch denselben Roman, in dem zum erstenmal das Wort „Nihilist“ vorkam, mit dem die Debatten über die „neuen Menschen“ begannen und, kurz, das Ganze seine Formulierung und Popularität erhielt. Turgenjeff verfolgte beständig mit größter Aufmerksamkeit die Veränderungen der bei uns herrschenden Stimmungen und der Ideale des „Helden der Zeit“, weshalb er unsere führenden literarischen Kreise nie aus dem Auge verlor. In dem erwähnten Roman hatte er nun einen Typ geschildert, der entschieden wie eine Offenbarung wirkte, da ihn vorher niemand bemerkt hatte, doch den jetzt plötzlich ein jeder in seiner Umgebung häufig vertreten sah. Die Verwunderung war ungeheuer; man verlor geradezu den Kopf, da die Überraschung für die Dargestellten gar so unerwartet kam und sie sich im Spiegelbilde des Romans nicht erkennen wollten, – obschon der Autor sich keineswegs mit entschiedener Ablehnung zu dem Helden des Romans verhielt. Doch der jungen Generation war das zu wenig; sie erklärte deshalb mit einem Riesenlärm, Turgenjeff, damals der erste Name in unserer Literatur, sei geistig zurückgeblieben und ein Gegner der allgemeinen Sache. In den damaligen endlosen Gesprächen und Disputen hatte ich häufig Gelegenheit, unterschiedlichen Nihilisten zu beweisen, daß sie, wenn sie folgerichtig dächten, sich zu denselben Anschauungen bekennen müßten, die der Nihilist Basaroff im Turgenjeffschen Roman vertritt. Die Mehrzahl des Publikums ereiferte sich, wie gewöhnlich, sehr, hatte aber von der ganzen Sache nur ungenaue, meist recht bunte Vorstellungen. Die eifrigsten Anhänger der nihilistischen Richtung vermuteten nicht einmal, daß z. B. die Wissenschaft und die Kunst gleichfalls ihrem Götzen geopfert werden müßten. Im April 1862 erschien in der „Zeit“ ein Artikel von mir, der Turgenjeff als streng objektiven Künstler scharf verteidigte, und der die Lebenswahrheit des von ihm geschilderten Typus bewies. Turgenjeff, der kurz nach dem Erscheinen des Artikels in Petersburg eintraf und auf der Redaktion der „Zeit“ erschien, wo er die Brüder Dostojewski und mich antraf, und uns alle drei zu einem Diner im Hotel einlud, war durch den Sturm, der sich gegen ihn erhoben hatte, offenbar sehr beunruhigt. In den folgenden Jahren wurde Turgenjeff mit einem ganzen Regen von Vorwürfen und Schimpf überschüttet, so daß er bis 1867 nichts Ähnliches veröffentlichte.
Inzwischen erschien im Jahre 1866 der Roman „Rodion Raskolnikoff“, in dem mit bewunderungswürdiger Kraft ein gewisser extremer und charakteristischer Ausdruck des Nihilismus dargestellt ist, und von diesem Roman bis zu der kurz vor dem Tode geschriebenen „Legende vom Großinquisitor“ zieht sich in den Werken Dostojewskis ununterbrochen eine vielgestaltige und tiefe Analyse unserer sittlichen und geistigen Problematik. Betrachtet man das Ganze von diesem Standpunkt aus, so muß man Dostojewski noch ein ungeheures Verdienst um die Literatur und die Gesellschaft zusprechen. Er allein hat die Aufgabe in ihrer ganzen Tiefe und Breite erfaßt hat, alle Arten und Äußerungen dieser Dummheit und Sittenlosigkeit gezeigt, die sich in russischen Menschen entwickeln, wenn sie den Heimatboden verlassen, d. h. wenn sie sich von der Treue zu Rußland und vom christlichen Geist lossagen. Er blickte in die Seelen dieser Menschen und schilderte den Kampf ihrer Irrtümer mit dem guten Element, das noch in ihrer Seele lebt. Dabei tritt bei ihm das religiöse Element, wie auch die Sittlichkeit und Vaterlandsliebe des Volkes deutlich als Gegengewicht hervor, als Zuflucht und Rettung vor dem Chaos und der Albernheit der verweichlichten oberen Gesellschaftsschicht. Das Ganze ist groß, feinsinnig und tief angefaßt, dazu mit beständigen Hinwendungen zu den ewigen Aufgaben der Menschenseele, mit künstlerischen Versuchen, die erhabensten, wie die anrüchigsten Geheimnisse der Menschenherzen zu erspähen. Es ist kein Wunder, daß solch ein Schriftsteller die Leser schließlich außerordentlich zu interessieren begann.
In dieser kurzen Skizze der Stellungnahme unserer Literatur zum Nihilismus muß ich aus Sachlichkeit auch auf meine kleine Rolle hinweisen.
Auf Grund meines Artikels über Turgenjeff erschien in der nächsten Nummer des „Zeitgenossen“ ein überaus scharfer, ausschließlich gegen mich gerichteter Artikel. Diese Ehre hatte ich hauptsächlich meiner Analyse der nihilistischen Richtung zu verdanken. Und mehr noch dieser meiner Richtung als einigen meiner positiven Anschauungen schreibe ich die Bemerkung Fjodor Michailowitschs zu, die er – viel später einmal, als unsere Freundschaft kühler war – mir gegenüber machte. Es war im Jahre 1873, als er die Redaktion des „Bürger“ übernommen hatte. Da verlangte er von mir, ich solle mehr schreiben; als ich darauf sagte, ich hätte zu wenig Gedanken, um so viel zu schreiben, fiel er mir ins Wort: „Wieso zu wenig Gedanken? Die Hälfte meiner Anschauungen sind Ihre Anschauungen!“ Man wird es verstehen, daß diese in geärgertem Tone gesagte Bemerkung sich als großes Kompliment in meinem Gedächtnis erhalten hat, und ich schreibe sie, wie gesagt, meinem hartnäckigen Einstehen für meinen Standpunkt gegen den Nihilismus zu. Menschen mit künstlerischer Verstandesart sehen oft ein großes Verdienst in der logischen Entwicklung eines Gedankens, wozu sie selbst wenig geneigt sind, und wenn man dann im Kern der Sache eine Übereinstimmung findet, wie es bei Fjodor Michailowitsch und mir größtenteils der Fall war, so ist den Künstlern die abstrakte Formulierung ihrer Ideen und Gefühle sehr angenehm.
Auf den erwähnten Angriff des „Zeitgenossen“ antwortete ich in unserer Mainummer. Doch unsere Polemik wurde durch äußere Verhältnisse unterbrochen. Durch irgendeine Beziehung oder eine Anzeige fiel auf unseren Gegner der Verdacht, mit den revolutionären Proklamationen – nach denen die Brandstiftungen in Petersburg begannen – in Verbindung zu stehen, und der „Zeitgenosse“ wurde auf acht Monate verboten. Wir waren darüber aufrichtig betrübt, denn damit war uns der Gegner genommen, während wir gerade dem Kampf gegen ihn eine große Bedeutung beimaßen. Wir wußten sehr gut, daß seine Richtung trotz seines Schweigens oder sogar noch mehr dank diesem unfreiwilligen Schweigen fortfuhr, sich im Publikum zu entwickeln und zu erstarken. Uns aber fehlte jetzt der allgemein anerkannte Repräsentant der Richtung. Doch ganz abgesehen von diesem sozusagen internen Kummer, war schon die allgemeine Lage sehr schwer und traurig. Die Feuersbrünste flößten ein Grauen ein, das sich schwer beschreiben läßt. Ich entsinne mich noch, wie ich einmal mit Fjodor Michailowitsch nach den Inseln hinausfuhr. Vom Schiff aus sah man in der Ferne Rauchwolken, die sich an drei oder vier Stellen über der Stadt erhoben. Wir kamen in einen der Vergnügungsparks, wo eine Musikkapelle spielte und Zigeuner sangen. Aber wie gern wir uns auch zerstreut und amüsiert hätten, die schwere Stimmung ließ sich doch nicht verscheuchen, und es zog mich bald nach Haus. Daß bei diesen Feuersbrünsten Brandstiftung vorlag, war kaum zu bezweifeln, nur sind sowohl diese wie auch noch andere traurige Vorfälle jener Zeit aus irgendwelchen Gründen vollkommen unaufgeklärt geblieben.
Im Juni dieses Jahres (1862) trat Fjodor Michailowitsch seine erste Reise ins Ausland an. Er fuhr u. a. nach Paris und London, wo er mit Alexander Herzen zusammentraf, den er damals noch sehr milde beurteilte. Seine „Winteraufzeichnungen“ verraten sogar ein wenig den Einfluß Herzens. Später aber, in den letzten Jahren, äußerte er oft seinen Unwillen über die Unfähigkeit Herzens, das russische Volk zu verstehen und seine volkliche Eigenart zu schätzen. Mißachtung der einfachsten und gutmütigen Sitten, Stolz auf den Besitz der Aufklärung – diese Züge Herzens ärgerten Fjodor Michailowitsch sehr; übrigens verurteilte er dieselben auch an Gribojedoff, nicht nur an unseren Revolutionären und kleinen Anklägern.
Aus Paris erhielt ich von Fjodor Michailowitsch einen Brief, in dem er mir genau angab, wie und wo wir uns in Genf treffen könnten, wohin er von Köln aus, den Rhein hinauf, fahren wollte. Die Fortsetzung des Briefes führe ich hier an, da sie viel für ihn Bezeichnendes wiedergibt.
„... Liebster Nikolai Nikolajewitsch, es ist jetzt eine schlimme Zeit, wie Sie schreiben – eine Zeit ungewisser und quälender Erwartung. Aber eine Zeitschrift ist doch eine große Sache ... Herrgott, wenn man bedenkt, wieviel noch nicht getan und noch nicht gesagt ist! Und ich sitze hier in der sogenannten schönen Fremde und brenne doch schon darauf, wenn auch nicht körperlich, so doch geistig, wieder nach Rußland zurückzukehren. Ein jeder, ein jeder muß jetzt mithelfen und vor allem danach trachten, auf den richtigen Weg zu kommen! Gar zu sehr haben sich die Begriffe in unserer Gesellschaft verwirrt. Ein allgemeines Zweifeln und Nicht-Wissen hat begonnen ... Ach, Nikolai Nikolajewitsch, Paris ist die langweiligste Stadt, und wenn es hier nicht sehr viel wirklich gar zu bemerkenswerte Dinge gäbe, so könnte man wahrlich sterben vor Langweile. Die Franzosen sind, bei Gott, ein Volk, von dem einem übel wird. Sie sprachen einmal von den selbstzufrieden-frechen und gemeinen Gesichtern, die auf unseren Petersburger mondänen Promenaden florieren. Aber ich schwöre Ihnen, die hiesigen wiegen die unsrigen auf. Bei uns sind es einfach fleischfressende Lumpen, und zwar wissen sie das größtenteils selber. Hier aber ist der Kerl vollkommen überzeugt, daß es gerade so sein müsse. Der Franzose ist still, ehrlich, höflich, aber falsch und das Geld ist bei ihm alles. Von Idealen keine Spur. Nicht nur keine Überzeugungen, sogar eigenes Nachdenken dürfen Sie nicht verlangen. Das Niveau der allgemeinen Bildung ist bis zum Äußersten niedrig (ich spreche nicht von den staatlich angestellten Gelehrten, dieser gibt es doch nicht viele, und schließlich, ist denn Gelehrtheit Bildung in dem Sinne, wie wir dieses Wort zu verstehen gewöhnt sind?) ... Es gibt gewisse Dinge, die zu bemerken und zu verstehen eine halbe Stunde genügt, und die doch ganze Seiten der Nation deutlich bezeichnen, eben durch den Beweis, daß solche Tatsachen möglich sind, daß es so etwas wirklich gibt ... Und noch etwas, Nikolai Nikolajewitsch: Sie ahnen nicht, wie die Einsamkeit einem hier die Seele bedrückt. Man kommt in eine ganz sehnsüchtige und schwermütige Stimmung. Freilich, Sie sind ein einsamer Mensch und haben keinen Grund, mich deshalb besonders zu bedauern. Aber nichtsdestoweniger: man fühlt sich gewissermaßen losgelöst vom Erdboden und zurückgeblieben hinter der wichtigen, von uns verrichteten Arbeit und den laufenden Fragen im eigenen Vaterlande. Allerdings habe ich es bisher ungünstig getroffen im Auslande; scheußliches Wetter und zudem treibe ich mich immer noch in Nordeuropa umher und habe von den Naturwundern nur den Rhein mit seinen Ufern gesehen. (Nikolai Nikolajewitsch! Das ist wirklich ein Wunder!) Was wird es erst weiterhin geben, wenn ich von den Alpen in die Täler Italiens hinabsteige. Ach, wenn wir’s doch zusammen könnten! Wir sehen uns dann Neapel an, gehen in Rom spazieren, ja vielleicht liebkosen wir sogar eine junge Venezianerin in der Gondel (– Was meinen Sie? Nikolai Nikolajewitsch?) Doch – ‚kein Wort, kein Wort, ich schweige schon‘, – wie Poprischtschin[5] in einem ähnlichen Falle sagt ... Leben Sie wohl. Übrigens richtiger: auf Wiedersehen. Es ist doch nicht möglich, daß wir uns hier im Auslande nicht treffen! Das würde ich mir niemals verzeihen. Ich drücke Ihnen kräftig die Hand. Grüßen Sie von mir alle unsere gemeinsamen Bekannten. Wie benimmt sich Ihr unerzogener Kater? Addio!
Ihr Dostojewski.“
In meiner Antwort auf diesen Brief versprach ich, zur rechten Zeit in Genf einzutreffen, was ich denn auch tat. Um ihn dort zu finden, versuchte ich es mit einem bewährten Mittel: ich begab mich auf die Hauptpromenade, den Kai, und suchte dort die besten Cafés auf. Wenn ich nicht irre, traf ich ihn gleich im ersten. Unsere Freude war natürlich groß, zumal wir uns beide lange Zeit in der Umgebung von ausschließlich Fremden vereinsamt gefühlt hatten, und unsere Begrüßung war denn auch so lebhaft und unsere Freude so laut, daß wir die anderen Cafébesucher, die würdig und schweigsam an ihren Tischchen vor den Zeitungen saßen, belästigten. Wir beeilten uns deshalb, hinauszukommen und waren von nun an selbstverständlich unzertrennlich. Fjodor Michailowitsch war kein Meister im Reisen; ihn interessierte weder die Natur besonders, noch historische Sehenswürdigkeiten, noch Kunstwerke, außer vielleicht die allergrößten. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf die Menschen gerichtet: und nur ihre Natur, ihren Charakter suchte er zu erfassen und vielleicht noch so den Gesamteindruck des Straßenlebens. Er begann mir auch sogleich mit Eifer auseinanderzusetzen, daß er die übliche Manier der Reisenden verachte – nach dem Führer alles Berühmte sich anzusehen. Und tatsächlich, wir sahen uns nichts an, sondern spazierten nur, wo es mehr Menschen gab, und unterhielten uns. Genf fand er im allgemeinen düster und langweilig. Auf meinen Vorschlag machten wir an einem schönen Tage einen Ausflug nach Luzern. Dann wollte ich unbedingt nach Florenz, von welcher Stadt Apollon Grigorjeff so begeistert geschrieben und erzählt hatte. Wir fuhren über Turin, Genua, Livorno. Von Turin, der Stadt mit den geraden, ebenen Straßen, sagte Fjodor Michailowitsch, daß es ihn an Petersburg erinnere. In Florenz verbrachten wir eine Woche in einem bescheidenen Hotel „Pension Suisse“ (Via Tornabuoni). Wir hatten es dort gut, denn das Hotel war nicht nur bequem und solid eingerichtet, es zeichnete sich auch noch durch gewisse patriarchalische Sitten aus und nicht durch jene widerlichen Ansprüche auf Luxus und andere Hotelunsitten, die sich in ihm schon ziemlich eingebürgert hatten, als ich 1875 wieder dort einkehrte. Auch in Florenz taten wir nichts von alledem, was Touristen zu tun pflegen. Wir brachten die Tage zu in Spaziergängen und bei der Lektüre von Victor Hugos Roman „Les misérables“, der damals erschien und den Fjodor Michailowitsch Teil für Teil kaufte und von denen wir drei oder vier in dieser Woche durchlasen. Aber ich wollte doch nicht die Gelegenheit versäumen, die großen Kunstschätze kennen zu lernen, und wollte in ruhiger, aufmerksamer Betrachtung versuchen, den geistigen Überschwang, der diese Schönheit geschaffen hatte, zu erfassen und nachzuempfinden. So besuchte ich denn mehreremal die galleria degli Uffizii. Einmal gingen wir auch zusammen hin. Da wir aber keinen bestimmten Vorsatz hatten und unvorbereitet waren, so begann Fjodor Michailowitsch sich alsbald zu langweilen und wir verließen die Galerie, ich glaube, noch bevor wir zur Venus von Medici gekommen waren. Dafür waren unsere Spaziergänge in der Stadt sehr unterhaltsam, obschon Fjodor Michailowitsch manchmal fand, daß der Arno an die Fontanka, einen Petersburger Kanal, erinnere, und obgleich wir kein einziges Mal in den Cascinen waren. Am schönsten aber waren unsere Gespräche abends vor dem Schlafengehen bei einem Glase roten Landweins. Da ich auf den Wein zu sprechen gekommen bin, möchte ich bemerken, daß Fjodor Michailowitsch in dieser Beziehung äußerst mäßig war. Ich erinnere mich nicht eines einzigen Falles in den ganzen zwanzig Jahren, wo ich an ihm auch nur die geringste Wirkung getrunkenen Weines bemerkt hätte. Eher bekundete er eine kleine Vorliebe für Süßigkeiten. Sonst war er im Essen sehr mäßig.
Aus den „Winteraufzeichnungen“ werden die Leser am besten ersehen, worauf seine Aufmerksamkeit im Auslande wie überall gerichtet war: ihn interessierten die Menschen, ausschließlich die Menschen mit ihrer Seelenart, ihrer Lebensweise, ihren Gefühlen und Gedanken.
In Florenz trennten wir uns. Er wollte nach Rom reisen (wozu es jedoch nicht kam) und ich wollte noch auf eine Woche nach Paris.
Im September war unsere ganze Redaktion wieder vollzählig in Petersburg versammelt. Apollon Grigorjeff war schon im Sommer aus Orenburg zurückgekehrt. Wir machten uns alle mit Lust an die Arbeit und es ging so gut, daß es eine Freude war.
Das folgende Jahr, 1863, war eine bedeutungsvolle Zeit in unserer allgemeinen Entwicklung. Im Januar brach der polnische Aufstand aus und rief in unserer Gesellschaft eine große Bestürzung hervor, die eine schroffe Wandlung einzelner Ansichten zur Folge hatte. Bei der liberalen Stimmung nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der regierenden Kreise, hatte man die polnische Frage anfangs überhaupt nicht richtig aufzufassen verstanden. Polen, der Selbständigkeit beraubt, erwies sich als Ausgangspunkt unvermeidlicher Erschütterungen. Nicht wenige Patrioten sagten schon lange, daß wir Polen, indem wir es Rußland einverleibten, in unseren Körper wie irgendeine schädlich wirkende Medizin aufgenommen hätten. Deshalb vertraten der „Tag“ und die „Moskauer Nachrichten“ zunächst den Standpunkt, daß die beste Lösung des Problems vielleicht wäre, Polen abzuschütteln und seinem eignen Schicksal zu überlassen. Da kamen aber die Ansprüche der Polen auf das Westgebiet, und diese warfen einerseits ein ganz neues Problem auf, andererseits verwirrten sie die Mehrzahl der gebildeten Leute so weit, daß sie in ihrer tiefen Unkenntnis der Sache mit der Erfüllung dieser neuen Forderungen einverstanden gewesen wären. Da waren es die beiden genannten Moskauer Blätter, die viel zu einer richtigen Beurteilung der Sachlage beitrugen. In der Gesellschaft kam es zu einem krassen Umschwung der Anschauungen: der Patriotismus loderte auf, die nicht bodenständigen Liberalen verloren ihre Bedeutung und Alexander Herzen, der es sich einfallen ließ, für die Polen einzutreten, verlor auf immer sein Ansehen bei den Lesern.
Die Petersburger Literatur hatte zu diesen Vorgängen von Anfang an fast ausnahmslos geschwiegen, vielleicht deshalb, weil sie nicht wußte, was sie sagen sollte, oder weil sie von ihrem abstrakten Standpunkte aus urteilte und den Anmaßungen der Aufständischen sogar beistimmte. Dieses Schweigen reizte die Moskauer Patrioten und die patriotisch Gesinnten der Regierungskreise. Sie fühlten, daß in der Gesellschaft eine den Staatsinteressen in diesem Augenblick feindliche Stimmung oder Richtung vorhanden war und waren darüber mit Recht empört. Und diese Empörung wartete nur auf die erste Kundgebung der geheimen Stimmung, die sich vorläufig nur durch Schweigen ausdrückte, um sie dann als Feind im Innern niederzuschlagen. Und so geschah es denn auch, nur daß die Strafe infolge eines Mißverstehens nicht die Schuldigen traf, sondern die „Zeit“.
Es muß eingestanden werden, daß unsere Zeitschrift den Aufgaben, die zu erfüllen die Pflicht eines jeden Blattes, besonders eines patriotischen gewesen wäre, nur mangelhaft nachkam. Die „Zeit“ war in diesem Jahr in literarischer Hinsicht allerdings interessant, aber zur Polnischen Frage hatte sie sich überhaupt noch nicht geäußert. Ihr erster Artikel über dieses Problem war ein Aufsatz von mir in der Aprilnummer: „Eine verhängnisvolle Frage.“ Und eben dieser Aufsatz wurde mißverstanden und veranlaßte das Verbot der Zeitschrift.
Selbstverständlich war weder bei den Brüdern Dostojewski noch bei mir auch nur eine Spur von Polonophilismus vorhanden. Der Sinn meines Artikels war der, daß wir mit den Polen nicht nur materiell, sondern auch geistig kämpfen müßten und die endgültige Lösung des Problems erst dann eintreten würde, wenn wir die Polen geistig besiegt hätten. Die Polnische Frage erfordert mehr als jede andere die Mitwirkung auch aller unserer inneren Kräfte, sie erinnert uns an unseren Unterschied von Europa und verheißt Klärung und Entwicklung unserer selbständigen Elemente. In Wirklichkeit, im Leben, übertreffen wir die Polen unendlich; doch diese unsere Stärke muß man zu Bewußtsein bringen und aus ihr klare Formen geistiger und kultureller Entwicklung schöpfen. Beide Dostojewskis waren mit meinem Artikel sehr zufrieden und stolz darauf, daß sie ihn brachten. Im Grunde war es eine Umprägung der politischen Frage in eine abstrakte Formel. Aber das Leben mit seinen konkreten Gefühlen und Taten ging so glühend vorwärts, daß es diesmal die Abstraktheit nicht ertrug. Insofern war dieser unselige Artikel natürlich schlecht geschrieben. Nachher machte mir Fjodor Michailowitsch einen leisen Vorwurf eben wegen der trockenen Abstraktheit meiner Ausführungen, was mich damals ein wenig kränkte; doch jetzt gebe ich gern zu, daß er recht hatte. Es tut mir weh, an den Kummer zu denken, den ich unfreiwillig vielen Patrioten zufügte. Aber eine noch viel größere Strafe war es, daß andere wiederum mich für einen Polonophilen hielten und mir gegenüber gerade aus diesem Grunde eine besondere Hochachtung bezeugten. Das schmerzte mich mehr als alle verächtlichen Blicke, deren ich so viele zu ertragen hatte, und alle betonte Kühlheit sogar meiner nahen Bekannten, weil ich in ihren Augen ein Konservativer und Rückschrittler war. Dieses unklare Denken, diese kurzsichtige und enge Auffassung aller Fragen, diese verblüffende Armut an Logik und Kritik findet man in jeder Gesellschaft, in der unsrigen aber hat sie einen besonderen Einfluß. Das ist natürlich von großem Übel, denn es stört die Entwicklung des Denkens und somit auch die der Literatur. Doch um den unangenehmen Eindruck zu erklären, den der Ton meiner Schrift hervorrief, muß ich noch ein paar Worte über mich sagen.
Grenzenloser Patriotismus – das war die Gefühlswelt, in der ich fern von den Hauptstädten aufgewachsen und erzogen worden war. Rußland erschien mir als ein Land von ungeheuren Kräften, mit unvergleichlichem Ruhm bedeckt, als erstes Land der Welt, so daß ich im buchstäblichen Sinn des Wortes Gott dafür dankte, daß ich als Russe zur Welt gekommen war. Deshalb konnte ich es lange Zeit überhaupt nicht fassen, daß es Menschen gab, die in der Beziehung anders fühlten und dachten, und ebenso schwer war mir, Anschauungen zu verstehen, die diesem meinem Gefühl widersprachen. Als ich mich aber schließlich überzeugte, daß Europa uns verachtet, daß es in uns ein halbbarbarisches Volk sieht und daß es für uns nicht nur schwierig, sondern einfach unmöglich ist, die europäischen Völker zu einer anderen Auffassung von uns zu bekehren, da war diese Entdeckung unsäglich schmerzlich für mich, und diesen Schmerz empfinde ich auch jetzt noch. Aber ich habe nie auch nur daran gedacht, mich von meinem Patriotismus loszusagen oder meinem Vaterlande und seinem Geist den Geist gleichviel welch eines anderen Landes vorzuziehen. Wenn es mir auch häufig schien, daß Rußland, wie der Dichter Tjutscheff sagt, „nicht mit dem Verstande zu erfassen“ sei und man an Rußland „nur glauben“ könne, so begann ich doch mit der Zeit immer besser zu erkennen, wie es kam, daß „der stolze Blick der andren Völker nicht verstehen und nicht erkennen kann, was in Rußlands demütiger Nacktheit glüht und voll Geheimnis leuchtet“. Die Verachtung der Europäer war nur der beständige Stachel, der sowohl meine Treue zum Geist meines Volkes verstärkte, wie er das Verstehn dieses Geistes förderte. Eben diese Treue und dieses Verstehen wollte ich auch in anderen erwecken, und deshalb hatte ich von der Anmaßung der Polen geschrieben und darauf hingewiesen, daß wir uns nur durch unerschütterlichen Glauben an uns selbst und die Erkenntnis des Geistes, den wir in uns tragen, über ihre Anmaßung stellen können. Unser Unglück besteht vorläufig nur in der Schwierigkeit und Unklarheit dieser Erkenntnis. Doch dieses Unglück lastet nur auf denen, die sich vom Boden losgerissen haben. Wer aber von uns bestehen will, der suche diesen Geist und richte seinen Verstand darauf, sein Wesen zu erkennen.
Der polnische Aristokratismus ist schon im allgemeinen, besonders aber in seinem Gegensatz zu dem angrenzenden russischen Gebiet, für jeden Russen etwas Widerliches; er hat auch am meisten zum Untergang Polens beigetragen. Er selbst hat sich durch die traditionelle Aneignung der europäischen Bildung entwickelt, auf der er auch jetzt noch beruht. Daraus folgt, daß es zuweilen besser ist, in der Kultur zurückzubleiben, dafür aber seinen eigenen Geist zu behalten und nicht in diesen rettungslosen Zwiespalt der Ziele und Gefühle zu geraten, in dem sich jetzt die Polen befinden. In diesem Sinne hatte ich meinen Artikel „Eine verhängnisvolle Frage“ genannt. Ich war bereit, unumwunden zu sagen, daß es für die Polen keine Rettung mehr gibt, daß die Geschichte sie zum Untergang verurteilt hat. Doch der Artikel entsprach in seiner zu abstrakten Form nicht den landläufigen Begriffen und man verstand ihn falsch. Als sich das Gerücht verbreitete, der „Zeit“ drohe Gefahr, wollten wir es zunächst nicht glauben, denn unser Gewissen war rein. Bald aber war es zu spät zu einer Erklärung: man hatte uns für schuldig befunden und erlaubte uns nicht einmal mehr einen Rechtfertigungsversuch. Die Zeitschrift wurde bedingungslos untersagt und zwar für immer. Ich hatte natürlich alles getan, was ich konnte und wozu man mir riet, doch selbst Persönlichkeiten wie Katkoff[6] und Aksakoff[7] vermochten nicht das Geringste auszurichten.
Unsere Lage war nicht nur ärgerlich, sie war sogar ziemlich schwierig. Mir drohte Ausweisung aus Petersburg, wir alle verloren den Abnehmer für unsere Arbeiten, und noch schlimmer wurden durch den Schlag die Redakteure getroffen, die nun alle ihre Hoffnungen vernichtet sahen. Dennoch kann ich nicht behaupten, daß wir den Kopf hängen ließen. Wir trösteten uns damit, daß der ganze unangenehme Zwiespalt immerhin eine glänzende Reklame für uns sei, zumal der wahre Sachverhalt in den literarischen Kreisen und im Publikum schon bekannt wurde.
Doch unseren neuen Hoffnungen war es nicht bestimmt, in Erfüllung zu gehen. Michail Michailowitsch erhielt nach acht Monaten allerdings die Erlaubnis, ein neues Blatt zu gründen, die „Epoche“, doch begann sie nach mehrfachen Verzögerungen unter sehr ungünstigen Verhältnissen zu erscheinen. Fjodor Michailowitsch war gegen Ende des Sommers ins Ausland gereist und hatte dort wieder gespielt, aber diesmal verloren. Kennen gelernt hatte er das Roulette schon auf der ersten Reise und dabei über 1000 Francs gewonnen. Im Spiel sah er übrigens für sich nichts Schlimmes, da er sich sagte, als Schriftsteller müsse er auch diese Leidenschaft und die Sitten der Spielorte kennen lernen. Soweit ich mich erinnere, hatte er genügend Geld zur Reise mitgenommen, doch infolge der Spielverluste erhielt ich Ende September einen Brief von ihm, in dem er mich dringend bat, zum Verleger Boborykin zu gehen und für einen noch ungeschriebenen Roman dreihundert Rubel als Vorschuß zu erbitten. „Mag Boborykin erfahren,“ schrieb er, „wie es der ‚Zeitgenosse‘ und die ‚Vaterländischen Annalen‘ erfahren haben, daß ich, abgesehen von meinem ersten Roman ‚Arme Leute‘, in meinem Leben noch niemals etwas geschrieben habe, ohne das Honorar im voraus fordern zu müssen. Ich bin als Literat ein Proletarier und wenn jemand meine Arbeit wünscht, so muß er mir vorher meinen Lebensunterhalt sichern. Diese Methode verwünsche ich selbst. Aber es ist einmal so und wird sich wahrscheinlich nie ändern ...“ Aus dem Auslande kehrte er im Spätherbst zurück. Als jedoch die „Epoche“ zu erscheinen begann, war er in Moskau, wo seine Frau im Sterben lag, und, selber krank, konnte er nichts schreiben. Mein Leitartikel „Der Umschwung“ wurde von der Zensur gestrichen, da sie mich für sehr gefährlich hielt, obgleich ich nur den einen Wunsch hatte, meine patriotische Gesinnung zu beweisen. Die anderen Mitarbeiter hielten nicht mehr so zusammen wie früher. Doch vor allem hatte sich das Verhalten des Publikums zur Literatur geändert. Es hatte sich im Jahre 1863 allerdings ein mächtiger „Umschwung“ der Meinungen vollzogen. Das gutgläubige Publikum hatte zum erstenmal wahrgenommen, wohin die gewisse Literaturpartei es führte, und wandte sich nicht nur von ihr, sondern von der Literatur überhaupt ab. Ganz Russland wurde von Patriotismus erfaßt, und da die Literatur nicht sehr patriotisch war, so verlor man den Geschmack an ihr. Unter solchen Umständen hätte es von seiten des Redakteurs einer besonderen Energie bedurft, um die Sache durchzuführen, diese aber fehlte Michail Michailowitsch. Auch Fjodor Michailowitsch konnte nach dem Tode des Bruders trotz aller Energie den Fall der Zeitschrift nicht abwenden. Als die „Epoche“ mit dem Februarheft 1865 zu Ende ging, war außer den Einnahmen auch noch das Kapital verloren, das eine reiche Moskauer Verwandte den beiden Brüdern vermacht und auf deren Bitte im voraus ausgezahlt hatte (jedem zehntausend Rubel), und überdies lastete auf Fjodor Michailowitsch noch eine Schuld von fünfzehntausend Rubeln. Wenn wir jedoch in Erwägung ziehen, daß nach dem Abbruch der journalistischen Tätigkeit schon im nächsten Jahre (1866) der Roman „Rodion Raskolnikoff“, 1868 der „Idiot“, 1870 die „Dämonen“ erschienen, so muß man den Bankerott der „Epoche“ für ein Glück ansehen, denn hätte die Zeitschrift weiterbestanden, so wäre Fjodor Michailowitschs Arbeitskraft von ihr absorbiert worden.
Im Juli 1865 trat Fjodor Michailowitsch wieder eine Auslandsreise an, von der er im November nach Petersburg zurückkehrte, wo er das ganze nächste Jahr blieb. Diese beiden Jahre waren für ihn eine sehr schwere Zeit. Krank, einsam, von Gläubigern bedrängt, hatte er noch für die zahlreiche Familie des verstorbenen Bruders zu sorgen. Man kann nicht umhin, die Energie zu bewundern, mit der er alles überwindet und in derselben Zeit noch sein erstes großes Werk „Rodion Raskolnikoff“ schreibt. Im Oktober 1866 begann er den kleinen Roman „Der Spieler“ niederzuschreiben, doch als er sah, daß er zum Termin nicht fertig werden konnte, erkundigte er sich bei einem Lehrer der Stenographie nach einer Stenographin. Der Lehrer empfahl ihm seine beste Schülerin, Anna Grigorjewna Ssnitkina, ein junges Mädchen, das kurz vorher das Mariengymnasium beendet und in demselben Jahre seinen Vater verloren hatte. Sie war mit Freuden bereit, der Aufforderung Dostojewskis, des von ihrem Vater bevorzugten Schriftstellers, nachzukommen, um so mehr, als er auch von ihr wie von ihrer ganzen Verwandtschaft mit Spannung gelesen wurde. Dieses junge Mädchen sollte später seine Frau werden. Auch in der Ehe half ihm Anna Grigorjewna beständig bei der Arbeit. Er diktierte ihr nach seinen Entwürfen, die er ins unreine mit vielen Korrekturen, Einschaltungen usw. niedergeschrieben hatte, worauf sie ihre stenographische Niederschrift umschrieb. Ihre Trauung fand am 15. Februar 1867 statt. Der Ehe entsprossen vier Kinder: Ssofja, geb. am 28. Februar 1868 in Genf und gest. am 12. Mai; Ljubow, geb. am 14. September 1869 in Dresden; Fjodor, geb. am 16. Juli 1871 in Petersburg; und Alexei, der am 12. August 1875 in Staraja Russa zur Welt kam und am 16. Mai 1878 in Petersburg starb.
Im zweiten Monat nach der Hochzeit reisten sie ins Ausland, wo sie viel länger verblieben, als sie beabsichtigt hatten und wünschten. Von Berlin fuhren sie nach Dresden, wo sie sich zwei Monate aufhielten, von dort nach Baden-Baden, wo Fjodor Michailowitsch wieder spielte, zuerst gewann, später aber alles verlor, so daß er nur dank dem von Katkoff nachgeschickten Vorschuß Baden-Baden verlassen konnte. In Genf trafen sie mit nur dreißig Franken ein. Dort verlebten sie den Winter 1867–68, in welcher Zeit Fjodor Michailowitsch den „Idiot“ schrieb. Sie führten ein einsames, einförmiges Leben, hatten keine Bekannten, außer einem Landsmann, der sie zuweilen besuchte und ihnen manchmal aus der größten Verlegenheit half, indem er ihnen fünf oder zehn Franken lieh. Die Geburt des ersten Töchterchens war eine große Freude. Fjodor Michailowitsch lebte förmlich auf und verbrachte jeden freien Augenblick am Kinderwagen und freute sich über jede Bewegung der Kleinen. Ihren Tod hat er nie verschmerzen können. Den Sommer 1868 verbrachten sie in Vevey am Genfer See. Im September reisten sie nach Italien; zwei Monate verlebten sie in Mailand, darauf den Winter 1868/69 in Florenz, wo er den „Idiot“ beendete. Das Leben in Florenz verlief für sie ebenso eintönig wie in der Schweiz, doch konnten sie hier wenigstens die Gemäldegalerien besuchen, was besonders Anna Grigorjewna sehr oft tat. Zu den Kunstwerken, die Fjodor Michailowitsch am meisten gefielen, gehörte der Turm des Florentiner Domes von Giotto und die Türen des Battistero von Lorenzo Ghiberti. Zu den Italienern verhielt er sich übrigens immer mit großer Sympathie, fand sie schlicht und gutmütig – die Menschen aus dem einfachen Volk erinnerten ihn an russische Bauern. Zuweilen besuchten Dostojewskis auch das Theater, doch das geschah immerhin sehr selten, da bei ihnen ständig Geldmangel herrschte.
Im Juli 1869 kehrten sie über Venedig, Triest, Wien und Prag nach Dresden zurück. In den letzten Monaten des Jahres 1869 schrieb er die Novelle „Der Gatte“ und das ganze folgende Jahr die „Dämonen“. In Dresden, wo ihnen wieder ein Töchterchen geboren wurde, mußten sie fast volle zwei Jahre bleiben, was Fjodor Michailowitsch sehr schwer fiel, da ihn beständig Heimweh und der Gedanke quälte, daß er Rußland fremd werde, Rußland nicht mehr kenne. Die Rückkehr war ihnen jedoch unmöglich, da sie dazu einer größeren Summe bedurften. Das Geld aber, das sie erhielten, reichte trotz ihres bescheidenen Lebens nicht aus: einen bedeutenden Teil desselben verbrauchte der Unterhalt der Witwe des Bruders und seines Stiefsohnes aus erster Ehe, und außerdem mußten noch Prozente für die bei der Abreise versetzten Sachen bezahlt werden; trotzdem verfielen sie zu guter Letzt. Schließlich wurde ihnen der Aufenthalt im Auslande doch zu unerträglich, und sie beschlossen, alle schweren Folgen auf sich zu nehmen – es galt, noch die Schulden zu bezahlen – und am 8. Juli 1871 trafen sie in Petersburg ein.
Das letzte Jahrzehnt seines Lebens brachte Fjodor Michailowitsch in Petersburg zu, abgesehen von kürzeren Reisen nach Ems zu Kurzwecken und dem Sommeraufenthalt in Staraja Russa, wo sie seit 1872 nicht nur jeden Sommer, sondern auch den einen Winter verlebten, als Fjodor Michailowitsch seinen vierten großen Roman schrieb (1874/75). Im Frühling des Jahres 1876 kauften sie sich in Staraja Russa (im Gouvernement Novgorod, südlich vom Ilmen-See) ein Haus mit einem großen alten Garten. Im Juni des Jahres 1879 machte er mit Wladimir Ssolowjoff[8] eine Reise nach einem Kloster in der Nähe von Koselsk (im Gouvernement Kaluga), der Koselskaja Optina, wo er sich fast eine Woche aufhielt. Die Eindrücke dieser Reise sind in den „Brüdern Karamasoff“ wiedergegeben. So sehen wir denn, daß das Leben Fjodor Michailowitschs zu guter Letzt in vollkommen geregelten Verhältnissen verlief und aus einem mehr oder weniger unsteten ein seßhaftes wurde. Diese Besserung der Verhältnisse, die ihm eine gesündere Lebensweise und Freiheit in der Wahl seines Aufenthaltsortes gestattete, war hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß Anna Grigorjewna es auf sich nahm, im Selbstverlage Neuausgaben seiner früheren Werke zu machen, was sie im Jahre 1873 mit den „Dämonen“ begann. Fjodor Michailowitsch war nicht nur auf den geistigen Erfolg seines Schaffens aufrichtig stolz, er war auch stolz auf den materiellen Erfolg und freute sich, daß er seine Schulden bezahlen konnte und sich nicht mehr mit dem Gedanken zu quälen brauchte, daß seine Familie einst in Armut zurückbleiben werde. 1878 wandte er sich zum letztenmal mit der Bitte um Vorschuß an die Redaktion des „Russischen Boten“, die ihren Mitarbeiter so lange und bereitwillig mit großen und kleinen Vorschüssen unterstützt hatte. Später hatte er es nicht mehr nötig und konnte sogar ein kleines Kapital beiseite legen. Die Redaktion der „Vaterländischen Annalen“, in denen seine zwei letzten Romane erschienen, zahlte allein für den ersten Abdruck der „Jugend“ 250 Rubel pro Druckbogen, für den Abdruck der „Brüder Karamasoff“ 300 Rubel pro Druckbogen.
Im letzten Jahrzehnt seines Lebens trat er als Publizist nur in den Jahren 1873 und 1876/77 hervor. Die Redaktion des „Bürgers“ war ihm vom Fürsten W. Meschtscherski angeboten worden. Er erhielt für seine Tätigkeit 250 Rubel monatlich, außer dem Honorar für seine Artikel. Fürst Meschtscherski war ihm überaus zugetan und ließ sich gern von ihm beeinflussen. Wer diesen Jahrgang des „Bürger“ liest, wird sich alsbald überzeugen, wieviel Arbeit und Sorgfalt vom Redakteur auf ihn verwandt worden ist. Leider ist es mir nicht bekannt, aus welchen Gründen und Erwägungen Fjodor Michailowitsch die Redaktion später niederlegte.
„Das Tagebuch eines Schriftstellers“ erschien seit 1876. Es hatte einen Riesenerfolg und war tatsächlich ein glücklicher Gedanke, da es dem Bedürfnis und der Schreibweise Fjodor Michailowitschs durchaus entsprach. Jede Nummer enthielt eigentlich nur eine Reihe von Feuilletons, wenn man sich so ausdrücken kann, in denen er über die verschiedensten Tagesfragen, vornehmlich jedoch über politische, soziale und literarische Fragen schrieb. Ja man kann sagen, daß er in seinem „Tagebuch“ gewissermaßen seine eigene Biographie dieser Zeit geschrieben hat, denn er hat in ihm alles zur Sprache gebracht und erklärt, was ihn in jedem der zwölf Monate dieser Jahre beschäftigt, was er gedacht und gefühlt hat. Und nirgends, scheint es mir, drückt sich seine Energie und sein Mut so deutlich aus wie in diesem „Tagebuch“. Besonders setzte die Richtung dieser Zeitschrift die Leser in Erstaunen und riß sie schließlich mit. Diese Richtung widersprach aufs schärfste den Meinungen und Neigungen des Petersburger Publikums und war ein offensichtlicher Protest gegen die herrschende geistige Strömung. Es läßt sich denken, wie sehr sich alle diejenigen freuten, die mit den herrschenden Anschauungen unzufrieden waren und nirgends einen Protest oder die Vertretung der von ihnen geliebten Ideen fanden. Solcher gibt es viele bei uns, doch gehören sie nicht zu denen, die sich mit der Literatur befassen.
In den Jahren 1878, 79 und 80 unterließ Dostojewski aus Rücksicht auf seine Gesundheit und die Arbeit an seinem letzten Werk die Fortführung des „Tagebuchs“, obgleich zuletzt von jeder Nummer sechstausend Exemplare gedruckt worden waren und einzelne Nummern noch eine zweite und dritte Auflage erforderten.
Als Zeuge des Sieges, den Fjodor Michailowitsch auf der Puschkinfeier in Moskau davontrug, will ich versuchen, den ganzen Vorgang, an dem ich leidenschaftlichen Anteil nahm, so gut ich kann, wiederzugeben. Da ich nur Zuschauer war, konnte ich das innere Drama, das sich während dieser Feier abspielte und dessen Hauptrolle Fjodor Michailowitsch zufiel, um so besser erkennen. Er war aus Staraja Russa, wo er den Sommer mit seiner Familie verbrachte, als einer der offiziellen Vertreter des slawischen Wohltätigkeitsvereins kurz vor der Hauptfeier, also bereits vor mir, in Moskau eingetroffen und hatte, wie ich später erfuhr, schon an einem Bankett teilgenommen, das von seinen Verehrern ihm zu Ehren gegeben worden war.
Als ich mich zur Feier aufmachte, erwartete ich, offen gestanden, nichts Gutes. Ich fürchtete viel Lärm, viel leeren Enthusiasmus, und es war sehr möglich, daß sich dabei nichts von Bedeutung ereignen würde. Zum Glück hatte ich mich diesmal getäuscht. Die Rede Dostojewskis gab der Feier einen Inhalt, der nach dem vergänglichen Feuerwerk des ganzen Festes wie ein harter glänzender Kristall bestehen blieb.
Nach der Enthüllung des Puschkindenkmals am 6. Juni, den Festlichkeiten der Moskauer Duma und der Universität, begann am 7. Juni im Adelssaal der literarische Teil der Puschkinfeier mit einer öffentlichen Versammlung der „Gesellschaft der Liebhaber russischer Literatur“. An diesem Tage sollten Turgenjeff und nach ihm Aksakoff ihre Reden halten, also zwei Vertreter der entgegengesetzten Richtungen. Doch da sich die Eröffnung mit allen Ansprachen usw. sehr lange hinzog, so konnte nur Turgenjeff noch zu Wort kommen. Seine Rede wurde selbstverständlich mit großem Beifall aufgenommen. Unter den Literaten aber entspann sich nachher ein lebhafter Streit über den Inhalt dieser Rede, und man äußerte den Wunsch, sie zu widerlegen oder wenigstens zu ergänzen. Anders war es auch nicht zu erwarten von einer „Gesellschaft“, zu der so viele Slawophile gehörten. Besonders war es aufgefallen, auf welche Stufe Turgenjeff Puschkin stellte. Er erkannte ihn zwar als volklichen, d. h. als selbständigen Dichter an, doch stellte er darauf noch die Frage: war Puschkin deshalb ein nationaler Dichter? Denn national könne man nach der Meinung des Redners nur den großen und universalen Dichter nennen. Erst wenn ein Dichter den Geist seines Volkes vollkommen ausdrückt, erst dann ist er der „große“ und zugleich der universale Dichter, der der Schatzkammer der Menschheit einen Beitrag zuträgt. Die Antwort aber auf diese Frage verweigerte der Redner. „Ich behaupte nicht,“ sagte er, „daß Puschkin diese Bedeutung zukomme, aber ich wage auch nicht, sie ihm abzusprechen.“
Das alles und noch manches andere erregte große Unzufriedenheit. In der Gruppe der aktiven Teilnehmer an der Feier hinterließ die Rede ein Gefühl des Unbefriedigtseins und der Unklarheit. Man zerpflückte kritisch die Worte Turgenjeffs und einige Literaten, die am nächsten Tage zu reden hatten, wollten sich zu seiner Stellungnahme äußern und Puschkin gewissermaßen verteidigen. Aber das, was am nächsten Tage, am 8. Juni zur Verteidigung Puschkins geschah, überstieg doch alle Erwartungen und Absichten. Zuerst sollte Aksakoff seine Rede halten, dann Dostojewski, doch weiß ich nicht, aus welchem Grunde beschlossen wurde, daß Dostojewski beginnen sollte. Zwar las er seine Rede vor, aber das war kein Lesen; das waren Worte, die unmittelbar aus dem Herzen kamen und jedes Herz ergriffen. Der ganze Enthusiasmus und die ganze Natürlichkeit, die dem Stil Dostojewskis eigen sind, kamen durch seinen meisterhaften Vortrag noch mehr zur Geltung. Ich spreche noch nicht einmal vom Inhalt der Rede, obgleich er es war, der die Kraft des Vortrags ausmachte. Ist es mir doch, als hörte ich in diesem Augenblick wie über der atemlosen Stille der ganzen großen Versammlung seine Stimme sich erhob: „Demütige dich, stolzer Mensch, arbeite, müßiger Mensch!“
Schon nach den ersten Worten, mit denen Dostojewski begann, horchte alles auf und verstummte. Man hörte zu, als sei vorher nichts von Puschkin gesagt worden, – bis die Spannung sich im ersten Beifallssturm löste. Dann aber war im Publikum jede Zurückhaltung vergessen und schrankenlos gab es sich seiner Begeisterung hin. Sah man doch einen Menschen vor sich, der selbst ganz erfüllt war von Begeisterung, und von diesem Menschen vernahm man eine Deutung, die diese Begeisterung wahrlich auch verdiente.
Von dem Sturm, der sich nach dem Schluß der Rede im Saal erhob, kann sich wohl kaum jemand, der ihn nicht selbst erlebt hat, eine Vorstellung machen. Man erstürmte förmlich die Estrade; ein Jüngling, der sich bis zu Dostojewskis durchgedrängt hatte, fiel in Ohnmacht. Dostojewski wurde umarmt, geküßt. Ich erinnere mich nicht mehr aller Ausrufe der Begeisterten. Aksakoff wandte sich mit den Worten an ihn: „Turgenjeff und ich, er als Vertreter der Westler und ich als Vertreter der Slawophilen, wir sind Ihnen beide unsere volle Zustimmung und unseren tiefsten Dank schuldig!“ Und Annenkoff[9] kam auf mich zu und sagte ganz begeistert: „Was doch eine wirklich geniale Charakteristik bedeutet! – sie hat mit einem Schlage die ganze Sache entschieden!“
Als Aksakoff, der alte Liebling der Moskowiter, später seine Rede halten sollte und das Publikum mit lebhaftem Applaus sein Erscheinen auf der Estrade begrüßte, sagte er nur kurz, daß er nach der Rede Dostojewskis nichts mehr zu sagen habe, denn alles, was er zu sagen beabsichtigt und niedergeschrieben, sei nur eine schwache Variation bloß einiger Themen dieser „genialen Rede“. Diese Worte riefen wieder stürmischen Applaus hervor. „Ich betrachte“, fuhr Aksakoff fort, „die Rede Dostojewskis als ein Ereignis in unserer Literatur. Gestern konnte man noch darüber streiten, ob sie es sei oder nicht; heute ist diese Frage bereits abgetan. Wir kennen jetzt die wahre Bedeutung Puschkins und somit ist alles weitere Reden überflüssig.“ Mit diesen Worten verließ Aksakoff die Rednerbühne. Und wieder wollten die Ovationen der Begeisterten kein Ende nehmen, doch diesmal galt der Beifall auch der Handlungsweise Aksakoffs wie seinem Urteil über die Rede Dostojewskis.
So feierte man in Dostojewski den Helden dieses Tages, der der ganzen Feier Inhalt und Farbe gegeben, der alle Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar weit übertroffen hatte, und man war ihm dankbar für die Befreiung von der zuletzt qualvollen Spannung. Das Publikum verlor ihn von nun an nicht mehr aus den Augen und überschüttete ihn bei jeder Gelegenheit mit den lautesten Beifallsbezeugungen. Dasselbe geschah schon am Abend dieses Tages, an dem die dreitägige Puschkinfeier mit einer literarisch-musikalischen Ausführung ihren Abschluß fand und Dostojewski auf allgemeines Bitten hin Puschkins Gedicht „Der Prophet“ zweimal mit bewunderungswürdiger Meisterschaft vortrug.
So endete diese herrliche Feier. Der letzte Applaus war verstummt, und müde und befriedigt löste sich die Versammlung auf. Der Eindruck, den ich davontrug, war nicht allein stark, er war mir auch vollkommen klar. Ich gedachte jener literarischen Bewegung, in der ich einst mit solchem Interesse mitgewirkt hatte, unseres ganzen Literatenkreises, der zuerst (1859) für das „Russische Wort“ geschrieben hatte, dann für die „Zeit“, die „Epoche“, die „Morgenröte“, den „Bürger“ ... Das waren Gruppen von Menschen, die der Literatur immer eine große Bedeutung beigemessen hatten und ihr am treuesten dienten. In Puschkin sahen sie ihren Dichter, wie denn auch niemand besser über Puschkin geschrieben hat als Apollon Grigorjeff. Ihnen hatte sich Dostojewski angeschlossen, war für einige von ihnen der Führer geworden und hatte ihrer Richtung den Namen gegeben, indem er sie die Richtung der „Bodenständigen“ nannte. Und diese Richtung war es, die hier gesiegt hatte.
Zugleich hatte Dostojewski uns in zweierlei Hinsicht ein großes Beispiel gegeben: das Beispiel eines echten Konservativen und ein Beispiel, wie wir uns zu allem uns National-Feindlichen zu verhalten haben.
Konservatismus und Patriotismus hält man oft für geistige Beschränktheit, für Dummheit und Stumpfheit, was sie freilich auch oft genug sind, da sie von einer Menge Menschen geteilt werden, der Verstand der Menschen aber im allgemeinen schwach und begrenzt ist. Doch das berührt noch nicht die Sache selbst. Was kann im Grunde natürlicher und richtiger sein, als die Liebe zu unserer Umgebung und der Wunsch, das zu erhalten, was wir lieben? Und selbst lieben lernen wir doch von Menschen, die uns nahestehen, und lernen verstehen auf Grund des geistigen Inhalts, der uns zuerst gegeben wird. Ein feinfühliges Herz und ein feiner Geist entdecken allmählich die positive Seite des sie umgebenden Lebens und eignen sie sich an, ebenso wie seine Geistesart und Schönheit, die den Hauptnerv jedes Menschendaseins ausmachen und ohne die das Leben unmöglich ist. Was aber von einem Menschen einmal liebgewonnen, einmal begriffen ist, wird eine tiefe Natur ganz gewiß nicht mehr vergessen, das kann sie nicht mehr wie etwas Überflüssiges und Gleichgültiges fortwerfen. So kann der einfachste und gewöhnlichste Vorgang in begabten Menschen die größte Bedeutung erlangen. Menschen, die für den Konservatismus wenig Sinn haben, die mit Leichtigkeit die Gefühle und Gedanken, die einst in ihnen gelebt, abschütteln können, beweisen damit doch zweifellos nur ihre geringe Feinfühligkeit, die Schwäche ihres Herzensgedächtnisses. Sie lassen sich gewöhnlich von ihrer Energie fortreißen, und darin liegt ihre Rechtfertigung; doch das Schädliche des Nichtverstehens, der Verachtung, der Vergewaltigung drängt sich unvermeidlich in ihre Tätigkeit und entstellt oft eine Tat, die für den edelsten Zweck ausgeführt wird.
Dostojewski war von Natur konservativ. In ihm vollzog sich mächtig, doch schnell der Prozeß, der fast unterschiedslos die Entwicklung aller bedeutenden russischen Schriftsteller charakterisiert. Zuerst begeistern sie sich für abstrakte Gedanken, für Ideale, die sie vom Westen übernehmen, dann kommt es zum inneren Kampf und zur Enttäuschung, bis schließlich die zeitweilig unterdrückten Gefühle, die Liebe zu dem Heiligtum, das Rußlands Leben und Stärke ausmacht, erwachen. Auch Dostojewski gab es auf, nach höheren, führenden Ideen im Westen zu suchen, doch bewahrte er trotzdem Liebe und Verehrung für das europäische Geistesleben. Anderseits vermochte gerade er in der Ausbreitung des extremen Westlertums, das sich Nihilismus nennt, die Wurzel dieser entarteten Bestrebungen zu entdecken, und er verstand und bedauerte auch diese verirrten Seelen. Sein Blick, der nicht nur alle Gegensätze, sondern auch die Möglichkeit eines Ausgleichs der Gegensätze sah, diese feine und tiefe Sympathie, mit der er die beiden Pole unseres geistigen Lebens umfaßte und sie zu einem höheren Lebensprinzip und durch die Tat zu vereinigen suchte – das war der charakteristische Zug Dostojewskis. Seine Feindschaft gegen etwas bedeutete bei ihm nie eine bedingungslose Verneinung des Feindlichen.
Und gerade diese seine Fähigkeit des versöhnenden Verstehens und Mitempfindens war es, die in seiner Rede zur Puschkinfeier zum Ausdruck kam und die Bestrebungen der Westler und der Slawophilen als auf ein und dasselbe höhere Ziel gerichtet zu deuten verstand. Da war es kein Wunder, daß Begeisterung die alten Gegner erfaßte und sie sich in diesem Augenblick versöhnt die Hände reichten.
Nach der Puschkinfeier, die ihm den größten und schönsten seiner literarischen Erfolge verschaffte, blieb ihm nicht mehr viel Zeit zum Leben – kaum acht Monate. Doch gerade diese letzte Zeit verbrachte er in der größten Tätigkeit. Außer der Erläuterung und Verteidigung seiner Moskauer Rede schrieb er in dieser zweiten Hälfte des Jahres 1880 den Schluß der „Brüder Karamasoff“, und noch bevor dieser im „Russischen Boten“ veröffentlicht war, lasen wir bereits die Anzeige, daß im nächsten Jahr das „Tagebuch“ wieder in jedem Monat erscheinen werde. Der Druck der Januarnummer war fast schon beendet, als der Tod seiner fieberhaften Tätigkeit ein Ende setzte.
Für diejenigen, die ihn näher kannten, kam sein Tod eigentlich nicht überraschend. Er lebte augenscheinlich nur noch von den Nerven, denn sein Körper hatte schon einen solchen Grad von Abgezehrtheit erreicht, daß ihn der erste, geringste Stoß zerbrechen konnte. Am erstaunlichsten war dabei seine Unermüdlichkeit in der geistigen Arbeit, obgleich ihm das Arbeiten, wie er mir selbst einmal sagte, schwer fiel und er zum Schreiben eines Druckbogens zweimal oder dreimal mehr Zeit brauchte als früher. Außerdem wurde er in den letzten Jahren, besonders seit der Herausgabe des „Tagebuchs“, mit Briefen überschüttet und von Besuchern zu Tode erschöpft. Aus allen Ecken und Enden von Petersburg kam man zu ihm, oft mit Bitten um Unterstützung, da er Armen stets half und für fremdes Unglück immer Teilnahme hatte. Doch ebensooft kam man zu ihm mit Gewissensfragen, oder um seine Ansichten zu widerlegen, oder um ihm Verehrung zu bezeugen. Von derselben Art waren auch die Briefe, die er aus allen Gegenden Rußlands erhielt. Seine Popularität freute ihn. Er sah darin Beweise, daß seine Worte nicht ungehört verklangen. Das freute ihn sehr, denn er hielt es für seine Pflicht, Menschen zu ermutigen und zum Guten zu lenken. Besonders aufmerksam verhielt er sich zur Jugend, zu Studenten und Studentinnen. War doch der „bekehrte Nihilist“ sein Thema, das er liebte, und nicht nur in „Rodion Raskolnikoff“ hat er es ausgearbeitet, wir finden es auch in allen seinen folgenden Werken wieder. Deshalb ist es verständlich, daß die Jugend sich so zu ihm hingezogen fühlte.
Er war sehr streng gegen sich selbst und von nahezu übertriebener Gewissenhaftigkeit. Er erlaubte sich nicht nur keine häßliche oder böse Handlung, sondern verzieh sich nicht einmal eine häßliche oder böse Empfindung. Man kann sagen, daß er sich in seinem Leben wie in der Arbeit beständig selbst erzog, nur die besten Gefühle in sich entwickelte und in seinen Handlungen nicht nur tadellos und uneigennützig war, sondern sogar bis zur Selbstverleugnung ging. Obgleich er von seiner Begabung eine sehr hohe Meinung hatte – und wohl mit Recht –, so hat er sich doch nie abseits von der ganzen großen Menge der Schreibenden gestellt, nie hochmütig auf die Tagesliteratur herabgesehen. Dieses Fehlen selbst des geringsten literarischen Aristokratismus war sogar rührend. Er wußte, daß er, wenn er in die Öffentlichkeit trat, wie es jeder Schriftsteller tut, damit auf den Markt, auf die Straße hinaustrat, doch es fiel ihm nicht ein, sich seines Handwerks oder seiner Handwerksgenossen zu schämen, denn er wußte nur zu gut, daß das, was er auf den Markt hinaustrug und den Lesern anbot, unermeßlich höher war als Geld und Geldeswert. Er war stolz auf sein Handwerk, es war für ihn etwas Großes, Heiliges – und diese Auffassung kann uns vieles in seinem Verhalten erklären. Denn er wußte, was er tat, wenn er seine Seele auf die Straße trug.
In den letzten neun Jahren seines Lebens litt Fjodor Michailowitsch an einem Emphysem, das er sich durch eine Erkältung zugezogen hatte. Der tödliche Ausgang dieser Krankheit trat durch das Zerreißen einer Lungenarterie ein. Es begann in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar mit einem Nasenbluten, dem er weiter keine Beachtung schenkte. Am 26. fühlte er sich offenbar ganz wohl, bis um vier Uhr nachmittags plötzlich ein Blutsturz erfolgte und anderthalb Stunden darauf ein zweiter, wobei der Kranke das Bewußtsein verlor. Als er wieder zu sich kam, äußerte er sofort den Wunsch, zu beichten und das Abendmahl zu nehmen. In Erwartung des Priesters nahm er Abschied von seiner Frau und seinen Kindern und segnete sie. Nach dem Abendmahl fühlte er sich vollkommen wohl. Am 28. Januar hatte er um zwölf Uhr mittags wieder einen Blutsturz, worauf seine Kräfte schnell abnahmen.
In entscheidenden Augenblicken seines Lebens pflegte Fjodor Michailowitsch die Bibel, die er in seiner Sträflingszeit bei sich gehabt, aufs Geratewohl aufzuschlagen und die ersten Zeilen der aufgeschlagenen Seite zu lesen. So tat er es auch jetzt: er schlug die Bibel auf und bat seine Frau, ihm die aufgeschlagene Stelle vorzulesen. Es war das der vierzehnte Vers aus dem dritten Kapitel Matthäi: „Johannes wehrete ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von dir getauft werde; und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Halte mich nicht auf; also gebühret es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.“ Als er diese Worte hörte, sagte er zu seiner Frau:
„Hörst du? – ‚halte mich nicht auf‘ – also werde ich sterben.“ Und er schloß das Buch.
Sein Vorgefühl sollte recht behalten. Er verschied am 29. Januar um acht Uhr achtunddreißig Minuten abends.
Die Beerdigung Dostojewskis wurde zum Anlaß einer Kundgebung, die alle in Erstaunen setzte. Einen solchen Andrang von Menschen, so zahllose Beweise von Trauer und Verehrung hatten selbst die leidenschaftlichsten Anhänger des Toten nicht erwartet. Man kann wohl behaupten, daß es eine solche Beerdigung in Rußland noch nie gegeben hat. Dabei muß man nicht vergessen, daß Dostojewski ganz unerwartet starb, daß viele von seinem Ableben erst spät erfuhren, so daß in der kurzen Zeit bis zu seiner Beerdigung irgendwelche Verabredungen nicht möglich waren. So handelte jeder Verein, jede Schule aus eigenem Antrieb und jede der zweiundsiebzig Deputationen, jeder der fünfzehn Sängerchöre unabhängig von den anderen.
Und so einfach, so selbstverständlich, so ruhig und feierlich vollzog sich alles. In der Kirche des Heiligen Geistes war nicht nur der Sarg auf dem hohen Katafalk mit Blumen und Kränzen vollständig bedeckt, es standen auch noch ringsum und hingen sogar an den Wänden riesige Kränze, die der Kirche eine ganz besondere, eigenartige, weihevolle Stimmung verliehen. Das Gedränge war groß, doch nichtsdestoweniger herrschte vollkommene Stille. Durch die Ehrung, die man dem toten Schriftsteller erwies – und an der sich alle beteiligten, so daß neben dem Riesenkranz der Petersburger Studenten, den Kränzen der Großfürsten und Großfürstinnen, die bescheidenen Blümchen der Bettler und der ärmsten Kinder lagen –, wurde es erst sichtbar, wie ungeheuer groß der Kreis seiner Anhänger war, und sowohl seine Nächsten wie seine Anhänger selbst waren überrascht, als sie sahen, daß die Zahl seiner Verehrer so unübersehbar war. In der ganzen Stadt begannen später erregte Debatten über die Bedeutung und die Ursache dieser Kundgebung. Personen, die zu Mißtrauen neigten und zur Literatur sich gleichgültig verhielten, behaupteten, diese ungeheuere Menschenmenge habe nur den Wunsch gehabt, den ehemaligen Sträfling zu ehren und dabei ihren Protest gegen die Regierung auszudrücken; andere jedoch, die mit der Literatur besser bekannt und selbst Anhänger fortschrittlicher Ideen waren, kamen der Wahrheit schon näher, wenn sie zu ihrem Leidwesen feststellten, daß diese Liebe und Hingebung dem „Patrioten“ gegolten, was ihrer Meinung nach ein Beweis von Rückständigkeit war. Und schließlich gab es noch eine dritte sonderbare Auslegung, die alles darauf zurückführte, daß Dostojewski, wie sie sagten, der Darsteller alles Dunkeln und aller Schrecken des russischen Lebens gewesen sei, jedoch nicht wie Gogol darüber gelacht, sondern geweint habe.
Unter den Tausenden, die dem Toten das letzte Geleit gaben, werden natürlich Vertreter der verschiedensten Anschauungen gewesen sein, doch die Hauptmasse war entschieden von ganz anderen Gefühlen beherrscht: die beerdigte in Dostojewski ihren Erzieher, ihren Lehrer, den, der zu ihr gesagt hatte: „Demütige dich, stolzer Mensch! Arbeite, müßiger Mensch!“ Alle, die nach einer sittlichen Stütze suchten, sahen in ihm einen Führer, der ihnen die Wege zeigte, auf denen man die Rettung suchen kann und muß. Man achtete und liebte in ihm nicht nur den Patrioten und Konservativen; für viele war er auch ein Trost und eine Hoffnung, und das nicht nur deshalb, weil er die revolutionären Umtriebe gegeißelt und bekämpft hatte, sondern weil er die höchsten, rein geistigen Interessen der russischen Menschen verstand, weil in seinen Worten sich nicht nur religiöse Stimmung, aufrichtige Liebe zum Volk offenbarte, sondern vor allem deshalb, weil ihm unsere staatliche Macht teuer war, teuer unsere volkliche Einheit und unsere politische Aufgabe, für die wir seit jeher soviel geopfert haben und noch jederzeit zu opfern bereit sind.
Gewiß wird es in der ungeheuren Menge, die ihm zum Grabe folgte und in der so viel Jugend vertreten war, auch viele bekehrte und unbekehrte Nihilisten gegeben haben. Denn Dostojewski, der ihre Verirrungen so scharf rügte, verstand die Verirrten doch so tief wie kein anderer, und er war es auch, der ihnen wieder den richtigen Weg wies. Aber zweifellos gab es unter ihnen auch solche, die uns die Hoffnung geben, daß wir dieses große Übel überwinden werden. In dem großen Toten hatte diese Hoffnung wie ein Feuer gebrannt und er hatte in dem Glauben gelebt, daß er für diese rettenden Ansätze arbeitete.
Sein Tod war nicht der Tod eines verdienten Künstlers, der in Ruhe seine Tage zu Ende gelebt, sondern der Tod eines politischen Kämpfers am Vorabend seiner letzten glühenden Rede, die am Tage vor seiner Beerdigung erschien.
Wenn wir die Entwicklung Dostojewskis verfolgen, so sehen wir, daß mit ihm dasselbe geschah, was nun schon seit dem achtzehnten Jahrhundert mit allen unseren großen Schriftstellern geschehen ist: alle begannen sie damit, daß sie sich für das Fremde begeisterten, und alle kehrten sie später zum Eigenen zurück. So war es zum Teil mit Vonwisin und so geschah es sehr ausgesprochen bei Karamsin, Gribojedoff, Puschkin und Gogol. Dostojewski ist in dieser Beziehung ein neues Ärgernis für unsere Westler, ein neuer und wichtiger Grund für sie, über unsere russische Literatur aufgebracht zu sein.
Diese innere Umkehr, die sich in den Besten von uns vollzieht, wird oft Verrat und Abtrünnigkeit genannt; doch gerade bei Dostojewski ist am deutlichsten zu sehen, daß es sich hierbei nur um Entwicklung handelt, um die Aufdeckung der Anlagen, die in der Natur des Menschen liegen, nicht aber um einen Eintausch fremder Gedanken gegen andere fremde Gedanken. Dostojewski ist von seinem ersten bis zu seinem letzten Werk ein und derselbe; er konnte sich nicht verändern, denn schon in seinem ersten Werk ist seine ganze Seele zu erkennen, die ganze Art seiner Lebensauffassung. Von der Natur dieser Seele hing es ab, welche Einflüsse auf sie einwirkten. Und diese Einflüsse waren: die russische Literatur und das russische einfache Volk.
Als ich Dostojewski kennen lernte, war er ein glühender Verehrer Puschkins und Gogols. Diese beiden Riesen unserer Literatur spiegeln sich schon in seinem ersten Werk „Arme Leute“ in bemerkenswerter Weise wieder. Hier finden wir es unmißverständlich ausgedrückt, daß der Autor mit Gogol nicht ganz zufrieden ist und nur in Puschkin seinen unmittelbaren Führer sieht. Der kleine Beamte Makar Djewuschkin, der Held in „Arme Leute“, der auffallend an Gogols Held im „Mantel“ und in den „Aufzeichnungen eines Irrsinnigen“ erinnert, ist sehr eingenommen von Puschkins „Stationsaufseher“. Er kann die Novelle nicht genug loben und bedauert sehr den armen Helden der Erzählung. Bald darauf liest er aber Gogols Novelle „Der Mantel“, und die macht auf ihn einen geradezu niederschmetternden Eindruck. Er ist aufs tiefste verletzt, da er in dieser schonungslosen Darstellung sich selbst erkennt, er betrinkt sich vor Leid und es widerfährt ihm infolgedessen ein Unglück nach dem anderen. So wird denn die schonungslose Ironie Gogols als gar zu grausame und herzlose Darstellung der Menschen vom Autor verurteilt. Und noch mehr wird sie verurteilt durch die Art, wie Djewuschkin selbst geschildert ist. Während in den Gestalten Gogols nur grauenvolle Leere und Gemeinheit zu sehen ist, besitzt dieser Makar Djewuschkin Schätze an Zartheit und Selbstverleugnung, und Herzenszüge, deren Schönheit er selbst nicht einmal ahnt. Während niemand Gogols Akakij Akakijewitsch oder Poprischtschin sein wollte, muß jeder Leser mit Neid auf den unglücklichen Makar Djewuschkin blicken und sich gestehen, daß zwischen dieser seelischen Schönheit und seiner eigenen Seele ein weiter Abstand ist.
Das war Dostojewskis erster Schritt, im Jahre 1846 – eine kühne und entschlossene Korrektur Gogols. Es war das zugleich eine entscheidende Wendung in unserer Literatur. Ihre Bedeutung lag darin, daß die Korrektur Gogols unentbehrlich war, daß unsere Literatur sie unbedingt ausführen mußte und sie auch noch bis zum heutigen Tage ausführt, daß man in gewissem Sinne auch alle unsere anderen großen Schriftsteller, Ostrowski, wie L. N. Tolstoi, eine Korrektur Gogols nennen und darin ihre größte Originalität sehen kann. Dostojewski aber begann sie als erster.
Gogol hat sich nicht grundlos gequält, nicht grundlos alle seine Kräfte angespannt, um etwas Neues zu schaffen. Diese gespannt feinfühlige Stimmung, in der sich die Gemeinheit des Seienden so deutlich Gogol offenbarte, war am Ende unerträglich. Ein unüberwindlicher Ekel erhob sich in ihm bei der Betrachtung des russischen Lebens, dieses Lebens, in dem alles Gute sich schamhaft und hartnäckig in der Tiefe verbirgt, während das Gemeine und Schmutzige auf der Oberfläche paradiert und allen in die Augen springt. Gewiß hat Gogol die „heimlichen Tränen“ vergossen, von denen er spricht; aber das waren Tränen des Mitleids eines ekstatischen Idealisten, nicht aber Tränen der Liebe. Und je mehr wir in den Sinn der ganzen Literatur nach Gogol, die mit Dostojewski beginnt, eindringen, um so klarer erkennen wir Gogols Grundfehler und die ganze dringende Notwendigkeit, die unsere neueren Schriftsteller empfanden – die Einseitigkeit zu vermeiden und einen neuen Weg einzuschlagen.
Zweifellos wird man Dostojewskis Werke einmal anders auslegen; man wird aus ihnen Schlüsse ziehen und mit ihnen Gefühle nähren, die Dostojewskis wahren Gedanken und Gefühlen aufs tiefste widersprechen. Unsere Intelligenz hat sich gar zu sehr daran gewöhnt, in gewissen Geleisen zu denken. Es gibt zwei Gefühle, die für das Seelenleben unserer gebildeten Leute außer den täglichen Lebensinteressen gewöhnlich bestimmend sind: das eine davon ist das Gefühl des Unwillens, des sogenannten edlen Unwillens über jegliches Böse und Gemeine in Rußland; das andere ist das Gefühl des Mitleids mit Rußland, ein mitleidvolles Erkennen seiner Armseligkeit und seines tragischen Loses. Beide Gefühle sind sehr gut, jedoch zum Unglück nur durch einen gar zu dünnen Strich von schlechten Gefühlen getrennt: der Unwille grenzt an Erbitterung und das Mitleid an Selbstüberhebung, so daß oft Menschen, die sich anscheinend beständig edelster Stimmung hingeben, im Grunde nur ihre schlechten Eigenschaften nähren und nur aus ihnen ihren ganzen Edelsinn schöpfen. Von Dostojewski kann ich dagegen mit aller Bestimmtheit bezeugen, daß ihn niemals auch nur entfernt die Achtung vor seinem großen Vaterlande verlassen hat und der Unwille bei ihm niemals zur Erbitterung geworden ist. In dieser Hinsicht ist er für uns alle ein Beispiel. Man bedenke doch nur, wieviel er unter den bestehenden Verhältnissen zu leiden hatte! Und dennoch war nach allem, was er ausgestanden, nicht die leiseste Erbitterung in ihm und ebensowenig maßte er sich ein Recht auf die Autorität an, die die Gesellschaft bei uns so gern denen zuspricht, die gelitten haben, oder die die Märtyrer sich oft eigenmächtig beimessen. Überhaupt war an ihm die Entwicklung der Persönlichkeit, die ungewöhnliche seelische Energie auffallend. Ich habe ihn in den schwersten Stunden gesehen, doch niemals ließ er den Mut sinken, ja ich glaube sogar, daß man solche Umstände gar nicht ersinnen könnte, unter denen er wirklich zusammengebrochen wäre. So spricht er denn aus seiner eigenen Seele, wenn er einen seiner Helden, Dmitri Karamasoff, sagen läßt: „... ich habe soviel Kraft in mir, daß ich alles besiegen werde, alles werde ich überwinden, alles Leid, nur um mir immer wieder sagen zu können: Ich bin! Unter tausend Qualen – ich bin! Wenn ich mich auch auf der Folterbank krümme – aber ich bin!“ Es war in ihm ein unerschöpflicher Kräftevorrat, der nach jedem Nachlassen und sogar Sinken seines Schaffens sich immer wieder von neuem zu noch höheren Schöpfungen emporschwang. Es war dabei etwas Rätselhaftes in ihm. Neue Gestalten, neue Pläne tauchten beständig vor ihm auf, belagerten ihn geradezu und störten ihn bei der Arbeit. Deshalb sind auch einzelne seiner Romane ganze Knäule durcheinandergeflochtener, verwickelter Themen.
Und so schildert er denn unermüdlich seine Gestalten, macht sie aber nicht wie Viktor Hugo zu Theaterhelden, läßt sie weder Wunder, noch Heldentaten vollbringen. Er hält sich unentwegt an den strengen Realismus, der das Vermächtnis Gogols war, aber selbst unter der größten Verkommenheit versteht er noch menschliche Züge zu entdecken. Dabei ist in jeder Schilderung Dostojewskis soviel Wahrheit, eine solche Tiefe seelischer Wahrheit enthalten, daß man den unmittelbaren Eindruck der Wirklichkeit selbst zu erleben glaubt. Der Fieberzustand seines Idioten, die Qualen eines Verbrechers oder eines Selbstmörders, Fieberträume, Hallucinationen – alles ist verständlich und klar wiedergegeben. Der Leser verfolgt mit Spannung die Gedanken und Gefühle von Personen, von denen er früher überhaupt keine Vorstellung hatte, und sieht mit Verwunderung, daß diese Gedanken und Gefühle in der eigenen Seele einen Widerhall finden.
Leid, Verzweiflung, Verbrechen, Krankheit – das sind die stets wiederkehrenden Themen Dostojewskis. Aber was ist denn ihr Sinn, welches ist ihr Ergebnis? Etwa wieder Mutlosigkeit und Bitterkeit? O nein, sondern Verzeihen und Liebe. Das ist der herrschende Gedanke, den er so glühend und unerschrocken in seinem letzten Roman („Die Brüder Karamasoff“) offen ausspricht. In diesem Ideal Christi fand er die Rechtfertigung seiner beständigen Liebe zum einfachen russischen Volk und fand er den höheren Sinn seiner ganzen, großen, heißen Vaterlandsliebe. Die Liebe zum einfachen Volk, zum Erdboden, wie er es nannte, ist eine bedeutungsvolle Erscheinung in unserer Literatur überhaupt. Die Erkenntnis der geistigen Schönheit und geistigen Gesundheit, die das Volk sich erhalten hat, während wir sie eingebüßt haben, hat bei uns schon lange begonnen und wächst mit jedem Tage. Einem Menschen aber wie Dostojewski, der mit solcher Liebe Volkstypen geschildert hat (bereits in seinen „Aufzeichnungen aus einem Totenhause“) – einem solchen Menschen konnte der Hauptnerv des Volkslebens natürlich nicht verborgen bleiben: Das hohe Ideal der Heiligkeit. Zu diesem Ideal streben sowohl unsere einfältigsten Seelen, wie unsere größten Geister, die bisweilen lange auf anderen Wegen umherirren, bevor sie diesen Weg finden. Wir wissen bereits, daß das Ideal Christi zum höchsten Ideal auch unseres anderen großen Dichters geworden ist – des Grafen L. N. Tolstoi. Die Zusammenhänge sind bei ihm dieselben wie bei Dostojewski. Auch er hat mit dem ganzen volklichen Verstehen seines großen künstlerischen Gefühls in langer, liebevoller Beobachtung des Volkes dessen Ideal erkannt. Diese Übereinstimmung mit Dostojewski ist auffallend. Persönlich kannten sie sich nicht, doch hatten sie in der letzten Zeit immer die Absicht, sich kennen zu lernen. Ich erlaube mir, einige Zeilen aus einem Brief Tolstois, den ich im September des vorigen Jahres von ihm erhielt, hier anzuführen. Er schreibt:
„Ich verstehe nicht das Leben derjenigen Menschen in Moskau, die es selbst nicht verstehen. Aber das Leben der Mehrzahl – der Bauern, der Pilger und noch mancher Leute, die selbst ihr Leben verstehen – verstehe auch ich und liebe es über alles. Ich fahre fort, dafür zu arbeiten und wie mir scheint, nicht fruchtlos. Unlängst fühlte ich mich nicht wohl und da nahm ich ‚das Totenhaus‘ zur Hand. Ich hatte vieles vergessen, da las ich es nun wieder, und ich muß sagen, ich kenne kein besseres Buch in der ganzen neuen Literatur, Puschkin nicht ausgenommen. Nicht der Ton, sondern der Standpunkt ist ein so natürlicher, wahrer und christlicher. Es ist ein gutes, belehrendes Buch. Ich hatte gestern den ganzen Tag eine Freude daran, wie ich mich lange nicht gefreut habe. Wenn Sie Dostojewski sehen, so sagen Sie ihm, daß ich ihn liebe.“
(26. Sept. 1880).
Ich brachte diesen Brief Fjodor Michailowitsch, und das war einer der schönsten Augenblicke für ihn, und auch für mich als Zeugen.
So findet denn in der Liebe zum Volk, aus der sich eine treue Ergebenheit zum Volksideal entwickelt, das Schaffen unserer zwei besten Künstler des Wortes seine Vollendung.
Hieraus offenbart sich uns am deutlichsten der Sinn der Schöpfungen Dostojewskis. Außer seiner allgemeinen Sympathie zu allen „Erniedrigten und Beleidigten“, hatte er, besonders in der zweiten Hälfte seines Schaffens, noch eine bestimmte Aufgabe: die kranken Seiten unserer vom Volk losgerissenen Gesellschaft aufzudecken. Er zeigt uns zwei Arten von Typen: die „Nihilisten“, die sich in den letzten Jahrzehnten bei uns entwickelt haben, und die älteren Typen der „vierziger Jahre“. So spielt in seinem letzten Roman das Drama zwischen dem alten Karamasoff, der die Anschauungen der vierziger Jahre teilt, und seinen Söhnen, Iwan und Ssmerdjäkoff, dem Nihilisten. Mit unvergleichlicher Tiefe und Feinheit zeichnet Dostojewski die Entartung dieser Seelen durch unsere sogenannte Aufklärung. Sowohl hier wie in seinen anderen Romanen gehört sein größeres Mitgefühl der jungen Generation, eben Iwan, in dem die ernste, aufrichtige Überzeugungstreue – wenn auch die Überzeugungen falsch sind – so dargestellt ist, daß sie zu Dichtung und Großartigkeit wird. Am wenigsten schonte Dostojewski die Menschen der „vierziger Jahre“, was aus seinen Werken nur zu deutlich hervorgeht; es ist geradezu, als könne er ihnen nicht mehr vergeben, und so machte er sie entweder lächerlich, wie z. B. Stepan Trofimowitsch in den „Dämonen“, oder ekelhaft abstoßend, wie Fjodor Pawlowitsch Karamasoff, der gleichsam aus dem Leben ausgeschnitten erscheint. Zu den Nihilisten aber verhielt er sich, man kann sagen, mit väterlichem Kummer, mit väterlichem Mitgefühl. Und unsere junge Generation begriff allmählich, mit welch einem Herzen er sich zu ihr wandte und antwortete ihm mit Bezeugungen ihres Herzens.
In seinem letzten großen Roman hat Dostojewski klarer als in allen anderen Romanen auch die positive Seite Rußlands gezeigt. Rußland besteht doch nicht nur aus entarteten Westlern, wie der alte Karamasoff einer ist, – und aus gedanklich so maßlos vermessenen Nihilisten wie sein Sohn Iwan. Durch den unglücklichen Diener Ssmerdjäkoff ist der Vatermord geschehen, dessen Schuld zu gleichen Teilen auf den Vater dieses Dieners wie auf seinen Halbbruder Iwan fallen muß, der diese bedauernswerte Kreatur irregeführt hat. Doch außer ihnen gibt es noch Dmitri Karamasoff, den gewöhnlichen Russen, den barbarischen Recken, in dem viel Böses, aber auch viel Gutes ist, und der bereit ist, für die Schuld der anderen zu büßen. Auch hat uns Dostojewski noch im jungen Aljoscha Hinweise gegeben, die wie Verheißungen für die Zukunft sind. Und der Liebling des Dichters, Iwan Karamasoff, der in der Seele, im Geiste den Vater erschlagen hat, wie die Nihilisten im Geiste Rußland erschlagen wollen, Iwan wird von seinem Gewissen wie vom Donner gerührt, und wenn er die Krankheit übersteht, wird er zur Besinnung kommen und ein anderer Mensch werden. Das sollten wir nicht vergessen und auch uns danach richten.
So seien wir denn stark und mutig wie Dmitri Karamasoff, der sich durch kein Unglück brechen läßt; lernen wir es, fremde Schuld zu tragen und zu verzeihen, denn es ist wahr, was er sagt: „Alle sind für alle schuldig.“ Das sind Züge des wahren russischen Geistes, des Geistes, in dem das ganze Rußland lebt und wächst und stark ist. Lernen wir es, Rußland mit dieser Liebe zu lieben, die in den „Brüdern Karamasoff“ atmet, und auf unsere Heimat nicht wie ihre Sklaven mit einem Gefühl der Erniedrigung zu blicken, und auch nicht mit Überhebung wie ihre Herren und Lehrer, sondern mit dem Gefühl, mit welchem Söhne auf ihre Mutter sehen. Versuchen wir, „aufzuerstehen“, wie Dmitri Karamasoff träumt, und, wie er sagt, einen „neuen Menschen“ in uns zu erziehen, um ein Recht auf die Stellung des Sohnes zu unserer Mutter zu haben: auf daß das Ideal der Christlichkeit, das die Seele unseres großen Landes erfüllt, auch zu unserem Ideale werde. Ich denke, dies ist es, was Dostojewskis großes Vermächtnis uns gebietet.
N. N. Strachoff.
Über die literarische Tätigkeit Dostojewskis, soweit sie als Material für Band 12 der Ausgabe in Betracht kam, über die Beteiligung und Herausgeberschaft des Dichters an den verschiedenen Zeitschriften, in denen er seine kritischen Arbeiten veröffentlichte, gibt die Einleitung von N. N. Strachoff die nähere Auskunft. Strachoff (geboren im Jahre 1828 zu Belgorod im Gouvernement Kursk, Literaturhistoriker, Naturwissenschaftler und Philosoph) war Dostojewskis Freund. Seine Arbeit über den Dichter, die den vollen Reiz der persönlichen Anteilnahme an Dostojewskis Entwicklung wie Lebensgang hat, wurde dem Bande in Übersetzung beigegeben, weil sie unmittelbarer, als es jede geschichtliche Rückschau heute könnte, in das literarische Milieu des jungen Rußland einführt, dem Dostojewski angehörte und über das er sich schließlich führend erhob. Die Nähe, in der Strachoff zu der Welt des Nihilismus, aber auch des Antinihilismus und hier zu der politischen Partei der Slawophilen stand, zeigt die Welt, aus der Dostojewski hervorging und macht sie, die zunächst so überaus ideologisch erscheint, mit einer Fülle von biographischen und psychologischen Einzelzügen erst menschlich-begreiflich und darüber hinaus für unser modern-politisches Verständnis Dostojewskis ungemein wertvoll.
Die Lebensgeschichte Dostojewskis von seiner Kindheit bis zu seiner Rückkehr aus Sibirien und dem Beginn seiner publizistischen Tätigkeit (1821–1860), die der ihm gleichfalls befreundet gewesene Literaturhistoriker Orest Miller sogleich nach dem Tode Dostojewskis verfaßt hat, wurde dem vorhergehenden Bande der Deutschen Gesamtausgabe, Bd. XI, zugewiesen. Strachoffs Überblick über die letzten zwei Jahrzehnte Dostojewskis (1860–1881) ist von ihm als Fortsetzung jener Biographie der ersten Lebenshälfte Dostojewskis von Miller gedacht und in einem von ihnen gemeinsam herausgegebenen Bande 1883 erschienen.
Die Entstehung der im vorliegenden Bande vereinigten Aufsätze Dostojewskis fällt in die Jahre 1861–1880. Die Aufsätze von 1861 sind in der von seinem Bruder und ihm damals herausgegebenen Monatsschrift „Die Zeit“ erschienen; die von 1873 in der Zeitschrift „Der Bürger“, deren Redakteur er ein Jahr lang war; die von 1876–1880 in den von ihm allein herausgegebenen Monatsheften „Das Tagebuch eines Schriftstellers“. Die Gedanken aus seinem Notizbuch stammen aus seinem letzten Lebensjahr.
Der Text wurde in Auswahl und – soweit es die Notwendigkeit mit sich brachte, Dostojewskis Wiederholungen zu vermeiden – in Kürzung vorgelegt.
E. K. R.
Die Rede zur Puschkinfeier ist mit diesem Vorwort und einer Antwort auf die Angriffe eines Westlers im August 1880 in einem einzelnen Heft veröffentlicht worden. Vgl. Seite 5.
Meine Rede über Puschkin und seine Bedeutung habe ich am 8. Juni dieses Jahres in einer feierlichen Versammlung der „Freunde russischer Dichtung“ vor zahlreicher Zuhörerschaft gehalten und sie hat einen nicht geringen Eindruck gemacht. Iwan Ssergejewitsch Aksakoff, der bei dieser Gelegenheit von sich sagte, daß ihn alle gewissermaßen für den Führer der Slawophilen hielten, meinte in seiner Ansprache, daß meine Rede geradezu „ein Ereignis“ gewesen sei. Ich erwähne dies nicht, um mich etwa selbst zu loben, sondern einzig und allein um folgendes zu erklären: Wenn meine Rede tatsächlich ein Ereignis gewesen ist, so war sie das nur von dem einen Gesichtspunkte aus, den ich hier in einem besonderen Vorwort klarlegen möchte, denn nur aus diesem Grunde habe ich das Vorwort zu schreiben unternommen. Was jedoch meine Rede selbst anbetrifft, so wollte ich in ihr lediglich die vier folgenden Punkte der Bedeutung Puschkins für Rußland auseinandersetzen:
1. Daß Puschkin der erste gewesen ist, der mit seinem tiefen, durchschauenden und hochbegnadeten Geiste und aus seinem echt russischen Herzen heraus die bedeutungsvolle krankhafte Erscheinung in unserer Intelligenz, unserer vom Boden losgerissenen Gesellschaft, die sich hoch über dem Volk stehend dünkt, entdeckt und als das erkannt hat, was sie ist. Er hat sie erkannt und hat es vermocht, den Typ unseres negativen russischen Menschen plastisch vor unsere Augen zu stellen: den Menschen, der keine Ruhe hat und der sich mit nichts Bestehendem zufrieden geben kann, der an seinen Heimatboden und an die Kräfte dieses Heimatbodens nicht glaubt, der Rußland und sich selbst (oder richtiger seine Gesellschaftsklasse, die ganze Schicht der Intelligenz, zu der auch er gehört, und die sich von unserem Volksboden gelöst hat) im letzten Grunde verneint, der mit seinen Volksgenossen nichts gemein haben will und der unter all dem doch aufrichtig leidet. Puschkins Aleko[10] und Onegin haben eine Menge solcher Gestalten, wie sie selbst sind, in unserer Literatur hervorgerufen. Ihnen folgten Petschorin[11], Tschitschikoff, Rudin, Lawretzkij und Bolkonskij[12] und unzählige andere, die allein schon durch ihr Erscheinen die Richtigkeit der von Puschkin erfaßten Tatsache bezeugten. Ihm, Puschkin, und seiner großen Einsicht wie Genialität, gebührt daher die Ehre und der Ruhm, die allergefährlichste Wunde der bei uns nach Peters folgenschwerer Reform entstandenen Gesellschaft, unserer sogenannten Intelligenz, aufgedeckt zu haben. Seiner intuitiven Diagnose verdanken wir die Erkenntnis und Feststellung unserer Krankheit. Und nicht zuletzt ist er es auch gewesen, der uns als erster einen Trost gegeben hat: denn von ihm ist uns gleichzeitig diese große Hoffnung gekommen, daß unsere Krankheit nicht tödlich zu sein braucht, daß vielmehr die russische Gesellschaft sehr wohl noch einmal gesunden kann und daß sie noch immer die Möglichkeit hat, sich zu erneuern und aufzuerstehen, wofern es ihr nur gelingt, sich dem Volksgeist wieder anzuschließen, denn
2. er, Puschkin, hat uns als erster (gerade als erster, und vor ihm niemand) die künstlerischen Typen einer russischen Schönheit gegeben, dieser Schönheit, die unmittelbar aus der russischen Seele hervorgegangen ist, die sich in unserem Volksgeist offenbart, überall in unserem Boden, und die er, Puschkin, dort denn auch gesucht und gefunden hat. Das bezeugt die Gestalt der Tatjana in „Eugen Onegin“, diese echt russische Frau, die sich vor all der eingeschleppten Lüge zu bewahren gewußt hat, das bezeugen ferner seine historischen Gestalten, wie der Mönch Pimen und andere in seinem Drama „Boris Godunoff“, diese unmittelbar aus dem Leben genommenen und so überaus wahren Gestalten in dem Roman „Die Hauptmannstochter“ und noch viele, viele andere Typen, die von ihm in seinen Balladen, Gedichten, Erzählungen, Aufzeichnungen und sogar in seiner „Geschichte des Pugatschoffschen Aufstandes“ unsterblich gemacht worden sind. Die Hauptsache aber, die man besonders unterstreichen muß, ist, daß alle diese Typen in ihrer unleugbar vorhandenen Schönheit des russischen Menschen und seiner Seele – ganz und ausschließlich unserem Volksgeist entnommen sind. Hier muß man schon die ganze Wahrheit sagen: nicht in unserer gegenwärtigen Zivilisation, nicht in unserer sogenannten „europäischen“ Bildung (die es bei uns, nebenbei bemerkt, noch niemals wirklich gegeben hat), nicht in den Ungeheuerlichkeiten äußerlich angeeigneter europäischer Ideen und Formen hat Puschkin uns diese Schönheit gezeigt, sondern einzig im russischen Volksgeiste hat sie sich ihm offenbart und zwar, wie gesagt, in ihm allein. Deshalb hat er uns denn – ich wiederhole es – mit seiner Feststellung der Krankheit auch die große Zuversicht geben dürfen, wie man sie in die Worte zusammenfassen kann: „Glaubt an den Volksgeist, von ihm allein erwartet eure Rettung und sie wird euch werden!“ Puschkin verstehen wollen – und nicht diesen Schluß aus ihm ziehen – nein, das ist unmöglich.
Der dritte Punkt, den ich in der Bedeutung Puschkins feststellen wollte, ist jene besondere, allercharakteristischste und bei keinem anderen Genie außer ihm vorhandene Eigenart des künstlerischen Schöpfertums: ich meine die Fähigkeit, sich in den Geist einer jeden fremden Nation vollkommen hineinzuversetzen, ja sogar sich selbst in einen geistigen Vertreter jeder Nation zu verwandeln und im Geiste der Fremden schöpferisch zu werden. Ich sagte in meiner Rede, daß es in Europa die größten künstlerischen Weltgenies gegeben hat, wie Shakespeare, Cervantes, Schiller, doch kann man bei keinem einzigen von ihnen diese Fähigkeit wahrnehmen – wir sehen sie nur bei Puschkin. Und nicht etwa nur das Sichhineinversetzen, das bloße Verstehen der anderen ist hier das Bedeutungsvolle, sondern gerade die erstaunliche Vollkommenheit der Verwandlung. Diese Fähigkeit konnte ich in meiner Rede über die Bedeutung Puschkins natürlich nicht außer acht lassen, denn sie ist nun einmal die charakteristische Eigenheit seines Genies, eine Eigenart, die von allen Künstlern der Welt nur er allein hat, und durch die er sich denn auch von ihnen allen unterscheidet. Wenn ich dies sage, dann geschieht es natürlich nicht, um solche Größen unter den europäischen Genies, wie Shakespeare und Schiller, herabzusetzen: einen so lächerlich dummen Schluß könnte aus meiner Rede wirklich nur ein Dummkopf ziehen. Der Universalismus, die Allgemeinverständlichkeit und die unerforschliche Tiefe der Welttypen des Menschen arischer Rasse, die Shakespeare für alle Zeiten gegeben hat, sind von mir nicht einen Augenblick in Frage gestellt worden. Und wenn Shakespeare in seinem Othello wirklich einen venezianischen Mohr und nicht einen Engländer dargestellt hätte, dann würde er ihm nur den Nimbus einer örtlichen nationalen Charakteristik verliehen haben, die Weltbedeutung dieses Typus jedoch wäre ganz dieselbe geblieben, denn auch im Italiener hätte er das, was er ausdrücken wollte, ebenso und mit derselben Kraft ausgedrückt. Wie gesagt: nicht die Weltbedeutung Shakespeares und Schillers habe ich herabziehen wollen, indem ich die geniale Fähigkeit Puschkins, sich in den Geist fremder Nationen zu versetzen, hervorhob, sondern ich tat es bloß in dem Wunsch, den gerade in dieser Fähigkeit und in ihrer Vollkommenheit enthaltenen großen und prophetischen Hinweis für uns Russen klarzulegen – denn
4) diese Fähigkeit ist ganz entschieden eine russische Nationaleigenschaft: Puschkin teilt sie mit unserem ganzen Volk und er ist als vollendeter Künstler zugleich derjenige, der am vollendetsten diese Fähigkeit zum Ausdruck bringt, wenigstens in seinem Werk, seinem künstlerischen Schaffen. Unser ganzes Volk trägt diese Neigung, sich in den Geist anderer Völker zu versetzen, und somit die Neigung zur Allversöhnung, in seiner Seele und hat das in den zwei Jahrhunderten nach der Reform Peters auch schon mehr als einmal bewiesen. Da ich nun aber auf diese Fähigkeit unseres Volkes hinwies – wie sollte ich da nicht auch auf die in ihr enthaltene große Beruhigung hinweisen, die sie uns auf unsere Frage nach unserer Zukunft als Antwort gibt, auf diese große und vielleicht größte aller Volkshoffnungen, die leuchtend vor uns steht! So sprach ich denn aus, daß unser Streben nach Europa, mit allen seinen Übertreibungen und Ausartungen, in seinem letzten Grunde nicht nur berechtigt, sondern auch volkstümlich ist, und daß es sich mit dem Trieb des Volksgeistes vollkommen deckt und zweifellos auch etwas in sich birgt, das einen höheren Zweck verfolgt. In meiner kurzen, leider gar zu kurzen Rede konnte ich diesen Gedanken natürlich nicht genügend entwickeln, doch glaube ich trotzdem, daß das, was ich gesagt habe, nicht mißzuverstehen ist. Und wozu, ja: wozu sich darüber empören, daß, wie ich sagte, „unser bettelarmes Land vielleicht zu guter Letzt der ganzen Welt ein neues Wort sagen wird?“ Und wie lächerlich, darauf hinzuweisen, daß wir uns, bevor wir der Welt ein neues Wort sagen könnten, doch „erst ökonomisch, wissenschaftlich und staatlich entwickeln müssen“, und daß wir erst dann daran denken könnten, „neue Worte“ so (angeblich) vollendeten Organismen, wie es die Völker Europas sind, von uns aus zu sagen. Ich habe es ja in meiner Rede ausdrücklich betont, daß mir nichts ferner liegt, als das russische Volk in Dingen seiner ökonomischen oder wissenschaftlichen Errungenschaften mit den Völkern des Westens auch nur vergleichen zu wollen. Ich sage ganz einfach, daß von allen Völkern Europas das russische Volk am fähigsten ist, die Idee der allmenschlichen Einigung, der Nächstenliebe, der unparteiischen Beurteilung, die das Feindliche verzeiht, das Ungleiche unterscheidet und entschuldigt, die Widersprüche aufhebt, in sich aufzunehmen. Das ist kein „ökonomischer“, sondern ein rein ethischer Zug, und wer könnte bezweifeln oder verneinen, daß er im russischen Volk vorhanden ist? Oder wer dürfte sagen, daß das russische Volk nur eine immerfort duldende träge Masse sei, dazu bestimmt, nur „ökonomisch“ dem Gedeihen und der Entwicklung unserer Intelligenz zu dienen, die sich da hoch über dem Volk erhebt, daß aber dieses Volk selbst in sich nur tote duldsame Tatlosigkeit trüge, von der man nichts zu erwarten habe, weshalb denn auch gar kein Grund vorhanden sei, irgendwelche Hoffnungen auf dieses Volk der Menge zu setzen? Es ist traurig genug, sagen zu müssen, daß sogar sehr viele in Rußland einer solchen Ansicht sind und daß sie ihren Standpunkt noch dazu mit Eifer verfechten. Und nun habe ich gewagt, etwas ganz anderes auszusprechen.
Ich wiederhole, daß ich „diese meine Phantasie“, wie ich mich ausdrückte, nicht eingehender, nicht mit der notwendigen Ausführlichkeit habe erklären und ihre Richtigkeit beweisen können – und doch konnte ich nicht unterlassen, auf sie hinzuweisen. So ohne weiteres zu behaupten, daß unser armes und unschönes Land nichts von derartig hohen Trieben in sich schließen könne, bevor es nicht „ökonomisch“ und „staatlich“ dem Westen ähnlich geworden sei – das ist einfach unsinnig. Die fundamentalen ethischen Geistesgüter hängen – wenigstens in ihrem Wesensgrunde – nicht von der ökonomischen Leistungsfähigkeit eines Volkes ab. Unser ganzes armes und unansehnliches Land steht da, immer abgesehen von seiner oberen Schicht, einmütig wie ein Mann! Alle achtzig Millionen seiner Bevölkerung stellen eine geistige Einheit dar, wie sie in Europa nirgends zu finden ist und auch gar nicht zu finden sein kann: folglich ist es schon aus diesem Grunde unmöglich, zu sagen, unser Land sei unbedeutend, ja, im strengen Sinne des Wortes, noch nicht einmal arm vermag man es zu nennen. Im Gegenteil, in Europa, in diesem Europa, wo soviel Reichtümer zusammengescharrt sind – in Frankreich z. B., in England! – ist der ganze Staatsbau bei allen diesen Nationen untergraben und wird vielleicht morgen einstürzen, um dann etwas beispiellos Neuem, das an nichts Dagewesenes gemahnt, Platz zu machen. Und alle diese Reichtümer, die Europa aufgehäuft hat, werden es nicht vor dem Sturz bewahren können, denn „in einem Augenblick wird aller Reichtum verschwunden und vernichtet sein“. Und dieser, gerade dieser untergrabene Staatsbau, diese infizierte Bourgeoisie wird unserem Volk nun als einzig zu erstrebendes Ideal vor Augen gehalten, und erst wenn dies Ideal einmal von ihm erreicht sein sollte, sagt man, dürfe es wagen, daran zu denken, den Europäern irgendein Wort zu stammeln. Dagegen behaupten wir, daß dieses Volk eine in Liebe allversöhnende und allvereinende Geisteskraft auch unter den gegenwärtigen ökonomischen Verhältnissen besitzen und in seinem Innersten erhalten kann, ja, es kann das sogar in Zeiten, die noch weit schlimmer als die jetzigen der Armut sind: es hat das sogar in der Zeit nach dem Einfall der Tataren ins Land[13] und in der wüsten Zeit des Interregnums[14] gekonnt, bis Rußland ausschließlich vom eigenen und einigen Volksgeist gerettet wurde. Und schließlich: selbst wenn es wirklich so unbedingt notwendig sein sollte zur Erlangung des Rechtes, die Menschheit zu lieben, eine alles vereinende Seele und die Fähigkeit zu besitzen, nicht fremde Völker deshalb zu hassen, weil sie nicht so sind, wie wir, und den Wunsch zu haben, nicht sich in der eigenen Nationalität von allen anderen abzuschließen und sich gegen sie zu verschanzen, damit nur das eigene Volk alles bekäme, während man die anderen Völker für so etwas wie Zitronen hält, aus denen sich Saft herauspressen läßt (und Völker von diesem Nationalcharakter gibt es doch in Europa!) – wenn es auch wirklich, sage ich, zur Erlangung alles dessen notwendig sein sollte, zunächst ein reiches Volk zu werden und die Verfassung europäischer Staaten bei uns einzuführen, muß dann deshalb, so fragt es sich, alles unbedingt sklavisch nachgeahmt und, sogar einschließlich der Bourgeoisie (die dort, wie gesagt, vielleicht morgen schon stürzen wird), bei uns eingeführt werden? Wird man denn wirklich auch hierin dem russischen Organismus nicht gestatten, sich national zu entwickeln, durch die eigene organische Kraft? oder muß es wirklich unbedingt ein ganz unpersönliches und lakaienhaftes Kopieren Europas sein? Ja, aber: was soll man denn mit dem russischen Organismus anfangen? Begreifen diese Herren überhaupt, was ein Organismus ist? Und dabei reden sie doch so klug über die Naturwissenschaften! – „Das wird das Volk nicht zulassen“, sagte vor etwa zwei Jahren jemand im Gespräch zu einem überzeugten Westler. – „Dann muß man es beseitigen!“ versetzte darauf der Westler gelassen und erhaben. Und das war nicht „irgendeiner“, das war vielmehr ein – Repräsentant unserer Intelligenz. Diese Geschichte ist nicht erfunden, denn sie ist leider – von mir erlebt.
Mit den angeführten vier Punkten wollte ich Puschkins Bedeutung für uns feststellen, und meine Rede hat also, wie bereits erwähnt, Eindruck gemacht. Nicht durch irgendwelche besonderen Vorzüge (ich betone das ausdrücklich) und nicht durch talentvollen Vortrag (darin gebe ich allen meinen Gegnern vollkommen recht, denn wirklich, ich will mich nicht loben), sondern durch ihre Aufrichtigkeit hat sie den Eindruck gemacht und – ich sage es dreist – durch die Richtigkeit der von mir hervorgehobenen Tatsachen, die eben überzeugen mußten, ungeachtet der Kürze und Unvollkommenheit meiner Rede. Aber worin, fragt es sich, bestand denn das „Ereignis“, wie Iwan Ssergejewitsch Aksakoff es nannte?
Das „Ereignis“ war die Tatsache, daß von den Slawophilen oder der sogenannten russischen Partei (Gott, es gibt bei uns eine „russische Partei“!) ein großer und vielleicht entscheidender Schritt zur Versöhnung mit den Westlern gemacht wurde, denn die Slawophilen haben damit die Berechtigung anerkannt, die in dem Streben der Westler nach Europa liegen könnte; haben sogar die Berechtigung aller Übertreibungen und ihrer unsinnigsten theoretischen Folgerungen anerkannt, haben sich für diese Berechtigung mit dem echt russischen, unserem Volk so eigentümlichen Trieb erklärt, der unsrer ganzen geistigen Veranlagung nur zu sehr entspricht, die Übertreibungen selbst aber haben sie als historische Notwendigkeiten angesehen und als ein Fatum gerechtfertigt, so daß, wenn man einmal die Summe ziehen sollte, es sich herausstellen würde, daß die Westler in demselben Maße ihrem Vaterlande und der Richtung seines Geistes gedient haben, wie alle jene echt russischen Leute, die aufrichtig ihre Heimat lieben und sie vielleicht nur gar zu eifersüchtig vor der Europa-Begeisterung aller „russischen Ausländer“ zu bewahren suchen. Und zum Schluß wurde in dieser Rede erklärt, daß alle Gegensätze, aller Widerstreit und alle Feindseligkeiten zwischen den beiden Parteien bisher überhaupt nur ein großes Mißverständnis gewesen sind. Diese Erklärungen in ihrer Gesamtheit dürften nun wohl das gewesen sein, was man meinetwegen ein „Ereignis“ nennen kann, denn die Repräsentanten der Slawophilenpartei waren nach meiner Rede mit allen ihren Folgerungen durchaus einverstanden. Ich möchte jetzt nur noch darauf hinweisen – was übrigens auch schon in meiner Rede geschehen ist –, daß die Ehre, diesen ersten Schritt getan zu haben (wenn der aufrichtige Wunsch, eine Versöhnung herbeizuführen, zur Ehre gereicht), daß das Verdienst, dieses neue Wort, wenn man es so bezeichnen will, verkündet zu haben, durchaus nicht mir allein zukommt, sondern dem ganzen Slawophilentum, dem Geist und der Richtung unserer ganzen „Partei“, daß ferner das Gesagte von jeher allen jenen klar gewesen ist, die unparteiisch das Slawophilentum zu erfassen suchten, und daß der Gedanke, den ich ausgesprochen, von ihnen schon früher, wenn auch nicht gerade wörtlich, in dieser Weise ausgedrückt, so doch dem Sinne nach angedeutet worden ist. Ich aber habe nichts weiter getan, als daß ich ihn im richtigen Moment aussprach.
Und nun die Folge: sollten jetzt die Westler unsere Folgerung annehmen und sich mit ihr einverstanden erklären, so würden ja allerdings wirklich alle Mißverständnisse zwischen den beiden Parteien beseitigt sein, und die Westler und Slawophilen hätten tatsächlich „keinen Stoff mehr zum Streit“, wie I. S. Aksakoff sich ausdrückte, „da jetzt alles erklärt ist“. Unter diesem Gesichtspunkt wäre meine Rede freilich „ein Ereignis“ gewesen. Aber das Wort „Ereignis“ ist doch wohl nur in der ersten Begeisterung von der einen Partei ausgesprochen, ob aber auch die andere Partei es anerkennen oder ob die Forderung nur ein Ideal bleiben wird, das ist eine ganz andere Frage. Neben den Slawophilen, die mich dort in ihre Arme schlossen und mir die Hände schüttelten, kaum daß ich die Rednertribüne verlassen hatte, kamen auch Westler auf mich zu, um mir auch ihrerseits fest die Hand zu drücken, und zwar waren es nicht so irgendwelche, sondern gerade die Führer der Parteien, oder doch diejenigen, welche gerade jetzt die beinahe entscheidende Rolle in ihr spielen. Und ihr Händedruck war ebenso heiß und sprach von ebenso aufrichtigem Beifall wie der der Slawophilen, und sie nannten meine Rede genial, und taten das mehr als einmal und hoben immer wieder ihre Bedeutung hervor. Aber ich fürchte, ich fürchte aufrichtig: geschah das nicht alles nur im ersten Augenblick des Mitgerissenseins?! Oh, nicht das fürchte ich, daß sie nachträglich ihre Meinung, meine Rede sei genial gewesen, ändern könnten! Ich weiß es ja selbst, daß sie nicht genial war, und fühlte mich auch durch ihr Lob keineswegs geschmeichelt, weshalb ich ihnen von ganzem Herzen ihre Meinungsänderung bezüglich meiner Genialität verzeihen würde. Es ist etwas anderes, was ich befürchte. Es wäre nämlich möglich, daß die Westler (ich meine nicht jene, die mir die Hand schüttelten, sondern die Westler im allgemeinen, was vorausgeschickt sei), daß die Westler also, wenn sie erst einmal über das dort Ausgesprochene nachdenken, ungefähr folgendes sagen könnten: „Aha!“ werden sie vielleicht sagen (übrigens sage ich ausdrücklich „vielleicht“, nichts Bestimmteres), „da haben sie nun nach langem Streit und Hader endlich doch zugegeben, daß unser Streben nach Europa berechtigt und natürlich ist! Sie haben eingesehen, daß auf unserer Seite dasselbe Recht besteht, das sie bis jetzt nur für sich in Anspruch nahmen, und haben nun ihre Fahnen endlich vor uns gesenkt. Nun, wir nehmen Ihre Anerkennung mit Vergnügen an, meine Herren, und beeilen uns, Ihnen zu erklären, daß das von Ihrer Seite sogar sehr nett ist: es verrät wenigstens einen gewissen Verstand, den wir Ihnen übrigens auch nie abgesprochen haben, mit Ausnahme vielleicht der Stumpfsinnigsten unter unseren Parteigängern, für die alle wir nicht wohl einstehen können – aber ... Sehen Sie mal, hier sitzt nun wieder ein gewisser neuer Haken, weshalb man denn diesen Punkt möglichst schnell klarlegen müßte. Die Sache ist nämlich die, daß Ihre These, unser Zug nach Europa stimme durchaus mit dem Volksgeist überein, ja, sei sogar metaphysisch als sein unmittelbarer Ausdruck zu erklären – daß diese Ihre Behauptung also für uns doch von mehr als fragwürdiger Richtigkeit bleibt, womit dann die Möglichkeit einer Versöhnung zwischen uns wiederum ausgeschlossen ist. Lassen Sie es sich gesagt sein, daß wir uns allerdings von Europa, von der europäischen Wissenschaft und von der Reform Peters haben lenken lassen, keineswegs aber vom Geist unseres Volkes, sintemal wir diesen Geist noch nicht zu entdecken vermocht haben und er uns auf unserem Wege auch noch nie begegnet ist – was etwa von ihm irgendwo vorhanden sein sollte, das haben wir hinter uns liegen lassen und sind schleunigst von ihm fortgeeilt. Wir sind von Anfang an selbständig unseren Weg gegangen und haben uns durchaus nicht von irgendeinem angeblichen Trieb des russischen Volkes, seiner universalen Aufnahmefähigkeit oder seiner Neigung zur Versöhnung aller nationalen Gegensätze treiben lassen – kurz, es ist nichts von dem geschehen, worüber Sie jetzt so viele Worte verloren haben. Im russischen Volk – da es nun einmal zur Sprache gekommen ist, wollen wir es ganz aufrichtig aussprechen – sehen wir nach wie vor nur eine passive Masse, von der wir nichts zu lernen haben, die vielmehr nur die Entwicklung Rußlands – im fortschrittlichen Sinne – hemmt und die man umgestalten und umschaffen muß: wenn nicht organisch, was leider nicht möglich ist, so doch wenigstens mechanisch, d. h. indem man sie einfach zwingt, ein für allemal zwingt, uns zu gehorchen. Um aber diesen Gehorsam zu erreichen, ist es eben erforderlich, bei uns genau dieselbe bürgerliche Organisation einzuführen, wie sie in den europäischen Staaten bereits vorhanden ist. An und für sich ist unser Volk arm und gemein, wie es das von jeher gewesen, und kann weder ein Ansehen noch eine Idee haben. Die ganze Geschichte unseres Volkes ist eine Ungereimtheit, aus der Sie aber bisher weiß der Teufel was für Schlüsse gezogen haben. Nur wir allein haben uns den nüchternen Blick bewahrt und das Volk richtig eingeschätzt. Ein Volk, wie das unsrige, darf keine Geschichte haben, und das, was es bis jetzt für seine Geschichte hält, muß von ihm mit Abscheu vergessen werden, jawohl, restlos vergessen werden. Eine Geschichte haben – das dürfen nur wir, die Intelligenz, der das Volk einzig mit seiner Arbeit und Kraft zu dienen hat.“
„Übrigens erlauben Sie, regen Sie sich wegen unserer Einwände nicht auf und unterbrechen Sie uns nicht: nicht zu unseren Leibeigenen wollen wir unser Volk machen, wenn wir von seinem Gehorsam sprechen, o nein, natürlich nicht! Ziehen Sie, bitte, nicht so falsche Schlüsse! Wir sind human, wir sind Europäer: das wissen Sie ja nur zu gut. Im Gegenteil, wir wollen unser Volk allmählich bilden, regelrecht bilden, und unser Werk damit krönen, daß wir das Volk allmählich bis zu uns erheben und seine Nationalität in eine andere verwandeln, in irgendeine, die sich dann schon von selbst einstellen wird, wenn die Nation nur erst einmal richtig gebildet ist. Seine Bildung aber werden wir darauf gründen und damit beginnen, womit wir selber begonnen haben: mit der Verleugnung unserer Vergangenheit und einem Fluch auf unsere ganze Geschichte. Haben wir einem Mann aus dem Volke erst das Lesen und Schreiben beigebracht, so geben wir ihm gleich darauf Europa zu riechen, und dann umstricken wir ihn vollends mit – nun, sagen wir, mit den feinen Sitten, den Kleidern, Getränken und französischen Tänzen. Mit einem Wort, wir zwingen ihn, sich seines früheren Bastschuhs und seines selbstgebrauten ‚Kwas‘[15] zu schämen, desgleichen seiner alten Lieder – und wenn es auch unter letzteren einzelne musikalisch sehr schöne geben mag, was wir ja gar nicht in Abrede stellen wollen, dann werden wir ihn doch zwingen, Couplets zu singen, wie sehr Sie sich darüber auch ärgern sollten. Kurz, um den guten Zweck zu erreichen, werden wir mit allen nur möglichen Mitteln zunächst die schwachen Seiten seines Charakters beeinflussen, ganz wie das ja auch mit uns geschehen ist, und schließlich wird dann das Volk – unser sein. Es wird sich seiner Vergangenheit selbst schämen und sie verfluchen. Wer das hinter ihm Liegende verflucht, der gehört bereits zu uns. Das ist unsere Formel! Und nach dieser Formel werden wir vorgehen, wenn wir uns daran machen, das Volk zu uns zu erheben. Sollte das Volk sich aber als unfähig zur Bildung erweisen, dann ja, dann muß man es beseitigen. In dem Fall wäre eben der Beweis dafür erbracht, daß unser Volk nur eine unwürdige, barbarische Herde ist, mit der man wirklich nichts anderes anfangen kann, als daß man sie zum Gehorsam zwingt. Denn was sollte man sonst mit ihm anfangen? – ist doch nur bei unserer Intelligenz und in Europa die Wahrheit! Wenn es bei uns auch achtzig Millionen Volk gibt (womit Sie übrigens dem Anscheine nach ein wenig zu prahlen belieben), so haben alle diese Millionen doch nur dann einen Lebenszweck, wenn sie dieser europäischen Wahrheit dienen, außer der es eine andere Wahrheit nun einmal nicht gibt und auch gar nicht geben kann. Mit der Menge aber, mit diesen achtzig Millionen, werden Sie uns nicht einschüchtern. So: und damit hätten wir Ihnen einmal gründlich unsere Meinung gesagt, diesmal in ganzer Nacktheit. Wir aber bleiben bei dem, was wir gesagt haben. Wir können doch nicht, wenn wir Ihre Folgerung annehmen, mit Ihnen – nun, zum Beispiel über so seltsame Dinge philosophieren, wie die Pravoslavie[16] und ihre angebliche und besondere Bedeutung! Wir hoffen vielmehr, daß Sie uns wenigstens dies nicht zumuten werden, namentlich nicht jetzt, in einem Augenblick, in dem das letzte Wort Europas, und das allgemeine Ergebnis der europäischen Wissenschaft, doch der Atheismus ist, ein aufgeklärter und humaner Atheismus! Wir aber – wir können doch nicht Europa etwa nicht folgen!! So sind wir denn meinetwegen bereit, jene Hälfte der bewußten Rede, in der Sie uns Beifall zollen, mit gewissen Einschränkungen gelten zu lassen – also sei’s drum, erweisen wir Ihnen diese Liebenswürdigkeit. Was aber die andere Hälfte betrifft, die, auf die Sie sich und alle diese Ihre ‚Grundlagen‘ beziehen – ja: da verzeihen Sie, da können wir nun nichts mehr annehmen und billigen!“
Eine so traurige Antwort auf meine Rede ist durchaus möglich. Doch wie gesagt: ich wage sie nicht nur nicht in den Mund jener Westler zu legen, die mir die Hand drückten, sondern nicht einmal in den Mund der vielen, sehr vielen Aufgeklärten, die trotz ihrer Theorien prächtige Russen sind und für ihr Vaterland arbeiten und als russische Bürger alle Achtung verdienen. Dafür aber wird die Masse, die Masse der Abtrünnigen, der von ihrem Erdboden Losgerissenen, die Masse der Westler, der Durchschnitt, die Straße, auf der man die Idee weiterschleift, – dieser ganze Pöbel der „Richtung“ (und der ist zahlreich wie Sand am Meer) oh, dieser Schlag Menschen wird unbedingt in ähnlicher Weise antworten, wenn er es nicht schon getan hat! (Notabene: In betreff des Glaubens zum Beispiel ist schon in einer Broschüre mit dem ganzen ihnen eigenen Scharfsinn erklärt worden, das Ziel der Slawophilen sei – ganz Europa zur Orthodoxie zu bekehren.) Doch verscheuchen wir diese schwarzen Gedanken und hoffen wir zunächst auf die Führer dieses „Europäertums“. Wenn sie auch nur die Hälfte unserer Ansichten und in sie gesetzten Hoffnungen zu den ihrigen machen, so sei ihnen auch hierfür Ehre und Ruhm, und wir werden sie mit Begeisterung begrüßen. Selbst wenn sie nur die eine Hälfte annehmen, d. h. wenn sie wenigstens die Selbständigkeit und Eigenart des russischen Geistes anerkennen, so wie die Rechtmäßigkeit seines Daseins und seine menschenfreundliche allversöhnende Neigung, so wird es auch fast nichts mehr geben, worüber wir noch zu streiten hätten, wenigstens nichts Grundsätzliches. Dann würde meine Rede allerdings so etwas wie den Grund zu einem neuen Ereignis gelegt haben. Nicht sie selbst – ich wiederhole es noch zum letztenmal – wäre das Ereignis gewesen (sie ist eine solche Bezeichnung nicht wert), sondern der große Triumph Puschkins, der die Veranlassung zu unserer Einigung gewesen wäre – einer Einigung aller wahrhaft gebildeten und aufrichtigen Russen für ein großes allumfassendes Zukunftsziel.
Vorgetragen am 8. Juni 1880 in der Versammlung des Vereins der „Freunde russischer Dichtung“.
„Puschkin ist eine außergewöhnliche Erscheinung und vielleicht der bisher einzige Ausdruck des russischen Geistes“, sagt Gogol. Ich füge von mir aus hinzu: und zwar ein prophetischer Ausdruck. Ja, in Puschkins Erscheinen liegt für uns alle, uns Russen, etwas zweifellos Prophetisches. Puschkin kam uns in einer Zeit, als sich zum ersten Male so etwas wie Selbsterkenntnis in unserer Gesellschaft hervorzuwagen begann, ein ganzes Jahrhundert nach der Reform Peters[18], und sein Erscheinen wirkte wie eine Überleuchtung unseres dunklen Weges mit neuem und bahnweisendem Licht. In diesem Sinne ist Puschkin in der Tat eine Prophezeiung und ein Programm zugleich.
Das Schaffen dieses großen Dichters teile ich in drei Perioden. Ich sage das nicht als Literaturkritiker: wenn ich von der schöpferischen Tätigkeit Puschkins rede, will ich nur meinen Satz von seiner prophetischen Bedeutung für Rußland klarlegen, und was ich unter diesem Ausdruck verstehe. Übrigens möchte ich hier vorausschicken, daß zwischen besagten drei Abschnitten seiner Entwicklung, wie mir scheint, keine festen Grenzen bestehen. Der Anfang des „Onegin“ zum Beispiel gehört meiner Ansicht nach noch in die erste Periode seines Schaffens, das Ende dagegen in die zweite, in der Puschkin seine Ideale in seinem eigenen Lande bereits gefunden, liebgewonnen und in seine große, weit ausschauende Seele aufgenommen hatte. Ferner: es ist üblich, zu sagen, daß Puschkin in der ersten Periode seines Schaffens europäische Dichter nachgeahmt habe, wie Parny, André Chénier und besonders Byron. Und es ist wahr: diese und andere Dichter Europas haben zweifellos einen großen Einfluß auf die Entwicklung seines Genies gehabt und haben diesen Einfluß wohl auch zeit seines Lebens behalten. Nichtsdestoweniger waren schon die ersten Dichtungen Puschkins keineswegs nur Nachahmungen, vielmehr verrät sich auch in ihnen schon die ungewöhnliche Selbständigkeit seines Genies. Aus Nachahmungen spricht nie ein so echter Schmerz, nie eine so tiefe Selbsterkenntnis, wie Puschkin sie z. B. in den „Zigeunern“ hat – in einem Poem, das ich durchaus noch zu seiner ersten Schaffensperiode rechne. Von seiner schöpferischen Kraft und von der mitreißenden Gewalt seiner Sprache ganz zu schweigen – nein, die hätte er wahrlich nicht gehabt, wenn er nur ein Nachahmer gewesen wäre. Die Gestalt des Aleko, des Helden dieses Poems, vertritt bereits einen großen und tiefen und echt russischen Gedanken, denselben, der später in so einheitlicher Vollendung im „Onegin“ ausgedrückt ist, wo uns fast derselbe Aleko entgegentritt, nur mit dem Unterschied, daß er dort nicht mehr in einer phantastischen Umgebung und in phantastischem Licht erscheint, sondern greifbar wirklich, wahrheitsgetreu und verständlich vor uns steht. Schon in Aleko hat Puschkin jenen Unglücklichen, der in seinem ganzen großen Vaterlande keinen festen Verbleib hat, jenen historischen russischen Märtyrer, dessen Erscheinen in unserer, vom Volk losgerissenen Gesellschaft – eben historisch betrachtet – so unvermeidlich war, in einer genialen Skizze festgehalten. Entdeckt aber hat er ihn wahrlich nicht nur in Byrons Werken! Dieser Typ ist fehlerlos erfaßt, ist eine von unseren stehenden Figuren und hat sich bei uns, in unserem russischen Vaterlande, seit langem und auf lange Zeit eingebürgert. Dieser russische „Skitáletz“[19] aus den höheren Gesellschaftskreisen setzt auch heute noch sein Leben fort, und ich glaube, er wird so bald nicht aussterben. Und wenn diese Naturen heutzutage nicht mehr Zigeunerlager aufsuchen, um in der wilden eigenartigen Lebensweise der Nomaden ihr Weltideal und im Schoße der Natur Ruhe und Erlösung von dem sinnlosen, verwirrenden Leben unserer russischen Gesellschaft zu finden, so werfen sie sich dafür dem Sozialismus in die Arme, den es zu Alekos Lebzeiten noch nicht gab – das heißt: sie gehen mit ihrem neuen Glauben nur auf einen fremden Acker, um dort mit Eifer auf ihre Weise zu arbeiten, geradeso überzeugt, wie Aleko es war, daß sie auf diesem ihrem phantastischen Arbeitsfeld das Glück nicht nur für sich selbst, sondern zugleich für die ganze Welt erlangen werden. Denn dieser russische Heimatlose bedarf nun einmal des allmenschlichen Glücks, um mit sich zur Ruhe kommen zu können: sonst, o nein, sonst gibt er sich nicht zufrieden – d. h. so lange tut er es nicht, wie es sich in der Sache nur um die Theorie handelt. Der „Skitaletz“ von heute wie der von damals sind noch ganz dieselben Russen, nur daß sie zu verschiedenen Zeiten geboren wurden. Dieser Menschenschlag ist, ich wiederhole es, gerade zu Anfang des zweiten Jahrhunderts nach der großen Reform Peters in unserer vom Volk und von der Volkskraft losgelösten Gesellschaft entstanden. Gewiß, eine riesige Mehrzahl der gebildeten Russen haben damals, zu Puschkins Zeiten, ebenso ihr Leben im Staatsdienst zugebracht, wie sie in unserer Zeit friedlich als Beamte weiter dienen, in den Renteien, auf den Eisenbahnen und in den Banken – oder sie verdienen sich ihr Geld durch andere Mittel, sie beschäftigen sich sogar mit Wissenschaft, geben Stunden, halten Vorträge und verrichten alles regelmäßig, faul, friedlich, leben von monatlichem Gehalt und kleinen Kartenpartien, ohne jede innere Anfechtung oder Neigung zur Flucht in ein Zigeunerlager, oder gleichviel wohin und welches Lager sich in unserer Zeit eben mehr dazu eignen würde. Viel, sehr viel ist es schon, wenn sie ein wenig die Liberalen spielen, „mit einem Schimmer von westeuropäischem Sozialismus“, dem aber ein gewisser russisch gutmütiger Charakter verliehen wird. Doch alles das ist nur ein Zeitunterschied. Was liegt daran, daß der eine noch nicht angefangen hat, sich zu beunruhigen, während der andere schon bei der verschlossenen Tür angelangt ist und sie mit dem Kopf auch bereits einzurennen versucht hat – natürlich vergeblich. Dasselbe erwartet sie alle – jeden zu seiner Zeit, wenn sie nicht den rettenden Weg betreten und sich bescheiden mit dem Volk vereinigen. Oder nicht einmal alle mag dasselbe erwarten: es genügen auch die „Auserwählten“, es genügt auch der zehnte Teil der aus der Ruhe Gekommenen, und die übrige große Mehrheit wird ebenfalls dank ihrer Unruhe keine Ruhe mehr finden. Aleko freilich versteht es noch nicht, seine Sehnsucht richtig auszudrücken: bei ihm ist alles gleichsam noch abstrakt. Er sehnt sich nach der Natur und klagt über die Gesellschaft, verspürt einen Drang, der sich irgendwie auf die ganze Welt bezieht, und trauert ob der vermeintlich irgendwo, irgendwann, durch irgendwen verlorenen Wahrheit, die er nun nirgends zu finden vermag. Hier ist, ersichtlich, ein bißchen Jean Jacques Rousseau zu spüren. Worin diese Wahrheit bestanden, wo und wie man sie wiederfinden könnte und wann sie verloren gegangen, das weiß er allerdings nicht zu sagen, aber er leidet aufrichtig. Vorläufig sehnt sich denn auch der phantastische unduldsame Mensch nur nach Erlösung von vornehmlich äußeren Erscheinungen. So muß es ja auch sein! Die Wahrheit ist für ihn irgendwo außerhalb seiner Person, vielleicht irgendwo in anderen Ländern, zum Beispiel in den europäischen, die alle ihren geschichtlich festgefügten Bau und eine bestimmte Ordnung in ihrem staatlichen wie gesellschaftlichen Leben besitzen. Und niemals wird er begreifen, daß die Wahrheit vor allen Dingen in ihm selbst sein muß, ganz innerlich, nur in ihm selbst – wie sollte er das auch anders verstehen? Er ist doch in seinem eigenen Lande ein Fremder, schon seit einem ganzen Jahrhundert hat er das Arbeiten verlernt, besitzt er nichts mehr von lebendiger Kultur, ist er wie ein Pensionsmädchen zwischen geschlossenen Wänden aufgewachsen. Die Pflichten, die er erfüllte, waren seltsam und willkürlich, je nach seiner Zugehörigkeit zu einer der vierzehn Rangklassen, in die unsere gebildete russische Gesellschaft eingeteilt ist. Er ist vorläufig nur ein losgerissenes und in der Luft schwebendes Stäubchen. Er fühlt das auch und leidet darunter oft sogar qualvoll! Nun, und schließlich – was hat es auch auf sich, daß er, der vielleicht zum russischen Geburtsadel gehört und sogar, was höchst wahrscheinlich ist, Leibeigene besitzt, mit der ganzen Freiheit seines Standes sich den kleinen phantastischen Einfall gestattet, an Menschen Gefallen zu finden, die „ohne Gesetz“ leben, um zeitweilig, wenn es sein soll, im Zigeunerlager einen Bären zu führen und ihn tanzen zu lassen? Am ehesten konnte ihm noch das Weib, „das Naturweib“, wie ein Dichter sich ausdrückt, die Hoffnung auf eine Erlösung von seiner Lebensqual verheißen: nichts ist infolgedessen selbstverständlicher, als daß er sich in leichtsinnigem, jedoch leidenschaftlichem Glauben in eine junge Zigeunerin verliebt. Es hieß das soviel wie: „Hier, nur hier finde ich den Ausweg, hier werde ich auch mein Glück finden, hier im Schoße der Natur, fern von aller Welt, hier unter diesen Menschen, die keine Zivilisation und keine Gesetze haben!“ Und was ist das Ergebnis? – schon bei seinem ersten Zusammenstoß mit den Bedingungen dieses freien Lebens hält er nicht stand und befleckt seine Hände mit Blut[20]. Nicht nur nicht zu einer allgemeinen Weltharmonie, nein, nicht einmal zum Leben in einer Zigeunerbande taugt der Unselige, und so jagen sie ihn denn fort – ohne Rache, ohne Bosheit, schlicht und nicht ohne Vornehmheit in ihrer einfachen Art. Der Alte sagt nur: „Verlaß uns, stolzer Mensch. Wir sind Zigeuner, haben kein Gesetz, wir richten nicht und lieben nicht, zu strafen.“
Das ist natürlich alles recht phantastisch, aber der „stolze Mensch“ ist Wahrheit und von dem Dichter ist er treffend geschildert. Denn: so erfaßt und dargestellt wurde er bei uns zum erstenmal von – Puschkin. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja alles so echt an ihm ... kaum geht ihm etwas wider den Strich, da bringt er auch schon in Wut zwei Menschen um und rächt sich sofort für die Kränkung. Noch bequemer freilich wäre es gewesen, sich seiner Zugehörigkeit zu einer der vierzehn Rangklassen zu erinnern und selber das richtende und marternde Gesetz anzurufen (denn auch das ist vorgekommen), damit nur ja seine persönliche Kränkung gerächt werde. Nein, diese wahrheitsgetreue Dichtung ist nicht eine Nachahmung, in ihr ist schon die russische Beantwortung unserer „Frage“, dieser „verfluchten Frage“ im Sinne des russischen Volksglaubens und der russischen Volkswahrheit angedeutet: „Beuge dich, stolzer Mensch, und brich vor allen Dingen erst deinen Hochmut. Beuge dich, müßiger Mensch und arbeite erst einmal auf deinem Acker!“ Denn das wäre in der Tat die Lösung des Problems nach der Rechtsauffassung des Volkes und der Volksvernunft. „Nicht außerhalb deiner ist die Wahrheit, sondern in dir selber, suche sie in dir, unterwirf dich dir, bemächtige dich deiner und du wirst die Wahrheit erkennen! Nicht in den äußeren Dingen ist die Wahrheit und nicht irgendwo fern hinter Bergen und Meeren, sondern vor allem in deiner Arbeit an dir selbst! Besiege dich, bezähme dich – und du wirst frei sein, wie du es dir noch nie erträumt hast. Beginnst du aber ein großes Werk, so machst du auch andere frei und wirst das Glück schauen. Dein Leben wird sich mit Inhalt füllen und du wirst endlich dein Volk und seine heilige Wahrheit begreifen. Weder bei Zigeunern noch sonstwo ist die Weltharmonie zu finden, wenn du selbst ihrer nicht wert bist, wenn du Bosheit und Hochmut in dir hast und das Leben umsonst haben willst, ohne auch nur zu ahnen, daß man für sein Leben zahlen muß.“
Diese Lösung des Problems ist in jener Dichtung Puschkins bereits angedeutet und beinahe vorgezeichnet. Viel klarer aber ist sie im „Eugen Onegin“ ausgedrückt, in diesem Roman, der nicht nur nicht phantastisch ist, sondern geradezu fühlbare Wirklichkeit, in dem das russische Leben mit so schöpferischer Kraft dargestellt ist und in einer so vollendeten Kunst, wie es sie vor Puschkin nicht gegeben hat und vielleicht nach ihm nicht wieder geben wird.
Onegin kommt aus Petersburg – unbedingt aus Petersburg, das ist zweifellos die erste Bedingung. Einen so wichtigen Umstand in der Lebensgeschichte seines Helden konnte Puschkin natürlich nicht übergehen. Und ich wiederhole, dieser Held ist derselbe Aleko, namentlich später, wenn er ausruft: „Warum lieg ich nicht gelähmt, wie in Tula der Assessor?“ Vorläufig jedoch, zu Anfang des Romans, ist er ein halber Geck und Gesellschaftsmensch und hat noch viel zu wenig gelebt, um vom Leben schon ganz und gar enttäuscht zu sein. Aber auch ihn beginnt bereits heimzusuchen und zu beunruhigen jener „vornehme Dämon heimlicher Qual“. In der Einsamkeit auf seinem Gut, im Herzen seiner Heimat ist er natürlich nicht „bei sich zu Hause“. Er fühlt sich da nicht heimisch. Er weiß nicht, was er dort anfangen soll und es kommt ihm vor, als wäre er bei sich selbst zu Gaste. Später, wenn er in seiner Langweile und Unzufriedenheit und inneren Unruhe im Vaterlande und in fremden Ländern von Ort zu Ort reist, fühlt er sich – als fraglos kluger und fraglos aufrichtiger Mensch, der er ist – auch unter den Fremden sich selber fremd. Freilich liebt auch er sein Land, aber er traut ihm nicht. Natürlich hat er von den einheimischen Idealen gehört, aber er glaubt nicht an diese Ideale. Er glaubt nur an die vollkommene Unmöglichkeit gleichviel welch einer Arbeit auf dem Heimatboden und blickt auf die, die an diese Möglichkeit glauben – deren es damals, wie auch jetzt, nur wenige gab – mit einem traurigen Spottlächeln herab. Lenskij[21], sein junger Freund, wird von ihm einfach aus Hypochondrie erschossen, vielleicht gerade infolge seiner Sehnsucht nach dem Friedensideal –, das wäre uns nur zu ähnlich, weshalb diese Erklärung denn auch die wahrscheinlich richtige ist. Wie anders dagegen Tatjana! Die ist ein starker Mensch, die steht fest und sicher auf ihrem Boden. Sie ist tiefer als Onegin, und natürlich auch klüger als er. Sie ahnt schon allein durch ihren feinen Sinn, wo die Wahrheit ist und worin sie besteht, was dann der Schluß des Romans bezeugt. Vielleicht wäre es besser gewesen, Puschkin hätte seinen Roman nach ihr „Tatjana Larina“ genannt, und nicht nach ihm „Jewgenij Onegin“, denn sie, nicht er, ist der Held. Sie ist ein bejahender Typ, nicht ein verneinender, wie er, sie ist ein Typ wahrhafter Schönheit, ist die Verherrlichung der russischen Frau – und sie ist es denn auch, die der Dichter den Grundgedanken seiner Dichtung in der berühmten Szene der letzten Begegnung Tatjanas mit Onegin aussprechen läßt. Ja, man kann sogar sagen, daß ein solches Urbild der russischen Frau, eine Heldin von solcher Schönheit, in unserem ganzen Schrifttum nicht wieder geschaffen worden ist – ausgenommen höchstens die Gestalt der Lisa in Turgenjeffs „Adelsnest“. – Nur die Angewohnheit, auf alles hochmütig herabzusehen, bringt Onegin dazu, daß er bei der ersten Begegnung auf dem weltfernen Gut ihrer Eltern überhaupt nicht sieht, wen er in der schüchternen Gestalt des reinen unschuldigen Mädchens vor sich hat, während sie sich schon bei dem ersten Blick auf ihn seltsam befangen fühlt. Er verstand eben nicht, in dem armen Mädchen die geistige Feinheit, die ganze Vollendung und Vollkommenheit ihres inneren Menschen zu erkennen und hielt sie vielleicht wirklich nur für einen „moralischen Embryo“. Sie – ein Embryo! und das noch nach ihrem Liebesbrief an ihn! Wenn jemand in diesem Roman ein moralischer Embryo ist, dann ist das wahrhaftig niemand anderes als er selbst, Onegin! Freilich, er konnte sie gar nicht erkennen: kennt er denn überhaupt die Menschenseele? Er ist ein abstrakter Mensch, ein unruhiger Träumer und bleibt es sein Leben lang. Auch später in Petersburg, wo er sie als vornehme Dame wiedersieht, begreift er sie nicht, obschon er ihr schreibt, daß seine Seele ihre ganze Schönheit fühle. Doch das sind nur Worte: sie geht an ihm und seinem Leben vorüber, von ihm unerkannt, unbegriffen! Darin besteht eben die Tragödie ihres Romans. Wäre dagegen damals, bei der ersten Begegnung mit ihr, Childe Harold, oder gar Lord Byron in eigener Person geradenwegs aus England auf dem Gut eingetroffen und hätte ihn auf den eigenartigen Reiz des schüchternen, jungen Mädchens aufmerksam gemacht – oh, da wäre Onegin sogleich von ihr betroffen und entzückt gewesen! Soviel geistiges Lakaientum steckt zuweilen in diesen Weltschmerzmärtyrern! Doch es geschah nicht, und Onegin, der die Weltharmonie sucht, begibt sich, infolgedessen, nachdem er Tatjana als Antwort auf ihren Brief eine Predigt gehalten und sich dabei immerhin noch sehr anständig benommen hat, mitsamt seinem Weltschmerz und dem aus kleinlich dummem Ärger vergossenen Blut auf dem Gewissen, auf Reisen – zunächst im eigenen Lande, doch offenbar ohne überhaupt zu bemerken, wo er sich befindet. Im Überschwang seiner vermeintlichen Gesundheit und Kraft ruft er unter Flüchen aus: „Jung bin ich, stark ist in mir das Leben!“ und doch weiß er nicht, worauf er wartet, was auf ihn wartet, und so bleibt ihm nichts als sein Weltschmerz.
Das begriff Tatjana. In den unsterblichen Versen des Romans erzählt der Dichter, wie sie das Haus dieses ihr so wunderbaren und rätselhaften Menschen besucht. Ich will hier nicht weiter von der unnachahmlichen Schönheit und Tiefe dieser Strophen reden. Sie betritt sein Zimmer, sie betrachtet seine Bücher, die Sachen, alle Gegenstände, bemüht sich, aus ihnen seine Seele zu erraten, ihre Rätsel zu lösen – und der „moralische Embryo“ bleibt schließlich mit einem seltsamen Lächeln nachdenklich stehen, wie in einer Vorahnung der Lösung des Problems, und ihre Lippen fragen leise:
„Oder sollte er – eine Parodie sein?“
Ja, sie mußte darauf verfallen, sie hatte das Geheimnis erraten. In Petersburg – lange Zeit nachher, nach der neuen Begegnung –, da kennt sie ihn bereits vollkommen. Übrigens, nebenbei hat jemand gesagt, daß das gesellschaftliche Leben bei Hofe verderblich ihre Seele beeinflußt habe und daß gerade die Würde der hochgestellten Dame und die neuen gesellschaftlichen Begriffe zum Teil die Ursache ihrer Absage an Onegin gewesen seien. Nein, so verhielt es sich nicht. Nein, sie ist auch als Fürstin dieselbe Tanjä, dieselbe, die sie dort auf dem Lande war! Sie ist nicht verdorben, im Gegenteil, sie fühlt sich bedrückt durch dieses prunkvolle Petersburger Leben; es ist für sie eine Last und ein Zwang, unter dem sie leidet; sie verabscheut ihre gesellschaftliche Stellung, und wer sie anders beurteilt, der begreift überhaupt nicht, was Puschkin ausdrücken wollte. Fest und ruhig sagt sie zu Onegin:
„... Doch bin ich einem andren angetraut
Und werd’ ihm ewig treu sein.“
Das sagt sie gerade als russische Frau, darin besteht die Verherrlichung derselben, die uns Puschkin mit ihrer Gestalt gegeben hat. Sie spricht die innere Wahrheit dieser Dichtung aus. Oh, ich sage kein Wort über ihre religiösen Ansichten, über ihre Auffassung der Heiligkeit der Ehe – nein, das werde ich nicht berühren. Aber wie denn: weigert sie sich deshalb, ihm zu folgen, obgleich sie ihm sagt: „Ich liebe Sie“ – deshalb etwa, weil sie „als russische Frau“ (und nicht als Südländerin oder irgendeine Französin) unfähig wäre zu einem mutigen Schritt, etwa weil sie nicht die Kraft hätte, ihre Fesseln zu zerreißen, und nicht stark genug wäre, das Gefeiertwerden, ihre gesellschaftliche Rolle, ihren Reichtum, den Ruf der Tugend zu opfern? Nein, die russische Frau ist mutig. Die russische Frau handelt furchtlos nach dem, was sie für richtig hält: das hat sie bewiesen. Aber Tatjana ist „einem anderen angetraut“, und diesem, dem sie nun einmal gehört, wird sie „ewig treu sein“. Aber wem denn, wem denn treu? Welchen Pflichten? Treu diesem alten General, den sie doch nicht lieben kann, da sie ja Onegin liebt, und den sie nur genommen, weil „die Mutter sie unter Tränen beschworen“? In ihrer verletzten, wunden Seele war damals weder Hoffnung noch Freude, sondern nichts als Verzweiflung. Also treu diesem alten General? Ja, treu diesem alten General, ihrem Mann, dem ehrlichen Menschen, der sie liebt, der sie achtet und stolz auf sie ist. Mag auch die Mutter sie beschworen und angefleht haben, aber sie, Tatjana selbst und keine andere hat das Jawort gegeben, sie, sie selbst hat ihm Treue geschworen. Mag sie ihn auch aus Verzweiflung genommen haben, jetzt ist er ihr Gatte, und ihr Treubruch würde ihn mit Schimpf und Schande bedecken, würde ihn vernichten. Und kann denn ein Mensch sein Glück auf dem Unglück eines anderen aufbauen? Das Glück liegt nicht allein in den Genüssen der Liebe, sondern auch in der höheren Harmonie des Geistes. Womit sollte man aber den Geist beruhigen, wenn hinter einem ein unehrenhafter, mitleidloser, fast unmenschlicher Schritt liegt? Sollte sie nur deshalb von ihm fliehen, weil es sich um ihr Glück handelte? Aber was kann denn das für ein Glück sein, das auf fremdem Unglück beruht? Nehmen wir an, daß Sie den Bau der Geschicke des Menschengeschlechts aufzuführen hätten, mit dem Ziel, die Menschen zu beglücken, ihnen zum Schluß Frieden und Ruhe zu geben. Nehmen Sie an, zu dem Zweck wäre es unbedingt erforderlich, im ganzen nur ein einziges menschliches Wesen zu Tode zu quälen – ja sagen wir, nicht einmal ein gar so wertvolles, meinetwegen sogar irgendein ganz lächerliches Wesen, also nicht etwa eine Figur aus Shakespeare, sondern – nun, sagen wir, einfach nur einen ehrenwerten alten Mann, den Gatten einer jungen Frau, an deren Liebe er in blinder Überzeugung glaubt, obgleich er ihr Herz gar nicht kennt, der sie aber ehrt und achtet, stolz auf sie ist, glücklich durch sie und ruhig. Und nur dieser eine Mensch muß entehrt und geschmäht und gequält werden, um auf den Tränen dieses Mannes den Glücksbau aufzuführen! Würden Sie da wohl einwilligen, der Baumeister dieses Gebäudes unter dieser einen Bedingung zu sein? Das ist die Frage. Vermöchten Sie auch nur einen Augenblick die Ansicht zu vertreten, daß die Menschen, für die Sie diesen Bau aufführen, einwilligen würden, dieses Glück von Ihnen anzunehmen, wenn Sie in das Fundament den Schmerz eines, zwar unbedeutenden, doch unverdientermaßen unbarmherzig zu Tode gequälten Menschen einmauerten, und daß die Menschen in diesem Glück ewig zufrieden sein könnten? Deshalb frage ich: konnte Tatjana in ihrer Reinheit und Vornehmheit und mit ihrem von eigenem Leid wehen Herzen sich überhaupt anders entschließen? Nein; denn eine reine russische Seele sagt sich in diesem Fall: „Mag ich allein das Glück entbehren, mag auch mein Unglück unvergleichlich größer sein als das Unglück dieses alten Mannes, mag auch niemand jemals erfahren, auch mein Mann nicht, daß ich mich geopfert habe, mag auch niemand mein Opfer schätzen, ich will doch nicht auf Kosten eines anderen glücklich sein!“ Das ist der Kern der Tragödie. Hier handelt es sich um ein Entweder – Oder, für ein Drittes ist es zu spät, und danach fällt denn die Antwort aus, die sie Onegin gibt. Nun wird man vielleicht einwenden: „Ja, aber auch Onegin ist doch unglücklich, den einen macht sie glücklich, den alten Mann, an den anderen aber, den jungen, und sein Unglück denkt sie nicht!“ Erlauben Sie, hier handelt es sich noch um eine andere Frage, vielleicht sogar um die wichtigste im Roman. Übrigens hat die Frage, warum Tatjana nicht Onegin folgt, bei uns, oder wenigstens in unserer Literaturkritik, eine besondere Geschichte, die sogar recht charakteristisch ist, deshalb habe ich mir auch nur erlaubt, mich über diese Frage so ausführlich zu verbreiten. Das Charakteristischste dürfte wohl sein, daß die moralische Lösung dieser Frage bei uns so lange allen Zweifeln ausgesetzt gewesen ist. Ich denke: selbst wenn Tatjana frei gewesen, wenn ihr Mann schon gestorben wäre, daß sie auch dann nicht Onegins Werben angenommen hätte. Man muß doch das ganze innere Wesen dieser Frau erfassen. Sie sieht doch, wer er ist: er, der ewig unstete Mensch, findet plötzlich die Frau, die er als junges Mädchen verschmäht hat, findet sie in einer neuen glänzenden Umgebung, – und diese Umgebung ist für ihn auch das Ausschlaggebende, ihre gesellschaftliche Rolle ist es, die ihn bestrickt. Vor diesem ehemaligen kleinen Mädchen, auf das er beinahe mit Verachtung herabsah oder doch mit Geringschätzung, beugt sich jetzt die Gesellschaft – die Gesellschaft, diese ungeheure Autorität in den Augen Onegins, ungeachtet aller seiner Weltschmerzen und Weltideale. Deshalb also, nur deshalb wirft er sich wie geblendet ihr zu Füßen! Endlich glaubt er, sein Ideal gefunden zu haben, seine Rettung, seine Erlösung von seiner Sehnsucht, die er früher nicht zu erkennen verstanden, und „das Glück war doch so möglich, so nah!“ ruft er aus. Wie Aleko zur jungen Zigeunerin, so strebt Onegin jetzt zu Tatjana, indem er in seinem neuen absonderlichen Einfall alle Lösungen seiner Probleme sucht. Und das sieht doch Tatjana, sie hat ihn doch schon längst durchschaut?! Sie weiß doch ganz genau, daß er im Grunde nur seine neue Einbildung liebt, und nicht sie, die ja dieselbe Tatjana geblieben ist, die sie früher war! Sie weiß, daß er sie für etwas ganz anderes hält als das, was sie ist, daß er sie nicht nur nicht liebt, sondern daß er sogar überhaupt nicht fähig ist, gleichviel wen, zu lieben, wenn er auch noch so sehr leidet! Er liebt seinen Einfall, sein Trugbild, aber er selbst ist auch nur ein Trugbild. Würde er doch, wenn sie ihm folgte, schon am nächsten Tage wieder gleichgültig werden und an seinen Überschwang mit spöttischem Lächeln zurückdenken. Er hat keinen Boden unter sich, auf dem er stehen könnte, er ist ein Stäubchen, das vom Winde getragen wird. Wie anders dagegen Tatjana! Sie hat sogar in der Verzweiflung und in dem Bewußtsein, daß ihr Leben verfehlt ist, etwas Festes und Unerschütterliches, auf das ihre Seele sich stützen, woran sie sich aufrichten kann. Das sind ihre Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihre Heimat, an die Landeinsamkeit, in der ihr stilles, reines Leben begann, und wäre es auch nur „das Kreuz und der Schatten der Bäume auf dem Grabe ihrer alten Kinderfrau“. Oh, diese Erinnerungen an ihre Jugend sind ihr jetzt das Teuerste, was sie hat, diese Erinnerungen allein sind ihr geblieben, aber sie genügen, um ihre Seele vor der letzten Verzweiflung zu bewahren. Und das ist nicht wenig, nein, das ist schon viel, sehr viel, denn das ist ein fester Boden, ist etwas, worauf man bauen kann. Hierin liegt die Berührung mit dem eigenen Volk, mit seinen Heiligtümern, liegt das, was das Vaterland zur wahren Heimatscholle macht. Was aber hat er, Onegin, und was ist er überhaupt? Doch nicht aus Mitleid konnte sie ihm folgen, nur um ihm eine Abwechslung zu bieten, um ihm nur für einige Zeit aus unendlicher liebevoller Barmherzigkeit das Phantom eines Glückes zu schenken, während sie mit Sicherheit wußte, daß er schon am nächsten Tage sich skeptisch und spöttisch zu diesem seinem neuen Glück verhalten werde! Nein, es gibt tiefe und starke Seelen, die ihr Heiligtum nicht bewußt der Schmähung preisgeben können, und wär’s auch nur aus unendlicher Barmherzigkeit. Nein, Tatjana konnte nicht Onegin folgen!
In diesem seinem unsterblichen Roman „Onegin“ erscheint also Puschkin als ein großer Volksdichter, wie wir vor ihm keinen gehabt haben. Er hat darin mit einem einzigen Griff, in der treffendsten Weise, mit dem scharfsichtigsten Blick, den Kern unseres Wesens, unserer ganzen über dem Volk stehenden Gesellschaft erfaßt und dargestellt. In derselben Schaffensperiode aber, in der er uns den Typ des russischen Skitaletz schuf, den es heute noch ganz so wie damals gibt und der für unser zukünftiges Schicksal von größter Bedeutung ist, während er neben ihn die wahre Vertreterin unendlicher Schönheit in der russischen Frau stellte, prägte er gleichzeitig – und wiederum als erster – in anderen Werken eine ganze Reihe der prächtigsten russischen Volkstypen. Die Schönheit auch dieser Typen besteht vor allem in ihrer Echtheit, die so groß ist, daß man sie ordentlich wie lebende Menschen vor sich zu sehen meint: so unverkennbar sind sie, so wahr und leibhaft stehen sie vor einem: wie gemeißelt. Ich möchte nochmals betonen, daß ich nicht als Literaturkritiker rede, deshalb werde ich meinen Gedanken auch nicht durch eingehende Untersuchungen der genialen Werke unseres Dichters zu erklären versuchen. Über seinen russischen Chronisten[22] zum Beispiel müßte man allein schon ein ganzes Buch schreiben, wollte man die volle Bedeutung dieser Gestalt erfassen und wiedergeben, die Puschkin uns in ihrer ruhigen Geistesgröße wie ein Wahrzeichen und einen ewigen Zeugen unseres kraftvollen Volksgeistes vor Augen gestellt hat. Diesen Typ gibt es wirklich, von dem kann niemand sagen, er sei vom Dichter frei erfunden, sei bloß eine Idealgestalt. Wenn man aber zugesteht (und das muß man), daß es solche Menschen im russischen Volk gibt, dann muß man auch zugeben, daß es notwendig einen Volksgeist, der sie hervorbringt, geben muß, und weiter, daß dieser Geist auch die erforderliche Lebenskraft haben wird. Überall tritt bei Puschkin der Glaube an den russischen Charakter hervor, der Glaube an eine geistige Kraft des Volkes: wo aber Glaube ist, da ist Zuversicht, und die besitzt er denn auch – eine große Hoffnung und ein großes Vertrauen auf den russischen Menschen. Daß er in der Hoffnung auf den Sieg des Guten furchtlos der Zukunft entgegenschaue, sagt Puschkin einmal bei einem anderen Anlaß, doch könnte sich dieser Ausspruch auf seine ganze in nationalem Geiste schöpferische Tätigkeit beziehen. Und niemals, weder vor noch nach ihm, hat ein russischer Schriftsteller sich so herzlich und so vertraut mit seinem Volk verbunden, wie Puschkin. Gewiß, wir haben unter unseren Schriftstellern viele Kenner des einfachen Volkes, die es treffend und sogar liebevoll zu schildern verstehen. Vergleicht man sie aber mit Puschkin, so muß man sich gestehen, daß bis jetzt, außer einem, höchstens zweien von seinen jüngsten Nachfolgern, alle diese Schriftsteller nur „das Volk schildernde Herren“ sind. Selbst bei den begabtesten von ihnen, ja, sogar bei diesen zwei Ausnahmen, die ich soeben erwähnte, bricht doch – bricht irgendwo ein gewisses Herabsehen auf dieses Volk hervor, so etwas, das wie aus einem ganz anderen Leben, einer anderen Welt kommt, so etwas wie ein Wunsch, dieses Volk zu sich emporzuziehen und dadurch dann glücklich zu machen. In Puschkin dagegen hat sich eine wirkliche Vereinigung mit dem Volke vollzogen, die in ihm selbst fast so etwas wie eine echte und innige Rührung auslöst. Man denke nur an seine Geschichte vom Bären, dessen Bärenfrau der Bauer erschlagen, oder an sein Gedicht:
„Freund Iwan, wenn wir jetzt trinken,
Müssen wir vorerst einmal ...“
und Sie werden ohne weiteres verstehen, was ich meine.
Alle diese Schätze des schöpferischen Erfassens sind von Puschkin, unserem größten Dichter, gleichsam in der Art eines Hinweises für alle nach ihm kommenden russischen Künstler, für alle nachfolgenden Schöpfer auf diesem Gebiete, hinterlassen worden. Man kann sogar ohne Zögern behaupten: ohne Puschkin wären alle nach ihm gekommenen Begabungen überhaupt nicht möglich gewesen; wenigstens hätten sie sich nicht mit solcher Kraft und Deutlichkeit zu äußern vermocht, ungeachtet ihrer unzweifelhaften Veranlagung, wie ihnen das nach Puschkin in unserer Zeit tatsächlich gelungen ist. Doch gilt dies nicht bloß von der Dichtung, vom künstlerischen Schaffen: ohne Puschkin hätte sich vielleicht auch unser Glaube an unsere russische Selbständigkeit, unsere uns jetzt bereits bewußt gewordene Hoffnung auf unsere Volkskräfte und damit auch der Glaube an unsere Zukunft und Bestimmung, an unsere selbständige Rolle in der Reihenfolge der europäischen Völker nicht so nachdrücklich und unverrückbar festgesetzt, wie das nach Puschkin geschehen ist (wenn auch freilich noch immer nicht bei allen, vielmehr erst bei verhältnismäßig wenigen)!
Diese Tat Puschkins nun tritt eigentlich erst dann plastisch hervor, wenn man voll und ganz erfaßt, was ich unter der dritten Periode seines Schaffens verstehe.
Ich sage nochmals: diese drei Perioden haben keine festen Grenzen zwischen sich. So könnten zum Beispiel einzelne seiner Werke, die er in der dritten geschrieben, sogar ganz zu Anfang entstanden sein, denn Puschkin war immer ein ganzer, sagen wir ein abgeschlossener Organismus, der von Hause aus alle Keime in sich trug und sie nicht etwa von außen nach und nach in sich aufgenommen hat. Die äußeren Anregungen haben in ihm nur die Keime zum Treiben gebracht, das Wachstum gefördert, oder haben, wenn man will, nur das tief in ihm Schlummernde wachgerufen. Aber dieser Organismus mußte sich naturgemäß entwickeln, und die Stufen oder, wie ich sie nannte, Perioden dieser Entwicklung lassen sich in der Tat unterscheiden, ja, es läßt sich sogar nachweisen, daß eine jede ihren besonderen Charakter hat, und es läßt sich verfolgen, wie eine jede sich allmählich aus der vorhergehenden entwickelt hat. So kann man zur dritten Periode denjenigen Teil seiner Werke rechnen, in denen vornehmlich universale Ideen ausgedrückt sind, in denen sich die poetischen Gestalten anderer Völker finden und die den Geist dieser Völker widerspiegeln. Von diesen Werken sind einige erst nach dem Tode des Dichters veröffentlicht worden. In dieser Periode aber hat das Schaffen Puschkins in seiner Art sogar etwas Wunderbares, es ist eine Erscheinung, die außerhalb alles bisher Dagewesenen zu stehen scheint, und es liegt etwas in ihr, dessen sich vor ihm noch niemand hat rühmen können.
Es ist wahr, die europäische Literatur hat Genies von ungeheurer Größe aufzuweisen – hat Männer wie Shakespeare, Cervantes, Schiller. Aber man nenne mir doch nur einen von diesen Großen, der eine solche Fähigkeit, das Wesen fremder Nationalitäten wiederzugeben, besessen hätte, wie unser Puschkin. Gerade diese Fähigkeit, diese Hauptfähigkeit unserer Nationalität, teilt Puschkin mit unserem ganzen Volk, und gerade sie macht ihn zu unserem nationalsten Dichter.
Selbst die größten europäischen Genies haben niemals vermocht, den Geist und das Wesen eines fremden Volkes, ja nicht einmal eines blutverwandten Nachbarvolkes, seine Seele, die ganze verborgene Tiefe dieser Seele und das Innerste dessen, wozu jedes Volk berufen ist, mit solcher persönlichen Schöpferkraft aus sich selbst heraus zu gestalten, wie es Puschkin gelang. Die europäischen Genies haben im Gegenteil, wenn sie sich anderen Völkern zuwandten, die fremde Nationalität gewöhnlich in ihre eigene verwandelt und nach den Begriffen ihrer Nation aufgefaßt. Sogar bei Shakespeare sind zum Beispiel die Italiener fast ohne Unterschied – Engländer. Nur Puschkin besitzt vor allen Dichtern der Welt die Fähigkeit, sich vollständig in den Geist einer fremden Nation zu versetzen. Nehmen Sie seine Faustszene, nehmen Sie sein Poem „Der geizige Ritter“ und die Ballade „Einst lebte ein armer Ritter ...“ Lesen Sie seinen „Don Juan“, und wenn Sie nicht wüßten, daß er von Puschkin ist, würden Sie gewiß nicht erraten, daß ihn – kein Spanier gedichtet hat. Und was sind das für tiefe, unheimliche Stellen in seinem Poem „Das Fest während der Pest“! Aus diesen phantastischen Gestalten spricht das Genie Englands. Dieses prachtvolle Pestlied des Helden, und dieses Lied der Mary – das sind englische Lieder, das ist der Schauer des britischen Genies, seine Klage, sein qualvolles Ahnen dessen, was seiner harrt. Erinnern Sie sich der Verse:
„Einst kam ich in ein ödes Tal –“
Es ist fast eine wörtliche Übertragung der drei ersten Seiten eines seltsamen mystischen Buches, das ein alter englischer Sektierer vor langer, langer Zeit in Prosa geschrieben hat, – aber ist es nun wirklich nur eine Übertragung? Aus der traurigen und gleichsam geisterfüllten Musik dieser Verse fühlt man förmlich die Seele des nordischen Protestantismus in der Seele dieses keltischen Sektenstifters, dieses uferlosen Mystikers mit dem stumpfen, finsteren und unbesiegbaren Wollen in der unbegrenzten und geheimnisvollen Phantasie. Beim Lesen dieses seltsamen Gedichts ist es einem, als spüre man den Geist der Reformationszeit, dieses kriegerische Feuer des frühesten Protestantismus, und begreiflich wird einem schließlich auch die Geschichte selbst, und zwar nicht nur durch ein gedankliches Verstehen, sondern es ist, als wäre man selber dabeigewesen, als wäre man soeben am Lager der bewaffneten Sektierer vorübergegangen, als hätte man mit ihnen Hymnen gesungen, mit ihnen Tränen der Begeisterung vergossen, mit ihnen an das geglaubt, woran sie glaubten. Und neben diesem religiösen Mystizismus stehen religiöse Verse aus dem Koran, die „Nachdichtungen aus dem Koran“: spricht aus diesen nicht ein Mohammedaner, nicht der Geist des Korans selber, und seines Schwertes, der in Einfalt erhabene Glaube und seine grausig blutige Kraft? Dann wieder haben wir die antike Welt in den „Ägyptischen Nächten“. Da verspüren wir die irdischen Götzen, so wie sie waren, die Götzen, die sich über ihrem Volk als Götter festgesetzt, die das Genie ihres Volkes und sein Streben bereits verachten, die an ihr Volk nicht mehr glauben und darüber einsame Götter geworden sind und in ihrer Einsamkeit, in ihrer dem Tode vorangehenden Langweile und Geistesarmut sich mit fanatischen, tierischen Roheiten, mit der Wollust niedriger Insekten, der Wollust eines Spinnenweibchens, das sein Spinnenmännchen auffrißt, die Zeit vertreiben. Nein, ich sage in allem Ernst: es hat noch keinen Dichter gegeben, der so wie Puschkin die ganze Welt in sich aufgenommen hätte. Doch nicht die Aufnahmefähigkeit im allgemeinen ist hier das Erstaunliche, sondern seine ganz unglaubliche Tiefe, das vollständige Sichhineinversetzen seines Geistes in den Geist fremder Völker, die fast vollkommene und deshalb so erstaunliche „Verwandlung“, eine Erscheinung, die sich bei keinem einzigen anderen Dichter wiederholt hat. In der Tat finden wir sie nur bei Puschkin und in diesem Sinne ist er, wie ich bereits sagte, eine noch nie dagewesene Erscheinung und unserer Meinung nach eine prophetische, denn ... denn eben darin hat sich am stärksten seine nationale russische Kraft geäußert, gerade die Volkstümlichkeit seiner Dichtung, das nationale Moment in der gesamten weiteren Entwicklung, das nationale Moment unserer Zukunft, das in der Gegenwart noch nicht an den Tag getreten ist, und das sich, wie gesagt, hier zum ersten Male prophetisch geäußert hat. Denn wo läge sonst die Kraft des russischen Volksgeistes, wenn nicht in seinem Streben zur Universalität und nach Allmenschlichkeit? Als Puschkin zum Dichter seines Volkes wurde, da begann er, sobald er nur mit dem Volksgeist in Berührung kam, sofort die große Bestimmung dieser Kraft zu ahnen. Hierin ist er ein Enträtsler und hierin ist er auch ein Prophet.
Denn, was bedeutet für uns die Reform Peters? nicht nur im Hinblick auf unsere Zukunft, sondern auch in unserem Verhältnis zur Vergangenheit, zu allem, was bereits geschehen ist, was sich vor unseren Augen vollzogen hat? Was war sie uns? Sie war doch nicht nur eine Aneignung europäischer Kleider, Sitten, Erfindungen und der europäischen Wissenschaft. Erfassen wir recht, was sie war und wie sie war, betrachten wir sie aufmerksamer. Ja, es ist sehr leicht möglich, daß Peter sie anfänglich nur in diesem Sinne einführte, ich meine in eng utilitaristischem Sinne – aber in der Folge, bei der weiteren Entwicklung seiner Idee, hat Peter sich fraglos von einem gewissen unbewußten Instinkt leiten lassen: der aber zog ihn zu zukünftigen und selbstverständlich zu großen Zielen. Ebenso hat auch das russische Volk nicht etwa nur aus Utilitarismus die Reform angenommen, sondern mit einer gewissen Vorahnung, ein viel weiteres, ein unvergleichlich höheres Ziel zu erreichen, als es der nächstliegende Utilitarismus je sein könnte, das hat es herausgefühlt – natürlich gleichfalls unbewußt, aber doch unmittelbar und mit voller Lebenskraft. Da setzte dann mit einemmal dieses Streben ein: zur lebendigen Wiedervereinigung der Menschen, zu einer, sagen wir, universalen Einigung! Nicht feindlich (wie man es hätte erwarten können), sondern freundschaftlich, mit ganzer Liebe nahmen wir das Genie, den Schöpfergeist der fremden Völker in unsere Seele auf, aller Völker, so viel es ihrer nur gab, ohne Rassenunterschiede zu machen und die einen den anderen vorzuziehen, da unser Instinkt fast schon vom ersten Schritt an die Widersprüche zu unterscheiden, das Fremde einzuschätzen und die Unterschiede zu entschuldigen verstand: allein damit haben wir unsere Fähigkeit und Neigung (die uns selbst noch neu und unbewußt waren) zur Wiedervereinigung aller Völker der großen arischen Rasse bezeugt. Ja, die Bestimmung des russischen Menschen ist unstreitig eine universale. Ein echter, ein ganzer Russe werden, heißt vielleicht nur (d. h. letzten Endes, vergessen Sie das nicht) – ein Bruder aller Menschen werden, ein Allmensch wenn Sie wollen. Oh, unsere ganze Spaltung in Slawophile und Westler ist ja nichts als ein einziges großes Mißverständnis, wenn auch ein historisch notwendiges. Einem echten Russen ist Europa und das Geschick der ganzen großen arischen Rasse ebenso teuer wie Rußland selbst, wie das Geschick des eigenen Landes, eben weil unsere Bestimmung die – wenn man sich so ausdrücken darf – die Verkörperung der Einheitsidee auf Erden ist, und zwar nicht einer durch das Schwert errungenen, sondern durch die Macht der brüderlichen Liebe und unseres brüderlichen Strebens zur Wiedervereinigung der Menschen verwirklichten Einheit. Verfolgen Sie unsere Entwicklungsgeschichte nach der Reform Peters und Sie werden bereits Spuren und Andeutungen dieses Gedankens, meines Traumes, wenn Sie wollen, in der Art unseres Umgangs mit den europäischen Nationen, ja, sogar in unserer auswärtigen Politik finden. Denn was hat Rußland in diesen ganzen zwei Jahrhunderten seit Peter mit seiner Politik anders getan, als Europa gedient, und zwar vielleicht in einem noch viel größeren Maße, als sich selbst? Ich glaube nicht, daß dies nur infolge der Talentlosigkeit unserer Diplomaten geschehen ist. Die Völker Europas wissen ja nicht einmal, wie teuer sie uns sind! Und ich baue fest darauf, daß wir in Zukunft, d. h. natürlich nicht wir, sondern die künftigen Russen, bereits alle ausnahmslos begreifen werden, daß ein echter Russe sein nichts anderes bedeutet, als sich bemühen, die europäischen Widersprüche in sich endgültig zu versöhnen, der europäischen Sehnsucht in der russischen allmenschlichen und allvereinenden Seele den Ausweg zu zeigen, in dieser Seele sie alle in brüderlicher Liebe aufzunehmen und so vielleicht das letzte Wort der großen, allgemeinen Harmonie, des brüderlichen Einvernehmens aller Völker nach dem evangelischen Gesetz Christi auszusprechen. Ich weiß, ich weiß, daß meine Worte, in der Begeisterung gesprochen, wie sie sind, übertrieben und phantastisch erscheinen können. Nun wohl, mögen sie es sein, aber ich bereue nicht, sie ausgesprochen zu haben. Sie mußten einmal ausgesprochen werden und zwar gerade jetzt, im Augenblick unseres Triumphes, in dem Augenblick, wo wir unseren großen genialen Toten ehren, der gerade diesen Gedanken in seiner ganzen schöpferischen Kraft verkörperte.
Übrigens ist dieser Gedanke schon mehr als einmal geäußert worden. Ich habe daher gar nichts Neues gesagt. – Am meisten wird man freilich daran Anstoß nehmen, daß er allzu selbstbewußt scheinen könnte: „Was, uns, unserem bettelarmen, unkultivierten Lande, fiele eine solche Aufgabe zu. Uns wäre es bestimmt, der ganzen Welt ein neues Wort zu sagen?“ Ja, rede ich denn von ökonomischen Erfolgen, von Erfolgen des Schwertes und der Wissenschaft? Ich rede doch nur von der Brüderlichkeit der Menschen und davon, daß zur universalen brüderlichen Einigung das russische Volk vielleicht am meisten von allen anderen veranlagt und bestimmt ist, und daß ich in unserer Geschichte, in unseren begabten Männern und im schöpferischen Genie Puschkins die Beweise dafür sehe. Mag unser Land arm sein, aber dieses arme Land „durchwandert Christus in Bettlergestalt“. Ja, warum sollten wir nicht trotz unserer Armut sein letztes Wort in uns tragen können? Hat nicht auch er im Stall in einer Krippe geruht?
So wiederhole ich: wir können wenigstens schon auf Puschkin, auf die Universalität und Allmenschlichkeit seines Genies hinweisen. Vermochte er doch das Genie jedes fremden Volkes wie ein ihm nahe verwandtes in seine Seele aufzunehmen. Und in der Kunst, im künstlerischen Schaffen hat er dieses Streben des russischen Geistes zur Universalität unstreitig bewiesen, darin aber liegt schon ein großer Hinweis für uns. Sollte unser Gedanke auch nur ein phantastischer Glaube sein, so haben wir in Puschkin doch wenigstens etwas, woraus dieser Glaube entstehen, worauf er fußen könnte. Wäre Puschkin nicht so jung gestorben, er hätte uns vielleicht noch große und unsterbliche Gestalten der russischen Seele offenbart, die unseren europäischen Brüdern bereits verständlicher sein, die sie uns näher bringen würden, als sie uns jetzt stehen. Er hätte ihnen vielleicht die ganze Wahrheit unserer Bestrebungen erklärt und sie würden uns jetzt besser verstehen, hätten es leichter, unser Wesen zu deuten und sie würden eher aufhören, so mißtrauisch und hochmütig auf uns herabzusehen, wie sie es jetzt tun und noch lange tun werden. Hätte Puschkin länger gelebt, dann gäbe es vielleicht auch zwischen uns Russen weniger Mißverständnisse und Streitigkeiten, als es ihrer jetzt zwischen uns gibt. Aber Gottes Ratschluß war anders. Puschkin starb in der Blüte seiner Jahre und seines Könnens und hat fraglos ein großes Geheimnis mit sich ins Grab genommen, so daß wir jetzt versuchen müssen, dieses Geheimnis ohne ihn zu erfassen.
Ich hatte die neue Nummer meines „Tagebuchs“ bereits beendet, indem ich ihren Inhalt auf meine am 8. Juni in Moskau gehaltene „Rede“ und ein Vorwort zu derselben beschränkte. Das Vorwort „Zur Puschkinrede“ schrieb ich in der Vorahnung des Lärms, den man schlagen werde und der denn auch richtig nach dem Erscheinen meiner Rede in den „Moskauer Nachrichten“ nicht lange auf sich hat warten lassen. Als ich aber Ihre Kritik las, Herr Gradowskij, ließ ich den Druck des „Tagebuchs“ bis auf weiteres einstellen, um in derselben Nummer noch meine Antwort auf Ihre Angriffe veröffentlichen zu können.
Oh, meine Vorahnungen sind alle in Erfüllung gegangen, das Geschrei, das sich erhoben hat, ist fürchterlich: stolz sei ich und feig sei ich, und eingebildet und ein „Dichter“! und die Polizei hätte man requirieren sollen, um die „Ausschreitungen“ des Publikums einzudämmen – das heißt, natürlich, eine moralische Polizei, eine liberale Polizei. Aber warum denn nicht die wirkliche? Ist doch auch diese bei uns jetzt liberal, sogar durchaus nicht weniger liberal, als die liberalen Herren, die dieses Geschrei über uns erhoben haben. Es fehlte ja auch nicht viel, und die wirkliche hätte eingegriffen! Doch lassen wir dieses Thema vorläufig, ich will lieber gleich zur Abwehr Ihrer Angriffe übergehen. Vorher möchte ich nur noch bemerken, daß ich mit Ihnen persönlich weder etwas zu schaffen noch mich über etwas auseinanderzusetzen habe, Herr Gradowskij. Letzteres ist so ausgeschlossen, daß ich tatsächlich nicht im geringsten die Absicht habe, Sie zu überzeugen oder gar von Ihrer Ansicht abzubringen. Auch früher schon habe ich mich, wenn ich Ihre Artikel las, stets über den Gedankengang derselben gewundert. Wenn ich Ihnen jetzt antworte, so geschieht das ausschließlich um der – anderen willen: ich meine unsere Leser, die dann über uns urteilen können. Für diese schreibe ich. Ich fühle, ich ahne, ja ich sehe sogar, daß neue Elemente erstanden sind und erstehen, die sich bis zur Verzweiflung nach einem neuen Wort sehnen, die angewidert sind von dem alten liberalen Gespött über Rußland, über jedes Wort der Hoffnung auf Rußland, die müde sind des liberal-zahnlosen Skeptizismus der alten Leichen, die man zu beerdigen vergessen hat, und die denn auch nur deshalb noch unter uns wandeln, dabei freilich sich nach wie vor für die junge Generation halten. Jawohl: müde der alten liberalen Führer und Retter Rußlands, die sich in den ganzen fünfundzwanzig Jahren ihres Aufenthaltes bei uns nur als „grundlose Marktschreier“ erwiesen haben. Kurz, ich möchte außer meiner Antwort auf Ihre Bemerkungen noch vieles sagen, so daß ich, wenn ich antworte, eigentlich nur die gebotene Gelegenheit ergreife, um mich auszusprechen.
Zunächst stellen Sie die Frage – und machen mir damit sogar einen Vorwurf –, warum ich nicht deutlicher erklärt habe, woher sich diese Menschen ohne festen Verbleib, von denen ich in meiner „Rede“ sprach, bei uns eingebürgert haben. Nun, die Geschichte ihrer Herkunft ist lang, da müßte man weit ausholen. Überdies würden Sie mir ja doch nicht beistimmen, gleichviel was ich Ihnen hierauf antworten wollte, denn Sie haben schon eine eigene Antwort auf die Frage, wie sie unter uns möglich geworden sind, in Bereitschaft, und die lautet ganz einfach: „Infolge des Jammers, mit solchen rohen Leuten wie Skwosnik-Dmuchanowskij[23] zusammenleben zu müssen, und außerdem natürlich vor Kummer über die damals noch nicht befreiten Bauern“ – eine Folgerung, die im allgemeinen eines zeitgenössischen russischen Liberalen wert ist, eines von diesen Leuten, bei denen alles was Rußland betrifft, bereits längst – ungeachtet unserer Probleme, die jetzt erst aufkommen – gelöst und unterschrieben ist. Das geschieht nämlich bei ihnen mit einer ungeheuren, nur dem russischen Liberalen möglichen Leichtigkeit.
Nichtsdestoweniger ist diese Frage viel schwieriger und verwickelter, als Sie denken; jawohl, bedeutend schwieriger und zwar trotz Ihrer vermeintlich endgültigen Lösung des Problems. Was nun die Leute wie Skwosnik-Dmuchanowskij und ihren Kummer wegen der Leibeigenschaft der Bauern betrifft, so werde ich noch darauf zurückkommen. Doch zunächst gestatten Sie, daß ich mich zu einem von Ihnen gebrauchten höchst bezeichnenden Wort äußere, das Sie wiederum mit einer Leichtfertigkeit, die fast an Mutwillen grenzt, ausgesprochen haben und das ich nicht übergehen darf.
Sie schreiben:
„... Wie dem auch sei, jedenfalls befinden wir uns schon seit zweihundert Jahren unter dem Einfluß der europäischen Aufklärung, die auf uns überaus stark einwirkt – wohl dank des ‚universalen Verständnisses‘ der Russen, welches Herr Dostojewski für unsere nationale Eigentümlichkeit erklärt hat. Vor dieser Aufklärung können wir nicht so einfach etwa irgendwohin flüchten – wir wüßten auch nicht warum? Es ist das eine Tatsache, an der wir nichts zu ändern vermögen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil jeder Russe, dem es um seine Aufklärung zu tun ist, diese Aufklärung unbedingt aus der europäischen Quelle erhält, eben infolge des unbedingten Nichtvorhandenseins russischer Quellen ...“
Dies ist gewiß sehr schwungvoll von Ihnen ausgedrückt. Aber Sie haben da unter anderem ein großes Wort gebraucht: „Aufklärung“. Erlauben Sie, daß ich Sie frage, was Sie unter diesem Wort verstehen: die Wissenschaft des Westens, die Technik, die handwerklichen Fertigkeiten oder die – Aufklärung des Geistes? Was die ersteren betrifft, d. h. die Wissenschaften und die Techniken, so müssen wir die allerdings vom Westen übernehmen, und uns in der Beziehung von Europa abzuwenden, dazu haben wir gar keinen Grund, ganz abgesehen davon, daß es andere Lehrmeister nicht gibt, außer den westeuropäischen, wofür Europa von uns Dank und Preis sei ewiglich. Aber unter Aufklärung verstehe ich (und ich denke, daß niemand sie anders auffassen kann), verstehe ich – das, was das Wort buchstäblich besagt: „Erleuchtung“, also das geistige Licht, das die Seele erhellt, das Herz durchleuchtet, den Verstand lenkt und ihm den Lebensweg weist. Wenn das Wort aber dies bedeutet, so gestatten Sie mir, zu erklären, daß wir durchaus keine Veranlassung haben, eine solche Aufklärung aus den westeuropäischen Quellen zu beziehen, eben infolge des vollkommenen Vorhandenseins (und keineswegs Nichtvorhandenseins) russischer Quellen. Sie wundern sich? Ja, sehen Sie: im Streit der Meinungen, da liebe ich es, gleich mit dem Wesentlichen der Sache anzufangen, um die es sich handelt.
Ich behaupte, daß unser Volk schon seit langem aufgeklärt ist, da es Christus und die Lehre Christi in sein Wesen aufgenommen hat. Man wird mir hierauf entgegnen, das Volk kenne die Lehre Christi nicht und Predigten würden ihm nicht gehalten. Das ist aber nur ein leerer Einwand: es kennt alles, alles das, was es wissen soll, obschon es ein Examen in der Religion nicht bestehen würde. Gelernt aber hat es das, was es weiß, in seinen Kirchen, wo es im Laufe von Jahrhunderten die Gebete und Hymnen hört, die besser sind, als mittelmäßige Predigten. Es hat sie für sich wiederholt und gesungen in den Wäldern, wenn es vor den ins Land einfallenden Feinden flüchtete, und vielleicht hat es schon zu Batyjs Zeiten, als die Tatarenhorden durchs Land zogen, gesungen: „Herr, sei mit uns!“ Vielleicht ist diese Hymne damals entstanden, denn außer Christus hatten die Horden uns alles geraubt, es blieb uns nichts als Christus. In dieser Hymne aber ist bereits die ganze Wahrheit Christi enthalten. Und was will es besagen, daß dem Volk keine langen Predigten gehalten werden und daß die Diakone die Heilige Schrift in uns unverständlicher Weise vortragen – die größte Anklage, die gegen unsere Kirche erhoben wird, von unseren Liberalen natürlich, denselben, die auch die Behauptung ersonnen haben, die kirchenslawische Sprache sei schon als solche unbequem und dazu dem Volk unverständlich?! Dafür tritt der Priester zu ihm hinaus und spricht das Gebet „Herr meines Lebens“ – in diesem Gebet aber ist das ganze Wesen des Christentums enthalten, sein ganzer Katechismus, und dieses Gebet kennt das Volk auswendig, so wie es auch viele Lebensgeschichten der Heiligen kennt und nie müde wird, andächtig zuzuhören, wenn jemand sie erzählt. Doch die Hauptschule des Christentums, die das Volk durchgemacht hat, das sind die Jahrhunderte der zahllosen Leiden und Heimsuchungen, von denen seine Geschichte berichtet, die Jahrhunderte, in denen es von allen verlassen und niedergetreten war, dabei für alle und alles arbeitete, in Christus aber nur seinen Tröster behielt, den es denn auch auf ewig in sein Herz schloß und der dafür seine Seele vor der Verzweiflung bewahrte. Übrigens, wozu sage ich Ihnen dies alles? Will ich Sie denn etwa überzeugen? Meine Worte werden Ihnen natürlich kindisch, wenn nicht ganz überflüssig erscheinen. Doch ich wiederhole zum drittenmal: nicht um Ihretwillen schreibe ich. Dies Thema ist von großer Wichtigkeit, darüber muß noch vieles gesagt werden – und das werde ich auch, solange ich noch die Feder in der Hand halte. Jetzt aber will ich meinen Gedanken nur als These aussprechen: Wenn unser Volk schon seit langer Zeit aufgeklärt ist, weil es in sein Wesen Christus und dessen Lehre aufgenommen, so hat es mit ihm zugleich natürlich auch die wahre Aufklärung angenommen. Bei diesem eigenen Vorrat an Aufklärung können ihm die Wissenschaften des Westens selbstverständlich zu einer unschätzbaren Wohltat werden, und wir brauchen nicht zu befürchten, daß das Bild Christi durch die Wissenschaften bei uns so getrübt werden könnte, wie im Westen selbst. Übrigens ist das auch dort nicht durch die Wissenschaften geschehen, wie es die Liberalen gleichfalls behaupten, sondern schon viel früher, als die Kirche des Westens selbst die Erscheinung Christi entstellte, indem sie sie von neuem in der Gestalt des Papsttums verkörperte und sich aus einer Kirche in einen neuen römischen Staat verwandelte. Ja, im Westen gibt es wahrlich kein Christentum mehr und ebensowenig eine christliche Kirche, obschon es dort noch viele Christen gibt, die ja wohl nie ganz aussterben werden. Der Katholizismus ist nicht mehr Christentum und geht in Götzendienst über, der Protestantismus aber nähert sich mit Riesenschritten dem Atheismus, und wird zu einer schwanken, veränderlichen (und nicht ewig feststehenden) Sittenlehre.
Oh, versteht sich, Sie werden mir hierauf sogleich erwidern, daß das Christentum und die Verehrung Christi keineswegs den ganzen Zyklus der Aufklärung enthielten, diese seien nur eine Stufe derselben, und zur Aufklärung gehörten im Gegenteil die Wissenschaften, Staatsideen, die allgemeine Entwicklung usw. usw. Darauf kann ich Ihnen freilich nichts antworten und eine Antwort wäre wohl auch nicht angebracht, denn wenn Sie zum Teil recht haben mögen, in betreff der Wissenschaften, zum Beispiel, so werden Sie doch dafür niemals zugeben, daß das Christentum unseres Volkes die hauptsächlichste und lebendigste Grundlage seiner Aufklärung ist und ewig bleiben muß! In meiner Rede sagte ich, daß Tatjana, indem sie sich weigerte, Onegin zu folgen, in russischem Geiste gehandelt habe, nach der Auffassung des russischen Volkes von Ehre und Gerechtigkeit. Einer meiner Kritiker jedoch, den es offenbar kränkt, daß das russische Volk eine eigene wahre Anschauung haben soll, widerspricht mir plötzlich mit der Frage: „Aber die Versündigung gegen das siebente Gebot?“ Kann man solchen Kritikern überhaupt antworten? Hauptsächlich kränkt sie ja doch, daß das russische Volk seine festen Begriffe von Rechtschaffenheit haben und somit wirklich aufgeklärt sein könnte. Ja, existiert denn der Ehebruch in unserem ganzen Volk, und existiert er denn als Recht und in Rechtschaffenheit? Hält ihn denn das ganze Volk für gut und richtig? Gewiß, unser Volk ist noch roh, wenn auch längst nicht das ganze Volk, o nein, bei weitem nicht das ganze Volk, das schwöre ich, und ich darf es schwören, denn ich kenne unser Volk, ich habe mit ihm jahrelang zusammengelebt, habe mit ihm gegessen und geschlafen und ward selbst „zu den Verbrechern gezählt“; ich habe gemeinsam mit ihm im Schweiße des Angesichts die Arbeit schwieliger Hände verrichtet, während die anderen, die ihre Hände „in Blut getaucht“, die „Liberalen“ spielten und über das Volk spöttelten und in Vorträgen und Aufsätzen zu dem Ergebnis kamen, daß unser Volk „von Tiergestalt und auch geistig von Tierart“ sei. Also sagen Sie mir nicht, daß ich das Volk nicht kenne! Ich kenne es: von ihm aus habe ich Christus wieder in meine Seele aufgenommen, den ich als Kind im Elternhause kennen gelernt, dann aber verloren hatte, als auch ich mich in einen „europäischen Liberalen“ verwandelte. Doch gut, mag unser Volk sündig und roh sein, und tierisch seine Gestalt und seine Art: „Der Sohn ritt auf der Mutter“ usw. Sie kennen doch das Lied? – aus irgendeinem Anlaß muß es ja entstanden sein! Alle russischen Lieder sind nach einem Geschehnis entstanden, nach etwas wirklich Gewesenem – ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Aber so seid doch wenigstens einmal gerecht, ihr Liberalen: bedenkt, was das Volk in all den vergangenen Jahrhunderten durchgemacht hat! Fragen Sie sich zunächst, wer an seiner Roheit am meisten schuld ist, verurteilen Sie es nicht so blindlings! Es ist doch mehr als lächerlich, einen Bauern deshalb zu verurteilen, weil er nicht von einem französischen Coiffeur zurecht gestutzt ist, – denn darauf laufen alle diese Beschuldigungen im Grunde hinaus, die unsere europäischen Liberalen gegen unser Volk erheben, da sie sich nun einmal darin so überaus gefallen, ihm alles abzusprechen: es soll weder eine Persönlichkeit haben, noch eine Nationalität! Mein Gott, im Westen aber, gleichviel bei welchem Volk – gibt es denn dort weniger Trunksucht und Diebstahl, und etwa nicht ebensolche Roheit, dabei noch eine Verstockung des Herzens und eine Erbitterung, die es in unserem Volk nicht gibt, das dafür von wirklicher, echter, unwissender Roheit ist, das wahre Gegenteil der Aufklärung, denn diese ist bisweilen mit einer solchen Gottlosigkeit verbunden, wie man es nicht für möglich halten sollte, wird aber dort nicht mehr für Sünde gehalten, sondern gerade für die einzige Wahrheit. Mag immerhin unserm Volk Tierisches und Sündhaftes anhaften, eines aber hat es zweifellos: das ist, daß es wenigstens, als Ganzes genommen (und nicht nur im Ideal, sondern in der wirklichsten Wirklichkeit) seine Sünde niemals für das Richtige gehalten hat, hält oder halten wird, auch niemals den Wunsch empfinden wird, sie dafür zu halten! Es sündigt, aber früher oder später sagt es doch: ich habe gefehlt. Sagt es nicht der Sündige selbst, so sagt es ein anderer für ihn, und die Wahrheit bleibt bestehen. Die Sünde ist wie stinkender, stickiger Dunst, und der wird sich verflüchtigen, sobald die Sonne vollends aufgeht. Die Sünde ist etwas Vorübergehendes, Vergängliches, Christus aber ist ewig. Das Volk sündigt stündlich und treibt Unfug, aber in besseren Stunden, in den Stunden Christi verwechselt es nie Recht mit Unrecht. Das eben ist das Wichtige: woran ein Volk glaubt, worin es die Wahrheit sieht, wie es sich dieselbe denkt, was sein höchster Wunsch ist, was es liebt und um was es zu Gott betet. Dieses Ideal ist in unserem Volk – Christus. Mit Christus aber besitzt es natürlich auch Aufklärung, und in wichtigen, entscheidenden Augenblicken hat denn auch unser Volk alles, was es volklich anging, stets im christlichen Sinne entschieden. Sie werden spöttisch einwenden: „Weinen, das ist wenig, seufzen gleichfalls, man muß auch handeln, man muß auch verwirklichen.“ Aber unter Ihnen, meine Herren, die Sie doch aufgeklärte Europäer zu sein glauben, gibt es denn unter Ihnen viele Gerechte? Nennen Sie mir doch Ihre Gerechten, die Christus ersetzen könnten! In dem Volk aber gibt es Gerechte. Es kommen unleugbar in ihm Charaktere von unendlicher Schönheit und Stärke vor, die freilich von Ihnen noch nicht bemerkt worden sind. Aber es gibt diese Gerechten und Märtyrer der Wahrheit – gleichviel ob wir sie sehen oder nicht sehen. Ich weiß nicht – wem es gegeben ist, sie zu sehen, der wird sie natürlich sehen und begreifen, wer aber in ihnen nur Tiere sieht, der wird selbstverständlich nichts sehen als das Tierische. Aber das Volk weiß, daß es diese Gerechten unter ihm gibt, schenkt ihnen sein volles Vertrauen, ist stark und gefestigt in diesem Gedanken und in der Hoffnung, daß sie es immer im nötigen, alle bedrängenden Augenblick retten werden. Und wie oft schon hat unser Volk das Vaterland gerettet! Und noch vor kurzem hat es sich, als es vor Sünde, Trunksucht und Sittenlosigkeit fast schon zu verfaulen schien, in neuer geistiger Freude und Frische erhoben und den letzten Krieg für den Glauben Christi, den die Muselmänner mit Füßen traten, ausgefochten. Es nahm den Krieg an, es griff gleichsam nach ihm, wie nach einer Möglichkeit, sich durch Opfer von den Sünden und Sittenlosigkeiten zu reinigen; und es sandte seine Söhne hin, zu kämpfen und, wenn es sein müßte zu fallen für die heilige Sache, und es schrie nicht, daß der Rubel sinke und der Preis für Lebensmittel steige. Es hörte voll Spannung zu, wenn jemand vom Kriege erzählte, es forschte gierig weiter und las selbst in den Zeitungen, soviel es nur lesen konnte, dessen sind wir Zeugen und solcher Zeugen gibt es viele. Ich weiß: die Erhebung des Volksgeistes während des letzten Krieges, und um so mehr noch der Grund dieser Erhebung, werden von unseren Liberalen nicht anerkannt, sie lachen über diese „Idee“. „Wie, in diesen Knechten soll eine sie alle vereinende Idee stecken, sie sollen staatsbürgerliches Gefühl, einen politischen Gedanken haben! – darf man das auch nur annehmen?“ Und warum, warum ist unser europäischer Liberaler so oft ein Feind des russischen Volkes? Warum stehen in Europa diejenigen, die sich Demokraten nennen, immer für das Volk ein oder stützen sich wenigstens auf das Volk, indes unser Demokrat so oft den Aristokraten spielt und zu guter Letzt fast immer dem dient, was die Volkskraft unterdrückt, um als richtiger selbstherrlicher „Herr“ sein Leben zu beschließen? Oh, ich behaupte ja nicht, daß sie bewußt Feinde des Volkes seien, aber gerade in der Unbewußtheit liegt das Tragische. Sie sind ungehalten über meine Fragen? Das ändert nichts an der Sache. Für mich sind das alles Axiome, und ganz gewiß werde ich nicht aufhören, sie zu erklären und zu beweisen, solange ich noch schreibe und spreche.
Doch kommen wir zum Schluß: mit den Wissenschaften verhält es sich so wie ich sagte, aber „Aufklärung“ brauchen wir nicht aus westeuropäischen Quellen zu beziehen. Täten wir es, so könnten sich mit Leichtigkeit solche landläufigen Phrasen einschleppen, wie zum Beispiel: Chacun pour soi et Dieu pour tous, oder après nous le déluge. Oh, gewiß wird man nun sogleich zetern: „Gibt es denn bei uns nicht auch solche Aussprüche, sagt man nicht bei uns zum Beispiel: ‚Der verzehrten Gaben gedenkt man nicht‘, und Hunderte von ähnlichen Sprichwörtern?“ Ja, der Sprichwörter gibt es viele im Volk: der Verstand des Volks ist gar nicht so gering, ebensowenig ist es ohne Humor, und die zunehmende Erkenntnis flüstert immer allerlei pessimistische Betrachtungen ein – aber das sind bei uns doch alles nur Redensarten, und dem Volk fällt es gar nicht ein, an ihre moralische Wahrheit zu glauben, es scherzt über sie und verneint sie selbst. Werden Sie es aber wagen, zu behaupten, daß „Chacun pour soi et Dieu pour tous“ im Westen nur eine Redensart sei und nicht eine gesellschaftliche Formel, die dort von allen angenommen ist und der alle dienen und an deren Richtigkeit alle glauben? Wenigstens alle diejenigen, die über dem Volk stehen und das Volk im Zaum halten, die Land und Arbeiter besitzen und wie Schildwachen vor der „europäischen Aufklärung“ aufgepflanzt sind. Wozu bedürften wir wohl einer solchen Aufklärung? Was sollten wir mit einer solchen anfangen? Nein, suchen wir lieber bei uns etwas anderes. Die Wissenschaften sind eine Sache für sich und die Aufklärung ist gleichfalls eine Sache für sich. In der Hoffnung auf das Volk und im Vertrauen auf seine Kräfte werden wir vielleicht noch irgendeinmal diese unsere christliche Aufklärung in vollem Glanz und in ihrer ganzen Schönheit entfalten. Sie werden mir nun freilich sagen, das sei ein langes Hin und Her als Antwort auf Ihre Kritik. Mag sein! Ich betrachte diese Ausführungen selbst nur als ein Vorwort, jedoch als ein notwendiges. Ganz wie Sie in meiner „Rede“ solche Punkte, in denen Sie nicht mit mir übereinstimmen, hervorheben und diese für das Wichtigste halten, so habe auch ich jetzt einen solchen Punkt aus Ihrer Kritik hervorgehoben, einen, in dem ich den Kern unserer Meinungsverschiedenheit sehe und der uns am meisten hindert, zu einer Übereinstimmung zu gelangen. Nun ist das Vorwort beendet, befassen wir uns jetzt mit Ihrer Kritik und zwar von nun an ohne Abschweifungen.
Sie schreiben in Ihrer Kritik meiner Rede:
„... doch hat Puschkin, als er Aleko und Onegin in ihrer Verneinung darstellte, nicht gezeigt, was sie denn eigentlich ‚verneinten‘, und es dürfte sehr gewagt sein, zu behaupten, daß sie gerade die ‚Volkswahrheit‘, diese Grundlage der russischen Weltanschauung, verneint hätten. Das ist bei ihm nirgendwo gesagt.“
Nun, ob es von ihm gesagt oder nicht gesagt wurde, und wie groß das Wagnis einer solchen Behauptung auch gewesen sei – darauf werden wir sogleich zu sprechen kommen. Zunächst wenden wir uns dem Passus zu, in dem Sie von Gogols Skwosnik-Dmuchanowskijs sprechen, bei denen Puschkins Aleko es nicht ausgehalten haben soll, weshalb er das Weite suchte – angeblich suchen mußte – und zu den Zigeunern lief. Sie schreiben:
„In der Tat, die Welt des damaligen ‚Skitaletz‘ war eine Welt, die eine andere Welt verneinte. Zur Erklärung dieser Typen sind die anderen Typen erforderlich, die Puschkin niemals dargestellt hat, obschon er sich hin und wieder in heftigem Unmut gegen sie wandte. Die Natur seines Talents hinderte ihn daran, in diese Finsternis hinabzusteigen und in die ‚Perle der Schöpfung‘ Eulen und Fledermäuse mit aufzunehmen, dieses lichtscheue Nachtvolk, das die Kellerräume in den unteren Stockwerken des russischen Gebäudes bevölkert.“ (sollten es nicht die oberen Stockwerke sein?) „Das hat erst Gogol getan, die große Kehrseite Puschkins. Er ist es denn auch, der der Welt die Erklärung gibt, weshalb Aleko zu den Zigeunern flüchtete, weshalb Onegin sich langweilte und quälte, weshalb alle diese ‚überflüssigen Menschen‘[25] entstanden.
Die Korobotschka[26], die Ssobakewitschs, die Skwosnik-Dmuchanowskijs, die Dershimordas und Tjäpkin-Ljäpkins bei Gogol, sind die Gegenstücke zu Puschkins Aleko, Rudin und den vielen anderen: sie bilden den Hintergrund, ohne den diese Gestalten unverständlich wären. Aber die Gogolschen Helden waren doch auch Russen – Gott, und wie echte noch dazu! Die Korobotschka kannte keinen Weltschmerz. Skwosnik-Dmuchanowskij verstand es vortrefflich mit den Kaufleuten umzugehen. Ssobakewitsch durchschaute vollkommen seine Bauern und sie durchschauten ihn gleichfalls. Aleko und Rudin sahen das alles natürlich nicht und sie begriffen es auch nicht; sie liefen einfach fort, wohin ein jeder nur konnte: Aleko zu den Zigeunern, Rudin nach Paris, um dort auf den Barrikaden für eine Sache zu sterben, die ihn gar nichts anging.“
Also sehen Sie mal, sie liefen einfach fort. Oh, welch eine Feuilletonistenleichtfertigkeit im Urteil! Und wie einfach das alles bei Ihnen ist, wie klipp und klar und von vornherein schon entschieden! Sie reden ja wahrlich in fertigen Worten, wie man zu sagen pflegt. Übrigens, weshalb heben Sie es so nachdrücklich hervor, daß Gogols Helden Russen waren – „und wie echte noch dazu!“ Das hat ja nichts mit unserer Meinungsverschiedenheit zu schaffen! Wer weiß es denn nicht, daß sie Russen waren? Auch Aleko und Onegin waren Russen, auch wir, Sie und ich, sind Russen, und ein Russe, ein echter Russe, war doch auch Rudin, der nach Paris „fortlief“, um dort für eine Sache zu sterben, die ihn nach Ihrer Ansicht gar nichts anging. Aber gerade deshalb ist er doch ein so echter Russe, eben weil diese Sache ihn keineswegs so „gar nichts anging“, wie etwa einen Engländer oder Deutschen, – denn eine europäische, eine universale, eine allmenschliche Angelegenheit ist für einen Russen niemals gleichgültig. Und das ist doch auch der Zug, der Rudin auszeichnet. Seine Tragödie bestand doch hauptsächlich darin, daß er auf seinem Felde keine Arbeit fand und auf ein anderes Feld ging und dort starb, nur war dieses Feld ihm durchaus nicht so fremd, wie Sie annehmen. Um was es sich aber hierbei eigentlich handelt, ist folgendes: alle diese Menschen Gogols, wie Skwosnik-Dmuchanowskij und Ssobakewitsch, sind zwar Russen, das läßt sich nicht leugnen, aber sie sind entartete, vom Volksboden getrennte Russen, die, wenn sie das Volk auch von der einen Seite kennen, von der anderen Seite des Volkes dagegen nichts ahnen, ja sie vermuten nicht einmal, daß es eine solche andere Seite gibt – und das ist die ganze Ursache des Unglücks dieser Menschen. Von der Seele des Volkes, von allem dem, wonach das Volk sich sehnt, und um was es betet – von all dem wußten sie nichts, denn sie verachteten das Volk über alle Maßen. Ja, sie sprachen ihm die Seele einfach ab – außer im Moment der ‚Seelenrevision‘[27] natürlich. „Ssobakewitsch durchschaute vollkommen seine Bauern,“ behaupten Sie. Das ist nicht möglich. Ssobakewitsch sah in seinem Leibeigenen nur dessen Marktwert, den er an Tschitschikoff verkaufen konnte. Sie behaupten, Skwosnik-Dmuchanowskij habe es vortrefflich verstanden, mit den Kaufleuten umzugehen. Aber ich bitte Sie! Lesen Sie doch nur die Rede dieses Skwosnik an die Kaufleute im fünften Akt: so kann man allenfalls zu Hunden reden, aber nicht zu Menschen – Sie jedoch nennen das „vortrefflich“ mit einem russischen Menschen umgehen? Ist es möglich, daß Sie das wirklich „vortrefflich“ finden? Da wär’s doch besser, einfach Ohrfeigen auszuteilen und die Menschen an den Haaren über die Erde zu schleifen.
In meiner Kindheit sah ich einmal auf der Landstraße einen Feldjäger vorüberfahren – in einem prächtigen Uniformrock, einen Dreimaster mit Federbesatz auf dem Kopf, – der den Postknecht während der rasenden Fahrt unausgesetzt und ganz fürchterlich mit der Faust ins Genick und auf den Rücken schlug, der Postknecht aber peitschte wiederum wie wahnsinnig die in gestrecktem Galopp jagende Troika. Dieser Feldjäger war natürlich von Geburt ein Russe, aber doch so verblendet und dem Volk entfremdet, daß er sich anders nicht mit einem einfachen Russen verständigen konnte, als mittels seiner riesigen Faust – anstatt aller Worte. Und doch hat er sein Leben lang mit solchen Postknechten und anderen Leuten aus dem Volk zu tun gehabt. Aber die Schöße seines Uniformrocks und der Hut mit dem Federbesatz, sein Offiziersrang und seine blankgeputzten Petersburger Stiefel waren ihm teurer, seelisch und geistig teurer, nicht nur als der russische Bauer, sondern vielleicht sogar teurer als ganz Rußland, das er kreuz und quer durchfahren und in dem er doch aller Wahrscheinlichkeit nach so gut wie nichts Bemerkenswertes gefunden hatte, nichts, das mehr wert gewesen wäre, als einen Hieb seiner Faust oder einen Fußtritt mit seinem blankgeputzten Stiefel. Seine Vorstellung von ganz Rußland beschränkte sich nur auf seine Vorgesetzten, alles andere, was es außer dieser vorgesetzten Behörde noch gab, schien ihm einer Existenz überhaupt nicht wert zu sein. Wie könnte nun wohl ein solcher Mensch das Wesen des Volkes und seine Seele begreifen! Er war zwar ein Russe, aber doch schon ein „europäischer“ Russe, nur mit dem Unterschied, daß sein „Europäertum“ nicht etwa mit der Aufklärung begonnen hatte, sondern mit der Ausschweifung, wie das ja bei vielen, sehr vielen der Fall ist. Ja, diese Verderbnis ist bei uns schon mehr als einmal für das richtigste Mittel zur Verwandlung des Russen in einen Europäer gehalten worden. Der Sohn eines solchen Feldjägers wird vielleicht ein Professor, d. h. bereits ein patentierter Europäer geworden sein. Also reden Sie doch nicht von ihrem Verständnis des Volkswesens! Da taten Männer not wie Puschkin, Chomjäkoff, Ssamarin, Aksakoff[28], die als erste von dem wirklichen Wesen des Volkes zu sprechen anfingen. (Vor ihnen war von diesem Wesen allerdings schon manchmal die Rede gewesen, aber diese Rede hatte immer irgendwie klassisch und theatralisch geklungen!) Als aber diese Männer endlich von der „Volkswahrheit“ zu reden anfingen, da sah man sie erstaunt an und hielt sie für Epileptiker und Idioten, und man glaubte, ihr Ideal sei: „Rettich zu essen und Denunziationen zu schreiben“. Ja, Denunziationen! Sie setzten eben durch ihr Erscheinen und ihre Ansichten alle so in Erstaunen, daß die Liberalen schon bedenklich wurden und zu fürchten anfingen: wie, wollten diese sonderbaren Leute sie nicht am Ende denunzieren? Nun urteilen Sie selbst: sind von den heutigen Liberalen wohl schon viele weit abgekommen von einer so lächerlich dummen Auffassung der Slawophilen?
Doch zur Sache! Sie sagen, Aleko sei von Dershimorda zu den Zigeunern gelaufen. Gut, nehmen wir an, daß es sich so verhält. Aber das Schlimme dabei ist, daß Sie selbst, Herr Gradowskij, mit vollkommener Überzeugung Aleko das Recht auf diesen Widerwillen zusprechen. Sie sagen zwischen den Zeilen ungefähr: „Es war ihm eben unmöglich, nicht zu den Zigeunern fortzulaufen, denn Dershimorda war doch gar zu gemein.“ Ich aber behaupte, daß Aleko und Onegin in ihrer Art gleichfalls Dershimordas waren, und in einer Beziehung sogar noch schlimmere. Nur tue ich das mit dem Unterschied, daß ich nicht ihnen die Schuld daran zuschreibe, da ich die Tragik ihres Schicksals vollkommen begreife, Sie aber loben sie noch dafür, daß sie fortliefen: „So große und interessante Menschen, wie sie waren, wie hätten sie sich mit solchen Ungeheuern einleben sollen?“ meinen Sie, wenn Sie es auch nicht aussprechen. Sie irren sich aber sehr. Da behaupten Sie auch gleich, Aleko und Onegin wären durchaus nicht vom Boden losgerissen gewesen und hätten durchaus nicht die Volkswahrheit verneint. Und nicht nur das: „Sie waren auch durchaus nicht hochmütig“ – sogar das behaupten Sie. Aber hier ist doch der Hochmut die gerade, logische und unvermeidliche Folge ihrer Abstraktheit, ihrer Losgerissenheit vom Volksboden. Sie können doch nicht leugnen, daß sie das Land nicht gekannt haben, da sie in Instituten aufwuchsen und erzogen wurden, daß sie Rußland in Petersburg, im Staatsdienst, kennen lernten und zum Volk immer im Verhältnis des Herrn zum Leibeigenen standen. Und wenn sie auch auf ihren Gütern in nächster Nähe der Bauern lebten, so kannten sie diese doch nicht. Jener Feldjäger hatte auch sein Leben lang mit Postkutschern zu tun gehabt und sah dennoch nichts anderes in ihnen, als Wesen, die nur Schläge seiner Faust verdienten. Aleko und Onegin verhielten sich Rußland gegenüber wie erhaben über alles, und waren hochmütig und anmaßend und unduldsam, wie alle, die in einem vom Volk getrennten engen Kreise leben, unter Bedingungen, die man mit „alles-frei“ bezeichnen kann, nämlich frei sowohl von der Bauernarbeit wie auch von der europäischen Kulturarbeit, von der sie gleichfalls die Nutznießung gratis hatten. Gerade daraus aber – daß alle unsere intelligenten Leute infolge einer gewissen historischen Entwicklung fast im Laufe der ganzen letzten zwei Jahrhunderte unserer Geschichte sich in Müßiggänger, die bloß ihre Hände pflegten, verwandelt haben, läßt sich ihre Abstraktion, ihre Losgelöstheit vom Heimatboden erklären. Nicht an Dershimorda scheiterte er, sondern an sich selbst, weil er sich Dershimorda und dessen Herkunft nicht zu erklären verstand. Dazu war er viel zu stolz. Aus diesem Grunde fand er auch keine Möglichkeit, auf dem eigenen Felde zu arbeiten. Die anderen aber, die an diese Möglichkeit glaubten, hielt er für Dummköpfe oder gleichfalls für Dershimordas. Und nicht nur in seinem Verhalten zu Dershimorda war unser Skitaletz stolz, er war es auch ganz Rußland gegenüber, denn nach seiner Überzeugung bestand Rußland nur aus Sklaven und Dershimordas. Wenn es aber noch etwas Edleres enthielt, so waren sie allein dieses Edlere, sie, Aleko und Onegin, sonst aber niemand außer ihnen. Daraus folgte die Überhebung ganz von selbst. Indem sie in ihrer Absonderung vom Volk verblieben, mußten sie sich natürlich wundern, wie hoch sie in ihrer Bildung über den gemeinen Dershimordas standen, selbstverständlich ohne auch nur das Geringste von diesen zu begreifen. Wären sie nicht stolz gewesen, so hätten sie begriffen, daß auch sie selbst Dershimordas waren, nach dieser Einsicht aber hätten sie dann – und zwar gerade durch diese Einsicht – vielleicht auch den Weg zur Versöhnung gefunden. Dem Volk gegenüber aber empfanden sie eigentlich nicht einmal so sehr Stolz als einfach Ekel, und zwar alle ausnahmslos. Sie werden das freilich nicht glauben wollen, im Gegenteil, Sie geben nur oberflächlich zu, daß einzelne Charakterzüge Alekos und Onegins allerdings nicht angenehm sind, um mir gleich darauf den Text zu lesen und anmaßend zu behaupten, ich hätte einen beschränkten Blick und es wäre wohl kaum vernünftig, „die Symptome zu kurieren, die Wurzel der Krankheit aber unangerührt zu lassen“. Sie glauben, daß ich, wenn ich sage: „Demütige dich, stolzer Mensch“ – damit Aleko nur seine persönlichen Eigenschaften, seine Privatfehler zum Vorwurf mache, den eigentlichen Grund des Übels jedoch vollständig übersehe, „als läge das ganze Wesen der Sache nur in den persönlichen Eigenschaften der Stolzen, die sich nicht demütigen wollen“, wie Sie meinen. „Es ist ja noch gar nicht festgestellt,“ sagen Sie, „wem gegenüber der Skitaletz denn nun eigentlich so stolz war, und damit ist auch die Frage noch offen, wovor er sich denn hätte demütigen sollen.“ Das ist mir denn doch ein gar zu hochmütiger Einwurf von Ihnen! Ich glaube, ausdrücklich gesagt zu haben, daß der Skitaletz ein Produkt der historischen Entstehung unserer Gesellschaft ist, folglich wälze ich doch nicht die ganze Schuld nur auf seine Person, auf seine persönlichen Eigenschaften. Sie haben das gelesen, denn ich habe es geschrieben und es steht gedruckt, weshalb übergehen Sie es also? Sie zitieren meinen ganzen Passus über das „Demütige dich“ und schreiben dann von sich aus:
„Mit diesen Worten hat Herr Dostojewski das ‚Allerheiligste‘ seiner Überzeugungen ausgesprochen, das, was zugleich die Stärke und Schwäche des Autors der ‚Brüder Karamasoff‘ ausmacht. In diesen Worten ist ein großes religiöses Ideal enthalten, eine mächtige Predigt persönlicher Ethik, aber es fehlt jede Andeutung sozialer Ideale.“
Und darauf beginnen Sie sogleich, die Idee der „persönlichen Vervollkommnung im Geiste der christlichen Liebe“ zu kritisieren. Auf Ihre diesbezügliche Meinung werde ich noch zu sprechen kommen, zunächst will ich Ihnen Ihre ganze Unterlage, die Sie, wie es scheint, zu verbergen wünschen, aufdecken und sie Ihnen zeigen, und zwar folgendermaßen: Sie ärgern sich über mich nicht nur deshalb, weil ich dem Skitaletz manches zum Vorwurf mache, sondern weil ich in ihm nicht wie Sie die Idealgestalt sittlicher Vervollkommnung sehe und ihn nicht für den gesunden Russen halte, wie er nur sein kann und sein soll. Daß Sie trotzdem zugeben, Aleko und Onegin hätten freilich einige „unsympathische Charakterzüge“, ist nur eine Finte von Ihnen. Ihrer inneren Auffassung nach, die Sie aus irgendeinem Grunde nicht ganz aussprechen wollen, ist der Skitaletz der Typ des normalen und ästhetischen Menschen, letzteres schon deshalb, weil er von Dershimorda fortläuft. Sie sind sogar höchst ungehalten, wenn jemand es wagt, in diesem Typ auch nur einen Fehler zu finden. Sie sagten bereits unumwunden: „Es ist doch sinnlos, zu behaupten, daß sie an ihrem Stolz gescheitert seien und sich nicht vor der Volkswahrheit hätten demütigen wollen.“ Und zum Schluß behaupten Sie noch mit Eifer, daß gerade diese unsere Menschenklasse die Bauern befreit habe. Sie schreiben:
„Sagen wir mehr: wenn in der Seele der besten dieser Skitaltzy aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts ein Gedanke lebte, so war das gerade der Gedanke an das Volk, und ihr glühendster Haß galt gerade der Sklaverei, die dieses Volk bedrückte. Gewiß haben sie auf ihre Art das Volk geliebt und die Leibeigenschaft gehaßt, meinetwegen ‚als Europäer‘, wenn man will. Aber wer war es denn, wenn nicht sie, die unsere Gesellschaft zur Aufhebung der Leibeigenschaft vorbereiteten? Wo sie konnten, haben auch sie dem ‚eigenen Acker‘ gedient, anfangs als Verbreiter der Befreiungsidee, dann aber als Vermittler, als welche sie in erster Reihe wirkten.“
Das ist es eben, daß die Skitaltzy die Leibeigenschaft in ihrer Art haßten, eben „europäisch“ haßten, darin liegt ja der ganze Kern der Sache. Das ist es eben, daß sie die Leibeigenschaft nicht um der russischen Bauern willen haßten, um des Russen willen, der für sie arbeitete, als ihr Leibeigener, dessen Arbeit sie ernährte und der folglich auch von ihnen – wenn sie es auch in Gemeinschaft mit anderen taten, so doch immerhin auch von ihnen – geknechtet wurde. Wer verbot ihnen denn, wenn sie schon so sehr unter dieser Beleidigung ihres staatsbürgerlichen Gefühls litten, daß sie zu den Zigeunern liefen oder auf die Barrikaden nach Paris – wer hinderte sie denn, ganz einfach wenigstens ihre eigenen Bauern zu befreien und einen Teil des eigenen Landes unter ihnen zu verteilen, um damit wenigstens das eigene Gewissen von diesem Unrecht und sich selbst von der persönlichen Verantwortung freizumachen? Aber von solchen Befreiungen hat man seltsamerweise nicht viel gehört, staatsbürgerliches Wehgeschrei dagegen ertönte doch genug und allerorten. „Das Milieu“, heißt es ja wohl, „das Milieu war die Fessel, und wie hätte er sich selbst seines Vermögens berauben sollen?“ Aber weshalb denn nicht, wenn die Bauern ihm schon so leid taten, daß er auf die Barrikaden lief? Ja, sehen Sie, das war es nun wieder, daß man in diesem „Städtchen Paris“ nicht ohne Geld auskam, selbst wenn man an den Barrikadenkämpfen teilnahm, die Leibeigenen aber – schickten den Zins. Oder man machte es noch einfacher: man verpfändete oder verkaufte die Bauern, oder tauschte sie ein (war das nicht ganz gleich?), und hatte man das Kapital flüssig gemacht, dann fuhr man nach Paris, um dort behilflich zu sein, französische radikale Journale und Revuen herauszugeben, jetzt schon zum Heil der ganzen Menschheit, und nicht nur des russischen Bauern. Sie versichern, Herr Gradowskij, daß der Kummer um den leibeigenen Bauer sie alle gepeinigt habe? Nun, es war wohl nicht gerade ein Kummer wegen der Leibeigenschaft der russischen Bauern, sondern der ganz abstrakte Kummer wegen der Knechtschaft des Menschengeschlechtes im allgemeinen: „Die sollte es doch überhaupt nicht mehr geben, sie ist rückständig, sie verträgt sich nicht mit der Aufklärung! Liberté, Egalité et Fraternité!“ – nur daran dachten sie. Was jedoch den russischen Bauern persönlich anbelangt, so hat der Kummer um ihn diese großen Herren ganz gewiß nicht allzu sehr geplagt. Ich habe eine Menge vertraulicher Meinungsäußerungen sehr, sogar sehr „gebildeter“ Herren der guten alten Zeit gehört und genau im Gedächtnis behalten. Zum Beispiel: „Die Sklaverei ist ja freilich ein fürchterliches Übel, das steht außer Frage,“ äußerten sie, wenn sie unter sich waren, „aber wenn man es genau betrachtet, so ist doch unser Volk – ja, ist denn das überhaupt ein Volk? Kann man es denn auch nur entfernt z. B. mit dem Pariser Volk von siebzehnhundertdreiundneunzig vergleichen? Es hat sich ja doch schon an die Sklaverei gewöhnt, sein Gesicht, seine ganze Gestalt drückt schon den Sklaven aus, ja, und wenn Sie wollen – die Rute zum Beispiel ist ja natürlich eine schreckliche Gemeinheit, im allgemeinen gesprochen, aber beim russischen Bauern ist sie doch, bei Gott, ganz unentbehrlich. Unser Bäuerlein muß die Rute zu fühlen bekommen, sonst wird’s trübselig. Tja, nichts zu machen, aber so ist es nun einmal, unser Volk!“ heißt es – das habe ich seinerzeit mit eigenen Ohren gehört, ich schwöre es, und sogar von sehr gebildeten Leuten. Das ist die sogenannte „nüchterne Wahrheit“.
Onegin wird seine Leibeigenen wahrscheinlich nicht geprügelt haben, obschon es schwerhält, hierüber mit Bestimmtheit etwas auszusagen; aber Aleko – nun, was diesen betrifft, so bin ich überzeugt, daß er seine Leibeigenen mitunter hat prügeln lassen, allerdings nicht aus Herzenshärte, sondern fast sogar aus Mitleid, fast sogar um des Guten willen, in dem Sinne etwa wie: „Das ist doch für ihn eine Notwendigkeit, ohne sie kommt er doch nicht aus, er kommt ja selber und bittet: ‚Straf mich, Herr, mach mich wieder zum Menschen, bin ganz aus der Zucht geraten!‘ Was soll man denn mit solch einer Natur anfangen, sagen Sie doch gefälligst? Nun, und so tut man ihm denn den Gefallen!“
Ich wiederhole es, ihr Gefühl für den Bauern grenzte oft an Ekel vor ihm. Und wieviel schmutzige Anekdoten wurden unter ihnen vom Bauern, von seiner Sklavenseele, seinem „Götzendienst“, seinem Popen und seinem Weibe erzählt, und zwar ganz leichten Herzens, zuweilen von Leuten, deren eigenes Familienleben fast einem Bordelleben glich. Oh, versteht sich, das geschah ja nicht immer in irgendeiner bösen Absicht, sondern nur aus übermäßigem Eifer bei der Aufnahme der letzten europäischen Ideen, die nach unserer Art aufgefaßt wurden, und geschah gleich mit der ganzen russischen Leidenschaftlichkeit. Sie waren eben in allem Russen! Oh, die russischen sich grämenden „Skitaltzy“ waren bisweilen große Schelme, Herr Gradowskij, und gerade diese kleinen Anekdoten vom russischen Bauern und die Geringschätzung für ihn (wenn nicht Verachtung) haben in den Herzen dieser Herren ihrem Kummer ob der Leibeigenschaft immer die Spitze dadurch abgebrochen, daß er einen gewissen abstrakt universalen Charakter annahm. Mit einem solchen Kummer aber läßt es sich noch ganz gut, sogar sehr gut leben, namentlich wenn man sich dabei geistig von der Betrachtung seiner eigenen moralischen Schönheit und der Erhabenheit nährte, die man im Fluge seiner staatsbürgerlichen Ideen entwickelte, und körperlich, nun – körperlich immerhin vom Zins dieser selben Bauern, und sogar wie noch, sich nährte! Da fällt mir soeben eine Geschichte ein, die vor kurzem ein alter Herr im Journal zum besten gab. Es war im Sommer 1845 auf einem in der Nähe von Moskau belegenen entzückenden Landgut, dessen Besitzer, nach den Worten dieses alten Herrn, „grandiose Diners“ zu geben pflegte. So hatten sich dort wieder einmal die humansten Professoren, die seltsamsten Liebhaber und Kenner der schönen Künste und noch manches anderen, die berühmtesten Demokraten, die sich in der Folge sogar als Staatsmänner ausgezeichnet und fast einen Weltruf erworben haben, ferner Kritiker, Schriftsteller und die reizendsten Damen, sie alle Menschen von höchster geistiger Entwicklung, versammelt. Und plötzlich bricht die ganze Gesellschaft auf, wahrscheinlich nach einem Diner mit Champagner, getrüffelten Pasteten und meinetwegen Vogelmilch (es muß doch etwas Besonderes gegeben haben, wenn man die Diners „grandios“ nennt), um einen Spaziergang zu machen. Auf dem Felde im reifen Roggen treffen sie eine Schnitterin. Nun, die Feldarbeit ist doch wohl nichts weniger als leicht: die Bauern stehen um 4 Uhr morgens auf, um dann bis zum Abend das Korn zu schneiden – zwölf Stunden gebückt unter sengenden Sonnenstrahlen. Und dort im Roggen findet nun unsere Gesellschaft die Schnitterin in – können Sie sich das vorstellen! – in „primitivem Kostüm“ (das heißt wohl einfach im Hemde?)! Wie entsetzlich! Alle Friedensgefühle und Humanitätsbegriffe sind vor den Kopf gestoßen, und sogleich läßt sich eine beleidigte Stimme vernehmen: „Von allen Weibern ist es nur das russische Weib, das sich vor keinem Menschen schämt!“ Und darauf, versteht sich, sogleich die Folgerung: „Nur das russische Weib ist von allen das einzige, vor dem sich niemand schämt“ (d. h. nicht zu schämen braucht, etwa, als müsse es so sein!). Es kam zum Streit. Einzelne verteidigten die Bäuerin, aber was waren das für Verteidiger und mit welchen Entgegnungen hatten sie zu kämpfen! Und so etwas war möglich in einer Gesellschaft von diesen meist aus dem Gutsbesitzerstande hervorgegangenen „Skitaltzy“, die sich lukullisch sattgegessen, Champagner und Austern geschlürft hatten – und zwar für wessen Geld? Für ein Geld, das sie aus der Bauern Arbeit bezogen! Für Sie, meine Herren Weltschmerzleidende, arbeitet diese Bäuerin doch, für das aus ihrer Arbeit gewonnene Geld haben Sie sich doch sattgegessen! Weil sie im hohen Roggen, wo niemand sie sehen konnte, gequält von Hitze und Schweiß, ihren Rock ausgezogen und im Hemde arbeitet – deshalb soll sie schamlos sein, soll sie Ihr Schamgefühl verletzt haben – „von allen Weibern das schamloseste!“ – ach Sie Keuschheitspriester! Aber Ihre Pariser Zerstreuungen und Ihre Erlebnisse im „Städtchen Paris“ und der Cancan im Jardin Mabille, vor dem unsere russischen Herren wie Butter an der Sonne zergehen – selbst wenn von ihm nur die Rede war, und das nette Liedchen –
„Ma commère quand je danse
Comment va mon cotillon?“
mit dem graziösen Raffen des Röckchens und dem Ruck mit dem Hinterteilchen dazu – das alles empört unsere schamhaften Herren keineswegs, im Gegenteil, es zieht sie sogar ungeheuer an!
„Aber ich bitte Sie, das ist bei ihnen doch alles so graziös, dieses Cancanchen, dieses Röckchen und ... na ja – das sind doch in ihrer Art die elegantesten Articles de Paris, hier aber – wie kann man das überhaupt vergleichen: hier ist’s doch nur ein Weib, ein russisches Bauernweib, ein Klotz, ein unbehauener Klotz!“
Nein, das war sogar nicht einmal bloßes Überzeugtsein von der Gemeinheit unseres Bauern und Volkes, da war die Ansicht schon ins Gefühl übergegangen, schon zum Gefühl geworden, da verriet sich bereits eine physische Empfindung des Ekels vor unserem Bauern – oh, natürlich nur eine unwillkürliche, fast unbewußte Empfindung, die sie selbst vielleicht gar nicht bemerkten. Und ich muß gestehen, ich kann mit Ihrem kapitalen Streitsatz keineswegs übereinstimmen, Herr Gradowskij: daß diese „Skitaltzy“ es gewesen seien, die in unserer Gesellschaft für die Befreiung der Leibeigenen vorgearbeitet hätten. Vielleicht mit abstraktem Geschwätz, indem sie ihren bürgerlichen Kummer nach allen Regeln überall hervorkehrten – oh, natürlich kam schließlich alles der Sache zugute. Bewirkt aber haben die Befreiung der Bauern, geholfen haben denen, die die Befreiung durchführen wollten, eher solche Männer wie z. B. Ssamarin[29], nicht aber Ihre Skitaltzy. Jener anderen dagegen, jener vom Schlage eines Ssamarin, die wohl in keiner Beziehung den Alekos und Onegins glichen, gab es doch damals gar nicht so wenige, und die halfen alle bei der großen Arbeit mit, Herr Gradowskij, von ihnen aber reden Sie natürlich kein Wort. Ihren Leuten jedoch ist die Geschichte, nach allen Anzeichen zu urteilen, sehr bald langweilig geworden, und sie begannen wieder zu schmollen. Sie wären auch keine „Skitaltzy“ gewesen, wenn sie sich anders verhalten hätten. Als sie dann nach der Aufhebung der Leibeigenschaft erst das Geld für ihre losgekauften Bauern erhalten hatten, da verkauften sie auch ihr übriges Land an Aufkäufer zum Aussaugen und ihre Wälder zum Abholzen. Sie selbst siedelten ins Ausland über und führten bei uns den Absentismus ein ... Sie werden mit mir darin natürlich nicht übereinstimmen, Herr Professor, aber was soll ich denn tun: es ist mir nun einmal absolut unmöglich, den Ihnen so teuren, der oberen Schicht entstammenden liberalen Russen für das Ideal des normalen echten Russen anzuerkennen, für den besten Typ, der der Rasse angeblich jemals wirklich war, ist und sogar in Zukunft sein soll. Ich sehe nur, daß dieser Typ in den letzten Dezennien wenig auf dem Arbeitsfelde seines Volkes geleistet hat. Und diese Auffassung halte ich für etwas richtiger und begründeter als Ihre Dithyrambe auf jene Herren.
Ich komme jetzt zu Ihrer Auffassung von der „persönlichen Vervollkommnung im Geiste der christlichen Liebe“ und Ihrer Behauptung, daß dieselbe durchaus unzureichend sei im Vergleich mit „sozialen Idealen“ und vor allem mit „sozialen Institutionen“. Ja, auch Sie weisen darauf hin, daß dies der wichtigste Punkt in unserer Meinungsverschiedenheit ist. Sie schreiben:
„Indem Herr Dostojewski Demut vor der Volkswahrheit und den Volksidealen verlangt, scheint er diese ‚Wahrheit‘ und diese Ideale für etwas bereits Fertiges, Feststehendes und Ewiges zu halten. Wir erlauben uns, dieser Annahme zu widersprechen. Die sozialen Ideale unseres Volkes sind noch im Stadium des Entstehens, Sie fangen erst an sich zu entwickeln. Das Volk muß noch viel an sich arbeiten, um den Namen eines großen Volkes zu verdienen.“
In betreff der „Wahrheit“ und der Ideale des Volkes habe ich Ihnen zum Teil schon geantwortet. Diese Wahrheit und diese Ideale des Volkes halten Sie direkt für ungenügend zur Entwicklung sozialer Ideale Rußlands. Das heißt also: Religion ist ein Ding für sich und alles Soziale, Gesellschaftliche ist etwas ganz anderes, d. h. wiederum ein Ding für sich. Sie schneiden den lebendigen Organismus mit Ihrem Gelehrtenmesser in zwei Hälften und behaupten, daß diese voneinander ganz unabhängig sein müssen. Betrachten wir sie näher, untersuchen wir jede dieser Hälften für sich, vielleicht können wir dann irgendwelche Schlüsse ziehen. Betrachten wir zunächst die Hälfte der „persönlichen Vervollkommnung im Geiste der christlichen Liebe“.
Sie schreiben:
„Herr Dostojewski ruft uns zur Arbeit auf, zur Arbeit an uns selbst. Die persönliche Vervollkommnung im Geiste der christlichen Liebe ist natürlich die erste Voraussetzung jeder Tätigkeit, gleichviel, ob sie groß oder klein ist! Aber daraus folgt noch nicht, daß Menschen, die im christlichen Sinne persönlich vollkommen sind, unbedingt einen vollendeten Staat bilden. Nehmen wir ein Beispiel:
Der Apostel Paulus erklärt Sklaven und deren Herren ihr Verhältnis zueinander. Sowohl diese wie jene konnten die Lehre des Apostels befolgen und taten es meist auch wirklich, sie waren persönlich gute Christen, aber die Sklaverei wurde damit nicht geheiligt und blieb eine unmoralische Einrichtung. So wird auch Herr Dostojewski, wie ein jeder von uns, vortreffliche Christen gekannt haben, sowohl unter Gutsbesitzern wie unter Bauern. Aber die Leibeigenschaft blieb trotzdem eine Schändlichkeit vor Gott, und der Zar-Befreier erfüllte nicht nur die Forderungen der persönlichen, sondern auch der sozialen Sittlichkeit, von der man in der alten Zeit keine richtige Vorstellung hatte, obschon es ‚gute Menschen‘ damals nicht weniger gab, als heutzutage. Persönliche und soziale Sittlichkeit ist nicht ein und dasselbe. Daraus folgt, daß eine soziale Vervollkommnung nicht lediglich durch die Besserung der persönlichen Eigenschaften der Menschen erreicht werden kann. Ein Beispiel:
Nehmen wir an, daß seit dem Jahre 1800 eine Reihe von Predigern der christlichen Liebe und Demut sich vorgenommen hätten, die Sittlichkeit solcher Menschen, wie Gogols Gutsbesitzerin Frau Korobotschka und Ssobakewitsch, zu heben. Wäre es auch nur denkbar, daß sie die Aufhebung der Leibeigenschaft durchgesetzt hätten und daß es keines Machtwortes mehr bedurft hätte? Im Gegenteil, die Korobotschka hätte zu beweisen angefangen, daß sie eine wahre Christin und ‚Mutter‘ ihrer Bauern sei und wäre trotz aller gegenteiligen Versicherungen des Missionars bei ihrer Ansicht verblieben.
Eine Verbesserung der Menschen in einem gesellschaftlichen Sinne kann nicht lediglich durch Arbeit nur an der eigenen Person und durch persönliche Demut erreicht werden. An sich selbst arbeiten und sich zur Demut erziehen, das kann man auch in der Wüste oder auf einer unbewohnten Insel. Aber als Angehörige einer Gesellschaft, eines Staates, entwickeln und verbessern sich die Menschen erst in der Arbeit nebeneinander, füreinander und miteinander. Das ist auch der Grund, weshalb die soziale Vollkommenheit der Menschen in einem so hohen Grade von der Vollkommenheit der sozialen Institutionen abhängt, die im Menschen wenn nicht christliche, so doch bürgerliche Werte erziehen.“
Sehen Sie, wie viel ich aus Ihrem Artikel abgeschrieben habe! Das klingt alles sehr selbstbewußt und die „persönliche Vervollkommnung im Geiste der christlichen Liebe“ hat gründlich die Wahrheit zu hören bekommen. Das heißt soviel wie: in staatlichen Dingen taugt sie zu nichts. Kurios, fürwahr, fassen Sie demnach das Christentum auf! Allein schon die Vorstellung, daß die Korobotschka und Ssobakewitsch wahre Christen werden könnten, sogar vollkommene, und darauf die Frage: könnte man sie dann dazu bringen, auf die Leibeigenschaft zu verzichten? ist bemerkenswert. Mir scheint es eine recht verfängliche Frage zu sein, die Sie da aufwerfen, und Ihre eigene Antwort lautet natürlich: „Nein, die Korobotschka wäre selbst als wahre Christin nicht dazu zu bewegen.“
Darauf antworte ich ohne weiteres: wenn die Korobotschka überhaupt eine wahre und vollkommene Christin hätte werden können oder geworden wäre, so hätte die Leibeigenschaft auf ihrem Gut auch schon zu existieren aufgehört, weshalb man sich dann um nichts weiter zu bemühen brauchte, wenn auch alle Aktenstücke und Kaufbriefe in ihrem Besitz verblieben.
Erlauben Sie: die Korobotschka war doch auch früher schon Christin, schon von Geburt an, d. h. seit ihrer Taufe, nicht wahr? Folglich verstehen Sie unter der Lehre der neuen Prediger des Christentums dem Wesen nach wohl dasselbe alte Christentum, nur erhöht, gesteigert, also ein vollendetes oder vollkommenes, das sozusagen schon sein Ideal erreicht hat? Aber was kann es dann noch für Sklaven geben, ich bitte Sie! Man muß doch das Christentum wenigstens annähernd begreifen! Und was würde es dann die Korobotschka, die wahre Christin, noch angehen, ob ihre Bauern Leibeigene sind oder nicht? Sie wäre ihnen „Mutter“, eine richtige Mutter, und die „Mutter“ in ihr hätte sogleich die frühere „Herrin“ in ihr einfach ausgeschaltet, und das wäre ganz von selbst geschehen. Das frühere Verhältnis – dasjenige der Herrin zum Sklaven – wäre in dem Fall wie Nebel vor der Sonne verschwunden und die alten Menschen wären von anderen verdrängt worden, die in einem ganz neuen, vordem undenkbar gewesenen Verhältnis zueinander gestanden hätten. Und überhaupt wäre damit etwas schier Unglaubliches geschehen: es wären eben überall vollkommene Christen entstanden, solche, wie es ihrer bisher auch als einzelne freilich so wenige gegeben hat, daß man selbst diese kaum zu entdecken vermöchte. Übrigens sind ja Sie es, Herr Gradowskij, der diese phantastische Möglichkeit in Erwägung zieht, nicht ich, folglich dürfen Sie sich auch nicht den Folgerungen entziehen. Ich versichere Ihnen, Herr Gradowskij, daß die Bauern der Korobotschka dann freiwillig bei ihr geblieben wären, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ein jeder sieht, wo er es am besten hat. Oder meinen Sie, daß die Bauern es mit Ihren Institutionen besser hätten, als bei der sie liebenden, wie eine leibliche Mutter für sie sorgenden Gutsbesitzerin? Desgleichen erlaube ich mir, Ihnen zu versichern, daß die Sklaverei zu Lebzeiten des Apostels Paulus nur deshalb auch in christlichen Gemeinden bestehen blieb, weil die damaligen, eben erst entstehenden Gemeinden noch nicht in dem Maße christlich waren, daß sie ein vollkommenes Christentum darstellten (was wir aus den Sendschreiben des Apostels ersehen). Aber die einzelnen Mitglieder der Gemeinden, die damals persönlich die Vollkommenheit erreichten, hatten auch keine Sklaven mehr und konnten sie ja gar nicht mehr haben, denn diese wurden sogleich zu ihren Brüdern, ein Bruder aber, ein wirklicher Bruder kann nicht seinen Bruder als Sklaven unter sich haben. Nach Ihren Worten müßte man dagegen annehmen, daß die Predigt der christlichen Lehre machtlos gewesen sei. Wenigstens schreiben Sie, daß durch die Predigt des Apostels die Sklaverei noch nicht geheiligt worden wäre. Andere Gelehrte aber, namentlich europäische Professoren der Geschichte, haben schon unzählige Male dem Christentum gerade das vorgeworfen, daß es angeblich die Sklaverei heilige. Das heißt aber, das Wesen der Sache nicht begreifen. Man stelle sich vor: die Madonna hätte Leibeigene und wollte diesen nicht die Freiheit geben. Welch ein Absurdum! Im Christentum, im wirklichen Christentum wird es Herren und Diener geben, aber ein Sklave ist undenkbar. Ich rede vom wahren, vollkommenen Christentum. Diener sind nicht Sklaven. Der Jünger Timotheus diente dem Apostel Paulus, als sie gemeinsam umherzogen, aber lesen Sie doch die Briefe Pauli an Timotheum: schreibt er an einen Sklaven, ja überhaupt an seinen Diener? Ich bitte Sie! – Das sind doch Briefe an seinen „Sohn Timotheus“ – an seinen „geliebten Sohn“! Ja, in einem solchen, gerade in einem solchen Verhältnis werden die Herren zu den Dienern stehen, wenn diese wie jene vollkommene Christen sind. Herren und Diener wird es geben, aber die Herren werden nicht Tyrannen sein, und die ihnen Dienenden nicht von ihnen Tyrannisierte. Stellen Sie sich vor, daß es in der zukünftigen Gesellschaft einen Kepler, einen Kant, einen Shakespeare gibt: sie leisten die große geistige Arbeit für alle, und alle wissen das und verehren und schätzen sie. Natürlich hat Shakespeare keine Zeit, sagen wir, sein Zimmer aufzuräumen. Glauben Sie mir, unter solchen Voraussetzungen wird unbedingt ein anderer Bürger zu ihm kommen, um ihm zu dienen, er wird es freiwillig tun, wird ungebeten die geringe Arbeit bei Shakespeare verrichten: sein Zimmer aufräumen usw. Wird er deshalb erniedrigt oder ein Sklave sein? Keineswegs. Er weiß, daß Shakespeare unvergleichlich nützlicher ist als er und er sagt sich oder ihm: „Dafür sei dir Ruhm und Ehre, und mir ist es eine Freude, dir dienen zu können. Soviel ich’s kann, trage ich auch meinen Teil zur großen Tat bei, indem ich dir Stunden des Schaffens erhalte, doch bin ich deshalb noch kein Sklave. Gerade durch diese meine Erkenntnis, daß du, Shakespeare, dank deinem Genie höher stehst als ich, habe ich bewiesen, indem ich zu dir kam, um dir zu dienen, daß ich an sittlicher Menschenwürde dir keineswegs nachstehe, sondern als Mensch dir ebenbürtig bin.“ Oder vielmehr, er wird das gar nicht sagen. Es wäre schon allzu selbstverständlich. Solche Fragen sind ganz ausgeschlossen, ja undenkbar. Denn die Menschen werden dann wirklich neue Menschen sein, Kinder Christi, und werden das ehemalige Tier in sich überwunden haben.
Sie werden freilich hierauf erwidern, dies sei eine phantastische Zukunftsillusion. Aber mit dem Phantasieren habe ja nicht ich den Anfang gemacht, sondern Sie, und Sie verstiegen sich sogar so weit, daß Sie sich die Korobotschka als eine vollkommene Christin denken konnten, die jedoch ihren „leibeigenen Kindern“ die Freiheit vorenthält. Das ist wohl etwas phantastischer als alles von mir Geschriebene.
Nun werden vielleicht die klugen Leute lachend einwenden: „Ja, wozu sich dann noch um die Vervollkommnung im Geiste der christlichen Liebe bemühen, wenn wirkliches Christentum, wie aus alledem hervorgeht, auf der Erde überhaupt nicht vorhanden ist, oder falls doch, dann nur so selten, daß man diese vereinzelten Fälle kaum wahrnehmen kann, anderenfalls (wie wiederum aus meinen eigenen Worten hervorgeht) wäre ja sofort alles beigelegt, jegliche Sklaverei vernichtet, die Typen vom Schlage der Korobotschka würden sich in lichte Genien verwandeln und den Menschen bliebe nichts weiter übrig, als Gott dem Herrn eine Hymne zu singen!“ Ja, natürlich, meine Herren Spötter, wirkliche Christen gibt es noch entsetzlich wenige (aber immerhin gibt es doch schon einige!). Woher aber wissen Sie, wievieler es bedarf, damit das Ideal des Christentums im Herzen des Volkes nicht stirbt und mit diesem Ideal auch seine große Hoffnung erhalten bleibt? Ins Weltliche übersetzt: wievieler unverfälschter treuer Bürger bedarf es, damit in der Gemeinschaft der Menschen die Idealgestalt eines Bürgers nicht vergessen wird? Auch diese Frage werden Sie schwerlich beantworten können. Hier handelt es sich um eine Sozialökonomie von eigener Art, von einer ganz besonderen Art, die uns noch unbekannt ist und die sogar auch Sie, Herr Gradowskij, noch nicht kennen.
Wieder wird man einwenden: wenn die große Idee nur so wenige Anhänger hat, von welchem Nutzen kann sie dann sein? Ja aber wer vermag denn jetzt schon zu sagen, von welchem Nutzen sie schließlich sein, was sie zu guter Letzt bewirken wird? Offenbar ist bisher nur das Eine nötig gewesen: daß der große Gedanke nicht starb. Ganz etwas anderes ist es dagegen jetzt, wo etwas Neues in der Welt herannaht und man bereit sein muß ... Und übrigens handelt es sich hier gar nicht um den Nutzen, sondern um die Wahrheit. Denn wenn ich felsenfest daran glaube, daß die Wahrheit hierin liegt, gerade hierin, woran ich glaube, was geht es mich dann an, daß die ganze Welt an meine Wahrheit nicht glaubt, mich verspottet und einen anderen Weg geht? Gerade darin liegt doch die Macht eines großen ethischen Gedankens, gerade dadurch vereint er die Menschen zum stärksten Verband, daß er sich nicht nach seinem sofortigen Nutzen bewerten läßt, sondern die Menschen in die Zukunft leitet, zu ewigen Zielen, zu absoluter Freude. Wodurch wollten Sie sonst die Menschen zur Verwirklichung Ihrer sozialen Ideale vereinigen, wenn Sie keine Grundlage in einer uranfänglichen großen sittlichen Idee haben? Diese sittlichen Ideen haben aber alle das eine gemeinsam: daß sie ausnahmslos auf der Idee der persönlichen absoluten Vervollkommnung am letzten Ende, d. h. als Ideale beruhen, denn diese Vervollkommnung enthält alles in sich, alles Streben, alles unendliche Verlangen, und folglich ist sie, gerade sie der Mutterschoß aller unserer sozialen, bürgerlichen Ideale. Versuchen Sie es doch mal, die Menschen zu einer bürgerlichen Gesellschaft zu vereinigen: zu dem einzigen Zweck, um für ihre „Bäuchlein zu leben“! Die sittliche Antwort auf Ihren Versuch wäre die Formel: „Chacun pour soi et Dieu pour tous.“ Unter dieser Formel wird aber keine einzige bürgerliche Gesellschaft lange bestehen, Herr Gradowskij.
Doch ich gehe noch weiter und beabsichtige, Sie in Erstaunen zu setzen.
So hören Sie denn, Herr Professor, daß es speziell soziale Ideale, die mit ethischen Idealen in keiner organischen Verbindung stehen, die vielmehr für sich ganz allein bestehen, also vom Ganzen abgeteilte Ideale, wie Sie sie mit Ihrem gelehrten Messerchen abteilen zu können meinen, ferner, daß es solche soziale Ideale, die äußerlich übernommen und an jeden beliebigen neuen Ort verpflanzt werden könnten und daselbst zu gedeihen vermöchten, als „Institution“ wie Sie sich ausdrücken – daß es solche Ideale, sage ich, überhaupt nicht gibt, noch je gegeben hat und auch gar nicht geben kann! Ja, und was ist denn eigentlich ein soziales Ideal, wie ist dieses Wort überhaupt zu verstehen?
Sein Wesen liegt natürlich in dem Bestreben der Menschen, eine Formel für ihre soziale Organisation zu finden, eine möglichst fehlerlose und allen gerecht werdende Formel – nicht wahr? Aber diese Formel ist den Menschen unbekannt, sie suchen sie schon seit Tausenden von Jahren, seit dem Anfang ihrer geschichtlichen Entwicklung und können sie nicht finden. Die Ameise kennt die Formel ihres Ameisenbaues, die Biene die ihres Stockes (wenn sie sie auch nicht nach Menschenart kennen, so kennen sie sie doch in ihrer eigenen Art und mehr ist ja nicht nötig), aber der Mensch kennt seine Formel nicht. Wenn das aber der Fall ist, woher sollte dann wohl das Ideal einer sozialen Organisation in die menschliche Gesellschaft gekommen sein? Verfolgen Sie die Geschichte und Sie werden sogleich sehen, woher das Ideal kommt. Sie werden sehen, daß es einzig und allein ein Erzeugnis der sittlichen Vervollkommnung der einzelnen Menschen ist: damit fängt es an, und so ist es von jeher gewesen und wird ewig so bleiben. Als erstes sehen wir in der Geschichte jedes Volkes, jeder Nationalität, daß die sittliche Idee der Entstehung der betreffenden Nationalität immer vorangegangen ist, denn gerade sie ist das, was die nationale Besonderheit bildet, sie erst erschafft die Nationalität. Hervorgegangen aber ist diese sittliche Idee immer aus mystischen Ideen, aus Überzeugungen, daß der Mensch ewig sei, unsterblich, daß er nicht wie ein gewöhnliches Erdentier nur sein Leben friste, sondern mit anderen Welten und der Ewigkeit verbunden sei. Diese Überzeugungen sind immer und überall zur Religion geworden, zum Bekenntnis der neuen Idee, und stets hat sich dann, kaum daß die neue Religion entstanden war, sogleich auch staatlich eine neue Nation gebildet. Nehmen Sie z. B. die Juden oder die Muselmänner: bei ersteren bildete sich die Nation erst nach der Gesetzgebung durch Moses, obschon sie bereits mit dem Gesetz Abrahams begonnen hatte, und ebenso sind die mohammedanischen Nationen erst nach dem Koran entstanden. Um den empfangenen geistigen Schatz zu erhalten, beginnen die Menschen sogleich, sich zusammenzuschließen, und dann erst, in eifriger gemeinsamer Arbeit „nebeneinander, füreinander und miteinander“ (wie Sie sich beredt ausdrücken) – dann erst fangen die Menschen an, auch danach zu suchen, wie sie sich wohl so einrichten könnten, daß von dem erhaltenen Schatz nichts verloren gehe, dann suchen sie nach einer sozialen Formel des gemeinschaftlichen Lebens, nach einer Staatsform, die ihnen am ehesten helfen könnte, suchen jenen sittlichen Schatz, den sie erhalten, wenn möglich über die ganze Welt hin zu seinem vollsten Glanz zu entfalten und zu seinem größten Ruhme zu erheben. Und wohlgemerkt, sobald nach Ablauf der Zeiten und Jahre (denn auch hierin waltet ein Gesetz, das wir freilich nicht kennen) in der betreffenden Nation das geistige Ideal zu verfallen begann, da begann zugleich auch die Nation zu verfallen und mit ihr auch ihr ganzer Staatsbau, und es verblich auch das soziale Ideal, das sich inzwischen in ihr gebildet hatte. Von welcher Art der Charakter der Religion eines Volkes ist, von dem Charakter sind auch die sozialen Formen dieses Volkes. Folglich sind die sozialen Ideale mit den sittlichen Idealen stets unmittelbar und organisch verbunden, doch die Hauptsache ist, daß sie einzig und allein aus diesen hervorgehen. Ganz für sich allein aber entstehen sie nie, denn indem sie entstehen, ist ihr Zweck nur die Befriedigung des sittlichen Strebens der betreffenden Nation, je nachdem wie und inwieweit dieses sittliche Streben in ihr entstanden und vorhanden ist. Folglich aber ist die „persönliche Vervollkommnung im religiösen Geiste“, wie wir sehen, im Leben der Völker die Grundlage alles weiteren, denn die persönliche Vervollkommnung ist nichts anderes als die Ausübung der empfangenen Religion. Die „sozialen Ideale“ aber entstehen nie ohne dieses Streben nach Selbstvervollkommnung und können auch gar nicht ohne dasselbe entstehen. Sie werden vielleicht bemerken, auch Sie hätten ja gesagt, daß die „persönliche Vervollkommnung der Anfang alles weiteren“ sei und daß Sie nichts mit einem Messer geteilt hätten. Das aber ist es ja gerade, daß Sie dies doch getan haben, daß Sie einen lebendigen Organismus zerschnitten und somit in zwei einzelne Hälften geteilt haben. Die persönliche Vervollkommnung ist nicht nur „der Anfang alles weiteren“, sondern auch die Fortsetzung des Ganzen und sogar den Ausgang begreift sie in sich. Sie umfaßt, erschafft und erhält den Organismus der Nation und zwar nur sie allein. Nur für sie lebt die soziale Formel der Nation, da sie doch nur zu dem Zweck gesucht wird, um den ursprünglichen ersten Schatz zu erhalten. Wenn aber in der Nation das Bedürfnis nach allgemeiner einzelner Vervollkommnung in dem Geiste, der dies Bedürfnis hervorgerufen, erlischt, dann verschwinden allmählich auch alle „bürgerlichen Einrichtungen“, da es dann nichts mehr zu erhalten gibt. Deshalb kann man unter keinen Umständen dem zustimmen, was Sie in folgenden Worten ausdrücken:
„Dies ist auch der Grund, weshalb die soziale Vollkommenheit der Menschen in so hohem Maße von der Vollkommenheit der sozialen Institutionen abhängt, die im Menschen wenn nicht christliche, so doch bürgerliche Werte heranbilden.“
„Wenn nicht christliche, so doch bürgerliche“! Sieht man hier nicht das Messer des Gelehrten, das Unteilbares trennt, das den ganzen, in sich abgeschlossenen lebendigen Organismus in zwei getrennte tote Hälften teilt, in eine sittliche und eine bürgerliche?
Sie werden vielleicht sagen, daß sowohl in den „sozialen Institutionen“ wie in der Rolle des „Bürgers“ die größte sittliche Idee enthalten sein kann, daß in bereits ausgereiften, entwickelten Nationen die „bürgerliche Idee“ stets an die Stelle der anfänglichen religiösen Idee tritt, die sich also gewissermaßen zu jener entwickle und der jene daher durchaus rechtmäßig folge.
Ja, das behaupten allerdings viele, wir aber können für die Richtigkeit dieser Auffassung kein einziges historisches Beispiel finden. Wenn die sittlich-religiöse Idee in der Nation sich überlebt hatte, so setzte immer nur ein panisch ängstliches Vereinigungsbedürfnis ein, nämlich zu dem Zweck, um für den Fall, daß etwas geschehen sollte, „die Bäuchlein zu retten“ – andere Ziele kennt die bürgerliche Vereinigung dann nicht mehr. Da vereinigt sich gerade jetzt die französische Bourgeoisie, und vereinigt sich nur zu diesem Zweck: um die eigenen Bäuchlein vor dem vierten Stand, der schon die Tür, die zu ihr führt, zu zertrümmern droht, sicherzustellen. Aber das „Retten der eigenen Bäuchlein“ ist von allen Ideen, die die Menschen zu vereinigen suchen, die schwächste und letzte, in jeder Beziehung. Sie ist schon der Anfang vom Ende, ist die Vorahnung des Endes. Sie vereinigen sich, und dabei spitzen doch alle die Ohren und äugen ängstlich, um bei der ersten Gefahr möglichst schnell auseinanderzustieben. Und was könnte dann die „Institution“ als solche, als etwas für sich allein Genommenes, wohl noch retten? Gäbe es Brüder, so gäbe es auch eine Brüderschaft. Wenn es aber keine Brüder gibt, so können Sie durch keine einzige „Institution“ Brüderschaft erzielen. Was für einen Sinn hat es, überhaupt eine „Institution“ zu schaffen und mit der Aufschrift „Liberté, Egalité, Fraternité“ zu versehen? Erreichen werden Sie mit einer solchen Institution entschieden nichts, so daß man dann wohl – oder vielmehr unfehlbar, oder sogar unbedingt – zu den drei Worten noch etwas als viertes hinzufügen müßte, nämlich: „ou la mort“. „Fraternité ou la mort“ – und die Brüder werden den Brüdern die Köpfe abschlagen, um durch eine „bürgerliche Institution“ Brüderschaft einzuführen. Das ist nur ein Beispiel, aber ein gutes. Sie, Herr Gradowskij, suchen, wie auch Aleko es tut, die Rettung in Äußerlichkeiten. Sie meinen: Mag es auch bei uns in Rußland auf Schritt und Tritt nur Dummköpfe und Spitzbuben geben (vielleicht hat es auch wirklich den Anschein, natürlich je nach dem Standpunkt), aber da brauchte man nur irgendeine europäische „Einrichtung“ aus Europa nach Rußland zu verpflanzen und es wäre, Ihrer Ansicht nach, alles gerettet. Die mechanische Übernahme europäischer Formen (Formen, die dort vielleicht morgen schon zusammenbrechen werden), die unserem Volk fremd und seiner Art nicht angepaßt sind, ist bekanntlich der Hauptgedanke der russischen Westler. Übrigens belieben Sie, Herr Gradowskij, indem Sie Rußland seine schlechte Organisation vorwerfen und ihm Europa vorhalten, sich wörtlich auszudrücken:
„Vorläufig aber können wir uns nicht einmal in jenen Fragen und Widersprüchen zurechtfinden, die Europa bereits längst beantwortet und überwunden hat.“
Wie, Europa und bereits überwunden? Wer hat Ihnen nur so etwas aufbinden können? Dieses Europa ist doch schon am Vorabend seines Falles angelangt, eines Falles, der ausnahmslos allgemein und furchtbar sein wird. Der Ameisenbau ohne Kirche und ohne Christus (denn die Kirche, die ihr Ideal getrübt hat, hat sich dort allerorten schon längst in einen Staat verwandelt) mit seinem bis auf den Grund erschütterten sittlichen Prinzip, dieser Ameisenbau, der alles Gemeinsame und alles Absolute eingebüßt hat – dieser Ameisenbau ist, behaupte ich, bereits so gut wie untergraben. Der vierte Stand fängt an sich zu erheben, schon pocht er an die Tür und begehrt Einlaß, und wenn man ihm den nicht gewährt, wird er die Tür zertrümmern. Er will nicht die früheren Ideale, er verwirft jedes Gesetz, das bisher gegolten. Auf Kompromisse und Nachgeben läßt er sich nicht mehr ein, mit schwachen Stützen und kleiner Hilfe werden Sie da das Gebäude nicht retten. Nachgiebigkeit im Kleinen feuert nur an, und der vierte Stand will alles haben. Es wird etwas einsetzen, was bisher noch niemand für möglich gehalten hat. Alle diese parlamentarischen Regierungsysteme, alle gegenwärtig herrschenden sozialen Theorien, alle zusammengescharrten Reichtümer, alle Banken, Wissenschaften und Juden, alles das wird im Nu zunichte werden – außer den Juden natürlich, die auch dann den Kopf nicht verlieren und wieder obenauf sein werden, so daß der Krach ihnen sogar zugute kommen dürfte. Alles das „steht nahe vor der Tür“. Sie belieben zu lachen? Selig sind die Lachenden. Gäbe Gott Ihnen langes Leben, damit Sie alles mit eigenen Augen schauen. Dann werden Sie sich wundern. Oder Sie erwidern mir hierauf lachend: „Da muß ja Ihre Liebe zu Europa von recht absonderlicher Art sein, wenn Sie Europa einen solchen Ausgang prophezeien!“ Ja, freue ich mich denn? Ich sage es ja nur in der Vorahnung, daß die Summe schon so gut wie gezogen ist. Die endgültige Abrechnung aber, das Quittieren jener Summe, kann sogar viel früher erfolgen, als selbst die stärkste Phantasie es sich ausdenken könnte. Die Symptome sind furchtbar. Allein schon die ewig alte unnatürliche politische Lage der europäischen Staaten könnte den Anfang bilden. Aber wie sollte sie auch natürlich sein, wenn die Unnatur schon in ihrer Grundlage ruht und sich im Laufe von Jahrhunderten aufgehäuft hat. Es kann nicht ein kleiner Teil der Menschheit die ganze übrige Menschheit wie einen Sklaven beherrschen, einzig zu diesem Zweck aber sind bisher alle bürgerlichen (schon lange nicht mehr christlichen) Einrichtungen im jetzt vollkommen heidnischen Europa entstanden. Diese Unnatürlichkeit und diese „unlösbaren“ politischen Probleme (die übrigens allen bekannt sind) müssen unfehlbar zum großen, endgültigen, abrechnenden, politischen Kriege führen, in den alle hineingezogen werden und der noch in diesem Jahrhundert, vielleicht sogar schon in diesem Jahrzehnt, ausbrechen wird. Was meinen Sie: vermag die Gesellschaft dort einem langen politischen Krieg jetzt noch standzuhalten? Der Fabrikant ist ängstlich und leicht zu erschrecken, der Jude gleichfalls, sie würden, sobald der Krieg sich etwas in die Länge zieht, oder nur droht, sich in die Länge zu ziehen, sogleich alle ihre Fabriken und Banken schließen, und die Millionen hungriger entlassener Proletarier werden auf die Straße gesetzt sein. Oder hoffen Sie etwa auf die Vernunft der Staatsmänner und darauf, daß diese es nicht zum Kriege kommen lassen werden? Aber wann hat man denn jemals auf diese Vernunft bauen können? Oder hoffen Sie vielleicht auf die Parlamente? – daß diese nicht die Mittel zum Kriege bewilligen werden, weil sie etwa die Folgen voraussähen? Ja, aber wann haben denn die Parlamente irgendwelche Folgen vorausgesehen und einem auch nur ein wenig energischen oder wenigstens beharrlichen Staatsmann die Mittel verweigert? Und so setzt der Krieg den Proletarier auf die Straße. Was meinen Sie, wird er auch jetzt wieder nach alter Art geduldig warten und hungern? – jetzt, nach den Siegen des politischen Sozialismus, nach der „Internationale“, den Kongressen der Sozialisten und der Pariser Kommune? Nein, jetzt wird es anders sein: die Proletarier werden sich auf Europa stürzen und alles Alte auf ewig zerstören. Erst an unserem russischen Ufer werden die Wogen zerschellen, denn dann erst wird es sich allen sichtbarlich offenbaren, in welchem Maße unser nationaler Organismus sich von den europäischen Organismen unterscheidet. Dann werden auch Sie, meine Herren Doktrinäre, sich vielleicht besinnen und bei uns die „volklichen Grundelemente“ zu suchen anfangen, über die Sie jetzt nur zu lachen verstehen. Und dabei, meine Herren, weisen Sie jetzt, gerade jetzt auf dieses Europa hin und empfehlen es uns als Vorbild und fordern uns auf, bei uns jene selben „Einrichtungen“ einzuführen, die dort morgen schon stürzen werden, als das überlebte Absurdum, das sie sind, jene „Einrichtungen“, an die auch in Europa klügere Leute schon längst nicht mehr glauben, und die sich nur nach den Gesetzen des Beharrungsvermögens bis jetzt noch erhalten haben. Ja, und wer könnte denn überhaupt – außer einem Doktrinär – die Komödie dieser bourgeoisen Vereinigung, die wir in Europa sich abspielen sehen, für die normale Formel menschlicher Vereinigung auf Erden halten? Und diese Leute, sagen Sie, hätten bei sich zu Hause ihre Probleme schon längst gelöst! Etwa nach den zwanzig Konstitutionen binnen weniger als einem Jahrhundert und nach wenig weniger als zehn Revolutionen? Oh, vielleicht, – nur werden wir uns dann, für einen Augenblick von Europa befreit, bereits selbständig, ohne europäische Vormundschaft, mit unseren eigenen sozialen Idealen befassen, die unbedingt in Christus und der Idee der persönlichen Vervollkommnung wurzeln, Herr Gradowskij. Sie werden nun wieder fragen: was für eigene, von Europa unabhängige soziale Ideale kann es denn bei uns geben? Ja, soziale Ideale – bessere, als Ihre europäischen, stärkere als Ihre europäischen, stärkere und sogar – o Entsetzen! – freisinnigere als es die Ihrigen sind! Ja, freisinnigere, denn sie kommen unmittelbar aus dem Organismus unseres Volkes und sind nicht lakaienhaft unpersönliche Kopien europäischer Vorbilder. Hier kann ich natürlich nicht näher darauf eingehen, wenn auch nur deshalb nicht, weil der Artikel ohnehin lang geworden ist. Übrigens – erinnern Sie sich: was war und was wollte die älteste christliche Kirche sein? Sie bildete sich sogleich nach Christus, damals nur aus einigen wenigen Menschen, und sogleich, fast schon in den ersten Tagen nach Christus, war sie bestrebt, ihre „bürgerliche Formel“ zu finden, die restlos auf der sittlichen Hoffnung und der Idee der Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes auf Grund der persönlichen Vervollkommnung beruht. Es entstanden christliche Gemeinden, Kirchen, und dann begann schnell eine neue, bis dahin noch nie gesehene Nationalität zu entstehen – eine allbrüderliche, allmenschliche in der Form der allgemeinen ökumenischen Kirche. Aber sie wurde verfolgt, ihr Ideal entwickelte sich gleichsam unterirdisch – über ihm aber, auf der Erde, entstand gleichfalls etwas Großes, ein riesenhaftes Gebäude, ein ungeheurer Ameisenbau: das römische Imperium, das gleichfalls so etwas wie ein Ideal und eine Auslösung des sittlichen Strebens in der ganzen alten Welt war. Es erschien der Menschgott, und das Imperium nahm als religiöse Idee Gestalt an, es ward Gestalt einer Idee, die in sich und durch sich allem sittlichen Streben der ganzen alten Welt den Ausweg bot. Aber der Ameisenhaufen ward von der Kirche untergraben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden entgegengesetztesten Ideen, die es überhaupt auf der Erde geben kann: der Menschgott stieß auf den Gottmensch, Apollon auf Christus. Und es kam zum Kompromiß: das Imperium nahm das Christentum an und die Kirche das römische Recht und seine Staatsform. Ein kleiner Teil der Kirche ging in die Einsamkeit und setzte in der Einsiedelei die frühere Arbeit fort: Es entstanden wieder christliche Gemeinden, dann Klöster – alles freilich nur Versuche, sogar bis zum heutigen Tage. Der andere riesengroße Teil der Kirche teilte sich in der Folge, wie Sie wissen, in zwei Hälften. In der westlichen Hälfte ging die Kirche zu guter Letzt vollständig in den Staat auf. Und als das Imperium unterging, trat die Kirche an seine Stelle – sie hatte sich endgültig verwandelt und war tatsächlich zum Staat geworden. Das Papsttum war die Fortsetzung des alten römischen Staates, nur in seiner neuen Form.
In der östlichen Hälfte dagegen ward der Staat vom Schwerte Mohammeds zerstört und so blieb ihr nur Christus, ein Christus, der vom Staat ganz abgesondert war. Das Land aber, das dann von Byzanz aus diesen Christus annahm und von neuem erhob, hat so grauenvoll unter Feinden, unter dem Tatarenjoch, unter Unordnung im Reich, unter der Leibeigenschaft, unter Europa und dem imitierten Europäertum zu leiden gehabt und erträgt auch jetzt noch so unendlich viel Schweres, daß seine soziale Formel – im Sinne des Geistes der Liebe und der christlichen Selbstvervollkommnung – sich in ihm allerdings noch nicht hat ausarbeiten können. Nur haben Sie, Herr Gradowskij, deshalb wohl noch nicht das Recht, diesem Volk daraus einen Vorwurf zu machen. Vorläufig ist unser Volk meinetwegen erst nur der Träger Christi, auf den allein es denn auch seine ganze Hoffnung setzt. Es nennt sich, den Mann aus dem Volke, „Krestjanin“[30], d. h. soviel wie „Christjanin“, und das ist nicht nur ein leeres Wort, sondern hierin liegt eine Idee, die seine ganze Zukunft ausfüllen wird.
Sie, Herr Gradowskij, machen Rußland seine Unordnung zum Vorwurf. Aber wer hat denn in diesen ganzen letzten zwei Jahrhunderten und namentlich in den letzten fünfzig Jahren eine bessere innere Einrichtung des Landes am meisten verhindert? Das waren doch gerade immer nur die Leute Ihres Schlages, Herr Gradowskij, die sogenannten russischen Europäer, die in den ganzen zwei Jahrhunderten nicht ausstarben und sich jetzt noch ganz besonders breit machen. Wer ist der größte Feind der organischen und selbständigen Entwicklung Rußlands auf seinen eigenen volklichen Grundlagen? Wer ist es, der spöttisch und hochmütig nicht einmal das Vorhandensein dieser Grundlagen anerkennt und sie überhaupt nicht bemerken will?! Wer ist es, der unser Volk – nach irgendwelchen illusorischen Begriffen nennen sie es: „zu sich emporheben“ – umwandeln will?! d. h. einfach alle zu solchen machen, wie diese Herren selber sind, zu liberalen Pseudoeuropäern, indem sie von der Masse des Volkes immer wieder je ein Menschlein abreißen und verführen und „entarten“, d. h. verderben und zum Europäer wandeln, sei es auch nur insoweit, als man das mit europäisch zugeschnittenen Rockschößen erreichen kann?! Damit sage ich nicht, daß der Europäer verderbt sei; ich sage nur, daß einen Russen auf diese Weise in einen Europäer verwandeln, wie unsere Liberalen es tun, oft nichts anderes als einfach „verderben“ bedeutet. Gerade das aber ist das Ideal, das Programm ihrer Tätigkeit: von Zeit zu Zeit ein Menschlein von der ganzen Masse abzureißen – das ist ihr Bestreben. Wie absurd! Und so wollten sie alle achtzig Millionen unseres Volkes nach und nach umwandeln? Ja, glauben Sie denn wirklich im Ernst, daß unser Volk als Ganzes, die einheitliche Masse des Volkes, jemals einwilligen werde, etwas ebenso Unpersönliches zu werden, wie es diese russischen Herren Europäer sind?
Unsere beiden großen Dichter vom Anfang des Jahrhunderts, Puschkin und Lermontoff, waren „Byronianer“. Dieses Wort wurde am Grabe Nekrassoffs in einem Tone gesagt, als wäre es ein Scheltwort. Wer es aber in diesem Sinne gebraucht, befindet sich in einem Irrtum.
Der „Byronismus“ war allerdings nur eine vorübergehende, fast nur momentane, aber, an sich betrachtet, doch große, notwendige und heilige Erscheinung im Leben der europäischen Geister oder sogar im Leben der ganzen Menschheit. Er entstand in einer Zeit der allgemeinen Enttäuschung, wenn nicht gar Verzweiflung. Mit überschwenglicher Begeisterung hatte man die neuen Ideale des neuen Glaubens, der gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts von Frankreich verkündet wurde, aufgenommen, – als plötzlich der Verlauf der Dinge in der führenden Nation Europas eine Wendung nahm, die so wenig den großen Erwartungen entsprach und die Menschen in ihrem hoffnungsvollen Glauben so tief enttäuschte, daß gerade jene Zeit für die suchenden Geister vielleicht die traurigste Zeit war, die die Geschichte Westeuropas kennt. Und nicht nur aus äußeren (politischen) Gründen stürzten die für einen Augenblick erhobenen Götzen, sondern ebenso infolge ihres inneren Bankrotts, was denn auch alle führenden Geister und alle starken Herzen sofort erkannten. Aber der neue Ausweg war noch nicht zu finden, noch öffnete sich keine neue Tür, und so rang man mit dem Ersticken, rang innerhalb eines entsetzlich verkleinerten Horizonts und unter einem drückend tief herabgesenkten Himmel. Die alten Götterbilder lagen in Trümmern, die neuen aber blieben aus. Das war die Zeit, die ihren dichterischen Ausdruck in einem großen Genie, einem leidenschaftlichen Dichter fand. Aus seinen Strophen tönte die damalige Sehnsucht der Menschheit, sprach zugleich ihre finstere Enttäuschung, ja ihr Irrewerden an ihrem Lebenszweck und an ihren Idealen, von denen sie sich betrogen sah. Byrons Muse war damals eine neue, noch völlig unbekannte Muse der Vergeltung und Trauer, der Verwünschung und Verzweiflung. Und dieser Geist, der aus Byron sprach, sprach plötzlich aus der ganzen Menschheit: aus allen Ländern hörte man einen Widerhall seiner Stimme. Der Byronismus – der war nun gleichsam die erste Tür, die sich öffnete; oder wenigstens war in der allgemeinen traurigen Stimmung, die zum größten Teil ganz unbewußt sein mochte, gerade Byrons Stimme jener mächtige Schrei, in dem sich alles Gestöhn der Menschheit sammelte. Wie hätte er da nicht auch bei uns ein Echo finden sollen, und noch dazu in einem so großen, genialen und führenden Geist wie Puschkin? Denn dem Byronismus konnte sich bei uns damals weder ein größerer Geist, noch ein großes Herz verschließen, und das war durchaus natürlich und geschah nicht etwa nur aus Mitgefühl mit Europa und der europäischen Menschheit, so aus der Ferne, sondern weil auch bei uns in Rußland gerade zu jener Zeit gar zu viele neue, gleichfalls noch ungelöste und quälende Probleme auftauchten und auch noch gar zu viele alte Enttäuschungen zu verwinden waren ... Aber die Größe Puschkins, als führendes Genie, bestand ja gerade darin, daß er so schnell und als einziger in einer fast vollständig verständnislosen Umgebung den festen Weg, den großen und ersehnten Ausweg für uns Russen fand und auf ihn hinwies. Dieser Ausweg aus der Verzweiflung, diese Rettung war – das Volk, die Anerkennung des russischen Volksgeistes und die Einsicht, daß wir uns seiner Wahrheit unterwerfen müssen.
Jeder geschichtliche Zeitabschnitt hat von jeher neben seinen herrschenden Anschauungen und Überzeugungen noch einige andere Anschauungen, zu denen öffentlich sich zu bekennen, den Zeitgenossen gleichsam der Mut fehlt. Die Menschen von heute können freilich eine Menge guter Beweggründe zu einem solchen Verhalten haben, doch oft genug, ja sogar meistens verschweigen wir unsere wahre Meinung aus einem gewissen geheimen Jesuitismus, dessen größter Knebel unsere Eigenliebe ist – eine bis zur eifersüchtigsten Eitelkeit, ja sogar bis zum empfindlichsten Ehrgeiz gesteigerte Eigenliebe. Das Seltsamste an dieser Eigenliebe ist nun wohl, daß sie alles ruhig hinnimmt, sogar Bezeichnungen wie Schurke, Spitzbube, Dieb – d. h. sofern sie nicht buchstäblich ausgesprochen werden – alles, außer einem Zweifel an ihrem Verstande. Der Grund hierfür ist vielleicht darin zu suchen, daß man gerade in unserer Zeit immer stärker und schmerzhafter zu fühlen und sogar schon zu erkennen anfängt, daß jeder Mensch erstens seiner selbst wert ist, und zweitens, als Mensch im Namen seiner Menschenwürde auch jedes anderen Menschen wert sein sollte. Infolge dieser Erkenntnis verlangt es den Menschen nach Achtung seines Ich. Da aber der überlegene Verstand der einzige unverrückbare und unbestreitbare Vorrang des einen Menschen vor dem anderen Menschen ist, so will eben keiner in der Berechtigung auf den Vorrang hinter dem anderen zurückstehen. Darum ist man denn auch heutzutage mitunter gar zu zaghaft, wenn es sich darum handelt, eine Überzeugung zu äußern. Aber man ist es, weil man befürchtet, die anderen könnten sie rückständig oder sogar beschränkt nennen. Und doch müßte ein jeder, der aufrichtig überzeugt ist, seine Überzeugungen heilig halten; wer aber seine Überzeugungen heilig hält, müßte doch auch etwas für sie tun. Ja, jeder ehrliche Mensch ist es, unserer Meinung nach, einfach sich selbst schuldig, für seine Überzeugungen einzutreten, wofern er wirklich selbst an sie glaubt – denn es gibt ja unter den Überzeugten auch solche, die selber an ihre Überzeugungen nicht glauben. Ich habe sogar persönlich einen solchen Herrn gekannt. Er gehörte zu jener Kategorie zweifellos kluger Leute, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes tun als Dummheiten. (Übrigens, wie ist das zu erklären, daß beschränkte, stumpfe Menschen viel weniger Dummheiten begehen als kluge Menschen?) Doch als ich jenen Herrn fragte, weshalb er denn andere mit solchem Eifer zu überzeugen trachte und woher er dieses Feuer, diese Leidenschaft der Überzeugung nehme, wenn er selber an seinen Worten zweifle – da antwortete er, daß er sich eben deshalb so ereifere, weil er sich selbst überzeugen wolle. Da sieht man, was das heißt, eine Idee von außen lieben, nur aus Vorliebe für sie, und ohne sie vorher wirklich geprüft zu haben (es ist sogar, als fürchteten sie sich davor), ob sie richtig ist oder falsch! Wer weiß, vielleicht ist es nur zu wahr, daß manche leidenschaftlichen Eiferer ihr Leben lang andere zu überzeugen suchen, nur um sich selbst zu überzeugen, und dann doch unüberzeugt ins Grab gehen ... Doch genug davon! ... Mag man nun von uns denken, daß auch wir uns von unserer Idee hinreißen ließen, daß die Idee an sich falsch, unbegründet sei und von uns übertrieben werde, daß wir aus all zu jugendlicher Leidenschaft oder aus greisenhafter Geistesschwäche sprechen usw. usw. ... Nun, dann möge man es denken! Wir aber sind überzeugt, daß wir damit keinem schaden, wenn wir öffentlich aussprechen, woran wir glauben. Weshalb sollten wir es also nicht wirklich tun?
Ja, wir glauben, daß die russische Nation eine außergewöhnliche Erscheinung in der Geschichte der ganzen Menschheit ist. Der Charakter des russischen Volkes ist den Charakteren aller anderen europäischen Völker so unähnlich, daß die Europäer ihn bis heute noch nicht verstehen; oder was noch schlimmer ist, sie verstehen ihn verkehrt. Die europäischen Völker streben alle demselben Ziele zu, sie haben alle ein und dasselbe Ideal; das wird niemand bestreiten können. Aber alle entzweien sie sich in ihren Lokalinteressen. Ihre Exklusivität auch unter sich geht bis zur Unversöhnlichkeit, und je weiter desto mehr gehen sie auseinander und entfernen sich vom gemeinsamen Wege. Wie es scheint, will jede Nation nur aus eigener Kraft und ganz allein in ihrem Lande das allmenschliche Ideal finden, und so stören sie sich gegenseitig und schaden damit nur ihrer Sache. Wir wiederholen jetzt im Ernst, was wir einmal scherzend sagten: Der Engländer kann bis auf den heutigen Tag in der Existenz des Franzosen noch keine Logik sehen, und umgekehrt: der Franzose versteht den Engländer nicht um ein Atom besser, und das gilt nicht nur vom Durchschnittsfranzosen, vom instinktiven Empfinden des Volkes, sondern sogar von seinen ersten Männern, sogar von den geistigen Repräsentanten beider Nationen. Der Engländer macht sich bei jeder Gelegenheit über seinen Nachbarn lustig und blickt mit unversöhnlicher Verachtung auf dessen nationale Eigenheiten. Ihre Gegnerschaft raubt ihnen die Unvoreingenommenheit und macht sie parteiisch. So hören sie auf, sich gegenseitig zu verstehen. Die Franzosen sehen mit anderen Augen auf das Leben als die Engländer und ebenso verschieden sind ihre Religionen – und darauf sind sie noch stolz! Immer beharrlicher und eigensinniger entfernen sie sich voneinander in ihren Gesetzen wie in ihrer Weltanschauung. Sowohl der Franzose wie der Engländer sieht in der ganzen Welt nur sich allein und in jedem anderen ein Hindernis auf seinem Wege; und ein jeder will nur bei sich das vollbringen, was bloß alle Völker zusammen vollbringen könnten, mit vereinten Kräften. Wie nun, sollte diese Gegnerschaft etwa nur ein Überbleibsel der früheren Kämpfe sein? Muß man die Ursachen der Entzweiung in der Zeit der Jeanne d’Arc oder in der der Kreuzzüge suchen? Ist denn die Zivilisation wirklich so machtlos, daß sie diesen alten Haß bis auf den heutigen Tag noch nicht hat überwinden können? Oder sollte man die Ursachen nicht vielmehr im Boden selbst, im Blut, im ganzen Geist der beiden Völker suchen? Auch die übrigen Europäer sind größtenteils wie jene. Die Idee der Allmenschheit schwindet bei ihnen mehr und mehr. Bei jedem Volk erhält sie ein anderes Aussehen, verblaßt zunächst und nimmt dann im Bewußtsein der Menschen eine ganz andere Gestalt an. Das Christentum, das sie bisher noch verband, verliert mit jedem Tage an Kraft und Bedeutung. Selbst die Wissenschaft vermag die immer mehr Auseinanderstrebenden nicht zu vereinen. Freilich haben sie insofern recht, als eben diese ihre Exklusivität, diese Gegnerschaft untereinander, diese ihre Abgeschlossenheit von anderen und dieses stolze Vertrauen auf sich allein – als gerade das ihnen die Riesenkräfte im Kampf mit den Hindernissen auf ihrem Wege gibt. Nur werden dadurch diese Hindernisse immer größer und zahlreicher. Dieser große Gegensatz ist es, der die Europäer hindert, die Russen zu verstehen, und so nennen sie die größte Eigenart des russischen Charakters – „Charakterlosigkeit“. Wir wissen, daß wir alles das vorläufig ohne Beweise aussprechen, doch die Anführung von Beweisen würde zu weit führen und über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen. Aber auch so wird man uns wenigstens beipflichten, daß der Charakter der russischen Nation sich aufs schärfste von den Charakteren der europäischen Nationen unterscheidet, denn wodurch er sich vornehmlich auszeichnet, ist seine hohe synthetische Begabung. Und doch hat die russische Nation jahrhundertelang feindlich auf Europa geblickt, hat eigensinnig nichts mit Europa zu tun haben wollen und hat seine Zukunft nicht einmal geahnt! Peter aber verspürte in sich gleichsam instinktiv die neue Kraft und erriet die Notwendigkeit einer Erweiterung des geistigen Horizonts und des Arbeitsfeldes für alle Russen. Ich sage „die Notwendigkeit“, weil es ihr Bedürfnis war, das sie unbewußt in sich trugen und das unbewußt aus ihnen hervorbrach, – das schon von Anbeginn, seitdem es überhaupt Slawen gibt, in ihrem Blute lag. Man sagt, Peter habe aus Rußland nur ein Holland machen wollen. Das wissen wir nicht. Die Persönlichkeit Peters ist trotz aller historischen Erklärungen und Forschungen der letzten Zeit für uns bis jetzt noch sehr rätselhaft. Wir begreifen nur eins: daß er doch mehr als nur originell sein mußte, um als Zar von Moskau in Holland Werftarbeiter zu werden. Jedenfalls sehen wir in Peter ein Beispiel dafür, wozu ein Russe sich entschließen kann, wenn er sich erst einmal voll und ganz überzeugt hat und fühlt, daß die Zeit gekommen ist und in ihm selber die neuen Kräfte schon herangereift sind. Schier unheimlich ist es, bis zu welchem Grade der Geist des Russen frei ist und von welch ungeheurer Gewalt sein Wille sein kann! Noch niemals hat sich jemand von seinem Boden so losgerissen, wie der Russe, und ist von seinem Wege so jäh abgebogen, um seiner neuen Überzeugung zu folgen! Und wer weiß, meine Herren Europäer, vielleicht ist es gerade Rußlands Bestimmung, solange zu warten, bis Sie Ihre Aufgabe beendet haben, inzwischen Ihre Ideen sich anzueignen, Ihre Ideale, Ihre Ziele, den Charakter Ihrer Bestrebungen zu begreifen, dann aber Ihre Ideen zu vereinen, sie zu allmenschlicher Bedeutung zu erheben und schließlich freien Geistes, frei von allen nebensächlichen Kasten- und Klasseninteressen, ein neues, großes, in der Geschichte noch unbekanntes Wirken zu beginnen, dort einsetzend, wo Sie aufhören, und Sie alle mitzureißen! Hat doch unser Dichter Lermontoff Rußland mit dem Recken unserer Sagen Ilja von Murom verglichen, der dreißig Jahre lang gelähmt in der Hütte saß, dann aber plötzlich aufstand und ging, als er mit einemmal Reckenkraft in sich verspürte. Wozu sind denn so reiche und eigenartige Fähigkeiten den Russen verliehen? Etwa nur zu dem Zweck, um zu nichts nütze zu sein?
Vielleicht wird man uns jetzt fragen, woher wir soviel Großtuerei, soviel Anmaßung uns angeeignet und wo denn unsere Selbstkritik geblieben, unser nüchterner Blick? Darauf entgegnen wir: wenn wir solange so unnachsichtige Selbstverurteilung ertragen haben, dann werden wir auch eine andere Wahrheit ertragen können, selbst wenn sie das gerade Gegenteil jener ersten Selbsterkenntnis ist. Wir erinnern uns noch sehr gut, wie wir uns ‚Slawen‘ schalten, weil wir uns nicht in Europäer verwandeln konnten. Sollten wir nun wirklich nicht gestehen dürfen, daß wir damals ohne Einsicht sprachen? Wir wollen deshalb die Fähigkeit der Selbstverurteilung nicht abschütteln, wir lieben sie und halten sie für eine der besten Seiten der russischen Natur, für ihre Eigenart, für etwas, was die Europäer nicht haben. Wir wissen, daß wir uns in unserer Selbstverurteilung noch lange werden üben müssen, ja vielleicht sogar – je länger, desto besser. Aber versuchen Sie doch einmal, meine Herren, dem Franzosen etwas Abfälliges zu sagen, nun z. B. was seine Tapferkeit betrifft oder seine légion d’honneur. Oder rühren Sie den Engländer in irgendeiner allergeringfügigsten seiner häuslichen Gewohnheiten an, und Sie werden sehen, was er Ihnen antwortet. Weshalb sollen wir nun nicht auch einmal eine unserer guten Seiten hervorheben – daß wir Russen nämlich nicht so empfindlich und pedantisch sind (ausgenommen vielleicht die sogenannten Generale unserer Literatur)! Wir glauben an die Kraft des russischen Geistes nicht weniger als gleichviel welche anderen Völker an ihren Geist. Sollten wir nun wirklich nicht das bißchen Lob vertragen? Nein, meine Herren Europäer! Verlangen Sie von uns vorläufig noch keine Beweise für die Richtigkeit unserer Äußerungen über Sie und über uns, bemühen Sie sich lieber, uns etwas besser kennen zu lernen, wenn Sie dazu nur die Muße finden. Da haben Sie sich Gott weiß von wem sagen lassen, wir seien Fanatiker, und Sie glauben, die Soldaten würden bei uns zum Fanatismus aufgestachelt. Mein Gott, wenn Sie wüßten, wie lächerlich diese Ihre Annahme ist! Wenn es in der Welt überhaupt ein Wesen gibt, das keinen Fanatismus kennt, so ist das gerade der russische Soldat. Und wie schlecht kennen Sie auch unsere Offiziere! Sie haben es sich nun einmal in den Kopf gesetzt, daß es bei uns nur zwei Stände gäbe: les boyards et les serfs, – und darauf sitzen Sie nun, stolz auf Ihr Wissen. Wo sind denn hier die Bojaren? Freilich gibt es bei uns verschiedene Stände, doch zwischen allen unseren Ständen gibt es mehr Vereinigungs- als Entzweiungspunkte. Das ist die Hauptsache. Das ist die Bürgschaft für den Frieden im Inneren, für die Ruhe im allgemeinen, die brüderliche Liebe und jedes Gedeihen. Jeder Russe ist vor allen Dingen Russe, erst in zweiter Reihe kommt in Frage, zu welch einem Stande er gehört. Bei Ihnen dagegen ist es ganz anders, und wir bedauern Sie deshalb. Ja bei Ihnen pflegt es gerade umgekehrt zu sein. Bei Ihnen ist aus Standesinteresse mitunter sogar die ganze Nation zum Opfer gebracht worden, und das noch sogar vor kurzem, das geschieht selbst jetzt noch und wird gewiß noch mehrmals geschehen. Folglich sind bei Ihnen die Stände noch sehr stark unterschieden, die Stände sowohl wie alle Ihre Korporationen.
Man wird uns nun vielleicht verwundert fragen wollen: „Aber worin besteht denn Ihre gelobte Fähigkeit, Ihre Fortgeschrittenheit? Uns deucht, zu sehen ist sie noch nirgends!“ – Ja, Sie sehen sie nicht, denn Sie richten Ihren Blick auch gar nicht dorthin, wohin man ihn richten muß. Es genügt, daß sie schon im Geist und im Verlangen des ganzen Volkes ist; es genügt, daß eine, wenn auch noch so kleine Gruppe anfängt, unter sich wenigstens im allgemeinen übereinzustimmen. Nennen Sie uns nicht dünkelhafte, kurzsichtige, unreife Menschen. Nein, wir haben schon lange den nötigen Einblick und suchen längst alles zu analysieren; wir quälen uns mit dem Hin- und Herraten; wir sind uns über dem Analysieren sogar selber zum Überdruß geworden. Wir haben doch auch gelebt und vieles erlebt. Übrigens, sollten wir Ihnen nicht einmal die Geschichte unserer Entwicklung, unseres Wachstums erzählen? Natürlich werden wir nicht mit Peter dem Großen beginnen; wir beginnen mit der jüngsten Zeit, eben mit der Zeit, als in unsere gebildete Schicht plötzlich die Analyse eindrang. Nun also ...
Es gab Augenblicke, wo wir, d. h. die Zivilisierten, an uns selbst nicht glaubten. Damals lasen wir noch französische Romane, lehnten aber einen Alexander Dumas und seine ganze Sippe mit Verachtung ab. Wir stürzten uns damals auf George Sand, aus deren Romanen wir zuerst das erfuhren, was die Zensur in anderen Werken nicht durchließ – oh, und mit welcher Begeisterung lasen wir George Sand! Damals hörten wir Ihr europäisches Urteil über uns demütig an und gaben Ihnen noch recht, meine Herren, im übrigen aber wußten wir nicht, was tun. Und weil wir nichts anzufangen wußten, begründeten wir die naturalistische Schule. Auch Byronianer gab es bei uns. Die taten größtenteils nichts, saßen müßig und verfluchten nicht einmal die Welt, was sie als Byronianer eigentlich doch hätten tun müssen. Höchstens lächelten sie mal, wenn ihre Faulheit es der Mühe wert fand. Ja sie spotteten sogar über Byron, weil er sich noch so geärgert und geweint und geflucht hatte, was doch zu einem Lord ganz und gar nicht paßte. Sie sagten, es lohne sich nicht, sich zu ärgern und zu verfluchen, es sei alles ohnehin schon so widerlich, daß man nicht einmal seinen Finger rühren wolle, und ein gutes Diner sei noch das beste vom Leben. Und wir hörten ihnen in Ehrfurcht zu und glaubten, in ihrem Ausspruch vom guten Diner irgendeine geheimnisvolle, allerfeinste und geistreichste Ironie zu vernehmen. Sie aber wurden dick und dicker, nicht nur mit jedem Tage, sondern fast mit jeder Stunde. Einige blieben auch bei der Theorie vom guten Diner nicht stehen und gingen folgerichtig weiter: sie fingen an, die eigenen Taschen auf Kosten anderer Taschen zu füllen. Viele wurden später Falschspieler, wir aber meinten: „Nun ja ... das tun sie doch auch aus Prinzip. Man muß doch vom Leben alles nehmen, was zu nehmen ist“. Und wenn sie vor unseren Augen Taschendiebstahl betrieben, so sahen wir auch darin nur eine besondere Art angewandten Byronismus, eine weitere Entwicklung und Anwendung desselben, die Byron noch unbekannt geblieben war. Wir seufzten und schüttelten betrübt das Haupt und klagten: „Da sieht man, wozu die Verzweiflung einen bringen kann: dieser Mensch ist erfüllt vom edelsten Unmut über das Schlechte, er brennt vor Verlangen nach Betätigung, aber man läßt ihn nichts tun, man gibt ihm kein Arbeitsfeld und da – und da unterschlägt er nun mit dämonischem Lächeln Karten oder wird zum Taschendieb.“ Und wie rein, wie kindlich unschuldig sind viele von uns aus dieser schmachvollen Atmosphäre hervorgegangen! Unendlich viele! – Fast sogar alle – außer den Byronianern, versteht sich.
Aber wir hatten doch auch manche Hochherzige, denen es gelang, ein überzeugendes, zündendes Wort zu sagen. Oh, die klagten nicht, daß man sie nicht sprechen und nicht arbeiten lasse, oder wenn sie auch klagten, dann doch nicht mit müßigen Händen, sondern sie taten, was und wie sie konnten, sie taten doch wenigstens etwas und ... haben viel, sehr viel getan! Sie waren naiv wie Kinder, konnten die Byronianer ihr Lebtag nicht begreifen und starben als Märtyrer. Friede ihrer Asche! Wir hatten auch Dämonen, echte Dämonen; es waren ihrer zwei[31] und – oh, wie wir sie liebten, wie wir sie auch heute noch lieben und schätzen! Der eine von ihnen lachte, lachte sein Leben lang, lachte über sich und über sie, und wir alle lachten mit ihm, lachten so lange, daß wir schließlich zu weinen anfingen von unserem Lachen. Der eine von ihnen machte aus einem Mantel, der einem Beamten abhanden kam, die furchtbarste Tragödie. Er zeichnete uns in drei Zeilen den ganzen Leutnant Pirogoff – den ganzen, bis auf das letzte Tüpfelchen. Er schilderte uns alle möglichen Menschen, Spekulanten und Hochstapler, Geizhälse und Betrüger, Beamte und Ehrenbürger. Er brauchte nur einmal mit dem Finger auf sie zu weisen und sie waren auf ewig gestempelt, so daß wir schon auf den ersten Blick wußten, wer sie sind und wie sie heißen. Oh, das war ein Dämon von so kolossaler Gewalt, wie Europa noch nie einen gehabt und bei sich vielleicht nicht einmal dulden würde. Und der zweite Dämon – doch diesen zweiten Dämon haben wir vielleicht noch mehr geliebt als den ersten. Er verfluchte und quälte sich, quälte sich wirklich; er rächte sich und vergab, er weinte und lachte, lachte auch über uns, wenn er schrieb, er war großmütig und ... lächerlich. Er erzählte uns sein Leben, seine Liebesabenteuer, er litt und wir litten mit ihm, und dennoch: wer weiß, ob wir von ihm nicht nur genasführt wurden? – Oft konnten wir nicht unterscheiden, ob er im Ernst sprach, wie es den Anschein hatte, oder ob er sich über uns lustig machte. Unsere Beamten kannten ihn auswendig und ein jeder von ihnen spielte den Mephisto, sobald er die Kanzlei verließ. Wir teilten niemals seine Ansichten, aber er bedrückte uns, machte uns traurig und wir ärgerten uns und wir empfanden Mitleid mit irgend jemandem, den wir nicht greifen, nicht nennen konnten, und sogar Wut erfaßte uns. Zuletzt langweilten wir ihn und er verfluchte und verhöhnte uns alle und verließ uns. Unsere Blicke folgten ihm lange – bis er schließlich irgendwo umkam, zwecklos, aus Kaprice, und sogar, wie gesagt, etwas lächerlich. Wir aber lachten nicht. Uns war damals überhaupt nicht nach Lachen zu Sinn. Jetzt ist es etwas anderes. Jetzt haben wir begriffen, daß wir diese ganze Mephistofelei, alle diese dämonischen Anschauungen etwas zu Voreilig uns angelegt, daß es für uns noch etwas zu früh war, uns selber zu verfluchen und an uns zu verzweifeln. Ja, das waren unsere Dämonen. Doch es gab auch noch andere Typen.
Zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft gibt es eine sogenannte „goldene Mittelmäßigkeit“, die auf die führende Rolle Anspruch erhebt. Diese „Goldenen“ haben eine ungeheuere Eigenliebe. Mit geradezu vernichtender Verachtung und unverschämter Anmaßung blicken sie auf alle herab, die noch unbekannt und nicht so „bedeutend“ sind wie sie. Sie aber sind die ersten, die auf jeden Neuerer Steine werfen. Und wie hämisch boshaft, wie beschränkt sind sie in ihrer Verfolgung jeder Idee, die noch nicht Zeit gehabt hat, in das Bewußtsein der Gesamtheit einzudringen. Dann aber – was für Marktschreier sie dann sind, was für eifrige und dabei doch stumpfe Anhänger derselben Idee, sobald diese erst einmal in der Gesellschaft Bedeutung erlangt hat! Allerdings begreifen auch sie schließlich den neuen Gedanken, nur begreifen sie ihn immer erst nach allen anderen und immer gleichsam roh, beschränkt, stumpf, und niemals lassen sie die Einsicht gelten, daß, wenn die Idee richtig ist, sie dann auch entwicklungsfähig sein muß und folglich mit der Zeit unbedingt einer anderen Idee weichen wird, die aus ihr selber hervorgeht und sie, wiederum den neuen Anforderungen einer neuen Generation entsprechend, vervollständigen muß. Aber die Goldenen verstehen nie die neuen Anforderungen, und was die neue Generation betrifft, so hassen sie diese stets und sehen stolz auf sie herab. Das ist sogar ihr bestes Erkennungszeichen. Unter diesen Goldenen gibt es immer eine große Menge Händler und Hausierer, deren Handelsobjekt die moderne Phrase ist. Sie sind es, die jeden neuen Gedanken gemein machen, ihn in eine Modephrase verwandeln. Alles was sie anfassen, machen sie gemein. Jede lebendige Idee wird in ihrem Munde zu einem Leichnam. Sie aber sind die ersten, die den Lohn für die neue Idee einheimsen: am Tage nach der Beerdigung des genialen Menschen, der die Idee verkündet hat und der gerade von ihnen zu seinen Lebzeiten verhöhnt und verachtet worden ist. Einige von ihnen sind sogar dermaßen beschränkt, daß sie im Ernst glauben, der geniale Mensch habe nichts getan – getan hätten alles sie allein. Ihr Eigendünkel ist schier unermeßlich. Sie sind geistig stumpf und unoriginell, ja sogar knechtisch sind sie, obschon sie der Menge klug erscheinen. Mit ein paar Schlagworten machen sie Eindruck, mit einigen gewagten scharfen Phrasen; dabei geraten sie gewöhnlich in Ekstasen, da sie weder den Sinn noch den geistigen Bau der Idee verstehen, und so schaden sie ihr selbst dann, wenn sie auch noch so aufrichtig die neue Ansicht teilen. Ein kleines aktuelles Beispiel: Die Denker und Philantropen beschäftigen sich mit der Lösung eines Problems, sagen wir meinetwegen mit der Frauenfrage. Es handelt sich um die soziale Stellung der Frau, um ihre Gleichberechtigung mit dem Mann, ihre bisherige Abhängigkeit vom Mann, usw. usw. Die „Goldenen“ verstehen das nun unbedingt in dem Sinne, daß die Ehe von Stund’ an über den Haufen geworfen werden soll – die Hauptsache ist für sie, daß es von Stund’ an geschehe. Ferner denken sie, daß jede Frau ihrem Manne nun nicht nur untreu sein kann, sondern ihm sogar untreu sein muß, und daß eben darin der ganze sittliche Wert und Sinn der Idee enthalten sei.
Am komischsten wirken diese Herren, wenn die Gesellschaft in einer zerfahrenen Übergangszeit sich in zwei Parteien teilt. Dann wissen sie nämlich nie, welcher Partei, welcher Meinung sie sich anschließen sollen, und dabei sind sie doch oft Autoritäten! Da heißt es nun für sie, sich entscheiden, seine Meinung äußern. Was tun? Nach langem Schwanken entscheidet sich der Goldene endlich und – jedesmal fürs Falsche. Das ist schon so sein Gesetz. Das ist sogar der charakteristische Zug der Goldenen. Ein Beispiel erleben wir jetzt in der Volksschulfrage. Man stützt sich auf die Tatsache, daß das gebildete Volk – d. h. das des Lesens und Schreibens kundige – die Gefängnisse fülle, und daraus folgern die Goldenen, daß Bildung fürs Volk schädlich sei. Die Tatsache, die sie als vermeintlichen Beweis dieser Schädlichkeit anführen, gibt es nur deshalb, weil die Kenntnis des ABC unter dem Volk noch so wenig verbreitet ist. Anstatt sie nun noch weniger zu verbreiten, sollte man sie gerade soviel als irgend möglich zum Allgemeingut machen. Erst dann, wenn der Bauer, der lesen und schreiben kann, nicht mehr eine solche Ausnahme unter seinesgleichen sein wird, erst dann wäre die eine Ursache aufgehoben, weshalb gerade die Nichtanalphabeten die Gefängnisse bevölkern. Überdies sollten unsere Goldenen doch nicht vergessen, daß das ABC der erste Schritt zur Bildung ist. Oder vielleicht gehört es sogar zu ihrem Regierungssystem, das Volk im Dunkeln zu halten? Freilich ... es gibt keinen Menschen, der verstockter und kapriziöser und schädlicher wäre, als es manch einer der Kabinettphilantropen ist. Doch genug davon. Wir sind überzeugt, daß selbst die geringste Elementarbildung das Volk sittlich heben, dem einzelnen mehr Selbstachtung verleihen und somit die Wurzel vieler Laster ausrotten würde. Alles hängt von den Verhältnissen ab, alles verändert sich nur entsprechend den Verhältnissen. Ist erst einmal das dringende Bedürfnis nach einem Neuen vorhanden oder wenigstens die Erkenntnis, daß die Gesamtheit zu ihrem Gedeihen einer Neueinführung bedarf, so wird sie alsbald auch Mittel und Wege finden, um das Notwendige auszuführen. Dagegen wird keine selbst wirklich gute Reform von der Masse als Verbesserung empfunden, sondern viel eher als neue Bedrückung, oder jedenfalls als etwas Lästiges, wenn ihr noch nicht die Notwendigkeit dieser Verbesserung zum Bewußtsein gekommen ist, und wäre es auch nur in einer noch so geringen Erkenntnis. Ebenso verhält es sich mit unserer Elementarschulfrage. Doch trotz aller Goldenen und deren Ansichten wissen wir, daß unsere Intelligenz, die sich vom Volksboden gelöst hat, das Volk – diese „unerratene Sphinx“, wie einer unserer Dichter es nennt – zu guter Letzt doch verstehen lernen wird. Sie wird den Geist des Volkes erfassen und ihn in sich aufnehmen, denn sie weiß bereits, daß dies die Grundlage unserer zukünftigen Entwicklung ist. Und sie hat schon erkannt, daß es an ihr ist, den ersten Schritt zu tun, um die Versöhnung und Vereinigung zustande zu bringen, und sie wird auch die Lösung finden, wie das geschehen muß.
Nun hängt alles vom ersten Schritt zur Annäherung ab: daß wir herausbekommen, wie wir es anfangen sollen, damit das Volk uns sein mißtrauisches Gesicht wieder zuwendet. Natürlich werden sich noch eine Menge Herren finden, die über unsere Worte lachen können. Wir wissen, daß es solcher Menschen eine Legion gibt, doch gehen sie uns nichts an. Übrigens hat jemand, wie wir hören, versichert, wir, d. h. unsere Zeitschrift, sähe ihre Aufgabe darin, eine Versöhnung zwischen der europäischen Zivilisation und unserem Volksgeist zustande zu bringen. Wir halten diese Äußerung nur für einen Scherz. Nicht ein einzelner Mensch kann das noch unbekannte Wort der Versöhnung sagen und dieses Problem lösen. Wir versuchen ja nur die Hauptidee, die uns leiten wird, anzugeben. Wir werden gleich allen anderen die Lösung des Problems suchen, werden unermüdlich wiederholen und beweisen, daß gesucht werden muß; wir werden forschen, das Material verarbeiten, unsere Eindrücke und Gedanken den Lesern mitteilen – darin wird unsere ganze Tätigkeit bestehen. Ein Wort ist gleichfalls eine Tat, und bei uns noch mehr als sonstwo. Ein Wort zur rechten Zeit kann von unschätzbarem Nutzen sein. Deshalb haben wir die Hoffnung, daß auch wir nützlich sein werden. Unsere Zeitschrift wendet sich an unsere gebildeten Kreise, nicht an das Volk, denn noch immer ist das erste Wort und der erste Schritt die Aufgabe der gebildeten Kreise gewesen. Dasselbe erwarten wir auch in diesem Fall, um so mehr, als es die gebildete Schicht war, die sich vom Volk entfernte. Die Annäherung wird noch viel Mühe kosten, das fühlen wir alle, obschon wir noch nicht klar sehen, worin die Schwierigkeiten bestehen werden. Die Hauptsache ist wohl die Beseitigung der Mißverständnisse, und die sind immer durch Geradheit, Offenheit und Liebe zu beseitigen. Wir haben bereits erkannt, daß die Interessen unseres Standes im Volk ruhen und die des Volks in uns. Wenn diese Erkenntnis allgemein wäre, so wäre der Erfolg gewiß. Aber obschon sie noch nicht allgemein ist, so sind doch Anzeichen vorhanden, daß sie sich bereits zu verbreiten anfängt, vorläufig aber genügt das auch. Es ist möglich, daß diejenigen, die die Annäherung wünschen, in ihren Versuchen tausend Fehler begehen werden, doch was tut das! – eine gerechte Sache ist deshalb noch nicht verloren. Wenigstens bleibt die Idee unerschüttert. Worauf es ankommt, ist – daß das Volk unseren Willen sieht und ihn begreifen lernt. Und das zu erreichen, dazu wird uns die Liebe am ehesten helfen, da sie verständlicher ist als alle Schlauheiten und diplomatischen Finessen. Liebe ist leicht zu erkennen, das Volk ist einsichtig und dankbar und fühlt sofort, von wem es geliebt wird. Ein Vorbild der Annäherung hat uns der Zar gegeben, indem er das letzte Hindernis auf dem Wege zur Vereinigung beseitigte: indem er die Leibeigenschaft aufhob – und es gibt nichts Höheres, Heiligeres in der ganzen tausendjährigen Geschichte Rußlands als es diese Tat des Herrschers ist. Wohl haben wir in den letzten anderthalb Jahrhunderten nichts getan, als das Volk zu Mißtrauen gegen uns zu erziehen, aber wenn nur der Wille da ist, werden wir es doch erreichen, daß wir wieder sein Zutrauen und seine Achtung erringen. Und welche Riesenkräfte werden wir dadurch gewinnen! Wie wird alles wachsen, erstarken, sich erneuern! Natürlich wird von der ganzen dazu erforderlichen Kraft nur ein Zehntel von uns stammen, die übrigen neun Zehntel bringt das Volk selber auf.
„Aber was wollen Sie denn mit Ihrer Bildung anfangen?“ hören wir fragen.
„Sie wollen das Volk bilden, d. h. dem Volk dieselbe europäische Zivilisation geben, die Sie selbst schon als nicht zu uns passend erkannt haben. Sie wollen also einfach das Volk europäisieren?“
Hierauf entgegnen wir, daß es doch nicht gut möglich ist, von der europäischen Idee auf einem ihr vollständig fremdem Boden dieselben Früchte zu erwarten, die sie auf ihrem europäischen Boden gezeitigt hat. Bei uns ist alles dermaßen anders, ist alles so unähnlich Europa, sowohl innerlich wie äußerlich, wie überhaupt in jeder Beziehung, daß es ganz ausgeschlossen ist, europäische Resultate von uns zu erwarten. Deshalb wiederholen wir: was zu uns paßt, das wird bleiben, was nicht paßt, wird von selbst wegfallen. Es ist ausgeschlossen, daß man unser Volk zu Deutschen oder anderen Europäern machen könnte. Im Vergleich zum Volk sind wir, die Intelligenz, nur ein verschwindend kleines Häuflein, und folglich sind auch unsere selbständigen Kräfte um soviel geringer als die der ganzen riesengroßen Volksmasse. Und doch haben wir uns ganze anderthalb Jahrhunderte in Europa aufgehalten, ohne deshalb zu Deutschen geworden zu sein. Folglich haben auch wir, ungeachtet unserer geringen Zahl und Kräfte und unserer Losgelöstheit vom Volksboden, die großen russischen Grundideale der Allmenschlichkeit und Allversöhnung in uns getragen und sie auch in dieser Zeit nicht eingebüßt. Jetzt haben sie sich in uns erhoben. Wir begriffen, daß wir nichts anderes werden können, als das, was wir sind. Und es kam das Verlangen über uns, zu unserem Volk zurückzukehren. Wir fingen an, uns unserer Untätigkeit, unserer Unselbständigkeit inmitten der ungeheuren Tätigkeit der europäischen Völker zu schämen – und wir begriffen, daß wir in Europa nichts zu tun haben. Anderseits steht nicht zu befürchten, daß die europäische Wissenschaft unserem Volk eine Fessel auflegen werde; sie wird nur sein Arbeitsfeld vergrößern und ihm die Möglichkeit geben, auch sein Wort in der Wissenschaft zu sagen. Bisher war die Wissenschaft bei uns wie eine seltene Treibhauspflanze, und unsere Gesellschaft hat eine besondere wissenschaftliche Betätigung weder in der Theorie noch in der Praxis bewiesen, denn sie war vom Volk losgerissen und an und für sich kraftlos. Nur die Krone hat Brücken und Wege gebaut und auch das meist mit Hilfe fremder Ingenieure. Aber auch die Wissenschaft wird schließlich bei uns Wurzel fassen – vielleicht erst in einer Zeit, wenn wir nicht mehr sind. Wir können noch nicht einmal ahnen, was dann sein wird, doch wir wissen, daß unsere Zukunft nicht schlecht sein kann. Unserer Generation aber ward die Ehre zuteil, das erste Wort auszusprechen und den ersten Schritt zu tun.
In den Kreisen unserer Intelligenz pflegen jetzt viele, wenn man mit ihnen vom Volk spricht, gegen ein Auseinanderhalten von Volk und Intelligenz zu protestieren: „Was für ein Volk? Auch ich bin Volk!“ heißt es.
Im achten Teil des Romans „Anna Karenina“ sagt Lewin, der geliebte Held des Autors, auch von sich, daß er Volk sei. Diesen Lewin habe ich früher einmal einen Menschen mit reinem Herzen genannt. Obschon ich nun unverändert fortfahre, an die Reinheit seines Herzens zu glauben, glaube ich doch nicht, daß er – Volk sei. Im Gegenteil, ich sehe jetzt, daß auch er sich mit Vorliebe absondert. Überzeugt habe ich mich davon, als ich diesen achten und letzten Teil des Romans las. Lewin ist ja allerdings keine gegenwärtige, keine lebende Persönlichkeit, sondern nur die Phantasiegestalt eines Schriftstellers; aber dieser Schriftsteller, der ein ungeheures Talent, ein bedeutender Geist und ein von der Intelligenz Rußlands überaus geachteter Mensch ist, läßt diese Phantasiegestalt auch seine, des Autors, persönlichen Ansichten entwickeln, was besonders deutlich in diesem letzten Teil geschieht, wobei er in scharfen Widerspruch mit der gegenwärtigen russischen Wirklichkeit gerät. Das aber dürfte doch schon ein ernstes Thema für eine Erörterung sein, selbst in unserer so bewegten Zeit, die voll ist von großen, erschütternden, in schneller Reihenfolge sich entwickelnden Ereignissen. Denn wenn wir von dem nicht existierenden Lewin reden, reden wir ja in Wirklichkeit von den Ansichten eines der bedeutendsten Russen unserer Zeit. Und diese Ansichten betreffen die gegenwärtige russische Tat: den Balkankrieg.
Das Wesentliche dieser Ansichten besteht, wenn ich den Autor richtig verstanden habe, hauptsächlich darin, daß unsere ganze sogenannte nationale Bewegung zugunsten der slawischen Brüder von unserem Volk keineswegs geteilt und sogar überhaupt nicht verstanden werde.
So sehen wir, daß auch Lewin, der Mensch mit dem reinen Herzen, sich von der riesigen Mehrzahl der Russen lossagt und absondert. Seine Ansicht ist übrigens gar nicht neu und originell. Sie wäre denen, die im letzten Winter bei uns in Petersburg fast ebenso dachten – und das waren ihrer sozialen Stellung nach durchaus nicht obskure Leute – sehr gelegen gekommen, weshalb man es bedauern könnte, daß das Buch ein wenig zu spät erschienen ist. Aus welchem Grunde diese finstere Absonderung Lewins erfolgte, vermag ich nicht festzustellen. Allerdings ist er ein heißer, „unruhiger“, alles analysierender Mensch, der streng genommen in keiner Beziehung sich selber traut. Aber immerhin ist dieser Mensch „reinen Herzens“, dabei bleibe ich, obschon es schwer zu erraten ist, auf welchen geheimen und mitunter sogar lächerlichen Wegen das widernatürlichste, künstlichste und sogar schändlichste Gefühl in manch ein beispielhaft aufrichtiges und reines Herz eindringen kann. Übrigens möchte ich noch vorausschicken, daß ich diesen Lewin doch nicht mit der Person des Autors identifiziere, obwohl der Autor, wie sehr viele behaupten und wie auch ich deutlich sehe, seine eigenen Überzeugungen und Ansichten durch Lewin aussprechen läßt, ja sie ihm oft fast mit Gewalt in den Mund legt, bisweilen sogar auf Kosten der künstlerischen Geschlossenheit des gezeichneten Charakters. Ich sage das aus einer gewissen bitteren Verwunderung heraus, denn wenn auch sehr vieles von dem, was Lewin sagt, nur die Ansichten Lewins, des erdichteten Menschen, des künstlerisch dargestellten Charakters sind, so kann ich doch nicht leugnen, daß ich, was des Autors eigene Ansichten betrifft, nicht solche Ansichten gerade von diesem Autor erwartet hätte!
Hier sehe ich mich gezwungen, zunächst einzelne meiner Gefühle darzulegen, trotz meines Vorsatzes mich nicht mit literarischer Kritik zu befassen. Aber wenn ich diese Ansichten auch gelegentlich der Kritik eines literarischen Werkes ausspreche, so haben sie doch nichts mit denen eines Literaturkritikers zu schaffen. Tatsächlich schreibe ich in diesem „Tagebuch“ alle meine Gedanken über meine Eindrücke nieder, schreibe somit über alles, was mir von den laufenden Ereignissen und Vorgängen bemerkenswert erscheint, und da habe ich es mir nun Gott weiß weshalb zum Vorsatz gemacht, von meinen vielleicht stärksten Eindrücken zu schweigen, bloß deshalb, weil sie die russische Literatur betreffen. Natürlich lag diesem Vorsatz ein ganz richtiger Gedanke zugrunde, aber eine buchstäbliche Befolgung des Vorsatzes ist dennoch nicht richtig, das sehe ich jetzt ein, eben weil es eine Befolgung des Buchstabens wäre. Zudem ist dieser Roman in meinen Augen nicht mehr ein einfaches literarisches Werk, sondern schon eine ganze nationale Tat, ein Faktum von bereits ganz anderer Bedeutung. Diese Tat, die die Schöpfung dieses Romans zweifellos ist, fiel für mich in diesem Frühjahr mit der enormen Tat der Kriegserklärung zusammen und in meinem Geist sah ich beide Taten sofort in Verbindung miteinander, denn ich fand zwischen ihnen einen mich selbst überraschenden bedeutungsvollen Zusammenhang.
Im April begann unser großer Krieg für eine große hochherzige Idee: die geknechteten und mißhandelten slawischen Völker zu befreien und ihnen ein neues Leben zu ihrem und der Menschheit Wohl wiederzugeben. Dieser Zweck des Krieges ist für Europa so unbegreiflich, daß es ihn nur für einen listigen Vorwand hält und uns mit allen Mitteln zu schaden sucht. So hat es sich schon mit unserem Feinde gegen uns verbündet – wenn auch nicht in einem offiziellen Bündnis –, um wenigstens heimlich gegen uns zu kämpfen, in Erwartung des offenen Kampfes. Doch davon ein anderes Mal. Ich wollte hauptsächlich von dem Eindruck sprechen, den alle diejenigen empfangen mußten, die an die große zukünftige universale Bedeutung Rußlands glauben, als sie in diesem Frühjahr die Kriegserklärung lasen. Dieser einzig dastehende Krieg, um Schwachen und Bedrückten Leben und Freiheit zu geben, nicht ihnen zu nehmen, dieser in der heutigen Welt gar nicht mehr glaubwürdig klingende Kriegszweck war für alle, die an Rußlands Zukunft glauben, eine Tatsache, die feierlich und bedeutungsvoll diesen ihren Glauben bestätigte. Das war nun nicht mehr lediglich ein Traum, eine Vermutung bloß, sondern Wirklichkeit, war Tatsache, durch die die Hoffnungen bereits in Erfüllung zu gehen begannen. „Wenn aber der Anfang schon gemacht ist, dann wird auch alles andere in Erfüllung gehen, auch das, daß Rußland an der Spitze aller vereinigten Slawen sein großes neues Wort Europa sagen wird. Und selbst dieses Wort hat sich bereits angekündigt, doch ist Europa noch weit davon entfernt, dasselbe zu verstehen, und selbst wenn es versteht, wenn es verstehen muß, wird Europa noch lange nicht an das neue Wort glauben.“ So dachten damals die „Gläubigen“. Ja, der Eindruck war feierlich und bedeutungsvoll, und selbstverständlich mußte der Glaube der Gläubigen sich festigen und erstarken. Doch der begonnene Krieg ist immerhin von unberechenbarer Tragweite, so daß auch für uns, die wir an Rußland glauben, beunruhigende Fragen sich einstellten. Rußland und Europa! Rußland hat das Schwert gegen die Türken gezogen, aber wer weiß, vielleicht stößt es dabei mit Europa zusammen, und das – wäre das nicht zu früh? Der Zusammenstoß mit Europa ist etwas anderes als der mit der Türkei und wird nicht nur mit dem Schwert ausgefochten werden, so haben es die Gläubigen von jeher aufgefaßt. Aber sind wir nun auch zu diesem anderen Zusammenstoß bereit? Freilich, das Wort hat sich bereits angekündigt, aber ganz abgesehen von den Europäern – wird es denn auch bei uns von allen verstanden? Wir Gläubigen sagen z. B., daß Rußland allein die Elemente in sich trage, die zu einer Lösung des verhängnisvollen europäischen Problems des vierten Standes, und zwar ohne Kampf und Blut, ohne Haß und Feindschaft, erforderlich sind, daß es aber dieses Wort erst dann sagen werde, wenn Europa bereits im eigenen Blute schwimmt, denn vorher würde ja doch niemand in Europa unser Wort vernehmen, oder wenn auch vernehmen, so würde es doch niemand verstehen. Ja, wir Gläubigen glauben daran, aber was antwortet man uns darauf selbst hier in Rußland? Selbst hier sagen uns unsere Landsleute, dies seien nur fanatische Illusionen, die Weissagungen sein wollen, seien nur wilde Träume, und wir sollten ihnen doch Beweise geben, sichere Anzeichen und bereits greifbare Tatsachen! Ja was könnten wir ihnen nun zur Bekräftigung unserer Weissagungen nennen? Etwa die Aufhebung der Leibeigenschaft – ein Faktum, das bei uns noch so wenig begriffen worden ist in seiner Bedeutung als Beweis russischer Geisteskraft? Oder die angeborene Natürlichkeit unserer Nächstenliebe, die schon in unserer Zeit immer deutlicher aus all dem hervorzutreten anfängt, was sie jahrhundertelang fast bis zum Ersticken bedrückt hat? Doch gut, wir weisen also darauf hin: da wird man uns denn entgegnen, daß all diese Tatsachen wiederum nur von unseren tollen Illusionen zu solcher Bedeutung aufgebauscht worden seien; überdies würden sie verschieden gedeutet und somit könne man sie überhaupt nicht als irgendwelche Beweise gelten lassen. Das würden uns fast alle antworten. Und nun bedenke man: wir, die wir uns selber noch nicht verstehen und die wir so wenig an uns glauben, wir – stoßen mit Europa zusammen! Europa aber – das ist doch etwas Ungeheures, Heiliges! Uns ist es teuer, dieses Land, teuer der zukünftige, der im Frieden errungene Sieg des großen christlichen Geistes, der sich im Osten am reinsten erhalten hat ... Und in der Erwägung der Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit Europa im Laufe unseres jetzigen Krieges fürchten wir am meisten, daß Europa uns mißverstehen könnte und uns wie früher, wie gewöhnlich, mit Hochmut, mit Verachtung und mit dem Schwert begegnen werde, als wären wir wilden Barbaren nicht wert, vor Europa den Mund aufzutun. Ja aber, fragten wir uns nun, was werden wir ihnen denn sagen oder zeigen, damit sie uns richtig zu verstehen anfangen? Wir haben doch, scheint es, noch so wenig von solchen Gütern, die ihnen verständlich wären und um deretwillen sie uns achten könnten? Denn unsere fundamentale, wichtigste Idee, unser beginnendes „neues Wort“ werden sie noch lange, gar zu lange nicht verstehen. Sie brauchen Fakta, die sie unmittelbar, die sie heute schon verstehen könnten, verstehen mit ihrem heutigen Blick. Und mit diesem Blick fragen sie uns: „Wo ist denn Ihre Zivilisation? – läßt sich denn in dem Chaos, welches wir alle bei Ihnen sehen, eine Ordnung der ökonomischen Kräfte wahrnehmen? Wo ist Ihre Wissenschaft, Ihre Kunst, Ihre Literatur?“
Gerade in dieser Zeit, d. h. in diesem Frühjahr, traf es sich einmal, daß ich auf der Straße einem unserer Schriftsteller begegnete, den ich zu den am meisten von mir geliebten Autoren zähle. Wir sehen uns sehr selten, alle paar Monate einmal, und auch dann immer zufällig und auf der Straße. Er ist einer der hervorragendsten der fünf oder sechs unserer Belletristen, die alle zusammen aus irgendeinem Grunde die „Plejaden“ genannt werden[32]. Wenigstens hat die Kritik in Übereinstimmung mit dem Publikum sie von allen anderen Schriftstellern ihrer Art abgeteilt, und so ist es denn seit langem geblieben – der Kreis der „Plejaden“ erweitert sich nicht. Es ist mir stets eine Freude, mit diesem liebenswürdigen Romancier, den ich so überaus schätze, zusammenzutreffen und ihm unter anderem zu beweisen, daß ich es nicht glaube und auch gar nicht glauben könne, daß er, wie er sagt, alt geworden sei und nichts mehr schreiben werde. Nach einem kurzen Gespräch mit ihm trage ich immer eines seiner feinen und weitsichtigen Worte mit mir fort. Bei jener letzten Begegnung gab es viel Stoff zu einer Unterhaltung, denn der Krieg war schon erklärt. Doch er begann sofort und ohne Umschweife von „Anna Karenina“ zu sprechen (auch ich hatte gerade den siebenten Teil gelesen, mit welchem der Roman im „Russischen Boten“ schloß), und da er anscheinend nicht zu den Leichtbegeisterten gehört, war ich überrascht, als ich ihn mit leidenschaftlicher, überzeugter Begeisterung über dieses Werk urteilen hörte.
„Das ist etwas Beispielloses, das ist ein Werk von erstem Range! Wer kann sich bei uns, von den Schriftstellern, damit messen? Und in Europa – wer? Wer könnte dort etwas Ähnliches vorweisen? Haben sie dort in allen ihren Literaturen jetzt oder in den letzten Jahren oder überhaupt in neuerer Zeit ein Werk hervorgebracht, das sich neben dieses stellen könnte?“
Hauptsächlich überraschte mich an diesem Urteil, das übrigens vollkommen mit dem meinigen übereinstimmte, daß dieser Hinweis auf Europa geradezu eine Antwort war auf die Fragen und Zweifel, die sich damals in so vielen Herzen ganz von selbst erhoben. So erhielt dieses Buch in meinen Augen die Bedeutung eines Faktums, auf das wir Europa als Antwort auf jene Fragen hinweisen könnten. Natürlich wird man spöttisch einwenden, das sei ja im ganzen nur Literatur, nur irgendein Roman, und es sei lächerlich, die Bedeutung desselben so zu übertreiben und mit einem Roman gegen Europa aufzutreten. Ich weiß, daß man lachen wird, doch diese Aufregung ist überflüssig, denn ich übertreibe keineswegs und sehe die Dinge ganz nüchtern. Ich weiß, daß es allerdings nur ein Roman ist, nur ein Tropfen von dem, was nötig wäre. Für mich aber besteht die Hauptsache darin, daß dieser Tropfen bereits vorhanden, bereits Wirklichkeit ist, wenn aber der Anfang schon Tatsache ist, d. h. wenn das Genie Rußlands schon dieses Faktum hervorzubringen vermocht hat, so ist es folglich nicht zur Unfruchtbarkeit verdammt, nicht der Kraftlosigkeit geweiht, sondern kann schöpferisch sein, kann etwas Eigenes geben, kann sein Wort anheben und es zu Ende sprechen, wenn die Zeit gekommen sein wird. Und überdies ist jenes Werk doch weit mehr als nur ein Tropfen. Oh, auch hierin mache ich mich nicht im geringsten einer Übertreibung schuldig: ich weiß nur zu gut, daß nicht nur nicht in einem einzelnen Schriftsteller der Plejaden, sondern auch in ihnen allen zusammen nicht das zu finden ist, streng genommen, was man geniale schöpferische Kraft nennt. Unstreitige Genies mit einem unstreitig „neuen Wort“ hat es in unserer ganzen Literatur nur drei gegeben. Lomonossoff, Puschkin und zum Teil Gogol. Diese ganze Plejadengruppe dagegen (und der Autor der „Anna Karenina“ gehört gleichfalls zu ihr) ist unmittelbar aus Puschkin hervorgegangen, aus einem der größten Russen, den man aber fast überhaupt noch nicht verstehen gelernt hat. Puschkin ist der Vertreter von Ideen, die gleichsam die Veranschaulichung des Künftigen oder der Bestimmung ganz Rußlands und seines Zieles, das heißt soviel wie unseres ganzen zukünftigen Schicksals sind.
Alle unsere jetzigen „Plejaden“ haben nur nach Puschkins Hinweisen gearbeitet, etwas Neues aber haben sie nach ihm nicht gesagt. In ihm lagen bereits alle die Keime, die die Plejaden später entwickelt haben. Und dabei haben sie nur den kleinsten Teil der von ihm hinterlassenen Aufgaben ausgearbeitet. Dafür ist freilich das, was sie getan haben, mit solchem Reichtum an Kraft, mit solcher Tiefe und Deutlichkeit ausgearbeitet worden, daß Puschkin sie selbstverständlich anerkannt hätte. „Anna Karenina“ ist, was die Idee des Werkes betrifft, gewiß nichts Neues, wenigstens bei uns nichts Neues. Statt dieses Werkes könnten wir Europa natürlich ebensogut die Quelle selbst nennen, d. h. Puschkin als schärfsten, stärksten und unerschütterlichsten Beweis für die Selbständigkeit des russischen Genies und sein Recht auf die größte universale, allmenschliche und allvereinende Bedeutung in der Zukunft. Doch leider wissen wir, daß, wieviel wir auch reden und vorweisen wollten, Europa unsere Schriftsteller noch lange nicht lesen wird, oder selbst wenn man es dort täte, so würde man uns doch noch lange nicht verstehen und nicht schätzen. Und die Europäer sind ja auch noch gar nicht imstande, uns zu verstehen, nicht etwa aus Mangel an Geist, sondern weil wir für sie eine ganz andere Welt sind, als wären wir vom Monde auf die Erde versetzt, weshalb sie sogar die Tatsache, daß wir doch immerhin existieren, gar nicht zugeben möchten. Das weiß ich besser als mancher andere und rede deshalb von den Hinweisen, mit denen wir Europa auf die bewußten Fragen antworten könnten, nur in dem Sinne unserer eigenen Überzeugung von unserem Recht auf Selbständigkeit Europa gegenüber.
Nichtsdestoweniger ist „Anna Karenina“ als Kunstwerk etwas Vollkommenes – ist ein Werk, dem die europäischen Literaturen der Gegenwart nichts Gleichwertiges gegenüberstellen können; was aber die Idee dieses Werkes betrifft, so ist sie bereits etwas ganz Nationales, ist gleichsam ein Stück von uns, ist eben das, was unsere Besonderheit vor der ganzen europäischen Welt ausmacht, und ist somit unser „neues Wort“ oder wenigstens der Anfang desselben – ein Wort, das in Europa niemand zu sagen versteht, dessen aber gerade Europa so dringend bedarf, trotz seines ganzen Stolzes. Ich kann mich hier nicht in einer literarischen Kritik ergehen, doch will ich immerhin ein paar Worte über dieses Buch sagen.
In diesem Werk ist eine Untersuchung der Schuld und des Verbrechens der Menschen durchgeführt. Die geschilderten Menschen sind unter unnormalen Bedingungen genommen. Das Böse besteht schon vor ihnen. In den Strudel der Lüge hineingerissen, begehen diese Menschen ein Verbrechen und gehen unrettbar ins Verderben. Wie Sie sehen, ein Gedanke, der das liebste und älteste der europäischen Themen behandelt. Aber wie wird nun ein solches Problem in Europa gelöst? Sehr einfach. Und zwar gibt es dort zwei Arten von Lösungen. Die erste Lösung ist: das Gesetz ist gegeben, niedergeschrieben, formuliert, ist in Jahrtausenden ausgearbeitet, Gut und Böse festgestellt, aufgewogen, die Maße und Grade sind historisch von den Führern der Menschheit in unermüdlicher Arbeit an der Menschenseele und in höherer wissenschaftlicher Untersuchung der Gesetze des menschlichen Zusammenlebens festgesetzt. Diesem ausgearbeiteten Kodex ist ein jeder blinden Gehorsam schuldig. Wer das nicht tut und jene Gesetze übertritt, der bezahlt das mit seiner Freiheit, seinem Eigentum, seinem Leben, bezahlt buchstäblich und unmenschlich.
„Ich weiß,“ sagt ihr anderen, „daß das sowohl blind wie mitleidlos und unhaltbar ist, da ja die endgültige Formel der Menschheit auf ihrem halben Wege noch nicht ausgearbeitet sein kann. Doch da es einen anderen Ausweg nicht gibt, so muß man sich eben an das halten, was man hat, was schwarz auf weiß gegeben ist, und zwar buchstäblich und rücksichtslos. Täte man das nicht – so wäre man schlimmer daran. Somit kann man sagen, daß wir, trotz der ganzen Unnatürlichkeit und Unsinnigkeit der Ordnung dessen, was wir unsere große europäische Zivilisation nennen, nichtsdestoweniger danach trachten müssen, daß die Kräfte des Menschengeistes gesund und unbeschädigt bleiben, daß die Gesellschaft nicht an dem Glauben, sie befinde sich auf dem Wege zur Vollkommenheit, zu zweifeln anfängt und nicht zu denken wagt, es sei das Ideal des Schönen und Erhabenen verdunkelt und der Begriff von Gut und Böse entstellt und umgedeutet, das Normale werde mehr und mehr verdrängt, Einfachheit und Natürlichkeit gingen unter dem Druck der unausgesetzten anwachsenden Lüge verloren.“
Die zweite Lösung ist das Gegenteil der ersten: sie geht von der Annahme aus, daß die menschliche Gesellschaft unnormal aufgebaut sei, weshalb man den einzelnen für die Folgen dieser Unnormalität nicht verantwortlich machen könne. Also ist der Verbrecher frei von jeder Verantwortung und folglich gibt es vorläufig überhaupt kein Verbrechen. Will man nun mit dem, was allgemein Verbrechen genannt wird, und mit der Schuld der Menschen ein Ende machen, so muß man das zunächst mit der Unnormalität der Gesellschaft und ihres sozialen Aufbaus tun. Da aber eine Korrektur der bestehenden Ordnung der Dinge langwierig und unzuverlässig, ja sogar aussichtslos wäre, und man übrigens auch keine Mittel dazu hat, so muß man den ganzen bisherigen Bau der Gesellschaft zerstören und die alte Ordnung gleichsam mit dem Besen auskehren. Dann kann man alles von neuem beginnen, nach neuen Grundsätzen, die zwar noch unbekannt sind, aber immerhin nicht schlechter sein können als die der gegenwärtigen Ordnung; im Gegenteil, sie haben sogar viele Aussicht auf vollen Erfolg, denn unser Vertrauen gehört der Wissenschaft.
Das wäre die zweite Lösung. Man erwartet den zukünftigen Ameisenbau, inzwischen aber überschwemmt man die Welt mit Blut. Andere Lösungen der menschlichen Schuld und der Verbrechen kennt die westeuropäische Welt nicht.
In der Anschauung des russischen Autors – d. h. in seiner Auffassung von Schuld und Verbrechen – tritt dagegen deutlich hervor, daß kein Ameisenbau, kein Triumph des „vierten Standes“, keine Beseitigung der Armut, keine Organisation der Arbeit die Menschheit vor der Unnormalität bewahren wird oder würde, und folglich auch nicht vor Schuld und Verbrechen. Ausgedrückt ist das in einer unvergleichlichen psychologischen Ergründung der Menschenseele und mit furchtbarer Tiefe und Kraft durch einen bei uns bisher nicht gekannten Realismus der künstlerischen Darstellung.
Es ist klar und verständlich bis zur leibhaftigen Sichtbarkeit gezeigt, daß das Böse im Menschen tiefer sitzt als die Sozialisten annehmen, die sich als Ärzte aufspielen, daß das Böse sich in keiner sozialen Organisation, und wäre sie noch so vollkommen, vermeiden läßt, daß die Seele des Menschen überall dieselbe bleibt, daß das Unnormale und die Sünde aus ihr allein hervorgehen und daß schließlich die Gesetze des Menschengeistes noch so unbekannt, von der Wissenschaft noch so unerforscht, so unbestimmt und so geheimnisvoll sind, daß es bis jetzt weder gründliche Ärzte noch selbst endgültige Richter gibt und auch nicht geben kann, außer dem einen, der da sagt: „Die Rache ist mein, ich will vergelten.“ Nur er allein kennt das ganze Geheimnis dieser Welt und das definitive Schicksal des Menschen. Der Mensch aber kann sich noch nicht unterfangen, mit dem Stolz eigener Unfehlbarkeit zu richten, noch ist die Zeit nicht gekommen. Der Mensch, der Richter ist über andere, muß von sich wissen, daß er kein endgültiger Richter, vielmehr selber ein Sünder ist, daß die Wage und das Maß in seiner Hand eine Absurdität sind, wenn er sich nicht selbst vor dem Gesetz des noch unerforschlichen Geheimnisses beugt und nicht in dem einzigen Ausweg seine Zuflucht sucht – in der Barmherzigkeit und in der Liebe. Auf daß aber der Mensch nicht umkomme vor Verzweiflung und womöglich in der Überzeugung untergehe, daß das Böse von geheimnisvoller und verhängnisvoller Unvermeidlichkeit sei, ist dem Menschen eben ein Ausweg gezeigt. Ihn hat der Dichter mit der Überzeugungskraft des Genies in der genialen Szene offenbart, die im Krankenzimmer der Heldin des Romans sich abspielt – wo die Verbrecher und Feinde sich plötzlich in höhere Wesen verwandeln, in Brüder, die einander alles verzeihen und eben durch dieses ihr gegenseitiges Verzeihen Lüge, Schuld und Verbrechen von sich abstreifen und sich dadurch mit einem Schlage selbst rechtfertigen, im vollen Bewußtsein dessen, daß sie das Recht dazu erhalten haben. Dann aber, im Schlußteil des Romans, in der schrecklichen Schilderung des Falles der Menschenseele, der Schritt für Schritt verfolgt wird, in der Wiedergabe jenes unüberwindlichen Zustandes, wo das Böse sich der Seele des Menschen bemächtigt und ihn fesselt, jede Bewegung, jede Widerstandskraft, jeden Gedanken, jede Lust zum Kampf gegen das Böse lähmt, im Kampf gegen die Finsternis, die sich auf die Seele senkt und von ihr in der Leidenschaft des Rachedurstes bewußt statt des Lichtes erwählt wird – in dieser Schilderung liegt für den Richter der Menschen, der das Maß und die Wage hält, so viel offenbarte Wahrheit, daß er natürlich erschrocken Bedenken tragen und ausrufen wird: „Nein, nicht immer ist die Rache mein, nicht immer werde ich vergelten,“ und er wird nicht unmenschlich dem in Verstocktheit gesunkenen Verbrecher als Schuld anrechnen, daß er den vom Lichte ewig gewiesenen Ausweg verschmähte und ihn geradezu bewußt verwarf. Wenigstens wird er sich nicht an den Buchstaben des Gesetzes halten ...
Wenn wir nun in der Literatur Werke von solcher Gedanken- und Darstellungskraft besitzen, weshalb sollten wir dann nicht in der Folge auch unsere Wissenschaft haben können und unsere eigenen Lösungen der ökonomischen, der sozialen Probleme; weshalb spricht Europa uns die dazu erforderliche Selbständigkeit ab, die Möglichkeit, daß wir unser eigenes Wort sagen könnten? Man kann wirklich nicht den lächerlichen Gedanken gelten lassen, daß die Natur uns Russen nur mit literarischen Fähigkeiten versehen habe. Alles übrige ist doch eine Frage der geschichtlichen Entwicklung, der Umstände, der Forderungen der Zeit. Das könnten sich schließlich auch unsere russischen Europäer sagen, solange sie noch auf das Urteil der europäischen Europäer über uns warten müssen ...
Jetzt, nachdem ich mein eigenes Empfinden auseinandergesetzt, wird man vielleicht verstehen, wie der Abfall eines solchen Autors, seine Absonderung von der großen russischen Tat unserer Tage – dem Kriege für die Unterdrückten und Verfolgten – und die paradoxe Unwahrheit des Urteils, das er in diesem unseligen achten Teil des Romans über unser Volk fällt, auf mich gewirkt haben. Er nimmt ja dem Volk alles, spricht ihm das Wertvollste ab, raubt ihm den Sinn und Zweck seines Lebens. Ja, es wäre dem Autor unvergleichlich angenehmer, wenn unser Volk sich nicht in seinem Herzen für die um ihres Glaubens willen leidenden Brüder erheben würde. Nur in diesem Sinne leugnet er auch die Beweise, ungeachtet dessen, daß sie Tatsachen sind. Freilich wird das alles nur von den imaginären Gestalten seines Romans ausgesprochen, aber, wie ich schon sagte, hinter ihnen sieht man nur zu deutlich den Autor selbst. Allerdings ist es ein aufrichtiges Buch: der Autor spricht aus der Seele. Sogar die peinlichsten Sachen (und die gibt es in diesem Buch) nehmen sich in ihm aus, als wären sie ganz unversehens hineingeraten, so daß man sie trotz ihrer ganzen Peinlichkeit nur für ein offenherziges Wort hält und nicht im geringsten etwa Tücke vermutet. Nichtsdestoweniger halte ich dieses Buch durchaus nicht für so harmlos, wie es manche Leute tun. Jetzt wird und kann es zum Glück keinen Einfluß mehr haben, denn daß es vielleicht einer kleinen abgesonderten Gruppe von Leuten beipflichtet, ist belanglos. Aber die Tatsache, daß ein solcher Autor in diesem Sinne überhaupt schreiben kann, ist doch sehr bedauerlich, bedauerlich und traurig für unsere Zukunft. Doch übrigens – zur Sache: ich will widersprechen und werde darauf hinweisen, was mich besonders überraschte.
Zunächst muß ich ein paar Worte über Lewin sagen, der ersichtlich der Hauptheld des Romans ist. In ihm ist alles Positive ausgedrückt und zwar gewissermaßen als Gegensatz zu jenen Unnormalitäten, an denen andere Gestalten des Romanes zugrunde gehen oder unter denen sie zu leiden haben. Im übrigen ist Lewin offenbar der Erwählte, durch den der Autor seine eigenen Gedanken ausdrückt. Aber dieser Lewin war immer noch nicht vollkommen, immer fehlte ihm noch etwas, und so mußte der Autor sich wieder mit dem Fehlenden befassen, damit Lewin keinerlei Zweifel oder Fragen mehr verkörpere. – In der Folge wird der Leser begreifen, aus welchem Grunde ich zunächst hierbei verweile und somit nicht direkt zur Sache komme.
Lewin ist glücklich, der Roman entwickelt sich zu seinem größten Ruhme, aber – ihm fehlt noch der innere, der geistige Friede. Ihn quälen die ewigen Fragen der Menschheit: Gott, das ewige Leben, Gut und Böse und Ähnliches. Es quält ihn, daß er ein Ungläubiger ist und sich nicht damit zufrieden geben kann, womit sich alle anderen zufrieden geben, indem sie ihre Interessen auf Naheliegendes beschränken, als da sind Tagesfragen, Verdienst, Vergötterung der eigenen Person oder anderer Götzen, Eigenliebe usw. usw. Ein Anzeichen von Großherzigkeit, nicht wahr? Aber von Lewin ist ja auch weniger nicht zu erwarten. Nebenbei zeigt es sich, daß Lewin auch sehr viel gelesen hat. Er kennt sowohl die Werke der Philosophen, der Positivisten, wie auch der gewöhnlichen Naturforscher, doch nichts befriedigt ihn, sondern im Gegenteil, die Bücher verwirren ihn noch mehr, so daß er in der freien Zeit, die ihm die Bewirtschaftung seines Gutes läßt, in den Wald oder aufs Feld geht, sich ärgert, sogar Kitty, seine junge Frau, nicht in dem Maße schätzt, wie sie es wohl verdient hätte. Da führt ihm der Zufall einen seiner Bauern in den Weg, der ihm gesprächsweise von zwei anderen Bauern, Mitjuscha und Fokanytsch, zwei in sittlicher Beziehung entgegengesetzten Typen, erzählt und sich dabei folgendermaßen ausdrückt:
„Ja, Mitjuscha, warum nicht, der wird’s schon herauszuschlagen verstehen! Der erpreßt es einfach und nimmt sich das Seine. Dem tut doch kein Christenmensch leid. Onkel Fokanytsch aber, der wird doch nicht wie Mitjuscha einem anderen Menschen das Fell über die Ohren ziehen. Der wird auch so abgeben, daß man später zahlen kann, manchem wird er auch billiger geben. Da kann er denn auch selber nicht soviel Pacht zahlen ...“
„Aber warum wird er denn manchem billiger geben?“ fragte Lewin.
„Ja, das ist schon so, die Menschen sind eben verschieden. Der eine Mensch lebt sozusagen nur für seine Bedürfnisse, wie beispielsweise sagen wir meinethalben Mitjuscha, der sich nur den Wanst vollschlägt; aber Fokanytsch, der Alte, – das ist ein Mensch mit Gewissen. Der lebt für die Seele, der hat Gott nicht vergessen.“
„Wie das?! Wie – Gott nicht vergessen? wie lebt er für die Seele?“ rief Lewin fast erschrocken vor Betroffenheit.
„Nun, das weiß man doch, wie! Lebt in Rechtschaffenheit, in Gott. Die Menschen sind nun mal verschieden. Beispielsweise Ihr selber, Herr, wenn man so nimmt – Ihr werdet doch auch keinem Menschen unrecht tun.“
„Ja, ja, leb’ wohl!“ sagte Lewin hastig – die Aufregung verschlug ihm den Atem – er griff nach seinem Stock und entfernte sich schnell in der Richtung zum Hause ............
Doch statt nach Hause zu gehen, ging er wieder in den Wald, legte sich unter einer Esche ins Gras und begann fast mit Begeisterung zu denken. Das Wort war gefunden, alle ewigen Rätsel gelöst durch dieses eine einfache Wort des Bauern: „Für die Seele leben, Gott nicht vergessen.“ Der Bauer hat ihm natürlich nichts Neues gesagt: all das wußte er selber schon lange; aber der Bauer hat ihn doch auf den Gedanken gebracht und hat ihm die Lösung im verzwicktesten Augenblick zugeflüstert. Hierauf folgt eine Reihe von Betrachtungen Lewins, die sehr gut und treffend ausgedrückt sind. Lewins Gedankengang ist ungefähr folgender: wozu das mit dem Verstande suchen, was vom Leben schon gegeben ist, womit jeder Mensch geboren wird und dem jeder Mensch (sogar unfreiwillig) folgen muß und auch tatsächlich folgt. Jeder Mensch wird mit einem Gewissen, mit dem Begriff von Gut und Böse geboren, folglich wird er auch unmittelbar zu einem Lebensziel geboren: für das Gute zu leben und das Böse zu vermeiden. Damit kommt der Bauer ebenso wie der Herr zur Welt, der Franzose wie der Russe, wie der Türke – alle verehren das Gute (NB. obschon viele das in einer höchst eigenartigen Weise tun). „Ich aber wollte“, sagt sich Lewin, „alles das mathematisch, wissenschaftlich, mit der Vernunft erfassen, oder ich erwartete ein Wunder, während mir das alles schon ohne mein Dazutun gegeben, einfach mit mir geboren ist.“ Daß es aber ohne unser Dazutun uns gegeben ist, dafür gibt es Beweise: alle Menschen begreifen oder können es begreifen, daß man seinen Nächsten lieben muß wie sich selbst. In diesem Wissen liegt denn auch, genau genommen, das ganze Gesetz der Menschen, wie es uns Christus erklärt hat. Indessen ist uns diese Erkenntnis angeboren, folglich uns ohne unser Dazutun geschenkt, denn der Verstand könnte uns um keinen Preis dieses Wissen geben, – warum nicht? Nun ja, weil „den Nächsten lieben“ nach dem Verstande beurteilt – unklug ist.
„Woher habe ich das genommen?“ fragt sich Lewin. „Bin ich etwa durch den Verstand darauf gekommen, daß ich meinen Nächsten lieben soll und nicht ihn würgen? Man hat mir das in der Kindheit gesagt und ich habe es freudig geglaubt, weil man mir nur gesagt hatte, was schon in meiner Seele lag. Aber wer hat dies entdeckt? Der Verstand jedenfalls nicht. Der Verstand hat den Kampf ums Dasein entdeckt und das Gesetz, welches fordert, daß man alle, die uns an der Befriedigung unserer Wünsche hindern, beseitige. Dies ist das Ergebnis des Verstandes. Den Nächsten aber zu lieben konnte der Verstand nicht lehren, da das unklug ist.“
Hierauf fällt Lewin eine Szene ein, die er kürzlich mit seiner Schwägerin Dolly und deren Kindern erlebt hatte. Die Kinder brieten Himbeeren in einer Tasse über einer Kerze und gossen sich die Milch im Bogen wie eine Fontäne aus dem Kannenschnabel in den Mund. Die Mutter, die sie bei dieser Betätigung ertappte, versuchte natürlich, ihnen klar zu machen, daß sie, wenn sie die Gefäße zerschlügen und die Milch verschütteten, dann weder ein Trinkgefäß noch Milch hätten. Aber die Kinder glaubten ihr offenbar kein Wort von dem, was sie sagte, denn „sie konnten sich den ganzen Umfang dessen, was sie genossen, gar nicht vorstellen, und infolgedessen konnten sie sich auch nicht denken, daß das, was sie verdarben, dasselbe sei, wovon sie lebten.“
„Das ist alles von selbst da,“ dachten sie, „Interessantes oder Wichtiges gibt es dabei nicht, weil es stets so war und sein wird und stets alles ein und dasselbe ist. Darüber brauchen wir gar nicht nachzudenken, denn das ist das Gegebene; wir aber wollten uns etwas Eigenes und ganz Neues ausdenken. Und so dachten wir uns denn aus, die Himbeeren in die Tasse zu legen und sie über dem Licht zu braten und uns die Milch direkt aus der Kanne wie eine Fontäne in den Mund zu gießen. Das ist lustig und neu und gewiß nicht schlechter, als aus Tassen zu trinken.
„Tun wir nun nicht ganz dasselbe, tue ich es nicht, indem ich mit dem Verstande die Bedeutung der Naturkräfte und den Sinn des menschlichen Lebens zu erfassen trachte?“ fuhr Lewin fort zu denken. „Und tun denn die philosophischen Theorien etwa nicht alle das gleiche, indem sie auf einem seltsamen, dem Menschen nicht eigenen Gedankenweg zu der Erkenntnis dessen führen, was der Mensch lange schon weiß, und mit solcher Sicherheit weiß, daß er ohne es gar nicht leben könnte? Ist es denn nicht aus der Entwicklung der Theorie jedes Philosophen klar ersichtlich, daß er schon im voraus ebenso sicher wie jener Bauer und auch nicht im geringsten klarer als jener den Hauptsinn des Lebens kennt, und nur auf einem unzuverlässigen Verstandeswege zu dem zurückkehren will, was allen bekannt ist?
Nun, wie, wenn man die Kinder allein ließe, wenn sie alles selbst machen müßten, Tassen und Kannen, dazu Kühe melken usw. – würden sie dann Mutwillen treiben? Sie würden Hungers sterben. Nun, so versuche man doch einmal, uns mit allen unseren Leidenschaften, unseren Gedanken allein zu lassen, ohne Vorstellung vom einzigen Gott und Schöpfer! Oder ohne eine Vorstellung von dem, was Gut ist und was Böse, ohne sittlichen Instinkt.
Ich möchte bloß wissen, was ohne diese Begriffe aufgebaut werden würde!
Wir zerstören nur, weil wir geistig satt sind. Eben wie die Kinder!“
Mit einem Wort, die Zweifel haben aufgehört und Lewin hat endlich den Glauben gefunden; er glaubt – doch an was? Das hat er noch nicht genau formuliert! Er stellte sich nur freudig die Frage: „Sollte das wirklich Glaube sein?“ Oder man muß annehmen, daß es nicht der Fall ist. Ja mehr noch als das: es ist sogar kaum anzunehmen, daß solche Leute wie Lewin überhaupt jemals einen endgültigen Glauben haben können. Lewin nennt sich zwar „Volk“, aber er ist ein Edelmann, ein Moskauer Landedelmann jener selben mittel-höheren Kreise, deren Historiker Graf L. Tolstoi ja vornehmlich ist.
Der Bauer hat Lewin freilich nichts Neues gesagt, aber immerhin hat er ihn auf einen Gedanken gebracht, und mit diesem Gedanken begann sein Glaube. Schon daraus allein könnte Lewin ersehen, daß er durchaus nicht „Volk“ ist und kein Recht hat, von sich derlei zu sagen. Doch davon später. Ich will hier nur erwähnen, daß gerade diese Herren, wie z. B. Lewin, niemals vollkommen „Volk“ werden können, gleichviel wie lange sie unter dem Volk oder neben dem Volk leben, ja – in vieler Hinsicht werden sie es sogar überhaupt nicht verstehen und nie verstehen lernen. Eigendünkel und bloßer Wunsch – dazu noch ein so wunderlicher – genügen nicht, einen Menschen nun gleich zu dem zu machen, was er plötzlich sein will. Mag er hundertmal Gutsbesitzer und sogar ein arbeitender Gutsbesitzer sein, alle Bauernarbeit kennen, sogar zu mähen und einen Wagen anzuspannen verstehen und wissen, daß zu Scheibenhonig frische Gurken gereicht werden – in seiner Seele bleibt dennoch, trotz allen guten Willens, ein Etwas zurück, das man, wie mich deucht, einfach „Müßiggang“ nennen muß. Es ist das derselbe „Müßiggang“, sowohl in physischer wie in geistiger Beziehung, der Lewin, wie sehr er sich auch zusammennehmen wollte, doch nun einmal von seinen Vorfahren vererbt worden ist und den das Volk in jedem Herrn sieht, obschon es nicht mit unseren Augen schaut. Doch auch hiervon später. Was nun seinen Glauben betrifft, so wird er ihn wieder zerstören, wird es selber tun, lange wird er nicht bei uns verweilen: alsbald wird sich wieder irgendwo ein Haken zeigen, und seinen ganzen Glauben zerreißen. Z. B. Kitty stolpert beim Gehen – warum stolperte sie? Wenn sie stolperte, dann konnte sie eben nicht ohne zu stolpern gehen; es läßt sich genau feststellen, daß sie aus diesem und jenem Grunde stolpern mußte. Es ist klar, daß hierbei alles von Gesetzen abhing, die sich aufs genaueste feststellen lassen. Aber wenn dem so ist, so herrscht ja in allem die Wissenschaft. Wo bleibt da die Vorsehung? wo ist dann ihre Rolle? und wo die Verantwortung des Menschen? Wenn es aber keine Vorsehung gibt, wie kann ich dann an Gott glauben, usw. usw. Das ist wie eine gerade Linie, die sich in die Unendlichkeit fortsetzt. Mit einem Wort, dieser Lewin, diese ehrliche Seele, ist zugleich eine chaotisch müßige Seele par excellence, anderenfalls wäre er nicht das, was er ist: ein zeitgenössischer Herrensohn der russischen Intelligenz und dazu noch aus den mittelhohen Adelskreisen.
Eine Stunde, nachdem der neue Glauben in ihm erweckt ist, wird das von ihm auch schon glänzend bewiesen: er behauptet, das russische Volk empfinde für die Balkanslawen nichts von dem, was Menschen im allgemeinen empfinden können, er verleugnet die Seele des Volkes in der eigenmächtigsten Weise, ja er erklärt sogar, daß er selber nicht das geringste Mitleid mit den heimgesuchten Menschen habe. Er erklärt, daß es ein „unmittelbares Gefühl für die bedrückten Balkanslawen nicht gäbe und gar nicht geben könne“ – d. h. nicht nur nicht in ihm, sondern überhaupt in keinem Russen, denn, wie er sagt: „ich bin selber Volk!“ Fürwahr, diese Herren bewerten das russische Volk denn doch etwas gar zu niedrig! Übrigens – nach Väterart. Kaum eine Stunde ist seit dem Erwerb des neuen Glaubens vergangen, da werden schon wieder Himbeeren über dem Licht gebraten.
Die Kinder kommen ihm entgegen gelaufen und berichten, daß Gäste eingetroffen seien. Es sind Gäste aus Moskau. Man setzt sich in der Nähe des Bienengartens unter Bäumen, Lewin bringt Scheibenhonig und frische Gurken herbei und die ganze Gesellschaft macht sich sogleich an den Honig und an die Orientfrage. Dies spielt nämlich im vorigen Jahr, – Sie wissen doch: Tschernajeff[33], unsere Freiwilligen, die Spenden. Die Unterhaltung wird bald sehr lebhaft, denn alle streben unaufhaltsam zur Hauptsache. Die Gesellschaft besteht, abgesehen von den Damen, erstens aus den beiden Gästen: einem Moskauer Professörchen, einem netten, aber etwas dummen Menschen, und dem Stiefbruder Lewins, Ssergei Iwanowitsch Kosnyscheff, der uns als ein Mensch von großem Verstande und großem Wissen geschildert wird. Der Charakter Kosnyscheffs ist im Roman künstlich aufgebaut und wird erst zum Schluß verständlich (ein Mensch mit den Anschauungen der vierziger Jahre). Kosnyscheff hat sich in der letzten Zeit mit Eifer und Hingabe der Hilfstätigkeit für die Balkanslawen gewidmet und das Komitee hat ihm Berge von Arbeit aufgeladen, so daß man sich kaum vorzustellen vermag, wenn man der fieberhaften Tätigkeit dieser Komiteemitglieder im vorigen Jahre gedenkt, wie er sich überhaupt hat freimachen können, und dazu noch auf ganze zwei Wochen, die er auf dem Lande verbringen will. Freilich gäbe es anderenfalls auch nicht diesen Disput im Bienengarten und somit auch nicht den ganzen achten Teil des Romans, welcher nur um dieses Disputs willen geschrieben ist. Ja sehen Sie, dieser Kosnyscheff hatte irgendein gelehrtes Buch über Rußland geschrieben, das vor etwa zwei oder drei Monaten in Moskau erschienen war, und obschon er lange daran gearbeitet und große Hoffnungen in dieses Werk gesetzt, hatte es schmählich Fiasko gemacht: von der Kritik war dem Werk überhaupt keine Beachtung geschenkt worden. Darauf erst hatte Kosnyscheff sich der slawischen Tätigkeit angeschlossen, und das mit einem Eifer, wie ihn niemand von ihm erwartet hätte. Daraus folgt, daß er gewissermaßen nicht auf natürlichem Wege zu dieser Betätigung gelangt und sein ganzer Eifer für die Balkanslawen nur „ambition rentrée“ ist, nichts weiter, und man ahnt bereits, daß Lewin im Disput mit ihm selbstverständlich Sieger bleiben muß. Kosnyscheff war auch in den früheren Teilen des Romans sehr geschickt in komischem Lichte dargestellt; aus dem achten Teil aber geht bereits klar hervor, daß er überhaupt nur zu dem Zweck geschaffen ist, um im Schlußkapitel als Piedestal zu Lewins Größe zu dienen. An sich freilich ist diese Gestalt dem Autor sehr gut gelungen.
Dafür ist eine der mißlungenen Gestalten der alte Fürst, Lewins Schwiegervater, der gleichfalls dort unter den Bäumen im Bienengarten sitzt und sich an dem Gespräch über die Orientfrage beteiligt. Die Figur des alten Fürsten ist dem Autor sogar im ganzen Roman mißlungen, nicht nur im Schlußkapitel. Der alte Fürst soll einer der positiven Charaktere des Romans sein, selbstverständlich nicht auf Kosten des Realismus! So hat auch er seine Schwächen und fast sogar seine komischen Seiten, aber im allgemeinen ist er doch ein ehrwürdiger, höchst ehrwürdiger Mann. Er ist der Gutherzige des Romans, ist sozusagen die gesunde Vernunft – nicht die, die in den Stücken des achtzehnten Jahrhunderts wie ein gelehrter Esel redete. Da gab’s nichts anderes als nur Vernunft und abermals Vernunft. Der Fürst dagegen hat auch Humor und überhaupt menschliche Züge. Das Ergötzliche besteht nur darin, daß dieser alte Mensch die Aufgabe hat, geistreich sein zu müssen. Dabei hat er aber das Unglück, daß ihm nichts wirklich Geistreiches zu sagen gelingt. Statt dessen urteilt er in diesem Schlußkapitel über unser Volk und einen Teil unserer Gesellschaft geradezu zynisch. Der „Gutherzige“ entpuppt sich plötzlich als Verneiner des ganzen russischen Volkes wie alles dessen, was in diesem Volk Gutes lebt. Man hört so recht die Aufgebrachtheit eines alten Klubmitglieds und den greisenhaften Ärger. Übrigens ist seine politische Theorie nichts weniger als neu. Sie besteht darin, daß wir uns nur für Rußland interessieren sollten, und deshalb ist er der Meinung, daß die Balkanslawen uns nichts angehen – anderenfalls würde er von uns nicht Interesse nur für Rußland verlangen. Wir dagegen sind der Meinung, daß die Hilfe, die wir den Slawen bringen, eine Handlung im Interesse Rußlands, d. h. im Sinne der Bestimmung Rußlands ist. So besteht denn der allgemeine Charakter seiner Ansichten in der Engheit seiner Auffassung der russischen Interessen. Er sagt, er könne nicht begreifen, weshalb man hier in Rußland plötzlich die Balkanslawen so sehr liebe, während er, der Fürst, in seinem Herzen nicht die geringste Liebe zu ihnen verspüre. Auch verstehe er nicht, gegen wen denn die Russen in den Krieg ziehen, da doch die Regierung noch keiner anderen Macht den Krieg erklärt habe. Katawassoff, der Professor aus Moskau, sagt darauf, daß es Fälle geben könne, wo die Regierung den Willen des Volkes nicht erfüllt, und dann äußere sich die öffentliche Meinung eben in der Weise, wie es jetzt in Rußland geschehe. Hierauf heißt es von Lewin, der mit dem alten Fürsten übereinstimmt:
„... er wollte sagen, daß, wenn die öffentliche Meinung ein unfehlbarer Richter wäre, die Revolution und Kommune doch ebenso gesetzmäßig sein müßten, wie diese Bewegung zugunsten der Slawen.“
Es ist sonderbar, daß dieser Lewin und der alte Fürst sich durch keinerlei Erwägungen in ihrem Denken aufhalten lassen. Doch schließlich – wer sieht denn nicht, daß aus dem Fürsten gekränkte Eigenliebe spricht (die Leute ziehen in den Krieg, ohne ihn vorher gefragt zu haben, ob ihm das genehm ist!) und aus Lewin seine paradoxe Meinung. Nicht die Wahrheit ist Lewin teuer, sondern das, was er sich ausgedacht hat. Übrigens spricht vielleicht auch aus Lewin gekränkte Eigenliebe, denn es ist ja kaum glaublich, was alles die Eigenliebe der Menschen kränken kann. Das Volk und unsere Freiwilligen gegen die Verleumdungen Lewins und des alten Fürsten zu verteidigen, hat meines Erachtens keinen Sinn, ja es wäre für die Verteidigten sogar erniedrigend. Wenn Lewin zur Erklärung der Tatsache, daß Hunderte von Freiwilligen aus Rußland hinziehen, um mit den Balkanslawen gegen die Türken zu kämpfen, ohne weiteres sagt, daß „in einem Volke von achtzig Millionen sich immer nicht nur Hunderte, wie jetzt, sondern Tausende von Menschen finden werden, die ihre gesellschaftliche Stellung eingebüßt haben, Tausende von Müßiggängern, die stets bereit sind, sich der Räuberbande eines Pugatschoff[34] anzuschließen oder nach China oder Serbien zu gehen“ – so können wir nur darauf hinweisen, daß die Freiwilligen nicht heimlich aufbrachen. Alle haben sie gesehen und ihnen das Geleit gegeben und es war manch ein bekannter Name unter ihnen. Gewiß wird es neben der größten Aufopferung auch Leute gegeben haben, die einfach aus Abenteuerlust, aus Ruhmsucht oder aus anderen Gründen hinzogen. Aber noch weiß man nicht, wie viele auch von diesen Abenteuerlustigen ihr Leben dort hingegeben haben. Doch die Behauptung, daß unsere Freiwilligen vom vorigen Jahr alle nur Müßiggänger und verlorene Leute gewesen seien, hat zum mindesten keinen Sinn, denn wie gesagt, wir haben Hunderte von ihnen gekannt. Was nun die Spenden betrifft, die selbst von den ärmsten Leuten aus dem Volk für die bedrängten und mißhandelten Glaubensbrüder dargebracht wurden, so behauptet der Fürst, daß das „Volk“ überhaupt nicht wisse, worum es sich dabei handelt. Er sagt:
„... der Geistliche war verpflichtet, am Sonntag die ganze Geschichte in der Kirche zu verlesen. Nun und das tat er denn auch. Das Volk aber verstand davon nichts, es seufzte hin und wieder, wie es bei jeder Predigt seufzt. Darauf sagte der Priester, daß man in der Kirche zu einem heiligen Zweck sammle, und da holten sie jeder eine Kopeke hervor und gaben sie, wozu aber, das wußten sie selbst nicht.“
Diese Behauptung, die sich über alle Beweise einfach hinwegsetzt, ist als Äußerung gerade des Fürsten unschwer zu erklären. Sie stammt von einem der früheren Volksvormunde, dem ehemaligen Herrn leibeigener Bauern, der, so gut er auch immer sein mag, für seine Sklaven doch nichts anderes als Verachtung empfinden kann, während er sich selbst unvergleichlich klüger dünkt als sie. Und diese Leibeigenen sollten irgend etwas eben so gut verstehen wie er? – Das ist ausgeschlossen!
„Sie haben geseufzt, wie bei jeder Predigt, aber verstanden haben sie nichts!“ – Davon ist er überzeugt. Denselben Gedanken äußert auch Lewin, und auf eine gereizte Entgegnung Kosnyscheffs, daß mit den dargebrachten Spenden bereits das ganze Volk seinen Willen äußere, erwidert er:
„Das Wort ‚Volk‘ ist so unbestimmt. Ja, die Bezirksschreiber und die Volksschullehrer, und von den Bauern einer von Tausend, die wissen vielleicht, um was es sich handelt. Die übrigen achtzig Millionen äußern weder ihren Willen, noch haben sie überhaupt einen Begriff davon, in welcher Angelegenheit sie ihren Willen äußern sollten. Welches Recht haben wir nun da, von einem Volkswillen zu sprechen?“
Übrigens sei hier ein für allemal bemerkt, daß der Ausdruck „Wille des Volkes“ für die Bewegung im Volk, die wir im vorigen Jahre erlebten, durchaus nicht zutreffend ist. Es war nicht der „Wille“ des Volkes als solcher, der sich kund tat, sondern es zeigte sich nur sein großes Mitgefühl, sein christlicher Geist und schließlich sein Bedürfnis, gewissermaßen Buße zu tun – ja, so könnte man es tatsächlich nennen. Doch zunächst will ich zu erklären versuchen, wie es möglich war, daß das Volk, das weder Geographie noch Geschichte gelernt hat, dennoch bewußt an der Bewegung für die bedrängten Balkanslawen teilnahm.
So lange das russische Volk besteht, d. h. schon seit seiner Bekehrung zum Christentum, sind immer Pilger aus Rußland nach Palästina, zum Heiligen Grabe, oder nach Athos gewandert. Die Erzählungen dieser Pilger von dem Erlebten und Gesehenen sind im Volk, wie alle Erzählungen vom „Göttlichen“, ungemein beliebt; man hört fast andächtig zu und behält das Gehörte beinahe Wort für Wort. Diese Erzählungen haben sich im Volk durch Generationen vererbt und verbreitet. Deshalb wissen denn selbst unsere Bauern auf dem Felde, auch wenn sie nie etwas von Serben, Bulgaren oder Montenegrinern gehört haben, doch ganz genau und schon seit Jahrhunderten, daß die heiligen Stätten und die christliche Bevölkerung jener Gegenden von den heidnischen Türken erobert worden sind, und daß diese Bevölkerung unter dem Joch der Ungläubigen ein schweres Leben hat. Das wissen sie nicht nur, sondern es schmerzt sie auch aufrichtig. Denn in seinem Herzen hat sich das russische Volk immer zu den heiligen Stätten hingezogen gefühlt und in der Wallfahrt, wenn nicht nach Jerusalem, dann zu einem unserer russischen Klöster, eine gute Tat, etwas Seelenrettendes gesehen. Übrigens möchte ich bemerken, daß ich, indem ich von diesem historischen Zug des russischen Volkscharakters rede, ihn weder gutheiße, noch tadele, sondern nur eine Tatsache feststelle, mit der man sich vieles erklären kann. Was sollen wir denn tun, wenn wir nun einmal diesen historischen Zug haben! Ich weiß nicht, wohin er uns führen wird, aber es ist doch möglich, daß er uns zu etwas führt. Im Leben der Völker bildet sich das Wichtige immer entsprechend den wichtigsten nationalen Sondereigenheiten aus. Vorläufig hat z. B. der obenerwähnte Charakterzug unseres Volkes nur sein bewußt nationales Verhalten zu jedem Kriege Rußlands mit dem Sultan zur Folge gehabt. Was jedoch den gegenwärtigen Krieg betrifft, so scheint noch der Zeitpunkt von besonderer Bedeutung für die Volksbewegung des vorigen Jahres gewesen zu sein.
Es ist verhältnismäßig schon ziemlich lange her, schon sechzehn Jahre, daß die Leibeigenschaft bei uns aufgehoben wurde. Es verging seitdem ein Jahr ums andere, doch – in welcher Verfassung sah sich das Volk, wie äußerte sich sein Dank für den Gnadenakt des Zaren? Es sah zunehmende Trunksucht, sah unter seinen Standesgenossen gewissenlose Ausbeuter sich vermehren, sah ringsum Armut, sah sich selbst oft bis zum Tierischen gesunken – viele, oh, viele werden bei diesem Anblick schon Reue und Kummer empfunden haben und das Verlangen nach Buße. Im Schmerz der Selbstverurteilung begann ein Suchen nach dem Guten, Heiligen ... Und da hörten sie plötzlich von Christen, die um ihres Glaubens willen gemartert werden, die lieber ihr Leben hingeben, als daß sie zum Islam übertreten, obwohl sie dafür belohnt werden sollten. Diesen ersten Gerüchten von den Vorgängen am Balkan folgten die Aufrufe ans Volk, den Bedrängten zu helfen, es wurden Spenden gesammelt; dann sprach man von einem russischen General, der den Christen in ihren Kämpfen gegen die Ungläubigen beistand, dann begannen Freiwillige aus Rußland hinzuziehen – alles das erschütterte das Volk. Es war wie ein Aufruf, Buße zu tun. Und da sahen und erlebten wir es: wer aus dem Volk nicht als Freiwilliger hingehen konnte, der steuerte wenigstens ein Scherflein bei; die Freiwilligen aber wurden von allen begleitet, ganz Rußland gab ihnen das Geleit.
Der alte Fürst hatte freilich in Karlsbad von all dem nichts gesehen, und als er dann gerade während der Hochflut der Bewegung zurückkehrte, verstand er von ihr so wenig, daß er über sie nur spötteln konnte. Doch was konnte dieser Greis, dessen Anschauungen aus dem Klub stammen, von Rußland oder dem russischen Bauern überhaupt verstehen? Der kluge Lewin hätte freilich mehr verstehen können als der alte Fürst, doch ihn machte die Erwägung stutzig, daß das Volk ja weder Geschichte noch Geographie kennt, und überdies kränkte es ihn, daß sich dabei niemand um ihn und seine Meinung kümmerte. Freilich weiß unser Volk nichts von Geschichte und Geographie, doch das, worauf es ankommt, das weiß es. Allerdings könnte man dem Volk inbetreff seiner alten historischen Neigung zu Buße und Wallfahrt eine Menge sehr kluger und vernünftiger Dinge sagen, z. B., daß seine Wallfahrten nur eine sehr enge und einseitige Auffassung seiner Pflicht seien, und daß es besser täte, wenn es vom Trinken ließe und seine Habe vermehrte und somit etwas dazu beitrüge, daß sein Vaterland endlich den „aufgeklärten europäischen Staaten“ zu gleichen anfange. Man könnte dem Pilger vorhalten, daß Gott seine Wallfahrt durchaus nicht brauche, und zwar hauptsächlich deshalb nicht, weil sie weder ihm, dem Pilger, noch seiner Familie Nutzen bringe, ja, daß seine Wallfahrt sogar direkt schädlich sei, weil er auf lange Zeit sein Haus und seine Heimat um eines im Grunde egoistischen Zweckes willen verlassen müsse, nämlich um seine Seele zu retten, während es Gott unvergleichlich angenehmer wäre, wenn er dieselbe Zeit in seinem Gemüsegarten zubrächte oder Kälber hütete. Wie gesagt, es läßt sich sehr viel Vernünftiges gegen das Wallfahren vorbringen, aber – was soll man denn tun, wenn unser Volk so geartet ist, daß das Suchen des Guten in ihm fast ausschließlich diese Form angenommen hat, d. h. die Form des Bußetuns, mittels einer Wallfahrt oder eines Opfers? Jedenfalls könnte der kluge Lewin in Erwartung der „Aufklärung“ wenigstens diesen historischen Charakterzug dem Volk anrechnen. Er könnte sich doch sagen, daß viele Freiwillige und viele von denen, die sie begleiteten, einer guten Regung folgten und in ihrer Handlungsweise eine gute Tat sahen (das steht ganz außer Frage!), folglich aber waren es doch nicht „verlorene Leute“, sondern vielleicht sogar die besten aus dem Volk, und viele, sehr viele von ihnen werden diese Tat in der Tiefe ihres Herzens eben als Buße und Sühne empfunden haben. Und vor seinem Zaren fühlte sich deshalb keiner schuldig, im Gegenteil, er hoffte und wartete darauf, daß sein Zarbefreier auch in dieser Frage als Befreier eingreifen werde, wir aber, die wir in unseren Winkeln saßen, wir freuten uns, daß das große russische Volk unsere Hoffnung und unser großes ihm gehörendes Vertrauen rechtfertigte. So dürfte denn wohl nichts so mangelhaft sein, wie der Vergleich dieser guten, opferwilligen Bewegung mit der Bande Pugatschoffs, der Kommune usw.! Das konnte wahrlich nur der gereizte Hypochonder Lewin sagen! Da sieht man, wozu empfindliche Eigenliebe führen kann!
Doch seine Gereiztheit geht noch weiter, er erklärt sogar unumwunden, daß ein unmittelbares Gefühl für die Unterdrückung der Slawen nicht vorhanden sei und auch gar nicht sein könne. Auf die Entgegnung Kosnyscheffs, daß es doch wohl nur für ihn nicht vorhanden sei, antwortet er:
„Vielleicht, aber ich sehe das nicht; ich bin selbst Volk und fühle es doch nicht.“
Er hat also kein Mitgefühl mit den Mißhandelten? Übrigens wird der Streit zwischen Lewin und Kosnyscheff in einer Weise geführt, die von der Frage abweicht. Kosnyscheff sagt:
„... Stelle dir vor, du gehst auf der Straße und siehst, daß Trunkene ein Weib oder ein Kind schlagen. Ich denke, da würdest du nicht erst fragen, ob jenen Betrunkenen der Krieg von der Regierung deines Landes erklärt ist oder nicht, sondern würdest hineilen, und die Bedrängten verteidigen.“
„Aber doch deshalb nicht töten.“
„Doch, du würdest töten,“ sagt Kosnyscheff, und sagt damit natürlich etwas Unhaltbares, denn um ein Weib auf der Straße vor Betrunkenen zu beschützen, braucht man doch wahrlich noch nicht zu töten. Aber sie wissen es ja auch, daß es sich in dieser Frage nicht um eine zufällige Rauferei auf der Straße handelt, sondern um ein systematisches Niedermetzeln, um raffinierte Folterungen. Und auf eben jene Behauptung Kosnyscheffs entgegnet Lewin:
„Ich weiß nicht. Wenn ich dergleichen sähe, würde ich mich meinem unmittelbaren Gefühl hingeben, im voraus aber kann ich es nicht sagen. Ein solches unmittelbares Gefühl für die Unterdrückung der Slawen ist jedoch nicht vorhanden, und kann es auch gar nicht sein.“
Das ist psychologisch nicht uninteressant. Es gibt ja gewiß auch absolut gefühllose Menschen, die einfach roh oder entartet sind; nur gehört Lewin zweifellos nicht zu diesen, im Gegenteil, er ist sogar ein sehr gefühlvoller Mensch. Deshalb fragt es sich, ob nicht bei gewissen, des Mitgefühls sogar sehr fähigen Menschen die – Entfernung von psychologischer Bedeutung sein kann. Vielleicht versagt ihr Mitgefühl, wenn es heißt: „Die Greueltaten sind ja allerdings unerhört, man reißt lebenden Menschen die Haut ab, wirft Kinder vor den Augen der Mütter in die Luft und fängt sie mit dem Bajonett auf, vergewaltigt Frauen, schneidet ihnen die Brüste ab, sticht Kindern die Augen aus und setzt sie auf einen Spieß – aber das geschieht da irgendwo weit, irgendwo dort auf der anderen Hälfte des Erdballs. Und da das so weit ist, empfinde ich eben kein Mitgefühl!“ Wenn nun die Entfernung solchermaßen auf das Mitempfinden einwirkt, so muß man sich unwillkürlich fragen: bis zu welcher Entfernung reicht denn eigentlich die Menschenliebe?
Doch Lewin ist, wie gesagt, zweifellos ein gefühlvoller Mensch, und obschon er für die Slawen kein Mitgefühl hat, geht seine Menschenliebe doch so weit, daß er einen ... Türken nicht töten könnte. Stellen wir uns einmal eine solche Szene vor: Lewin steht, mit dem Gewehr in der Hand und aufgepflanztem Bajonett – zwei Schritt von ihm steht ein Türke mit einem Säugling im Arm, dem er mit einer Nadel die Augen auszustechen sich anschickt. Die siebenjährige Schwester des kleinen Opfers schreit wie wahnsinnig und sucht mit aller Gewalt dem Türken ihr Brüderchen zu entreißen. Lewin aber steht nachdenklich und unentschlossen da und spricht zu sich selbst:
„Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich empfinde nichts. Ich bin selbst Volk. Ein unmittelbares Gefühl für die Unterdrückung der Slawen ist nicht vorhanden und kann es auch gar nicht sein.“
In der Tat, was würde er in dem Fall tun – nach allem, was er gesagt hat? Sollte er wirklich nicht das Kind befreien? Sollte er ihm wirklich die Augen ausstechen lassen und es nicht sofort dem Türken entreißen?
„Entreißen ist leicht gesagt, aber da wird man den Türken vielleicht – stoßen müssen?“
„Nun, so stoße ihn!“
„Stoße ihn! Aber wenn er mir das Kind nicht geben will und den Säbel zieht? Da wird man ihn womöglich totschlagen müssen?“
„Nun, so schlag’ ihn tot!“
„Nein, wie darf man denn das! Nein, totschlagen darf man den Türken nicht. Dann mag er schon lieber dem Kinde die Augen ausstechen und es umbringen. Ich gehe zu Kitty.“
Das wäre Lewins folgerichtige Handlungsweise. Er sagt doch, daß er nicht wisse, ob er dem Weibe oder dem Kinde helfen würde, wenn er dabei einen Türken töten müßte. Die Türken tun ihm eben gar so leid.
„Vor zwanzig Jahren hätte die Presse noch geschwiegen,“ sagt Kosnyscheff, „jetzt aber wird die Stimme des russischen Volkes gehört, das bereit ist, sich zu erheben, wie ein Mann, bereit, sich zu opfern für die bedrängten Mitbrüder; das ist ein großer und wichtiger Schritt und ein Beweis von Kraft.“
„Aber hier handelt es sich doch nicht nur darum, sich zu opfern, sondern darum, die Türken zu erschlagen,“ sagte Lewin vorsichtig. „Das Volk opfert und ist jederzeit bereit, für seine Seele zu opfern, nicht aber für den Totschlag ...“
Also mit anderen Worten: „Liebes Mädchen, hier ist Geld, nimm es, wir opfern es für unsere Seelen, aber deinem Brüderchen laß vom Türken die Augen ausstechen. Denn das geht doch nicht, daß wir den Türken totschlagen ...“
Und darauf schreibt der Autor ganz persönlich und von sich aus über Lewin:
„Er konnte sich nicht damit einverstanden erklären, daß eine Handvoll Menschen, unter ihnen auch sein Stiefbruder, das Recht haben sollten, auf Grund dessen, was ihnen die Hunderte der durch die Hauptstädte reisenden schönredenden Freiwilligen erzählt hatten, zu sagen, sie und die Presse drückten den Willen und das Empfinden des Volkes aus, und dabei war das ein Wille, der Rache und Totschlag verlangte.“
Das entspricht nicht der Wahrheit: von einem Verlangen nach Rache kann überhaupt nicht die Rede sein. Auch jetzt, wo wir mit diesem blutdürstigen Volk Krieg führen, hört man über das Verhalten der Russen zu ihren Feinden nur Dinge, die Beweise der größten Menschlichkeit sind. Ja, man kann dreist behaupten, daß wenige der europäischen Armeen mit einem solchen Feinde so umgehen würden, wie es jetzt unsere Armee tut. Zwei oder drei unserer großen Tageszeitungen haben denn auch schon die Frage erörtert, ob es nicht ratsam wäre, die unerhörten Grausamkeiten der Türken zu vergelten: dieses Abschneiden der Nasen und anderer Glieder der Verwundeten und Gefangenen, bevor sie getötet werden. Man sollte meinen, daß mit dieser gesunkenen und verlogenen Nation kein anderes Volk noch menschlich umgehen könne, doch bin auch ich dafür, daß man von irgendwelchen Gegenmaßnahmen Abstand nimmt. Daß jedoch Kindern die Augen ausgestochen werden, das dürfen wir nicht zulassen, und um ein für allemal die Möglichkeit zu solchen Schändlichkeiten zu beseitigen, muß man die Verfolgten befreien, dem Verfolger aber auf immer die Waffe entreißen. Das aber ist nur möglich durch den Kampf. Kampf jedoch ist nicht Rache, und Lewin braucht deshalb für die Türken nichts zu befürchten. Auch im vorigen Jahr, noch vor der Kriegserklärung, als nur unsere Freiwilligen hinzogen, hätte er in der Beziehung ruhig sein können. Oder kennt er denn nicht den Russen und den russischen Soldaten? Freilich wird unser Soldat den Feind im Kampf töten, aber mit dem gefangenen Türken hat man ihn schon oft seine schmale Soldatenkost teilen gesehen. Und ich versichere, jeder Soldat, der das tat, wußte nur zu gut, daß dieser selbe Türke ihm, dem Russen, wenn er in türkische Gefangenschaft geraten wäre, den Kopf abgeschnitten, daraus mit anderen Köpfen einen Halbmond zusammengestellt hätte, und in der Mitte – einen Stern aus anderen Körperteilen. Außerdem könnte Lewin sich sagen, daß dieser russische Soldat, der den Türken im Kampf erschlägt, doch auch sein eigenes Leben einsetzt, daß er ebensogut vom Türken erschlagen werden kann und vielleicht auch wird, vorher aber noch Mühe und Pein und vor dem Tode womöglich Folterqualen auszustehen hat. Um der „Rache“, um des „Totschlags“ willen habe sich das russische Volk erhoben? Hat man jemals gehört, daß die Verteidigung von Kindern und Frauen, die aufgespießt, die vergewaltigt werden und die in der ganzen Welt keinen Beschützer haben – für eine rohe Tat, für lächerlich, fast für unsittlich, für Rachelust und Blutdurst gehalten worden ist? Und was ist das für eine Gefühllosigkeit neben größter Sentimentalität! Dieser Lewin hat doch auch ein Kind und er liebt doch seinen kleinen Knaben; wenn dieser in der Wanne gebadet wird, ist es doch fürs ganze Haus ein Ereignis. Blutet ihm denn da nicht das Herz, wenn er liest, daß sich unter den Baschibosucken Spezialisten herausgebildet haben, die ein Kind, das sie an den Beinchen packen, mit einem Ruck in zwei Hälften zerreißen können, oder von den toten Kindern neben den Leichen ihrer erschlagenen Mütter liest, denen die Brüste abgeschnitten sind? Doch dieser Lewin, der das liest, denkt bei sich vermutlich:
„Kitty ist gesund und hat mit Appetit gegessen; der Kleine wurde gebadet und er fängt schon an, mich zu erkennen. Was geht es mich an, was sich dort irgendwo fern von hier bei den Balkanslawen zuträgt; ein unmittelbares Gefühl für die Mißhandlung der Slawen ist nicht vorhanden und kann es auch gar nicht sein – denn ich empfinde nichts.“
Schließt damit Lewin seine Epopöe? Und ihn will uns der Autor als Beispiel eines rechtschaffenen und ehrlichen Menschen hinstellen?
Solche Menschen, wie der Autor der „Anna Karenina“, sind Erzieher der Gesellschaft, sind unsere Lehrer und wir sind ihre Schüler. Was aber lehren sie uns nun eigentlich?
Mir scheint, daß das vorherrschende Gefühl aller Richter der Welt, der unseren aber im besonderen, das Gefühl der Macht sein muß, oder besser gesagt, der Eigenmacht. Um so bemerkenswerter ist es, daß sie heutzutage bei uns nie verurteilen, sondern ausnahmslos freisprechen. Freilich ist auch das ein Beweis ihrer Macht, sogar der Beweis eines übermäßigen Gebrauches ihrer Macht, jedoch nur in einer, weiß Gott, sentimentalen Richtung, die aber leider von allen eingehalten wird. Das ist eben das Auffallende, daß die Manie, um jeden Preis freizusprechen, nicht nur die Bauern unter den Geschworenen, die gestern noch Leibeigene waren, ergriffen hat, sondern sogar die Geschworenen aus den höchsten Ständen, selbst Edelleute und Universitätsprofessoren. Gerade diese Allgemeinheit der Manie kann einen auf seltsame Gedanken bringen.
Viele erklären sich das damit, daß es ihnen leid täte, ein fremdes Menschenleben zu vernichten. Das russische Volk sei mitleidig, sagen sie.
Sonderbar, ich habe immer geglaubt, daß zum Beispiel das englische Volk auch Mitleid empfindet, und wenn in ihm auch nicht diese, sagen wir, Weichherzigkeit zu finden ist, so hat es doch jedenfalls auch seine Menschenliebe. Das Bewußtsein und das Gefühl der christlichen Pflicht ist bei den Engländern in hohem Maße vorhanden, ist bis zur festen und selbständigen Überzeugung ausgebildet, vielleicht sogar ausgesprochener als bei uns, wenn man ihre alte Bildung und Selbständigkeit in Betracht zieht. Dort ist den Geschworenen die Macht doch nicht so wie den unsrigen plötzlich vom Himmel in den Schoß gefallen. Auch haben sie das ganze Geschworenengericht selbst geschaffen, haben es von niemandem entlehnt, sondern aus dem eigenen Leben in Jahrhunderten ausgearbeitet. Deshalb weiß dort jeder Geschworene, daß er, sobald er seinen Platz im Gerichtssaal eingenommen hat, nicht nur ein gefühlvoller Mensch mit einem guten Herzen ist, sondern in erster Linie Staatsbürger. Er ist sogar der Meinung (ob er recht hat, ist eine andere Frage), daß die Erfüllung einer Bürgerpflicht wertvoller ist als die christliche Herzenstat eines Menschen. Der englische Geschworene weiß, daß er im Gerichtssaal aufhört, eine Privatperson zu sein, daß er dort nur der Vertreter der öffentlichen Meinung seines Landes ist und die Fahne Englands hochzuhalten hat. Die Fähigkeit, ein Staatsbürger zu sein, ist doch nichts anderes, als die Fähigkeit, in sich den Vertreter seines ganzen Landes zu sehen. Auch in England kennt man Nachsicht im Urteil, auch dort berücksichtigt man das „zersetzende Milieu“ (das bei uns jetzt so beliebte Schlagwort), aber es geschieht das doch nur bis zu einer gewissen Grenze, nur soweit es die gesunde Vernunft des Landes zuläßt. Deshalb wird im alten England das Laster nicht Tugend genannt, sondern bleibt Laster und das Verbrechen – Verbrechen, und die sittliche Grundlage des Landes bleibt deshalb nicht minder fest bestehen.
Hier höre ich eine Stimme einwenden: „Aber woher soll es denn auch bei uns Bürger geben? bedenken Sie doch nur, was wir noch gestern waren! Unsere Bürgerrechte (und dazu noch was für welche!), die haben uns doch, unvorbereitet wie wir waren, einfach überfallen und ruhen nun auf uns wie eine Last, die uns fast erdrückt!“
„Freilich, in Ihrer Bemerkung liegt schon etwas Wahres, aber andererseits, das russische Volk ...“
„Das russische Volk?“ unterbricht mich eine andere Stimme. „Aber, erlauben Sie, wer kennt von uns denn das russische Volk? Ich glaube, daß hier nicht nur Weichherzigkeit freispricht, sondern das Grauen vor der Macht selbst! Diese plötzliche furchtbare Macht über ein Menschenschicksal hat uns erschreckt, und bevor wir uns zu Ihren englischen Bürgern ausbilden, sprechen wir eben vorläufig frei. Aus Angst sprechen wir frei. Unsere Geschworenen denken vielleicht bei sich: ‚Sind wir denn besser als der Angeklagte? Wir sind reich und sichergestellt, aber wenn wir in seiner Lage gewesen wären, wer weiß, ob wir nicht noch Schlimmeres getan hätten als er?‘ – und deshalb sprechen sie frei. Aber das ist vielleicht doch ein Wert, vielleicht ein Unterpfand eines höheren Christentums der Zukunft, eines geistigen Ausdrucks, wie die Welt bisher noch keinen ähnlichen gekannt hat!“
Dieser Gedanke wäre allerdings beruhigend, aber ... weshalb hat denn unser Volk dieses Grauen vor der Macht? Spricht es frei, weil es sich vor dem Mitleid mit dem Verurteilten, vor dem Schmerz des Mitleids fürchtet? – Nun, so nehme man doch den Schmerz auf sich. Die Wahrheit steht höher als Mitleid.
Allerdings, wenn wir uns mitunter wirklich selbst für schlechter halten als den Verbrecher, so geben wir doch damit zu, daß wir zur Hälfte an seinem Verbrechen mit schuld sind. Denn wir sagen uns, wenn wir selbst besser wären, so würde auch er besser sein und jetzt nicht als Angeklagter vor uns stehen ...
Aber muß man ihn deshalb freisprechen?
Nein, im Gegenteil: gerade deshalb muß man die Wahrheit aussprechen und das Böse – das Böse nennen, doch die Hälfte der Last des Urteils auf sich nehmen. Wir müssen den Gerichtssaal mit dem Gedanken betreten, daß auch uns Schuld trifft, und eben dieser Schmerz des Mitleids, den jetzt alle so fürchten und mit dem wir den Saal nach einer Verurteilung verlassen, wird unsere Strafe sein. Wenn dieser Schmerz echt und tief ist, so wird er uns besser machen, und nur wenn wir selbst besser werden, machen wir das Milieu besser. Das ist es ja, daß man überhaupt nur auf diese Weise das Milieu verbessern kann. Aber so aus Angst vor dem eigenen Mitgefühl freisprechen – das ist nicht schwer, nur käme man auf diesem Wege bald zu der Folgerung, daß es Verbrechen überhaupt nicht gebe, sondern an allem bloß das Milieu schuld sei, und schließlich – wenn wir folgerichtig weitergehen –, daß Verbrechen sogar Pflicht sei, oder doch ein edler Protest gegen die herrschende Ungerechtigkeit. Dazu führt die Lehre vom Milieu, im Gegensatz zur christlichen Lehre, die, obgleich sie den Einfluß des Milieus durchaus anerkennt und Barmherzigkeit predigt, dennoch den Kampf gegen das Milieu als sittliche Pflicht des Menschen aufstellt und dabei scharf abgrenzt, wo das Milieu aufhört und die Pflicht anfängt.
Indem das Christentum den Menschen verantwortlich macht, erkennt es seine Freiheit an. Wenn man den Menschen von jedem Fehler der gesellschaftlichen Einrichtung für abhängig erklärt, wie es die Lehre vom Milieu tut, so führt man den Menschen zur vollständigen Unpersönlichkeit und entbindet ihn von jeder persönlichen sittlichen Pflicht, von jeder Selbständigkeit, und bringt ihn somit in die größte Knechtschaft, die man sich nur denken kann.
„Ja, aber,“ höre ich jemandes ironische Stimme einwenden, „glauben Sie denn, daß diese freisprechenden zwölf Geschworenen, die mitunter ausnahmslos Bauern sind, auch nur eine Ahnung von Ihrer neuesten Milieutheorie haben, die Sie ihnen da unterschieben?“
„Hm, ja ... freilich, wie sollten sie dazu kommen, d. h. alle die Vielen ... Aber Ideen ... Ideen liegen doch in der Luft, Ideen sind doch ansteckend ...“
„Na, das fehlte noch!“ lacht die ironische Stimme.
„Aber wie ... wenn gerade unser Volk ganz besonders zur Lehre vom Milieu neigte, schon seinem Wesen nach, sagen wir meinetwegen infolge seiner slawischen Veranlagung? Wie, wenn gerade unser Volk das beste Material für gewisse europäische Propaganda wäre?“
Die höhnische Stimme lacht noch lauter, aber das Lachen klingt etwas gezwungen.
Nein, es scheint mir doch, daß es sich hier vorläufig nicht um eine „Philosophie des Milieus“ handelt.
Es ist wahr, schon seit Jahrhunderten nennt unser Volk die Verurteilten „Unglückliche“. Was will es damit ausdrücken? – die christliche Auffassung oder die Auffassung des Milieus? Hier liegt der springende Punkt, gerade hier konnte die Propaganda mit Erfolg einsetzen!
Es gibt unausgesprochene, unbewußte und nur intensiv gefühlte Ideen, die mit der Menschenseele gleichsam verwachsen sind. Sie existieren sowohl im einzelnen Volk, wie in der ganzen Menschheit. Solange diese Ideen noch unbewußt dem Volksleben zugrunde liegen und erst nur stark und sicher empfunden werden, nur so lange kann das Volk ein starkes und lebendiges Leben führen. Im Bestreben, diese in sich verborgenen Ideen zum Ausdruck zu bringen, liegt die ganze Energie seines Lebens. Je unerschütterlicher das Volk seine Idee bewahrt, je weniger es fähig ist, von seinem anfänglichen Gefühl abzuweichen, je weniger es geneigt ist, sich falschen Deutungen dieser Idee hinzugeben, um so kraftvoller und glücklicher wird es sein.
Ein Teil der Idee des russischen Volkes kommt nun zweifellos in der Tatsache zum Ausdruck, daß es die Verbrecher „Unglückliche“ nennt. Kein europäisches Volk hat je etwas Ähnliches geäußert, erst jetzt beginnen in Europa einzelne Philosophen für diese Auffassung einzutreten; unser Volk aber hat sie schon vor Jahrhunderten ausgesprochen. Doch daraus folgt noch nicht, daß es nicht durch eine falsche Auslegung dieser Idee irregeführt werden könnte, wenigstens zeitweilig.
Meiner Ansicht nach will das russische Volk mit der Bezeichnung „Unglückliche“ den Verbrechern sagen: „Ihr habt gesündigt und büßt dafür, aber auch wir sind Sünder. Wären wir besser, so würdet ihr vielleicht nicht in den Gefängnissen sitzen. Mit der Strafe für eure Verbrechen tragt ihr auch die Last der allgemeinen Ungerechtigkeit. Betet für uns, wie wir für euch beten, und nehmt unser Almosen, das wir euch geben, damit ihr seht und wißt, daß wir euer gedenken und unsere brüderlichen Bande mit euch nicht zerrissen haben.“ Doch niemals hat das Volk deshalb aufgehört, einen Verbrecher für schuldig zu halten. Es wäre auch das größte Unglück für uns, wenn das Volk dem Verbrecher sagen würde: „Du bist unschuldig, denn es gibt kein Verbrechen.“ Und daß das Volk noch so denkt, das ist unsere Hoffnung, ist der Grund, weshalb wir unseren Glauben an unsere Zukunft nicht aufzugeben brauchen.
Ich habe im Zuchthaus unter vielen Verbrechern gelebt, doch habe ich unter ihnen nicht einen gesehen, der sich nicht selbst für einen Verbrecher gehalten hätte. Niemand sprach von seinem Verbrechen. Niemand murrte wider seine Strafe. Wenn einmal ein Neuling mit seiner verbrecherischen Tat prahlen wollte, so erteilten ihm alle Sträflinge einstimmig einen barschen Verweis. Man sprach einfach nicht von seinem Verbrechen. Doch sicherlich gab es nicht Einen unter ihnen, dem eine lange Zeit seelischen Leidens, reinigender und aufrichtender Reue erspart geblieben war. Ich habe sie einsam grübeln, habe sie in der Kirche beten gesehn, habe manches vielverratende Wort gehört und erinnere mich noch des Ausdrucks ihrer Gesichter, – oh, man glaube mir, da war nicht einer unter ihnen, der sich in seiner Seele schuldlos gefühlt hätte!
Ich möchte nicht, daß meine Worte als Ausdruck von Grausamkeit aufgefaßt werden, wenn ich behaupte, daß nur durch strenge Bestrafung, durch Gefängnis und Zwangsarbeit die Hälfte aller Verbrecher gerettet werden kann. Die Strafe bedrückt nicht, wie man meint, sondern erleichtert. Selbstreinigung durch Leid ist leichter, leichter als das Los, welches man ihnen bereitet, wenn man sie vollkommen freispricht. Man nimmt ihnen damit nur die Möglichkeit, sich zu bessern, und pflanzt in ihre Seele Zynismus, läßt in ihnen eine verfängliche Frage offen und ruft ihren Spott über die Richter hervor. Man erreicht damit nur, daß der Verbrecher selbst irre wird an den Dingen. „Freilich,“ wird er sich sagen, „sie haben ja recht mit dem Freispruch; wenn ich in Not war, wie sollte ich da nicht stehlen?“ Die Hauptsache aber ist, daß dadurch der Glaube an die Gerechtigkeit und die Volkswahrheit erschüttert wird.
In den letzten Jahren, die ich im Auslande verbrachte, hat mir oft das Herz geschmerzt, wenn ich dort unsere Emigranten und Absentisten sah, deren Kinder die Muttersprache kaum verstanden oder schon verlernt hatten. Aber bisweilen, wenn ich den Lesesaal nach der Lektüre unserer Zeitungen verließ, konnte ich – bei Gott, meine Herren – unsere Absentisten verstehen. Mein Herz krampfte sich zusammen, wenn ich las, wie das in Rußland neueingeführte Geschworenengericht sich „bewährte“! Es wurde nur freigesprochen – eine Frau, die ihren Mann erschossen, ein Jüngling, der die Kasse bestohlen, um seine Geliebte zu bezahlen, ein Bauer, der sein Weib solange und so grausam mißhandelt hatte, bis das Weib sich erhängte – kurz, sie wurden alle für unschuldig erklärt. Und wenn das noch wenigstens Menschen gewesen wären, die ein besonderes Mitleid oder Nachsicht verdient hätten! Aber nein!! Deshalb konnte ich mir auch den Grund des Freispruchs nie erklären. Der Eindruck war bedrückend, nahezu beleidigend. In diesen bösen Augenblicken erschien mir Rußland bisweilen wie ein Sumpf, ein Moor, auf dem sich’s jemand hat einfallen lassen, einen Palast zu bauen. Von oben gesehen ist der Boden scheinbar fest und glatt, in Wirklichkeit aber ist er wie ein Brei. Tritt man auf ihn, so versinkt man in eine bodenlose Tiefe. Ich machte mir heftige Vorwürfe wegen meines Kleinmuts und tröstete mich damit, daß ich mich als Kritiker aus der Ferne immerhin täuschen konnte.
Doch jetzt bin ich wieder in Rußland ...
„Ja, sprechen sie überhaupt aus Mitleid frei?“ – das ist nun die Frage! Lachen sie nicht darüber, daß ich ihr eine solche Bedeutung zuschreibe. „Mitleid“ ist doch immerhin noch irgendwie zu erklären, es läßt wenigstens die eine oder andere Deutung zu. Wenn es aber nun nicht Mitleid ist?
Dann steht man wie vor einer Finsternis, in der irgendein Wahnsinniger lebt.
In unseren russischen Klöstern gibt es, wie man weiß, auch jetzt noch unter den Mönchen manche Asketen und Heilige, Beichtväter und Ratgeber. Ob das nun gut oder schlecht ist, ob man der Mönche bedarf oder nicht – diese Frage wollen wir hier nicht erörtern. Es soll zwar nicht zeitgemäß sein, von Mönchen zu reden, doch können wir nicht umhin, es hier trotzdem zu tun, da das Folgende ein Mönch erzählt hat. Diese Beichtväter und Ratgeber sind bisweilen hochgebildete Menschen, Menschen mit einem tiefen Verstande. Wenigstens wird so von ihnen berichtet, ich kenne sie nicht. Einige von ihnen, sagt man, seien in ganz Rußland bekannt, und aus den fernsten Gegenden kämen die Menschen zu ihnen, oft sogar zu Fuß aus Archangelsk, aus Sibirien, aus dem Kaukasus. Wer zu ihnen kommt, den treibt eine Verzweiflung, mit der die eigene Seele nicht mehr kämpfen kann, oder auf dem Gewissen dieser Menschen ruht eine so furchtbare Schuld, daß sie mit ihrem Geistlichen in der Heimat nicht darüber sprechen mögen – nicht aus Angst oder Mißtrauen, sondern weil die Verzweiflung ihnen jeden Glauben an eine Vergebung ihrer Sünde genommen hat. Hören sie dann zufällig von einem solchen fernen, trostspendenden Beichtvater, dann machen sie sich auf und pilgern zu ihm.
So hat nun einer von diesen Mönchen in einem Gespräch unter vier Augen seinem Zuhörer folgendes erzählt:
„Schon seit zwanzig Jahren höre ich Beichten, und, werden Sie es mir glauben, in zwanzig Jahren lernt man so viele verborgene Krankheiten der Menschenseele kennen, daß einen, wie man meinen sollte, nichts mehr wunder nehmen könnte. Und dennoch kommt es vor, daß man selbst nach zwanzig Jahren erschauert beim Anhören manch einer Schuld. Man verliert die Gemütsruhe, die erforderlich ist, um dem Verzweifelten Trost geben zu können, und man muß sich selber zu Demut und Vertrauen zwingen.“
Und hierauf hat er folgende unglaubliche Geschichte aus dem Volksleben erzählt:
... Ich sehe, ein Bauer kommt auf den Knien zu mir gekrochen. Ich hatte schon vom Fenster her gesehen, wie er draußen auf der Erde kriechend näher kam. Sein erstes Wort zu mir war:
„Für mich gibt es keine Rettung mehr: bin verdammt! Was du auch sagst, ich weiß: ich bin verdammt!“
Ich versuchte, ihn einigermaßen zu beruhigen. Ich sah, daß der Mensch weither gekommen war, weil es ihn nach Strafe und Leiden für sein Vergehen verlangte.
„Wir kamen im Dorf mehrere Burschen zusammen,“ begann er, „und da fingen wir an unter uns zu streiten, wer den anderen in Frechheit überbieten könne. Ich prahlte, daß ich sie alle ausstechen würde. Da zog mich ein anderer Bursche beiseite und sagte mir unter vier Augen: ‚Hör mal, das kannst du nie und nimmer, was du da sagst. Du prahlst ja nur.‘“
„Ich wollte schon schwören, aber er unterbrach mich: ‚Nein, wart,‘ sagte er, ‚nicht so. Du schwöre mir bei deinem Seelenheil in jener Welt, daß du alles tun wirst, was ich dir sagen werde.‘“
„Ich schwor.“
„‚Gut,‘ sagte er. ‚Bald haben wir Fasten. Bereite dich zum Abendmahl vor. Die Hostie nimm, aber verschluck sie nicht. Wenn du dann aufstehst – tritt zur Seite, nimm sie aus dem Munde und behalt sie in der Hand. Das weitere werde ich dir dann sagen.‘“
„So tat ich auch. Aus der Küche führte er mich geradewegs in den Gemüsegarten. Nahm einen Pflock, stieß ihn in die Erde und sagte: ‚Leg’ hin!‘ Ich legte die Hostie auf den Pflock. ‚Jetzt geh und hol eine Flinte,‘ sagte er. Ich ging und holte sie. ‚Lad’ sie,‘ sagte er. Ich lud. ‚Ziele und schieß.‘ Ich erhob die Hand und zielte. Und da – wie der Schuß fiel, stand plötzlich vor mir das Kreuz mit dem Gekreuzigten. Da fiel ich bewußtlos hin ...“
Zugetragen hatte sich das schon mehrere Jahre vor der Beichte. Den Namen dieses Pilgers wie auch die Strafe, die er ihm auferlegt, hat der Pater natürlich nicht gesagt. Wahrscheinlich hat er die Seele dieses Menschen mit einer furchtbaren Buße belastet, vielleicht sogar mit einer, die fast über menschliche Kraft ging, in der Erwägung, daß, je schwerer die Strafe, sie um so eher das Gewissen erleichtern werde. „... weil es ihn doch nach Strafe und Leiden für sein Vergehen verlangte ...“
Dieser Fall verdient es entschieden, näher betrachtet zu werden, ja er ist sogar äußerst charakteristisch. Ich bin immer der Meinung gewesen, daß das letzte Wort gerade diese Menschen aussprechen werden, diese reuigen oder auch nicht reuigen, bußfertigen oder unbußfertigen; sie werden es sagen und uns den neuen Weg weisen, den neuen Weg ins Freie aus allen unseren anscheinend vollkommen unlösbaren Problemen. Es wird doch nicht Petersburg unser russisches Schicksal endgültig entscheiden. Deshalb aber ist jeder, ja sogar jeder geringste neue Zug dieser „neuen Menschen“ unserer Aufmerksamkeit wert.
Erstens, was mich am meisten wundert, das ist der Anfang des Ganzen, die Möglichkeit eines solchen Streites und Wettkampfes in einem russischen Dorf: wer den anderen in Frechheit überbieten könne. Es ist das eine Tatsache, die auf furchtbar vieles hindeutet, und ich muß sagen, daß sie für mich eine sogar ganz unerwartete Erscheinung ist – ich habe doch genug Menschen aus dem Volk gesehen, sogar die charakteristischsten Verbrecher und Sträflinge.
Ferner ist die, sagen wir, krankhafte Seite des Vorfalls bemerkenswert. Halluzinationen sind eine vornehmlich krankhafte Erscheinung und zugleich hört man von dieser Krankheit nur sehr, sehr selten. Die Möglichkeit einer plötzlichen Halluzination bei einem, wenn auch sehr erregten, aber immerhin ganz gesunden Menschen ist an sich bisher vielleicht noch nicht vorgekommen. Doch das ist eine medizinische Frage, von der ich wenig verstehe.
Etwas ganz anderes ist es mit der psychologischen Seite des Falles. Da erscheinen vor uns zwei Charaktere, die in hohem Maße für das ganze russische Volk typisch sind! Da ist vor allen Dingen dieses Vergessen eines jeden Maßes bezeichnend (doch ist das, wohlgemerkt, fast immer nur eine zeitweilige Erscheinung, gleichsam eine vorübergehende Anfechtung). Da ist dieses Bedürfnis, über das Maß hinauszugreifen, das Bedürfnis nach herzbeklemmenden Empfindungen, das Verlangen, an einen Abgrund heranzugehen, sich mit dem halben Körper schon über den Rand zu beugen, in die schaudervolle Tiefe zu blicken und – sehr oft oder wenigstens in nicht seltenen Fällen – sich wie ein Wahnsinniger mit dem Kopf voran in die Tiefe zu stürzen. Das ist das Verneinungsbedürfnis im russischen Menschen, bisweilen sogar in einem durchaus nicht verneinenden, sondern in einem ehrfürchtig alles bejahenden Menschen – die Verneinung von allem, selbst des größten Heiligtums des eigenen Herzens, seines höchsten Ideals, des ganzen Volksheiligtums, vor dem er soeben noch ehrfurchtsvoll gekniet, das aber dann plötzlich gleichsam zu einer unerträglichen Last für ihn wird. Auffallend ist dabei namentlich jene Hast, jener unbezwingbare Drang, in dem der Russe sich in manchen Augenblicken seines eigenen oder des ganzen Volkslebens zu äußern beeilt, wenn der Augenblick einer von jenen ist, die den Charakter des Menschen herausfordern – gleichviel ob es in einer guten oder in einer unflätigen Tat geschieht. Mitunter gibt es für ihn dann überhaupt keine Schranken mehr. Was es auch sei, Liebe, Wein, Eigenliebe, Neid oder die tolle Stimmung eines Gelages – da gibt sich mancher Russe rückhaltlos dem Augenblick hin, ist imstande, alles zu zerreißen, zu vernichten, von allem sich loszusagen, von der Familie, von den Sitten, von Gott. Manch ein herzensguter Mensch kann plötzlich zum Tier und Verbrecher werden, wenn er einmal in diesen Wirbel hineingerät – in diesen für uns verhängnisvollen Wirbel momentaner, konvulsivischer Selbstverneinung und Selbstzerstörung, die dem russischen Volkscharakter seit jeher zu seinem Verhängnis eigen sind. Aber mit ebensolcher Kraft, mit ebenso großem Ungestüm im Verlangen nach Selbsterhaltung und Buße versteht es das ganze Volk, wie auch der einzelne Russe, sich selber wieder zu retten, und er rettet sich gewöhnlich gerade in dem Augenblick, wenn er schon bei der letzten Grenze angelangt ist, d. h. wenn er nirgendwohin mehr weitergehen kann. Doch besonders bezeichnend ist es, daß der Rückschlag – der die Wiederherstellung, die Rettung zur Folge hat – immer ernster ist als der erste Stoß, der ihn zur Verneinung und Selbstvernichtung treibt. Jene erste Anwandlung ist eben immer eine Art Kleinmut oder eine Laune, während der Rückschlag mit der Wiederherstellung und Rettung aus eigener Kraft immer etwas Großes ist: und ihm gibt sich der russische Mensch mit der größten, gewaltigsten und ernstesten Anstrengung hin und blickt dann auf seine frühere Verneinung mit Selbstverachtung zurück.
Ich glaube, das hauptsächlichste, das ursprünglichste geistige Bedürfnis des russischen Volkes ist das Bedürfnis zu leiden, ewig und unersättlich, überall und in allem. Dies Lechzen nach Leid hat es, wie mir scheint, schon von jeher in sich gehabt. Wie ein leidtragender Strom zieht es durch seine ganze Geschichte, und zwar nicht nur in Gestalt äußeren Unglücks und verschiedener Heimsuchungen, vielmehr entspringt seine Quelle dem lebendigen Herzen des Volkes. Sogar im Glück des Russen, sowohl des einzelnen wie des ganzen Volkes, ist unbedingt ein Teil Leid enthalten, anderenfalls ist für ihn das Glück nicht vollständig. Niemals, nicht einmal in den Stunden der größten Triumphe, die seine Geschichte kennt, hat das russische Volk ein stolzes oder triumphierendes Aussehen, sondern nur ein, bis zum Leid ergriffenes; es atmet wohl auf, aber den Ruhm schreibt es der Gnade Gottes zu. Im Leid findet das russische Volk gleichsam einen Genuß. Und was vom ganzen Volk gilt, gilt auch vom einzelnen Russen, natürlich nur im allgemeinen gesprochen. Man betrachte z. B. die zahlreichen Typen des randalierenden Russen. Es ist bei ihm nicht nur übermäßige Ausgelassenheit, deren Schrankenlosigkeit oder Frechheit einen wundernimmt oder einen durch die Tiefe des Falles einer Menschenseele anwidert. Dieser widerliche Mensch ist in erster Linie selber ein Märtyrer. Eine naiv triumphierende Selbstzufriedenheit, eine satte Gespreiztheit ist einem Russen nie eigen, nicht einmal einem dummen. Man vergleiche einen russischen Betrunkenen mit – nun, meinetwegen mit einem deutschen: der betrunkene Russe ist vielleicht gemeiner als der betrunkene Deutsche, doch ist dieser zweifellos dümmer und komischer als der Russe. Die Deutschen sind ein vornehmlich selbstzufriedenes, auf sich stolzes Volk. Im betrunkenen Deutschen pflegen nun diese Grundzüge des Volkscharakters an Ausgeprägtheit proportional dem Quantum des getrunkenen Bieres zuzunehmen. Der betrunkene Deutsche ist ein zweifellos glücklicher Mensch und denkt nicht daran, zu weinen; statt dessen singt er selbstgefällige Lieder und ist stolz. Er kommt stocksteif besoffen nach Haus, aber er ist dabei stolz! Der russische Trinker dagegen trinkt gewöhnlich aus Leid und weint nachher. Oder wenn er auch großtut, so ist das doch kein Triumphieren, sondern nur ein Randalieren. In der Regel fällt ihm dann irgendeine ihm widerfahrene Kränkung ein und er fängt an, dem Beleidiger, gleichviel, ob dieser zugegen ist oder nicht, bittere Vorwürfe zu machen. Schließlich beweist er ihm mit Nachdruck, daß er womöglich ein General sei, schimpft dabei aufrichtig, wenn man ihm nicht glaubt, bis er zu guter Letzt, um alle zu überzeugen, unbedingt nach der Polizei schreit. Aber er ist ja nur deshalb so, ruft auch nur deshalb nach der Polizei, weil er in den geheimsten Tiefen seiner betrunkenen Seele nur zu gut weiß, daß er ganz und gar kein General, sondern nur ein ekelhafter Säufer und tiefer gesunken ist als das niedrigste Vieh. Was wir hier im mikroskopischen Beispiel sehen, sehen wir auch im großen Ganzen. Selbst der größte Schandkerl, der fast schön ist in seiner Frechheit, in seiner eleganten Lasterhaftigkeit, so daß ihn die Dummköpfe sogar nachäffen, selbst dieser fühlt in den verborgensten Tiefen seiner verderbten Seele, daß er doch nur ein Nichtswürdiger ist. Er ist unzufrieden mit sich, die bittere Selbsterkenntnis nagt an seinem Herzen, und dafür rächt er sich an den anderen. Er martert sich, er tobt gegen sich und alles Gute in ihm und um ihn, bis er, unter ständigem Kampf gegen den in seinem Herzen sich ansammelnden Schmerz und doch zugleich sich wie daran berauschend, diese letzte Grenze erreicht. Wenn er aber dann, schon über dem Abgrund hängend, sich doch noch aufzurichten vermag, so straft er sich selbst am grausamsten, straft er sich mehr als andere es je könnten.
Was trieb diese Burschen in den Streit: „Wer den anderen an Frechheit überbieten könne?“ Und warum wählte der Bursche gerade diese Tat zur Prüfung der Vermessenheit des anderen? Er hätte doch auch eine andere Tat wählen können, etwa die Ermordung einer hochgestellten Persönlichkeit oder sonst einen ganz besonderen Mord, denn der Bursche hatte doch geschworen, daß er „zu allem“ bereit sei, und sein Versucher wußte, daß er tatsächlich „alles“ tun werde, was er von ihm als Beweis seiner Vermessenheit verlangte. Doch nein! Selbst die schrecklichsten Verbrechen scheinen dem Versucher nicht schrecklich genug zu sein. Er denkt sich etwas noch nie Dagewesenes, etwas Unerhörtes aus, woran noch nie jemand gedacht hat! Doch das, daß er gerade in dieser Tat das Unerhörteste, das Vermessenste sah, gerade das verrät die ganze Weltanschauung unseres Volkes!
Ich sagte – „woran noch nie jemand gedacht hat“. Ist es so? Nein, denn alles beweist, daß er sich schon lange mit diesem Gedanken beschäftigt haben muß. Vielleicht war schon in seiner Kindheit dieser Traum in seine Seele gekrochen, hatte sie mit Schrecken erfüllt und gequält – und diese Qual war für ihn vielleicht zum Genuß geworden. Er hatte sich das alles vielleicht schon lange zuvor ausgedacht – die Flinte, die Hostie – und nur als tiefstes Geheimnis in sich bewahrt. Selbst hätte er es vielleicht nicht zu tun gewagt, er spielte nur mit dieser Vorstellung, die ihm gefiel, die ihn verführte, der er nachgab. Eine Sekunde lang unerhörteste Vermessenheit – und wenn’s die Seele kostet! – doch dafür eine Sekunde über diesem Abgrund! Natürlich glaubte der Bursche, daß er für diese Tat ewig verdammt sein werde, aber – das Wagnis war doch zu verführerisch.
Man kann vieles unbewußt wissen, indem man es nur fühlt, aber nicht weiß. Jedenfalls ist dieser Verführer ein interessantes Seelenproblem, und dabei nicht zu vergessen, daß er ein Bauer war, unter Bauern lebte! Gerade das ist es, was einen am meisten überrascht. Auch wäre es interessant, zu erfahren, ob er, der Verführer, sich für schuldiger hielt als sein Opfer. Es ist anzunehmen, daß er es tat, oder wenigstens wird er sich für ebenso schuldig betrachtet haben – so daß er, als er den anderen Burschen herausforderte, zugleich sich selbst herausforderte.
Man sagt, das russische Volk kenne kaum das Evangelium, kenne nicht einmal die Grundlehren seines Glaubens. Mag sein, doch dafür kennt es Christus und trägt ihn seit jeher im Herzen. Das ist über jeden Zweifel erhaben! Wie aber eine richtige Auffassung von Christus ohne vorhergegangenen Religionsunterricht möglich ist, das ist eine andere Frage?! Jedenfalls hat das Volk dieses Gefühl für Christus von Generation zu Generation vererbt, und so ist es gleichsam eins geworden mit seinem Herzen. Vielleicht ist Christus die einzige Liebe des russischen Volkes, das ihn eben auf seine Art liebt, d. h. bis zur Qual. Deshalb ist ihm auch die liebste seiner Benennungen „das rechtgläubige Volk“, wie es sich denn vor allen anderen Völkern auf die richtigste Weise zu Christus bekennt. Es ist zugleich das einzige, worauf unser Volk stolz ist. Ich wiederhole – man kann vieles unbewußt wissen.
Und nun: gerade an diesem Volksheiligtum sich zu versündigen, mit der ganzen Überlieferung, mit der ganzen Umgebung, mit der Erde selbst, mit allen und allem zu brechen und sich selbst unrettbar, auf ewig ins Verderben zu stürzen für diesen einen Augenblick des Triumphes und Stolzes – nein, eine größere Versuchung hätte der russische Mephisto wahrlich nicht ersinnen können! Schon die bloße Möglichkeit so dunkler, geheimnisvoller und vielverschlungener Regungen in der Seele eines einfachen Bauern macht einen stutzig! Und dabei nicht zu vergessen, daß sich das alles in diesem Burschen doch fast bis zur bewußten Idee entwickelt hatte.
Ein anderes ist folgendes. Menschen können freilich bis zum Tierischen gefühllos sein, doch hier handelt es sich nicht um Gefühllosigkeit, sondern um etwas ganz Besonderes: um den mystischen Schrecken, der die größte Macht über die Menschenseele hat. Daß es sich in diesem Fall tatsächlich um eine mystische Angst gehandelt hat, steht nach dem ganzen Verlauf der Begebenheit wohl außer Frage. Die starke Seele des Burschen konnte zunächst noch gegen diese Angst ankämpfen. Übrigens – war das ein Beweis von Stärke oder von ängstlichem Kleinmut? Vermutlich wird es sowohl das eine wie das andere gewesen sein: eine Mischung der Gegensätze. Diese mystische Angst hat dann den Kampf noch verlängert, indem sie vom Herzen des Sünders das natürliche Empfinden fernhielt. Das Gefühl der Angst ist grausam, es verhärtet das Herz und panzert es gegen jede weiche oder hochherzige Regung. So konnte der Bursch die Tat vollbringen. Doch warum erschlug der Gepeinigte nicht seinen Peiniger?
Das ist es eben, daß sowohl bei diesem wie bei jenem in der Tiefe der Seele dasselbe Gefühl gewesen sein muß, so daß sie beide eine gewisse höllische Lust am eigenen Verderben empfunden haben werden – als sie dem atemraubenden Verlangen nachgaben, sich über diesen Abgrund zu beugen – und einen gewissen erschütternden Genuß von ihrer eigenen Vermessenheit.
Und da – im Augenblick, als die Tat geschehen war – steht plötzlich die Erscheinung des Gekreuzigten vor ihm!
Sein Herz hatte ihn gerichtet. Warum nicht sein Bewußtsein, warum zeigte ihm nicht sein Verstand die ganze Kleinlichkeit der Tat, die er für Kühnheit gehalten hatte, warum erblickte er das Gericht in der Gestalt einer Erscheinung, die doch wie von außen vor ihn hintrat, gleichsam unabhängig von seinem Geist und Gewissen? Das zu erklären, wäre eine große psychologische Aufgabe. Doch für ihn, den Verbrecher, war es natürlich ein Wunder des Herrn. Als Büßer kroch er über die Erde im Verlangen nach Strafe.
Der andere aber, der Versucher? Von ihm hatte der Büßer nichts gesagt und wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Vielleicht kroch auch er auf den Knien, vielleicht aber ... blieb er im Dorf und lebt dort noch heute, trinkt und lacht und spottet an den Feiertagen nach wie vor. Die Erscheinung war ja nicht ihm erschienen! Oder? ... Es wäre doch sehr wesentlich, näheres auch über ihn zu erfahren, so – als Studienmaterial.
Ja, es wäre wesentlich. Denn man fragt sich doch unwillkürlich: wie aber, wenn dieser nun der unverfälschte Dorfnihilist war? der einheimische Verneiner und Denker, der an nichts glaubt, der sich mit hochmütigem Lächeln ein Versuchsobjekt aussucht, einer, der mit seinem Opfer weder Mitleid hat noch bei der Ausführung der Tat zittert, sondern mit kalter Beobachtungslust das Beben und Zittern seines Opfers verfolgt? einzig aus dem Verlangen heraus, fremde Qualen zu sehen, oder Menschen in der Erniedrigung, weiß der Teufel – vielleicht sogar zu einer Art von wissenschaftlicher Erforschung?
Wenn solche Züge sogar schon in unserem Volkscharakter vorhanden sind, unter den Landleuten – so ist das allerdings eine etwas überraschende Entdeckung. Früher hat man nie ähnliches vernommen.
Die Bedeutung dieses ganzen Vorfalls liegt darin, daß er nicht von einem Dichter erdacht ist, sondern daß sich tatsächlich alles so zugetragen hat: es dürfte wahrlich nicht müßig sein, einmal in die Seele unseres zeitgenössischen Büßers zu schauen. Unsere Büßer verändern sich schnell. Dort unten im Volk gärt es seit der Aufhebung der Leibeigenschaft ebenso wie oben in der Gesellschaft. Der Riese erwacht und dehnt seine Glieder; vielleicht will er zu toben anfangen, will schrankenlos sich ausleben ... Man sagt, er tue es bereits; man spricht von Räubern und Verbrechern, von Trunksucht, von betrunkenen Kindern, betrunkenen Müttern, von Zynismus, von Armut, Unredlichkeit, von Gottlosigkeit ... Doch erinnern wir uns dieses Büßers und seien wir voll Zuversicht: im letzten Augenblick wird sich die ganze Lüge – wenn hier wirklich Lüge ist – aus dem Herzen des Volkes herausreißen, und vor sich wird es eine überirdische Erscheinung sehen. Dann wird das Volk zu sich kommen und sich auf seine göttlichen Aufgaben besinnen. Jedenfalls wird es sich selbst retten, wenn es wirklich bis zum Rande des Verderbens mit ihm kommen sollte. Sich selbst und auch uns wird es retten, denn wieder sei es gesagt: das Licht und die Rettung werden von unten kommen.
Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft ist in der Tat die Periode Peters in der Geschichte Rußlands abgeschlossen: nun leben wir in der größten Ungewißheit ...
„... In der Tat: welch ein Recht hatte diese Natur, mich in die Welt zu setzen, infolge dort irgendwelcher ewigen Naturgesetze? Ich bin mit Erkenntnisfähigkeit erschaffen und habe diese Natur erkannt: welches Recht hatte sie, mich ohne meinen Wunsch und Willen erkenntnisfähig zu erschaffen? Erkennend, folglich leidend, ich aber will nicht leiden – denn warum sollte ich einwilligen zu leiden? Die Natur spricht zu mir durch meine Erkenntnis von einer gewissen Harmonie innerhalb des Ganzen. Die menschliche Erkenntnis hat aus dieser Verkündung Religionen gemacht. Sie sagt mir, daß ich – obschon ich genau weiß, daß ich an der ‚Harmonie des Ganzen‘ nicht mitwirken kann und auch niemals mitwirken werde, ja überhaupt nicht begreifen werde, was sie denn nun eigentlich ist und bedeutet – sagt mir, daß ich mich aber dennoch dieser Verkündung unterwerfen, mich bescheiden, das Leid im Hinblick auf die Harmonie des Ganzen auf mich nehmen und zu leben einwilligen soll. Wenn man dagegen selbst und bewußt wählen könnte, so würde ich doch selbstverständlich lieber nur in dem kurzen Augenblick, den mein Leben währt, d. h. solange ich existiere, glücklich sein wollen, da doch das Ganze und seine Harmonie mich absolut nichts angehen, sobald ich aufhöre zu sein – gleichviel ob dieses Ganze nach meinem Tode mit seiner Harmonie erhalten bleibt oder ob es gleichzeitig mit mir zu existieren aufhört. Und wozu sollte ich mich so um seine Erhaltung nach meinem Tode sorgen? – das ist die Frage! Da wäre es doch besser, ich wäre wie alle Tiere erschaffen, d. h. lebend, jedoch ohne vernunftgemäße Erkenntnis – meine Erkenntnis ist ja nicht Harmonie, sondern ist Disharmonie, denn ich bin mit ihr unglücklich. Man betrachte nur einmal daraufhin die Menschen: wer ist denn glücklich in der Welt und was für Leute sind es denn, die widerspruchslos leben? – Gerade diejenigen, die den Tieren ähneln, die infolge der geringen Entwicklung ihres Bewußtseins dem Tier am nächsten stehen. Sie willigen gern ein, zu leben, aber gerade unter der Bedingung, wie Tiere zu leben, nämlich fürs Essen, Trinken, Schlafen, Nesterbauen und Kinder-in-die-Welt-Setzen. Essen, Trinken und Schlafen nach Menschenart heißt im allgemeinen erwerben und rauben, ein Nest einrichten aber schon unbedingt rauben. Man wird vielleicht einwenden, daß man sein Nest auch auf vernünftigen, wissenschaftlich einwandfreien sozialen Prinzipien aufbauen könne und durchaus nicht zu rauben brauche, wie es bisher der Fall war. Möglich, aber ich frage: ‚wozu? Wozu erwerben und bauen und sich soviel Mühe geben, um sich in der Gesellschaft der Menschen richtig, um sich vernünftig und sittlich, kurz – gerecht einzurichten?‘ Darauf vermag mir natürlich niemand eine Antwort zu geben. Alles, was man mir darauf antworten könnte, wäre: ‚um sich Genuß zu verschaffen.‘ Ja, wenn ich eine Blume oder eine Kuh wäre, dann gäbe es für mich vielleicht auch einen Genuß. Indem ich mir aber, wie jetzt, unaufhörlich Fragen vorlege, kann ich nicht glücklich sein, nicht einmal im höchsten und unmittelbarsten Glück der Liebe zum Nächsten und der Liebe der Menschheit zu mir, denn ich weiß, daß morgen schon alles dieses nicht mehr sein wird, sowohl ich wie dieses ganze Glück und die ganze Liebe und die ganze Menschheit – daß wir uns in ein Nichts verwandeln werden oder wieder in das anfängliche Urchaos. Unter einer solchen Bedingung aber kann ich um keinen Preis ein Glück annehmen – nicht aus Unlust, es anzunehmen, nicht aus Eigensinn um eines Prinzips willen, sondern einfach deshalb, weil ich weder glücklich sein kann noch werde, solange ich weiß, daß mich morgen das Nichtsein erwartet. Das ist eben eine Gefühlssache, ein ganz unmittelbares Gefühl, das ich nicht bewältigen kann. Nun gut, wenn ich allein sterben, und wenn dafür die Menschheit an meiner Statt ewig weiterleben würde, dann wäre ich vielleicht immerhin getröstet. Aber unser Planet ist doch nicht ewig und die Lebensdauer der ganzen Menschheit ist im Verhältnis zur Ewigkeit genau solch ein Augenblick wie mein Einzelleben. Und wie vernünftig, wie herrlich, wie gerecht und heilig die Menschheit auf Erden sich auch immer einrichtete – es wird morgen doch alles dieselbe Null sein. Und wenn das auch alles da aus irgendeinem Grunde notwendig ist, infolge irgendwelcher allmächtiger, ewiger und toter Naturgesetze, so ist doch, ich versichere Sie, in diesem Gedanken eine gewisse allertiefste Nichtachtung der Menschheit enthalten, die für mich tief beleidigend und um so unerträglicher ist, als es hier keinen Schuldigen gibt.
„Und schließlich, wenn man dieses Märchen von der endlich mal nach vernünftigen und wissenschaftlichen Grundsätzen eingerichteten Menschheit auf Erden als möglich annimmt und an seine dereinstige Verwirklichung glaubt, d. h. an das zukünftige Menschenglück auf Erden glaubt – so ist doch schon der bloße Gedanke, daß die Natur infolge irgendwelcher ihrer trägen Gesetze es nötig hatte, den Menschen Jahrtausende zu quälen, bevor sie ihn zu diesem Glück brachte, schon unerträglich und empörend. Jetzt füge man noch hinzu, daß dieselbe Natur, die dem Menschen endlich einmal ein Glück gewährt, all das morgen schon aus irgendeinem Grunde in eine Null verwandeln muß, ungeachtet aller Leiden, mit denen die Menschheit für dieses Glück gezahlt hat, und ohne mir und meiner Erkenntnis das zu verbergen, wie sie es einer Kuh verbirgt, – so kommt einem unwillkürlich ein äußerst spaßiger, aber auch unerträglich trauriger Gedanke: ‚Nun, wie, wenn der Mensch nur als ein unverschämter Versuch in die Welt gesetzt worden ist, nur um zu sehen, ob sich ein solches Wesen auf der Erde einleben kann oder nicht?‘ Das Traurige dieses Gedankens besteht hauptsächlich darin, daß es wiederum keinen Schuldigen gibt, es ist niemand da, der den Versuch anstellt, somit kann man niemanden verfluchen, denn es ist alles infolge toter Naturgesetze entstanden, die für mich vollkommen unbegreiflich sind und mit denen sich meine Erkenntnis unter keinen Umständen abfinden kann. Ergo:
„Da ich auf meine Fragen nach dem Glück durch meine eigene Erkenntnis von der Natur nur die Antwort erhalte, daß ich nicht anders als einzig in der Harmonie des Ganzen glücklich sein kann, ich aber diese Harmonie nicht verstehe und offenbar niemals zu verstehen imstande sein werde –
„Da die Natur mir nicht nur nicht das Recht abspricht, von ihr Rechenschaft zu fordern, sondern mir sogar überhaupt nicht antwortet – und das nicht deshalb, weil sie etwa nicht antworten will, sondern deshalb, weil sie nicht antworten kann –
„Da ich mich überzeugt habe, daß die Natur mir zum Beantworten meiner Fragen (mir unbewußt) mich selber bestimmt hat, und mir auf meine Fragen durch eine eigene Erkenntnis antwortet (denn ich sage mir das doch alles selbst) –
„Da ich bei einer solchen Einrichtung die Rolle sowohl des Klägers wie des Beklagten, des Richters wie des Angeklagten gleichzeitig auf mich nehme, diese Komödie von seiten der Natur aber so dumm finde und diese Komödie zu ertragen meinerseits sogar für erniedrigend halte –
„So verurteile ich in meiner fraglosen Eigenschaft als Richter und Kläger und Beklagter diese Natur, die mich so zeremonielos und unverschämt zum Leiden erschaffen hat – mit mir zusammen zur Vernichtung ... Da ich aber die Natur nicht vernichten kann, so vernichte ich mich allein, einzig weil es mich langweilt, eine Tyrannei zu ertragen, bei der es keinen Schuldigen gibt.“
Die Oktober-Nummer meines „Tagebuchs“ enthielt diese Beichte eines Selbstmörders, sein letztes Wort vor dem Tode, das er zur Rechtfertigung seiner Tat und vielleicht auch zur „Erbauung“ niedergeschrieben hatte. Einige meiner Freunde, deren Kritik ich sehr schätze, äußerten sich durchaus beifällig über diesen kleinen Aufsatz und meinten, es sei in ihm tatsächlich die Formel für diese Art Selbstmörder gefunden, ihr Wesen, ihr Gedankengang sei vollkommen klar ausgedrückt ... Nur eines flößte ihnen Bedenken ein: ob auch jeder Leser den Aufsatz richtig verstehen werde, oder ob man nicht eher das Gegenteil herauslesen könne? Auch ich hatte das schon während des Schreibens befürchtet, aber ich schämte mich, offen gestanden, in meinem Leser so viel Naivität vorauszusetzen, daß er die Absicht des Aufsatzes nicht durchschauen könne, da sie meines Erachtens doch so greifbar ersichtlich war. Leider war das ein Irrtum von mir. Denn kaum war diese Nummer des Tagebuchs erschienen, als ich sowohl schriftlich wie mündlich von Fremden und von Bekannten gefragt wurde, was dieser Aufsatz eigentlich zu bedeuten habe? „Was wollen Sie damit gesagt haben? Ist es möglich, daß Sie den Selbstmord verteidigen?“ lauteten die Fragen. Und nun erhielt ich noch aus Moskau die letzte Nummer einer Wochenschrift zugesandt, die eine mit „N. P.“ unterzeichnete, man kann sagen, „höflich schmähende“ Kritik meines kleinen Aufsatzes enthielt.
Als ich diese Kritik gelesen hatte, verlor ich nahezu allen Mut. Mein Gott, habe ich denn viele solcher Leser, und glaubt denn dieser Herr N. P., der da behauptet, mein Selbstmörder verdiene nicht das geringste Mitleid, daß ich ihm diesen Selbstmörder zum „bemitleiden“ vorgestellt habe? Die persönliche Auffassung des Herrn N. P. ist für mich natürlich nicht von solcher Bedeutung, daß ich sie widerlegen müßte, obschon Herr N. P. ein Typ zu sein scheint und wohl eine ganze Schar Gleichgesinnter hinter ihm steht – er ist nämlich der Typ einer ganz besonderen „unverfrorenen“ und radikalen Menschensorte, ist der Vertreter eben der „gußeisernen Begriffe“, von denen er in seiner Kritik ausgeht. Wenn ich trotzdem meinem vor zwei Monaten erschienenen Aufsatz eine Erklärung folgen lasse, so geschieht dies nicht wegen der Kritik des Herrn N. P., sondern weil ich schon vorher beschlossen hatte, es zu tun, – ich war ja bereits, und nur zu bald belehrt worden, daß ich meinen Gedanken noch erläutern und sogar breittreten mußte.
Meine Studie über den Selbstmörder bezieht sich auf die älteste und höchste Idee des Menschen: auf die Notwendigkeit des Glaubens an die Unsterblichkeit der Seele. Der Folgeschluß aus der Beichte dieses Selbstmörders, der durch „logischen Selbstmord“ umkommt, sollte sein: daß das Leben des Menschen ohne Glauben an seine Seele und ihre Unsterblichkeit unnatürlich, undenkbar und unerträglich ist. Und es schien mir allerdings, daß ich die Formel des logischen Selbstmörders gefunden und klar ausgedrückt hatte.
Der Glaube an die Unsterblichkeit ist für diesen Selbstmörder nicht vorhanden, was er gleich zu Anfang vorausschickt. Die Überzeugung von der Zwecklosigkeit seines Lebens und die Empörung über die Stummheit des ihn umgebenden Weltalls führen ihn allmählich und unvermeidlich zu der Überzeugung von der vollständigen Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins auf Erden. Es ist für ihn hiernach sonnenklar, daß nur diejenigen Menschen, die den Tieren am nächsten stehen, infolge der geringen Entwicklung ihres Bewußtseins und der großen Entwicklung ihrer rein physischen Bedürfnisse, einwilligen können, dieses Leben anzunehmen. Oh, er weiß, daß dieses rein körperliche Leben, essen, trinken, schlafen, Kinderzeugen und im Warmen sitzen, den Menschen noch lange an die Erde fesseln wird, wenn auch nicht in seinen höheren Typen. Dabei sind es aber gerade diese höheren Typen, die auf Erden herrschen und immer geherrscht haben, und denen, wenn die Zeit erfüllt war, die Millionen der anderen Menschen zu folgen pflegten. Was ist das nun, dieses höhere Wort und der höhere Gedanke? Dieses Wort, dieser Gedanke (ohne die das Leben der Menschheit undenkbar ist) wird sehr oft von ganz armen, unbeachteten, und sogar sehr oft verfolgten, in der Verbannung umgekommenen oder in Unbekanntheit dahingehenden Menschen zum erstenmal ausgesprochen. Doch der Gedanke selbst, das einmal von ihnen ausgesprochene Wort – die sterben nicht mit ihnen, sie verschwinden niemals spurlos und können auch gar nicht verschwinden, sobald sie einmal ausgesprochen sind ... Das aber ist fast das Erstaunlichste an der Menschheit! Der Gedanke eines Genies hat schon in der folgenden Generation oder in zwei bis drei Jahrzehnten alle und alles erfaßt und reißt alle und alles mit sich fort – und das Ergebnis ist, daß nicht die Millionen Menschen und nicht die anscheinend so unerschütterlichen und mächtigen materiellen Kräfte, nicht das Geld, nicht das Schwert, nicht die Gewalt, sondern der anfangs so unbeachtete Gedanke irgendeines äußerlich oft ganz unansehnlichen Menschen bleibt und herrscht. Herr N. P. schreibt in seiner Kritik, die Veröffentlichung einer solchen „Beichte“ in meinem Tagebuch sei ein „lächerlicher und bedauernswerter Anachronismus“ ... denn heute lebten wir „im Jahrhundert der gußeisernen Begriffe, im Jahrhundert der positiven Anschauungen, in einem Jahrhundert, dessen Parole lautet: leben um jeden Preis! ...“ (Sehr möglich! Das ist dann wohl auch der Grund, weshalb heutzutage die Selbstmorde unter den Intelligenten so häufig sind.) Ich kann aber dem verehrten Herrn N. P. und allen seinesgleichen versichern, daß dieses „Gußeisen“ sich vor mancher Idee, wie belanglos diese den Herren der „gußeisernen Begriffe“ anfangs auch erscheinen mag, wenn die Zeit kommt, in Staub verwandelt! Für mich persönlich ist eine der größten Befürchtungen für unsere Zukunft, und zwar schon für unsere nächste Zukunft, die Tatsache, daß einer besonderen, seltsamen ... nun sagen wir, Vorherbestimmung zufolge in einem großen, allzu großen Teil der russischen Intelligenz sich vollständiger Unglaube an die eigene Seele und ihre Unsterblichkeit zu verbreiten scheint, und zwar, wie mich dünkt, mit einer progressiv zunehmenden Schnelligkeit. Und nicht nur, daß dieser Unglaube sich aus Überzeugung ausbreiten wird (Überzeugung ist bei uns noch sehr wenig vorhanden), er äußert sich vielmehr, und zwar schon heute, in einem gewissen Indifferentismus zu der höchsten Idee des Menschseins, – in einem (bisweilen fast spöttischen und weiß Gott woher und nach welchen Gesetzen sich bei uns entwickelnden) Indifferentismus nicht nur zu dieser Idee, sondern überhaupt zu allem, was Leben ist, zur ganzen Lebenswahrheit, zu allem, was Leben gibt und nährt, was das Leben gesund erhält und der Fäulnis und Auflösung entgegenwirkt. Dieser Indifferentismus ist in unserer Zeit fast zu einer russischen Besonderheit geworden – im Vergleich mit den anderen europäischen Nationen. Er ist längst in die Familien der russischen Intelligenz eingedrungen und hat sie fast vollständig zerstört. Ohne eine höhere Idee aber kann weder ein Mensch noch eine Nation in der Welt bestehen. Auf Erden jedoch gibt es nur eine höhere Idee, und die ist: die Idee der Unsterblichkeit der Menschenseele – denn die übrigen „höheren“ Lebensideen haben alle ihren Ursprung nur in dieser einzigen Idee. Hierüber kann man mit mir streiten (d. h. über diese Einheit der Quelle alles Höheren auf Erden), doch ich übergehe das vorläufig und spreche meine Idee aus, ohne sie zu begründen. In kurzen Worten läßt sich nicht alles sagen, nach und nach kann man es besser erklären. Wir haben ja noch Zeit vor uns.
Mein Selbstmörder nun ist ein leidenschaftlicher Verfechter seiner Idee, d. h. der Notwendigkeit des Selbstmords, und nicht etwa ein indifferenter, nicht etwa ein „gußeiserner“ Herr. Er leidet, er quält sich tatsächlich, – wie mir scheint, habe ich das unmißverständlich ausgedrückt! Es ist für ihn nur zu ersichtlich, daß er nicht leben kann, und er weiß nur zu gut, daß er recht hat und daß es unmöglich ist, ihn zu widerlegen. Vor ihm stehen unbesiegbar die höchsten, die ersten Fragen: wozu soll der Mensch noch leben, wenn er bereits erkannt hat, daß tierisch zu leben für einen Menschen widerlich ist? unnatürlich, so zwecklos wie unzureichend? Was könnte ihn in solchem Fall da noch an die Erde fesseln? – Auf diese Fragen kann er keine Antwort erhalten, und das weiß er, denn wenn er auch erkannt hat, daß es, wie er sich ausdrückt, „eine Harmonie des Ganzen“ gibt, so sagt er sich doch, daß er sie nicht verstehen kann und niemals imstande sein wird, sie zu verstehen, und daß er nie an ihr teilnehmen werde. Gerade diese Klarheit ist es, die ihn umbringt. Wo liegt nun der Fehler, worin hat er sich geirrt? Der Fehler, meine ich, liegt einzig in dem Verlust des Glaubens an die Unsterblichkeit.
Doch er sucht ja selbst glühend (d. h. er suchte, als er noch lebte, und suchte mit Pein) nach Versöhnung. Er wollte sie in der Liebe zur ganzen Menschheit finden. „Wenn nicht ich, so könnte doch die Menschheit glücklich sein und irgendeinmal die Harmonie erreichen: dieser Gedanke könnte mich auf Erden zurückhalten,“ sagt er, und verrät sich. Denn dies ist doch wohl kein kleinlicher Gedanke, sondern verrät Großmut und Opferbereitschaft. Aber die unwiderlegbare Überzeugung, daß das Leben der ganzen Menschheit im Grunde genau solch ein Augenblick ist wie sein eigenes, und daß schon am nächsten Tage nach dem Eintritt der „Harmonie“ (wenn man an die Möglichkeit der Verwirklichung dieses Traumes überhaupt glaubt) die Menschheit sich genau so wie er in ein Nichts auflösen werde, kraft träger Naturgesetze, und noch dazu nach soviel Leid und Qual, die die Menschheit zur Verwirklichung dieses Traumes ausgestanden hat – dieser Gedanke bringt ihn um die letzte Versöhnungsmöglichkeit, denn sein Geist empört sich dagegen, empört sich gerade aus Liebe zur Menschheit. Er fühlt sich gekränkt für die ganze Menschheit, und dem Gesetz der Reflexion der Ideen zufolge – tötet das in ihm diese seine Liebe zur Menschheit. So geschieht es in Familien, die vor dem Hungertode stehn, daß die Eltern ihre Kinder, diese von ihnen am meisten geliebten Wesen, zu hassen anfangen, wenn die Qual dieser Kinder zu unerträglich wird – eben wegen der Unerträglichkeit ihrer Qualen. Ja ich behaupte sogar, daß die Erkenntnis ihrer vollkommenen Machtlosigkeit, ihrer Unfähigkeit, der leidenden Menschheit zu helfen, ihre Schmerzen, wenn auch nur ein wenig, zu lindern, während sie doch gleichzeitig von ihrem Leiden überzeugt sind, im Herzen der Menschen die Liebe zur Menschheit in Haß verwandeln kann. Die Herren der „gußeisernen Ideen“ werden das natürlich nicht glauben und natürlich auch gar nicht verstehen: für sie ist die Liebe zur Menschheit und deren Glück etwas so Wohlfeiles, da ist alles so billig und so bequem eingerichtet, so althergebracht, schon zu Urväterzeiten eingeführt und niedergeschrieben, daß es sich ihrer Meinung nach überhaupt nicht lohnt, darüber besonders nachzudenken. Doch ich hätte Lust, diese Herren noch ein wenig zu erheitern: daher behaupte ich denn (vorläufig wieder ohne zu begründen), daß die Liebe zur Menschheit sogar vollkommen undenkbar, unverständlich und unmöglich ist, ohne den Glauben an die Unsterblichkeit der Menschenseele. Diejenigen aber, die dem Menschen den Glauben an seine Unsterblichkeit nehmen und diesen Glauben durch die „Liebe zur Menschheit“ – im Sinne eines höheren Lebenszweckes – ersetzen wollen, die, sage ich, erheben ihre Hand gegen sich selbst; denn anstatt der Liebe zur Menschheit pflanzen sie in das Herz dessen, der den Glauben verloren hat, nur den Keim des Menschenhasses. Mögen die Weisen der gußeisernen Ideen über meine Behauptung meinetwegen die Achsel zucken! Dieser Gedanke ist weiser als ihre Weisheit, und ich glaube ohne zu zweifeln, daß er in der Menschheit einmal zu einer Aktion werden wird, obschon ich auch dieses ohne Begründungen ausspreche.
Ja ich behaupte sogar und wage auszusprechen: daß die Liebe zur Menschheit im allgemeinen und als Idee eine der für den Menschenverstand unfaßlichsten Ideen ist. Gerade als Idee! Nur das Gefühl kann sie rechtfertigen. Doch dieses Gefühl ist eben nur mit der gleichzeitigen Überzeugung von der Unsterblichkeit der Menschenseele möglich. (Auch dies ohne Begründungen.)
Das Ergebnis ist klar: daß der Selbstmord nach dem Verlust der Unsterblichkeitsidee zur unvermeidlichen, bedingungslosen Notwendigkeit für jeden Menschen wird, der in seiner Entwicklung auch nur ein wenig über dem Tier steht. Die Unsterblichkeit dagegen, die ein ewiges Leben verheißt, verbindet den Menschen um so mehr, um so fester mit der Erde. Hierin liegt scheinbar ein Widerspruch: wenn das Leben so lang ist, wenn es außer dem Leben hier auf Erden noch ein ewiges gibt, weshalb sollte einem dies Erdenleben dann noch so teuer sein? Das Ergebnis jedenfalls ist, daß der Mensch nur durch den Glauben an seine Unsterblichkeit seinen vernünftigen Zweck auf Erden erfaßt. Ohne Überzeugung von seiner Unsterblichkeit, lösen sich die den Menschen mit der Erde verbindenden Fäden, sie werden dünner und fangen an zu faulen, und der Verlust eines höheren Lebenssinnes (mag dieser auch nur in der Form einer ganz unbewußten Sehnsucht sich äußern) zieht zweifellos den Selbstmord nach sich. Hieraus folgt umgekehrt die Moral meines Aufsatzes: „Wenn die Überzeugung von der Unsterblichkeit für das Menschenleben so unentbehrlich ist, so ist sie folglich auch der normale Zustand der Menschheit ... Wenn dem aber so ist, dann muß diese Unsterblichkeit der Menschenseele zweifellos auch vorhanden sein.“
Mit einem Wort, die Unsterblichkeitsidee – das ist das Leben selbst, das lebendige Leben, seine endgültige Formel und der Hauptquell der Wahrheit und der richtigen Erkenntnis für die Menschheit. Das war und das ist der Sinn meines Aufsatzes, und ich nahm an, daß ein jeder, der ihn gelesen, sich über diesen seinen Sinn auch im klaren sein werde[35].
„Nur das ist stark, wofür Blut vergossen wird“ – bloß vergessen die Nichtswürdigen, daß es sich nicht bei denen als stark erweist, die das Blut vergießen, sondern bei denen, deren Blut vergossen wird. Und das, gerade das ist das Gesetz des Blutes auf Erden.
Als Staat konnte der Staat M. und N. nicht begnadigen (der Wille des Monarchen ausgenommen). Denn was ist eine Hinrichtung? – Im Staat: ein Opfer für eine Idee. Stünde aber an Stelle des Staates die Kirche – dann gäbe es keine Hinrichtungen. Kirche und Staat darf man nicht verwechseln. Daß man sie noch verwechselt, ist ein gutes Zeichen, denn daraus folgt, daß bei uns eine Neigung zur Kirche vorhanden ist. In England und Frankreich hätte man kein Bedenken getragen, sie zu erhängen.
Der ganze Fehler der „Frauenfrage“ besteht darin, daß man Unteilbares teilt, Mann und Weib einzeln betrachtet, während sie doch ein einziger geschlossener Organismus sind. („Und er schuf sie, Mann und Weib ...“) Ja sogar mit den Kindern, mit den Nachfahren und Vorfahren und mit der ganzen Menschheit ist der Mensch ein einziger unteilbarer Organismus. Die Gesetze aber teilen immer und lösen alles womöglich in die Urbestandteile auf. Die Kirche dagegen teilt nicht.
In der Natur ist alles für das Normale berechnet, alles nach dem Muster des Heiligen und Sündlosen zugeschnitten. (Der Mann 30 Jahre alt, die Frau 30 Jahre.) Die Schönheit ist dem Weibe zu Anfang gegeben, um den Mann zu fesseln, denn das sittliche Band ist noch schwach. Später ist die Schönheit nicht mehr nötig, man liebt das Weib, weil man seelisch zusammenwächst (organische Verbindung).
Unsere öffentliche Meinung ist deshalb nicht viel wert, weil sie bisher erst im Entstehen begriffen war, sich erst zu bilden begann. Bilden aber kann sie sich nur im langen Lauf der Geschichte, durch viele Generationen.
Unsere ganze liberale Partei steht abseits vom tätigen Leben, sie nimmt an der Tat nicht teil, sie ist mit ihr überhaupt nicht in Berührung gekommen. Sie hat nur verneint und gespöttelt.
Man versuche doch zu teilen, versuche doch einmal festzusetzen, wo die eigene Persönlichkeit aufhört und die andere anfängt! Das stelle man einmal durch die Wissenschaft fest! Die Wissenschaft macht sich eben daran. Und der Sozialismus stützt sich ja gerade auf die Wissenschaft. Im Christentum ist schon die Frage undenkbar. Welches sind die Chancen dieser und jener Lösung? – Es wird ein neuer unvorhergesehener Geist aufkommen.
Reichtum ist eine Stärkung des einzelnen, eine mechanische und geistige Befriedigung, folglich eine Loslösung des Einzelnen vom Ganzen.
Im Volk ist das Bedürfnis nach etwas Neuem, einem neuen Wort, einem neuen Gefühl vorhanden, das Bedürfnis nach einer neuen Ordnung. Die sorglose Zeit der Trunkenheit nach der Bauernbefreiung geht vorüber. Noch nie ist das Volk für gewisse Einflüsse so empfänglich gewesen (und schutzlos ihnen preisgegeben) wie gerade jetzt. Z. B. die Sekte der Stundisten[36]. Sogar die nihilistische Propaganda wird ihren Weg finden. Hat es bisher nur wegen der Dummheit, Unerfahrenheit und Naivität der Propaganda noch nicht getan. Man muß auf der Hut sein. Man muß das Volk beschützen. Unsere Kirche aber verharrt seit Peter dem Großen in einem Zustande der Lähmung. Es ist eine furchtbare Zeit, und dazu nun noch diese Trunksucht. Und die Stundisten. Währenddessen ist unser Volk fast ganz sich selbst überlassen, nur auf die eigenen Kräfte angewiesen. Unsere Intelligenz – alles geht vorüber.
Deutsche, Polen, Juden – lauter Korporationen, und helfen sich gegenseitig. Nur in Rußland gibt es keine Korporationen, nur Rußland allein ist geteilt. Und außer diesen Korporationen noch die mächtigste: die alte administrative Routine. Man sagt: unsere Gesellschaft sei nicht konservativ. Allerdings; die historische Entwicklung der Dinge (seit Peter) hat sie ja selber dazu gemacht. Und vor allem: sie sieht nicht, was es zu konservieren, zu erhalten gäbe. Alles ist ihr genommen, sogar die gesetzliche Initiative. Alle Rechte des russischen Menschen sind negativ. Gebt ihm etwas Positives und ihr werdet sehen, daß er gleichfalls konservativ sein wird. Dann hätte er doch etwas, was zu erhalten wäre. Nicht konservativ ist er bloß deshalb, weil es bei uns nichts zu erhalten gibt. „Je schlimmer, desto besser“ – das ist doch bei uns nicht etwa eine leere Redensart, sondern zum Unglück – die Sache selbst.
„Nowoje Wremja“, Nr. 1667, 28. Oktober 1880. Baron Hübner prophezeit die nächsten sozialistischen Bewegungen in Frankreich und in Europa. Rußland wird zum Bündnis aufgefordert. (Rußland soll nicht darauf eingehen! Es soll seine eigenen Vorteile wahrnehmen! Der Sozialismus wird an Rußland zerschellen.) In Frankreich werden sich den Sozialisten unfehlbar die Jesuiten anschließen und überhaupt alle Katholiken, die dank Gambettas Dummheit aus Paris ausgewiesen sind, alle Legitimisten und Bonapartisten werden sich dem Sozialismus zuwenden. Freilich ist das konservative Frankreich noch stark, trotz der Dummheit der Regierenden und der Dummheit der Republik. Aber das ist der Anfang vom Ende. Das Ende der Welt naht. Das Ende des Jahrhunderts wird sich in einer Erschütterung kundtun, wie noch nie zuvor. Rußland muß bereit sein, soll sich nicht bewegen, soll aufpassen und warten. Wenn es sich nur nicht zu einem Bündnis verleiten läßt! Das wäre furchtbar! Dann ist es aus mit Rußland, endgültig aus. Bei uns gibt es keinen Sozialismus, absolut keinen. Der ganze gesunde Teil des russischen Volkes aber wird sich nicht rühren, und der ist unzählbar groß.
Und wenn auch alle Juden in corpore, wenn das ganze Kahal wie eine Verschwörung über Rußland steht und den russischen Bauern aussaugt – oh, wir haben nichts dawider, wir sagen kein Wort, kein Wort! Sonst könnten wir ja am Ende gar den Vorwurf der „Unliberalität“ einheimsen: man würde schließlich von uns denken, wir hielten unsere Religion für besser als die jüdische und bedrängten die Juden aus „religiöser Unduldsamkeit“ – um Himmels willen, was dann! Man denke nur und frage sich – was dann!
Wer sind bei uns die besseren Menschen? Der Adel ist zerstört. In Frankreich ward er gleichfalls zerstört. Die Ehrenlegion wurde aufgepfropft, aber sie hat ihre Aufgabe nicht gelöst. (In Europa werden die besseren Menschen von der Obrigkeit bestimmt.) Bei uns führte Peter der Große, um die Aristokratie der Bojaren zu unterdrücken, vierzehn Rangklassen ein. Eine Analogie mit der Ehrenlegion. Sie wurden aufgepfropft, aber sie haben nicht einmal angefangen, die Aufgabe zu lösen, sind vor allem vom Volksgeist nicht anerkannt, und selbst bei den Beamten gehen sie dem Bankrott entgegen. (Beamte für Sold, die Affäristen, Advokaten, Banken werden die Aristokratie überwältigen.) Indessen geht es doch nicht ohne bessere Menschen. Peter handelte im europäischen Geiste, als er die vierzehn Klassen schuf, denn die „Besseren“ wurden nun gleichfalls von der Obrigkeit geschaffen und gingen nicht aus dem Volksgeist hervor. Die Besseren müssen aber vom Volk bezeichnet werden und werden es auch. Diese neue Einteilung wird sich bei uns eher als sonstwo verwirklichen. Noch ist das Volk stumm, das ist wahr, doch nennt es schon außer Alexei, dem Gottesknecht, z. B. Suworoff, Kutusoff. Aber es hat ja noch keine Stimme. Die Stimme der Intelligenz ist zu unklar und dem Volk zu unverständlich, übrigens auch gar nicht vernehmbar. Gott weiß, wen die Intelligenz für die Besseren erklärt. Die Pariser Kommune und der westliche Sozialismus wollen keine Besseren, sie wollen Gleichheit und würden Shakespeare enthaupten. Unserem Volk ist Neid vollkommen fremd. Vollbringt für das Volk eine gute Tat und es wird euch als seine Helden verehren. (Nur müßt ihr das Volk lieben, nicht indem ihr es zu euch emporzuheben trachtet, sondern indem ihr euch selber vor ihm beugt ...)
Die Höhe einer Menschenseele ist zum Teil danach zu ermessen, wie weit und vor wem sie fähig ist, Ehrfurcht und Verehrung zu bezeugen (oder Andacht zu empfinden).
Alle die Bismarck, Beaconsfield, die Französische Republik und Gambetta usw. – alle die sind, als Macht, für mich eine Vorspiegelung. Und je länger, desto mehr. Ihr Herr, wie der Herr aller, der Herr ganz Europas ist doch nur der Jude und seine Bank. Wir werden es ja erleben, daß er plötzlich sein Veto einlegt und Bismarck wie ein Stäubchen von seinem Platze gefegt wird. Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles: sowohl Europa wie die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus – besonders den Sozialismus, denn durch ihn wird er das Christentum mit der Wurzel ausrotten und die christliche Kultur zerstören. Und wenn dann nichts als Anarchie übrigbleibt, da wird dann der Jude an der Spitze des Ganzen stehen. Denn indem er den Sozialismus predigt, bleibt er als Jude mit seinen Stammgenossen doch außerhalb, und wenn der ganze Reichtum Europas vertan ist, bleibt die Bank des Juden. Dann mag der Antichrist kommen und die Anarchie herrschen.
Das Ideal menschlicher Schönheit – ist das russische Volk. Ich muß unbedingt auf diese Schönheit aufmerksam machen, den aristokratischen Typus zeigen usw. Unwillkürlich fühlst du, daß er menschlich nicht unter dir steht; und bald werdet ihr fühlen, daß er höher steht als ihr.
Ein Mensch, der in seinem ganzen Leben nicht lebt, sondern sich selbst ausdenkt.
Unsere Intellektuellen werden vom Volk doch nichts Vernünftiges zu sagen verstehen. Sie werden das Volk nur in Erstaunen setzen und es zu guter Letzt, und zwar sehr bald, um seine Geduld bringen – und damit wird die Sache enden.
„Väter und Söhne“ – die Eigenen erkennen die Eigenen nicht.
Die Behörden und alle diese Beamten, die sind doch in ihrem Verhalten zum Volk ungefähr: „A quelle sauce voulez vous qu’on vous mange, mais nous ne voulons pas“, usw. Dumpfe Verzweiflung.
Das Volk – dort ist alles. Das ist doch ein Meer, das wir bloß nicht sehen, da wir uns vom Volk im finnischen Sumpf abgesondert haben.
„Ich liebe dich, Schöpfung Peters ...“
Pardon, nein, ich liebe sie nicht.
Fenster, Löcher – und Monumente.
Niemand traut uns, alle hassen uns, – warum? Weil Europa instinktiv etwas Neues, ihm nicht im geringsten Ähnliches in uns spürt. In diesem Punkt stimmt Europa ganz mit unseren Westlern überein: die hassen Rußland gleichfalls, weil sie in ihm etwas Neues, noch nie Dagewesenes wittern.
Der Osten, Asien, Eisenbahnen! Wir aber leben für Europa. Sparen sollten wir, 4 statt 40 ausgeben – Peter der Große hätte es getan – und nicht vergessen: Rußland liegt zwar in Europa, aber in der Hauptsache doch in Asien. Nach Asien! nach Asien!
Das russische Volk lebt ganz in der Rechtgläubigkeit und in ihrer Idee. Außer der Rechtgläubigkeit ist in ihm nichts und hat es nichts – und braucht es auch nichts, denn die Rechtgläubigkeit ist alles; sie ist – Kirche, und Kirche ist die Krönung des Gebäudes, und zwar auf ewig. Sie denken, ich werde das jetzt zu erklären anfangen? – keineswegs! Alles später und unermüdlich. Vorläufig aber stelle ich nur die Formel auf und füge noch eine andere hinzu: Wer die Rechtgläubigkeit nicht versteht – der wird auch nie und nimmer das russische Volk verstehen. Ja nicht nur das: der kann das russische Volk nicht einmal lieben, sondern wird höchstens ein imaginäres Volk lieben, wie er das russische Volk in Wirklichkeit zu sehen wünschte. Und andererseits wird auch das Volk einen solchen Menschen nicht als zu ihm gehörig anerkennen: liebst du nicht das, was ich liebe, glaubst du nicht daran, woran ich glaube und achtest du nicht mein Heiligtum, so bist du nicht mein Bruder. Oh, das Volk wird ihm deshalb nicht zu nahe treten, wird ihn weder überfallen, noch berauben, noch verprügeln, es wird ihm nicht einmal ein böses Wort sagen. Es ist zu großzügig dazu, es kann viel aushalten und ist in Glaubenssachen duldsam. Das Volk wird den, der es anders sehen wollte, ruhig anhören – wenn er gescheit ist und zu reden versteht –, wird ihm für Ratschläge sogar danken, für die Wissenschaft, die man ihm bringt, wird sogar manchen Rat befolgen, denn das russische Volk ist großzügig und versteht die Dinge auseinanderzuhalten. Aber als seinesgleichen wird es ihn doch nicht ansehen, seine Hand wird es ihm nicht geben und sein Herz ebensowenig. Unsere Intelligenz aber im finnischen Sumpf sieht an ihm vorbei, und ärgert sich, wenn man ihr sagt, daß sie das Volk nicht kenne.
Grund genug zum Verzweifeln. Wozu soll er sich ausnutzen lassen, auch er wird zum Exploiteur. Höchstens ein Heiliger bleibt standhaft.
Sie werden doch nur die Interessen Ihrer Gesellschaft vertreten, nicht aber die des Volkes. Das Volk werden Sie wieder zu Leibeigenen machen wollen. Kanonen werden Sie gegen das Volk verlangen! Und die Presse – die Presse werden Sie nach Sibirien verbannen, sobald sie nur im geringsten Ihr Mißfallen erregt. Nicht nur gegen Sie etwas zu sagen wird verboten sein – nicht einmal atmen wird man in Ihrer Gegenwart dürfen.
Der Hauptgrund, weshalb unsere Gutsbesitzer sich mit dem Volk nicht verstehen und keine Arbeiter finden können, ist der, daß sie selber nicht Russen, sondern vom Boden losgelöste Europäer sind.
... Wenn man ihn allmählich einführt, nicht plötzlich in unverhältnismäßiger Weise die Bildung erweitert, sondern vorläufig nur den Boden vorbereitet – dann bekämen wir nach und nach ein Kontingent junger Leute mit klassischer Bildung. Und diese würden den Grundstock, den Anfang des weiteren bilden. Ferner könnte man etwa alle fünf Jahre, oder alle vier Jahre einmal die Unterrichtsstunden der klassischen Sprachen vermehren ... Das dauerte länger, aber es wäre richtiger. Bei uns aber hat man eine Vorliebe fürs Plötzliche (sic) – zwanzigtausend Werst Eisenbahn wurden bei uns in zehn Jahren gebaut, obschon das alles freie Kapital von der Landwirtschaft und der Industrie fortzog. So berief man die tschechischen Lehrer der alten Sprachen, – diese kalten, teilnahmslosen, der Jugend feindlich Gesinnten, die die russische Sprache nicht verstehen und als minderwertig erachten. Sie wurden gehaßt, verachtet, verspottet. Mitunter war sogar das Nationalgefühl im Schüler verletzt – bei uns aber ist davon ohnehin schon erschreckend wenig übriggeblieben ...
Wie man bei uns glaubt, alles Unglück Rußlands würde durch eine Konstitution beseitigt werden, so ist man in Europa übereingekommen – bewußt und unbewußt –, daß man zunächst mit Rußland ein Ende machen müsse, denn Rußland halte die Völker Europas von der inneren Arbeit ab, zwinge sie, ihre großen Heere zu erhalten und den Sultan zu beschützen, so daß sie ihn nicht aus Europa hinausjagen und seinen Besitz unter sich teilen können! An allem, heißt es, ist Rußland schuld ...
Wir können uns ihrem Haß nicht entziehen und einmal werden sie sich auf uns stürzen und uns zerreißen.
Nein, wir wissen noch nicht einmal, wie sie uns hassen. Nein, es ist nicht nur das, daß es nicht ihre Zivilisation ist und wir nicht Europäer sind. Nein, sie wittern die Idee, die zukünftige, selbständige, russische, obschon sie bei uns noch nicht geboren, nur die Erde unheimlich schwanger von ihr ist und sich schon anschickt, sie unter furchtbaren Qualen zu gebären. Wir glauben es bloß nicht und lachen. Nun, die Europäer aber ahnen sie schon. Sie ahnen mehr als wir selbst, d. h. als die russische Intelligenz. Was soll uns die Idee, wir bringen sie selber um. Wir leben für Europa, heißt es doch, alle nur zum Zeitvertreib für Europa, alle und alles – und für unsere Unschuld.
Dann wird man’s glauben.
Der Staat ist eine vorwiegend christliche Gesellschaft und hat die Tendenz, Kirche zu werden. In Europa ist es umgekehrt (einer der tiefen Unterschiede zwischen uns und Europa). Siehe die Rede Virchows („Nowoje Wremja“, Nr. 1745, 6. Januar 1881). Virchow erklärt, der Staat sei vorwiegend eine von Religion und Christentum freie Gesellschaft. So ist es in Frankreich (Gambetta). Unsere kleinen Dummköpfe haben die Formel des Westens sogleich aufgegriffen und in ihren Katechismus eingetragen. Bei uns aber, im russischen Volk, – uns ist sie bis ins Herz hinein fremd. Virchow fürchtet ganz einfach, die Christen könnten die Nichtchristen sogleich zu vernichten suchen. Im Gegenteil: der Geist des wahren Christentums ist – vollständige Glaubensfreiheit. Glaube freiwillig – das ist unsere Formel. Der Heiland ist vom Kreuz nicht herabgestiegen, weil er nicht gewaltsam durch ein äußeres Wunder bekehren, sondern gerade die Glaubensfreiheit wollte. Das ist der Geist des Christentums und auch unseres Volkes! Wenn es aber Abweichungen gibt, so bedauern wir es.
Ich suche keine Ehren und werde nichts annehmen, und wahrlich ist es nicht meine Absicht, für meine Richtung mir Sterne zu erraffen.
Ich bin wie Puschkin ein Diener des Zaren, weil seine Kinder, sein Volk, des Zaren Diener nicht verachten werden. Ich werde noch mehr sein Diener sein, wenn er wirklich glauben lernt, daß das Volk sich als seine Kinder fühlt. Ich weiß nicht, weshalb er es noch immer nicht recht glauben zu wollen scheint.
Zwei Kategorien von Volksschulen, in der ersten nur lesen; so gut es geht, auch schreiben (erlernen sie es – können sie Schreiber werden, sehr wenige werden es ganz verlernen) und die drei Gebete. Und dann die zweite Kategorie – gleichfalls für die Bauern – mit etwas höherem Lehrplan. Von dieser zweiten Kategorie vorläufig nur sehr wenige Schulen, denn wenn wir wenigstens die von der ersten ins Leben riefen, so wäre schon eine Kraft erzeugt. Wer lesen und schreiben kann – der vermag sich schon zu bewegen, der kann schon vorwärtskommen, der ist schon ausgerüstet und bewaffnet. Und Sie werden sehen, wie dann nach wenigen Jahren ganz von selbst die höheren Volksschulen entstehen werden: zunächst gilt es, die Lust zum Lernen hervorzurufen, dann wird das Verlangen nach weiterem Lernen und das Entstehen höherer Schulen nicht auf sich warten lassen. Bei uns aber soll alles plötzlich entstehen.
Der deutsche Junge (Pflicht), der russische Junge (zerfallene Familie).
Geschichte würde bei uns geistige Ideen wachrufen. Die geistigen Ideen des deutschen Jungen sind andere: seine Ordnung, seine Lebensweise, seine Nationalität. Bei uns aber, in unseren Familien ist nichts als Fäulnis. Hier könnte der Geschichtsunterricht rettend eingreifen und den Sinn des Jünglings wenigstens auf die historische Welt richten und somit von den abstrakten Phantastereien und dem ideellen Mischmasch, der die geistige Welt unserer Gesellschaft ausmacht, ablenken. Mit einem Wort, man hat nicht in nationalem Sinn gehandelt (der russische Junge ist entwicklungsfähiger als der Deutsche). Nur die Lehrer der Literatur könnte man kontrollieren, damit sie nicht liberale Absurditäten predigen.
Zwei Bälle werden über dem Kinderbett angebracht, ein roter und ein blauer, und zwar zur Beschleunigung der Entwicklung, um Gedanken zu erwecken. Als wolle man die Natur beseitigen! Der Eindruck der Harmonie des Ganzen in der Natur wird dadurch aufgehoben. Die werden ihr Lebtag im Ganzen Details, grelle Punkte, Ecken, Einzelheiten suchen.
Der unkultivierte russische Vater hat entweder seine Beamtenwelt und sein Kartenspiel, oder wenn er sich mit irgend etwas befaßt – geht er in Abstraktheit auf, in Weltfragen, in Sehnsucht nach der äußeren Form einer Konstitution oder im Materialismus. Bei der geringsten praktischen Betätigung quält er sich mit ewiger Unentschiedenheit über das, was Ehre und Gewissen ist (was seinem Sohn doch nicht entgehen kann) und das Auffallendste an ihm ist sein vollständiges Nichtverstehen alles dessen, was vor seiner Nase ist, der Widerwille gegen alles, was vor ihm liegt. Und dasselbe findet sich beim Sohn. Schade, daß ich mich kurz fassen muß und nicht das ganze Thema entwickeln kann. Aber der Geschichtsunterricht, die allgemeine Geschichte würde wenigstens Achtung vor den historischen Formen des Menschenlebens einflößen, würde wenigstens in den Erscheinungen einen Sinn zu sehen lehren. „Ideen sind nicht nötig,“ heißt es. – Dann werden sie eben selber Ideen erfinden.
Von den Vorzügen der Naturwissenschaften haben doch nur diejenigen so viel geredet, die nichts von ihnen verstehen. Wie viele von unseren Redakteuren und Zeitungsverlegern wissen denn etwas von ihnen? Um die Wahrheit zu sagen, unsere Gelehrten sind (und mancher ist sogar in Europa als Fachmann bekannt) – sind größtenteils vortreffliche Spezialisten, sagen wir meinetwegen sogar große Spezialisten, nur sind sie nichtsdestoweniger größtenteils ungebildete Leute, die über das klassische Unterrichtssystem natürlich kein Urteil haben können. Und über diesen stehen dann die Ausführenden, die von ihnen sich Rat holen, an und für sich zumeist die unschuldigsten Leute (mit einem Schimmer von Europäertum), die sich in ihrer Unschuld für glänzende Europäer halten, aus Unschuld, wie gesagt, und die auch aus purer Unschuld meist so gut wie überhaupt nichts von Rußland wissen – nun, und was kommt dabei heraus? Nichts, ganz wie bisher noch nichts herausgekommen ist ... Eine Kultur fehlt.
Die ganze Literatur zittert vor Ihnen, besonders vor dem „Satirischen Alten“. Niemand wagt es, gegen ihn aufzutreten. Er ist doch ein Liberaler, ist durch und durch liberal! – Nein, meine Herren, seien Sie erst einmal liberal, wenn das unvorteilhaft ist, dann würde ich Sie gern sehen wollen!
Mit abgedroschenen alten Gedanken schlagen Sie sich durch.
Die Presse sichert jedem Schurken das Wort, wenn er auf dem Papier zu schimpfen versteht, jedem, den man in anständiger Gesellschaft unter keinen Umständen reden ließe. In der Presse finden alle diese Menschen ihr Asyl, – komm, schimpf soviel du willst, – – sogar mit Ehrerbietung wird er aufgenommen.
Die Schurken foppen mich mit meinem angeblich ungebildeten und rückständigen Glauben an Gott. Diese Tölpel haben sich eine solche Gottesleugnung noch nicht einmal träumen lassen, wie sie in meinem „Großinquisitor“ und dem vorhergehenden Kapitel ausgedrückt ist und auf die das ganze Buch die Antwort gibt. Wenn ich an Gott glaube, so tue ich es doch nicht wie ein Dummkopf (wie ein Fanatiker). Diese da wollen mich belehren und lachen über meine Beschränktheit! Ihre dumme Kreatur hat sich ja nicht einmal träumen lassen von einer solchen Gewalt der Verneinung, wie ich sie durchgemacht habe. Und die wollen mich unterrichten!
(Eine psychologische und ausführliche kritische Erklärung Iwan Karamasoffs und der Erscheinung des Teufels.) Iwan ist tief, ist nicht einer der zeitgenössischen Atheisten, die mit ihrem Unglauben nur die Beschränktheit ihrer Weltanschauung und die Stumpfheit ihres kleinen Gehirns beweisen.
Ein ungewöhnlicher Eifer in der Aufnahme neuer Ideen, mit dem größten Verlangen, jedesmal bei der Aufnahme von etwas Neuem, alles Alte zu zertrampeln, mit Haß und Schimpf und Spott zu vernichten. Eine Art Rachegelüst ... „und ich verbrannte alles, was ich einst anbetete“.
Wenn physische Verrichtungen auf der Straße verboten sind, ebenso nackt einherspazierende Menschen, warum dann nicht auch dieses verbieten? – Ist es doch dieselbe physische Verrichtung, schädlich und gemein! Die Staatsanwaltschaft müßte sie ohne weiteres wegen Unmäßigkeit zur Rechenschaft ziehen.
Leontjeff[37]. („Es lohnt nicht, der Welt Gutes zu wünschen, denn es steht geschrieben, daß sie vergehen werde“.)
In dieser Auffassung liegt etwas Unvernünftiges und Ruchloses.
Überdies ist es eine ungemein bequeme Anschauung, so für den Hausgebrauch: denn wenn es schon geschrieben steht, daß alle verurteilt sind, wozu soll man sich dann noch anstrengen, wozu anderen Gutes tun? Lebe für dich! Lebe hinfort ein jeder ruhig für seinen Wanst.
Hier sprach außer der Meinungsverschiedenheit mit mir noch eine Art Neid mit. Ja vielleicht war es überhaupt nur Neid, der da sprach. Natürlich kann man von Herrn Leontjeff nicht verlangen, daß er das schriftlich eingesteht. Aber möge dieser Publizist seinem Gewissen die Frage vorlegen und sich selbst die Wahrheit gestehen; auch das würde genügen. (Für einen anständigen Menschen genügt auch das.)
Es gibt gewisse Dinge, lebendige Dinge, die zu begreifen vor übermäßiger Gelehrtheit sehr schwer ist. Die Gelehrtheit, die ja auch selbst im Übermaß immer noch eine schöne Sache ist, kann sich aber bei der Berührung mit manchen lebendigen Dingen sogar in eine äußerst schädliche Sache verwandeln. Es sind eben nicht alle lebendigen Dinge leicht zu begreifen. Das ist ein Axiom. Übermäßige Gelehrtheit hat bisweilen etwas Ertötendes in sich. Gelehrtheit ist ein Material, dem manche nicht gewachsen sind.
Auch ist die übermäßige Gelehrtheit nicht immer die wahre oder richtige Gelehrtheit. Die wahre Gelehrtheit ist nicht nur nicht feindlich dem Leben gegenüber, sondern stimmt schließlich mit dem Leben immer überein, dem sie neue Offenbarungen gibt, die sie im Leben selbst entdeckt. Das ist das wesentliche und großartige Kennzeichen der wahren Gelehrtheit. Die unwahre Gelehrtheit dagegen ist, und mag sie auch noch so groß sein, dem Leben doch immer irgendwie feindlich und geht womöglich bis zur Verneinung des Lebens. – Bei uns ist von Gelehrten der ersten Kategorie seltsamerweise wenig zu hören, dafür aber genug von solchen der zweiten Art, ja wie es scheint sogar nur von dieser. Es kann selbst die übermäßigste Gelehrtheit keine Gewähr dafür bieten, daß der Gelehrte nicht doch nur zur zweiten Kategorie gehört. Doch brauchen wir die Zuversicht nicht aufzugeben, daß es bei uns auch solche von der ersten geben wird. Irgend einmal werden wir sie doch haben. Wozu denn jede Hoffnung verlieren?
Wie viele Menschen denken nicht selbst, sondern leben mit Gedanken, die andere bereits fertiggedacht haben! Bei uns aber lebt man nicht nur mit fertigen Gedanken, sondern lebt sogar mit fertigem Leid (und dabei ohne Kultur).
Der Nihilismus ist bei uns aufgetreten, weil wir alle Nihilisten sind. Uns hat nur die neue, originelle Form seiner Erscheinung erschreckt. (Alle sind ohne Ausnahme Fjodor Pawlowitsch Karamasoff.)
Komisch war die Bestürzung und die Sorge unserer Klugen, die zu erforschen suchten, woher die Nihilisten kämen. Sie sind eben nirgendwoher gekommen, sondern sind die ganze Zeit mit uns, in uns und bei uns gewesen. (Die Dämonen.) „Aber nein, wie denn das, wir sind nicht Nihilisten,“ behaupteten die Klugen, „wir wollen nur durch die Verneinung Rußlands Rußland retten (d. h. indem wir in der Art einer besonderen Sphäre, etwa als Aristokraten, über dem Volke stehen, das wir zu unserer Nichtigkeit emporheben wollen).“ Der Nihilismus ließe sich mit unserer Kirchenspaltung vergleichen. Ja aber die Kirchenspaltung war für uns von großem Nutzen.
Nicht aus Ekel vor der Welt haben sich die Heiligen in die Einsamkeit zurückgezogen, sondern zu ihrer sittlichen Vervollkommnung. Unsere früheren Mönche lebten sogar fast auf dem Marktplatz. Z. B. der Mönch Parfeni. Allein schon das Verlangen nach geistiger Erleuchtung ist – geistige Erleuchtung.
Gewissen ohne Gott ist etwas Entsetzliches, es kann sich bis zur größten Unsittlichkeit verirren.
Es ist unzureichend, Sittlichkeit als Überzeugungstreue zu definieren. Man muß sich auch noch fortwährend fragen: sind meine Überzeugungen richtig? Ihr Prüfstein aber ist – Christus. Doch hier kommt nicht mehr Philosophie in Frage, sondern Glaube. Glaube jedoch ist wie eine Farbe.
Tatmenschen seien nur Leute von fragwürdiger Sittlichkeit. – Wie man wohl auf diesen Gedanken gekommen sein mag?
Einen Menschen, der Ketzer verbrennt, kann ich nicht für sittlich erklären, denn ich erkenne eure These nicht an, nach welcher Sittlichkeit Übereinstimmung mit den inneren Überzeugungen sei. Das ist nur Ehrlichkeit, nicht aber Sittlichkeit. Für mich ist das Beispiel und Ideal der Sittlichkeit Christus. Ich frage: hätte er Ketzer verbrannt? – nein. Also ist es eine unsittliche Handlung.
Der Großinquisitor ist allein schon deshalb unsittlich, weil sich in seinem Herzen und Gewissen die Idee festsetzen konnte, Menschen zu verbrennen sei notwendig.
Gut – das Nützliche. Schlecht – das Nichtnützliche. Nein, gut ist das, was wir lieben. Alle Ideen Christi sind vom Menschenverstande verdorben worden und scheinen unerfüllbar zu sein. Die linke Backe ... mehr als sich selbst lieben ... Aber ich bitte, wozu das, wozu? Ich bin hier für einen Augenblick, Unsterblichkeit gibt es nicht, da lebe ich lieber wie ich will. Das sei keine Berechnung (sagt ein englischer Priester). Erlauben Sie mir, selber zu wissen, was für mich eine Berechnung oder keine Berechnung ist.
Der Staat wurde für die Mittelmäßigen geschaffen. – Wann hat denn der Staat bei seinem Entstehen gesagt: ich erschaffe mich für die Mittelmäßigen? Sie sagen, so habe es die Geschichte gemacht. Nein, immer haben Auserwählte geführt! Aber nach diesen, das ist allerdings wahr, hat sogleich die Mittelmäßigkeit auf den Ideen der höheren Menschen ihren kleinen mittelmäßigen Kodex aufgebaut. Bis dann wieder ein großer oder ursprünglicher Mensch kam und den Kodex zerstörte. Sie halten, scheint es, den Staat für etwas Absolutes? Glauben Sie mir, wir haben nicht nur keinen absoluten, sondern noch nicht einmal einen mehr oder weniger vollendeten Staat gesehen. Alles Embryonen.
Die Gesellschaften seien entstanden aus dem Bedürfnis, sich einzurichten? – Das ist nicht wahr, sondern immer infolge einer großen Idee.
Die andere Backe hinhalten, den Nächsten mehr lieben, als sich selbst – nicht deshalb, weil es vorteilhaft ist, sondern weil es einem gefällt, bis zum brennenden Gefühl, bis zur Leidenschaft. Christus habe sich geirrt – das sei erwiesen! Doch dieses brennende Gefühl sagt: lieber bleibe ich bei meinem Irrtum mit Christus als mit euch.
Sie sagen: Europa habe doch viel Christliches auch ohne den Papst und den Protestantismus getan. Oh, selbstverständlich, das Christentum ist dort doch nicht in einem Augenblick gestorben, es brauchte doch zum Sterben eine lange Zeit, es hinterließ doch Spuren. Es gibt dort auch jetzt noch Christen, aber auch schrecklich viel falsche Auffassung vom Christentum.
Ihre Handlung ist sittlich, aber nicht ihre Idee.
Sittlich ist nur das, was mit unserem Schönheitsgefühl übereinstimmt und mit dem Ideal, in welchem dasselbe sich verkörpert.
Sein Verhalten mag ehrlich sein, aber seine Handlung ist nicht sittlich. Denn, wenn die Handlung eines Menschen bloß mit seinen Überzeugungen übereinstimmt, so braucht sie deshalb noch nicht sittlich zu sein. Es ist bisweilen sittlicher, nicht nach seiner Überzeugung zu handeln, wie es mancher tut, der dabei seiner Überzeugung durchaus treu bleibt, doch infolge eines Gefühls die Handlung nicht ausführt. Mit seinem Verstande schilt und verachtet er sich deshalb, aber sein Gefühl, d. h. sein Gewissen läßt ihn doch nicht die Tat ausführen (und schließlich weiß er auch, daß er sie nicht aus Feigheit unterläßt). Er unterläßt die Befolgung seiner Überzeugung nur deshalb, weil er dies als sittlicher erkannt hat, denn eine Befolgung wäre.
Es gibt bei uns allerdings Kulturmenschen, aber sie entstanden, indem sie das Ganze verneinten und nur der kleinste Teil kehrte zum Volk zurück. Die übrigen sind alle negativ kultiviert. (Übrigens: weshalb mußte Peter das Volk zu Leibeigenen machen, um einen gebildeten Stand zu erhalten?!) Die Befreiung der Bauern geschah ganz abstrakt, ohne Verständnis für den russischen Bauern und sogar: indem man ihn verneinte; man bemitleidete ihn als Sklaven, aber man sprach ihm seine Persönlichkeit, seine Selbständigkeit, seinen ganzen Geist dabei ab.
Bei vollständigem Realismus im Menschen den Menschen finden. Das ist ein durchaus russischer Zug, und in diesem Sinne bin ich natürlich volklich (denn meine Richtung entspringt der Tiefe des christlichen Volksgeistes), obschon ich dem Gegenwärtigen russischen Volk unbekannt bin – doch das Zukünftige wird mich kennen.
Man nennt mich einen Psychologen. Das ist nicht richtig. Ich bin nur ein Realist im höheren Sinne, d. h. ich zeige alle Tiefen der Menschenseele.
... Ich frage: weshalb ist es unsittlich, Blut zu vergießen? Wenn ich das Gegenteil behaupte, werden Sie meine Behauptung natürlich auf keine Weise widerlegen können.
Wenn wir nicht im Glauben und in Christus eine Autorität hätten, würden wir uns in allem verirren.
Es gibt sittliche Ideen. Sie erwachsen aus dem religiösen Gefühl, aber mit der Logik allein sind sie niemals zu rechtfertigen.
Es wäre nicht mehr möglich, zu leben.
Ein Beispiel: Der Jesuit lügt und ist überzeugt, daß lügen um eines guten Zweckes willen nützlich und gut sei. Sie loben es, daß er seiner Überzeugung gemäß handelt, d. h. er lügt und das ist schlecht, da er aber aus Überzeugung lügt, so ist das gut. Also einerseits ist lügen gut, andererseits schlecht. Wunderbar!
Auf dem Boden, auf dem Sie stehen, werden Sie immer geschlagen werden. Das werden Sie nur dann nicht, wenn Sie anerkennen, daß es sittliche Ideen gibt (aus dem Gefühl, von Christus), beweisen aber, daß sie sittlich sind, ist unmöglich (Berührung mit anderen Welten).
... Natürlich ist das nicht wissenschaftlich, obschon – warum schließlich nicht? Die gewaltige Tatsache der Erscheinung Christi auf Erden und alles dessen, was darauf folgte, verlangt meiner Ansicht nach auch wissenschaftliche Ausarbeitung. Die Wissenschaft kann es doch nicht für unter ihrer Würde halten, die Bedeutung der Religion in der Menschheit zu untersuchen, und wäre es auch nur im Hinblick auf die historische Tatsache, die durch ihre Ununterbrochenheit und Beharrlichkeit frappiert. Die Überzeugung aber der Menschheit von der Berührung mit anderen Welten – diese unausrottbare Überzeugung ist doch gleichfalls sehr bedeutsam. So etwas läßt sich doch nicht mit einem Federstrich lösen.
Der Großinquisitor und das Kapitel von den Kindern. Angesichts dieser beiden Kapitel hätten Sie über mich, vielleicht wissenschaftlich, aber nicht in philosophischer Hinsicht so geringschätzig zu urteilen brauchen, obschon Philosophie nicht meine Spezialität ist. Auch in Europa gibt es keinen atheistischen Ausdruck von solcher Gewalt und hat es nie gegeben. Folglich glaube ich an Christus und bekenne ich mich zu diesem Glauben nicht wie ein Kind, sondern mein Hosianna ist durch das große Fegefeuer der Zweifel hindurchgegangen, wie in meinem letzten Roman der Teufel von sich sagt.
[1] Fjodor Michailowitsch hätte sich natürlich gern auch als offiziellen Redakteur der Zeitschrift gesehen, doch stand er damals noch unter polizeilicher Aufsicht, weshalb er erst 1873 als Redakteur des „Bürger“ bestätigt werden konnte. Da aber die beiden Brüder in größtem Einvernehmen lebten, so ergab sich daraus die beste Arbeitsteilung: M. M. übernahm alles Geschäftliche, während F. M. sich nur mit der geistigen Leitung der Zeitschrift befaßte. N. N. Strachoff.
[2] Russischer Publizist von Ruf, geboren 1845. E. K. R.
[3] Alexander Herzen, Sohn eines russischen Aristokraten und einer Württembergerin (geb. 1812 in Moskau, gest. 1870 in Paris). Er war Schriftsteller und Politiker, wurde schon als Student verbannt, gab in London von 1856–65 die Zeitschrift „Die Glocke“ heraus. Seinem ungeheueren Einfluß auf die Intelligenz jener Zeit, sowie seinem offenen Brief an Kaiser Alexander II. wird der Anstoß zur Verwirklichung der Bauernbefreiung zugeschrieben. E. K. R.
[4] Professor der Geschichte. Näheres Bd. XI, S. 311. E. K. R.
[5] Der Held der „Aufzeichnungen eines Irrsinnigen“ von Gogol. E. K. R.
[6] Publizist, Politiker, Panslawist. E. K. R.
[7] Führer der slawophilen Partei in Moskau. E. K. R.
[8] Russischer Philosoph. E. K. R.
[9] Herausgeber der Werke Puschkins. E. K. R.
[10] Der Held in Puschkins Poem „Die Zigeuner“. E. K. R.
[11] Petschorin, die Hauptperson in Lermontoffs Roman „Der Held unserer Zeit“; Tschitschikoff, die Hauptperson in Gogols Roman „Die toten Seelen“; Rudin und Lawretzkij, ersterer im Roman gleichen Namens und letzterer im Roman „Eine adlige Familie“ von Turgenjeff. E. K. R.
[12] Fürst Andrej Bolkonskij, der Vertreter desselben Typs in Tolstois Roman „Krieg und Frieden“. E. K. R.
[13] In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, unter Batyj, dem Enkel Dschingis-Chans. E. K. R.
[14] Seit dem Tode des letzten Nachkommen Ruriks, Feodors I., 1598 (nachdem Boris Godunoff den Thronfolger Dmitri 1591 hatte ermorden lassen) – bis Michail Romanoff 1613 den Thron bestieg. E. K. R.
[15] Russisches Nationalgetränk aus gesäuertem Brot. E. K. R.
[16] Rechtgläubigkeit. E. K. R.
[17] Geb. 1799, fiel 1837 im Duell. E. K. R.
[18] Geb. 1672, seit 1689, nach Ausschluß seines Bruders und seiner Halbschwester von der Regierung, Alleinherrscher; begann mit der Reform Rußlands nach seiner Reise ins Ausland 1697 und starb 1725. E. K. R.
[19] Ein Mensch, der keinen Verbleib hat. E. K. R.
[20] Aleko ersticht die Geliebte und einen jungen Zigeuner, die er bei einem Stelldichein überrascht. E. K. R.
[21] Ein junger Gutsbesitzer und Dichter, Onegins Nachbar und Bräutigam der Olga Larina, der jüngeren Schwester Tatjanas. Onegin, der auf seinem Gut wie ein blasierter Einsiedler lebt, wird von Lenskij überredet, mit ihm zu einem Familienfest in Larins, den Gutsnachbarn, zu reiten. Nachträglich ärgert sich Onegin über seine Einwilligung, und um nun seinerseits Lenskij zu ärgern, tanzt er auf dem Fest ausschließlich mit dessen Braut. Lenskij wird eifersüchtig, fordert den Freund und fällt im Duell. E. K. R.
[22] Der alte Mönch in Puschkins Drama „Boris Godunoff“. E. K. R.
[23] Das Stadthaupt (der Bürgermeister) in Gogols Komödie „Der Revisor“. E. K. R.
[24] Der Obergorodowoi (Schutzmann) in Gogols Komödie „Der Revisor“. E. K. R.
[25] Diese Bezeichnung rührt von Turgenjeff her, dessen Romanhelden fast ausnahmslos „überflüssige Menschen“ sind, die im Vaterlande keine Arbeit zu finden verstehen, sich mit Vorliebe im Auslande – in Paris oder in süddeutschen Kurorten – aufhalten und sich im Grunde nur selbst zur Last fallen. E. K. R.
[26] Frau Korobotschka ist eine Gutsbesitzerin, Ssobakewitsch ein Gutsbesitzer oder vielmehr „Besitzer von Leibeigenen“ in Gogols „Toten Seelen“, Tjäpkin-Ljäpkin ist der Friedensrichter in Gogols „Revisor“. Die Namen der Gestalten Gogols enthalten gewöhnlich bereits die ganze Charakteristik der Personen: Frau Korobotschka = Frau Kästchen, ist ein beschränktes, geiziges Frauenzimmer. Ssobakewitsch, – etwa Herr Hundemann –, behandelt seine Bauern, als wären sie Hunde. Dershimorda – Haltsmaul – hält vornehmlich mit diesem Befehl die Ordnung aufrecht. Skwosnik bedeutet „durchtriebener Schelm“, während Dmuchanowskij an die kirchenslawische Bezeichnung für „Aufgeblasenheit“ erinnert. Der Name Tjäpkin-Ljäpkin ist gebildet aus „Tjäp-da-ljäp,“ dem vulgären Ausdruck für „obenhin“ oder „irgendwie“. „Tjäp-da-ljäp, da i kletka“ heißt: eins, zwei, drei mit etwas fertig sein – ganz wie der Friedensrichter Tjäpkin-Ljäpkin mit den Gerichtssachen eins, zwei, drei fertig ist. E. K. R.
[27] Da die Leibeigenen im Plural meist einfach „Seelen“ genannt wurden, so nannte man eine Volkszählung oder eine gerichtliche bezw. notarielle Feststellung des Besitzes der Gutsherrn „Seelenrevision“. E. K. R.
[28] Die bedeutendsten Slawophilen. E. K. R.
[29] Publizist und Slawophile. E. K. R.
[30] Das russische Wort für „Bauer“: es ist die ältere Form von „Christjanin“, d. h. „Christ“, und hat somit nichts – wie die Bezeichnung des Bauern in anderen Sprachen – mit „Land“ (Landmann) oder bauen, bebauen gemein. E. K. R.
[31] Gogol und Lermontoff. E. K. R.
[32] Tolstoi, Dostojewski, Turgenjeff, Gontscharoff, Grigorowitsch. E. K. R.
[33] Russischer General, der 1876 in Serbien gegen die Türken kämpfte. E. K. R.
[34] Usurpator, Führer im großen Bauernaufstand unter Katharina II., gab sich für (den ermordeten) Peter III. aus, wurde 1775 in Moskau hingerichtet. E. K. R.
[35] Dostojewski hat den Seite 321–325 wiedergegebenen Entwurf in demselben Oktoberheft seiner Monatsschrift „Das Verdikt“ genannt und „die Überlegung eines Selbstmörders aus Langeweile, selbstredend eines Materialisten.“ E. K. R.
[36] Anhänger einer lutheranisierenden Sekte in Südrußland, von der Regierung verfolgt. Sie verwerfen die Sakramente und alle gottesdienstlichen Gebräuche und haben keine Priester. E. K. R.
[37] Verfasser einer kleinen Broschüre: „Unsere neuen Christen – Graf L. N. Tolstoi und F. M. Dostojewski“. E. K. R.
Anmerkungen zur Transkription
Die „Sämtlichen Werke“ erschienen in der hier verwendeten ursprünglichen Fassung der Übersetzung von E. K. Rahsin in mehreren Auflagen und Ausgaben 1906–1922 im Piper-Verlag. Dieses Buch wurde transkribiert nach:
F. M. Dostojewski: Sämtliche Werke.
Zweite Abteilung: Zwölfter Band
Literarische Schriften
R. Piper & Co. Verlag, München, 1921.
5. bis 9. Tausend
Das Cover wurde von den Bearbeitern den ursprünglichen Bucheinbänden nachempfunden und der public domain zur Verfügung gestellt.
Die Anordnung der Titelinformationen wurde innerhalb der „Sämtlichen Werke“ vereinheitlicht und entspricht nicht der Anordnung in den ursprünglichen Ausgaben. Alle editionsspezifischen Angaben wie Jahr, Copyright, Auflage usw. sind aber erhalten und wurden gesammelt direkt nach der Titelseite eingefügt.
Fußnoten wurden am Ende des Buches gesammelt.
Inhaltsverzeichnis und Überschriften im Text wurden harmonisiert.
Zu den Anführungszeichen: Gespräche wurden in doppelte Anführungszeichen („“) eingeschlossen. Die Wiedergabe von Äußerungen anderer innerhalb von Gesprächen wurde in einfache Anführungszeichen (‚‘) eingeschlossen.
Besonderheiten der Transliteration russischer Begriffe und Namen: Der Buchstabe „ä“ (oder auch „jä“) steht für den kyrillischen Buchstaben „ja“. Die Schreibweise häufig vorkommender russischer Namen wurde vereinheitlicht (nicht verwendete Varianten in Klammern):
Gradowskij (Gradowski)
Lewin (Levin)
Ostrowski (Ostrowsky)
Pugatschoff (Pugatscheff)
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Weitere Änderungen, teilweise unter Zuhilfenahme anderer Auflagen oder des russischen Originaltextes, sind hier aufgeführt (vorher/nachher):