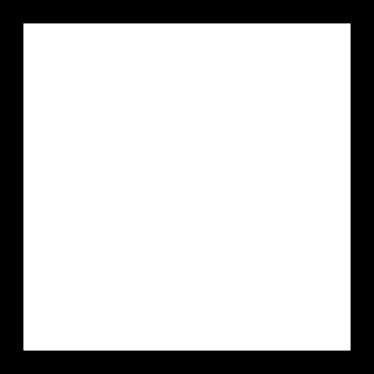Title: Der Zweifüßler und andere Geschichten: Naturgeschichtliche Märchen
Author: Carl Ewald
Editor: Hermann Kiy
Illustrator: Willy Planck
Release date: April 21, 2022 [eBook #67897]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: German
Original publication: Germany: Franckh'sche Verlagshandlung
Credits: Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1922 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Naturgeschichtliche Märchen
von
Karl Ewald
Zweiter Band der autorisierten
deutschen Gesamtausgabe von
Hermann Kiy
Mit acht Tafeln und zahlreichen
Abbildungen von Willy Planck
Dreiundzwanzigste Auflage

Kosmos,
Gesellschaft der Naturfreunde
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart
1922
Alle Rechte vorbehalten.
STUTTGARTER SETZMASCHINEN-DRUCKEREI
HOLZINGER &
Co. STUTTGART
|
|
Seite
|
|
Der Zweifüßler
|
|
|
Libelle und Seerose
|
|
|
Das Ding in viererlei Gestalt
|
|
|
Das Unkraut
|
|
|
Die Unsichtbaren
|
|
|
Der Kuckuck
|
|
|
Der Seestern
|
|
|
Die Buche und die Eiche
|
|
|
Der Ameisenhügel
|
|
|
Die Korallen
|
|
|
Eine unglaubliche Geschichte
|
|
|
Der Wind
|
|
|
Der gute Mann
|
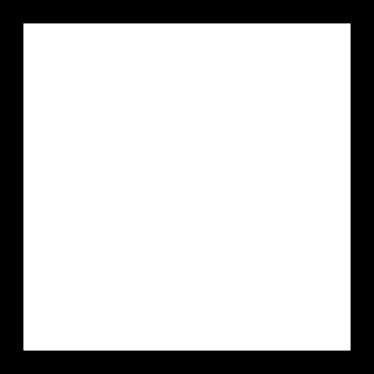
[S. 5]
Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, in den warmen Ländern, wo die Sonne stärker scheint als bei uns, der Regen dichter fällt und alle Pflanzen und Tiere besser gedeihen, weil der Winter ihnen nichts anhaben kann.
Der Wald war voller Leben und Lärm.
Die Fliegen summten, der Sperling fraß die Fliegen und der Habicht fraß den Sperling. Die Bienen krochen in die Blütenkelche hinein, um Honig zu suchen, der Löwe brüllte und die Vögel sangen; der Bach rieselte und das Gras wuchs. Die Bäume rauschten, während ihre Wurzeln Saft aus der Erde sogen, und die Blumen dufteten und strahlten.
Da auf einmal ward es seltsam still.
Es war, als hielten alle den Atem an und lauschten und starrten. Die Bäume rauschten nicht mehr. Das Veilchen erwachte aus seinen Träumen und guckte verwundert auf. Der Löwe wandte sein Haupt und blieb stehen, die eine Pfote vom Erdboden erhoben. Der Hirsch hörte auf zu äsen, der Adler ruhte hoch in der Luft auf seinen Schwingen aus, die[S. 6] kleine Maus kam aus ihrem Loch hervor und spitzte die Ohren.
Durch den Wald kamen zwei gegangen, die den andern Wesen nicht glichen, und die noch niemand je gesehen hatte.
Aufrecht gingen sie. Ihre Stirn war hoch, ihr Auge stark. Sie hielten einander bei der Hand und sahen sich um, als wüßten sie nicht, wo sie wären.
„Wer in aller Welt ist das?“ fragte der Löwe.
„Das sind Tiere,“ entgegnete der Hirsch. „Sie können gehen, aber sie gehen wunderlich. Warum springen sie nicht auf allen vieren, da sie doch vier Beine haben? Dann kämen sie schneller vorwärts.“
„O,“ wendete die Schlange ein, „ich habe gar keine Beine und komme doch recht gut vom Fleck, sollte ich meinen.“
„Ich glaube nicht, daß es Tiere sind,“ sagte die Nachtigall. „Sie haben ja keine Federn und keine Haare, außer dem bißchen auf dem Kopfe.“
„Schuppen würden wohl auch genügen,“ rief der Hecht, indem er das Maul aus dem Flusse hob.
„Manch einer muß sich mit der nackten Haut zurechtfinden,“ bemerkte der Regenwurm still.
„Sie haben keinen Schwanz,“ piepste die Maus. „Es sind nie im Leben Tiere gewesen.“
„Auch ich habe keinen Schwanz,“ schrie die Kröte, „und doch wird wohl niemand bestreiten wollen, daß ich ein Tier bin.“
„Seht... seht doch bloß!“ rief da der Löwe.[S. 7] „Jetzt nimmt der eine von ihnen einen Stein in die Vorderpfote... das könnte ich nicht.“
„Aber ich!“ sagte der Orang-Utan. „Das ist doch keine Kunst. Übrigens kann ich eure Neugier befriedigen. Die beiden sind wirklich Tiere. Es ist Mann und Weib. Sie heißen Zweifüßler und sind entfernte Verwandte von mir.“
„So so!“ brummte der Löwe. „Wie kommt es denn, daß sie keinen Pelz haben?“
„Den haben sie wohl ausgezogen,“ meinte der Orang-Utan.
Der Löwe aber fragte weiter: „Warum gehst du denn nicht hin und sagst ihnen guten Tag?“
„Ich kenne sie ja gar nicht,“ erwiderte der Orang-Utan. „Und ich mache mir auch gar nichts daraus, mit ihnen zu verkehren. Ich habe nur von ihnen erzählen hören... sie gehören einer sehr armseligen, heruntergekommenen Affenart an, versteht ihr. Ich will ihnen ja gerne gelegentlich eine Apfelsine zustecken, aber ich übernehme durchaus keine Verantwortung für sie.“
„Sie sehen ganz appetitlich aus,“ sagte der Löwe. „Ich hätte wohl Lust, einmal zu versuchen, wie sie schmecken!“
„Das kannst du ja tun,“ meinte der Orang-Utan. „Sie werden der Familie doch niemals Ehre machen, und sie werden noch einmal ein schlimmes Ende nehmen.“
Da ging der Löwe auf die beiden zu; aber als[S. 8] er vor ihnen stand, verlor er plötzlich den Mut. Er verstand die Sache selbst nicht, denn er hatte ja sonst vor nichts im Walde Angst. Aber die beiden neuen Tiere hatten so seltsame Augen und wandelten so frohen Mutes dahin, daß der Löwe dachte, sie müßten über irgendeine geheime Macht gebieten, die er nicht sehen könnte. Ihre Zähne taugten nicht viel, und ihre Krallen waren nicht der Rede wert. Aber ein Geheimnis mußte ja an ihnen sein.

Mit gesenktem Kopf wich er ihnen aus.
„Warum hast du sie nicht gefressen?“ fragte die Löwin.
„Ich hatte keinen Hunger,“ war die Antwort des Löwen.
Dann legte er sich im hohen Grase zur Ruhe und tat so, als dächte er gar nicht mehr an die beiden. Und da er der vornehmste war, so folgten die andern Tiere seinem Beispiel. Trotzdem interessierten sie sich alle ungemein für die neuen Tiere.
Inzwischen wanderten der Zweifüßler und sein Weib weiter; und im Wandern erstaunten sie mehr und mehr über die Schönheit der Welt. Dabei hatten sie gar keine Ahnung davon, wieviel Aufsehen sie erregten, und sahen nicht, wie die Tiere heimlich ihren Spuren folgten. Aber wohin sie auch kamen, überall steckten die Bäume die Köpfe zusammen und flüsterten; die Vögel begleiteten sie über ihren Köpfen durch die Luft, und aus jedem Strauch starrten verwunderte Augen sie an.
[S. 9]
„Hier wollen wir wohnen,“ rief der Zweifüßler aus und zeigte auf eine wunderschöne kleine Wiese, wo ein lieblicher Fluß zwischen Blumen und Gräsern dahinfloß.
„Nein — hier!“ jauchzte sein Weib und lief in den benachbarten Wald, dessen Bäume kühlen Schatten spendeten und dessen Boden mit dichtem, weichem Moose bedeckt war.
„Wie seltsam ihre Stimmen klingen!“ flötete bewundernd die Nachtigall. „Sie haben mehr Töne als ich.“
„Wenn sie nicht so groß wären, würde ich ihnen empfehlen, neben mir im Schilfe ihr Nest zu bauen,“ sagte der Rohrsänger.

Die beiden neuen Tiere gingen weiter und fanden immer neue Stellen, von denen die eine ihnen noch schöner erschien als die andere, so daß sie zu keinem Entschlusse kamen, wo sie bleiben sollten. Da begegneten sie dem Hunde, der stark hinkte, weil er sich die Pfote an einem scharfen Stein verletzt hatte. Er wollte ihnen aus dem Wege laufen, konnte aber nicht. Frau Zweifüßler hielt ihn fest und betrachtete seine Wunde.
„Ich werd’ dir helfen, du Ärmster!“ tröstete sie. „Wart’ nur ein wenig.... Neulich hab’ ich mir selber den Fuß verletzt und mit Blättern geheilt.“

Der Hund merkte, daß sie nichts Böses mit ihm vorhatte. Darum blieb er ruhig stehen, während sie ins Gebüsch lief, um Blätter zu holen. Inzwischen[S. 10] streichelte der Zweifüßler seinen Rücken und sprach ihm freundlich zu. Nach einer Weile kam sie mit Blättern zurück, legte sie auf die Pfote und band eine Ranke darum:
„Jetzt spring weiter! Morgen bist du gesund.“
Nun setzten die beiden ihre Wanderung fort, während der Hund stehenblieb, ihnen nachschaute und mit dem Schwanze wedelte. Da kamen die andern Tiere aus Gehölz und Gebüsch hervor.
„Du hast mit den Fremdlingen gesprochen.... Was haben sie gesagt?“ fragten sie im Chore.
„Sie sind besser als die andern Tiere im Walde,“ entgegnete der Hund. „Sie haben meine Pfote geheilt und mir das Fell gestreichelt. Ich werd’s ihnen nicht vergessen.“
„Sie haben ihm die Pfote geheilt... sie haben ihm das Fell gestreichelt...“
Von Mund zu Mund ging die Kunde durch den Wald. Die Bäume flüsterten es einander zu, die Blumen seufzten und nickten, die Eidechsen waren wie immer flinke Geschichtenträger, und die Nachtigall machte Verse daraus.
Die neuen Tiere aber gingen weiter und dachten gar nicht mehr an den Hund.
Schließlich wurden sie müde und setzten sich an einer Quelle nieder. Sie beugten sich über das rinnende Wasser, tranken und lachten ihrem eigenen Spiegelbilde zu. Und dann brachen sie saftige Früchte von den Bäumen und aßen sie. Als die Sonne unter[S. 11]ging, legten sie sich im Grase zur Ruhe und schliefen ein, einander mit den Armen umschlungen haltend. Nicht weit von ihnen lag, den Kopf auf den Vorderpfoten, der Hund, der ihnen unbemerkt gefolgt war, und schaute zu ihnen hinüber.
Der Mond schien rund und hell auf sie hinab. Er schien auch in das große, erstaunte Gesicht des Rindes hinein, das vor ihnen stand.
„Buh!“ brummte das Rind.
„Böh!“ höhnte der Mond. „Was gaffst du denn da?“
„Ich sehe mir die beiden an, die da schlafen,“ erwiderte das Rind. „Kennst du sie?“
„Mich dünkt, vor vielen, vielen Jahren ist auch auf mir so etwas herumgekrochen,“ sagte der Mond. „Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mein Gedächtnis hat in den letzten hunderttausend Jahren ungemein abgenommen. Ich kann gerade noch die Gedanken für meine Himmelstour zusammenhalten.“
„Ja, mit meinem Denken ist es auch nicht weit her. Aber ich habe Angst.“
„Vor den beiden da?“ fragte der Mond.
„Ich vermag es nicht zu erklären. Aber ich kann sie nicht leiden.“
„Dann tritt sie doch tot!“
„Das wag’ ich nicht,“ sagte das Rind. „Nicht allein. Aber vielleicht finde ich jemand, der mir hilft.“
[S. 12]
„Mach, was du willst!“ rief der Mond. „Mir ist das alles gleichgültig.“
Mit diesen Worten segelte er von dannen. Das Rind aber käute wieder und dachte nach, ohne zu einem Resultat zu gelangen.
„Schlafen Sie?“ fragte das Schaf, dessen langes Gesicht neben dem Rinde auftauchte.
Und plötzlich war die ganze Wiese lebendig.
Da waren alle die Tiere, die den beiden auf ihrer Wanderung gefolgt waren. Sowohl die, die am Tage schliefen und in der Nacht jagten, als die, die ihrer Arbeit nachgingen, während die Sonne schien. Niemand dachte mehr an Tätigkeit oder Ruhe. Und niemand dachte daran, dem andern ein Leid zuzufügen. Löwe und Hirsch, Wolf und Schaf, Katze und Maus, Pferd, Rind und viele andere standen Seite an Seite im Grase. Der Adler saß im Wipfel eines Baumes mitten zwischen all den kleinen Vögeln des Waldes. Der Orang-Utan hatte es sich auf einem der untersten Zweige bequem gemacht und verzehrte eine Apfelsine. Das Huhn stand auf einer Anhöhe neben dem Fuchs; die Ente und die Gans schwammen auf dem Flusse und reckten den Hals.
„Laßt uns beraten, da wir gerade alle hier beisammen sind!“ schlug der Löwe vor.
„Bist du satt?“ fragte das Rind.
„Gewiß, ich bin gesättigt,“ erwiderte der Löwe. „Heut nacht halten wir Frieden und Freundschaft.“
„Dann schlage ich vor, daß wir sofort und ohne[S. 13] weiteres die beiden fremden Tiere erschlagen,“ brüllte das Rind.
„Was ist denn in dich gefahren?“ rief da der Löwe. „Du bist doch sonst so ein verträglicher Bursche, gehst auf die Weide und tust keiner Katze etwas. Wie kommt es, daß du plötzlich so blutdürstig geworden bist?“

„Ich kann es mir auch nicht erklären,“ entgegnete das Rind. „Aber ich habe das bestimmte Gefühl, daß wir sie möglichst schnell erschlagen sollten. Sie werden uns Unglück bringen. Sie sind böse. Ihr sollt sehen: wenn ihr meinen Rat nicht befolgt, so werdet ihr es noch einmal bereuen.“
Nun mischte sich auch das Pferd ins Gespräch:
[S. 14]
„Ich stimme dem Rinde bei. Beißt sie tot, tretet sie tot! Je eher, desto besser!“
„Schlagt sie tot! Schlagt sie tot!“ riefen das Schaf, die Ziege und der Hirsch, die Ente, die Gans und das Huhn.
„Wie sonderbar,“ sagte der Löwe und sah sich erstaunt um. „Die friedlichsten und feigsten Tiere wollen den Fremden zu Leibe. Was haben sie euch getan? Warum fürchtet ihr euch vor ihnen?“
„Ja, erklären kann ich es ebensowenig wie das Rind,“ meinte das Pferd. „Aber ich habe das Gefühl, daß die beiden Wesen uns gefährlich sind. In meinen Lenden und Beinen zuckt es und reißt es.“
Und das Rind fiel ein: „Mir ist es, als würde mir die Haut abgezogen, wenn ich an die beiden denke. Es bohren sich Zähne in mein Fleisch.“
„Mich friert, als würde mir alle meine Wolle abgeschoren,“ schrie das Schaf.
„Mir ist zumute, als würde ich auf dem Feuer gebraten und gegessen,“ rief die Gans.
„Mir auch!“ „Mir auch!“ riefen die Ente und das Huhn.
„Höchst seltsam!“ philosophierte der Löwe. „Ich habe noch nie dergleichen gehört und verstehe eure Empfindungen nicht. Was können die Fremden euch anhaben? Nackt gehen sie umher, verzehren einen Apfel, eine Apfelsine und tun nichts Böses. Auf zwei armseligen Beinen wandeln sie dahin, während ihr vier habt, so daß ihr vor ihnen fortlaufen könnt.[S. 15] Außerdem habt ihr ja Hörner, Klauen und Zähne. Wovor fürchtet ihr euch also?“
„Du wirst deine Worte noch einmal bereuen,“ prophezeite das Rind. „Die neuen Tiere werden uns alle verderben. Dir droht ebenso Gefahr wie uns.“
„Ich weiß von keiner Gefahr und kenne keine Furcht,“ erklärte der Löwe stolz. „Aber ist denn wirklich nicht einer unter euch, der die beiden Fremden in Schutz nimmt?“
Da beeilte sich der Orang-Utan zu versichern: „Wenn sie nicht mit zu meiner Familie gehörten, würde ich das recht gerne tun. Aber es macht keinen guten Eindruck, wenn man die eigene Sippe herausstreicht. Laßt sie gehen, bis sie verkommen! Sie sind ganz unschädlich.“
„Dann will wenigstens ich etwas Gutes von ihnen sagen,“ begann nun der Hund. „Meine Pfote ist schon fast geheilt; und ich glaube, sie sind klüger als ihr alle zusammen. Nie und nimmer werd’ ich ihnen vergessen, was sie an mir getan haben.“
„Das ist recht, Vetter,“ sagte der Löwe. „Du bist ein tüchtiger Bursche; und man merkt, daß du aus guter Familie stammst. Ich glaube nicht, daß diese Zweifüßler gefährlich sind; und ich beabsichtige auch nicht, ihnen etwas zu leide zu tun. Herrgott... treffe ich sie eines Tages, wenn ich hungrig bin, dann fresse ich sie natürlich. Das ist eine Sache für sich. Der Hunger ist nun mal unser Herr. Aber heut nacht[S. 16] bin ich satt. Darum geh’ ich jetzt schlafen. Gute Nacht allerseits!“
Nun sagte niemand mehr etwas. Still, wie sie gekommen, entfernten sich die Tiere. Die Nacht verstrich, und im Osten dämmerte der Tag.
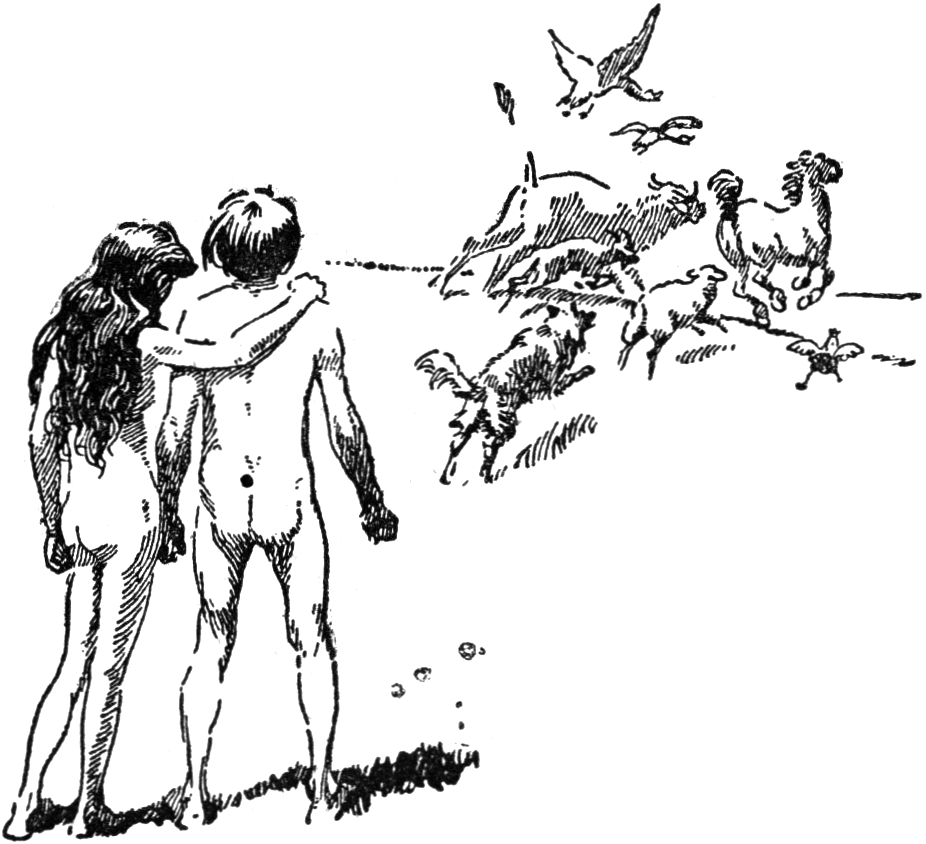
Da kamen plötzlich das Rind, das Pferd, das Schaf und die Ziege über die Wiese herangaloppiert. Hinter ihnen watschelten die Ente, die Gans und das Huhn, so gut sie folgen konnten. Das Rind war an der Spitze. Mit gesenkten Hörnern stürmte es auf die Stelle zu, wo die Fremden schliefen.
Aber im selben Augenblick sprang der Hund auf[S. 17] und bellte rasend. Die beiden Schlafenden erwachten und richteten sich auf. Und wie sie so dastanden, groß und aufrecht, mit ihren weißen Gliedern und starken Augen, und die Sonne sie beschien, da erschraken die alten Tiere und liefen dahin zurück, von wo sie gekommen.
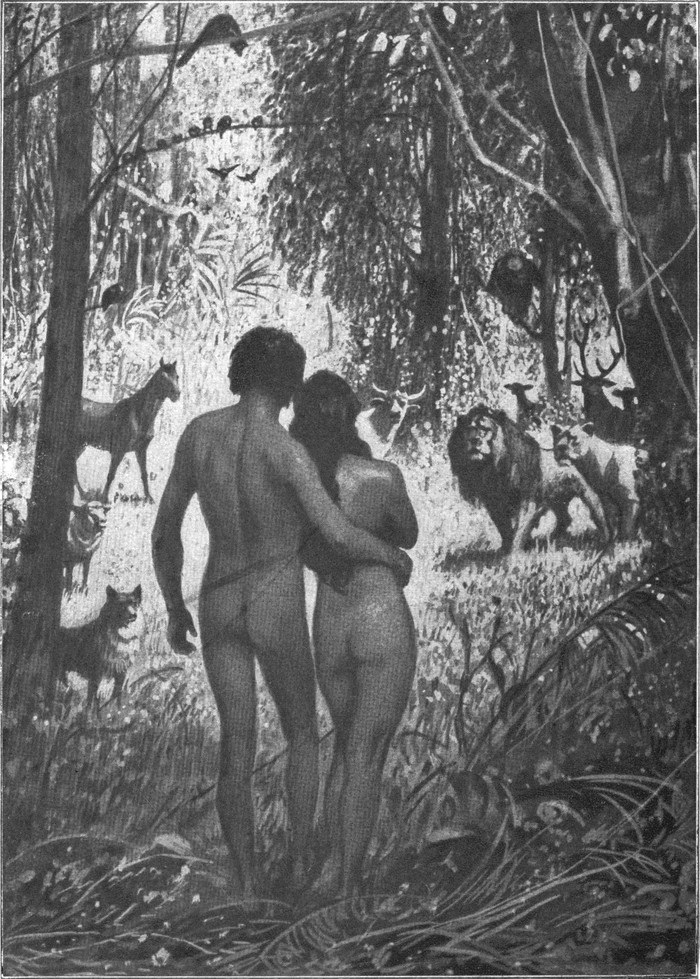
„Schönen Dank, Freund!“ sagte der Zweifüßler zum Hunde, indem er ihn streichelte.
Sein Weib untersuchte die kranke Pfote und plauderte mit ihrer wohlklingenden Stimme mit dem Tier. Da leckte der Hund den beiden froh die Hände.
Nun badeten die neuen Tiere im Flusse. Und dann kletterte der Zweifüßler auf einen Apfelbaum, der in der Nähe stand, um sich und seinem Weibe ein paar Früchte zum Frühstück zu holen.
Auf dem Baum saß der Orang-Utan und nagte an einem Apfel.

„Fort mit dir!“ drohte der Zweifüßler. „Dieser Baum hier gehört mir, daß du’s weißt! Wage nicht, auch nur einen Apfel anzurühren!“
„Du himmlische Güte!“ sagte der Orang-Utan. „In was für einem Tone sprichst du denn? Obendrein zu mir, der ich dich heute nacht noch in Schutz genommen habe, während alle anderen Tiere erklärten, dich erschlagen zu wollen.“
„Fort mit dir, du garstiger Affe!“ rief der Zweifüßler. Er brach einen Zweig ab und gab dem Orang-Utan ein paar gehörige Schläge, so daß dieser heulend in den Wald entfloh.
[S. 18]
Die Tage verstrichen.
Im Walde war alles emsig und fleißig, unten am Boden wie oben in der Luft. Die Weibchen hatten Eier oder Junge, und die Männchen konnten der Familie nicht genug Futter verschaffen. Jeder ging seinen eigenen Geschäften nach, und niemand dachte an den Nachbar, falls man nicht gerade vorhatte, ihn aufzufressen.
Die neuen Tiere hatten sich auf einer Insel im Flusse ein Haus gebaut.
Der Löwe war ihnen nämlich eines Tages am Rande des Gehölzes begegnet. Wie neulich war er ihnen zwar aus dem Wege gegangen; aber er hatte sie mit einem Blicke gestreift, bei dem der Frau des Zweifüßlers angst und bange geworden war.
„Der wird uns eines Tages auffressen wollen,“ sagte sie. „Ich wage es nicht mehr, mich auf die Wiese schlafen zu legen.“
So hatte denn der Zweifüßler die kleine Insel als Wohnort gewählt und eine Hütte aus Zweigen und Gräsern gebaut. Am Tage wateten sie durch den Bach und pflückten von den Früchten des Waldes. Des Nachts aber schliefen sie in ihrer Hütte. Die andern Tiere hatten sich allmählich alle an sie gewöhnt und sprachen nur noch selten von ihnen. Nur der Hund vergaß nie, am Morgen an das Ufer gegenüber der Insel zu laufen und seinen Morgengruß hin[S. 19]überzubellen. Und außer ihm nahm noch der Orang-Utan Notiz von den beiden, indem er sie verleumdete, wo er nur konnte.
„Wer kümmert sich um so etwas?“ sagte der Hirsch. „Das ist der Familienneid.“
Eines Nachts bekamen die neuen Tiere ein Junges.
„Die Zweifüßler haben Familienzuwachs gekriegt,“ sagte der Sperling, der überall herumkam und alle Neuigkeiten kannte.
„Weiß Gott, ich muß doch einmal hinübergehen und mir das Kindchen anschauen,“ flötete Frau Nachtigall. „Meine Eier werden die fünf Minuten über wohl warm bleiben.“
„Die Füchsin ist auch schon hingelaufen. Da kann ich es wohl wagen, meine Gänschen einen Augenblick allein zu lassen,“ sagte Mutter Gans.
Unten am Bach hatte sich schon eine große Gesellschaft versammelt.
Alle Frauen hatten ihren Haushalt im Stiche gelassen, um der Frau Zweifüßler die Wochenvisite abzustatten. Die saß im Grase vor der Hütte, mit dem Kinde an der Brust. Der Zweifüßler saß neben ihr und verspeiste eine Apfelsine.
„Er ist also genau so wie alle andern Männer,“ sagte Madam Hirsch.
„Es gibt schlimmere Männer,“ klagte Frau Maulwurf. „Der meine frißt die Kinder, wenn ich nicht achtgebe.“
[S. 20]
„Die Männer sind ein erbärmliches Gesindel,“ versicherte die Spinne. „Ich habe den meinen aufgefressen, nachdem ich die Eier gelegt hatte.“

„Verschone uns mit deinen greulichen Geschichten!“ sagte Frau Nachtigall. „Übrigens könnte der junge Vater seinem Weibe ruhig etwas vorsingen, finde ich. Mein Mann tut das wenigstens.“
[S. 21]
„Seht das Junge... Wie süß es ist!“ rief die Rohrsängerin.
„So ein Würmchen!“ erklärte Madam Hirsch. „Es kann ja nicht einmal auf den Beinen stehen. Und der Sperling sagte doch, es sei schon gestern abend um elf Uhr geboren worden. Als mein Kalb eine Stunde alt war, sprang es bereits lustig auf der Wiese umher.“
„Was soll denn das heißen, so ein kleines Wesen auf dem Arm herumzutragen?“ tadelte das Känguruh. „Wäre es mein Junges, so dürfte es hübsch im Beutel bleiben, bis es sich zu benehmen wüßte. Aber die arme Frau hat vermutlich nicht einmal einen Beutel.“
„Sehen kann es,“ sagte die Füchsin. „Meine Kinder sind volle neun Tage blind.“
„Ihr müßt bedenken, daß es arme Leute sind,“ verkündete der Orang-Utan. „So eine Familie hat es nicht leicht, wenn sie Zuwachs bekommt. Die Polizei sollte es verbieten!“
Aber damit war Frau Nachtigall durchaus nicht einverstanden:
„Das Kind ist so lieb und nett, das sieht jede Mutter. — He, Frau Zweifüßler, Sie müssen es unbedingt mit Maden füttern. Davon wird es schön fett.“
„Sie müssen sich in der Nacht darauflegen,“ rief das Rohrsängerweibchen. „Sonst erkältet es sich.“
„Kümmern Sie sich nur nicht um das, was die[S. 22] andern sagen!“ rief Madam Hirsch. „Bleiben Sie ruhig bei der Milch! Die ist für das kleine Wesen gut. Und setzen Sie es ins Gras, und lassen Sie es selber laufen! Es ist das beste, wenn Sie es von klein auf an Selbständigkeit gewöhnen.“
Von allen diesen Reden und Ratschlägen hörte Frau Zweifüßler nichts. Beglückt saß sie da und betrachtete ihr Junges. Jetzt war es mit Trinken fertig und fing an zu jauchzen und mit den Ärmchen und Beinchen zu strampeln. Der Zweifüßler nahm es, hielt es hoch in die Luft und lachte es an.
„Nein, wie niedlich ist es doch!“ rief die Rohrsängerin.
„Das ist es auch,“ meinte Madam Hirsch. „Aber die Eltern sind recht eingebildet. Sie nehmen ja gar keine Notiz von uns.“
Im nächsten Augenblick jedoch rief sie zur Insel hinüber:
„Es schadet nichts, Frau Zweifüßler. Bleiben Sie ruhig bei der Milch! Wenn sie ausgeht, dann kommen Sie ruhig zu mir! Das eine Kalb ist mir neulich gestorben, darum kann ich Ihnen aushelfen.“
Dann machten sie alle, daß sie nach Hause kamen, damit die Männer nicht entdeckten, daß sie beim Kaffeeklatsch gewesen waren. —
„Ich gehe ein Weilchen fort, um ein paar Apfelsinen oder etwas ähnliches zu holen,“ sagte der Zweifüßler. „Wir haben alles gegessen, was auf den Bäumen hier in der Nähe zu finden war.“
[S. 23]
„Spute dich nur!“ bat seine Frau. „Du weißt ja, ich mag in dieser Zeit nicht gern allein sein.“
Er durchwatete den Fluß und ging in den Wald. Nach geraumer Zeit kam er mit nur zwei kleinen, unansehnlichen Früchten zurück. Er war sehr ärgerlich darüber, und seine Frau nicht minder; denn sie war sehr hungrig. So saßen sie und berieten, ob sie nicht in der Nähe etwas Eßbares finden könnten. Denn wenn es erst Abend geworden, wagten sie die Insel nicht mehr zu verlassen.
„Gestern abend hab’ ich hier im Fluß den Fischotter gesehn,“ erzählte der Zweifüßler. „Er fing einen großen Fisch und fraß ihn. Vielleicht könnte ich es ebenso machen.“
„Versuch es einmal!“ ermunterte ihn sein Weib. „Essen muß ich ja, so viel steht fest.“

Da ging er wieder in den Fluß hinaus und ergriff mit den Händen einen großen Hecht, der ganz dicht neben ihm schwamm und an keine Gefahr glaubte. Der Hecht hatte den Zweifüßler ja schon so oft durch den Fluß waten sehen, ohne daß dieser sich im geringsten um ihn gekümmert hatte. Jetzt aber wurde der Fisch auf die Insel geworfen, wo er nun ächzend lag, nach Luft schnappte und schrie, so laut er konnte:
„He... hallo... Mord... Hilfe...“
Aber dann war er tot. Der Zweifüßler und seine Frau aßen ihn und fanden, daß er sehr gut mundete.
[S. 24]
„Bring mir morgen wieder so einen Fisch!“ sagte sie. „Die Äpfel habe ich, offen gestanden, schon satt bekommen.“
Am nächsten Tage ging er darum wieder in den Fluß hinein. Es dauerte denn auch nicht lange, bis er einen appetitlichen Fisch fand; aber gerade als er ihn packen wollte, schnappte der Fischotter ihm die Beute vor der Nase weg.
„Willst du wohl aus meinem Flusse fort, du Diebsgesicht!“ schrie er und schlug nach ihm.
„Mich nennst du einen Dieb?“ knurrte der Fischotter und zeigte seine weißen Zähne. „Ich habe gemeint, der Fluß gehöre mir; denn ich habe hier gewohnt, bevor du kamst.“
Da sprang der Zweifüßler ans Land, holte große Steine herbei und warf sie nach dem Fischotter. Einer traf ihn auf die Schnauze, so daß er blutete. Dann versteckte er sich in seiner Höhle, während der Zweifüßler einen andern Fisch fing und seiner Frau brachte. Aber als der Fischotter im Lauf der Nacht wieder zum Vorschein kam, saß der Orang-Utan da und nickte ihm zu.

„Ich habe das Ganze mit angesehen,“ sagte er. „Oben vom Baume aus, wo ich Zeuge war, wie er den Stein gegen dich warf. Dein Blut hat das Wasser ja ganz gerötet. Auch mich hat er einmal mißhandelt. Er sagte, die Äpfel gehörten ihm, und verjagte mich mit einem Stock vom Baume. Obwohl er verwandt mit mir ist.“
[S. 25]
„Könnte ich ihn nur treffen!“ rief der Fischotter und knirschte mit den Zähnen. „Aber ich bin zu klein.“
„Kommt Zeit, kommt Rat,“ erwiderte der Orang-Utan. „Wir werden schon mit ihm fertig werden.“
Die Sonne brannte herab, und die Erde war ganz ausgedörrt.
Bäume und Sträucher ließen die Blätter hängen, und das Gras war abgesengt und gelb, so daß das Rind kaum ein grünes Büschelchen fand. Das Wasser im Flusse stand so niedrig, daß die Fische auf den Grund stießen, und der Bach war längst eingetrocknet. Die Tiere lagen im Schatten und schnappten nach Luft. An vielen Stellen starben die Blumen und Tiere. Auch dem Zweifüßler und seinem Weibe und Kinde ging es nicht gut.
So recht von Herzen vergnügt war einzig und allein die Schlange. Sie streckte sich mitten im Sonnenschein und fand das Leben herrlich.
„Scheine nur, liebe Sonne!“ rief sie. „Je mehr, desto besser. Jetzt merke ich erst, daß ich lebe.“
Aber eines Tages kam der Regen.
Und zwar war es kein Regen, gegen den man sich schützen konnte, indem man einen Schirm aufspannte, oder vor dem man in den Hausflur flüch[S. 26]tete, bis er vorüber war. Nein — das Wasser stürzte aus den Wolken hernieder, so daß man nicht die Hand vor Augen sehen konnte; und es regnete Tag um Tag, als ob es nie mehr aufhören wollte. Es prasselte und trommelte auf die dürren Blätter herab, so daß die Leute kein Wort verstehen konnten, wenn sie etwas zueinander sagten. Der Fluß strömte wieder dahin, der Bach erwachte aus seinem Schlafe und rauschte und sang, wie er noch nie gesungen hatte. Die Erde glich einem durstigen Munde, der trank und trank und doch nie seinen Durst löschen konnte.
Allerorten herrschte eitel Freude.
Die Bäume reckten sich und streckten sich und brachten neue Triebe hervor, und dem Boden entsproß frisches grünes Gras. Die Blumen trieben von neuem Knospen, die Frösche quakten so fröhlich, daß es im ganzen Walde zu hören war, und die Fische schlugen munter mit dem Schwanze. Der Zweifüßler saß mit seiner Familie vor der Laubhütte und freute sich mit den andern Geschöpfen.
Aber es regnete immer weiter.
Der Fluß trat über seine Ufer, und der Zweifüßler bekam schließlich Angst, daß seine Insel von den Wogen überflutet werden würde. Der Regen strömte außerdem durch das Dach der Hütte, so daß drinnen kein trockner Fleck war.
„Das Kind friert,“ jammerte sein Weib.
Da beschlossen sie, die Insel zu verlassen; mit[S. 27] großer Mühe gelangten sie über den Fluß hinüber. Sie durchwateten die überschwemmte Wiese, wobei sie abwechselnd das Kind trugen. Endlich fanden sie einen Baum, der ihnen eine Zuflucht bot. Sie flochten Zweige zusammen, bauten ein Dach und stopften Gras und Moos in die Lücken; so hatten sie nun wieder eine Behausung.
„Bis hier herauf kommt das Wasser nicht,“ tröstete der Mann.
„Aber es regnet durch das Dach,“ klagte sein Weib. „Und für das Kind ist es zu kalt. Auch dich und mich friert ja.“
„Hab’ ich es nicht immer gesagt?“ frohlockte der Orang-Utan. „Sie haben keinen Pelz oder etwas ähnliches. Und sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen.“
„Sie hätten Ihr Junges mit Maden füttern sollen, Frau Zweifüßler,“ sagte Frau Nachtigall. „Dann wäre es besser gediehen. Meine Jungen sind fast schon ebenso groß wie ich selbst.“
„Sie hätten es auf die Wiese setzen und sich selber überlassen sollen, wie ich Ihnen riet!“ meinte Madam Hirsch. „Dann könnte es jetzt ohne Sie fertig werden.“
„Legen Sie sich auf Ihr Junges!“ riet wie früher Frau Rohrsänger. „So hab’ ich meine Kinderchen warm gehalten.“
Frau Zweifüßler sagte nichts auf alle diese[S. 28] Reden; betrübt betrachtete sie ihren Knaben, der vor Kälte zitterte.
„Es ist eigentlich ein fürchterlich verzogenes Kind!“ nörgelte Mutter Igel. „Gott behüte... was sein muß, muß sein; und wenn man Nachkommen in die Welt gesetzt hat, so muß man ihnen eine anständige Erziehung geben. Aber wenn so ein halbjähriger Lümmel noch immer saugt... pfui! Prügel sollte er haben, und dann rutsch! in die Welt mit ihm!“
„Diese Leute wollen eben keine Vernunft annehmen!“ schalt Madam Hirsch. „Da mögen sie sehen, wie sie durchkommen. Wie man sich bettet, so liegt man.“
Damit gingen die Tiere fort. Die Zweifüßler aber blieben auf ihrem Baume, während der Regen immer noch herabströmte und das Kind vor Kälte schrie.
„Sieh doch das dumme Schaf da unten auf der Wiese,“ sagte das Weib. „Es läßt es sich wohl sein in seinem dicken Pelz, während mein armer kleiner Junge hier liegt und frieren muß.“
Der Zweifüßler hörte recht gut, was sie sagte, gab ihr aber keine Antwort. Eine Weile saß er schweigend da und dachte nach. Dann kletterte er vom Baume hinunter und setzte sich auf die Erde, um weiter zu sinnen und zu grübeln, während der Regen herabstürzte. Oben hörte er sein Söhnchen[S. 29] schreien, und unten auf der Wiese sah er das Schaf weiden.

Da richtete der Zweifüßler sich auf und ging auf das Schaf zu. Unterwegs nahm er einen scharfen Stein auf und verbarg ihn in der Hand. Er ging ganz langsam und sah zur Seite, damit das Schaf nicht erschräke. Dann stürzte er plötzlich auf das Tier zu.
„Määh! Mord! Hilfe!.... Ich sterbe!“ schrie das Schaf.
Der Zweifüßler schlug es mit dem Stein gegen die Stirn, so daß es zu Boden fiel. Dann erwürgte er es mit den Händen, packte es am Fell und schleppte es zu dem Baum, der jetzt seine Wohnung war.
Mit dem scharfen Stein durchlöcherte er das Fell und begann, es mit den Nägeln zu zerreißen. Seine Frau kam herunter und half ihm. Sie arbeiteten eifrig mit den Zähnen, damit es schneller ginge; und mitten in ihrem Tun hörten sie auf und sahen einander mit frohen Augen an.
„Wie das gemundet hat!“ rief der Mann.
„Wunderschön!“ stimmte sein Weib ein. „Komm, wir wollen unserm Jungen den Pelz bringen; nachher essen wir weiter.“
Der Zweifüßler trank das Blut des Schafes und biß tief in das Fleisch ein.
„Ich fühle mich so stark wie noch nie!“ rief[S. 30] er aus. „Nun mag der Löwe kommen! Er hat es mit mir zu tun!“
Sie zogen das Fell ab und hüllten das Kind darin ein; das schlief bald danach warm und gut. Dann schleppten sie den Rest des Schafes in ihre Behausung und aßen davon. Nach jedem Bissen, den sie nahmen, fühlten sie sich gesünder und kräftiger. Sie dachten nicht mehr an Kälte und Regen, sprachen vielmehr vergnügt von der Zukunft.
„Auch ich will solch einen Schafpelz haben,“ sagte die Frau.
„Den sollst du bekommen,“ erwiderte ihr Mann, während er an einem Knochen nagte. „Wenn wir nicht noch ein anderes Tier finden sollten, dessen Fell weicher und wärmer ist. Denn auch ich will einen Pelz haben... Und dann könnten wir ein Schaffell unter der Decke aufspannen, so daß es nicht in unsere Baumhütte hineinregnen kann. Morgen schlage ich noch einige Schafe tot und schleppe sie hierher.“
„Dann essen wir sie,“ jubelte die Frau.
„Gewiß,“ sagte der Mann. „Jeden Tag essen wir Fleisch. Es ist nur gut, daß wir auf diesen Gedanken gekommen sind; denn die Fische im Fluß haben jetzt Angst vor mir.“
„Nimm dich in acht, daß dir kein Unglück zustößt!“ sagte sie.
„Ich werde schon vorsichtig sein,“ entgegnete er. „Morgen früh gehe ich an den Fluß und sammle[S. 31] mehrere scharfe Steine für den Fall, daß der, den ich habe, mir abhanden kommen sollte.... Weißt du was... ich binde solch einen scharfen Stein mit einer Ranke an das Ende eines langen Zweiges ... verstehst du. Dann kann ich das Schaf treffen und töten, bevor ich ganz zu ihm hinkomme... denn die Tiere fürchten sich natürlich vor mir, wenn sie erfahren, daß ich eins von ihnen getötet habe.“
Während sie so zusammen redeten, versammelten sich alle Tiere des Waldes auf der Wiese — wie in der ersten Nacht nach der Ankunft der neuen Tiere.
„Der Zweifüßler hat das Schaf ermordet!“ schrie der Sperling und eilte mit seiner Neuigkeit weiter, so naß und zerzaust er vom Regen war.
„Der Zweifüßler hat das Schaf ermordet und das Rind und die Ziege!“ schrie die Krähe, indem sie mit den nassen Flügeln schlug.
„Halt!“ rief da das Rind. „Noch bin ich am Leben, wenn ich auch auf das Ärgste gefaßt bin.“
„Der Zweifüßler hat alle Tiere im Walde getötet .... Nun sitzt er mitten auf der Wiese und frißt den Löwen!“ flüsterte das Schilfrohr.
Und alle Tiere stürmten auf die Wiese, um zu erfahren, was vorgefallen war. Mitten in der Versammlung stand der Löwe, den Kopf stolz erhoben:
„Was ist das für ein Spektakel?“
„Darf ich reden?“ rief der Orang-Utan und reckte einen Finger in die Luft. „Ich habe auf[S. 32] dem Palmenbaum gesessen und alles mitangesehen. Es war grauenhaft.“
„Du bist eigentlich ein übler Patron!“ sagte der Löwe. „Du machst deine eigene Familie schlecht.“
„Die Verwandtschaft ist sehr, sehr weitläufig!“ erwiderte der Orang-Utan. „Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ich ausdrücklich alle Verantwortung für diese Zweifüßler abgelehnt habe, die unserer Familie eigentlich nur zur Schande gereichen. — Ich saß also auf dem Baum und sah, wie der Mann herbeigestürzt kam, sich auf das Schaf warf und es erwürgte. Dann schleppte er das arme Geschöpf zu dem Baume, auf dem er wohnt. Ich schlich ihm nach und sah, wie er den Körper des Schafes in Stücke riß. Sein Weib half ihm dabei, und nachher setzten sie sich beide auf ihren Baum und aßen.“
„Ist das alles?“ fragte der Löwe. „Ich habe schon viele Schafe in meinem Leben verspeist, wenn mir Hirschfleisch auch lieber ist! Warum sollte der Zweifüßler sich nicht einen Happen Fleisch nehmen dürfen, wenn er Lust dazu hat?“
„Wenn ich eine Bemerkung einwerfen darf,“ begann nun das Rind, „so möchte ich an das erinnern, was ich gesagt habe, als wir neulich hier versammelt waren. Du hast gut reden, Löwe, denn dir vermag der Zweifüßler nichts anzuhaben. Uns aber frißt er auf. Trotzdem solltest auch du dich in acht nehmen. Er kann dir ein gefährlicher Kon[S. 33]kurrent werden. Wenn er nun viele Kinder bekommt, die alle Schafe auffressen!“
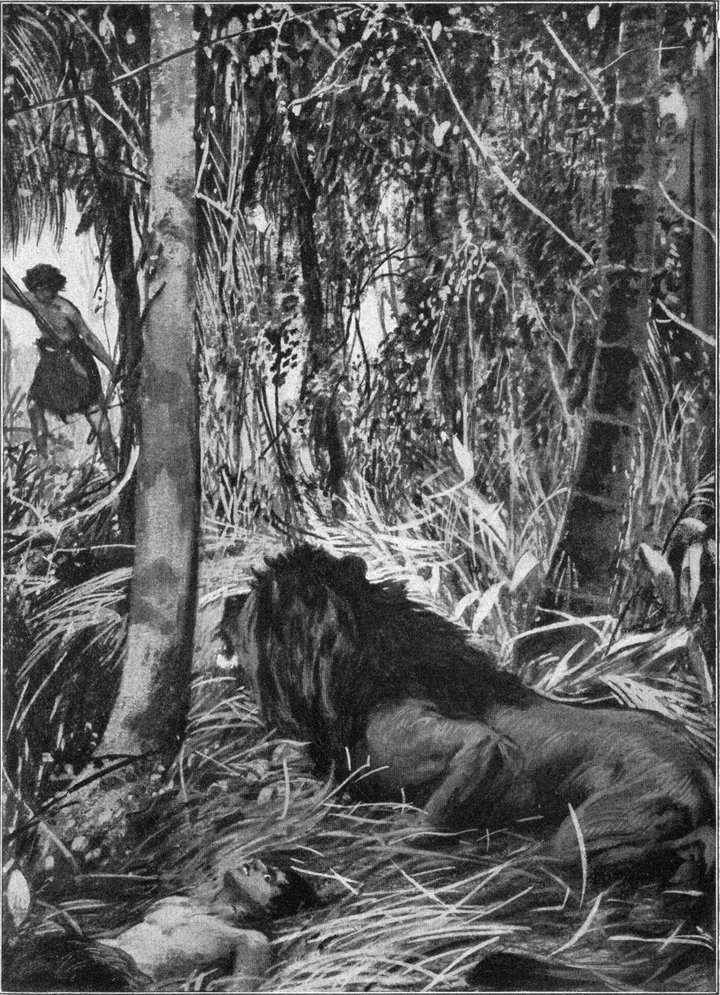
„Die Rinder sind ja immer noch übrig,“ sagte lachend der Löwe, und seine fürchterlichen Zähne glänzten.
„Ganz recht,“ entgegnete das Rind und wich vorsichtig zurück. „Die Reihe kommt sicher auch an die Rinder, nachdem er einmal Blut geleckt hat. Er sieht fürchterlich gefräßig aus. Und ich finde, es sind ohnehin schon genug Leute vorhanden, die mich zu fressen wünschen.“
„Hm!“ brummte der Löwe. „Daran mag ja etwas Wahres sein. Ich liebe nur diese Angstmeierei nicht. Aber laß uns mit dem Burschen reden!“
Er ging, und der Orang-Utan sprang ihm eifrig voraus, unaufhörlich rufend:
„Diesen Weg!... Diesen Weg!“
Und nun stand der Löwe unter dem Baum, auf dem der Zweifüßler wohnte. Alle die andern Tiere des Waldes waren ihnen gefolgt und lauschten und starrten.

„Zweifüßler!“ brüllte der Löwe mit seiner gewaltigen Stimme, die wie Donner klang, so daß alle erschrocken zusammenfuhren. Der Löwe schlug mit dem Schwanze um sich und sah in den Baum hinauf. Kein Laut kam herab. Er rief wieder, aber es antwortete niemand.
„Diese Frechheit!“ zeterte der Orang-Utan.
[S. 34]
„Vielleicht sind sie tot,“ sagte die Nachtigall. „Vielleicht haben sie zu viel von dem Schaf gegessen.“
„Man stirbt nicht von zu viel Essen, nur von zu wenig,“ grunzte das Schwein, das die ganze Zeit über mit dem Rüssel in der Erde wühlte, um einen Bissen zu finden.
Da brüllte der Löwe zum drittenmal, und zwar so heftig, daß ein kleiner Zeisig von seinem Zweig herabfiel — unmittelbar in den Rachen der Schlange, die ihn verschluckte, ohne daß einer von beiden einen Laut von sich gab. Darum erfuhr auch niemand etwas von der Geschichte.

Und nun kam der Zweifüßler oben auf dem Baume zum Vorschein.
Nach der starken Mahlzeit, die er genossen, hatte er fest und ruhig geschlafen; und er war wütend darüber, daß man ihn weckte.
„Wer wagt es, mich im Schlafe zu stören?“ rief er.
„Ich... der Löwe.“
„Der Löwe... der König der Tiere,“ sagten alle ehrerbietig durcheinander.
„In meinem Hause bin ich selber König,“ schrie der Zweifüßler. „Fort mit euch! Ich will schlafen.“
„Er lehnt sich gegen den Löwen auf... er ist von Sinnen... er hat sein Leben verwirkt!“ riefen die Tiere.
Der Zweifüßler aber ergriff den Schenkelknochen des Schafes, zielte gut, schleuderte ihn mit[S. 35] aller Kraft gegen den Löwen und traf ihn mitten auf die Stirn. Der Löwe stieß ein fürchterliches Gebrüll aus, und alle die andern Tiere sprangen erschrocken über die Wiese davon; mitten unter ihnen — mit unaufhörlichem Gebrüll — ihr König.
Der Zweifüßler dagegen legte sich wieder ruhig schlafen und schlief bis zum hellen Morgen.

Als er erwachte und vom Baume hinabstieg, lag der Hund da und nagte an dem Knochen, der den Löwen getroffen hatte. Der Hund wedelte mit dem Schwanze, und der Zweifüßler gab ihm noch einen zweiten Knochen.
„Willst du mein Diener und Freund sein?“ fragte er.
„Ja,“ erwiderte der Hund. „Du bist besser zu mir gewesen als die andern, und du bist stärker und klüger als sie.“
„Gut! Dann sollst du mein Wächter sein, sollst mir auf der Jagd helfen und mir stets Gesellschaft leisten.“
Die Regenperiode war zu Ende, und die Sonne bekam wieder Macht. Und wieder begann die Regenzeit, und so fort in ewigem Wechsel.
Die Zweifüßlerfamilie hatte jetzt eine neue Wohnung, die besser war als die Laubhütte auf der Insel und die Behausung auf dem Apfelbaum. Es[S. 36] war eine Höhle im Felsen, die der Mann eines Tages entdeckt hatte. Sie war kühl in der heißen Zeit und warm in der kalten, bot Schutz vor dem Regen und konnte in der Nacht oder, wenn Gefahr drohte, mit einem Stein verrammelt werden. Diese Höhle polsterte der Zweifüßler mit Fellen aus, verdichtete die Wände mit Moos und saß nun mit seiner Familie und dem Hunde im wohnlichen Heim.

Arbeit hatte er genug, denn die Familie war gewachsen. Er hatte jetzt drei Kinder, die ausgezeichnet gediehen und wie die Scheunendrescher aßen. — Aber er mußte sehr auf der Hut sein seit jener Nacht, in der er den Knochen gegen den Löwen geworfen hatte. Denn er hatte sich den König der Tiere zum Feinde gemacht, und fast alle Tiere des Waldes betrachteten ihn mit dem größten Mißtrauen.
Sie hatten auch wohl Grund dazu, denn der Zweifüßler war ein gewaltiger Jäger geworden, der dem Löwen in nichts nachstand.
In dem inneren Raum der Höhle verwahrte er zwei große Speere, sowie einen kleineren, den schon sein ältester Sohn zu handhaben verstand. Nicht heimtückisch beschlichen sie ihre Beute, wie es der Löwe und die andern jagenden Tiere taten. Der Hund trieb ihnen das Opfer entgegen, und sie warfen den Speer und töteten das Tier.
„Er jagt besser als ich,“ sagte eines Abends der Löwe zu seinem Ehegespons. „Heute hat er[S. 37] mit dem Spieß einen jungen Hirsch erlegt, den ich mir auserkoren hatte.“
„Warum nahmst du ihn denn nicht?“ fragte die Löwin.
„Ich bin durch das Gras auf den Hirsch zu gekrochen. Aber eh’ ich zum Sprunge kam, hatte der Elende ihn schon erlegt. Der Spieß steckte im Halse des Hirsches, und er stürzte tot zu Boden.“
„Warum aber hast du dem Unverschämten die Beute nicht abgenommen?“ fragte sie weiter.
„Er hatte noch einen Speer in der Hand. Und sein Junges hatte auch einen. Ich weiß nicht, welche Bewandtnis es mit diesen Speeren hat. Wer von ihnen getroffen wird, fällt um und stirbt.“
„Du hast also Angst vor dem Zweifüßler,“ rief da die Löwin. „Er ist König im Walde und nicht du! Wenn dein Sohn ebenso feig ist wie du, dann ist es aus mit uns!“
Der Löwe sagte nichts, sondern sah nur mit seinen gelben Augen vor sich hin.
Doch kurz bevor es Tag wurde, schlich er in das Gebüsch vor des Zweifüßlers Höhle und legte sich dort auf die Lauer; geduldig wartete er, bis der Stein beiseite gewälzt würde. Das geschah gleich nach Sonnenaufgang, und der Löwe bereitete sich zum Sprunge. Fast sinnlos vor Wut, sprang er auf den ersten zu, der sich zeigte, schlug ihn mit seiner starken Tatze nieder und trug ihn im Sprunge ins Gebüsch.
[S. 38]
Ein fürchterlicher Schrei rief den Zweifüßler in die Öffnung der Höhle. Da stand er, einen Speer in jeder Hand. Und der Löwe sah, daß er nicht seinen Feind getötet hatte, sondern nur eins seiner Kinder. Er ließ ab von der Leiche und rüstete sich von neuem zum Sprunge. Aber schon hatte ihn der Zweifüßler durch das Laub erspäht. Er warf den einen Speer, ohne zu treffen. Dann schleuderte er den andern, — aber da war der Löwe entflohen.
Laut wehklagend und schluchzend trugen der Zweifüßler und sein Weib ihr totes Kind in die Höhle. Der Löwe jedoch flüchtete durch den Wald, von Angst gejagt. Wohin er kam, überall wichen die Tiere erschrocken vor ihm aus.
„Der Löwe flieht vor dem Zweifüßler,“ meldete der Sperling eilfertig weiter.
Und das Gerücht verbreitete sich schnell durch den Wald und wuchs und wuchs.
„Der Zweifüßler hat den Löwen mit seinem Speer verwundet!“ schrie die Krähe.
„Der Zweifüßler hat den Löwen getötet und ist auf der Jagd nach der Löwin!“ pfiff die Maus.
Und der Löwe sprang in großen Sätzen von dannen.
Er eilte an seiner Höhle vorbei, als wagte er seiner Gemahlin nicht mehr in die Augen zu sehen. Erst spät am Abend kam er nach Hause.
„Bist du noch am Leben?“ spottete die Löwin.[S. 39] „Der ganze Wald hält dich für tot. Und der Zweifüßler?“
„Ich habe eins von seinen Jungen getötet,“ sagte der Löwe zornig.
„Und was hilft das?“ fragte sie.
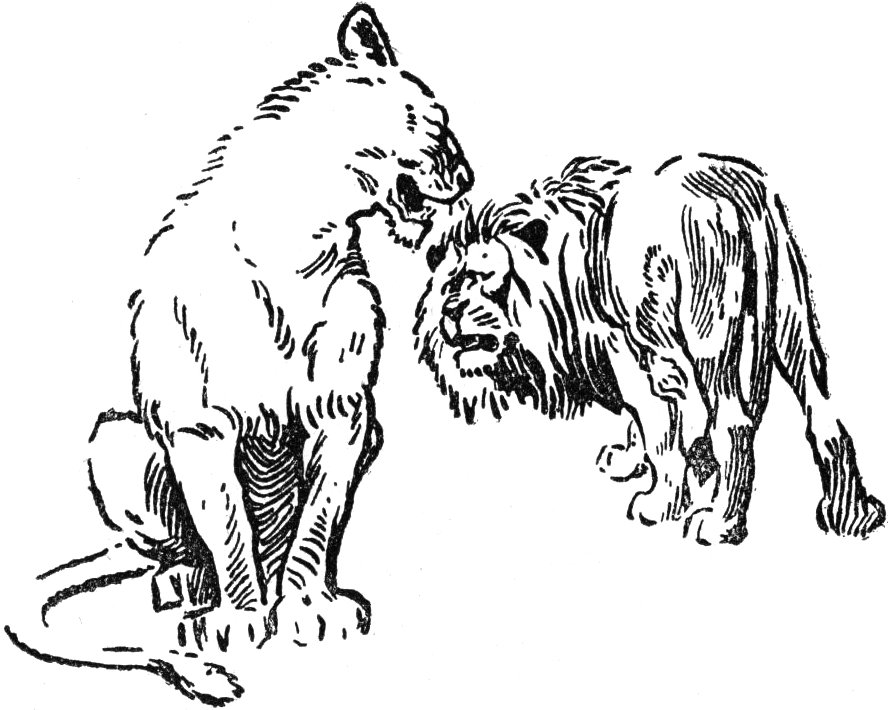
Da gab er ihr eine Backpfeife, wie sie sie noch nie bekommen hatte; und dann legte er sich hin und starrte mit seinen gelben Augen in die Luft.
Aber die Tiere im Walde hörten nicht auf, zu staunen und zu flüstern.
„Der Löwe hat Angst... Der Löwe flieht vor dem Zweifüßler...“
„Hab’ ich es nicht gleich gesagt?“ meinte das Rind. „Wir hätten sie auf der Stelle töten sollen.“
[S. 40]
„Ach ja!“ seufzte das Pferd. „Hätte der Löwe doch unsern Rat befolgt!“
„Ach ja!“ schrien Ente, Gans und Huhn.
Nur der Orang-Utan ging abseits in den Wald hinein und dachte nach.
„Der Vetter ist doch nicht so töricht, wie ich gedacht habe!“ sagte er zu sich selbst. „Ich weiß eigentlich nicht, warum ich nicht hingehen und es ihm nachmachen soll! Ich bin ihm ja ähnlich und habe sogar mancherlei vor ihm voraus, so daß ich mich mindestens ebensogut durchfinden müßte.“

Und der Orang-Utan nahm einen Stecken und versuchte, aufrecht wie der Zweifüßler zu gehen. Es glückte ihm auch, und so ging er denn auf die anderen Tiere los. Er hob den Stecken und schrie und machte greuliche Augen. Aber die Tiere scharten sich um ihn und lachten ihn aus. Der Fuchs schnappte ihm den Stecken aus der Hand, der Hirsch stieß ihn mit seinem Geweih in den Rücken, der Sperling erkor sich seinen Kopf für seine Schandtaten, und es kam eine so fröhliche Stimmung unter den Tieren auf, daß der Orang-Utan davonlief und sich im dichtesten Gebüsch versteckte.
Doch am nächsten Morgen hatten die Tiere an andere Dinge zu denken.
Sie sahen, wie der Zweifüßler den Leichnam seines Sohnes in den Wald trug und einen hohen Haufen von Steinen darauflegte. Sein Weib aber[S. 41] pflückte die schönsten Blumen und legte sie auf die Steine.
„Hat man je so etwas gesehen!“ rief die Nachtigall. „Wenn unsereiner stirbt, bleibt man liegen, wo man umfällt, oder wohin man sich geschleppt hat. Von dem Jungen des Zweifüßlers aber soll ein Aufhebens gemacht werden, wie zu ewigem Gedächtnis. Ich weiß nicht einmal, wo meine lebendigen Kinder vom vorigen Jahre geblieben sind, geschweige denn das arme Wesen, das aus dem Nest hinausfiel und den Hals brach.“
„Gebt nur acht! Es kommt noch schlimmer!“ sagte das Rind.
Und so war es. Eine Woche später ereignete sich etwas, das die Tiere des Waldes noch mehr aufbrachte als alles, was bisher geschehen war.
Frau Zweifüßler sah einen prächtigen Paradiesvogel auf einem Baum sitzen.
„Wie wunderschön sind diese Federn!“ rief sie. „Wer die hätte, könnte seinen Kopf damit schmücken.“
Und der Zweifüßler, der sie über den Verlust des Kindes trösten wollte, ging sofort mit seinem Speer hin und kehrte nach einer Weile mit dem toten Paradiesvogel zurück. Sein Weib rupfte die Federn aus und steckte sie ins Haar. Und beide freuten sich über den prächtigen Schmuck.
„Das ist denn doch zu toll!“ rief erbittert die Nachtigall. „Er tötet einen Vogel, bloß um[S. 42] seine Frau mit den Federn auszustaffieren. Da muß man ja froh sein, wenn man grau und häßlich ist.“

Gefolgt von einem großen Schwarm, trat die Paradiesvogelwitwe vor den Löwen, um Klage zu führen:
„Die neuen Tiere haben meinen Mann getötet, und nun sitze ich da als Witwe mit vier kalten Eiern. Wäre ich auf ihnen liegen geblieben, so hätte ich verhungern müssen, da mein Versorger ermordet ist. Da ging ich fort, um mir etwas zu essen zu verschaffen. Und als ich nach Hause kam, da waren die Eier kalt und tot. — Hier steh’ ich und fordere Rache und Bestrafung des Mörders!“
„Was soll man dazu sagen?“ entgegnete ihr der Löwe. „Es gibt ja so viele Witwen im Walde. Ich selbst frage auch nicht, ob das Tier, das ich töte, wenn ich hungrig bin, zu Hause Frau und Kinder hat.“
„Der Zweifüßler hat es nicht getan, weil er hungrig war,“ sagte der Paradiesvogel. „Er wollte seiner Frau nur einen Haarschmuck verschaffen.“
„Was soll er anfangen, wenn seine Frau es verlangt?“ erwiderte der Löwe. „Er wird nicht in Unfrieden mit ihr geraten wollen.“
Einige von den Tieren lachten. Die meisten aber schüttelten die Köpfe und meinten, es sei ein schlechter Witz, der sich für den König der Tiere nicht schicke.
In den nächsten Tagen sprachen die Tiere des[S. 43] Waldes von nichts anderem als vom Zweifüßler. Jeder einzige hatte Klage über ihn zu führen.
„Neulich hat er mir mein ganzes Nest mit siebzehn frisch gelegten Eiern weggenommen,“ sagte das Huhn.
„Aus dem Flusse sind alle Fische verschwunden,“ jammerte der Fischotter. „Und Prügel bekommt man noch obendrein.“
„Man kann nicht mehr im Frieden auf der Wiese äsen,“ klagte der Hirsch.
„Niemand schützt uns,“ blökte das Schaf traurig.
Während aber Sorge und Angst unter den großen und vornehmen Tieren herrschte, waren die kleinen und niedrigen guter Laune, ja sie machten sich geradezu lustig über die Furcht der großen.
„Was geht das alles uns an?“ rief die Fliege. „Mögen die Großen einander auffressen, soviel sie mögen. Ich für meinen Teil kann den Zweifüßler besser leiden als die Nachtigall.“
„Niemand ist mehr sicher,“ summte die Biene. „Gestern hat er mir meinen Honig geraubt.“
„Ja,“ fiel der Regenwurm ein. „Und vorgestern hat er meinen leiblichen Bruder genommen und auf einen Angelhaken gesteckt; und dann hat er einen Barsch damit gefangen.“
[S. 44]
Der Zweifüßler saß vor seiner Höhle und sann nach. Zu seinen Füßen lag der Hund und schlief. Im Innern war Frau Zweifüßler damit beschäftigt, das Frühstück zu bereiten.
Der Zweifüßler war schlecht gelaunt, denn er hatte Pech auf der Jagd gehabt.

Am vergangenen Tage hatte er den Wald durchstreift, ohne auf das geringste Wild zu stoßen; und am Morgen war es ihm nicht besser ergangen.
Die Tiere hatten zu große Angst vor ihm bekommen. Sie flohen schon, wenn sie ihren Feind mit seinem Speer von fern erblickten. Sie kannten jetzt die Zeiten, zu denen er jagte, und hielten sich vor ihm verborgen. Oder sie stellten Wachtposten aus, die laute Warnungsrufe ausstießen, wenn der Zweifüßler oder der Hund in der Nähe war. Bei der Höhle war weder Hirsch noch Rind noch Schaf noch Ziege mehr zu finden. Selten weidete eins der Tiere auf der Wiese. Sie alle hielten sich im dichtesten Walde verborgen, wo der Zweifüßler nicht durchdringen konnte. Er liebte es auch nicht sehr, dort zu jagen, weil er fürchtete, der Löwe könne im Hinterhalt liegen.
„Es geht uns nicht gut, Treu,“ sagte er zum Hunde. „Wir werden etwas Neues ausfindig machen müssen.“
[S. 45]
Und er begann, seine Messer und Äxte zu schärfen, die er aus Flintstein angefertigt hatte; und dann kam Frau Zweifüßler mit dem Frühstück, das aus nichts anderem als Äpfeln und Nüssen bestand. Nicht einmal Fische gab es mehr auf des Zweifüßlers Tafel. Denn die Fische verschwanden, sobald sie sein Spiegelbild im Wasser sahen.
„Halt!“ rief der Zweifüßler plötzlich. „Wäre es nicht viel einfacher, wenn ich zwei Schafe finge, und wir sie hier bei uns in der Höhle hätten. Dann bekämen sie Lämmer, die wir schlachten könnten; und ich brauchte nicht ewig auf die Jagd zu gehen.“
Seine Frau fand die Idee sehr gut; und während sie sich beide darüber unterhielten, besserte sich seine Laune zusehends. Er flocht einen langen Strick aus Ranken und machte sich mit seinem Speer, dem Hund und zweien seiner Söhne auf den Weg.

Lange schlich er am Waldrande umher, bis er ein Schaf erspähte, das mit zwei Lämmern auf der Wiese weidete. Auf allen Vieren kroch er auf sie zu, während Treu den Befehl erhielt, ganz still zu sein. Als er nahe genug war, warf er die Schlinge aus und zwar so geschickt, daß sie gerade um den Hals des Schafes fiel. Es blökte gottsjämmerlich, aber die Schlinge hielt fest und zog sich zusammen. Froh zog der Zweifüßler mit dem Tiere von dannen, und die kleinen Lämmer folgten, weil sie nicht wußten, was sie sonst anfangen sollten.
Als er nach Hause kam, band er das Schaf[S. 46] an einen Baum vor der Höhle. Das eine Lamm wurde geschlachtet und von der Familie gegessen, das andere ließ man am Leben. Die Kinder liefen auf die Wiese hinab und holten einen Armvoll Gras nach dem andern; und das Schaf fraß und gab seinem Lämmchen zu trinken.
„Willst du auch mich fressen?“ fragte es, als der Zweifüßler am Abend mit seiner Familie vor der Höhle saß und sich seines Werkes freute.
„Nein,“ sagte er. „Das will ich nicht. Ich will dich bei mir behalten, und du sollst mein Diener sein wie der Hund. Morgen geh’ ich aus und fange auch deinen Mann. Dann sollt ihr mir noch viele Lämmer zur Welt bringen; einige davon werden wir essen, und einige werden wir uns aufsparen, wie es gerade paßt.“
„Du hast meine Schwester getötet und ihr das Fell abgezogen!“ klagte das Schaf.
„So dumm bin ich nun nicht mehr,“ erwiderte der Zweifüßler. „Du wirst ja sehen.“
Frau Zweifüßler kam mit einem Messer herbei, und nun schnitten sie dem alten Schafe die Wolle ab. Es wehrte sich und schrie, aber der Zweifüßler hielt fest; und da es angebunden war, half dem Tiere all sein Gejammer nichts.
„Wenn die Regenzeit kommt, wird mich bitterlich frieren,“ schrie das Schaf.
„Wenn es kalt wird,“ entgegnete der Zweifüßler, „nehme ich dich in meine Höhle. Deine[S. 47] Wolle brauche ich, um uns Kleider daraus zu machen. Es hat keinen Zweck, daß du dich zur Wehr setzest. Wenn du brav und gehorsam bist, sollst du es so gut bei mir haben, wie du es noch nie gehabt hast.“
In der Nacht, während der Zweifüßler schlief, stand das Schaf da und dachte nach. Da tauchte aus dem Gebüsch der Kopf des Rindes auf, und kurz darauf war auch der Hirsch zur Stelle und das Pferd und die Ziege und viele von den andern Tieren.

„Worauf ist unser Feind denn nun verfallen?“ fragte das Rind. „Der Sperling erzählt, daß der Zweifüßler dich angebunden und dir die Wolle abgeschoren habe.“
„Der Sperling hat weiß Gott die Wahrheit gesagt!“ antwortete das Schaf. „Sieh doch nur, wie nackend ich bin! Mein Lämmchen hat er aufgegessen, und morgen will er auch noch meinen Mann fangen. Allerdings hat er mir Gras gepflückt, so daß ich mich sattgefressen habe.“
„Grauenhaft!“ rief das Rind aus. „Aber wir haben ja eigentlich nichts anderes erwartet. Kannst du dich nicht losreißen?“
„Ich habe es versucht,“ erzählte das Schaf. „Aber es geht nicht. Je mehr ich zerre, desto fester zieht sich die Schlinge um meinen Hals zusammen. Ich bin gefangen und bleibe gefangen.“
„Knechtschaft ist schlimmer als der Tod,“ sagte[S. 48] der Wolf. „Ich will deinem zweiten Lamm den Dienst erweisen, es zu fressen.“
Im Nu hatte er sich auf das Lamm gestürzt und ihm den Hals durchgebissen. Das Schaf schrie, der Zweifüßler erwachte und lief hinaus, und alle Tiere eilten fort.
„Du hast wohl geschlafen, Treu,“ sagte er. „Morgen müssen wir dem Unglück abzuhelfen suchen. Das fehlte gerade, daß ich für den Wolf Schafe einfangen und sie für ihn mästen sollte.“
Und am nächsten Morgen fand er einen Ausweg.
Er und seine Söhne gingen in den Wald, fällten mit ihren Äxten Bäume und machten spitze Pfähle daraus; und als sie eine Anzahl beisammen hatten, rammten sie sie im Kreise vor der Hütte in den Boden. Dann flochten sie Zweige zwischen die Pfähle; und als die Sonne sank, da stand ein fester, starker Pferch fertig da, über den kein Wolf hinwegspringen konnte. In diesen Pferch sperrten sie das Schaf.
Zwei Tage später fing der Zweifüßler in seiner Schlinge den Widder. Er fuhr fort zu jagen, und binnen kurzem war auch die Kuh gefangen und der Stier und das Kalb. Der Pferch wurde zu klein, so daß ein größerer gebaut werden mußte. Die ganze Familie lief hinaus, um Gras zu holen, und konnte doch nie genug herbeischaffen. Die Tiere in der Hürde brüllten.
In der Nacht unterhielten sie sich.
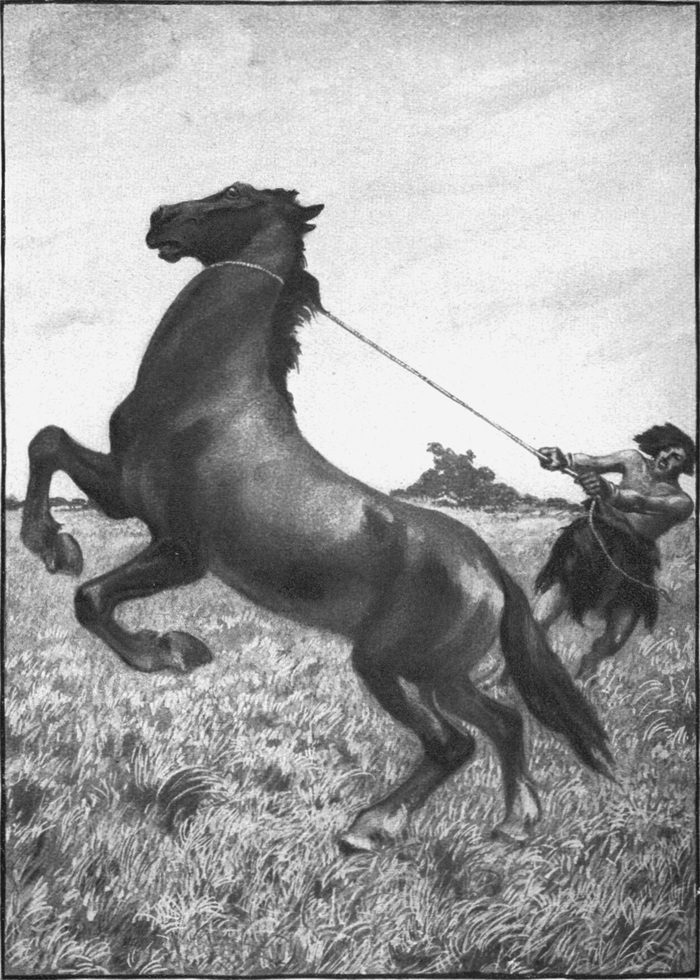
Das Schaf meinte: „Wißt ihr — offen ge[S. 49]standen: Das Leben hier hat eigentlich doch seine Vorzüge. Da draußen auf der Wiese schwebte man ja in beständiger Gefahr — vor dem Löwen und dem Wolf, vor der Schlange und dem Adler, von dem Zweifüßler selber ganz zu geschweigen.“
„Das mag alles sein,“ sagte die Kuh. „Aber ich kann die Art nicht leiden, wie die Frau Zweifüßler an meinem Euter zieht. Und ich fürchte, sie werden mich eines schönen Tages schlachten wie die andern Tiere. Es sind unser auch bald zu viele hier drinnen.“
Dem Zweifüßler wurde es immer schwerer, Gras für die vielen Tiere zu beschaffen, die er in seinem Pferch hatte.
Er und seine Familie hatten schon längst alles abgeschnitten, was in der Nähe der Höhle wuchs. Nun mußten sie ziemlich weit gehen, wenn sie etwas finden wollten; und es machte viel Mühe, es nach Hause zu schaffen.
„Wir werden umziehen müssen,“ sagte er zu seiner Frau. „Da das Gras nicht zu uns kommen will, müssen wir zum Grase gehen. Wir wollen wieder auf die Wiese hinunter. Webe du uns ein Zelt von der Wolle; dann sammeln wir alle Felle, die wir haben, stecken Pfähle in die Erde und hängen sie darüber. So kommen wir wohl zurecht.[S. 50] Und die Tiere können vor dem Zelt auf die Weide gehen.“
„Aber wenn sie dann alles Gras gefressen haben?“ fragte die Frau.
„Dann ziehen wir zur nächsten Wiese,“ sagte der Zweifüßler. „Wir packen das Zelt zusammen, laden es auf den Rücken des Rindes und ziehen weiter.“
„Wenn uns die Tiere nur nicht fortlaufen!“
„Treu muß mir helfen, sie zu hüten, — und auch unsere Jungen. Dann wird es schon gehen. Sie kennen uns ja nun und finden sich darein, wenn wir sie streicheln. Du sollst sehen, bald sind sie ganz zahm.“
Am nächsten Morgen brachen die Zweifüßler den Pferch ab.
„Ob er uns loslassen will?“ sagte die Kuh.
„Ich will nicht wieder auf die Wiese hinab,“ blökte das Schaf und fing an zu weinen. „Meine Beine sind steifer, als sie früher waren; und ich kann nicht mehr so gut laufen. Ich sehe auch nicht mehr so gut und kann fast gar nicht mehr riechen. Meine Sinne sind ja so lange nicht benutzt worden. Ich will beim Zweifüßler bleiben und mein Futter aus seiner Hand nehmen.“
„Du bist eben ein Sklave geworden,“ sagte das Rind. „Und du verdienst es nicht, in Freiheit zu sein. Wenn ich Gelegenheit finde, nehme ich[S. 51] Reißaus. Gestern hat er mein Kalb geschlachtet, das vergesse ich ihm nie.“
„Nun ja, mag ein Junges oder zwei daraufgehen, und mag man auch selber ins Gras beißen — was könnte man denn sonst auch erwarten!“ blökte das Schaf.
„Sklavenseele!“ murmelte verächtlich das Rind.
Der Zweifüßler hatte inzwischen den Pferch abgebrochen, während seine Frau alle Sachen zusammengepackt hatte. Dem Rinde wurde aufgeladen, soviel es tragen konnte. Dann nahmen die Zweifüßler selber den Rest und begaben sich auf die Wanderung nach der Wiese.
„Nun wird meine Ahnung sich erfüllen,“ sagte die Kuh, die unter ihrer ungewohnten Bürde stöhnte. „Ich bin todmüde in den Lenden und Beinen.“
Und als der Zug dahin kam, wo die Wiese anfing, da warf die Kuh auf einmal ihre Last ab und galoppierte davon, gefolgt von dem Bullen. Treu eilte ihnen zwar nach, aber sie machten Kehrt und wiesen ihm ihre Hörner, so daß er den Schwanz zwischen die Beine nahm. Der Zweifüßler warf ihnen seinen Speer nach, doch der verfehlte sein Ziel.
„Kommt Zeit, kommt Rat!“ sagte er. „Morgen geh’ ich aus und fange sie wieder ein. Nun wollen wir das Zelt aufschlagen und unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen.“
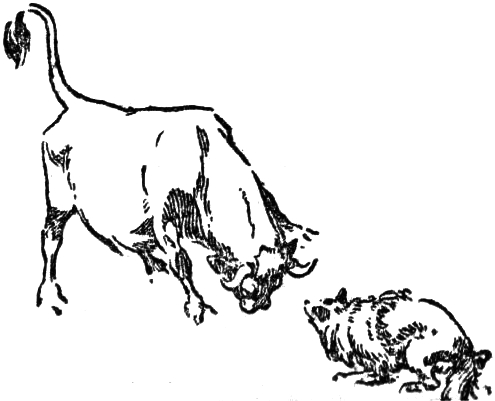
Sie errichteten das Zelt auf einer kleinen An[S. 52]höhe, von der sie die Wiese weit überblicken konnten. Am Fuße des Hügels rann eine Quelle. Treu trieb das Schaf auf die Wiese und wieder heimwärts. Der Zweifüßler fing das Huhn, die Gans und die Ente ein und stutzte ihnen die Flügel, so daß sie nicht fortfliegen konnten. So bekam er allmählich viele Schafe und Ziegen und viel Federvieh zusammen. Und als die Tiere diese Stelle abgegrast hatten, brach er das Zelt ab und errichtete es auf einer andern Wiese — und so fort. Es hatte den Anschein, als habe er die Kuh ganz vergessen, aber eines Tages erinnerte seine Frau ihn daran.
„Du mußt sehen, mir die Kuh wieder herzuschaffen,“ sagte sie. „Ich vermisse ihre Milch so sehr. Und ich und die Kinder brauchen neue Sandalen aus Kalbsleder.“
Da nahm der Zweifüßler seinen Speer, hängte seine Schlingen um und machte sich auf, um die Kuh zu finden. Als er eine Weile gegangen war, sah er sie in der Ferne. Aber sie hatte auch ihn schon erblickt und galoppierte weiter. Das Pferd, das nicht weit davon stand, sah den Zweifüßler spöttisch an und sagte:
„Du hättest wohl gerne meine vier flinken Beine.“
„Gewiß,“ räumte der Zweifüßler ein.
„Wie schön, daß es etwas gibt, das dir fehlt,“ höhnte das Pferd. „Du spielst dich ja sowieso schon als Herrn des Waldes auf.“
[S. 53]
Darauf antwortete der Zweifüßler nicht, hielt aber in aller Stille die Schlinge bereit. Und plötzlich warf er sie dem Pferde über den Kopf. Das Tier bäumte sich und sprang mit wilden Augen umher. Aber bei jedem Sprunge zog die Schlinge sich fester zu, und der Zweifüßler ließ das Seil nicht los, obwohl er eine Zeitlang über den Erdboden geschleift wurde. Er hatte das Seil so fest um seine Hand gewickelt, daß es ins Fleisch einschnitt und die Hand zu bluten anfing.
Schließlich ermattete das Pferd. An allen Gliedern zitternd, stand es still. Der Schaum floß ihm aus dem Maule.
„Was willst du von mir?“ rief es. „Mein Fleisch und meine Milch munden nicht; und ich habe auch keine Wolle, die du mir abscheren könntest.“
„Ich will mir deine vier Beine leihen,“ sagte der Zweifüßler. „Du hast dich ihrer ja selber gerühmt. Hoho! Steh’ nur still!... Wenn du hübsch folgsam bist, werd’ ich dir nichts tun!“

Mit diesen Worten wickelte er das Seil um seinen Arm, kam näher und näher, streichelte das mit Schweiß bedeckte Tier, packte plötzlich seine Mähne und schwang sich auf den Rücken des Tiers. Es bäumte sich, warf die Hinterbeine hoch in die Luft und versuchte, sich seines Reiters auf jede Weise zu entledigen. Der Zweifüßler aber hielt die Mähne und das Seil mit den Händen, preßte die Beine fest an den Leib des Tieres und blieb sitzen,[S. 54] soviel Mühe es auch kostete. Allmählich wurde das Pferd wieder ruhiger, und der Zweifüßler klopfte seinen Hals.
„Nun holen wir die Kuh!“
Er drückte die Fersen in die Flanken des Pferdes und gab ihm einen Hieb. In sausendem Galopp ging’s über die Wiese hin. Die Kuh machte nicht einmal den Versuch fortzulaufen, sondern blieb stehen und starrte sprachlos das seltsame Bild an, das sich ihr darbot. Bevor sie zur Besinnung kam, hatte sie die Schlinge um den Hals, und stolz ritt der Zweifüßler mit seiner Beute nach Hause.
Als sie das Zelt erreichten, sprang er vom Pferde, streichelte es und dankte ihm. Aber er machte keine Miene, ihm die Schlinge vom Halse zu nehmen.
„Gibst du mich nicht frei?“ fragte das Pferd.
„Nein,“ sagte der Zweifüßler. „Aber ich gebe dir etwas viel Besseres. Du sollst von der Quelle trinken und das saftigste Gras bekommen, das du je gekostet hast. Dann sollst du dich hinlegen und ausruhen und daran denken, daß du jetzt in meinen Diensten stehst und für den Rest deiner Tage sorgenfrei leben kannst, wenn du nur treu und willig bist und die Arbeit tun willst, die ich dir auferlege.“
Und dann fütterte er das Pferd und band es an die Zelttür. Dicht dabei stand die Kuh an ihrem Pflock.
„Sollen wir versuchen, uns loszureißen?[S. 55]“ flüsterte das Pferd, als es Nacht wurde und der Zweifüßler schlief.
„Nein,“ sagte die Kuh und schüttelte den Kopf. „Ich laufe nicht mehr fort. Mag kommen, was will! Es war ein grauenhafter Anblick, ihn auf deinem Rücken zu sehen. Er ist unser Herr, und niemand kann ihm widerstehen.“
Der Sperling aber flog auf flinken Flügeln durch den Wald.
„Der Zweifüßler hat das Pferd eingefangen... Er sitzt rittlings auf seinem Rücken... und hat es an sein Zelt gebunden... Das Pferd ist des Zweifüßlers Diener geworden.“
„Hast du’s gehört?“ fragte die Löwin ihren Mann. „Willst du ihn auch auf deinem Rücken reiten lassen, wenn er jagt?“
Der Löwe brummte drohend und rief:
„Laß ihn nur kommen!“
„Er wird sich in acht nehmen!“ erwiderte die Löwin höhnisch. „Und du gehst ihm aus dem Wege, feig, wie du bist.“
Da legte der Löwe den Kopf auf seine Pfoten und sagte nichts, sondern brütete nur in schweren Gedanken.
Der Zweifüßler zog mit seiner Herde von Wiese zu Wiese.
[S. 56]
Sie wuchs Jahr für Jahr, ebenso die Familie. Frau Zweifüßler hatte ihrem Manne jetzt sieben Söhne und sieben Töchter geboren, die alle gut gediehen und im Haushalt und bei der Herde halfen.
Und die Tiere gewöhnten sich daran, im Dienste des Zweifüßlers zu stehen, und waren zufrieden und guter Dinge.
Das Pferd trug den Zweifüßler, wenn er auf der Jagd war, oder ging Schritt für Schritt neben ihm, wenn er das Zelt abbrach und zu neuen Weideplätzen wanderte. Es kam herbei, wenn er rief; und weder das Pferd noch eins der andern Tiere dachte im Ernste daran, fortzulaufen, so daß es für Treu nicht schwer war, sie zu hüten.
Allerdings kam es ja vor, daß die Freiheitslust in ihnen erwachte. Besonders wenn sie ins Gespräch mit den wilden Tieren kamen. Aber die Lust verging ihnen wieder.
Eines Nachts in der Regenzeit kam der Hirsch zu dem Zelt, das der Zweifüßler zum Schutz für seine Tiere errichtet hatte.
„Ihr seid in guter Hut,“ sagte der Hirsch und schaute mißgünstig zu ihnen hinüber.
„Freilich!“ erwiderte das Schaf. „Es ist gemütlicher als in alten Tagen, wo man unter einem Baum stand und trotzdem plätschnaß wurde.“
„Das stimmt!“ sagte das Rind. „Und auch in der trockenen Zeit ist es recht angenehm, weil der Zweifüßler uns gutes Futter gibt, das er für uns[S. 57] gesammelt hat, während wir früher das Land nach einem Grashalm durchsuchen mußten.“
„Ich meinte im Gegenteil, ihr selbst müßtet euch abrackern,“ entgegnete der Hirsch. „Ich habe es ja mit angesehen, wie ihr für euern Herrn arbeiten und schuften müßt.“
„Man bekommt in diesem Leben nichts ohne Gegenleistung,“ erklärte darauf das Pferd. „Übrigens leugne ich gar nicht, daß meine Ahnungen in Erfüllung gegangen sind. Meine Lenden tun mir gehörig weh von der Arbeit des heutigen Tages.“
„Mir geht es nicht anders,“ fiel die Kuh ein. Und die Ente, die Gans und das Huhn stimmten gleichfalls mit ein. Nur das Schaf schüttelte den dicken Kopf, während es munter wiederkäute.
„Ich weiß nicht mehr, was ich geahnt habe,“ blökte es zufrieden. „Mir geht es gut, und damit basta.“
„Murrt ihr?“ rief Treu auf einmal dazwischen, der auf der Wacht lag und immer nur mit einem Auge schlief. „Soll ich unsern Herrn rufen?“
Da sprang der Hirsch erschrocken von dannen, und das Pferd sagte:
„Nein, das sollst du nicht. Er hat selber tüchtig gearbeitet und ist ebenso müde wie wir. Es wäre unrecht, ihn zu wecken.“
Und nun wurde es still in dem Zelt der Tiere.
Aber der Zweifüßler drinnen in seinem eigenen Zelt schlief nicht.
[S. 58]
Er saß da und dachte nach, und auch seine Frau konnte nicht einschlafen, denn sie hatte dieselben Gedanken wie ihr Mann.
„Ich hab’ es satt, im Lande umherzurennen,“ sagte er schließlich. „Wir sind nicht mehr jung, die Familie ist groß, und manchmal bin ich recht müde von der Arbeit.“
„Und ich nicht minder,“ setzte die Frau hinzu. „Aber daran läßt sich ja nun einmal nichts ändern. Wir müssen eben umherziehen, damit die Tiere Gras finden.“
Der Zweifüßler antwortete ihr nicht gleich.
Er stand auf und ging in den Regen hinaus, sah nach seinen Tieren und kam dann wieder ins Zelt zurück. Draußen brüllte der Löwe.
„Hast du ihn gehört?“ fragte sie.
Der Zweifüßler nickte.
Nach einer Weile begann er: „Du, woher kommt das Gras?“
„Das weißt du wohl ebensogut wie ich,“ erwiderte sie. „Wir haben ja oft darüber geredet, wie es seine Samen niederrieseln läßt, und wie sie zwischen dem alten welken Grase keimen, wenn der Regen kommt.“
„Ganz recht! Und warum sollten wir nicht die Samen sammeln und selber säen? Wenn wir nun all das alte Gras beseitigten und die Samen von der Sorte nähmen, die unsere Tiere am besten leiden können, dann müssen wir es doch so weit[S. 59] bringen können, daß das Gras viel dichter wächst. Und dann können wir Samen ernten und wieder säen und Jahr auf Jahr an derselben Stelle wohnen bleiben.“
„Ja, wenn wir das könnten!“ sagte Frau Zweifüßler und schlug die Hände zusammen.
„Warum sollten wir nicht? Und können wir das erst, so können wir auch ein starkes Haus — für uns und die Tiere — bauen. Ich bin überzeugt, wir können mit unsern Steinäxten die größten Bäume fällen, wenn wir nur geduldig aushalten. Sobald der Regen aufhört, mach’ ich mich auf, um eine Stelle zu finden, wo wir uns für den Rest unserer Tage niederlassen können.“
Nach einer Woche war der Himmel wieder klar. Der Zweifüßler sprang aufs Pferd, verabschiedete sich von seiner Familie und sagte, er wolle erst wieder nach Hause zurückkehren, wenn er gefunden habe, was er suche. Und wirklich kam er erst am Abend des dritten Tages heim und befahl, früh am nächsten Morgen alles zusammenzupacken und ihm zu folgen.
Als die Familie am Ziele ankam, mußten alle zugeben, daß er eine gute Wahl getroffen habe.
Der Boden war gut und verhieß reichen Ertrag: so frisch und üppig wuchs alles darauf. Auf der einen Seite eines großen, offenen Feldes lag Wald, auf der andern eine Wiese, die wieder von einem großen See begrenzt wurde, in dem die Fische[S. 60] lustig umhersprangen. Hinter dem See waren ferne blaue Berge, die einen schönen Anblick darboten und zu herrlichen Träumen anregten. Dicht am Waldessaume lag eine Anhöhe, an deren Fuß ein Bach rann. Der Bach mündete in den Fluß, der sich durch die Wiese dahinschlängelte, und der Fluß mündete in den See.
Und Feld und Wiese waren mit allen möglichen Gräsern und Blumen angefüllt.
Da war Mohn, groß und wunderschön rot. Da waren Glockenblumen und Möhren, Winden und Kornblumen, Disteln, Ampfer, Veilchen und noch viele, viele andre Blumen. Und sie alle wuchsen und breiteten sich aus, wie sie Lust hatten, denn sie waren ja die Herren im Lande.
„Hier wollen wir wohnen,“ sagte der Zweifüßler. „Auf der Anhöhe dort wollen wir ein großes, starkes Haus bauen mit Ställen für die Tiere und einem Pfahlwall zum Schutz gegen die, die uns übelgesinnt sind. Laßt uns sofort beginnen! Wenn das Haus erst steht, sollt ihr euer Wunder erleben!“
Und er und die Söhne machten sich daran, Bäume zu fällen.
Geduldig mühten sie sich Tag um Tag; aber viele Schläge ihrer Steinäxte waren nötig, bis die großen Bäume sich ergaben. Ein entsetzliches Rauschen ging von Stamm zu Stamm tief in den Wald hinein.
„Was ist das... was will er mit uns...[S. 61] warum sollen wir sterben?“ flüsterte ein Baum dem andern zu.
Aber der Zweifüßler und seine Söhne hörten nichts und sagten nichts. Sie arbeiteten und arbeiteten, bis sie hatten, was sie brauchten. Dann errichteten sie auf der Anhöhe ein starkes Haus aus gutem Holze — und noch zwei, drei Gebäude bauten sie, Ställe für die Tiere und einen großen Raum, mit dem der Zweifüßler seine bestimmten Absichten verfolgte, ohne darüber sprechen zu wollen.
Mit Moos wurden alle Ritzen und Spalten verstopft. Und um das ganze Gehöft herum errichteten der Zweifüßler und seine Söhne ein Pfahlwerk, das sie mit Zweigen durchflochten, so daß es eine starke Mauer wurde, die Schutz gegen die Feinde bot.
Und als das alles fertig war, da bat der Zweifüßler seine Frau, einen Sack aus Fellen für ihn zu nähen und einen für jeden von der Familie. Dann gingen alle auf Feld und Wiese hinaus und sammelten in den Säcken allerlei Arten Gräser, die sie säen wollten.
„Willst du nicht auch ein paar von meinen Samen nehmen?“ fragte der Mohn und warf seine roten Blätter ab... „Ich habe tausend in meinem Kopfe, und ich bin der Schönste im Lande.“
„Mag sein, mag sein!“ sagte der Zweifüßler. „Aber ich habe keine Verwendung für dich.“
„Du bist an mir vorbeigegangen,“ flüsterte das Veilchen bescheiden.
[S. 62]
„Du bist zwar reizend,“ erwiderte der Zweifüßler, „aber du kannst mir nichts nützen.“
„Und mich vergißt du ganz,“ schrie die Distel. „Obwohl ich die Stolzeste und Stärkste hier bin.“
„Aber die Zäheste bin doch wohl ich!“ rief die Klette.
„Gebt acht, daß ihr diese Samen nicht nehmt,“ sagte der Zweifüßler zu seiner Familie. „Unsre Tiere fressen sie nicht.“
Mit gefüllten Säcken kehrten sie heim; und wieder zogen sie aus und kehrten heim und zogen aus, bis sie einen gewaltigen Haufen gesammelt hatten.
„Nun wollen wir den Boden bestellen,“ sagte der Zweifüßler. „Komm, liebes Pferd, und leih mir deine Kräfte, wie du es früher getan hast!“

Er verfertigte einen Pflug, spannte das Pferd davor und trieb es übers Feld, Schritt für Schritt und Furche für Furche. Mit Freude sah er die Erde unter dem scharfen Steinmesser des Pfluges sich wenden.
„Was ist denn das?“ schrie der Mohn, und im nächsten Augenblick war er umgepflügt.
„Es hilft dir doch nichts!“ rief die Distel boshaft dem Zweifüßler zu. „Unsre Samen kommen trotzdem an die Oberfläche, um dich zu ärgern.“
„Das wollen wir erst mal sehen!“
Und dann ließ der Zweifüßler jeden von seiner Familie eine Distel abschneiden und forttragen. Als[S. 63] er so viel gepflügt hatte, wie ihm gut dünkte, säte er die eingesammelten Grassamen in die frische Erde hinein.
„Nun warten wir auf die Regenzeit,“ sagte er, „und sehen zu, wie es geht.“
Und die Regenperiode kam; und es ging, wie der Zweifüßler gehofft hatte.
Kleine grüne Keime schossen überall aus der gepflügten Erde hervor — alle gleichförmig, lauter Gräser, wie seine Tiere es gern hatten. Hier und da waren ja allerdings ein paar Disteln und Mohnblumen darunter, das meiste aber war gutes Gras.
„Seht ihr!“ sagte der Zweifüßler zufrieden. „Nun wartet bloß, bis die Sonne scheint, dann wird die Sache noch schneller gehen.“
Die Sonne sandte ihre Strahlen herab, und das ganze Feld war ein grüner, prächtiger Teppich, der wuchs und wuchs, so daß man es von Tag zu Tag wahrnehmen konnte.
Eines Morgens kam der Hirsch an den Rand des Waldes und sah mit Staunen das Bild, das sich ihm darbot. Dann rief er seiner Familie, die im Walde war, zu:
„Kommt hierher! Dann sollt ihr ein Feld sehen, so schön, wie ihr es noch nie geschaut! Eilt und kommt! Ich fange schon an zu äsen.“
„So, also das tust du!“ rief der Zweifüßler und kam mit seinem Speer herbeigestürzt. „Weg mit dir, du Diebsgesicht! Glaubst du, ich habe[S. 64] im Schweiße meines Angesichts gesät, damit du mir die Saat auffressen solltest! Weg mit dir! Dieses Feld ist mein!“
Der Hirsch floh in den Wald, so schnell er konnte. Aber der Sperling flog umher und erzählte:
„Der Zweifüßler hat sich ein großes Stück Land angeeignet, das sonst niemand betreten darf. Er hat den Hirsch einen Dieb genannt, als der darauf äsen wollte.“
Als die Zeit gekommen war, füllte der Zweifüßler das Haus, das er als Scheune gebaut hatte, mit dem Ertrag seines Feldes. Und sobald die Ernte beendigt war, begann er, an das nächste Jahr zu denken.
Er pflügte ein neues Feld um und noch eins und säte darauf. Und im folgenden Jahre rodete er ein Stück des Waldes und bestellte es gleichfalls.
Und so fuhr er fort, Jahr auf Jahr, bis er sich schließlich all das Land dienstbar gemacht hatte, das er von seinem Hause auf der Anhöhe überschauen konnte.
Rings um das Haus hatte er einen Garten mit den Obstbäumen und Kräutern angepflanzt, die er gebrauchen konnte. Lang und gerade dehnten sich die eingefriedigten Äcker, ein jeder mit einer[S. 65] bestimmten Sorte Gras oder Getreide; und der Zweifüßler war unerbittlich streng gegen jeden, der sein Werk zerstörte oder etwas von seinem Eigentum stahl.
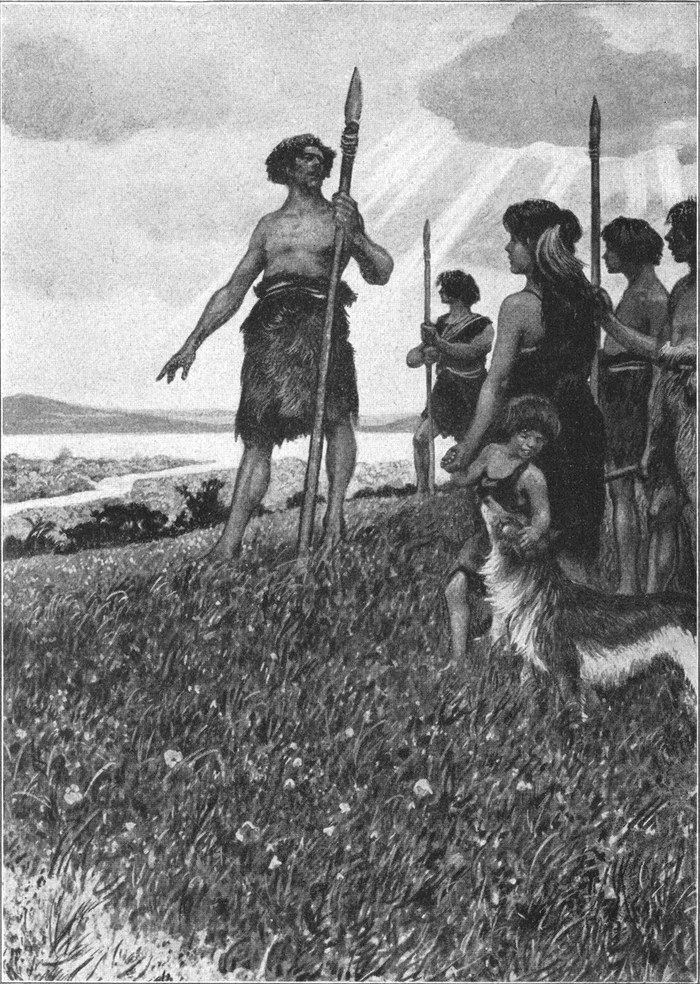
Er schien wirklich der Herr des Bodens zu sein. Niemand wagte es, sich ihm zu widersetzen. Seine Herde wuchs von Tag zu Tag, und die wilden Tiere flüchteten weit fort, sobald sie einen Zipfel von ihm oder den Seinen erblickten.
Aber tief im Walde, in der Stille der Nacht und wenn sie sonst sicher vor ihm waren, sprachen sie von alten Tagen, wo sie selbst die Herren gewesen, von der Schande, daß er sie so unterdrücke, und von ihrer Hoffnung auf bessere Zeiten.
„Er wirft Steine nach einem armen Vogel, der ein Korn auf seinem Felde aufliest,“ klagte der Sperling.
„Gestern hat er mich aus der Nußhecke um seinen Garten verjagt,“ fiel das Eichhörnchen ein.
„Sein Pfeil hat meinen linken Flügel getroffen, weil ich mir ein Lamm genommen hatte,“ erzählte der Adler.
„Mich hat er völlig aus dem Walde vertrieben,“ seufzte der Wolf. „Er hat gesagt, alles Wild gehöre ihm; und wenn ich wagte, es anzurühren, so werde er mich und meine Jungen verfolgen — wenn es sein müsse, bis ans Ende der Welt.“
„Morgen verfällt er vielleicht darauf, zu be[S. 66]haupten, daß alle Wiesen ihm gehören,“ sagte der Hirsch. „Wo soll unsereiner Gras finden?“
Und die Distel, der Mohn und die Glockenblume duckten sich an der Hecke zusammen. Das Veilchen versteckte sich im Garten. Die Brennessel stand finster und zornig vor der Einfriedigung des Gartens.
„Geht es uns besser?“ fragte die Distel. „Verjagt sind wir worden aus unserem Heim und müssen nun hier an der Hecke sitzen und mitansehen, wie das dumme Gras sich über das ganze Feld ausbreitet. Wir sitzen hier dank seiner Gnade. An jedem beliebigen Tage kann er uns das Leben nehmen.“
„Er hat ein paar von meinen Schwestern in seinen Garten gepflanzt,“ sagte das Veilchen.
„Auch von den meinen,“ rief der Mohn. „Aber ist das Freiheit?“
„Stich ihn, Distel!“ riet die große Eiche.
„Das hab’ ich getan, und er hat mit seinem Stock nach mir geschlagen,“ erwiderte die Distel.
„Verbrenn’ ihn, Nessel!“ sagte die Eiche.
„Ich hab’ es versucht, und es ist mir nicht besser als der Distel ergangen.“
Durch das Getreide aber ging ein vergnügtes Flüstern vom einen Ende des Feldes zum andern:
„Wir sind es... wir... wir... Wir regieren jetzt im Lande... wir sind gut... wir sind nützlich... Ihr seid nichts als Unkraut.“
„Hört die feigen Hunde!“ rief die Distel.
[S. 67]
Doch die Glockenblume meinte: „Wir können nichts tun. Aber warum fallt ihr großen Bäume nicht über ihn her und zermalmt diesen Räuber und seine Brut?“
„Es ist so eine Sache, umzufallen,“ sagte die Eiche. „Aber haben wir hier im Walde nicht einen König, der uns beschützen kann? Wo ist der Löwe?“
„Ja... wo ist der Löwe?“ riefen sie alle.
Aber der Löwe ließ und ließ sich nicht sehen.
Daheim im Garten saß der Zweifüßler unter einem großen Apfelbaum im Kreise seiner Familie.
Er schaute über seine Felder, auf denen das Getreide wogte, und er sah auf den Apfelbaum hinauf, der voll herrlicher gelber Früchte hing. Einer seiner Söhne war gerade mit zwei großen Fischen vom See nach Hause gekommen. Ein anderer war auf der Jagd im Walde... Jetzt hörten sie sein Rufen... Dort stand er am Waldessaum, einen fetten Rehbock über der Schulter.

Ein dritter arbeitete an einem Pflug, der besser werden sollte als der alte. Und auch alle andern hatten ihre Beschäftigung. Die Mädchen waren am Herde tätig und trieben den Mahlgang.
„Wir haben Glück gehabt,“ sagte der Zweifüßler zu seiner Frau. „Alles wächst und gedeiht unter unseren Händen. Und unsere Kinder werden es weiter bringen als wir, und deren Kinder wieder — — ich wage gar nicht daran zu denken, zu wie[S. 68]viel Macht und Herrlichkeit die Familie noch kommen kann.“
„Ja,“ sagte sie. „Es ist uns gut gegangen. Erinnere mich daran, daß wir den Sperlingen Getreidekörner streuen, wenn die schlechte Zeit kommt.“
„Das werd’ ich tun. Wir haben es ja dazu, den kleinen Diebsgesichtern eine kleine Handreichung zu leisten. Und ich höre sie gerne zwitschern, wenn ich am Morgen aufstehe.“
Mit jedem Tage, der verstrich, jammerten die alten Tiere stärker.
„Man weiß nicht mehr, was man darf, und was man nicht darf,“ sagte der Maulwurf. „Gestern wühlte mein Vetter die Erde auf, wie meine Familie es getan hat, solange sie existiert. Da wurde er auf einmal an die Oberfläche gezogen und von einem von den Söhnen des Zweifüßlers erschlagen, weil der Maulwurfshügel in eins seiner Beete kam.“
„Seine Tochter hat meine Frau erschlagen, weil sie ihr so garstig vorkam,“ sagte ein junger Spinnenherr. „Meine Frau war allerdings nicht eben lieb zu mir. Sie wollte mich gleich nach der Hochzeit fressen; diesem Geschick bin ich mit knapper Not entgangen. Aber sonst war sie das bravste Frauenzimmer unter der Sonne und tat keiner Seele etwas zuleide. Ausgenommen natürlich die Fliegen.“
[S. 69]
„Meine Frau hat er genommen und in seinen Garten gepflanzt,“ sagte die Hopfenranke.
„Und mich wirft er hinaus, sobald ich einen grünen Trieb sehen lasse,“ jammerte der Geisfuß.
„Uns sperrt er in Körbe ein,“ klagte die Biene.
„Uns jagt er mit Klappen und Tüchern,“ berichtete die Mücke.
„Uns schließt er ein, um uns fett zu machen dann zu essen,“ erzählte das Schwein.
„Für uns stellt er Fallen auf, wenn wir uns einen kleinen Happen nehmen wollen,“ sagte die Maus.
Und der Hirsch erklärte: „Er ist unser aller Herr. Wir haben niemanden, bei dem wir Klage führen könnten. Wir haben keinen König. Der Löwe ist nicht mehr der Herrscher des Waldes. Er schlägt uns mit seiner Tatze nieder, wenn er hungrig ist, aber er verteidigt uns nicht.“
Während die Tiere nun Rat hielten, was zu tun sei, kam die Löwin langsam gegangen und stellte sich mitten in ihren Kreis. Erschrocken fuhren die Tiere auf, aber die Löwin legte sich ruhig nieder und sagte:
„Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich tu’ euch nichts. Ich habe in den letzten acht Tagen vor Kummer kaum gegessen. Mich drückt die gleiche Sorge wie euch. Und für mich ist’s schlimmer, weil mein Gemahl uns alle gegen diese Fremden hätte verteidigen müssen und es nicht tut.[S. 70] Zu allem übrigen kommt für meine Person noch die Schande.“
„Der Löwe soll uns helfen! Der Löwe soll uns befreien!“ riefen alle Tiere durcheinander.
„Der Löwe rührt sich nicht,“ erwiderte sie traurig. „Er liegt zu Hause und starrt und starrt vor sich hin. Aber nun sollt ihr hören, was ich euch zu sagen habe.“
Da scharten sich alle um die Löwin und lauschten.
„Wir alle sind in Gefahr,“ begann sie, „wir alle ohne Ausnahme. Ich habe gesammelt, was ich vom Zweifüßler gehört und gesehen. Und ich kenne seinen Charakter und seine Pläne, als hätte er sie mir anvertraut. Die ganze Erde will er sich unterwerfen. Er und seine Kinder wollen über uns herrschen — im Guten wie im Bösen.“
„So ist es!“ riefen die Tiere.
„Ja, so ist es!“ wiederholte die Löwin. „Niemand darf sich für sicher halten. Das stärkste Tier und der größte Baum — hat er sie heute nicht gefällt, so kommt die Reihe morgen an sie. Der niedrigste Wurm und das erbärmlichste Kraut — ihr wißt nicht, wann er euch braucht, oder wann ihr ihm lästig werdet. Dann hat eure Stunde geschlagen.“
„Ja, ja!“ riefen sie.
Die starke Eiche nickte mit ihren knorrigen Ästen, der Hirsch senkte betrübt sein Geweih, der[S. 71] Regenwurm flüsterte im Erdreich sein „Ja!“ und die Bienen zitterten vor Angst.

„So ist es!“ sagte die Löwin. „Für ihn sind wir entweder nützlich oder schädlich — sonst nichts. Findet er eine Blume hübsch, so nimmt er sie in seine Hut; mag seine Nase ihren Geruch nicht ausstehen, so zertritt er sie. Spendet ein Baum ihm im Schlafe Schatten, so läßt er ihn wachsen. Steht der Baum ihm aber im Wege, oder kann er das Holz gebrauchen, so fällt er ihn. Verspricht ein Tier ihm Nutzen, so fängt er es ein und macht es zu seinem Sklaven. Er bekleidet sich mit seinem Fell, er ißt sein Fleisch und läßt es arbeiten. Er hört nicht auf, wenn er satt ist, wie wir andern. Gierig, wie er ist, fängt er Tiere ein und sammelt[S. 72] Früchte für eine lange Zeit, damit er nie Not zu leiden braucht.“
„Das ist wahr! Das ist wahr!“ riefen die Tiere im Chor.
„Wartet nur!“ fuhr die Löwin fort. „Ich bin noch nicht zu Ende... Er ist kein redlicher Jäger wie wir. Er erringt sich seine Beute nicht, auf seinen Beinen laufend... sondern er reitet zur Jagd auf dem Rücken des Pferdes, das er gezwungen hat, ihn zu tragen. Er packt seine Beute nicht mit seinen Krallen, tötet sie nicht mit seinen Zähnen... Er hat eine seltsame Waffe, die durch die Luft fliegt und dem, den sie trifft, den Tod bringt.“
„Wir kennen sie,“ sagte der Hirsch.
„Sie ist an meinem Auge vorübergesaust,“ ergänzte der Wolf.
„Sie hat meinen Flügel getroffen,“ berichtete der Adler.
Und die Löwin setzte ihre Anklage fort:
„Er trinkt nicht das Blut, ißt nicht das Fleisch wie wir. Sondern er brät es am Feuer... es brennt immer Feuer in seiner Hütte. Er hat der Natur Gewalt angetan... Wir haben das Feuer nur gekannt, wenn der Blitz einschlug und einen alten Baum in Flammen setzte... Er schlägt Steine gegeneinander, und es entstehen Funken... er reibt zwei Stücke morsches Holz aneinander, und eine Lohe schlägt heraus.“
Und alle riefen:
[S. 73]
„Ja, es ist wahr! Er hat sich das Feuer unterworfen.“
Die Löwin aber war unermüdlich:
„Er pflückt nicht die Früchte des Waldes an den Stellen, wo sie reif werden. Sondern er pflanzt die Pflanzen, die er verwenden kann, und rodet die anderen aus. Läßt man ihn schalten und walten, wie er will, so wird er die ganze Erde umgestalten. Es werden keine andern Kräuter darauf wachsen als die, die er gebrauchen kann — keine andern Tiere als die, die ihm zu Nutz und Vergnügen gereichen. Wollen wir weiter auf der Erde leben, so müssen wir seine Sklaven werden.“
„Seine Sklaven!“ riefen alle.
Nun schwieg die Löwin ein Weilchen, und es war ganz still. Aus der Ferne tönte Treus Bellen herüber.
„Hört ihr den Hund?“ rief die Löwin. „Seinen ersten Diener! Er hilft dem Zweifüßler beim Hüten der andern Tiere.“
Da riefen alle im Chore:
„Der Hund hat uns verraten! Laßt uns den Hund töten!“
Die Löwin hob ihre Tatze, und es wurde still. Und nun redete sie weiter:
„Entsinnt ihr euch noch der Nacht, als die neuen Tiere eben angekommen waren, und wir uns hier auf dieser selben Wiese versammelten? Einige warnten uns... das Pferd, das Rind und[S. 74] das Schaf... und auch die Gans und die Ente... nun sind sie alle die Sklaven des Zweifüßlers. Ihre Ahnung hat sie nicht betrogen. Aber erinnert ihr euch nicht, wie die beiden neuen Tiere aussahen, als sie hier lagen und schliefen? Nackte, elende Wesen waren es... Wir hätten sie ohne weiteres töten können, wenn wir nur gewollt hätten.“
„Das hätten wir tun können! Das hätten wir tun können!“ riefen die Tiere.
„Aber wir taten es nicht. Und nun sind sie die Herren des Waldes. Wißt ihr, woher ihre Macht stammt? Von den Tieren, die sie unterrichtet haben. Wenn wir ihnen diese Tiere nehmen können, dann werden sie wieder die armen Geschöpfe, die sie früher gewesen. Die Macht des Zweifüßlers besteht darin, daß er es versteht, andere für sich arbeiten zu lassen. Wollt ihr daher meinem Rate folgen, so müßt ihr versuchen, ihm seine Diener abspenstig zu machen. Laßt uns jemanden zu ihnen schicken, um sie zur Vernunft zu bringen. Wir müssen ihr Ehrgefühl wecken, indem wir sie an die Zeit erinnern, da sie frank und frei im Walde umherliefen .. Wer will diese Aufgabe übernehmen?“
„Du sollst selber gehen!“ riefen sie.
„Nein,“ sagte die Löwin, „das wäre nicht richtig. Blut trennt ihr und mein Geschlecht. Das könnte ihnen einfallen, und dann würden meine Worte wirkungslos bleiben. Es muß einer sein, den sie nie zu fürchten gehabt haben.“
[S. 75]
Eine Zeitlang wurde hin- und hergeredet, und dann wurde beschlossen, den Fuchs zum Abgesandten zu wählen. Der hatte ja allerdings aus alter Zeit noch ein unbeglichenes Konto bei Gans, Ente und Huhn, aber man fand nun einmal keinen besseren.
So schlich er denn fort — niemand kannte ja wie er die schnellsten und verstecktesten Wege im Walde — nachdem er versprochen, so schnell wie möglich Bescheid zu bringen. Die Tiere legten sich auf der Wiese zur Ruhe und flüsterten zusammen. Mitten in dem Kreise lag die Löwin und starrte beschämt und grollend vor sich hin.
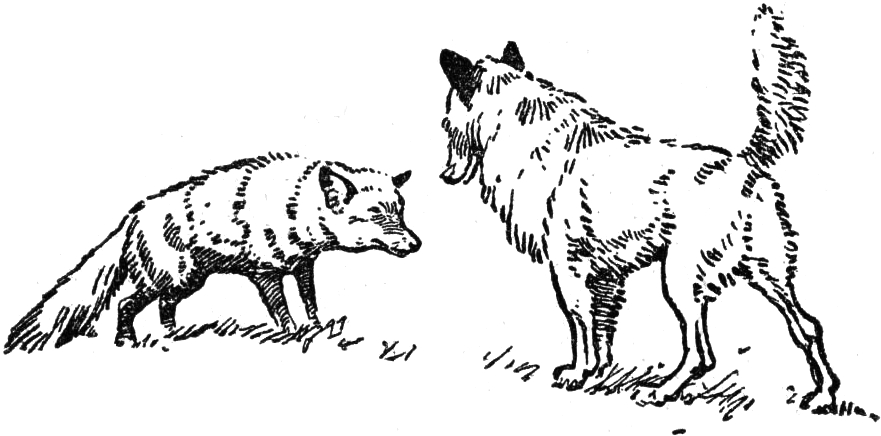
Als der Fuchs zum Hause des Zweifüßlers kam, traf er auf Treu, der gerade seine Nachtrunde machte, um zu sehen, ob ein Feind in der Nähe sei.
„Guten Abend, Vetter!“ sagte der Fuchs kriecherisch. „So spät noch unterwegs?“
„Das gleiche muß ich dir sagen,“ erwiderte Treu. „Ich halte Wache für meinen Herrn. Du hast kaum ein so rechtschaffenes Gewerbe.“
[S. 76]
„Ich habe keinen Herrn. Und noch vor kurzem warst auch du dein eigener Herr. Du solltest dir deine Freiheit zurückerobern. Folg mir auf die Wiese! Dort sind die andern Tiere versammelt. Sie wollen dir verzeihen, daß du in den Dienst des Zweifüßlers getreten bist, und dich als den braven guten Hund begrüßen, der du früher gewesen, wenn du das Tor öffnen willst, so daß die gefangenen Tiere befreit werden.“
„Hier sind keine gefangenen Tiere,“ sagte der Hund. „Uns allen geht es gut, und wir wünschen es uns nicht anders. Bin ich der Diener des Zweifüßlers, so bin ich auch sein Freund. Troll dich schleunigst zurück zu denen, die dich gesandt haben.“
Damit wandte er dem Fuchs den Rücken und schlüpfte durch ein kleines Loch in der Einfriedigung, das für ihn besonders angebracht war. Der Fuchs aber blieb ein Weilchen stehen, um zu warten, ob sich nicht einer von den anderen zeigen würde. Es dauerte denn auch nicht lange, bis ein junges Gänschen den Kopf aus dem Loche hervorsteckte.
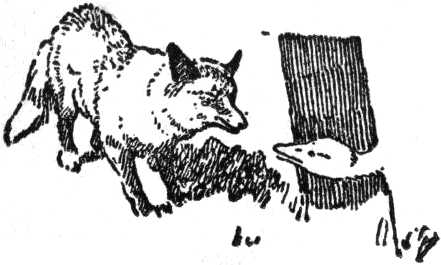
„Guten Abend, liebe Jungfer,“ sagte der Fuchs. „Sei so gut und komm ein bißchen näher!“
„Ich wag’ es nicht,“ erwiderte das Gänschen. „Ich darf des Nachts nicht fortgehen, so gern ich es auch möchte. Ich fürchte mich so sehr vor den Zweifüßlern. Neulich haben sie meine Mutter gebraten und aufgegessen.“
„Gräßlich!“ rief der Fuchs. „Keinen Augen[S. 77]blick länger dürfen Sie in dieser Mörderhöhle bleiben. Kommen Sie heraus zu mir! Dann werd’ ich Sie an einen Ort bringen, wo Sie nichts zu befürchten haben.“
„Wenn ich mich nur auf Sie verlassen könnte! Aber ich habe zehn Geschwister. Die kann ich doch nicht im Stiche lassen.“
„Sie sollten sie heut nacht nicht aufwecken! Junge Damen sind so geschwätzig; und wenn der Hund oder der Zweifüßler Ihre Flucht entdeckten, dann wäre es aus mit uns. Sie würden sofort gebraten werden, und ich bekäme natürlich auch Unannehmlichkeiten.“
„Das ist wahr!“ sagte das Gänschen. „Aber wollen Sie mir versprechen, meine Schwestern ein andermal nachzuholen?“
„Ich gebe Ihnen mein Wort darauf, daß ich von nun an jede Nacht eine der Jungfrauen holen werde, bis sie alle erlöst sind,“ gelobte der Fuchs. „Soweit es in meiner Macht steht. Natürlich können mir Hindernisse in den Weg treten.“
„Wie freundlich Sie sind! Und ich hatte gedacht, die wilden Tiere wären schlimme Ungeheuer. Das ist mir immer erzählt worden. Man hat mir gesagt, vor allem solle ich mich davor hüten, in den Wald zu laufen; dort könne ich das Ärgste erleben.“
„Lauter Verleumdungen! Die Tiere des Waldes sind Engel. Noch nie habe ich gehört, daß sie[S. 78] jemanden gebraten hätten. Aber kommen Sie, eh’ man uns hört.“
„Nun komme ich,“ sagte das Gänschen.
Es watschelte zu dem Loch hinaus, und sofort bohrten sich die Zähne des Fuchses in seinen Hals; es hatte eben noch Zeit zu schreien, dann war es fertig. Wie der Blitz aber war Treu da. Der Fuchs ließ das Gänschen los und biß um sich, so gut er konnte. Er war jedoch der Schwächere, und Treu gab keinen Pardon. Erst als der Räuber tot auf dem Platze lag, entfernte Treu sich zufrieden.

Inzwischen saßen die Tiere auf der Wiese und warteten.
[S. 79]
„Der Fuchs hat uns zum besten gehalten!“ brummte der Hirsch.
„Der Zweifüßler hat ihn natürlich gefangen und in seine Dienste genommen,“ meinte die Nachtigall.
Erst gegen Morgen kam ganz atemlos der Sperling herbei.
„Der Fuchs ist tot!“ schrie er. „Er liegt auf der Anhöhe vor dem Hause des Zweifüßlers. Ich hab’ ihn selber gesehen. Und neben ihm liegt eine tote Gans.“
Da erhob sich die Löwin, und mit ihr erhoben sich alle Tiere.
„Der Fuchs hat seine persönlichen Zwecke verfolgt,“ sagte die Löwin. „Auf der Jagd ist er gefallen. Wir können uns auf niemanden mehr verlassen.“
Damit ging sie langsam, mit gesenktem Kopfe, nach Hause.
Eines Nachts — ein paar Tage nach der Versammlung der Tiere auf der Wiese — lag der Löwe wie gewöhnlich in seiner Höhle und starrte mit seinen gelben Augen vor sich hin. Seine Gemahlin schlief oder gab sich wenigstens den Anschein, als ob sie schliefe. Alle Augenblicke seufzte sie tief auf. Alles im Walde war still.
[S. 80]
Der Löwe wußte recht gut, was die Seufzer seiner Gattin bedeuteten, und er wußte, wovon die Tiere im Walde gesprochen hatten. Nicht eine ihrer Klagen war ihm unbekannt; nicht eins der höhnischen Worte, die gegen ihn gefallen, war an seinem Ohre vorübergegangen. Nicht einen Augenblick war er über die Stimmung der Tiere gegen ihren König im Zweifel gewesen.
Er hatte auch nicht vergessen, wer am geringschätzigsten von ihm gesprochen hatte. Er würde schon wissen, sie zu treffen, wenn die Stunde käme, wo die Ordnung im Walde wiederhergestellt würde. Tag für Tag mußte er den Spott seiner Gemahlin über sich ergehen lassen, aber er achtete nicht mehr darauf. Die Zeit würde kommen, wo sie Abbitte tun und ihm wieder ihre Liebe und Bewunderung schenken würde. Und seine Kinder würden ihn wieder ehren, wie sie es früher getan. In der Geschichte des Waldes würde er fortleben als der König, während dessen Regierung das Reich großer Gefahr und schwerem Unglück ausgesetzt gewesen, und der schließlich doch als Sieger aus allen Kämpfen hervorgegangen war.
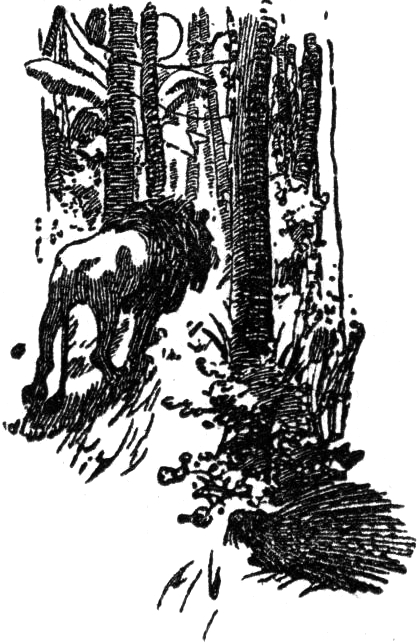
Der Löwe erhob sich und schritt langsam durch den Wald.
„Der König der Tiere geht auf die Jagd,“ sagte der Igel, der im Gebüsch umherschlich.
„Seht, wie mager er ist!“ rief die Fledermaus. „Das Fell schlottert ja um ihn.“
[S. 81]
„Er hat seit vielen Nächten nicht gejagt,“ sagte die Eule. „Seine Augen leuchten vor Hunger.“
Aber der König des Waldes dachte gar nicht an Jagd. Wie im Schlafe ging er nach der Richtung, in der das Haus des Zweifüßlers lag. Ein Hirsch sprang über den Weg, doch er sah ihn nicht. Langsam wanderte er weiter, bis er den offenen Platz erreichte, wo auf der Anhöhe das Haus des Zweifüßlers lag.
Geradeswegs ging er darauf zu, sprang über die Umzäunung und legte sich in den Sträuchern, die vor der Türe standen, nieder. So lag er auf der Lauer. Niemand konnte ihn sehen; nur seine gelben Augen leuchteten aus dem Laube. Und mit einem Satze konnte er an der Türe sein.
Der Zweifüßler schlief unruhig in dieser Nacht. Er warf sich auf seinem Lager aus Fellen umher; und als er schließlich einschlief, begann Treu, so heftig zu hellen, daß er aufstehen mußte, um nach dem Rechten zu sehen. Er hatte die Öffnung, durch die Treu sonst ein- und auslief, durch eine Falltür verschlossen, weil das Gänschen neulich diesen Weg eingeschlagen hatte und so dem Räuber zum Opfer gefallen war.
„Was hast du denn, Treu?“ fragte der Zweifüßler.
Der Hund fuhr fort zu bellen und sprang an seinem Herrn in die Höhe. Dieser öffnete eine kleine Klappe und blickte lauschend hinaus. Aber es war[S. 82] nichts zu sehen. Dann befahl er dem Hunde, sich niederzulegen, während er selbst wieder sein Lager aufsuchte. Aber nun hörte er das Pferd im Stall ausschlagen; die Kuh brüllte, und das Federvieh krähte und schnatterte. Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Er mußte wieder hinaus und fand alle seine Tiere zitternd, in furchtbarer Angst. Das Pferd war ganz in Schweiß; und Hühner, Enten und Gänse flogen unruhig umher. — „Was hat das zu bedeuten?“ fragte sich der Zweifüßler.

Er öffnete die Tür und trat in die Nacht hinaus, unbewaffnet und nackt, wie er von seinem Lager aufgestanden war. Da raschelte es in den Büschen vorm Hause, der Löwe sprang hervor; aber dem Zweifüßler gelang es, sich blitzschnell zurückzuziehen und die Tür zu verschließen und zu verrammeln.
Einen Augenblick stand er in großer Angst da und wußte nicht, was er tun sollte.
[S. 83]
Durch ein kleines Guckloch in der Tür sah er, daß der Löwe draußen vor den Büschen lag, die gelben Augen, die vor Wut leuchteten, auf die Türe geheftet und zum Sprunge bereit. Der Zweifüßler begriff, daß der Zeitpunkt gekommen war, wo der so lange aufgeschobene Kampf sich entscheiden mußte.
Er dachte daran, seine Söhne zu wecken, zu der andern Tür hinauszuschleichen und den Löwen von hinten anzufallen. Aber die Söhne schliefen an verschiedenen Stellen im Hause, und im Osten graute bereits der Tag. Während er sie holte, konnte leicht einer von der Familie hinausgehen und dem König des Waldes zum Opfer fallen.
Aber wie er so stand und überlegte, verließ ihn seine Angst.
Er machte sich klar, daß er Manns genug sei, seinen Feind allein zu töten. Still nahm er die beiden besten seiner Speere, prüfte sorgfältig die Schneide, holte tief Atem und öffnete die Tür.
Aber der Löwe war nicht da.
Der Zweifüßler sah nach der einen und nach der andern Seite, ohne seinen Gegner entdecken zu können. Aber er war ja ein alter, erfahrener Jäger; darum zweifelte er nicht daran, daß der Löwe sich auf die Lauer gelegt habe. Ruhig stand er in der Tür, jede Muskel gespannt, bereit zu dem Kampfe, der kommen mußte.
In dem Gebüsch raschelte es leise, und zugleich[S. 84] sah der Zweifüßler die Augen des Tieres im Laube. Er wußte, daß keine Zeit zu verlieren war. Sprang der Löwe zuerst, so war es zu spät.
Da warf er denn den einen Speer und traf den Löwen ins Auge. Ein rasendes Gebrüll ertönte. Und nun durchbohrte der zweite Speer das Herz des Tieres.
Alle im Hause kamen auf die Beine und liefen herbei.
Da lag der tote Löwe, groß und prächtig anzusehen. Treu bellte ihn an und wollte ihn beißen, aber der Zweifüßler verscheuchte ihn:
„Er war doch der König des Waldes! — Nun aber soll es aller Welt verkündet werden, daß er tot ist, und daß das Reich von jetzt an mir gehört.“
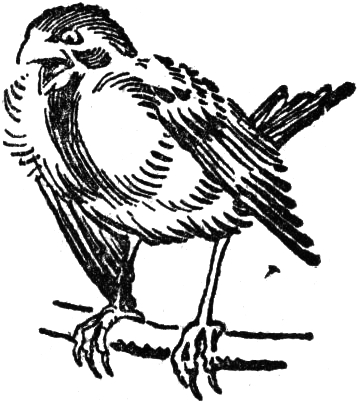
Dann zogen sie ihm das Fell ab und hängten es auf eine hohe Stange, die sie mitten aufs Feld setzten, so daß sie weit und breit zu sehen war.
„Der Löwe ist getötet!“ schrie der Sperling von Tür zu Tür. „Der Zweifüßler hat den König des Waldes ermordet. Sein Fell hängt auf einer Stange vorm Hause... ich hab’ es selber gesehen.“
Die Tiere strömten von allen Seiten herbei, um sich selbst von dem Geschehenen zu überzeugen. Vom Rande des Waldes schauten sie ängstlich zum Hause des Zweifüßlers hinüber, und oben aus der Luft starrten die Vöglein entsetzt auf die Erde nieder.
„Nun ist alles aus!“ sagte der Hirsch.
Und so war es auch.
[S. 85]
Im Lauf des Tages aber kam der Orang-Utan zum Zweifüßler, der vor seinem Hause saß, und redete ihn folgendermaßen an:
„Guten Tag, Vetter!“
Der Zweifüßler betrachtete den Ankömmling, ohne zu antworten.

„Du hast vielleicht gehört,“ fuhr der Orang-Utan fort, „daß ich dir allerlei Böses nachgesagt habe. Ich leugne es nicht, daß ich ein wenig unvorsichtig gewesen bin. Aber du weißt ja selber... wenn man so eine arme Familie sieht, hat man Angst vor dem Anhang. Man hat ja selber Kinder; und es ist heutzutage nicht leicht, durchzukommen. Außerdem hast du mir einmal einen Schlag mit deinem Stock gegeben. Das gleicht sich also wohl aus.“
„Was willst du von mir?“ fragte der Zweifüßler. „Ich habe weder Zeit noch Lust, dein Gewäsch mitanzuhören.“
„Nicht so hastig, Vetter,“ sagte der Orang-Utan, indem er sich neben ihn setzte. „Deine Erfolge erkenne ich durchaus an. Du hast Glück gehabt ... Herrgott, deine Tüchtigkeit will ich dir ja auch nicht abstreiten. Du hast deine Sache großartig gemacht. Die Geschichte mit dem Pferd war ganz ausgezeichnet. Und nun hast du auch noch den Löwen überlistet...“
„Was willst du eigentlich von mir, Unglückswurm?“ fragte der Zweifüßler ungeduldig.
„Ich will mich mit dir zusammentun, Vetter![S. 86] Wenn wir beide uns verbünden, können wir die ganze Welt erobern.“
„Bist du toll? Was soll ich mit so einem lächerlichen, dummen Tier anfangen, wie du es bist? Du kannst mir ja gar nichts nützen! Fort mit dir, oder ich werd’ dir deine Jacke ausklopfen, daß du ewig daran denken sollst!“
Der Orang-Utan trat ein wenig zurück, räumte aber das Feld nicht.
„Du solltest es dir doch überlegen, Vetter!“ meinte er. „Wie tüchtig du auch sein magst — nützen kann ich dir trotzdem. Ich kann Vermittler sein zwischen dir und den Tieren. Ich kann so mancherlei, was du nicht kannst; und was ich nicht verstehe, lerne ich leicht. Von dem Apfelbaum aus, wo ich meinen Sitz hatte, habe ich dich und dein Treiben studiert, während du auf dem Felde warst; und manchen Trick hab’ ich dir schon abgelauscht. Du mußt wissen...“
Der Zweifüßler stand auf und packte den einen Arm des Orang-Utans.
„Kommt mal her, dann sollt ihr was sehen!“ rief er ins Haus hinein.
Und die ganze Familie kam herbei und starrte den Affen an.
„Dieser Bursche hier will mit mir ein Kompagniegeschäft gründen,“ sagte der Zweifüßler lachend. „Er meint, er habe mir schon die Kunst abgesehen. Kommt, wir wollen ihn in ein Bauer[S. 87] setzen; dann mag er uns mit seinen Kapriolen unterhalten, wenn es regnet.“

Alles Protestieren des Orang-Utan half nichts. Der Zweifüßler hielt ihn fest, und bald darauf hatten seine Söhne einen Käfig fertig, in den der Gefangene gesperrt wurde.
„Familie ist und bleibt Gesindel,“ murrte er, während er auf dem Boden des Käfigs saß und sich die Flöhe absuchte.
Viele, viele Jahre, Jahrhunderte und Jahrtausende waren vergangen.
Und es war nicht mehr im Walde, in den warmen Ländern, wo die Sonne stärker scheint, der Regen dichter fällt, und alle Tiere und Pflanzen besser gedeihen, weil der Winter ihnen nichts anhaben kann.
Es war in einem großen Dorfe in Jütland.
Und da es gerade Markt war, so war das Dorf voll Menschen und Vieh. Überall waren Buden aufgeschlagen, in denen Holzschuhe, Blechgeschirr, Kuchen, Spielzeug und allerlei Kram feilgeboten wurde. Da waren Zelte, in denen Bier und andere Getränke zu haben waren, und unter anderen auch ein großes Tanzzelt. Ferner waren da: Theatrum mundi, zwei Karussells, eine Bude, in der die dickste Dame der Welt gezeigt wurde, und eine andere,[S. 88] wo man für fünfundzwanzig Pfennige einen winzigen Zwerg zu sehen bekam. Und außerdem gab es eine Bude mit weißen Mäusen sowie ein Flohtheater. Und viele Leierkästen, die ihre Melodien in wirrem Durcheinander ertönen ließen, so daß man kein Wort verstehen konnte, betrunkene Bauern und Jungen, die allerlei Narrenspossen trieben.

Aber mitten auf dem Marktplatz war das Allermerkwürdigste in einem großen Zelte verwahrt. Auch das konnte man für fünfundzwanzig Pfennige zu sehen bekommen; und wollte man wissen, was es war, so brauchte man nur dem Manne zuzuhören, der vor der Bude stand und mit heiserer Stimme rief:
„Bitte sehr, meine Herrschaften! Nur fünfundzwanzig Pfennige für Erwachsene, und für Kinder die Hälfte. Hier sehen Sie etwas, was hier am Platze noch nie gezeigt, im übrigen aber vorgeführt worden ist vor den Königen und hohen Herrschaften der ganzen Welt. Es ist selbst ein König, den ich die Ehre habe Ihnen zu zeigen — der König der Tiere, meine Herrschaften, der fürchterliche Löwe. Er lebt im Innern von Afrika und ist so stark, daß er mit einem Schlage seiner Vorderpfote einen Ochsen zu töten vermag. Er verzehrt täglich zwei Lämmer zum Frühstück. Wenn er aus dem Käfig entkäme, so würde er Sie alle binnen weniger als zehn Minuten ins Jenseits befördern. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, meine[S. 89] Herrschaften. Der Löwe ist in einem Käfig hinter dicken Eisenstangen eingesperrt. Dieses blutdürstige Raubtier ist hier zu sehen — fünfundzwanzig Pfennige für Erwachsene, und für Kinder die Hälfte! Bitte schön, meine Herrschaften! Eilen Sie, eh’ es zu spät ist. Nie in Ihrem Leben werden Sie etwas Ähnliches zu einem so billigen Preise zu sehen bekommen.“
So rief der Mann in einem fort. Vor dem Zelte hatte sich eine große Menschenmenge angesammelt, die gaffend dastand. Viele gingen auch in das Zelt hinein. Und wenn sie wieder herauskamen, erzählten sie den Umstehenden von dem, was sie gesehen. Und immer mehr gingen hinein — den ganzen Tag lang.
Im Hintergrunde des Zeltes stand der Löwenkäfig.
Er war niedrig und schmutzig. Auf dem Boden lag ein wenig unsauberes Stroh neben ein paar Fleischknochen. Die dem Publikum zugekehrte Wand bestand aus dicken, rostigen Eisenstangen. In einer Ecke ganz hinten lag der Löwe, den Kopf auf den Vorderpfoten. Schläfrig starrten seine gelben Augen auf die Leute. In seiner wirren Mähne war Stroh; und er war so mager, daß es grauenhaft anzusehen war. Von Zeit zu Zeit hustete er hohl und garstig.
Vor dem Käfig stand der Ausrufer mit einem langen Stock in der Hand und erzählte und erklärte.[S. 90] Die Marktbesucher betrachteten mit großen Augen das gewaltige Tier, das da so ruhig vor ihnen lag. So krank und matt er war — sie sahen doch, daß es wirklich der Löwe war, der König der Tiere. Und es lief ihnen kalt den Rücken hinab bei dem Gedanken, daß der gefangene Löwe ausbrechen könnte. Als er sich aber ganz und gar nicht rührte, sagte schließlich einer:
„Ich glaube, er ist tot.“

Da steckte der Mann, der die Erklärungen gab, seinen langen Stock durch die Gitterstäbe und stieß den Löwen in die Seite. Der drehte langsam den Kopf nach ihm um und sah den Mann an, ohne sich im übrigen zu rühren. Der Mann stieß ihn aber wieder und wieder an, bis er schließlich aufsprang und ein so lautes Gebrüll ausstieß, daß das ganze Zelt bebte und die Leute erschrocken auseinanderstoben.
„Seinen frühern Herrn hat er aufgefressen,“ erzählte der Mann. „Ich habe ihn von der Witwe gekauft. Er ist furchtbar wild und ungebärdig. Wissen Sie... er träumt von seiner Heimat, wo er in den wilden Wäldern gejagt hat, und wo er von allen Tieren geehrt und gefürchtet wurde. — Aber jetzt müssen Sie hinausgehen, damit auch andere diesen merkwürdigen Anblick haben können, der den Leuten hier am Orte noch nie geboten worden ist. Bitte schön, meine Herrschaften! Nur fünfundzwanzig Pfennige! Der König des Waldes, der gewaltige Löwe!“
[S. 91]
So ging es weiter bis zum späten Abend. Erst als der Marktplatz sich zu leeren begann, und niemand mehr auf sein Ausrufen achtete, schloß der Mann die Zelttüre und zählte das Geld, das der Tag ihm eingebracht hatte.
„Es ist ein schlechter Tag gewesen,“ sagte er und sah ärgerlich auf den Löwen. „Du hast im Grunde dein Abendessen durchaus nicht verdient.“
Mit diesen Worten warf er dem Löwen ein kleines, halbverfaultes Stück Fleisch hin. Dann verließ er das Zelt, schloß die Tür sorgfältig ab und ging in die Gastwirtschaft, wo er wohnte. Dort zechte er bis zum hellen Morgen.
Der Löwe aber rührte das verfaulte Fleisch nicht an. Den Kopf auf den Vorderpfoten, lag er da und schaute auf die Tranlampe, die in dem Zelte hing und einen ganz schwachen Lichtschimmer verbreitete. Da hörte er plötzlich einen Laut, hob den Kopf und blickte sich um.
„Soll ich nun nicht einmal in der Nacht Ruhe haben?“ rief er.
„Ich bin es bloß,“ erwiderte eine leise, pfeifende Stimme. „Ich bin aus Versehen hier mit eingeschlossen worden. Ich will hinaus! Ich will hinaus! Meine Herrin stirbt vor Angst um mich.“
Es war ein ganz kleiner Hund mit einem Schellenhalsband und einer gestickten Decke über dem Rücken. Er trippelte und trippelte, pfiff, heulte und[S. 92] kratzte an der Tür, aber niemand hörte ihn. Auf dem Marktplatz draußen war alles still.
„Herrgott!“ rief der Löwe. „Du bist ja der Hund! So viel kann ich sehen. Was für ein Gespenst haben die Menschen aus dir gemacht!“
„Ich will hinaus! Ich will hinaus!“ pfiff der Hund.
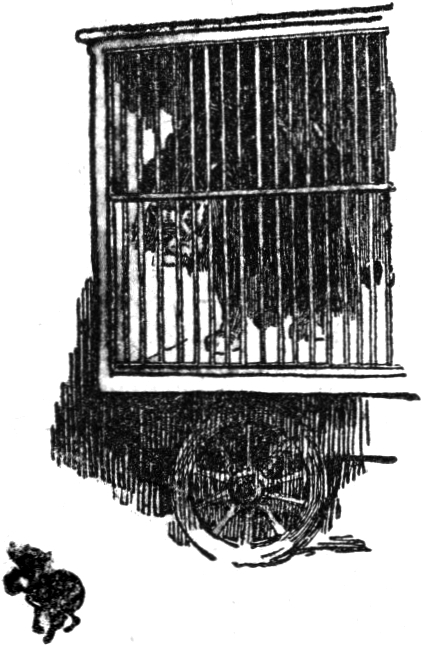
Der Löwe hatte den Kopf wieder auf die Vorderpfoten gelegt und betrachtete den Hund.
„Was pfeifst du denn so?“ sagte er. „Es tut dir ja niemand etwas zuleide. Ich könnte dich doch nicht auffressen, selbst wenn ich Lust hätte. Die Eisenstangen sind stark, mußt du wissen. Anfangs hab’ ich daran gerüttelt, aber jetzt tu ich’s nicht mehr. Im Käfig muß ich von Ort zu Ort reisen und mich für Geld sehen lassen, muß mich in den Hohn und die Neckereien der Leute finden, muß ihnen auf Kommando etwas vorbrüllen, damit sie erschaudern, während sie wissen, daß sie in Sicherheit vor meinen Zähnen sind.“
„Laß mich hinaus!“ bat der Hund.
„Ich kann nicht,“ erwiderte der Löwe. „Aber ich bin doch nicht so erbärmlich wie du. Ich bin wenigstens gegen meinen Willen hier — bin in einer Falle gefangen worden. Doch du bist freiwillig in den Dienst des Zweifüßlers gegangen und hast deine Kameraden verraten.“
„Ich weiß nicht, worauf du anspielst,“ sagte[S. 93] der Hund. „Ich weiß von keinem Zweifüßler. Ich diene bei den Menschen. Meine Herrin ist eine vornehme Baronin, und sie stirbt vor Angst, wenn sie mich nicht bald wiederbekommt.“
„Gewiß! Menschen nennt es sich — das verfluchte Geschlecht des Zweifüßlers. Die ganze Erde hat es unterjocht. Es gibt fast keine Stelle mehr, wo ein ehrlicher Löwe seine königliche Jagd ausüben könnte. Ich kenne die ganze Geschichte... sie hat sich in meiner Familie vom Vater auf den Sohn vererbt. Da draußen in der Wüste, wohin wir von den Menschen vertrieben worden sind, hab’ ich alles an dem letzten Abend, bevor ich gefangen genommen wurde, mitangehört. Wie der Zweifüßler und seine Frau nackt und ohne Waffen in den Wald kamen. Wie mein Stammvater sie beschützte. Und wie sie dann nach und nach alle Tiere überlisteten. Nur du gingst freiwillig in ihren Dienst. Die andern wurden eingefangen und gezähmt, und ihre Sinne stumpften in der Gefangenschaft ab, bis sie nicht mehr wie freie Tiere leben konnten, sondern sich in der Sklaverei wohlbefanden. Schließlich tötete der Zweifüßler meinen Stammvater mit seinem Speer. ... Ja ja, ich kenne die schändliche Geschichte von A bis Z.“
„Ich nicht,“ erklärte der Hund. „Ich mache mir auch durchaus nichts daraus, sie kennen zu lernen. Ich weiß nur, daß ich zu Hause bei meiner Herrin einen warmen kleinen Korb habe, und daß ich[S. 94] herrliches Essen und Küsse und Liebkosungen bekomme. Ich will hinaus! Ich will nach Hause!“
Der Löwe antwortete ihm nicht; er hing nur seinen Gedanken nach:
„Wenn ich hier so in meinem Käfig liege, wo ich bald sterben werde vor Sehnsucht und Husten, dann ist es mir wenigstens ein Trost zu sehen, wie elende Geschöpfe die Nachkommen des Zweifüßlers sind. Er war doch aufrecht und schön anzusehen — er war ein Tier! Aber diese Wesen... man kann kaum ein Stückchen von ihrem Körper sehen, so wickeln sie sich in Tücher ein. Der Zweifüßler sprang im Walde umher und kletterte auf die Bäume, er hatte wenigstens den Mut zu kämpfen... Aber die Angst der Menschen ist belustigend, wenn ich aufstehe und zu den Eisenstangen hingehe, oder wenn ich brülle. Sie zittern wie Espenlaub, obwohl sie wissen, daß ich ein elender Gefangener bin.“
„Ich will hinaus! Ich will nach Hause!“ winselte der Hund.
Der Löwe erhob sich und näherte sich dem Gitter. Er schlug mit dem Schwanze gegen seine mageren Flanken und öffnete seinen Rachen, indem die Zähne fürchterlich leuchteten. Das Hündchen aber zitterte unter seinem Blick vor Angst.
„Und du?“ rief der Löwe. „Hahaha! Lieber ein gefangener Löwe im Käfig als der arme Schoßhund einer alten Jungfer mit Schellen und Deckchen.“
[S. 95]
Und dann stieß er ein so lautes Gebrüll aus, daß im Dorfe alle Leute aus ihren Betten auffuhren. Hierauf legte er sich im Hintergrunde des Käfigs nieder, drehte sich auf die Seite um und schlief ein.
Der kleine Hund aber winselte so lange, bis jemand kam und ihn ins Freie ließ.

[S. 96]
Unter grünen Büschen und Bäumen lief der Bach dahin.
An den Ufern stand hohes, schlankes Schilf und flüsterte mit dem Winde. Mitten auf dem Wasser schwamm die Seerose mit ihrer weißen Blüte und ihren breiten grünen Blättern.

Gewöhnlich war’s ganz still auf dem Bache. Aber hin und wieder kam der Wind angefahren, dann sauste und brauste es im Röhricht, und die Seerose tauchte zuweilen ganz in den Wellen[S. 97] unter, und die Blätter richteten sich auf und standen aufrecht, so daß die dicken Stengel, die von unten, vom Grunde her kamen, Mühe hatten, sie noch länger zu halten.

Am Stengel der Seerose kroch die Libellenlarve den ganzen Tag lang auf und nieder.
„Herrgott, es muß doch langweilig sein, eine Seerose zu sein,“ sagte sie und sah zur Blüte auf.
„Du schwatzest mal wieder ins Blaue hinein,“ war die Antwort der Seerose. „Das ist gerade das herrlichste Dasein von der Welt.“
„Versteh’ es, wer es kann,“ sagte die Larve. „Ich würde mich keinen Augenblick besinnen, mich loszureißen und in der Luft herumzuschwirren wie die großen, schönen Libellen.“

„Pah!“ sagte die Seerose. „Das wäre ein nettes Vergnügen. Ach nein, still auf dem Wasser liegen und träumen, Sonnenschein einsaugen und sich von Zeit zu Zeit von den Wogen schaukeln lassen... das ist denn doch etwas anderes.“
Die Larve schwieg ein Weilchen und dachte nach. Dann rief sie aus:
„Ich sehne mich nun mal nach etwas Höherem. Wenn es nach mir ginge, möchte ich eine Libelle werden. Auf großen steifen Flügeln würde ich am Bache hinfliegen, würde deine weiße Blüte küssen, einen Augenblick auf deinen Blättern ausruhen und dann weiterfliegen.“
„Du willst zu hoch hinaus,“ erwiderte die See[S. 98]rose; „und das ist dumm. Der Sperling in der Hand ist mehr wert als die Taube auf dem Dache. Und ich möchte mir doch auch die Frage erlauben, wie du es anfangen willst, eine Libelle zu werden. Du siehst mir nicht danach aus, als wärest du dazu geschaffen. Jedenfalls müßtest du dich denn doch ein bißchen schöner auswachsen; so grau und häßlich, wie du jetzt bist.“
„Ja, das ist gerade das Unglück,“ antwortete die Larve verzagt. „Ich weiß ja selbst nicht, wie es zugehen soll; aber ich habe nun mal die Hoffnung, daß es doch geschieht. Darum krabble ich hier umher und verzehre alle die Tierchen, die mir in den Weg kommen.“
„Aha, du glaubst, mit dem Fressen bringst du es weiter!“ sagte die Seerose lachend. „Das ist wirklich eine famose Methode, es im Leben zu etwas zu bringen.“
„Ja, ich glaube wirklich, daß es die richtige für mich ist!“ rief die Libellenlarve eifrig. „Den lieben langen Tag esse ich, bis ich dick und fett bin, und dann, denke ich, wird eines schönen Tages all mein Fett zu Flügeln mit Gold und all den anderen schönen Dingen, die zu einer richtigen Libelle gehören.“
Die Seerose schüttelte den klugen weißen Kopf.
„Laß doch die törichten Gedanken,“ sagte sie, „und sei zufrieden und glücklich mit dem Lose, das dir beschieden ist! Du kannst dich in Ruhe und[S. 99] Frieden hier unten zwischen meinen Blättern tummeln und kannst an meinem Stengel auf und ab kriechen, soviel du willst. Du hast dein reichliches Auskommen und keine Sorgen — was verlangst du noch mehr?“
„Du bist von niederem Range,“ antwortete die Larve, „und darum hast du keinen Sinn für das Höhere. Ich aber will eine Libelle werden!“
Und sie kroch hinunter bis auf den Grund, um immer mehr Insekten zu fangen und sich noch feister und fetter zu fressen.
Aber die Seerose lag ruhig auf dem Wasser und dachte nach über den Lauf der Welt:

„Ich kann diese Tiere nicht verstehen. Vom Morgen bis zum Abend tummeln sie sich umher, jagen und fressen einander und können nicht in Frieden leben. Wir Blumen sind doch vernünftiger. Ruhig und friedlich wachsen wir, die eine neben der anderen, trinken Sonnenschein und Regen und nehmen alles hin, wie es kommt. Und ich bin die Glücklichste von allen; denn während die anderen Blumen auf dem festen Lande bei großer Dürre verwelken, schwimme ich unangefochten hier auf dem Wasser. Die Blumen haben es am besten; aber das können die dummen Tiere wohl nicht verstehen.“
Als die Sonne am Abend unterging, saß die Libellenlarve stumm und steif auf dem Stengel; die Beine hatte sie dicht angezogen. Sie hatte so[S. 100] viele Tierchen gefressen und war so dick, daß ihr zumute war, als ob sie platzen sollte. Und doch war sie nicht vergnügt. Sie dachte darüber nach, was die Seerose gesagt hatte, und die ganze Nacht ließen die unruhigen Gedanken sie nicht schlafen. Vor lauter Nachdenken tat ihr der Kopf weh, denn das war ungewohnte Arbeit. Auch im Rücken und Magen hatte sie Schmerzen. Ihr war, als werde sie in Stücke zerrissen und sollte sterben.
Als der Morgen graute, konnte sie es nicht länger aushalten.
„Ich weiß gar nicht, wie mir ist,“ stöhnte sie verzweifelt. „Das zwickt und zwackt mich; und ich weiß nicht, was mit mir werden soll. Vielleicht hat die Seerose recht, und ich bleibe ewig, ewig eine arme, kümmerliche Larve. Aber ist der Gedanke nicht furchtbar hart? Ich möchte doch so gern eine Libelle werden und im Sonnenschein umherfliegen. Au, mein Rücken, mein Rücken! Ich glaube, das ist der Tod.“
Sie hatte das Gefühl, daß ihr Rücken platzte, und schrie vor Schmerzen laut auf. In diesem Augenblick ging ein Brausen durch das Schilf am Ufer des Baches.
„Das ist der Morgenwind,“ dachte die Larve. „Die Sonne möchte ich wenigstens noch einmal sehen, ehe ich sterbe.“
Und mit großer Mühe kroch sie auf eines der[S. 101] Seerosenblätter, streckte die Beine aus und machte sich auf den Tod gefaßt.
Aber als die Sonne rot und rund im Osten aufging, da platzte der Rücken der Larve auf einmal. In ihrem Innern kribbelte und krabbelte es, und ihr war so eng und bange zumut — o, sie litt unsägliche Qualen.
Überwältigt schloß sie die Augen, aber im Innern, da drängte und arbeitete es weiter. Endlich merkte sie auf einmal, daß sie frei war, und als sie die Augen aufmachte, schwebte sie auf steifen, glänzenden Flügeln durch die Luft als anmutige Libelle.
Doch unten auf dem Seerosenblatt lag ihre häßliche, graue Larvenhülle.
„Hurra!“ rief die neugebackene Libelle. „Nun ist mein schönster Traum doch in Erfüllung gegangen!“
Und im Fluge durchschwirrte sie die Luft, als ginge die Fahrt bis ans Ende der Welt.

[S. 102]
„Die Närrin hat doch ihren Willen bekommen!“ dachte die Seerose. „Nun wollen wir sehen, ob sie zufriedener geworden ist.“
*
Zwei Tage darauf kam die Libelle angeflogen und setzte sich auf die Seerosenblüte.
„I, guten Tag!“ rief die Seerose. „Sieht man dich endlich einmal? Ich dachte wirklich, du wärest zu vornehm geworden, deine alten Freunde zu begrüßen.“
„Guten Tag,“ sagte die Libelle. „Wohin soll ich die Eier legen?“
„Ach, die wirst du schon unterbringen!“ antwortete die Blüte. „Setz’ dich ein Weilchen zu mir und erzähle mir, ob du jetzt zufriedener bist als damals, als du als häßliche kleine Larve an meinem Stengel auf und nieder krochst!“
„Wohin soll ich die Eier legen? Wohin soll ich die Eier legen?“ rief die Libelle und flog surrend hin und her, legte ein Ei hierhin und eines dahin und ließ sich endlich müde und matt auf ein Blatt nieder.
„Nun?“ fragte die Seerose.
„Ach, damals hatte ich es besser, viel besser!“ seufzte die Libelle. „Im Sonnenschein ist es ja zwar herrlich; und ein Vergnügen ist es, so über dem Wasser dahinzufliegen; aber habe ich denn je Zeit, mich daran zu erfreuen? Ich bin so furchtbar be[S. 103]schäftigt, mußt du wissen. Früher hatte ich an nichts zu denken. Jetzt aber muß ich den ganzen Tag lang umherfliegen, um die dummen Eier unterzubringen. Keinen Augenblick bin ich frei, und kaum habe ich Zeit zum Essen.“
„Hab’ ich’s dir nicht vorhergesagt?“ rief die Seerose triumphierend. „Hab’ ich dir nicht prophezeit, daß du aus dem Regen in die Traufe kommen würdest?“
„Leb’ wohl,“ antwortete die Libelle mit einem Seufzer, „ich habe keine Zeit, deine spöttischen Bemerkungen anzuhören. Ich muß heute noch mehr Eier legen.“

Doch als sie gerade fortfliegen wollte, da kam der Star.
„So eine schöne kleine Libelle!“ sagte er; „das ist ein prächtiger Leckerbissen für meine Kleinen!“
Und wupps! packte er die Libelle mit dem Schnabel und flog mit ihr fort.
„Da haben wir die Geschichte!“ rief die Seerose, und ihre Blätter zitterten vor Entsetzen. „Diese Tiere, o diese Tiere! Das sind lächerliche Geschöpfe. Da lobe ich mir doch wirklich mein stilles, friedliches Dasein. Ich tue keinem etwas zuleide, und keiner tut mir etwas. Wie bin ich doch so glück...“
Ehe sie aussprechen konnte, glitt ein Boot dicht an ihr vorüber.
„Ei, was für eine schöne kleine Seerose!“ rief Ellen, die im Boote saß, „die muß ich haben.“
[S. 104]
Sie beugte sich über den Rand des Bootes und riß die Blüte mit einem Ruck los. Als sie nach Hause gekommen war, setzte sie sie in ein Glas Wasser, und da stand sie drei Tage lang zwischen anderen Blumen.
„Das verstehe ich nicht!“ sagte die Seerose am vierten Morgen. „Es ist mir ja um kein Haar besser ergangen als der armen Libelle.“
„Nun sind die Blumen verwelkt,“ sagte Ellen und warf sie zum Fenster hinaus.
Da lag die Seerose mit ihren feinen, weißen Blättern an der schmutzigen Erde.

[S. 105]
Justizrats waren ausgezogen, und die Villa stand leer.
Eine Frau war dagewesen und hatte in allen Zimmern reingemacht. Man hatte auch den Hof gefegt, und dann war alles verschlossen worden, denn das Haus war nicht wieder vermietet.
Die Ratte fuhr umher — die Treppe zum Speicher hinauf, die Treppe zum Keller hinab — schnupperte überall und fand nichts.
„Diese boshaften Menschen..... diese unangenehmen Menschen,“ sagte sie. „Alles wie weggeblasen. Nicht einen Happen haben sie für eine hungrige alte Ratte übriggelassen.“
Und sie lief auf den Hof hinunter, kroch unter der Tür durch in den Holzschuppen und sah sich um.
„Nicht die Spur,“ schalt sie. „Ich werde wohl auch ausziehen müssen.“
Damit lief sie wieder hinaus.

Aber sie irrte sich, wenn sie meinte, es sei niemand im Holzschuppen.
Ganze vier waren da.
Zunächst einmal ein Stück Steinkohle, das war glänzend schwarz. Dann ein Stück Koks, das matt[S. 106] aussah und müde und aufgerieben. Ferner ein Buchenscheit, das im Finstern ganz weiß leuchtete. Und als Vierter im Bunde ein Stück armseligen Torfs.
Jeder von ihnen lag in seiner Ecke, und keiner schien den andern etwas anzugehn. Aber der Raum war so klein, daß sie bequem miteinander schwatzen konnten. Und da kein anderer zum Schwatzen da war, so nahmen sie vorlieb.
„Die idiotische Ratte!“ begann die Steinkohle. „Das einfältige Wesen! Sagt, es wär’ keiner hier, und dabei bin ich doch hier.“
„Und ich,“ sagte das Holzscheit. „Mich übersieht man wohl nicht.“
„Vergiß nur ja mich nicht,“ flüsterte das Stück Koks mit matter Stimme. „Ich kann nicht so schreien wie die Kohle und das Brennholz, denn ich hab’ viel durchgemacht, und das macht einen stiller. Aber darum bin ich doch nicht weniger wert.“
„Ja... ich bin ja auch noch hier,“ meinte der Torf bescheiden. „Mit Verlaub zu sagen.“
Die Steinkohle sah sich um.
„Natürlich seid ihr hier. Leugne ich das etwa? Aber wozu seid ihr denn eigentlich nütze? Darauf kommt’s eben an!“
„Tja — hm... ich bin ja nichts anderes als ein bißchen Brennmaterial,“ versicherte der Torf treuherzig. „Verzeiht, daß ich es sage, aber ich wurde ja gefragt.“
[S. 107]
„Ich bin das gleiche,“ sagte das Stück Koks.
„Und ich auch,“ das Holzscheit. „Und auch die großsprecherische Steinkohle ist meines Wissens zu nichts anderm gut, als verbrannt zu werden.“
„Seht richtig,“ erklärte die Steinkohle. „Verbrannt zu werden, ist unser gemeinsames Los. Aber wenn unser Ende auch das gleiche ist, darum ist’s doch noch nicht gesagt, daß wir gleich viel taugen. Ich bin der Wärmste... ich habe so viel Hitze in mir, daß ich manchmal nahe daran bin, auseinandergesprengt zu werden.“
„Aber ich bin der Flottste und der Teuerste,“ sagte das Holzscheit. „Nur reiche Leute sind in der Lage, mit mir zu feuern.“
„Ich bin der Reinlichste,“ sagte das Stück Koks.
„Entschuldigt,“ warf der Torf ein, „ich bin bloß der Billigste.“
„Du himmlische Güte!“ spottete die Steinkohle, „ein jeder hat ja seine Vorzüge. Ich glaube jedoch, daß mir niemand widersprechen wird, wenn ich hervorhebe, daß ich aus der feinsten Familie bin. Ich stamme aus der allerältesten Zeit... es lebt niemand in der Welt, der so alt ist wie ich.“
„Doch... ich,“ widersprach der Koks.
„Was faselst du?“ fragte die Steinkohle.
„Ja.... ich bin nun auch nicht gerade aus dem heutigen Jahrgang,“ ließ sich der Torf vernehmen. „Aber es würde mir nie einfallen, davon zu reden.“
„Und ich bin jung und frisch,“ sagte das[S. 108] Buchenscheit. „Bin noch nicht einmal ganz und gar trocken geworden. Ich pfeif’ auf euer elendes Alter.“
Ein Weilchen lagen sie still da. Dann sagte der Torf:
„Verzeihung... aber wollen wir nicht jeder unsere Geschichte erzählen? Wir werden doch hier ein halbes und vielleicht ein ganzes Jahr zu liegen haben. Und Geschichten, die sind so schön.“
„Meinetwegen,“ sagte der Koks, „nur muß ich auf das bestimmteste verlangen, daß ich zuletzt drankomme. Denn erstens bin ich so schwach, daß ich mich erst ein wenig erholen muß. Und zweitens würde eure Ungeduld, an die Reihe zu kommen, mich ganz nervös machen. Drittens —“
„Das Drittens schenk’ ich dir,“ unterbrach ihn das Holzscheit. „Nun beginne ich. Meine Geschichte klingt frisch und frei... ich besinne mich noch auf alles, als wär’ es gestern gewesen.“
„Fang an!“ sagte die Steinkohle. „Nach dir kommt der Torf an die Reihe, und dann komme ich.“
„Ich war einmal der stolzeste Baum im Walde,“ begann das Buchenscheit.
„Prahlhans!“ warf die Steinkohle dazwischen. „Wart’ du nur, bis die Reihe an mich kommt!“
„Wart’ selber so lange,“ sagte das Holzscheit. „Ich war also ein Baum... ein großer Baum...[S. 109] eine Buche. Ich stand im Walde, direkt am See, und konnte meine Zweige im blanken Wasser spiegeln. Frühling auf Frühling trieb ich Knospen, und ich kann wohl selbst von mir sagen, daß ich einen schönen Anblick darbot. Aber ich brauch’ es nicht zu sagen. Denn andere haben das schon getan. Alle, die mich sahen, bewunderten mich in lauten Tönen. Es war auch ein Dichter darunter, der Verse über mich schrieb und in die Zeitung setzte. Viele Liebesleute kamen und schnitten ihre Namen in meine Rinde ein. Zwei Raben bauten ihr Nest in meinem Wipfel, und rings in mir wohnten Buchfinke und Stare und waren hoch erfreut über ihr Logis.“

[S. 110]
„Das klingt recht hübsch,“ meinte die Steinkohle. „Es ist wirklich ärgerlich, daß man dir so gar nichts von alledem ansehen kann.“
„Wenn man fortwährend in dieser Weise unterbrochen wird, kann ich mich nicht darauf einlassen zu erzählen, wenn ich an die Reihe komme,“ sagte der Koks. „Wollen wir nicht gegenseitig unsre Nerven respektieren?“
„Zu Füßen lag mir stets ein wunderschöner Teppich,“ fuhr das Buchenscheit fort, „der war im Frühling von weißen Anemonen gewirkt. Späterhin kam feines grünes Gras an ihre Stelle. Im Winter aber macht’ ich mir selber einen dicken dichten Teppich aus meinen braunen Blättern zurecht, und dann fiel vom Himmel der Schnee darauf. Jeden Sommer wurde ich größer und größer... an alle Zweige fügt’ ich ein kleines Stück, und im Stamm legte sich Ring an Ring, bis ich schließlich ein echter, rechter Riese war. Wenn es im Winter ganz toll stürmte und meine Kameraden sich bogen und brachen, dann stand ich gleichgültig da. Ein langes Leben war’s und ein herrliches Leben zugleich.“
„Verzeih’,“ sagte der Torf. — „Aber wie kam es denn, daß es zu Ende ging?“
„Das weiß ich nicht,“ erwiderte das Brennholz. „Ich wurde gewiß zu groß. Ich hörte die Menschen darüber reden, daß die jungen Bäume auch an die[S. 111] Reihe kommen müßten, und daß ich gutes Brennmaterial abgeben werde und dergleichen mehr.“
„Die Menschen... ha, ha, ha!“ lachte die Steinkohle.
„Die Menschen... Verzeihung... ha, ha, ha,“ rief der Torf.
„Ich lache überhaupt nie mehr,“ sagte der Koks „Tät ich’s aber noch, so würd’ ich jetzt lachen.“
„Ich weiß nicht, was ihr zu lachen habt,“ sagte das Holzscheit verletzt. „Die Menschen sind doch unsre Herren und Meister, sollt’ ich meinen. — Sie haben mich durchgesägt, ein Tau um mich gezogen und an mir gezerrt, bis ich stürzte. Dreißig Mann mußten mithelfen bei dem Stück Arbeit, und ich fiel mit solchem Krachen nieder, daß die Erde erbebte. Dann sägte man mich wieder und wieder durch, spaltete mich mit Äxten, stapelte die Teile auf, verkaufte mich auf der Auktion und fuhr mich fort. Jetzt ist nur das Stück, das ihr hier seht, von mir übrig. Da habt ihr meine Geschichte! Weiß jemand eine bessere, bitte schön, so soll er damit herausrücken!“
„Vermutlich gibt es so einen,“ sagte die Steinkohle. „Aber erst wollen wir jetzt den Torf anhören.“
„Ja... Verzeihung,“ sagte der Torf. „Was ich zu sagen habe, ist ja ganz unbedeutend.“
„Erzähl’!“ riefen die anderen.
[S. 112]
„Ich war einmal der stolzeste Baum im Walde,“ sagte der Torf.
Weiter kam er zunächst nicht, so unbändig fingen die andern bei diesen Worten zu lachen an.
„Ja... Verzeihung! Sie müssen sehr entschuldigen ... ich sehe wohl ein, daß es lächerlich klingt, aber was soll ich machen? Ich bin ja genötigt, meine Geschichte zu erzählen, wie sie ist. Und ich war wirklich ein schöner Baum, selbst wenn man mir’s nicht mehr ansehen kann! Freilich keine Buche, sondern nur eine Birke...“
„Die Birke ist ein sehr hübscher Baum,“ sagte das Brennholz. „Nicht von besondrer Bedeutung und ohne rechten Schatten, aber sehr fein.“
„Schönen Dank!“ sagte der Torf.
„Dann haben dich die Menschen wohl gar auch gefällt?“ fragte das Holzscheit.
„Nein, gewiß nicht,“ sagte der Torf. „Offen gestanden, ich hab’ nie einen Menschen gesehen, bis ich zu Torf wurde. Darum hab’ ich mir vorhin zu lachen erlaubt, als die Menschen erwähnt wurden, wenn’s auch vielleicht nicht bescheiden war.“
„Weiter!“ mahnte die Steinkohle.

„Ich war also eine Birke. Auf mir ließen sich allerdings keine Vögel nieder; aber in dem Moor, auf dem ich stand, da gab es Vögel und Hirsche, Füchse und Wölfe und Bären. Im Sommer[S. 113] ging der Bär mit seinen Jungen umher und brummte. Im Winter heulten die Wölfe vor Hunger, daß es viele Meilen weit zu hören war. Auch Elentiere gab es in großen Herden. Und in den Lüften flogen mächtige Adler... ja, Verzeihung, daß ich’s sage, vielleicht klingt es eingebildet ... aber als ich zu Torf geworden war und im Stapel stand und mich im Walde umsah, da kam es mir wirklich so vor, als ob in alten Tagen, als ich ein Baum war, mehr Leben im Walde gewesen wäre.“
„Hahaha!“ lachte die Steinkohle.
„Worüber lachst du?“ fragte das Holzscheit.
„Ach... ich lache nur über den Torf, der da von alten Tagen redet!“ erwiderte die Steinkohle. „Der Grünschnabel!“
„Meine Nerven können diese Unterbrechungen auf die Dauer nicht vertragen,“ sagte der Koks. „Weiter, lieber Torf!“
„Ja, Verzeihung. Man erzählt ja, so gut man’s versteht. — Na. Also dann kam einmal ein grauenhafter Sturm, der wehte mich um, und ich fiel plumps! ins Moorwasser hinein. Da hab’ ich lange, lange Zeit gelegen... im ersten Frühling bekam ich sogar Knospen. Die sprangen auf, genau so wie damals, als ich noch ein Baum war. Aber das war bald vorbei. Der Biber benagte mich, und im Wasser begann ich zu faulen. Nach und[S. 114] nach kam ich ganz von meinem Stumpfe los, und dann sank ich.“
„Sieh, sieh,“ sagte die Steinkohle. „Du hast ja wirklich etwas erlebt.“
„Weiter!“ bat der Koks.
„Ja, da sank ich denn nun und sank und sank. Manchmal ging es schneller und manchmal langsamer. Bald blieb ich an etwas hängen, und bald sträubten sich meine Zweige. Aber hinunter kam ich doch, tief hinunter in das braune Wasser. Um mich her wuchs allerhand Grünzeug zusammen, und dies und jenes sank zu mir herab, so daß ich allmählich ganz vergraben war im Schlamm. Und da fing ich ernstlich zu faulen an.“
„Uha,“ rief das Brennholz. „Das Faulen ist eine ekelhafte Geschichte. Ich hatte mal einen unglücklichen Zufall an meiner einen Seite, wo ein Zweig abgebrochen war. Da kam der Specht und hackte ein Loch hinein, die Larven nagten, das Regenwasser sammelte sich zu einem kleinen See... es war widerlich! Ich hatte einen Vetter, der neben mir stand und einen ähnlichen Zufall erlitt. Der wurde ganz hohl davon.“
„Laß du den Torf reden!“ mahnte der Koks.
„Eigentlich hab’ ich nichts mehr zu erzählen,“ sagte der Torf. „Allmählich bin ich vollständig aufgefault. Es blieb nicht viel mehr von mir übrig als ein Knast, der mitten in mir sitzt. Ich wurde vermischt mit all dem andern, was im Moor war;[S. 115] und das, was von oben herunterkam, drückte und drückte so gewaltig auf uns, daß ich gar nicht mehr so recht weiß, was eigentlich zu mir und was zu dem andern gehörte. Die Jahrhunderte verstrichen. Eines Tages wurde in dem Moor Torf gestochen. In Kuchenform wurden wir auf die Wiese geworfen, zugeschnitten, in der Sonne getrocknet, entzweigebrochen, aufgestapelt und an den Justizrat verkauft. Das ist das Ganze. Verzeiht, daß es nicht mehr ist!“
„Es war doch wenigstens etwas,“ sagte die Steinkohle. „Und es war viel besser als die Geschichte der Buche. Du hast Alter, kleiner Torf, das ist die Pointe! Nur die alten Geschichten taugen etwas. All das Neumodische ist reiner Unsinn.“
„Na,“ sagte das Holzscheit. „Meine dreihundert Jahre hab’ ich doch auch auf dem Buckel.“
„Nun, ich bin wirklich nicht älter als zweitausend,“ erklärte der Torf.
„Laß jetzt die Steinkohle ihre Geschichte erzählen,“ sagte der Koks.
Und es folgte:
„Ich war einmal der stolzeste Baum im Walde —.“
„Na... also du auch?“ rief lachend das Holzscheit. „Das muß ja ein recht schwarzer Baum gewesen sein!“
[S. 116]
„Liebes Holzscheit,“ sagte die Steinkohle. „Du magst ja gerne lachen. Unwissende Leute lachen immer über das, was sie nicht verstehen; und ich nehme an, du wirst Lachkrämpfe bekommen, ehe meine Geschichte zu Ende ist.“
„Weiter!“ befahl der Koks.
„Ja... das ist leicht genug gesagt,“ begann die Steinkohle wieder. „Aber schwerer getan. Alles in allem, kann vermutlich keiner unter euch eine Silbe von dem verstehen, was ich jetzt erzählen will.“
„Gewiß... ich kann es,“ sagte der Koks.
„Meinst du!“ spottete die Steinkohle.
„Meine Geschichte ist im allgemeinen nicht für zerrüttete Nerven. Aber jetzt hört mich also an! — Vielleicht ist es das beste, wenn ich euch gleich erzähle, daß ich aus England bin, und daß ich auf der Reise hierher durch euren Wald kam... den Wald, wo das Brennholz als Buche und der Torf als Birke gestanden haben. Ich sage ungern jemandem etwas Böses nach, am allerwenigsten denen, die tiefer gestellt sind im Leben als ich. Aber es war wirklich ein armseliger Wald! Damals, als ich ein Baum war — da gab es noch Wälder. Aber das ist freilich hunderttausend Jahre her.“
„Das ist eine Lüge,“ schrie das Brennholz.
„Es ist wahr,“ sagte der Koks.
„Es freut mich, daß der Koks mir Glauben schenkt,“ erwiderte die Steinkohle. „Obwohl er doch nicht mehr Grund dazu hat als das Brennholz.[S. 117] Keiner von euch hat es gesehen. Die Wälder, die damals auf der Erde standen, sind weg... ganz und gar weg. Nur die Steinkohlen sind davon übrig. Wogegen es Buchen und Birken noch heut in Massen gibt.“
„Weiter!“ drängte der Koks.
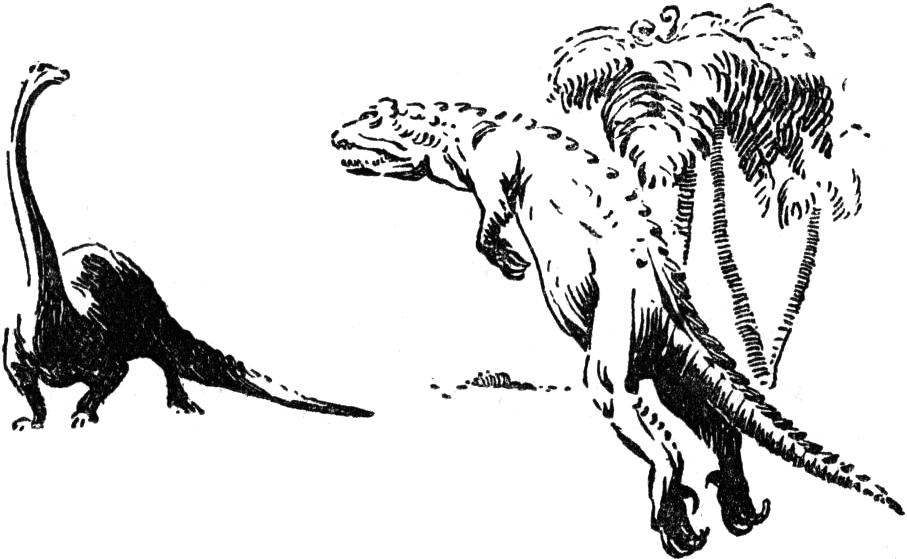
„In solch einem Walde war ich der stolzeste Baum. Ein Farrenbaum. Heutzutage habt ihr solch kleines Krautwerk, das ihr Farren nennt... Gott mag wissen, woher die stammen. Ich war ein Baum ... mit hohem, mächtigem Stamm und breiter Krone. Der ganze Wald bestand aus solchen Bäumen. Und Menschen... es gab keine Menschen damals. Auch keine Vögel, Hirsche und Bären und wovon ihr zu schwatzen wißt. Das ist allerhand kleines Gewürm, das hinzukam, seitdem alles hier auf Erden kleiner geworden ist. Ungeheure Echsen krochen auf den Felsen umher, andere derselben Art schwammen in[S. 118] den Seen, wieder andere durchflogen die Luft. Ich weiß wirklich nicht, wie ich sie euch beschreiben soll... doch, ich sah auf der Reise hierher ein winziges Tierchen, das sonnte sich auf einem Stein, und der Zugführer nannte es eine Eidechse, glaub’ ich. Wenn ihr so eine gesehen habt und sie euch tausendmal so groß denken könnt und mit einem fürchterlichen Schlund voll spitziger Zähne... dann habt ihr eine ganz schwache Vorstellung von den Tieren, unter denen ich meine Jugend verlebte.“
„Das kann man eine Geschichte nennen,“ sagte der Torf ehrerbietig.
„Da stand ich also. Meilenweit im Lande standen wir unter unseresgleichen. Aber freilich...“
Die Steinkohle schwieg ein Weilchen und seufzte.
„Weiter,“ sagte der Koks.
„Ja. Aber ihr wißt nicht einmal, wie es damals um das Land bestellt war. Und es ist mir auch gar nicht möglich, es euch begreiflich zu machen. Das Land war ja ganz anders als jetzt... aber ich muß das überspringen. Ich konnte ja nicht anders, ich mußte vorhin lachen, als der Torf von dem See sprach, in den er als Birke fiel... Herr Gott, was für eine Pfütze das war! Nein, seht ihr... als ich vor hunderttausend Jahren im Walde stand, da geschah eine Erdumwälzung. Das war nicht so ein Sturm, der ein paar armselige Zweige bricht... die ganze Erde zitterte, versteht ihr... sie spaltete sich... die Felsen spalteten sich...[S. 119] alles stürzte in die Schlünde hinab und wurde zerschmettert, Feuer schlug aus der Erde empor, und dann kam das Meer und überspülte das Ganze.“
„Fürchterlich!“ unterbrach der Torf.
„Da lag ich nun. Verborgen, begraben in Sand und Lehm und was weiß ich. Ich ahne nicht im mindesten, was oben in der Welt geschah während der hunderttausend Jahre, die vergingen, bis ich wieder ans Tageslicht kam. Nur kann ich an dem Ganzen sehen, daß es seit meiner Zeit böse rückwärtsgegangen ist mit allen Dingen.“
„Danke verbindlichst! Das kennen wir!“ sagte das Holzscheit. „So reden alle alten Leute. Ich entsinne mich deutlich, wie eines Tages zwei alte Damen in meinem Schatten saßen, die davon sprachen, was für wunderschöne Mädchen auf der Welt waren damals, als sie junge Mädchen waren.“
Die Steinkohle schwieg ein Weilchen.
„Weiter!“ sagte der Koks.
„Ja, ganz recht. Ich hing nur so meinen Gedanken nach. Es ist so seltsam für mich, all das mit anzuhören von Menschen und alten Damen und Mädchen, wovon ich nicht das geringste weiß, trotzdem ich hundertmal so alt bin wie der Älteste von euch. — Na, da lag ich also, und keiner kann sich einen Begriff davon machen, wie ich gedrückt wurde von allem, was oben auf mir lag. In mir entwickelte sich Feuer... nicht solch helle Lohe,[S. 120] die emporschlägt, wenn ein Endchen Brennholz brennt, sondern ein glimmendes, wütendes Feuer, das mich ganz veränderte. Alles, was von Leben und Kraft in mir war, das sammelte sich an zu etwas Unbändigem, Wahnwitzigem, wie ihr’s euch nicht vorstellen könnt, zu Gas nämlich.“
„Ach ja... Gas,“ sagte der Koks und fing jämmerlich an zu weinen.
„Ich sagte es ja, meine Geschichte sei zu stark für Ihre Nerven,“ meinte die Steinkohle.
„Fahrt — nur — fort,“ sagte der Koks und prustete nach jeder Silbe.
„Ich denke, die Erde hat sich gesenkt und wieder gehoben, und das Meer hat sie überspült und ist viele Male fortgeströmt in den hunderttausend Jahren, die ich da lag,“ erzählte die Steinkohle weiter, „davon weiß ich nichts. Eines Tages aber bohrten die Menschen, von denen ihr so viel redet, sich zu mir herunter. Da sah ich sie zum erstenmal. Sie gruben Gänge in den Felsen, wo ich lag, lange Gänge, tief unter der Erde, den einen länger und tiefer als den andern. Sie hackten mich und die andern aus den Schichten los, in denen wir lagen, und hißten uns in Körben empor. Nicht wenige von ihnen erschlugen wir während ihrer Arbeit. Denn als wir Luft bekamen, ließen wir das Gas frei, das in uns war, und es erstickte sie. Kam ein bißchen Feuer an uns heran, so explodierte unser Gas mit einem fürchterlichen Knall, zersprengte das[S. 121] Ganze und tötete die Leute, die in den Gängen waren.“
„O... das Gas... das Gas!“ schluchzte der Koks und bewegte sich hin und her, als käme er um vor Schmerzen.
„Jetzt bin ich auf der Stelle fertig,“ sagte die Steinkohle. „Den Rest meiner Geschichte kennt alle Welt. Ich wuchs auf der Erde als der stolzeste Baum des Waldes, bevor die Menschen erschienen. Ohne die Hilfe der Menschen wurde ich zu dem, was ich bin. Und als sie mich dann entdeckten, da wurde ich ihnen eine größere Hilfe als alles andre, was sie finden. Ich bin das vornehmste Brennmaterial der Welt. Ich treibe alle Fabriken, Eisenbahnen und Dampfschiffe der Erde. Ich habe soviel Hitze in mir wie kein zweiter. Von mir kommt das Gas.“
„Das Gas... ja, das Gas!“
Wieder war es der Koks, der so jammerte.
„Das ist meine Geschichte,“ sagte die Steinkohle. „Ich denke, sie sticht die euren aus.“
„Das ist gewiß,“ sagte der Torf.
„Wird auch wohl die letzte Geschichte sein, die wir zu hören bekommen,“ sagte das Brennholz. „Der Koks sieht nicht danach aus, als ob er sich zu einer Erzählung aufrappeln könnte.“
„Doch... aber gewiß,“ sagte der Koks. „Laßt mich bloß meine Gedanken ein bißchen sammeln, dann wird es gehen.“
Und der Koks faßte sich und erzählte.
[S. 122]
„Ich war einmal der stolzeste Baum im Walde —.“
Es läßt sich ganz und gar nicht beschreiben, wie es im Holzschuppen herging, als auch der Koks seine Erzählung mit diesen Worten begann.
Das Holzscheit schlug einen Purzelbaum vor Lachen, die Steinkohle grinste, daß sich geradezu Gasgeruch bemerkbar machte, der Torf rollte in einen Winkel und kicherte.
Die Ratte kam unter der Tür her angefahren.
„Mir scheint, hier war jemand?“ sagte sie.
Sie schnüffelte umher, fand aber nichts und lief wieder ihrer Wege.
„Teuerster Koks,“ sagte die Steinkohle, als sie sich wieder erholt hatte. „Deine Nerven müssen noch arg mitgenommen sein. Oder hast du etwa einen kleinen Anfall von Größenwahnsinn bekommen?“
„I, was für ein Baum du gewesen sein mußt!“ höhnte das Holzscheit. „Wenn ich dich doch nur gesehen hätte in all deinem Glanz und deiner Herrlichkeit.“
„Verzeiht!“ sagte der Torf. „Ich lachte, weil die andern lachten, trotzdem das vielleicht unbescheiden war. Aber wollen wir nicht den Koks zu Ende erzählen lassen?“
[S. 123]
„Erzähle!“ sagte das Holzscheit. „Wird ja eine Geschichte recht zum Lachen werden.“
„Im Gegenteil,“ erwiderte der Koks. „Meine Geschichte ist überaus traurig. Nicht weil ich meine, daß die euren so übertrieben amüsant wären, für mich selbst wenigstens. Aber mir ist’s noch schlimmer ergangen. Die Sache ist die, daß ich der leibhaftige Bruder der Steinkohle bin.“
„Nein, was Sie wissen, mein Bester!“ rief die Steinkohle.
„Und doch ist es so!“ sagte der Koks.
„Hahaha,“ lachte das Holzscheit. „Mir scheint auch, ihr gleicht euch ganz auffallend, wenn man recht genau zusieht.“
„Ich protestiere auf das bestimmteste,“ sagte die Steinkohle. „Man sehe mich an und sehe den Koks an. Er ist löchrig und jämmerlich, leicht wie eine Feder... ein jeder kann sehen, daß er ein armseliger Kerl ist, nicht vier Pfennige wert. Und dann sehe man mich an! Ich bin hart und bin schwer. Ich leuchte. Ich bin ein leiblicher Vetter des Diamanten, müßt ihr wissen.“
„Ich wahrhaftig nicht minder,“ sagte der Koks. „Es ist gar nicht hübsch von dir, daß du mich verleugnest. Wärest du behandelt worden wie ich, so sähest du wirklich auch kein bißchen besser aus.“
„Dann laß hören,“ sagte das Holzscheit.
„Ihr dürft ihm kein Wort glauben,“ versicherte die Steinkohle.
[S. 124]
„Ich bin aus England, ebenso wie die Steinkohle,“ sagte der Koks. „Ich wuchs in demselben Wald und war sogar ein Stück von demselben Farrenbaum — vor hunderttausend Jahren. Darum ist meine Geschichte genau dieselbe wie die der Steinkohle, bis auf...“
Der Koks schwieg und kämpfte mit seiner Rührung.
„Na?“ fragte das Holzscheit.
„Laßt ihn sich fassen!“ sagte der Torf.
Doch der Koks brach in ein Schluchzen aus, das so gewaltig war, daß er nahe daran war, entzweizugehen.
„Bis auf den Augenblick, als das Gas von mir ging,“ sagte er dann.
„Herrgott,“ meinte die Steinkohle. „Sollte es möglich sein?“
„Es ist die reine Wahrheit,“ sagte der Koks. „Wir wurden zu derselben Zeit aus der Kohlenmine ausgehauen, in demselben Korb emporbefördert, und auf demselben Schiff kamen wir hier in dies Land. Aber dann trennten sich freilich unsere Wege. Denn ich kam ins Gaswerk, und da schlossen sie mich in einen großen Behälter ein und erwärmten mich, bis alles Gas aus mir entwichen war. Und dann verkauften sie mich für billiges Geld an arme Leute mit kleinen Stuben.“
Der Koks schluchzte und schluchzte, und die[S. 125] andern ehrten seinen Kummer, weil sie ihn verstanden.
„Das Ganze ist im Grunde genommen recht sonderbar,“ sagte das Holzscheit nachdenklich.
„Nicht herausfinden kann man sich,“ seufzte der Koks.
„Wäre ich nun ins Moor gefallen, so wäre ich vielleicht zu Torf geworden,“ sagte das Holzscheit.
„Und wenn ich vor hunderttausend Jahren gefällt worden wäre, so wäre ich zu Brennholz geworden,“ sagte die Steinkohle.
„Hätte ich noch neunundneunzigtausend Jahre im Moor gelegen, so hätte ich vielleicht mein Dasein als Steinkohle beschlossen,“ orakelte der Torf.
„Und hätten sie mir nicht das Gas entzogen —,“ erklärte der Koks.
Mehr konnte er nicht sagen.
Eine Weile war’s still im Holzschuppen. Ein jeder dachte an seine Siebensachen. Dann ließ der Torf sich vernehmen:
„Nun hab’ ich es.“
„Was denn?“ fragte das Holzscheit.
„Ja... verzeiht!“ gab der Torf zur Antwort. „Ich hab’ nur herausgefunden, daß wir ein und dasselbe Ding sind in viererlei Gestalt.“
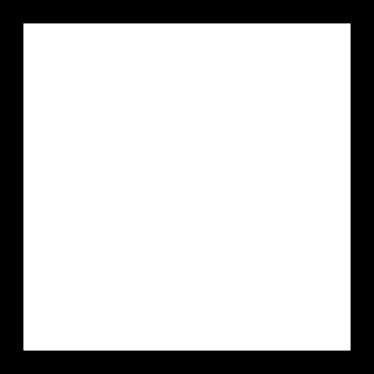
[S. 126]
Es war ein wundervolles, gesegnetes Jahr.
Sonnenschein und Regen wechselten gerade so, wie es am besten für das Getreide ist. Dauerte dem Bauer das trockne Wetter zu lange, so konnte man sicher sein, daß es schon am folgenden Tage regnete. Und meinte er, nun habe es genug geregnet, so teilten sich auch schon die Wolken; war es doch wirklich, als wenn er zu kommandieren hätte!

Darum war er guter Laune und klagte nicht[S. 127] wie sonst immer. Munter und vergnügt ging er mit seinen beiden Jungen durch die Felder.
„Die Ernte wird diesmal prächtig ausfallen,“ sagte er. „Die Scheunen bekomme ich voll und werd’ ein gutes Stück Geld verdienen. Dann kauf’ ich neue Hosen für Jens und Ole, und auf den Jahrmarkt nehme ich euch auch mit.“
„Wenn du mich nicht bald mähst, Bauer, so leg’ ich mich,“ brummte der Roggen, und seine schweren Ähren neigten sich zur Erde.
Das konnte der Bauer nun freilich nicht hören; aber ansehen konnte er dem Roggen, was er auf dem Herzen hatte; darum ging er nach Hause und holte seine Sense. — —
„Man hat es gut im Dienste der Menschen,“ sagte der Roggen. „Ich kann wenigstens immer sicher sein, daß ich alle meine Körner an den Mann bringe. Die meisten kommen in die Mühle, was ja allerdings nicht so angenehm ist. Aber dann wird schönes, frisches Brot daraus. Man muß ja schon etwas aushalten, der Ehre wegen. Das übrige bewahrt der Bauer auf als Saat fürs nächste Jahr.“
Neben dem Getreide, an der Hecke und am Grabenrand, stand das Unkraut. Distel und Klette, Mohn, Glockenblume und Löwenzahn wuchsen da in dichten Büscheln und trugen alle reichlich Samen. Auch für sie war es ein gutes Jahr gewesen, denn Sonne und Regen fallen ebensogut aus das armselige Unkraut wie auf das vornehme Getreide.
[S. 128]
„Uns mäht keiner, und keiner fährt uns in die Scheune,“ sagte der Löwenzahn und schüttelte den Kopf, aber ganz vorsichtig, damit die Samen nicht zu zeitig herausfallen sollten. „Was soll nur aus allen unseren Kindern werden?“
„Mir wird ganz schlimm zumute, wenn ich daran denke,“ seufzte der Mohn. „Hier steh’ ich mit vielen hundert Samen und weiß nicht, wohin damit.“
„Wir wollen den Roggen um Rat fragen!“ schlug die Klette vor.
Und sie fragten den Roggen, was sie tun sollten.
„Wenn man sein Schäfchen auf dem Trocknen hat, soll man sich nicht um fremde Angelegenheiten bekümmern,“ antwortete der Roggen. „Nur eins möcht’ ich euch raten: Werft mir ja eure dummen Samen nicht aufs Feld, denn dann bekommt ihr’s mit mir zu tun!“
Dieser Rat konnte nun den wilden Blumen nicht viel nützen; und den lieben langen Tag grübelten sie darüber nach, was sie tun sollten. Als die Sonne unterging, schlossen sie sich und schliefen ein; aber die ganze Nacht träumten sie von ihren Samen, und am nächsten Morgen hatten sie Rat gefunden.
Der Mohn wachte zuerst auf.
Vorsichtig tat er ein paar von seinen obersten Klappen auf, so daß die Sonne gerade auf die Samen[S. 129] scheinen konnte. Dann rief er den Morgenwind an, der spielend die Hecke entlanglief.
„Lieber Wind!“ bat er freundlich, „willst du mir einen Gefallen tun?“
„Gewiß,“ antwortete der Wind, „es ist mir ganz lieb, wenn ich etwas zu tun bekomme.“
„Es ist ja nur eine Kleinigkeit,“ sagte der Mohn. „Ich möcht’ dich nur bitten, mich ordentlich zu schütteln und zu zausen, damit meine Samen weithin zerstreut werden.“
„Gern,“ erwiderte der Wind.
Und nach allen Seiten flogen die Mohnsamen. Der Stengel wurde zwar geknickt; aber das nahm der Mohn sich nicht weiter zu Herzen. Denn wenn man gut für seine Kinder gesorgt hat, dann hat man eigentlich seine Pflicht und Schuldigkeit getan.
„Leb’ wohl!“ sagte der Wind und wollte weiter.
„Wart’ mal,“ rief der Mohn. „Versprich mir erst, daß du’s nicht den andern erzählen willst. Sonst könnten sie auf denselben Gedanken kommen, und meine Samen hätten nicht so viel Platz.“
„Ich bin stumm wie das Grab,“ erwiderte der Wind und eilte weiter.
„Pst! Pst!“ rief die Glockenblume. „Hast du vielleicht Zeit, mir einen ganz kleinen Gefallen zu tun?“
„Na, was ist es denn?“ fragte der Wind.
„Ach, ich wollte dich nur bitten, mich ein wenig zu schütteln. Ich habe ein paar von meinen Klap[S. 130]pen aufgemacht und möcht’ so gern, daß meine Samen in die weite Welt kämen. Aber du darfst es nur ja nicht den andern erzählen, sonst könnten sie auch noch denselben Einfall haben.“
„Gewiß, gewiß!“ sagte der Wind lachend. „Ich werde nichts sagen.“
Und er rüttelte ordentlich an der Blüte und lief weiter.
„Lieber, lieber Wind!“ rief der Löwenzahn. „Wohin so eilig?“
„Was hast du denn schon wieder?“ fragte der Wind.
„Nichts Großes. Es ist wirklich schwer für uns dieses Jahr, alle unsere Samen unterzubringen; und man möchte doch gern gut für seine Kinder sorgen. Was die Glockenblume und der Mohn und die arme Klette anfangen sollen, das weiß ich wirklich nicht. Aber die Distel und ich, wir haben uns zusammengetan; und nun haben wir einen Ausweg gefunden. Du sollst uns dabei helfen.“
„Nun wären es also im ganzen vier,“ dachte der Wind und konnte ein lautes Gelächter nicht unterdrücken.
„Worüber lachst du?“ fragte der Löwenzahn. „Ich habe es vorhin wohl gesehen, wie du mit der Glockenblume und dem Mohn tuscheltest; aber erzählst du ihnen etwas, dann bekommst du überhaupt nichts zu wissen!“
[S. 131]
„Gott behüte!“ rief der Wind; „ich bin stumm wie ein Fisch. Was wollt ihr denn?“
„Wir haben oben an unseren Samen einen kleinen, feinen Regenschirm angebracht. Es ist das zierlichste Spielzeug, das du dir denken kannst. Du brauchst mich nur ein klein wenig anzublasen, dann fliegen die Schirmchen auf und fallen nieder, wo du es haben willst. Willst du?“
„Aber gewiß!“
Und rutsch! fuhr der Wind über Distel und Löwenzahn hin und entführte alle Samen mit sich aufs Feld.
Die Klette überlegte noch. Sie begriff etwas schwer, und darum dauerte es so lange.
Aber am Abend sprang ein Hase über die Hecke.
„Versteck’ mich! Hilf mir!“ rief er. „Des Bauern Hund ist mir auf den Fersen.“
„Du kannst dich hier hinter der Hecke verkriechen,“ sagte die Klette, „dann will ich dich verbergen.“
„Dazu scheinst du nun nicht gerade geeignet zu sein,“ entgegnete der Hase; „aber in der Not muß man sich ja behelfen, so gut man kann.“
Und er versteckte sich hinter der Hecke.
„Dafür könntest du ein paar Samen mit aufs Feld nehmen!“ bat die Klette, brach ein paar von ihren vielen Köpfchen ab und hängte sie dem Hasen an.

Kurz darauf kam der Hund angelaufen.
[S. 132]
„Da ist er!“ flüsterte die Klette, und mit einem Sprunge setzte der Hase über die Hecke und in den Roggen hinein.
„Hast du nicht den Hasen gesehen, Klette?“ fragte der Hund. „Ich fühle, ich bin zu alt für die Jagd! Auf dem einen Auge bin ich ganz blind, und meine Nase findet die Spur nicht mehr.“
„Gesehen habe ich ihn,“ antwortete die Klette; „und wenn du mir einen Gefallen tun willst, so werde ich dir zeigen, wo er steckt.“

Den Gefallen wollte ihr der Hund gern tun, und die Klette ließ ihm ein paar Köpfchen auf den Rücken fallen und sagte zu ihm:
„Reibe dir doch einmal deinen Rücken an dem Steg nach dem Felde zu, so daß meine Samen abfallen. Aber da mußt du nicht nach dem Hasen suchen; vor kurzem erst habe ich ihn in den Wald laufen sehn.“

Der Hund rieb seinen Rücken an dem Steg, und die Samen fielen aufs Feld; dann trabte er in der Richtung nach dem Walde zu davon.
„Nun hätte ich wenigstens meine Samen untergebracht!“ sagte die Klette und lachte vergnügt in sich hinein. „Wie es aber der Distel, dem Löwenzahn, der Glockenblume und dem Mohn ergehen soll, das weiß der liebe Gott.“
*
[S. 133]
Im nächsten Frühjahr war der Roggen schon recht weit gediehen.
„Wir haben’s eigentlich gut,“ flüsterten die Roggenhalme. „Hier stehen wir hübsch beisammen und sind ganz unter uns. Wir sind uns gegenseitig nicht im geringsten im Wege. Es ist doch wirklich ein schönes Dasein, im Dienste der Menschen zu stehen.“
Aber eines schönen Tages steckten eine ganze Menge Mohnblumen, Disteln, Löwenzahn, Kletten und Glockenblumen die Köpfchen hervor, mitten zwischen dem üppig gedeihenden Roggen.
„Was ist denn das?“ rief der Roggen. „Wie in aller Welt seid ihr hierher gekommen?“
Und der Mohn sah verwundert auf die Glockenblume und fragte:
„Wie kommst du hierher?“
Und die Distel sah die Klette an und fragte:
„Wie in aller Welt kommst du hierher?“
Alle staunten gar sehr, die anderen hier zu finden; und es dauerte eine geraume Weile, bis die Sache aufgeklärt war. Aber der Roggen war am ärgerlichsten, und als er die Geschichte vom Hund und vom Hasen und vom Wind gehört hatte, da geriet er ganz außer sich und rief:
„Gott sei Dank, daß der Bauer den Hasen im Herbst erschossen hat! Und der Hund ist glücklicherweise auch gestorben, der Erzschlingel! Von denen[S. 134] habe ich also nichts mehr zu befürchten. Aber wie darf der Wind es wagen, den Unkrautsamen aufs Feld des Bauern zu schleppen?“
„Nur nicht so hitzig, du grüner Roggen!“ rief da der Wind, der hinter der Hecke gelegen und alles mitangehört hatte. „Ich frage niemanden um Erlaubnis, sondern mache, was ich will, und jetzt mußt du dich vor mir beugen.“
Und er fuhr über den jungen Roggen hin, so daß die dünnen Halme hin und her schwankten.
„Siehst du,“ sagte er dann, „der Bauer sorgt für seinen Roggen, denn das ist sein Beruf. Aber der Regen, die Sonne und ich — wir nehmen uns euer aller an, ohne Ansehen der Person. Für uns ist das armselige Unkraut ebensoviel wert wie das vornehme Getreide.“
Da kam der Bauer, um nach seinem Roggen zu sehen; und als er das Unkraut gewahrte, das auf dem Felde stand, kraute er sich ärgerlich hinter den Ohren und fing an zu schelten.
„Das hat der Wind getan, der schlechte Kerl!“ sagte er zu Jens und Ole, die neben ihm standen, die Hände in den Hosentaschen — sie hatten schon ihre neuen Hosen an.
Aber da kam der Wind herbeigeflogen, wehte allen dreien die Mützen vom Kopfe und rollte sie ein gutes Stück Weges fort. Der Bauer und die beiden Jungen liefen den Mützen nach, aber der Wind war geschwinder als sie.
[S. 135]
Zuletzt rollten die Mützen in den Dorfteich, und der Bauer und seine Söhne mußten lange nach ihnen fischen und angeln, ehe sie sie wieder erwischten.
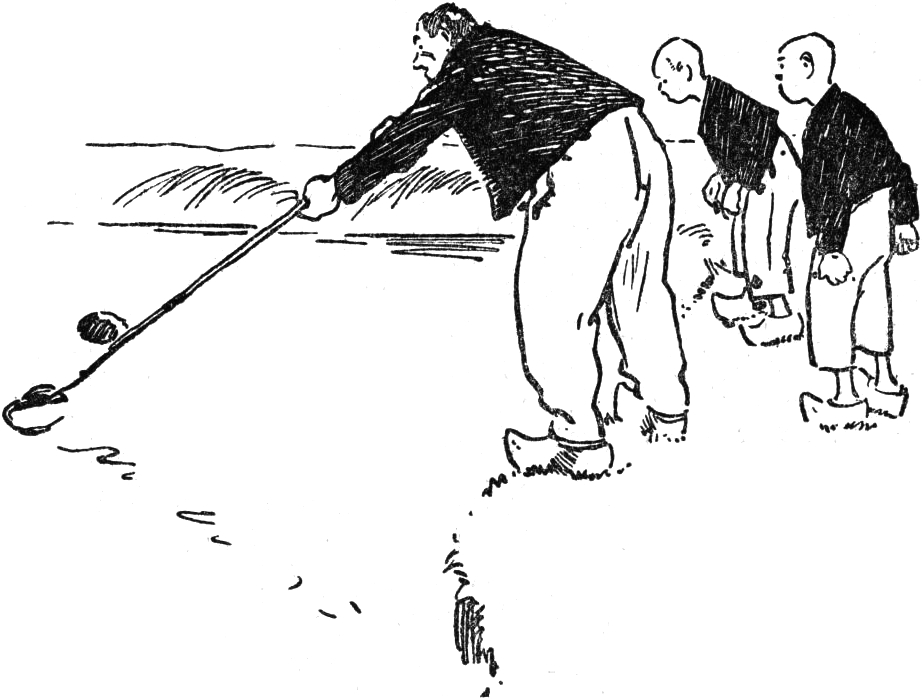
[S. 136]
Diese Geschichte spielt in der ganz alltäglichen Stube eines ganz alltäglichen Jungen.
Die Stube war nicht besonders groß und der Junge ebensowenig. Es stand ein eisernes Bett in dem Zimmer, wie kleine Kinder es haben; ein Bett, aus dem man nicht herausrollen konnte, und das sich größer machen ließ, je nach dem Alter. Ferner standen in der Stube ein Tisch aus Kiefernholz und zwei Stühle, die in ihren guten Tagen ihren Platz oben im Wohnzimmer gehabt hatten. Als es mit ihnen bergab ging, waren sie heruntergeholt worden; und hier erfüllten sie ihren Zweck, denn Jungen haben nun mal keinen sonderlichen Respekt vor Möbeln. Den bekommen sie erst, wenn sie groß werden und die Möbel selber bezahlen müssen. Und dann sind ihre Söhne kleine Jungen; und sie können gar nicht begreifen, wie unordentlich die sind.
Außerdem stand in der Stube noch eine Kommode, in der die Wäsche des Jungen lag, und darauf stand ein Regal mit seinen Büchern. An der Wand hing ein Bild, das den Vater und die Mutter darstellte; und die Mutter hatte ihn selber auf dem Schoße. Sie sagte oft, damals, als kleines Kind, sei[S. 137] er viel artiger gewesen als jetzt; und das war sehr wahrscheinlich; denn für einen kleinen Jungen ist es viel leichter, lieb und gut zu sein, als für einen großen.
Dann war auch noch ein Flitzbogen da, der entzwei war, und eine Trompete, der nichts fehlte, auf der unser Junge aber nie blasen durfte, weil sie zu viel Lärm machte. Auch eine alte Lampe und ein Bauer mit einem Kanarienvogel waren vorhanden.
Der Vogel stand drüben im Fenster, und vor dem Fenster war ein Hintergebäude mit hohen, häßlichen, grauen Mauern. Der Junge dachte oft, daß es unrecht sei, den Vogel gefangen zu halten; aber wenn er ihn freiließ, so würden ihn die Vögel ja doch gleich tothacken. Wollte er ihm wirklich etwas Gutes erweisen, so mußte er mit ihm bis zu den Kanarischen Inseln reisen. Aber dazu hatte er kein Geld; denn er bekam wöchentlich nur zehn Pfennige Taschengeld, und davon sollte er sich noch Griffel und Bleistifte kaufen. Freilich bekam er zwei Pfennige für jedes „Sehr gut“ in seinen Zensuren, aber das fiel ihm selten genug in den Schoß. Wie ich schon gesagt habe: es war ein ganz alltäglicher Junge.
Unser Junge lag in seinem eisernen Bett und war krank. Seit vielen Tagen war er nicht in der Schule gewesen, und es war vorläufig auch keine Aussicht vorhanden, daß er hingehen würde. Das[S. 138] sah man daran, daß seine Kleider nicht in der Stube waren. Man merkte es auch seinem hagern Gesicht an. Er hatte fast immer ebenso dicke Backen gehabt wie die gesündesten seiner Kameraden, aber jetzt waren die Backen beinahe ganz verschwunden. Seine Hände, die oben auf der Decke lagen, waren so dünn und bleich und rein wie nie zuvor.

Es war auch wirklich kein Wunder, daß der Junge so dünn war. Er bekam nichts andres zu essen als die Milch, die neben seinem Bette stand, und außerdem eine scheußliche grüne Medizin, die er beinahe nicht herunterkriegen konnte. Von der Medizin erhielt er alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll, und von der Milch durfte er so viel trinken, wie er wollte. Aber er hatte fast nie Lust dazu; und damit waren der Doktor und seine Mutter sehr unzufrieden.
Jetzt kam seine Mutter in die Stube. Sie brachte in einem Blumentopf eine große, pracht[S. 139]voll leuchtende rote Pelargonie. Die setzte sie so auf den Tisch, daß der Knabe die Blume sehen konnte.
„Ist sie nicht schön?“ fragte sie. „Die habe ich auf dem Markt gekauft. Sie soll dir gehören und dir erzählen, daß es jetzt bald Frühling wird. Dann springen alle Knospen auf, und alle kleinen Jungen werden gesund. Ist sie nicht herrlich?“
„Gewiß,“ antwortete der Junge.
„Es war die schönste, die da war,“ sagte die Mutter. „Und die größte. Willst du sonst noch etwas haben?“
„Darf der Vogel nicht auch hierher kommen?“ fragte er.
„Jawohl, das darf er,“ erwiderte sie.
Und sie setzte das Bauer neben die Pelargonie; und als der Kanarienvogel die schöne rote Blume sah, da fing er an zu singen; denn auch er hatte die Empfindung, daß es jetzt Frühling sei.
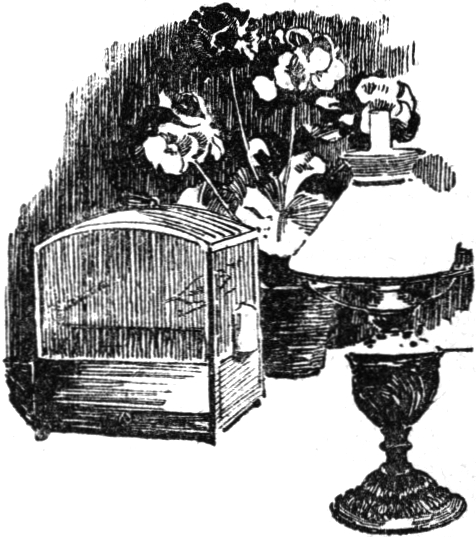
Da lächelte der Junge ein ganz klein wenig. Die Mutter küßte ihn und ging in die Küche; denn sie mußte ja dafür sorgen, daß das Essen fertig war, wenn der Vater aus dem Kontor nach Hause kam. Und Vater kam nach Hause und ging zu seinem Jungen hinein. Dann aßen sie in der Stube nebenan. Der Junge hörte das Tellergeklapper und Messergeklirr. Er dachte daran, zu fragen, was sie zu Tisch hätten, gab es aber auf, weil er zu[S. 140] müde war, und weil es ihn auch gar nicht interessierte.
Dann wurde es Nachmittag, und der Doktor kam.
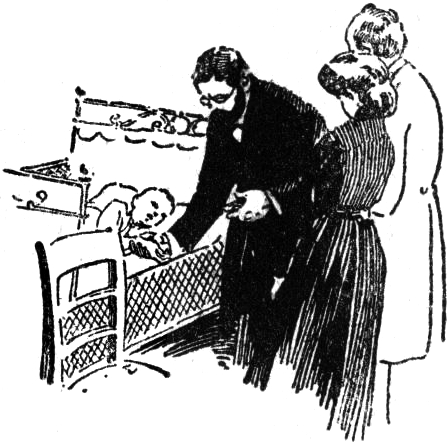
Er setzte sich auf die Bettkante und fragte den Jungen aus. Vater und Mutter standen mit betrübten Gesichtern daneben. Der Junge antwortete, so gut er konnte; aber auf viele Fragen wußte er nichts zu erwidern.
„Es geht ja recht gut,“ meinte der Doktor.
Das war durchaus nicht seine Ansicht, aber etwas mußte er ja sagen. Die Mutter seufzte und bekam nasse Augen.
„Aber den Kanarienvogel müssen wir aus der Stube bringen,“ sagte der Doktor. „Und die Pelargonie darf auch nicht hier im Zimmer stehen.“
„Dann weint unser Junge,“ sagte Mutter.
„Nein, der Vogel darf nicht hinaus,“ rief der Knabe entschieden. „Und auch die Blume soll hier bleiben. Ich habe sie ja eben erst bekommen.“
„Na, meinetwegen,“ sagte der Doktor. „Dann mögen sie in Gottes Namen hier bleiben.“
Damit ging er. Aber der Junge hörte recht gut, daß er in der Tür zu den Eltern sagte, sie möchten den Vogel und die Blume hinausnehmen, wenn der Junge schliefe. Und darum beschloß er, gar nicht einzuschlafen.
Nun wurde es Abend.
Im Eßzimmer war niemand, aber die Tür nach[S. 141] der Wohnstube, wo die Eltern saßen, stand offen. Die andre Tür vom Eßzimmer führte in die Schlafkammer und war während der ganzen Nacht angelehnt, seit der Junge krank war, damit man es gleich hören konnte, wenn er rief. Er hatte auch eine kleine Schelle, mit der er klingeln konnte. Anfangs hatte ihm das fürchterlichen Spaß bereitet, doch jetzt machte er sich nichts mehr daraus.
Bald darauf gingen die Eltern wieder ins Eßzimmer und aßen zu Abend. Als sie damit fertig waren, zog die Mutter die Gardinen vors Fenster, klopfte das Bett des Jungen zurecht und machte alles für die Nacht fertig. Sie zündete die alte Lampe an und schraubte den Docht herunter; dann sagte sie Gute Nacht, und auch Vater kam herein und sagte Gute Nacht, und nun sollte der Junge schlafen.
Die Hände auf der Decke, lag er ganz still da und starrte die Pelargonie an. Er fand, daß sie im Halbdunkel überaus groß und seltsam aussah. Ihre Blätter waren ganz anders als am Tage, und es waren so furchtbar viele da. Dann blickte er auf das Bauer, wo der Kanarienvogel auf seinem Pflock saß. Sonst hatte er in der Nacht ein Tuch über sich; aber der Junge hatte gebeten, das Tuch fortzulassen. Und diese Bitte gewährte man ihm auch, wie alle seine Bitten während der Krankheit.
Lange lag er so da.
Er hörte, wie Vater und Mutter zu Bett gingen.[S. 142] Sie kamen auf den Zehen durchs Eßzimmer. Vater blieb auf der Türschwelle stehen, aber Mutter kam bis an sein Bett heran und beugte sich über ihn. Er lag mit geschlossenen Augen da.
„Er schläft,“ flüsterte sie dem Vater zu.
Dann schlich sie zurück und nahm das Vogelbauer und die Pelargonie; doch da blickte er mit zornigen Augen auf:
„Du hast mir doch versprochen, daß sie hier drin bleiben dürften.“
„Ja, ja, ja, mein lieber Junge. Aber du hast doch gehört, daß der Doktor haben will, daß sie hinauskommen.“
Doch er gab nicht nach: „Du hast mir versprochen, daß sie hier drin bleiben sollen.“
„Laß sie nur stehen,“ fiel der Vater ein. „Es kann ihm nichts schaden.“
Dann nickten sie ihm zu, sagten, nun solle er versuchen, zu schlafen, und gingen fort. Er hörte sie noch eine Weile in der Schlafkammer rumoren. Der Lichtstreif fiel über den Fußboden des Eßzimmers bis zu seiner Tür. Bald darauf löschten sie die Lampe aus. Der Lichtstreifen verschwand, und es wurde ganz still.
Da auf einmal hörte der Junge eine Stimme sagen:
„Wenn ich nur die Nacht überlebe... wenn ich nur die Nacht überlebe.“
Der Junge hob den Kopf vom Kissen empor[S. 143] und lauschte, hörte aber nichts mehr. Mit großer Mühe richtete er sich auf seinem Ellbogen auf und blickte um sich.
Die Stube war leer.
Dort stand der Kanarienvogel, und neben ihm stand die Pelargonie. Dort hing die Photographie, auf der Vater und Mutter und er selber abgebildet waren... dort auf der Kommode lag das englische Lesebuch... und das Geschichts- und das Geographiebuch... und der Flitzbogen und die Trompete.
Es war niemand da. Und doch war er felsenfest davon überzeugt, daß er jemand hatte sprechen hören. Dann legte er sich wieder hin, weil er sich nicht aufrechthalten konnte, und lag ein Weilchen mit geschlossenen Augen da. Und dann sagte die Stimme wieder:
„Wenn ich nur die Nacht überlebe... wenn ich nur die Nacht überlebe.“
Der Junge fing an, wie ein Rasender zu klingeln.
Im nächsten Augenblick stand seine Mutter im Nachtgewand und auf bloßen Füßen an seinem Bett.
„Was hast du denn, mein lieber Junge?“ fragte sie.
„Mutter... ich fürchte mich... es spricht jemand hier in der Stube...“
„Es ist niemand hier,“ sagte sie und strich ihm über die Stirn, die mit Angstschweiß bedeckt[S. 144] war. „Das ist das Fieber. Oder vielleicht hast du auch geträumt. Hier ist niemand außer dir und mir und deinem kleinen Vogel. Soll ich den Vogel hinaustragen?“
„Nein, nein.“
Sie blieb eine Weile sitzen und redete ihm gut zu, bis sie fand, daß er sich wieder beruhigt hatte. Dann schraubte sie die Lampe ein wenig höher, damit er sich besser umsehen könnte, wenn er wieder Angst bekäme. Und dann ging sie hinaus.
Doch der Junge hatte sich ganz und gar nicht beruhigt.
Er schwieg bloß, weil er merkte, daß es keinen Zweck habe, mit Mutter darüber zu reden. Mutter verstand ihn nicht. So ist es manchmal mit der Mutter; und dann fühlt so ein kleiner Junge sich entsetzlich einsam und unglücklich.
Gut war es nur, daß der Kanarienvogel im Zimmer war. Wenn der doch aufwachen wollte! Hätte er nur einen Stock gehabt, um den Vogel aufzuscheuchen. Er wollte die Trompete und den Flitzbogen opfern, wenn der Vogel anfangen wollte, zu singen oder nur ein wenig zu piepsen und auf seinen Stäben umherzuhüpfen.
Aber der Vogel saß und schlief und rührte sich nicht. Und die Pelargonie sah ganz unheimlich aus mit ihrem Blättergewimmel.
Jetzt war die Stimme wieder da.
„Gut, daß sie fort ist,“ sagte die Stimme.[S. 145] „Sonst hätte ich auch noch für sie zu sorgen gehabt. Und nun hat die dumme Frau die Lampe höher geschraubt. Lieber hätte sie das Fenster öffnen sollen. Wenn ich nur diese Nacht überlebe... wenn ich nur diese Nacht überlebe.“
„Wer spricht da?“ rief der Junge.
Seine Stimme bebte vor Angst. Er wollte nach der Mutter klingeln, konnte aber nicht die Hand heben; so große Furcht hatte er. Er versuchte, sich aufzurichten, konnte aber nicht und sah sich um, so gut er es vermochte, ohne den Kopf zu heben.
„Wer spricht da?“ wiederholte er. „Wer ist hier im Zimmer? Er soll es sagen, sonst klingle ich, und dann kommt Vater mit seinem großen Stock.“
„Das wäre nicht sehr schön, wenn der käme,“ sagte die Stimme. „Nicht des Stocks wegen. Vor dem fürchte ich mich nicht. Aber unser sind ohnehin schon genug. Sollte er trotzdem kommen, so mußt du ihn bitten, das Fenster ein bißchen aufzumachen.“
„Wer bist du?“ fragte der Junge. „Ich habe Angst vor dir. Ich kann dich nicht sehen.“
„Mich kann niemand sehen,“ erwiderte die Stimme. „Es hat mich noch niemand erblickt. Ich bin unsichtbar. Ich bin die Luft.“
„Was bist du?“ sagte eine andre Stimme, die gröber war als die erste. „Bist du die Luft? Du redest da ja einen netten Unsinn zusammen. Wenn[S. 146] einer die Luft ist, so bin ich es doch wohl, möcht’ ich meinen.“
Der Junge faltete seine Hände und wußte sich vor Angst nicht zu lassen.
„Kümmere dich nicht um das, was er sagt, mein Junge,“ sagte nun wieder die erste Stimme. „Mein Name ist Sauerstoff, und ich bin der allerwichtigste Teil der Luft und der einzige, für den du Verwendung hast.“
„Springinsfeld, Windbeutel, Prahlhans!“ schalt die andre Stimme. „Hör’ mal mein lieber Junge... ich heiße Stickstoff, und ich mache vier Fünftel der Luft aus. Hörst du... vier Fünftel. Der Sauerstoff bildet nur ein erbärmliches Fünftel. Augenblicklich ist noch nicht einmal ein Fünftel Sauerstoff da, und morgen früh ist er vermutlich ganz weg.“
„Gerade davor habe ich Angst,“ rief der Sauerstoff. „Was für ein Bursche der Stickstoff ist, das kannst du ja schon an seinem Namen hören, mein Junge. Wäre er allein in der Stube, dann würdest du einfach sterben.“
„Wie kannst du dem Jungen nur so etwas weismachen!“ zeterte der Stickstoff. „Er kann mich ja gar nicht entbehren. Er bekommt mich mit allem, was er ißt und trinkt. Jeder Bissen, den er in den Mund steckt, ist voller Stickstoff.“
„Es hat keinen Zweck, viele Worte darüber zu verlieren,“ entgegnete der Sauerstoff. „Aus der[S. 147] Luft kriegt er dich jedenfalls nicht. Und bekommt er keinen Sauerstoff, dann erstickst du ihn. Es hat keinen Zweck, einem kleinen Jungen zu viel auf einmal zu erklären; und er soll lieber auf das hören, was ich ihm sage. Ist er vernünftig, so klingelt er seiner Mutter und bittet sie, ein Fenster zu öffnen. Die Nacht ist lang, und es sind noch mehr Leute hier drin im Zimmer, die Sauerstoff brauchen.“
„Wer ist denn hier drin?“ fragte der Junge.
„Die Pelargonie,“ erwiderte der Sauerstoff, „der Kanarienvogel und die Lampe.“
„Ich verstehe keine Silbe von alledem,“ sagte der Junge. „Was soll ich nur machen? Ich bin krank, und ich hab’ so große Angst.“
„Es ist nicht genug Stickstoff in dir,“ belehrte ihn der Stickstoff. „Darum bist du solch ein Hasenfuß.“
„Wenn ich gesund bin, habe ich keine Angst,“ rief der Junge. „Du kannst den Franz fragen. Er ist drei Jahre älter als ich, und ich hab’ ihm in der letzten Pause eine ordentliche Maulschelle gegeben. Aber euch kann ich nicht sehen, und darum fürchte ich mich vor euch.“
„In sichtbarer Gestalt bin ich nur den Gelehrten bekannt,“ sagte der Sauerstoff. „Aber wart’ einmal ... Hast du ein Taschenmesser?“
„Gewiß,“ rief der Junge, „ein wunderschönes, mit vier Klingen. Onkel Hans hat es mir zu Weih[S. 148]nachten geschenkt. Es liegt in meiner Hosentasche. Aber ich weiß nicht, wo meine Hosen sind.“
„Ist nicht eine von den Klingen rostig?“ fragte der Sauerstoff.
„Bist du verdreht?“ sagte der Junge. „Glaubst du, daß ich so schlecht auf mein Messer achtgebe. Franz, der liederliche Geselle, hat immer ein rostiges Messer. Er ist zwar Erster in der Klasse, aber trotzdem ein großer Luftikus, und außerdem klatscht er.“
„Ich kenne ihn nicht,“ versetzte der Sauerstoff. „Aber siehst du, dieser Rost auf dem Messer des Franz... das bin ich.“
„Dann bist du doch keine Luft, wie du vorhin sagtest,“ fiel der Junge ein. „Denn Rost kommt vom Wasser.“
„Das ist richtig,“ erklärte der Sauerstoff. „Aber ich bin auch im Wasser enthalten. Und wenn Wasser an das Eisen kommt, so laufe ich auf der Stelle hin und verbinde mich mit dem Eisen, und dann werde ich zu Rost.“
„Du solltest es lieber ganz offen sagen, wie es sich verhält,“ warf der Stickstoff ein. „Du verbrennst das Eisen. Das tust du. Und du verbrennst auch den Jungen. Wenn du das Messer verbrennst, wirst du zu Rost. Und wenn du den Jungen verbrennst, wirst du zu Kohlensäure. He... pst... Kohlensäure... bist du hier?“
„Jawohl,“ flüsterte eine dritte Stimme, die[S. 149] ganz dünn und schwach war. „Es ist wirklich schon lange her, seit mir so wohl gewesen ist wie heute nacht. Mir scheint, ich werde dicker und dicker.“
„Allerdings,“ entgegnete der Sauerstoff. „Und wenn der Junge vernünftig ist, so klingelt er sofort und läßt das Fenster öffnen, sonst geht schließlich die Lampe aus, und die Pelargonie und der Junge und der Kanarienvogel sterben.“
Da griff der Junge nach der Klingel und schellte wie besessen.
Mutter kam herein. Sie erschrak, als sie die heißen Backen und blanken Augen ihres kleinen Jungen sah.
„Mutter, Mutter,“ sagte er, und dann konnte er vor Schreck nichts mehr sagen.
„Geht es denn wieder schlecht, mein Liebling?“ fragte sie und streichelte seine Wange. „Ist wieder jemand im Zimmer, der spricht?“
Der Junge hielt ihre Hand fest: „Es sind so viele hier, Mutter... Gib nur ja auf mein Messer acht, während ich krank bin, damit es nicht rostet... nicht wahr, Mutter?“
„Gewiß, das werd’ ich tun. Denk’ bloß nicht daran.“
„Und dann läßt der Sauerstoff dich vielmals bitten, doch ja das Fenster aufzumachen. Sonst fürchtet er, daß er die Nacht nicht mehr überlebt.“
Mutter schüttelte den Kopf, beschwichtigte ihn und packte ihn in die Decke ein. Sie sah, daß er[S. 150] starkes Fieber hatte und phantasierte. Dann stand Vater in der Tür. Die Stimmen hatten ihn geweckt.
„Er redet ganz irre,“ sagte Mutter. „Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt.“
„Vater,“ rief der Junge. „Beeile dich und mach ein Fenster auf, sonst kann der Sauerstoff die Nacht nicht überleben. Hier ist zu viel Stickstoff, und dann ist die Kohlensäure da, von der ich mir keine rechte Vorstellung machen kann. Aber so viel steht fest, daß die Lampe ausgeht und wir alle ersticken müssen, wenn du nicht das Fenster öffnest.“
„Er phantasiert von etwas, was er in der Schule gehört hat,“ sagte der Vater.
Da gab Mutter ihm ein Pulver Antifebrin, und Vater ging ans Fenster und zog die Gardine zurück.
„Ich darf das Fenster nicht öffnen, mein Junge. Darüber würde der Doktor sehr böse werden, weil es noch so kalt ist. Siehst du, wie der Mond hereinscheint?“
Der Junge bat nochmals, das Fenster zu öffnen. Sie setzten sich auf den Bettrand, streichelten seine Wangen und redeten ihm gut zu.
Und dann schwieg er wie vorhin. Er sehnte sich bloß danach, daß sie wieder gehen möchten, damit er mit dem Sauerstoff reden könnte. Darum schloß er die Augen, als ob er schliefe. Als sie eine[S. 151] Weile seinen regelmäßigen Atemzügen gelauscht hatten, da glaubten sie es und schlichen still hinaus.
„Sauerstoff,“ fragte bald darauf der Junge, „bist du da?“
„Gewiß,“ entgegnete der Sauerstoff. „Sonst wär’ es um dich und mehrere andre übel bestellt. Aber gut geht es mir nicht.“
„Ist der Stickstoff auch hier?“ fragte der Junge.
„Allerdings,“ antwortete der Stickstoff.
„Und die Kohlensäure?“ forschte der Junge.
„Es lohnt nicht, von mir zu sprechen,“ sagte mit kleiner, dünner Stimme die Kohlensäure. „Ich bin zu unbedeutend.“
„Du bist schlimmer als der Stickstoff,“ meinte der Sauerstoff. „Das muß ich sagen, obwohl du mein eignes Kind bist. Wenn es nur bald Tag werden möchte! Wenn die Sonne kommt, trinkt die Pelargonie so viel Kohlensäure, wie sie kriegen kann.“
Der Junge lag lauschend da und sagte nichts.
Seine Wangen brannten wie Feuer. Von seiner Stirn troff der Schweiß herab, und seine Augen strahlten erschreckend klar. Auch durstig war er. Darum griff er zum Milchglase und trank ein wenig. Aber Angst hatte er nicht mehr.
Es schien ihm, als bekämen die Dinge Stimmen, ganz wie im Märchen. Er dachte, der Sauerstoff, der Stickstoff und die Kohlensäure seien drei verzauberte Prinzen. Wenn er doch nur das rechte[S. 152] Wort fände, so würde er ihnen ihre eigentliche Gestalt wiedergeben... Wie amüsant das sein würde, wenn sie morgen hier säßen beim Eintritt des Vaters und der Mutter... und des Doktors! Und dann: wie schön würde es in der Schule werden. Denn die Prinzen müßten natürlich seine Schule besuchen, die ja die vornehmste in der Stadt war. Neben ihm würden sie sitzen... Na, vielleicht war es doch am besten, noch ein bißchen zu warten; denn er war augenblicklich nicht unter den Ersten der Klasse; und auf den unteren Bänken konnten Prinzen doch nicht gut sitzen. Aber im nächsten Monat wollte er sich Mühe geben, um heraufzukommen ...
Weil ihn solche Gedanken beschäftigten, war er nicht im geringsten erstaunt, als der Kanarienvogel aufwachte, dreimal zwischen seinen Stäben umherhüpfte, was dasselbe ist, wie wenn ein kleiner Junge sich die Augen reibt, und sagte:
„Ich finde, die Luft ist heute nacht sehr schlecht hier im Zimmer.“
Und auch die Pelargonie stimmte mit ein. Sie war derselben Meinung.
„Aha,“ dachte der Junge. „Das sind auch Prinzen. Jetzt kommt allmählich Leben in die Bude.“
Aber er sagte vorläufig nichts, um die beiden nicht zu erschrecken, sondern drehte bloß den Kopf, sah sie an und freute sich auf das, was nun kommen sollte.
[S. 153]
Und doch kam es anders, als er erwartet hatte.
Die Lampe schnalzte plötzlich leicht auf mit der Feuerzunge und sagte:
„Ja, ich habe mir schon lange meine Gedanken darüber gemacht, während ich hier stand und ein kleines Schläfchen hielt. Es ist nur merkwürdig, daß der Junge nichts davon merkt. Die Menschen sind doch in der Regel sonst die ersten, die ein großes Lamento anstellen, wenn mit der Luft irgend etwas nicht in Ordnung ist.“
„Jungen sind keine richtigen Menschen,“ sagte der Kanarienvogel. „Wenigstens nicht in dieser Beziehung. Sie können unglaublich schlechte Luft vertragen.“
„Nicht, wenn sie krank sind,“ bemerkte die Pelargonie. „Und der Junge ist krank. Das weiß ich bestimmt. Seine Mutter hat es auf dem Markt zu der Frau gesagt, von der sie mich kaufte.“
„Ich sollte nicht wissen, daß er krank ist?“ versetzte der Kanarienvogel. „Ich, sein Liebling? Der Doktor sagte, ich müsse hinausgetragen werden, aber der Junge wollte es nicht haben, und darum blieb ich. Und ich sollte auch jeden Abend mit einem gräßlichen schwarzen Tuch bedeckt werden. Aber er bat, es nicht zu tun, damit er mich sehen könne. Wenn ich nicht wüßte, wie es um den Jungen steht, wer sollte es denn dann wissen?“
„Ich,“ rief die Lampe und schnalzte abermals mit der Feuerzunge. „Die Pelargonie ist erst gestern[S. 154] gekommen und kennt nur das Gewäsch, das sie auf dem Markt gehört hat. Der Kanarienvogel ist auch erst seit dem letzten Geburtstag des Jungen da, aber ich bin von Anfang an hier gewesen.“
„Bist du denn so alt?“ fragte die Pelargonie.
„Allerdings,“ zischelte die Lampe. „In der Nacht, als er geboren wurde, habe ich in der Schlafkammer gestanden. Ich habe die Hebamme beschienen. Und ihn selber, als er als kleiner roter Bursche da lag und sein erstes Gebrüll von sich gab. Damals war ich vornehmer als jetzt. Es war mehr Bronze an meinem Fuß, und meine Glocke war auch noch nicht entzwei. Als es anfing, mit mir bergab zu gehen, kam ich in dieses Zimmer.“
„Herrgott,“ schrie der Kanarienvogel.
„Und ich klage nicht. Es ist ein sehr guter Platz für eine ältere Lampe. Hier ist nicht mehr Arbeit zu verrichten, als ich bewältigen kann. Im Sommer werde ich nie angezündet, und im Winter bloß, wenn der Junge Schularbeiten zu machen hat, und dann, wenn er zu Bett muß. Aber an den Aufgaben lernt er nicht besonders lange, und ins Bett geht er im Geschwindmarsch, und dann löscht Mutter mich aus. Manchmal werde ich freilich wieder angezündet, wenn wir in der Küche ein paar Streichhölzer gemaust haben und im Bett noch etwas lesen wollen... Das ist ein sehr großes Verbrechen und darum unvergleichlich schön. Wird es entdeckt, so bekommt der eine von uns Prügel,[S. 155] und der andre wird sofort ausgeblasen. Aber in der jetzigen Zeit steh’ ich Nacht für Nacht angezündet und muß bis zum frühen Morgen brennen, wenn auch nur mit halber Flamme.“
„Ja, das ist eben das Unglück,“ sagte der Sauerstoff.
„Wie?“ rief die Lampe. „Wer spricht da? Wer wagt es, eine hochachtbare, alte, pflichttreue Lampe ein Unglück zu nennen?“
„Ich bin’s nicht gewesen,“ sagte die Pelargonie.
„Ich wahrhaftig auch nicht,“ fiel der Kanarienvogel ein.
„Der Sauerstoff war’s,“ sagte der Junge.
„Gewiß,“ bestätigte der Sauerstoff.
„Und wer bist denn du?“ fragte die Lampe; „ich kann dich nicht sehen.“
„Das kannst du freilich nicht. Und doch kannst du mich nicht entbehren. Ich bin der Sauerstoff. Ich bin die Luft.“
„Bist du die Luft?“ meinte die Lampe nachdenklich. „Ja, dann bist du allerdings ebenso wichtig für mich wie das Petroleum und der Docht und das Streichholz.“
„Er lügt, er lügt,“ rief der Stickstoff. „Er bildet nur ein lumpiges Fünftel der Luft. Ich bin die Luft. Stickstoff heiße ich; und schämen solltet ihr euch, daß ihr mich nicht kennt.“
„Wem soll ich nun Glauben schenken?“ fragte die Lampe. „Der da zuletzt redete, hat einen garsti[S. 156]gen Namen; und ich kann mir nicht denken, daß ich Verwendung für ihn habe.“
„Die hast du auch nicht,“ erklärte der Sauerstoff. „Und während du schwatzest, verstreicht die Zeit; und es endigt übel. Hier drinnen bildet sich mit jeder Minute mehr Kohlensäure; und sie ist noch viel ärger als der Stickstoff.“
„Ganz recht,“ sagte der Stickstoff. „Der Sauerstoff vergißt nur zu erzählen, daß er selber die Kohlensäure erzeugt. Er erzeugt Kohlensäure ebenso wie die Lampe und die Pelargonie und der Kanarienvogel und der kranke Junge.“
„Gewiß tu’ ich das,“ sagte der Sauerstoff. „Ich bewirke, daß die Lampe brennt, und daß die andern atmen. Fehle ich, so ist es mit ihnen zu Ende; und die widerwärtige Kohlensäure gehört ebensogut ihnen wie mir.“
„Warum nennst du mich widerwärtig?“ fragte die Kohlensäure. „Ich habe hier in der Welt ebensogut wie du meine Aufgabe zu erfüllen. Frage die Pelargonie! Sie trinkt mich den ganzen Tag aus der Luft. Sie kann mich durchaus nicht entbehren. Sie lebt geradezu von mir.“
„Das tu’ ich allerdings,“ gab die Pelargonie zu.
„Ja,“ fuhr die Kohlensäure fort. „Sobald es hell wird, trinkst du Kohlensäure und fährst fort, es zu tun, bis die Nacht kommt. Und das gleiche tun alle grünen Pflanzen der Welt, vom größten Baume bis zum kleinsten Grashalm. Sie alle[S. 157] trinken Kohlensäure, als wären sie nicht recht gescheit, und atmen Sauerstoff in die Luft aus. Darum ist es so wunderschön frisch im Walde.“
„Hört ihr wohl. Ich bewirke, daß es so frisch ist,“ sagte der Sauerstoff fröhlich.
„Ja, aber mich trinken sie,“ beteuerte die Kohlensäure.
„Aber aus mir sind sie erzeugt... aus mir sind sie erzeugt,“ rief der Stickstoff.
„Piep,“ sagte der Kanarienvogel. „Ich kann nicht klug daraus werden. Ich bin so traurig.“
„Auch mir geht es nicht gut,“ versicherte die Pelargonie. „Und ich begreife nicht, was wir anfangen sollen.“
„Es übersteigt meinen Verstand,“ klagte die Lampe. „Aber ich merke, daß die Luft schlechter und schlechter wird. Ich flackre. Ich gehe aus.“
„Noch nicht,“ fiel da der Sauerstoff ein. „Aber es wird so kommen. Alles, was der Stickstoff und die Kohlensäure erzählen, mag sein, wie es will; es hat mit der Sache nichts zu schaffen. Die Stube ist nur klein, und ich bin nur ein Fünftel der Luft, wie ihr gehört habt. Die Lampe kann nicht ohne mich brennen, und ihr könnt nicht ohne mich atmen. Je mehr Wesen mich brauchen, desto schneller bin ich aufgebraucht. Darum wollte der Doktor, daß der Kanarienvogel hinausgebracht würde. Darum hätte die Pelargonie heute nacht nicht im Zimmer stehen dürfen. Darum war es dumm von der[S. 158] Mutter des kranken Jungen, daß sie die Lampe in die Höhe schraubte. Und darum bleibt nichts andres übrig, als nach ihr zu klingeln, damit sie hereinkommt und das Fenster öffnet. Da draußen ist viel Sauerstoff. Hier drin aber ist nur noch wenig; und wenn der verbraucht ist, so erstickt ihr. Punktum.“
Der Junge lag regungslos da und lauschte und starrte. Jetzt glaubte er nicht länger, daß es ein Märchen sei. Er atmete schwer auf; und er bekam Tränen in die Augen, als er sah, wie der Kanarienvogel den Kopf hängen ließ und die Blätter der Pelargonie immer schlaffer wurden, während die alte Lampe flackerte und flackerte.
„Ich will nicht ersticken,“ jammerte der Kanarienvogel. „Könnte ich nur wieder vors Fenster kommen! Da war viel bessere Luft. Könnte ich nur aus dem Bauer hinausschlüpfen und durch die Scheibe fliegen... Ja, dann würden mich freilich die häßlichen Spatzen tothacken, aber das wäre doch besser, als hier zu ersticken.“
„Ich will lieber sterben als meinen Kanarienvogel missen,“ sagte der Junge und warf ihm einen zärtlichen Blick zu.
„Ich will nicht ersticken,“ verkündete die Pelargonie. „Ich bin so jung und habe so wunderschöne rote Blüten. Ich freute mich so, als ich heute morgen auf dem Markte stand, obwohl es da bei weitem nicht so schön war wie in dem Treib[S. 159]haus des Gärtners, wo ich groß geworden bin. Aber ich will nicht ersticken... ich will nicht ersticken.“
„Ersticken?“ sagte die alte Lampe. „Das bedeutet wohl dasselbe wie ausgelöscht werden. Dann bin ich wirklich oft im Leben erstickt. Gewöhnlich einmal am Tage. Es ist wirklich nicht so gefährlich. Man wird einfach wieder angezündet. Aber ich gehe ungern aus, bevor ich muß. Denn wenn sie kommen und sehen, daß ich Petroleum und Docht genug habe, und trotzdem ausgegangen bin, so glauben sie natürlich, daß ich ganz altersschwach bin, und setzen mich in die Rumpelkammer.“
„Daran läßt sich nichts ändern,“ sagte der Sauerstoff.
„Kann ein kleiner Junge auch wieder angezündet werden, wenn er erloschen ist?“ erkundigte sich der Junge.
„Nein,“ belehrte ihn der Sauerstoff. „Wenn ein Junge erloschen ist, so ist er weg. Und genau ebenso ist es mit der Pelargonie und dem Kanarienvogel. Die Lampe kann wieder angezündet werden, aber dann hat sie eben niemanden mehr zu bescheinen.“
Der Junge streckte die Hand aus, um die Schelle zu ergreifen. Er stieß daran, so daß sie auf den Fußboden fiel und ganz unters Bett rollte. Sie machte ja freilich Spektakel, aber niemand hörte es. Eine Weile lauschte er, ob Mutter nicht kommen[S. 160] werde, aber sie kam nicht. Er wollte rufen, aber die Stimme fror in seinem Halse fest, so große Furcht hatte er.
Und die Luft in der Stube wurde immer dumpfiger.
„Was geschieht jetzt mit uns?“ fragte der Junge.
„Jetzt ersticken wir,“ sagte der Sauerstoff.
„Blaff, blaff,“ sagte die Lampe.
„Piep,“ schrie der Kanarienvogel.
Und die Pelargonie duftete so süß, wie noch keine Pelargonie in der Welt geduftet hatte, weil sie glaubte, daß es jetzt zu Ende sei.
Der Junge aber lag da und überlegte sich, daß er nicht gern ersticken wolle.
Es konnte ja nicht mehr lange dauern, dann wurde der Wald grün. Ende Mai sollte der Schulspaziergang in den Wald stattfinden, und da wollte er mitgehen. Die Botanisiertrommel ganz voller Butterbrote. Und mit einer Flasche Saft. Und mit einer Mark in der Tasche... Und dann spielten sie Räuber und Soldaten... Er wollte Räuber sein... Räuberhauptmann...
Auf seinen dünnen, bloßen Beinen stand er zitternd auf dem Fußboden. Er hielt sich mit der einen Hand am Tisch und mit der andern am Bett fest... dann an einem Stuhl... dann an der Kommode... Und dann stand er drüben am Fenster.

Er konnte den Haken nicht losbekommen. Er[S. 161] versuchte und versuchte immer wieder und war im Begriff, umzufallen, so matt war er in den Knien.
Dann stieß er mit der geballten Faust das Fenster ein.
Er hörte die Glasscherben klirren und auf den Hof fallen. Und er sah das Blut auf seiner Hand. Aber wie er wieder ins Bett unter die Decke kam, das wußte er nicht und erfuhr er auch nie.
„Ah —,“ sagte die Pelargonie.
„Ah —,“ rief der Kanarienvogel.
„Ah —,“ die alte Lampe atmete auf.
„Es war doch ein tüchtiger Junge,“ sagte der Sauerstoff.
„Es ist Stickstoff in ihm,“ triumphierte der Stickstoff.
*
Es war Morgen.
Die Sonne war aufgegangen, und das Licht strömte in die kleine Kammer herein, so daß sich die alte Lampe daneben ganz jämmerlich ausnahm. Der Kanarienvogel trillerte lustig, die Pelargonie entfaltete zwei neue Knospen und ein kleines grünes Blatt, und der Junge schlief ruhig und fest, die dünnen Hände auf dem Laken vor sich. Der Sauerstoff, der Stickstoff und die Kohlensäure schwiegen still; und darum kann man wohl annehmen, daß sie sich über nichts zu beklagen hatten.
Doch als Mutter hereinkam und bemerkte, daß die Scheibe entzwei war und die Hand ihres Jungen[S. 162] blutete, da bekam sie natürlich fürchterliche Angst. Sie rief den Vater herbei, und beide standen vor dem Bett, betrachteten besorgt den Jungen und lauschten seinem Atem. Aber er schlief ruhig und atmete leicht und frei.
Er schlief noch, als der Doktor kam.
„In acht Tagen ist er gesund,“ sagte der Doktor, als er ihn untersucht hatte.
Und so kam es auch.
Aber der Junge erzählte keinem Menschen, was er in dieser Nacht erlebt hatte.
Im Examen jedoch bekam er in den Naturwissenschaften die beste Zensur.
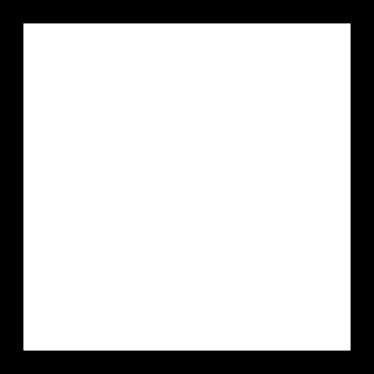
[S. 163]
Tief im Walde mitten auf einer grünen Wiese stand ein großer alter Dornbusch, und in ihm baute sich das Neuntöterpärchen sein Nest.
An dem ersten Maitage, an dem die Sonne ordentlich schien, wurde das Nest fertig; und nachdem sie ein Weilchen beisammen gesessen und die Zukunft besprochen hatten, legte Frau Neuntöter drei gute Eier.
„So,“ sagte sie und seufzte so tief, wie ein Neuntöter überhaupt seufzen kann. „Nun ist es vorbei mit der Jugend und ihren Torheiten; der Ernst des Lebens beginnt.“
Ihr Mann tröstete sie, so gut er konnte, während sie sich verdrießlich auf den Eiern zurechtsetzte und nicht auf ihn hören wollte.
„Ihr Männer schwatzt, wie ihr’s versteht,“ sagte sie. „Ihr solltet es selber einmal versuchen; aber ihr begnügt euch mit schönen Reden und überlaßt uns das Brüten. Mach’ kein so verliebtes Gesicht! Es steht dir nicht und macht mich nervös. Spute dich und fang’ mir eine fette Fliege!“
Am Abend war sie ganz außer sich vor Wut.
„Hätte ich gewußt, was ich jetzt weiß, so hätte ich mich nicht verheiratet, und wenn du noch so[S. 164] schön gesungen hättest,“ schrie sie. „Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus! Ich fliege fort!“
Der Neuntöter hörte sie ruhig an. Mit seinen früheren Frauen hatte er dieselbe Geschichte erlebt — denn ein Neuntöter nimmt in jedem Frühjahr ein neues Weibchen —; und er wußte, daß diese Aufregung sich wieder legen würde.
„Du kannst heute noch recht gut einen kleinen Ausflug unternehmen,“ schlug er vor. „Aber dann mußt du während der übrigen Zeit auch hübsch still sitzen; sonst kommen nie und nimmer Junge aus den Eiern. Meine vorige Frau — —“
„Bitte, verschone mich mit dem Frauenzimmer!“ schrie sie.
Im selben Augenblick flog sie auf, und der Neuntöter folgte ihr schleunigst; denn er fürchtete, sie könne in ihrer Aufregung zu Schaden kommen.
Aber als die beiden soeben fortgeflogen waren, setzte sich ein andrer Vogel neben das Nest und starrte hinein.
Er war viel größer als der Neuntöter und ganz graubraun mit hellen Flecken auf Brust und Bauch. Im Schnabel trug er ein Ei, das er vorsichtig neben die anderen Eier ins Nest legte. Es war nicht größer als sie und glich ihnen aufs Haar.

Einen Augenblick blieb der fremde Vogel noch sitzen und betrachtete traurig das kleine, warme Nest, in das er sein Ei gelegt hatte. Dann lüftete er die Flügel und flog über die Wiese in den Wald[S. 165] hinein. Auf einem hohen Baume saß dort das Männchen und wartete.
„Hast du das Ei untergebracht?“ fragte der Vogel die zurückkehrende Gefährtin.
„Ja,“ erwiderte das Weibchen, „ich habe es den Neuntötern im Dornengebüsch drüben auf der Wiese ins Nest gelegt. Das sind brave Leute; sie werden gut zu unserm Kinde sein.“
„Mehr können wir nicht tun,“ meinte der andere Vogel. Und dann rief er: „Kuckuck!“, und beide flogen davon.
Als die Neuntöter nach Hause kamen, bemerkten sie nicht, daß nicht mehr drei Eier, sondern vier im Neste lagen. Einmal waren sie beide im Rechnen nicht besonders gut beschlagen; und außerdem war Frau Neuntöter jetzt besser gelaunt. Sie setzte sich ganz fromm auf die Eier, und ihr Mann sang ihr etwas vor, so daß es weithin durch den Wald schallte.
Vierzehn Tage lang saß sie getreulich auf den Eiern und brütete, während der Neuntöter umherflog und Schmetterlinge, Larven und Fliegen fing. Er spießte sie auf die Dornen dicht neben dem Nest, so daß das Weibchen mit Leichtigkeit hinüber huschen, danach schnappen und dann flugs wieder zurück sein konnte.
„Du bist doch ein braver Kerl,“ sagte sie und nickte ihm gnädig zu. „Aber es ist ja allerdings auch deine Pflicht und Schuldigkeit, daß du mir ein paar[S. 166] Aufmerksamkeiten erweist, weil ich das Brüten zu besorgen habe.“
Am Morgen des fünfzehnten Tages brachen die Eierschalen entzwei, und vier nackte Vögelchen lagen da und sperrten ihre breiten, gelben Schnäbel auf. Das Neuntötermännchen betrachtete sie aufmerksam.
„Sie haben ja weder Augen noch Schnäbel,“ sagte er; „aber das kommt wohl noch alles.“
„Wie reizend sie sind!“ rief Frau Neuntöter.
Ihr Mann sah sie schelmisch an und pfiff vor sich hin:
„Und du hast sie zuerst gar nicht ausbrüten wollen!“
„Unsinn!“ entgegnete seine Frau gekränkt. „Das habe ich nie gesagt. Du solltest deinen armen Kinderchen lieber Futter bringen, anstatt hier solche Reden zu führen. Sie sperren die Schnäbel so weit auf, daß ich ihnen bis in ihre lieben kleinen Mägen hinabsehen kann.“
Und der Neuntöter flog aus und kam wieder und flog wieder aus, und so ging es den ganzen Tag von früh bis spät und viele lange Tage hindurch. Sooft er etwas zu essen brachte, sperrten die Jungen ihre Schnäbel weit auf. Es war, als könnten sie niemals satt werden. Aber die vier waren nicht alle gleich gefräßig. Das eine von den Jungen war viel gieriger im Fressen als die andern, wuchs aber auch viel stärker.
[S. 167]
„Das wird einmal ein tüchtiger Neuntöter,“ sagte der Vater und strich ihm mit dem Schnabel über den Rücken.
„Du darfst keinen Unterschied zwischen deinen Kindern machen,“ erwiderte die Mutter streng. „Ich finde nun gerade die kleinsten am nettesten.“
Eines Abends setzte sich der Neuntöter ganz niedergeschlagen neben sein Weibchen, das auf dem Neste saß, um die Jungen warm zu halten.
„Es ist nicht leicht, eine so große Familie durchzubringen,“ sagte er. „Dabei will man ja ordentlich aussehen und hat doch niemals Zeit, sich zu putzen; und ich glaube, es ist schon eine Ewigkeit her, seit ich mal einen kleinen Triller angeschlagen habe. Die Zeiten werden auch immer schlechter. Schmetterlinge sind fast gar nicht mehr aufzutreiben; und heute morgen haben mir die Buchfinken zweimal eine wunderschöne Larve dicht vorm Schnabel weggeschnappt. Du wirst mir noch beim Jagen helfen müssen! Ein armer Vogel wie ich kann es sich nicht erlauben, seine Frau zum Staatmachen zu Hause zu lassen.“
„Für die Kinder sorgen, nennst du das Staatmachen?“ rief da das Neuntöterweibchen heftig. „Übrigens brauchst du dich durchaus nicht so aufzuregen. Jetzt haben alle vier schon Federchen, da können sie bei dieser Wärme ganz gut allein liegen. Von morgen an werd’ ich dir helfen.“
Nun flogen beide Neuntöter miteinander im[S. 168] Walde umher und plagten sich redlich, um Futter für die Familie herbeizuschaffen. Soviel sie aber auch nach Hause brachten, die Jungen ließen nicht ab, die Schnäbel aufzusperren, zu schreien und einander beiseitezustoßen, um selber das größte Stück zu erwischen.
Als die Eltern eines Mittags heimkehrten, die Schnäbel voller Futter, herrschte ein entsetzlicher Lärm im Neste. Die Jungen reckten die Hälse, wie sie es noch nie getan hatten, und schrien wild durcheinander.
„Einer soll reden; sonst versteht man keine Silbe,“ befahl Frau Neuntöter. „Was ist also geschehen?“
Schließlich erfuhr sie dann also, daß das große Junge eins von den kleinen aus dem Nest gestoßen hatte. Eine Weile hatte das Vögelchen unten im Grase gelegen und kläglich gepiepst, bis der Fuchs gekommen war und das arme Wesen aufgefressen hatte.
„Er hat zuerst gestoßen,“ behauptete das große Junge. „Ich bin nicht schuld daran, daß er hinausgefallen ist.“
„Ich will dich lehren,“ rief da der Neuntöter zornig und wollte auf das Junge losfahren.
Aber seine Frau hackte ihn in den Nacken und schalt ihn ernstlich aus.
„Schäme dich, so heftig zu werden!“ schrie sie. „Willst du das unschuldige Kind mißhandeln? Wage[S. 169] nicht, es anzurühren! Du wirst doch wohl begreifen können, daß das kleine Wesen nichts dafür konnte.“
Nun beweinten sie beide das tote Kind; und als sie sich ausgeweint hatten, flogen sie aus, um neues Futter zu holen. Sie trösteten sich schnell über den Verlust; denn die drei Jungen, die noch am Leben waren, hatten einen so fürchterlichen Appetit, daß die Eltern manchmal fast verzweifelten. Das große fuhr fort zu wachsen und war jetzt schon doppelt so groß wie die beiden andern, die sich beklagten, daß der Grobian sie beiseitedränge und ihnen alles Futter wegnehme.
„Ihr müßt versuchen, euch zu vertragen, bis ihr euch selber helfen könnt,“ ermahnte die Neuntötermutter.
„Wären sie nur mal erst glücklich konfirmiert und mit uns nach dem Süden unterwegs!“ sagte der Neuntöter sorgenvoll. — —

Nach einer Woche ereignete sich etwas, was die Neuntötereltern wiederum tief betrübte. Als sie heimkehrten, war nur noch das große Junge im Nest.
„Aber wo sind denn deine Geschwister?“ schrie die Mutter erschrocken.
„Ich kann nichts dafür!“ piepste das große Junge. „Sie sind aus dem Nest gefallen. Ich kann nichts dafür! Ich habe mich bloß ein klein wenig umgedreht, und da ist das eine hinausgefallen; und ich habe einen Schreck bekommen und habe wohl[S. 170] dabei das andre angestoßen, das auf die Weise auch hinausgefallen ist. Ich kann aber nichts dafür! Und dann ist der Fuchs gekommen und hat sie beide gefressen.“
Als die beiden Alten das hörten, da weinten sie bitterlich.
„Wir haben das Nest zu klein gebaut,“ sagte schließlich der Neuntöter. „Aber wie konnte ich auch wissen, daß ich ein so großes Kind bekommen würde! Es wächst ja geradezu unheimlich.“
Und die Mutter klagte: „Du hättest sie nur beizeiten richtig erziehen müssen. Ach, meine armen lieben kleinen Kinder!“
„Wenn wir jetzt wenigstens das letzte behalten möchten!“ seufzte der Neuntöter. „Nun sei du ein gutes Kind und denk’ daran, daß du unser einziges bist.“
Das versprach das Junge, und dann fraß es all das Futter, das die Eltern mitgebracht hatten.
„Mehr, mehr!“ schrie der Nimmersatt. „Ich bin furchtbar hungrig!“
Und die Neuntöter stürzten fort, um seine Wünsche zu erfüllen.
Sie holten jetzt mehr Futter herbei als früher, als noch alle Kinder am Leben gewesen waren; aber der große Bursche konnte nie genug bekommen. Er wuchs und wuchs und wurde schließlich so groß, daß er keinen Platz mehr im Neste hatte. Da[S. 171] kletterte er hinaus und setzte sich auf einen Zweig daneben.

„Gott erbarme sich,“ schrie die Neuntötermutter, als sie heimkehrte und das große Junge dort sitzen sah. „Du wirst hinunterfallen und dir den Hals brechen.“
„Du hast immer etwas an mir auszusetzen!“ antwortete der junge Vogel ganz verzagt. „Ich hab’ es drinnen nicht mehr ausgehalten, weil es mir da zu eng war. Ich mache alles verkehrt und kann doch nichts dafür. Ich wünschte, ich wäre tot! — Hast du mir etwas mitgebracht?“
[S. 172]
Da halfen die beiden Alten ihm vorsichtig auf die Erde herunter und baten das Junge, sich gut im Grase zu verstecken und nur ja nicht zu schreien, damit der Fuchs seine Anwesenheit nicht bemerkte. Und von nun an brachten sie ihm täglich mehr als hundertmal Futter, und der junge Vogel wuchs immer mehr. Allmählich entwickelten sich auch seine Flügel- und Schwanzfedern, so daß er quer über die Wiese flattern konnte; die Eltern mußten oft nach ihm suchen und ihn rufen, wenn sie mit Futter beladen zurückkehrten. Es sah gar sonderbar aus, wenn die drei beisammen saßen; denn das Junge war jetzt doppelt so groß wie das Neuntöterpärchen, so daß es nicht ganz einfach war, ihm das Futter in den Schnabel zu stecken. Außerdem war es ganz graubraun gefärbt, mit hellen Flecken auf Brust und Bauch.
Gar oft saß der Neuntötervater nachdenklich da und starrte den großen Vogel an.
„Familienähnlichkeit hat er gar nicht,“ sagte er dann wohl zu seiner Frau, die im Halbschlummer hockte; so müde war sie. „Wir sind nicht so groß und haben auch eine andre Färbung.“
Eines Morgens schnappte das Junge nach einer großen, garstigen, zottigen Larve, die im Grase umherkroch.
„Spuck’ sie aus! Spuck’ sie aus!“ schrie die Mutter. „Sie ist giftig! Sie kann dir den Tod bringen!“
[S. 173]
„Solche Larven habe ich schon oft gegessen,“ erwiderte das Junge ganz ruhig. „Sie schaden mir nichts; und von dem, was ihr mir gebt, kann ich nicht satt werden.“
„Ein merkwürdiger Neuntöter,“ erklärte der Vater und schüttelte den Kopf.
„Es ist gar kein Neuntöter,“ sagte da auf einmal jemand ganz in der Nähe.
Das Männchen blickte auf und gewahrte ein altes Zaunkönig-Mütterchen, das sich auf einem Zweige schaukelte.
„Was ist es nicht?“ fragte er.
„Es ist gar kein Neuntöter,“ wiederholte der Zaunkönig.
„Was? Hat meine Frau nicht selbst das Ei in unser Nest gelegt, und haben wir das Junge nicht ehrlich und redlich zusammen mit seinen Geschwistern, die jetzt tot sind, erzogen?“
„Sind sie tot?“ fragte der alte Zaunkönig. „Herr Gott! Ja, so geht es! Es ist die alte Geschichte und obendrein eine überaus häßliche Geschichte.“
„Erzähle!“ bat der Neuntöter, flog hinauf und setzte sich neben den Zaunkönig. Seine Frau flog mit, während das Junge lauschend im Grase sitzenblieb und den Schnabel aufsperrte.
„Die Geschichte ist bald erzählt,“ sagte der Zaunkönig. „Aber es ist sehr gut, wenn recht viele[S. 174] sie erfahren. Der Jugend ist es dienlich, den Alten zuzuhören.“
Und nun schrie das Zaunkönigweibchen, so laut es mit seinem dünnen Stimmchen konnte; und von allen Seiten her flogen viele Zaunkönige, Neuntöter, Lerchen, Zeisige, Stieglitze und manch andere kleine Vögel herbei. Und sie ließen sich in den Büschen ringsum nieder und blickten gespannt auf das Zaunkönigweibchen und lauschten.
„Kennt ihr nicht den großen grauen Vogel, der manchmal unsre Nester umschleicht?“ fragte der Zaunkönig.

„Ich kenne ihn recht gut. Das ist der Habicht,“ rief ein vorlauter junger Stieglitz.
„Nein, du Naseweis!“ sagte der Zaunkönig. „Ich wollte, du hättest recht! Das wäre viel besser für uns; denn dann würden wir einfach gefressen, und damit gut. Der Habicht holt uns für seine Jungen, wie wir Fliegen und Larven für unsere Kinder fangen. Das ist ehrlich Spiel, und so ist nun einmal der Lauf der Welt; dagegen läßt sich nichts sagen, wenn es auch für den, der gefressen wird, recht traurig ist. — — Nein, der Vogel, von dem ich rede, heißt Kuckuck. Er sieht ungefähr aus wie ein Habicht, ist aber kein so verwegener Räuber und überhaupt kein ehrenwerter Vogel, der seinen Kindern Nahrung verschafft; er ist ein heimtückischer, fauler Patron, der nicht arbeitet, sondern nur im Walde umherfliegt, sich brüstet und ‚Kuckuck‘[S. 175] ruft. Glaubt nicht etwa, daß er ein Nest baut wie wir anständigen Vögel. Noch nie hat er zwei Strohhalme aufeinandergelegt. Noch nie hat er seine Eier ausgebrütet oder seine Jungen in den kalten Nächten gewärmt oder ihnen eine Fliege in ihre kleinen gelben Schnäbel gesteckt.“
„Gott erbarme sich!“ rief Frau Neuntöter dazwischen. „Was tut er denn?“
„Ja, du weißt das nicht, du arme Frau,“ erwiderte der alte Zaunkönig, „aber du sollst es erfahren! Sobald er ein Ei gelegt hat, nimmt er es in den Schnabel und trägt es in das Nest eines ehrbaren Vogelpärchens. Dann brüten die beiden es aus und ziehen es zusammen mit ihren eigenen Jungen groß. Alles tun sie ihm zuliebe; sie mühen sich von früh bis spät, um für das große Untier genug Futter herbeizuschaffen. Und wißt ihr, welchen Dank sie für all ihre Liebe ernten? Ich will es euch sagen. Das Kuckucksjunge nimmt ihren eignen Kindern das Futter vor der Nase weg; und wenn es groß genug geworden ist, pufft es sie zum Nest hinaus, um es sich selbst recht bequem darin zu machen. — Da habt ihr die Geschichte!“
Die kleinen Vögel ringsum auf den Zweigen zitterten vor Entsetzen. Das Neuntöterpärchen starrte den Zaunkönig sprachlos an, und die Federn der beiden Vögel sträubten sich vor Schreck.
„Seht die beiden dort!“ rief der Zaunkönig und zeigte auf die Neuntöter. „Die haben in diesem[S. 176] Sommer das Kuckuckskind in Pflege gehabt. Seht, wie mager und zersaust sie aussehen! Fragt sie, wo ihre eigenen Kinderchen geblieben sind! Wollt ihr aber das böse Pflegekind sehen, das sitzt da unten im Grase und sperrt gierig den Schnabel auf.“
Da blickten alle Vögel auf das große Kuckucksjunge, und sie erhoben ein lautes Geschrei:
„Kuckuckskind! Kuckuckskind!“
Der verspottete Vogel lief ein Stück weiter auf die Wiese hinaus, drehte sich dann um und schrie:
„Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! Ich bin weder böse noch undankbar!“
Aber die Vögel flogen hinter ihm her und wollten ihn tothacken. Allen andern voran drang der junge Stieglitz mit lautem Geschrei auf ihn ein. Ganz hinten folgten dem Schwarme die beiden Neuntöter. Obwohl sie tief verzweifelt waren über das, was sie gehört hatten, baten sie doch flehentlich, dem jungen Kuckuck nichts zuleide zu tun.
„Es ist ja unser einziges!“ jammerte Mutter Neuntöter. „Ich habe es ausgebrütet, und wir haben es großgezogen. Gewissermaßen ist es ja doch nun einmal unser Kind.“
In diesem Augenblick versetzte der junge Kuckuck dem Stieglitz einen Stoß mit dem Schnabel, daß er umfiel.
„Ich bin groß genug, mich allein zu verteidigen,“ rief er. „Ich sehe aber, daß der Schein[S. 177] gegen mich ist; darum will ich meiner Wege gehen. Ich danke meinen Pflegeeltern für alles Gute, das sie mir erwiesen haben; aber ich glaube nicht an die Geschichte des Zaunkönigs; so wahr ich lebe, will ich die Wahrheit an den Tag bringen, und wenn ich auch bis ans Ende der Welt reisen müßte!“
Dann flog der junge Kuckuck davon — über die Wiese und den Wald hin. Im Fliegen merkte er an der Kraft seiner Flügel, daß er jetzt erwachsen war. Über Felder, Wälder und Wiesen flog er weit fort in fremde Länder.
Sooft er sich niederließ, um auszuruhen, mußte er an die Geschichte denken, die er gehört hatte. Er konnte und konnte sie weder verstehen noch glauben; denn er wußte, daß er nicht schlechter war als die anderen Vögel, und er konnte nicht begreifen, warum ihn seine Mutter der Verachtung und dem Haß der andern Vögel preisgegeben hatte.
Dann hielt der Winter seinen Einzug im Norden.
Im Walde fielen die Blätter von den Bäumen, und die grüne Wiese verbarg sich unter einer dicken weißen Schneedecke. Mitten aus dem Schnee ragte der Dornbusch wie ein Bündel schwarzer Reiser in die Luft. Hier und da hing an einem Zweig noch eine in der Kälte zusammengeschrumpfte Beere.
Die Schmetterlinge, Fliegen und Larven waren verschwunden; und von den Vögeln waren nur die Sperlinge, Buchfinken und Meisen übrig und dann noch die großen Krähen, die unaufhörlich krächzten[S. 178] und mit den Flügeln um sich schlugen, um warm zu werden. Zaunkönig, Neuntöter, Stieglitz und alle die andern waren gen Süden geflogen, wo die Sonne wärmer scheint und die Blätter immer grün sind.
Dort in einem der warmen Länder saß der junge Kuckuck am Weihnachtsabend auf einem hohen Baume und starrte traurig über die Gegend hin. Die Sonne ging eben unter, und viel tausend Blumen erstrahlten in ihrem Glanze. Aber der Kuckuck sah nichts von alledem. Er hatte seine Mutter nicht gefunden, doch die Geschichte des Zaunkönigs konnte er nicht vergessen. Er hatte drei andre junge Kuckucke getroffen, die ganz dasselbe erlebt hatten wie er; und es kam ihm so vor, als gehöre er zu einem fluchbeladenen Geschlecht, das nicht wert sei, von der Sonne beschienen zu werden.
Wie er hier so seinen trübseligen Gedanken nachhing, da raschelte es im Laube neben ihm, und ein großes altes Kuckucksweibchen streckte den Kopf hervor und betrachtete ihn.
„Du siehst nicht besonders vergnügt aus,“ sagte die Alte. „Warum läßt du den Schnabel hängen? Ist es dir hier etwa nicht warm genug, oder findest du nicht genug zu essen?“
„Ich suche meine Mutter,“ erwiderte der junge Kuckuck.
Da hüpfte das alte Kuckucksweibchen auf den Zweig neben ihm und sah ihn aufmerksam an.
[S. 179]
„Vielleicht bin ich deine Mutter. Ich hab’ dich schon heute mittag im Walde beobachtet. Mein Herz sagt mir, daß du mein Fleisch und Blut bist.“
„Wenn du meine Mutter bist, so hast du gar kein Herz. Meine Mutter ist schlecht. Sie hat mir viel Böses angetan.“
Und dann erzählte der junge Kuckuck seine Geschichte. Das alte Weibchen hörte ihm aufmerksam zu und nickte von Zeit zu Zeit.
„In einem Dornbusch, sagst du? In einem großen, großen Walde hoch im Norden? Ja, das paßt alles. Du bist mein Kind. Wie groß und schön du geworden bist!“
Der alte Kuckuck strich dem jungen zärtlich mit dem Schnabel über den Flügel; doch dieser flog mit einem lauten Schrei in die Höhe und schüttelte sein Gefieder.
„Rühr’ mich nicht an,“ schrie er. „Du bist schlecht, ich hasse dich!“
„Herr Gott!“ sagte die alte Kuckucksmutter, ohne den Zorn ihres Kindes zu beachten. „Es ist mir, als ob es gestern gewesen wäre. Wie lange bin ich mit dem Ei, worin du lagst, umhergeflogen und habe nach einem Neste gesucht! Ich mußte ja ein Nest finden, in dem die Eier den meinen ähnlich sahen; sonst hätten die fremden Eltern es bemerkt und hinausgeworfen. Das dauerte sehr lange; und zuletzt bin ich so müde geworden, daß ich Angst bekam, es zu verlieren.“
[S. 180]
„Ich wünschte, du hättest es verloren!“ schrie der junge Kuckuck. „Dann wäre ich nie zur Welt gekommen, hätte meine lieben Pflegegeschwister nicht umgebracht und die armen, treuen Neuntöter nicht zu quälen brauchen. Es wäre mir erspart geblieben, mitanzuhören, wie man meine Mutter einen schlechten, faulen Vogel schimpfte, ohne daß ich ein Wort zu ihrer Verteidigung anführen konnte.“
Der alte Kuckuck sagte nichts, sondern starrte bloß sein erzürntes Kind an.
„Warum hast du dir kein Nest gebaut wie andere ordentliche Vögel?“ fragte der junge Kuckuck. „Und deine Eier ausgebrütet? Und deinen Kindern Futter gebracht? Warum hast du das nicht getan?“
Die alte Kuckucksmutter schüttelte schwermütig den grauen Kopf und seufzte:
„Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Es ist nicht so leicht, ein Kuckuck zu sein, das kannst du mir glauben! Ja, du wirst es noch selbst erfahren, wenn du im Sommer wieder nach Norden ziehst und Eier legen mußt.“
„Glaubst du etwa, daß ich mich dabei ebenso garstig benehmen werde wie du?“ fragte der junge Kuckuck höhnisch.
„Du kannst mir glauben, daß ich mir lieber ein Nest gebaut und meine Kinder bei mir behalten hätte, bis sie erwachsen gewesen und in die Welt hinausgeflogen wären!“ rief die Alte. „Schweren[S. 181] Herzens lege ich jeden Sommer die Eier in fremde Nester; und es betrübt mich stets, nichts darüber zu erfahren, was aus ihnen wird.“
„Warum tust du es denn dann?“
„Ich kann ja nicht anders,“ sagte der alte Kuckuck. „Das ist eben das traurige Geheimnis unseres Geschlechtes. Hör’ mich an, dann will ich es dir erzählen! Sieh mal, ich kann nur jeden achten Tag ein Ei legen. Begreifst du nun, daß das eine Ei verfaulen würde, bis das nächste gelegt ist, und daß ich sie nicht selber ausbrüten kann?“
„Warum legst du die Eier denn nicht schneller?“ fragte der junge Kuckuck. „Hast du keine Lust dazu? Der Zaunkönig sagte, du wärest faul.“
„Ich möchte es ja so gerne! Und ich täte alles, um nur meine Kinder bei mir behalten zu dürfen. Aber ich kann nicht. In meinem Körper ist jedesmal nur Platz für ein Ei; und jedes Ei braucht acht Tage, bis es entwickelt ist.“
Der junge Vogel sah den alten mißtrauisch an.
„Ich glaube dir nicht,“ sagte er bestimmt. „Das sind alles leere Ausflüchte! Der Neuntöter ist kaum halb so groß wie du, und er legt seine Eier im Handumdrehen.“
„Allerdings tut er das,“ erwiderte die Kuckucksmutter, „und er kann Gott dafür danken, daß er imstande dazu ist. Aber der frißt auch nicht so große giftige Larven wie wir Kuckucke. An denen ist nicht viel Fleisch, verstehst du; und darum brauchen wir[S. 182] so viele davon. Und aus diesem Grunde muß unser Magen so groß sein; da bleibt für die Eier nur ganz wenig Platz übrig.“
„Ob ich dir wohl wirklich Glauben schenken darf?“ fragte der junge Kuckuck.
„Das kannst du!“ erwiderte die Mutter. „So verhält es sich und nicht anders! Das eine beruht auf dem andern, siehst du; man muß es sich nur richtig klarmachen. Dann kann man es ertragen, so schwer es auch ist.“
„Ja, dann hast du ja wirklich gar keine Schuld,“ sagte der junge Kuckuck, nachdem er eine Weile nachgedacht hatte. „Und ich muß dich um Verzeihung bitten, weil ich so zornig auf dich gewesen bin. Aber ich finde es hart, daß die anderen Vögel das nicht wissen und uns darum verkennen müssen.“
Da setzte die Alte ein sehr ernstes Gesicht auf und erwiderte:
„So geht es oft hier in der Welt. Die Leute schwatzen, so gut sie’s verstehen; und man muß sie eben schwatzen lassen. Das kann man auch, wenn man ein reines Gewissen hat und seiner Arbeit nachgeht. Und die Arbeit des Kuckucks besteht nun einmal darin, schädliche Larven zu fressen.“
Inzwischen war die Sonne ganz untergegangen, und es wurde dunkel. Die beiden Kuckucke saßen noch lange beieinander und unterhielten sich über den Ernst des Lebens. Dann schliefen sie ein. Dem[S. 183] jungen Kuckuck träumte, er flöge mit seinem Ei im Schnabel umher und suchte nach dem Nest des Stieglitzes, um das Ei hineinzulegen. Und der Kuckucksmutter träumte, daß die Zeit gekommen sei, wo sie keine Kinder mehr zu bekommen und nicht in ewiger Angst und Sorge zu schweben brauchte.

[S. 184]
Irgendwo auf dem Grunde des Meeres trafen sich ein großer Dorsch, ein alter Hummer, ein Seestern und ein halber Sandwurm.
Der Dorsch stand übersatt im Wasser und starrte mit seinen dummen Augen vor sich hin; er mochte sich nicht vom Flecke rühren.
Der Seestern hatte seine fünf Arme um eine Auster geschlungen und war im Begriff, sie auszusaugen. Die Auster hatte zunächst ihre Schalen fest geschlossen; aber da spritzte der Seestern etwas Giftiges auf die Stelle, an der sich die Schalen schlossen, und nun konnte die Ärmste nicht mehr. Schon war sie halb ausgesogen; und der Seestern fing an, sich nach weiterer Nahrung umzusehen. Das konnte er, denn er hatte ein Auge auf der Spitze eines jeden seiner Arme.
Dem Hummer ging es nicht gut.
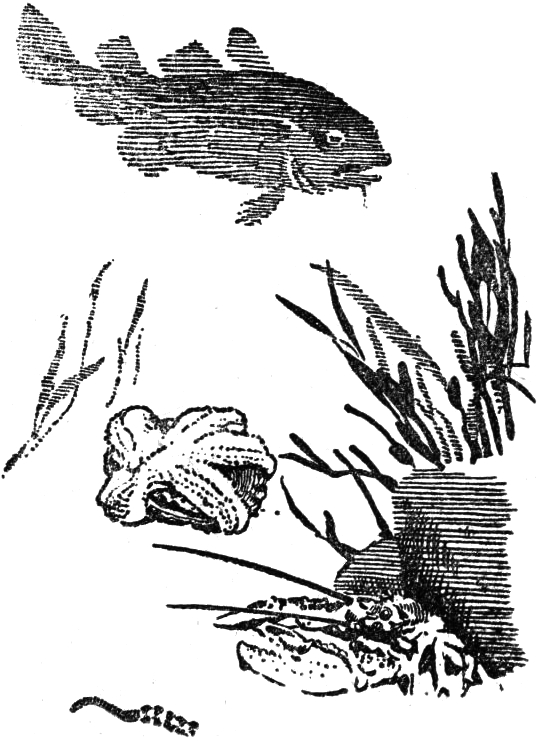
Er hatte vor einigen Tagen die Schale gewechselt, und das neue Gehäuse war noch ganz weich. Darum verbarg dieser Herr sich unter einem großen[S. 185] Stein, aß nicht und war ziemlich verdrießlich, wenn jemand ihn anredete.
Um den Sandwurm aber war es ganz schlimm bestellt.
Der hatte nämlich gestern seine hintere Hälfte eingebüßt. Wie das zugegangen war, wußte er selbst nicht. Augen hatte er nicht; es war allerdings auch kein Grund vorhanden, über diesen Mangel Tränen zu vergießen. Denn der Sandwurm hatte ganz und gar keine Verwendung für die Augen, weil er gewöhnlich im Sande wühlte. Und dann war’s auch im übrigen ein armseliger, weicher Bursch, der das Leben hinnehmen mußte, wie es kam, und dem es auch nicht einfiel, sich zu beklagen.
Aber natürlich suchte er nach seiner Hälfte. Man büßt ja ungern ein, was man hat. Und je weniger man hat, desto mehr Wert legt man begreiflicherweise auf seine Siebensachen.
Wie nun die vier Leutchen sich da unten aufhielten und jeder genug mit seinen Angelegenheiten zu tun hatte, da kam ein großer Tümmler zu ihnen hinunter.
Er jagte allen einen gehörigen Schreck ein. Der Dorsch machte einen Schlag nach der Seite, der Hummer kroch ganz unter den Stein, und der Seestern war nahe daran, die Auster fahren zu lassen. Der Sandwurm endlich merkte wohl an der Bewegung des Wassers, daß etwas los war, wußte aber wie gewöhnlich nicht Bescheid.
[S. 186]
„Ha! ha!“ rief der Dorsch. „Was bist du für ein Fisch?“
„Ich bin gar kein Fisch, wenn ich bitten darf,“ erwiderte der Tümmler.
„Aber Fischfasson hast du doch, wenn’s auch ein bißchen plump ist,“ erklärte der Dorsch.
„Ich weiß wohl, der Schein ist gegen mich,“ sagte der Tümmler. „Das hat mich schon oftmals geärgert. Es geht so weit, daß die Leute mich und meine Verwandten, die anderen Delphine, Walfische nennen. Und ich bin doch in Wirklichkeit ein vollkommen normales Säugetier.“
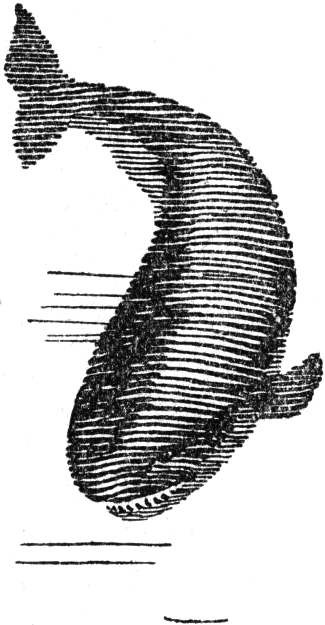
„Was ist das?“ fragte der Dorsch.
„Das Säugetier ist das vornehmste aller Tiere,“ entgegnete der Tümmler. „Wir können überhaupt nicht im Wasser atmen, wie die Fische und das andre Getier hier unten. Wir müssen hinauf, um Luft zu schnappen.“
„Armer Kerl!“ ließ der Dorsch sich vernehmen.
„Ich komme dir arm vor, du dummer Dorsch?“ brauste da der Tümmler auf.
„Ja, du bist zu bedauern!“ sagte der Dorsch. „Wo du dazu bestimmt bist, im Wasser zu leben — und daß du das bist, kann ich ja an deiner Gestalt sehen — da muß es doch greulich lästig sein, jeden Augenblick hinauf zu müssen, um Atem zu holen. Da finde ich denn doch, daß ich besser daran bin.“
„Findest du? Ja, jeder nach seinem Geschmack! Es war recht dumm von mir, mich mit einer Person,[S. 187] wie dir, einzulassen. Wie solltest du das Leben und die Gefühle vornehmer Leute verstehen können! Nun geh’ ich wieder. ’s war ganz zufällig, daß ich hier herunterkam.“
„Adieu!“ rief der Dorsch. „Verlier’ die Luft nicht, bis du hinaufkommst, um dir neue zu holen!“
Der Tümmler schwamm hinauf, und die anderen lachten über den Besucher.
„So einer!“ spottete der Dorsch. „Wie idiotisch vornehme Leute sein können! Da segelt der Tümmler umher und bildet sich ein, daß er besser daran sei als wir, weil er im Wasser keine Luft kriegen kann.“
„Ja, so ein Dünkel ist eine schlimme Sache,“ sagte der Hummer. „Wenn man älter wird, sieht man das am besten ein und lernt, daß wir alle gleich sind vor dem lieben Gott.“
„Na—a,“ fiel der Dorsch ein. „Das, scheint mir, heißt wieder ein bißchen zu weit gehen. Du hast selber gehört, wie ich diesen Prahlhans vorhin zurechtgewiesen habe; denn ich bin ein einfacher, rechtliebender Mann. Aber alle Unterschiede kann man nun doch nicht aus der Welt schaffen.“
„Dann also nicht,“ sagte der Hummer. „Ja, mir ist es gleichgültig; erst muß ich meine Schalen wieder haben.“
„Ja, du bist dabei, die Schalen zu wechseln,“ erwiderte der Dorsch. „Das kann nicht amüsant sein.“
[S. 188]
„Nein, das kannst du mir glauben, besonders in meinem Alter. Hier geht man nun Tag für Tag sozusagen im bloßen Hemde umher und ist dem Zugwind ausgesetzt und all den anderen Unannehmlichkeiten. Es ist das siebente Mal, daß ich die Geschichte durchzumachen habe.“
„Herr Gott! Und das läßt sich gar nicht vermeiden?“
„Nein, wie sollte das zugehen!“ erwiderte der Hummer. „Auf diese Weise wachsen wir ja.“
„Ganz recht,“ bemerkte der Dorsch, „das vergaß ich. Ich dachte nicht daran, daß du zu den niederen Tieren gehörst. Da kannst du’s selbst sehen, wie schlicht und aufrichtig ich bin.“
„Bin ich niedriger als du?“ fragte der Hummer.
„Selbstverständlich!“ war die Antwort. „Du kannst das am allerbesten an deiner Entwicklung sehen. Die niederen Tiere machen die Sache eben so im Sprunge ab. Sie verwandeln sich oder werfen das ganze Skelett ab, wie du jetzt. Bei den höheren Tieren geht alles mehr gleichmäßig zu. Wir wachsen von Tag zu Tag, unmerklich und stetig. Sollte ich mich so schinden müssen wie du, so stürbe ich auf der Stelle. Ich bin feiner organisiert, verstehst du.“
„Was faselt der Dorsch?“ fragte der Hummer und kroch ganz unter den Stein, obwohl er noch ziemlich weich war und jedes Sandkorn spüren konnte, das ihn berührte. „Soll es ein Zeichen[S. 189] deiner feinen Organisation sein, daß du stirbst, wenn du den Rock abwirfst?“
„Natürlich,“ erwiderte der Dorsch.
„Dann bin ich überaus glücklich, daß ich nicht so fein organisiert bin,“ sagte der Hummer. „Einen ähnlichen Unsinn habe ich noch niemals gehört. Alles in allem bist du ja ein ebenso großer Narr wie der Tümmler.“
„Wir verstehen einander gewiß nicht,“ meinte der Dorsch. „Aber darin liegt ja an und für sich nichts Merkwürdiges. Leute verschiedenen Standes müssen überhaupt nicht zusammen schwatzen, nur das Allernotwendigste. Die Tieferstehenden können das selten vertragen; sie werden eingebildet und naseweis davon.“
„Hat man schon je so etwas gehört?“ rief der Hummer.
„Adieu,“ sagte der Dorsch, vollführte einen gewaltigen Schlag mit dem Schwanz und war im selben Augenblick verschwunden.
„Gott mag wissen, was der sich einbildet!“ brummte der alte Hummer.
„Ja, ja,“ seufzte der Sandwurm.
„Wer ist das?... Ach so, du bist es, mein guter Sandwurm.“
„Ja, so ist es.“
„Wie geht es dir?“
„Ach,“ erwiderte der Sandwurm, „ich kann wirklich nicht klagen. Sand gibt es ja immer genug;[S. 190] und wenn man das Ganze frißt, so müßt’ es doch sonderbar zugehen, wenn nicht auch ein bißchen für den Darm darunter wäre. Es ärgert mich nur, daß ich meine hintere Hälfte verloren habe.“
„Gott behüte,“ meinte der Hummer. „Du armes Tier! Ich vertrag’ es nicht, von dergleichen zu hören, solange ich noch weich bin. Was machst du denn ohne Hinterteil?“
„Ja — man schlägt sich durch, so gut man kann.“
„Wie ist das nur zugegangen?“ fragte der Hummer.
„Was weiß ich davon,“ entgegnete der Pierer. „Ein armer Kerl wie ich muß die Dinge hinnehmen, wie sie kommen, und muß froh sein, daß man das Leben behält. Könnt’ ich nur meine Hälfte wiederfinden!“
„Was in aller Welt willst du mit ihr?“
„Jösses, ich will natürlich wieder mit ihr zusammenwachsen. Was denn sonst?“
„Kannst du das?“
„Ja, natürlich kann ich das. Wenn ich sie nicht ausfindig mache, muß ich mich daran geben, eine neue wachsen zu lassen. Aber das dauert selbstverständlich länger. Mit der alten wär’ es leichter.“
„Merkwürdig, merkwürdig,“ sagte der Hummer. „Ich habe wohl gehört, daß man ein Bein oder ein Fühlhorn einbüßen kann, und daß das dann wieder wächst, — aber die ganze hintere Hälfte?“
„Ja,“ fiel der Sandwurm ein, „und doch ist es[S. 191] so. Na, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Kann ja sein, daß ich sie doch noch finde. Oder vielleicht auch eine andere.“
„Was sagst du?“
„Ich sage, ich kann ja Glück haben und ein anderes Hinterteil finden,“ erklärte der Sandwurm. „Es ist doch gar nicht unwahrscheinlich, daß ein anderer Sandwurm dasselbe Malheur gehabt hat, wie ich. Unser sind wahrlich gar viele, und arme Wesen sind wir alle.“
„Gott erbarme sich!“ rief der Hummer. „Wenn du auch eine fremde Hinterhälfte findest — was kann sie dir nützen?“
„I, ich kann doch mit ihr zusammenwachsen,“ sagte der Sandwurm. „Was sollte dem im Wege stehen?“
„Du machst mir was weis.“
„Fällt mir nicht ein. Ich hab’ wahrhaftig nicht den Kopf dazu, um Geschichten zu erdichten. Sie müssen wissen, die Hälfte, die ich verloren hatte — das war, im Grunde genommen, gar nicht meine eigene.“
„Was war es nicht?“
„Nicht meine eigene, sondern eine, die ich das vorige Mal ergatterte, als ich ins Unglück kam. Aber davor die vorige — das war meine eigene. Das war die, mit der ich geboren worden bin.“
„Das ist ja höchst merkwürdig,“ murrte der alte Hummer. „Dann will ich nur hoffen, daß du[S. 192] deine hintere Hälfte oder eine fremde findest; — denn dir ist es wohl gleichgültig, was für eine es sein wird.“
„Das will ich nicht gerade sagen,“ bemerkte der Sandwurm. „Meine eigene war ein wenig verschlissen, drum: könnt’ ich eine jüngere und bessere entdecken, so wäre das recht schön.“
„Na, dann Glück zu!“
„Danke sehr, danke sehr. Es tut immer wohl, Teilnahme zu finden. Es hat mir vorhin auch ungeheure Freude gemacht, als Sie sagten, wir wären alle gleich vor dem lieben Gott. Es ist so herrlich für einen erbärmlichen Wurm, hie und da so etwas zu hören.“
„Nun — ja,“ begann da der Hummer. „Gesagt hab’ ich das ganz gewiß. Aber du mußt das nicht gar so buchstäblich nehmen. Dieser einfältige Tümmler und der dumme Dorsch, die spielten sich so furchtbar auf. Denen tat es gut, eins ausgewischt zu bekommen. Aber das kannst du dir doch niemals einbilden, daß zum Beispiel wir beide, du und ich, gleich wären!“
„Also — so war es nicht gemeint?“
„Du sagst das so wunderlich. Willst du dich wirklich mit einem vornehmen Hummer vergleichen, der Scheren hat und Augen auf Stielen, Fühler und vierzehn Beine, einen Schwimmschwanz mit Fächer, Panzer und Schild und viele andere Herrlichkeiten? Du, der du ewig herumrennst und nach[S. 193] deinem Hinterteil suchst und froh sein willst, wenn du ein anderes findest?“
„Ach nein,“ sagte der Sandwurm. „Es mag ja etwas daran sein. Ich denke noch an das, was Sie vorhin zu dem Dorsch sagten, und an das, was der Dorsch zum Tümmler sagte. Ich kann es nur so verstehen, daß es doch ein Vorteil für mich sein muß, wenn ich wieder mit meiner andern Hälfte zusammenwachsen kann, sobald ich sie ausfindig mache — da ich sie nun mal verloren habe. Und es kann doch auch nie und nimmer mein Schaden sein, daß ich eine andere brauchen kann, wenn ich nicht die eigene finde.“
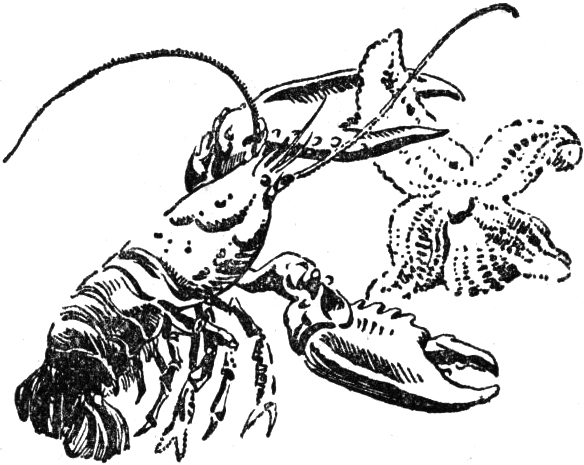
„Du Tropf!“ sagte der Hummer. „Ich bereue, daß ich mich mit dir in ein Gespräch eingelassen habe. Pack’ dich und find’ dich mit deinen Hinterhälften zurecht, wie du magst!“
„Schönen Dank!“ rief der Sandwurm.
Damit kroch er weg. Der Seestern ließ die Auster fahren, weil nichts mehr in ihr war.
[S. 194]
„Der Sandwurm da hat dir eigentlich gut Bescheid gesagt,“ erklärte der Seestern.
„Wen duzest du hier?“ raste der Hummer los.
Er vergaß, daß er noch weich war, und fuhr hervor und biß den einen Arm des Seesterns ab.
„Au!“ rief der Seestern.
„Au!“ schrie der Hummer. „Nun ist meine schöne Schere vielleicht auf Lebenszeit verdorben.“
„Und mein Arm ist weg,“ sagte der Seestern. „Aber ich werd’ mir schon einen neuen verschaffen.“
Damit kroch er seiner Wege. Und der Hummer desgleichen, denn er hatte die Gegend satt. Da war nun nichts anderes mehr als der abgebissene Arm des Seesterns. Und nach einer Weile kam der Sandwurm zurück.
„Hast du deine Hälfte nicht gefunden?“ fragte der Seesternarm.
„Wer spricht da?“ fragte der Sandwurm. „Ich sehe niemand.“
„Nur ich bin es! Ich bin der fünfte Arm des Seesterns. Der Hummer hat mich abgebissen, weil du ihn in Wut versetzt hattest.“
„Herr Gott, du armes Wesen,“ sagte der Sandwurm. „Nun ist es also aus mit dir!“
„Na—a,“ sagte der Seesternarm. „So arg ist’s nun auch nicht gerade! — Hast du deine Hälfte gefunden?“
„Nein,“ erwiderte der Sandwurm. „Und auch[S. 195] keine andere. Es wird aber wohl eine neue wachsen. Wenn ich bloß nicht zu alt dazu bin, — dann muß ich mich ja so behelfen.“
„Das täte mir leid für dich,“ sagte der Seesternarm.
„Ich danke dir für deine Freundlichkeit! Übrigens scheint es mir, als könntest du all das Mitleid, das du auftreiben kannst, selber gebrauchen. Aus dir kann doch nie mehr was Rechtes werden.“
„Warum denn nicht?“ fragte der Seesternarm. „Man soll nie die Hoffnung aufgeben. Der, zu dem ich gehört habe, bekommt bald genug einen neuen Arm; und ich denke wirklich auch nicht daran, zu krepieren.“
„Eigentlich scheinst du mir rechte Veranlassung dazu zu haben. Dir fehlen... laß mal sehen, dir fehlen vier Arme...“
„Und Mund und Magen und das Ganze.“
„Das heißt, dir fehlt das ganze Tier bis auf den Stumpf, der du bist!“
„Jawohl. Und was einem fehlt, soll man sich verschaffen. Wenn du sehen könntest, würd’ ich dir zeigen, daß ich schon ein ganz klein wenig auszuwachsen angefangen habe.“
„Kannst du denn sehen?“
„Gewiß doch,“ war die Antwort des Seesternarms. „Ich habe ein Auge, — jeder von uns hatte eins, und meines hab’ ich — Gott sei Dank! — behalten, weil es ganz an der Spitze sitzt. Und ein[S. 196] Stück Darm habe ich auch in mir, so daß es gar kein so schlechter Anfang ist.“
„Ja, Glück zu!“ sagte der Sandwurm.
„Danke,“ wehrte der Seesternarm ab. „Es wird sich schon machen. — Hättest du nur deine hintere Hälfte!“
„Hör’ einmal, Freundchen,“ begann nun der Sandwurm. „Ist’s nicht ein bißchen eingebildet von dir, dich mit meinen Siebensachen zu beschäftigen, da du selber in der Patsche sitzest? Kümmer’ dich gefälligst nicht um meine hintere Hälfte, und denk’ an den ganzen Seestern, der dir fehlt!“
„Herr Gott,“ sagte der Seesternarm, „machst du dich nun auch wichtig?“
„Wichtig?“ fragte der Sandwurm. „Wichtig mach’ ich mich nicht. Aber ich kann es nicht leiden, wenn jemand sich so anstellt. Es gibt denn doch auch Unterschiede.“
„Sooo?“ sagte der Seesternarm. „Ich meine, zum Hummer hättest du gesagt...“
„Du solltest nicht auf das hören, was ordentliche Leute reden, wenn du es nicht verstehen kannst,“ rief der Sandwurm zornig. „Was ich zum Hummer sage, ist etwas für sich; was ich zu dir sage, etwas ganz anderes. Du bist nichts als ein elender Stumpf von einem Weichtier, und ich bin ein Wurm... hörst du?... wenn auch zurzeit nur ein halber Wurm! Himmelhoch steh’ ich über dir, der daliegt und vegetiert, ohne Arme, ohne Magen, ohne Mund[S. 197] und alles, bis es eines Tages wieder an dir auswächst, diesen oder jenen Weg — es ist dir wohl ganz egal.“
„Du darfst nicht böse auf mich werden,“ bat da der Seesternarm. „Du kannst deine Hälfte wiederbekommen. — Aber wenn ich nun alles bekomme, was ich verloren habe, so ist das doch ganz tüchtig von mir... findest du nicht? Mich dünkt, je schlimmer es einem ergangen ist, desto tüchtiger ist der, der sich durchfindet. — War das nicht so ähnlich, was du zu dem alten Hummer sagtest?“
„Weichtier! Idiot!“ schrie der Sandwurm.
Dann kroch er fort.
Und der Seesternarm lag und wuchs; und es dauerte nur ein paar Tage, bis alles an ihm wieder ausgewachsen war. Nun war er ebensogut ein Seestern wie die andern; nur der alte Arm war viel größer als die vier neuen. Aber das besserte sich ja gewiß noch mit der Zeit.
Froh ging er in die Welt hinaus, um jemanden zu finden, vor dem er sich aufspielen konnte.
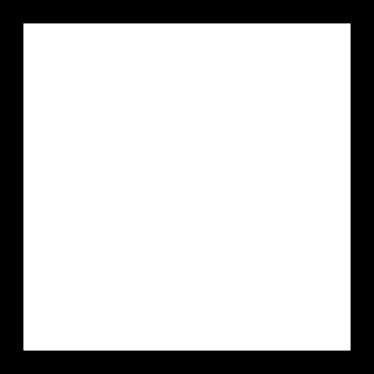
[S. 198]
Es war in der guten alten Zeit, als es noch keine Städte mit Häusern, Straßen und ragenden Kirchtürmen gab. Es gab auch noch keine Schulen. Denn es gab nicht viele Jungen; und die wenigen, die da waren, lernten von ihrem Vater mit dem Bogen schießen und den Hirsch in seinem Versteck aufstöbern, sie lernten den Bären erlegen und sich Kleider aus seinem Pelze anfertigen und lernten zwei Stücke Holz aneinander reiben, bis sie sich entzündeten. Wenn sie das konnten, dann hatten sie ausgelernt.
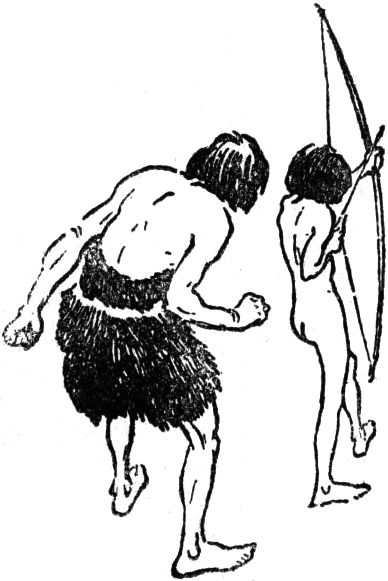
Auch keine Eisenbahnen gab es damals, keine bebauten Felder, keine Schiffe auf dem Meere und keine Bücher; denn es war ja niemand da, der sie lesen konnte.
Eigentlich gab es nur Bäume.
Aber davon waren auch genug da. Bäume standen überall bis an die Meeresküste, spiegelten sich in den Bächen und Seen und streckten ihre mächtigen Zweige zum Himmel. Am Strande neigten sie sich, sie tauchten ihre Zweige in das schwarze Moor; und von den hohen Hügeln schauten sie stolz über die Lande hin.
[S. 199]
Die Bäume waren alle vertraut miteinander, denn sie gehörten zu einer großen Familie; und darauf waren sie sehr stolz.
„Wir sind samt und sonders Eichbäume,“ sagten sie und brüsteten sich gehörig. „Uns gehört das Land, wir sind die Herrscher.“
Und das war auch richtig, denn damals gab es nur ganz wenige Menschen und sonst nur noch wilde Tiere. Der Bär, der Wolf und der Fuchs gingen auf die Jagd, und der Hirsch graste am Moore. Die Waldmaus saß vor ihrer Tür und nagte an Eicheln, und der Biber führte seine Bauten am Ufer des Baches auf.
Da kam eines Tages der Bär dahergetrottet und legte sich, so lang er war, unter einem hohen Eichbaum nieder.
„Bist du schon wieder da, du Räuber?“ rief die Eiche und schüttelte einen Haufen welker Blätter über ihn.

„Du solltest nicht so leichtsinnig mit deinen Blättern umgehen, lieber Freund,“ sagte der Bär und leckte seine Pfoten. „Das ist noch das einzige, daß man in deinem Schatten liegen kann.“
„Wenn ich dir nicht passe, kannst du ja deiner Wege gehen,“ antwortete die Eiche stolz. „Ich bin Herr im Lande; und wohin du siehst, siehst du nur meine Brüder.“
„Ganz recht,“ brummte der Bär; „das ist gerade das Langweilige an der Sache. Ich habe eine[S. 200] kleine Reise ins Ausland gemacht, weißt du; und nun bin ich ein wenig verwöhnt. Es war mehr im Süden — da hielt ich einmal ein kleines Schläfchen unter den Buchen. Das sind große, schlanke Bäume, keine krummen alten Burschen wie ihr. Und ihre Kronen sind so dicht, daß die Sonnenstrahlen gar nicht hindurchkommen können. Es war ein reines Vergnügen, darunter sein Mittagsschläfchen zu halten.“
„Buchen?“ fragte die Eiche neugierig. „Was sind das für Bäume?“
„Froh sein würdest du, wenn du nur halb so schön wärest wie eine Buche!“ sagte der Bär. „Aber jetzt mag ich nicht mehr mit dir schwatzen. Ich hab’ über eine Meile traben müssen des verfluchten Jägers wegen, der mich mit seinem Pfeil ins Hinterbein getroffen hatte. Jetzt will ich schlafen, und du bist wohl so freundlich, mich wenigstens in Ruhe zu lassen, da du mir doch nicht viel Schatten geben kannst.“
Der Bär reckte sich und schloß die Augen; aber aus dem Schlafen wurde diesmal nicht viel. Denn die anderen Bäume hatten gehört, was er erzählt hatte; und es begann ein Schwatzen und Plaudern und Blätterrauschen wie noch nie zuvor im Walde.
„Gott weiß, was das für Bäume sein mögen!“ meinte der eine.
[S. 201]
„Ach, der Bär will uns natürlich etwas weismachen!“ der andere.
„Was können das nur für Bäume sein, wo die Blätter so dicht sind, daß die Sonnenstrahlen nicht durchkommen können?“ fragte eine kleine Eiche, die zuhörte, wie die Gefährten zusammen sprachen.
Aber daneben stand ein alter, knorriger Baum, der gab der kleinen Eiche einen Klaps mit einem seiner untersten Zweige.
„Willst du wohl schön den Mund halten,“ sagte er, „wart’, bis du so alt bist, daß du mitreden kannst! Und ihr anderen müßt dem Bären seinen Schnickschnack nicht glauben. Ich bin viel größer als ihr, und ich kann den ganzen Wald übersehen. Aber soweit ich sehen kann, sind da nichts als Eichbäume.“
Die kleine Eiche war ganz eingeschüchtert und schwieg, und die anderen großen Bäume flüsterten leise zusammen, denn sie hatten großen Respekt vor dem Alten.
Aber der Bär erhob sich und rieb sich die Augen.
„Nun habt ihr mir mein Mittagsschläfchen gestört,“ brummte er grimmig, „und ihr könnt mir’s glauben, rächen werd’ ich mich dafür! Wenn ich wiederkomme, werde ich Buchensamen mitbringen; und ich weiß, ihr werdet alle gelb vor Neid werden, wenn ihr seht, wie schön die neuen Bäume sind.“
Damit trollte er von dannen. Aber die Eichen sprachen den lieben langen Tag von den lächerlichen Bäumen, von denen er ihnen erzählt hatte.
[S. 202]
„Wenn sie kommen, nehme ich ihnen Licht und Luft weg!“ versicherte der kleine Eichbaum; aber gleich hatte er seinen Klaps von der alten Eiche weg.
„Wenn sie kommen, dann bist du höflich gegen sie, du Grünschnabel!“ sagte sie. „Aber sie kommen nicht.“
* *
*
Darin behielt die alte Eiche nun doch nicht recht, denn sie kamen wirklich.
Als es Herbst wurde, kam der Bär zurück und legte sich unter der alten Eiche nieder.
„Ich soll dir einen Gruß von da unten bringen,“ sagte er und holte ein paar sonderbare Dingelchen aus seinem zottigen Pelze hervor. „Sieh mal, was ich hier für dich habe!“
„Was ist das?“ fragte die Eiche.
„Das sind Bucheckern,“ erwiderte der Bär, „die Buchensamen, die ich dir versprochen habe.“
Damit stampfte er sie in den Erdboden hinein und schickte sich an, wieder zu gehen.
„Es ist schade, daß ich nicht länger bleiben und mit ansehen kann, wie ihr euch krank ärgert,“ brummte er. „Aber das Menschenpack ist so zudringlich geworden. Neulich haben sie mir meine Frau und den einen von meinen Brüdern erschlagen, und ich muß mich nach einem ruhigen Plätzchen umsehen. So ein ehrlicher Bär ist fast[S. 203] nirgends seines Lebens mehr sicher. Lebt wohl, ihr alten Murrpeter!“
Als der Bär davongetrollt war, sahen die Bäume einander nachdenklich an.
„Jetzt wollen wir sehen, was daraus wird!“ sagte die alte Eiche.
Und dabei beruhigten sie sich. — Dann kam der Winter und beraubte sie all ihrer Blätter; der Schnee lag fußhoch, und jeder Baum stand in seine Wintergedanken versunken da und träumte vom Frühling.
Und als der Frühling kam, prangte das Gras in seinem frischen Grün, und die Vögel sangen da weiter, wo sie das letztemal aufgehört hatten. Die Blumen schossen zu Tausenden hervor, und alles strahlte in üppiger Frische.
Nur die Eiche hatte noch keine Blätter.
„Es ist am vornehmsten, wenn man zuletzt kommt,“ sagten sie. „Der König des Waldes stellt sich erst ein, wenn die ganze Gesellschaft beisammen ist.“
Aber schließlich kam auch ihre Zeit. Die Blätter brachen aus den dicken Knospen hervor, und die Bäume sahen sich an und sagten sich gegenseitig Schmeicheleien, wie schön sie sich ausnähmen. Die kleine Eiche war um ein großes Stück gewachsen. Darauf bildete sie sich nicht wenig ein und meinte, jetzt dürfe sie mitreden.
„Aus den Buchen des Bären wird nichts,“ ver[S. 204]kündete sie spöttisch, aber schielte gleich ängstlich zu der alten Eiche hinauf, die es ja gewöhnlich auf ihren Kopf abgesehen hatte.
Die alte Eiche hörte wohl, was der kleine Nachwuchs sagte, und die anderen Bäume hörten es auch. Aber sie schwiegen. Keiner hatte vergessen, was der Bär ihnen erzählt hatte; und jeden Morgen, wenn die Sonne schien, guckten sie verstohlen hinunter, um nach den Buchen zu sehen. Eigentlich war ihnen recht beklommen ums Herz, aber sie waren zu stolz, es sich anmerken zu lassen.
Und eines Tages kamen endlich die zarten Keime zum Vorschein. Die Sonne schien darauf, und der Regen tränkte sie; es dauerte gar nicht lange, so schossen sie ein ordentliches Stück in die Höhe.
„Nein, wie niedlich die sind!“ riefen die großen Eichen und verdrehten ihre krummen Zweige noch mehr, damit sie sie ordentlich zu sehen bekämen.
„Ihr sollt uns willkommen sein!“ sagte die alte Eiche und nickte den Buchen gnädig zu. „Ihr sollt meine Pflegekinder sein und sollt es ebenso gut wie meine eigenen Kinder haben.“
„Wir danken euch!“ flüsterten die kleinen Buchen; mehr sagten sie nicht.
Aber die kleine Eiche wollte nichts von den fremden Bäumen wissen.
„Das ist ja unheimlich, wie ihr in die Höhe schießt!“ rief sie der nächsten Buche ganz beleidigt[S. 205] zu. „Ihr reicht mir ja schon fast bis an den Leib. Wollt ihr nicht gefälligst daran denken, daß ich viel älter bin und außerdem von alteingesessener Familie!“

Die Buche lachte mit ihren winzigen grünen Blättern, aber sie sagte nichts.
„Soll ich meine Zweige ein bißchen beiseite[S. 206]nehmen, damit die Sonne euch besser bescheinen kann?“ fragte die alte Eiche höflich.
„Vielen Dank!“ antworteten die Buchen. „Wir wachsen so wunderschön hier im Schatten.“
Und der ganze Sommer verging und wieder einer und noch mehrere. Die Buchen fuhren fort zu wachsen und wuchsen endlich der kleinen Eiche ganz über den Kopf.
„Weg mit euren Blättern!“ schrie die Eiche. „Ihr nehmt mir das Sonnenlicht fort, und das vertrage ich nicht. Ich brauche viel Sonnenschein. Weg mit den Blättern! Sonst gehe ich zugrunde.“
Doch die Buchen lachten nur und wuchsen weiter. Zuletzt schlossen sie sich ganz über dem Kopfe der kleinen Eiche, und da starb sie ab.
„Das war nicht schön von euch!“ riefen die großen Eichen und schüttelten vor Zorn ihre Zweige.
Aber die alte Eiche nahm ihre Pflegekinder in Schutz.
„Das ist die gerechte Strafe,“ sagte sie. „Das hat sie nun für ihr Prahlen. Ich sage das, obwohl es mein eigen Fleisch und Blut war. Aber jetzt müßt ihr euch auch gut aufführen, ihr kleines Buchenvolk, denn sonst habt ihr einen Klaps von mir weg.“
Die Jahre vergingen, die Buchen wuchsen weiter, und es wurden schlanke Bäumchen daraus, die bis mitten zwischen die Zweige der alten Eiche reichten.
„Ihr fangt an, mir etwas lästig zu werden![S. 207]“ sagte eines Tages die Eiche. „Ihr solltet lieber anfangen, ein wenig in die Breite zu wachsen, und nicht immer weiter in die Höhe schießen. Seht mal an, wie voll eure Zweige hängen! Ihr müßt sie ordentlich biegen, wie ihr es bei uns seht! Was wollt ihr denn anfangen, wenn ein ordentlicher Sturm kommt? Ihr wißt nicht, wie der Wind unsere Wipfel rüttelt und schüttelt! Oft haben sogar meine alten Glieder geknarrt; wie wird es euch erst gehen mit eurem dünnen Firlefanz da in der Luft?“

„Jeder wächst auf seine Manier und wir auf die unsre,“ antworteten die jungen Buchen. „So ist’s nun mal Sitte in unserm Heimatlande, und wir brauchen darum wohl nicht schlechter zu sein als ihr.“
„Sehr höflich behandelt ihr mich bemoostes Haupt gerade nicht,“ sagte die Eiche. „Ich bereue schon, daß ich so gut zu euch war. — Wenn ihr auch nur einen Funken Ehrgefühl im Leibe habt, so seid so gut und nehmt eure Blätter ein wenig beiseite! In diesem Jahre haben meine untersten Zweige fast gar keine Knospen gehabt, weil ihr mir das Licht wegnehmt.“
„Wir verstehen nicht recht, was das uns angeht!“ antworteten die Buchen. „Jeder hat doch genug mit sich selber zu tun. Taugt er zu seiner Arbeit, und hat er Glück, so geht’s ihm gut. Wenn[S. 208] nicht, so muß er sich darein finden, daß es ihm schlecht geht. Das ist der Welt Lauf.“
Und die untersten Zweige der Eiche starben ab; der alte Baum fing an, wirklich in Besorgnis zu geraten.
„Ihr seid mir ein paar nette Bürschchen!“ schalt er. „Wie lohnt ihr mir denn meine Gastfreundschaft? Als ihr klein wart, habe ich euch zu meinen Füßen wachsen lassen und habe euch vor dem Sturm geschützt. Ich habe die Sonne auf euch scheinen lassen, so viel sie wollte, und hab’ euch wie meine eigenen Kinder behandelt. Und jetzt wollt ihr mich zum Dank ersticken!“
„Dummes Zeug!“ sagten die Buchen.
Und sie trugen Blüten und Früchte; und als die Früchte reif waren, rüttelte der Wind in den Zweigen und streute sie weit umher.
„Ihr seid flinke Burschen, so wie ich!“ rief der Wind. „Drum mag ich euch leiden und helfe euch gern.“
Und als der Fuchs sich am Fuße der Buche rollte und wälzte, war sein Fell im Nu voll von den stachlichten Früchten, und er lief mit ihnen weit ins Land hinein. Und ebenso machte es der Bär; und der lachte obendrein noch die alte Eiche aus, als er im Schatten der Buchen sein Ruhestündchen hielt. Die Waldmaus war ganz entzückt über das neue Gericht und meinte, Bucheckern schmeckten viel besser als Eicheln.

[S. 209]
Ringsumher schossen neue kleine Buchen hervor, die ebenso schnell wie ihre Eltern wuchsen. Sie sahen so frisch und vergnügt aus, wie wenn sie nichts von einem bösen Gewissen wüßten.
Aber die alte Eiche schaute traurig über den Wald hin. Überall kamen die hellen Buchenblätter hervor, und die Eichen seufzten und klagten sich gegenseitig ihre Not.
„Sie reißen die Herrschaft an sich!“ schrien sie und schüttelten sich, soweit die Buchen es zuließen. „Das Land ist nicht mehr unser.“
Ein Zweig nach dem andern starb ab, und der Sturm brach die Äste ab und warf sie zu Boden. Die alte Eiche hatte jetzt nur noch ein paar Blätter am Wipfel.
„Bald ist’s aus mit mir!“ sagte sie ernst.
Aber jetzt gab es viel mehr Menschen im Lande als früher; und die beeilten sich, die Eichen zu fällen, solange noch welche da waren.
„Eichenholz ist besser als Buchenholz,“ meinten sie.
„Da haben wir wenigstens endlich einmal etwas Anerkennung gefunden,“ sagte die alte Eiche. „Aber wir werden’s mit dem Leben bezahlen müssen.“
Und zu den Buchen sagte sie:
„Was habe ich doch nur gemacht, daß ich euch geholfen habe, als ihr klein wart! Was bin ich doch für ein alter Tor gewesen! Früher waren wir Eichbäume die Herren im Lande, und jetzt muß[S. 210] ich Jahr für Jahr sehen, wie meine Brüder rings im Kampfe mit euch den kürzeren ziehen. Mit mir selbst ist es nun auch bald aus, und nicht eine von meinen Eicheln hat in eurem Schatten keimen können. Aber bevor ich sterbe, möchte ich doch wissen, wie ihr so ein Benehmen eigentlich nennt?“
„Das ist bald gesagt, alter Freund!“ antworteten die Buchen. „Wir nennen’s Konkurrenz, und wir haben sie nicht erfunden. Sie erhält und regiert die Welt.“
„Ich verstehe eure Fremdwörter nicht,“ sagte die Eiche. „Ich nenne es schnöde Undankbarkeit.“
Damit starb sie.
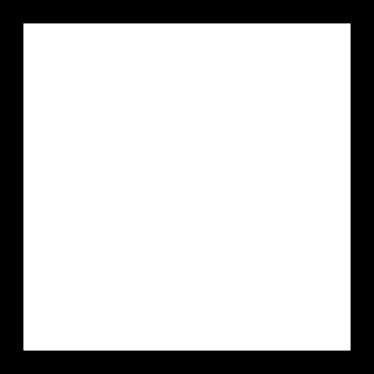
[S. 211]
Es war im April.
Der Stachelbeerstrauch war schon lange grün, aber das ist ja nun einmal so ein Prahlhans. Von den andern Sträuchern hatte noch keiner Blätter und auch von den Bäumen nicht. Aber sie hatten dicke Knospen, und ihre Stämme und Zweige glänzten vor Nässe; denn der Regen hatte soeben ein großes Frühjahrsreinemachen veranstaltet.
Jetzt schien die Sonne recht lustig. Ringsum erhoben die Anemonen ihre feinen Köpfchen aus der Erde, und der Star war schon lange da; mit jedem Tage wurden neue Zugvögel erwartet.
Am Rande des Waldes, da, wo die großen Tannen standen, lag ein gewaltiger Ameisenhügel.
Der war aus vielen Tausend Tannennadeln erbaut, und seine Spitze reichte bis an den untersten Zweig des Baumes. Aber er war feucht wie die Stämme und Zweige; und es sah aus, als wäre er ganz ausgestorben. Nicht eine einzige Ameise kroch darauf herum.
Auf dem Zweige über dem Hügel saß der Buchfink mit seiner Braut. Seine Brust begann sich schon zu röten, und er übte die Hochzeitstriller ein.
[S. 212]
„Herr Gott, wie hübsch du bist!“ flötete sie und sah ihn verliebt an.

„Ja, jetzt ist es auch das beste, daß wir an die Hochzeit denken,“ sagte er. „Wo sollen wir unser Nest aufhängen?“
[S. 213]
„Was schwatzest du da!“ sagte sie. „Meinetwegen können wir das Nest hier aufhängen. Aber es ist gewiß zu früh! Die Ameisen haben ja noch nicht einmal aufgemacht.“
Die beiden schauten auf den Hügel hinab. In diesem Augenblick öffnete sich ein Türchen des Hügels und eine große alte Ameise kam heraus. Sie streckte ihre Beine, gähnte und bewegte ihre Kiefer, um zu sehen, ob sie in Ordnung wären.
„Guten Tag,“ rief der Buchfink ihr zu. „Du brauchst keine Angst zu haben, ich werd’ dich nicht fressen.“
„Ich bin auch gar nicht ängstlich,“ erwiderte die Ameise. „Denn ich bin dir viel zu sauer.“
„Willst du ein bißchen im Sonnenschein umherfliegen?“
„Ich habe keine Flügel und habe auch keine Verwendung für so etwas.“
„Nichts für ungut,“ rief der Buchfink. „Ich meinte bloß, ob du nicht ausziehen und dir einen Schatz suchen wolltest.“
„Ich mache mir nichts aus einem Schatz,“ antwortete die Ameise.
„Gott behüte,“ sagte das Buchfinkenfräulein. „Dann kannst du dich ja nie verheiraten.“
„Nein,“ war die Antwort der Ameise.
„Und kannst keine Eier legen? und keine Junge bekommen?“
„Nein.“
[S. 214]
„Herr Gott. Das muß ja ein trauriges Leben sein.“
„Das Leben besteht aus Arbeit,“ sagte die Ameise. „Und ich bin ein Arbeiter. Obendrein der älteste im ganzen Hügel.“
Nach diesen Worten drehte sie sich um und rief etwas in den Hügel hinein. Einen Augenblick später öffneten sich hundert Türchen; und aus ihnen wimmelten lauter Ameisen hervor. Sie liefen hin und her und reckten sich und streckten sich und freuten sich über den Frühlingssonnenschein.
„Jetzt gehen wir an die Arbeit,“ befahl die alte Ameise. „Sechs von euch nehmen die halbtote Fliege vom vorigen Jahre, die dort liegt, und tragen sie zu den Larven hinab. Die erste Kompagnie marschiert hinaus und schafft Essen herbei. Ihr wagt mir nicht mit leeren Händen heimzukommen. Die zweite Kompagnie bessert den Hügel auf der Nordseite aus; der Schnee hat ihn ganz flachgedrückt. Die dritte Kompagnie öffnet die übrigen Türen und lüftet den Hügel bis in den Keller hinunter. Die vierte Kompagnie trägt die Puppen in den Sonnenschein hinauf. Aber ihr haftet mir mit euerm Leben dafür, daß sie sich nicht erkälten. Sobald ihr die kleinste Wolke am Himmel stehen seht, tragt ihr sie augenblicklich wieder hinunter.“
Die Ameisen liefen, so schnell sie konnten, um die Befehle auszuführen; aber es kamen immer[S. 215] mehr herauf, so daß der Hügel während der ganzen Zeit von Ameisen wimmelte. Jetzt rückte bereits die vierte Kompagnie mit den Puppen an, kleinen, runden weißen Dingern, die wie Eier aussahen und auch wirklich die Eier der Ameisen waren; sie trugen sie mit den Kiefern und legten sie vorsichtig in die Sonne, wo es am trockensten war; und dann liefen sie gleich wieder hinunter, um noch mehr Puppen zu holen.
„Sieh, sieh!“ rief der Buchfink. „Die Puppen da sehen sehr appetitlich aus.“
„Ich rate dir: nimm dich in acht,“ sagte die alte Ameise. „Wir können uns wehren; das kannst du glauben.“
„Ach was,“ meinte der Buchfink. „Einen freien Vogel wie mich lässest du wohl fliegen.“
Beide Buchfinken beugten sich über den Hügel hinab und sperrten die Schnäbel auf und schlugen mit den Flügeln. Aber die alte Ameise kommandierte mit lauter Stimme:
„Erste Batterie... zum Batterieschießen parat ... protzt ab...“
Im selben Augenblick legten sich hundert Ameisen auf den Rücken und streckten den Hinterleib in die Luft.
„Feuer!“ rief die alte Ameise.
Hundert feine Strahlen stiegen empor und trafen die Buchfinken in die Augen und die geöffneten[S. 216] Schnäbel. Sie schrien und fauchten und flogen höher in den Baum hinauf.
„Was ist das für eine Teufelei?“ schrie der Buchfink.
„Das ist Ameisensäure,“ rief die alte Ameise. „Laßt uns in Frieden!“
Schimpfend und halb blind flogen die Buchfinken in den Wald hinein. Doch die alte Ameise dachte gar nicht mehr an sie, sondern fuhr fort zu kommandieren, und die anderen liefen weg, kamen zurück und liefen wieder weg.
Dann kehrte die erste Kompagnie mit dem Futter zurück.
„Die sechste Kompagnie tritt an und nimmt die Nahrungsmittel entgegen!“ befahl die Alte.
Darauf wandte sie sich der ersten Kompagnie zu.
„Brecht!“ kommandierte sie.
Und alle die Ameisen brachen aus, was sie gefunden hatten; und die sechste Kompagnie nahm es und lief in den Hügel damit.
„Packt euch und holt mehr!“ befahl die alte Ameise. „Was nützt das bißchen?“ Während dieser Worte kreuzte sie ihre Fühler und verneigte sich tief.

Durch die größte der Türen kam eine sehr große, fette Ameise ganz langsam gegangen. Hinter ihr marschierten dreißig gewöhnliche Ameisen, die sich verneigten, sooft jene große Ameise sich[S. 217] umwandte, und die auf den kleinsten Wink ihrer Herrin achteten.
„Guten Tag, Majestät,“ sagte die Alte. „Willkommen im Sonnenschein! Darf ich fragen, ob auch die anderen Majestäten unterwegs sind?“
„Weiß nicht, kümmere mich nicht darum,“ erwiderte die fette Ameise. „Kümmere mich nicht um den Sonnenschein... kümmere mich um gar nichts. Mag keine Eier mehr legen.“
„Das ist auch nicht nötig, Majestät,“ sagte die Alte. „Der Hügel ist wahrhaftig voll genug. Wir haben unsere Mühe und Not damit, für alle genug Nahrung zu schaffen. Ich hoffe, daß Majestät sich wohl befinden, und daß das Gefolge gehorsam und untertänig ist?“
„Kümmere mich nicht darum,“ antwortete die Königin. „Wo sind meine Flügel? Wünsche ein wenig in der Sonne umherzufliegen.“
„Das ist leider unmöglich, Majestät. Wie Majestät sich erinnern werden, verloren Majestät die Flügel im vorigen Jahre bei einem bedauernswerten Unglücksfall unmittelbar nach Ihrer Majestät Hochzeit.“
Die Folge dieser Worte war, daß die Königin mit ihren Kiefern nach der Ameise biß; doch sie war zu dick und zu alt und konnte sie nicht erreichen. „Unsinn, Geschwätz... alter Flegel... hab’ sie selber abgerissen... wart’ nur...“
Dann watschelte sie weiter, von ihrem ehrerbie[S. 218]tigen Gefolge begleitet. Hinter ihr kamen noch andere Königinnen, die alle ein ähnliches Gefolge hatten und von der Alten mit der größten Untertänigkeit begrüßt wurden. Sie gingen umher, machten hier und da halt, faselten ein wenig, ließen sich füttern und gingen dann wieder in den Hügel hinein.
„Ach ja,“ seufzte die Alte, als die Prozession vorüber war. „Sie taugen nichts mehr. Aber das macht nichts, wir haben mehr neue, als wir brauchen können.“
„Verzeihung,“ sagte der Buchfink, der wieder in der Tanne über dem Hügel saß. „Sind deine Kanonen wieder eingefahren?“
„Wir tun keiner Katze ein Leid, wenn man uns nur in Frieden läßt,“ erwiderte die Ameise.
„Ja, ich werd’ mich in acht nehmen,“ sagte der Buchfink. „Vorläufig wenigstens. Wenn man das Nest voller Jungen hat, die vom Morgen bis zum Abend vor Hunger schreien, weiß man ja allerdings nicht, auf was für Gedanken man noch kommen kann.“
„Nein, das weiß Gott.“
„Was weißt du denn davon? Wer bist du eigentlich? Bist du eine Mannsperson oder ein Frauenzimmer?“
„Ach, im Grunde bin ich gewiß ein Frauenzimmer, aber jetzt bin ich so etwas wie ein geschlechtsloses Wesen, denke ich. Ich bin ein Arbeiter,[S. 219] schufte vom Morgen bis zum Abend und denke an nichts anderes.“
„Das klingt ja höchst sonderbar,“ sagte der Buchfink. „Wer legt denn eure Eier?“
„Das besorgen die Königinnen,“ antwortete die Ameise. „Das ist ihr Beruf; sonst haben sie nichts zu tun.“
„Und wer sorgt für die Kinder?“
„Ich und meinesgleichen. Wir bauen den Hügel, beschaffen die Nahrung, stopfen sie in die Familie hinein und halten das Ganze in Ordnung.“
„Habt ihr denn keine Mannsperson im Hause?“ fragte der Buchfink.
„Von der Sorte haben wir gerade genug.“
„Helfen die denn gar nicht?“
„Sie rühren sich nicht.“
„Dann muß es sich als Ameisenmann ja ganz angenehm leben lassen,“ sagte der Buchfink nachdenklich.
„Aber wir haben auch keine Achtung vor ihnen,“ sagte die Ameise. „Gleich nach der Hochzeit erwürgen wir sie alle, wenn sie nicht Reißaus nehmen.“
„Au,“ sagte der Buchfink. „Dann will ich doch lieber bleiben, was ich bin.“
„Tu’ du das! Und ich sorge für das Meine. Jetzt geht die Sonne unter, da schließen wir den Hügel.“
Und sie befahl den anderen, die Türen vor[S. 220]zusetzen. Im Augenblick war alles verschlossen, und der Ameisenhügel lag wieder wie tot da.
*
Einen Monat später ging es noch emsiger in dem Ameisenhügel zu.
Die Hälfte der Ameisen war in den Wald ausgerückt, um Nahrung herbeizuschaffen. Die andere Hälfte hatte genug damit zu tun, die Jungen, die mit jedem Tage wuchsen und gefräßiger wurden, zu pflegen und zu füttern. Viele von ihnen waren bereits Puppen geworden und aßen nichts, mußten aber unaufhörlich hin und her bewegt, gedreht und gewendet werden; die Larven dagegen schrien den ganzen Tag nach Nahrung.
Die alte Ameise kam selten aus dem Hügel heraus.
Draußen nahm die Arbeit ja sowieso ihren stetigen Verlauf; das Wichtigste war, in den Stuben Ordnung zu halten. Der Hügel reichte doppelt so tief unter die Erde wie darüber; und er bestand aus unendlich vielen Gängen und Kammern.
Aber die alte Ameise irrte sich nie. Sie wußte ganz genau, wo die Larven waren, die Arbeiter werden sollten, wie sie selbst, und wo sich die Larven befanden, die dazu bestimmt waren, Königinnen zu werden, und wo sich die Männchen befanden. Sie sorgte für Ordnung, so daß nicht die geringste Verwirrung oder Störung entstand. Tag und Nacht[S. 221] trippelte sie umher und steckte ihre Nase in alles hinein. Die einzigen, um die sie sich nicht kümmerte, waren die alten Königinnen.
Die riefen fortwährend nach ihr und beklagten sich oder schalten; aber sie tat so, als hörte sie es nicht. Eines Tages befahl sie sogar, daß die dreißig Ameisen, die die Leibwache der Königinnen bildeten, bei der Arbeit im Hügel mithelfen sollten.
Die Königinnen schrien wie besessen:
„Wir sterben vor Hunger! Wir sterben vor Hunger!“
Doch die Alte verbeugte sich bis auf die Erde und erwiderte:
„Wenn Ew. Majestäten vor Hunger zu sterben geruhen, so sterben Ew. Majestäten vor Hunger. Ich kann nichts dafür. Ew. Majestäten haben während Ihrer glorreichen Regierung so viele Eier gelegt, daß der Hügel mit Jungen überfüllt ist, und wir keinen einzigen Mann entbehren können.“
Darauf verneigte sie sich untertänigst. Die Königinnen aber schrien sich tot; und als sie tot waren, da befahl die Alte:
„Die erste Kompagnie tritt an und trägt die hochseligen Leichen in die untersten Larvenkammern, wo der Hunger am größten ist. Die zweite Kompagnie hält die Ehrenwache. Sputet euch ein wenig! Sobald die Hochseligen aufgefressen sind, begibt sich jeder schleunigst an seine gewohnte Arbeit.“
„Du läßt deinen Königinnen ja eine niedliche[S. 222] Behandlung zuteil werden, alter Schlingel,“ sagte eine große Puppe, die in der Kammer nebenan lag.
„Ew. Gnaden dürfen nicht böse werden,“ sagte die alte Ameise. „Die hochseligen Königinnen wären doch eines Tages gestorben, und der Hügel ist so voll Jugend, daß wir keinen Rat wissen. Bevor der Monat um ist, sind Ew. Gnaden hoffentlich selbst Königin; und dann werde ich nicht verfehlen, Ihnen allen nur möglichen Respekt zu erweisen.“
„Ich will nicht Königin hier im Hügel sein,“ sagte die Puppe. „Ich will in die Welt hinaus und mir selber einen Hügel gründen, in dem ich eine bessere Justiz üben werde.“
„Das können Ew. Gnaden machen, wie Sie wollen. Hier sind Prinzessinnen genug. Wenn wir nur zwanzig behalten, so sind wir ganz zufrieden. Aber jetzt bitte ich, mich zu entschuldigen. Ich muß zu den Herren hinunter. Die schreien, als säße ihnen das Messer an der Kehle.“
Und auf ihren alten Beinen lief sie nach den Kammern, wo die Männchen lagen, die nach Nahrung schrien.
„Haltet den Mund, ihr Wichte!“ gebot die Alte. „Freut euch, daß ihr überhaupt etwas bekommt, obwohl ihr nur so geringen Nutzen stiftet! Ich schäme mich, daß so viele Kammern mit euch Taugenichtsen gefüllt sind.“
Und dann lief sie weiter. Eine Ameise hielt[S. 223] sie auf und zeigte auf ein paar große weiße Würmer, die an einem verfaulten Holzstücke nagten.
„Darf ich die den Prinzessinnen vorwerfen?“ fragte die Ameise.
„Was faselst du da?“ rief die Alte. „Das sind ja die Jungen unseres Freundes, des Rosenkäfers. Sie bringen dem Hügel Glück; und wer sie anrührt, hat seinen Hals verwirkt.“
Gegen Abend saß die Alte auf ihrem gewöhnlichen Platze auf der Spitze des Hügels und blickte über die Gegend hin.
„Nun kommt bald die Blattläusezeit,“ sagte sie vor sich hin.
Dann drehte sie sich um und rief in den Hügel hinein:
„Alle Melkmägde herauf!“
Augenblicklich wimmelten Hunderte von Ameisen hervor, die auf nähere Befehle warteten.
„Seht ihr den Rosenstrauch drüben an der Hecke?“ begann die Alte. „Dahin begebt ihr euch jetzt und paßt mir gut auf, bis die Blattläuse kommen! Es dauert nur noch wenige Tage, dann verlassen die Herrschaften die Puppenhüllen, und wir müssen süßen Saft für sie bereit haben.“
Die Ameisen liefen davon.
„Du hast ja furchtbar viel zu tun,“ sagte der Buchfink oben von seinem Tannenzweig her.
„Ja,“ entgegnete die Ameise. „Das Leben besteht aus Arbeit.“
[S. 224]
„Jetzt geht die Sonne unter. Willst du nicht die Türen schließen?“
„Nein. Es ist zu warm. Wir lassen sie offen stehen, aber vor jeder Tür steht eine Wache; und du weißt wohl noch, wie wir Räuber behandeln.“
„Gewiß, ich danke,“ meinte der Buchfink.
Nun machte die Alte die Runde und sah nach, ob die Nachtwachen auf ihrem Posten seien. Dann ging sie hinein und wanderte während der ganzen Nacht in den Gängen umher.
Einige Larven waren noch nicht satt, und die anderen wollten sich verpuppen; und da waren auch Puppen, die aus ihrer Hülle herauswollten. Die Alte half den einen und ermahnte die andern, redete den Vornehmen gut zu und gab den Niederen Schläge, ohne sich auch nur einen Augenblick Ruhe zu gönnen.
*
Es war Ende Juni, und im Walde prangte der Sommer.
Überall war ein Duften und Sprießen und Singen ohnegleichen; alle Nester waren voller Jungen. Durch die Luft summten und tanzten Fliegen, Bienen, Wespen und Schmetterlinge. An der Hecke und im Graben standen Tausende von Blumen, und vom Himmel fiel Sonnenschein und Regen.
„Puh!“ stöhnte der Buchfink. „Sechs Kinder! Das ist eigentlich reichlich für Buchfinkenleute.“
[S. 225]
Doch die alte Ameise rief ihm zu: „Ich glaube, wir haben zwanzigtausend Junge im Hügel.“
„Grundgütiger Himmel!“ rief da der Buchfink.
Aber die Alte hatte heute wenig Zeit zum Schwatzen.
Sie sandte Boten zum Rosenstrauch hinüber und ließ fragen, ob die Melkmägde die Blattläuse bereit hätten; und sie erhielt den Bescheid, daß jederzeit mit dem Melken begonnen werden könne.
„Gut!“ sagte die Alte. „Heute nacht, glaube ich, wird es losgehen. Es ist unmöglich, die jungen Herrschaften noch länger in den Hüllen zurückzuhalten. Ach, das wird eine furchtbare Nacht werden. Und an den morgigen Tag wage ich gar nicht zu denken.“
Dann rief sie die ältesten und vernünftigsten Ameisen zusammen und schärfte ihnen ein, wie sie sich zu verhalten hätten.
„Heut nacht geht ihr herum und schneidet alle Puppenhüllen entzwei... Versteht ihr? Natürlich müßt ihr sehr vorsichtig zu Werke gehen, damit niemand Schaden erleidet. Ein jeder nimmt eine Puppe. Wenn die Sonne aufgeht, muß alles in Ordnung sein.“
Die Ameisen nickten. Und die Alte trocknete den Schweiß von ihren Fühlern und ging weiter im Text:
„Also morgen feiern wir Hochzeit im Hügel. Gebt acht, daß die Gänge frei sind, damit die jungen Herrschaften mit ihren Flügeln durchkommen kön[S. 226]nen. Laßt sie alle hinaus, zuerst die Prinzessinnen und dann die jungen Herren. Zuletzt natürlich die Arbeiter, um die ihr euch übrigens gar nicht zu kümmern braucht. Nun aber kommt das Wichtigste: Wenn die jungen Leute ausgeschlüpft sind, wollen sie fortfliegen. Laßt sie ruhig gewähren! Wir können gar nicht so viele ernähren. Aber dreißig von den Prinzessinnen haltet zurück... Ich werd’ euch noch näher angeben, welche es sein sollen. Die dürft ihr nicht aus den Augen lassen, verstanden? Wollen sie fortfliegen, so haltet ihr sie fest... in aller Untertänigkeit natürlich.... aber haltet sie fest! Was dann später geschehen soll, darüber bekommt ihr noch Bescheid. Richtet euch nur nach mir und gehorcht meinen Befehlen!“
Am Abend saß die Alte auf ihrem gewöhnlichen Platze vor der Tür. Sie war so müde, daß sie kein Glied rühren konnte.
Plötzlich glänzte und leuchtete es vor ihren Augen.
„Was nun?“ rief sie.
„Wir sind es!“ sagten dreizehn dünne Stimmchen. „Wir kommen, um uns zu bedanken und um Lebewohl zu sagen.“
Und den Hügel verließen in langer Reihe dreizehn kleine Rosenkäfer, die sich vor der alten Ameise verneigten und zum Zeichen der Freundschaft die Fühler mit ihr kreuzten.
„Herrgott, seid ihr es!“ rief die Ameise. „Wie hübsch ihr seid! Ich hatte euch in der Verwirrung[S. 227] ganz vergessen. Na, nun wäret ihr so weit! Ja, ihr handelt sehr vernünftig, wenn ihr heute eurer Wege geht. Morgen wird es hier im Hügel unerträglich sein. Glückliche Reise!“
„Schönen Dank!“ sagten die Rosenkäfer. „Vielen Dank für Logis und Kost! Dürfen wir kommen und unsere Eier in den Hügel legen?“
„Ja, das dürft ihr,“ sagte die Ameise. „Ich habe erzählen hören, daß die Menschen sich freuen, wenn der Storch auf ihrem Dache sein Nest baut. Sie glauben, daß ihnen das Glück bringt. Das gleiche glauben wir von den Rosenkäfern... Aber sehen meine alten Augen denn recht... Ich meinte, ihr wäret siebzehn gewesen?“
„Neulich, als wir gar zu hungrig waren, haben wir die vier aufgefressen,“ erzählten die Rosenkäfer.
„Nun ja, das ist der Lauf der Welt,“ meinte die Alte seufzend. „Lebt wohl! Und Gott sei mit euch!“
„O, diese Schmarotzer,“ rief der Buchfink.
„Das sind unsere Gastfreunde,“ erwiderte die alte Ameise.
„Du führst eigentlich ein sonderbares Leben,“ sagte der Buchfink. „Vom Morgen bis zum Abend mußt du dich abrackern für dich und deine vielen Tausend Schwestern. Möchtest du nicht lieber leben wie ich: mit einer lieben kleinen Frau und sechs Kinderchen? und möchtest du nicht lieber ein paar Flügel haben, die dich über den ganzen Wald hintragen könnten?“
„Mit sechs Kindern?“ wiederholte die Ameise.[S. 228] „Was sollte daraus werden? Ich bin ans Rechnen mit ganz anderen Zahlen gewöhnt. Und wenn ich etwas haben sollte, müßte es wohl ein Mann sein, da man mich ja doch als Frauenzimmer anzusehen hat, wenn ich auch nur eine ausgediente Magd bin. Aber ich kenne die Männer. Es ist kein Staat mit ihnen zu machen. Warte nur bis morgen; dann wirst du sehen, wie wenig Achtung wir hier im Hügel vor ihnen haben. Und dann wirst du auch Flügel zu sehen bekommen, das kannst du mir glauben. Aber die Flügel und die Liebesgeschichten sind nur ein kurzes, armseliges Vergnügen; und ich bin sehr zufrieden mit meiner Jungfernschaft und meiner Arbeit. — Gute Nacht!“
Die Nacht, die nun folgte, war die fürchterlichste in der ganzen Geschichte des Hügels.
Es entstand ein Wirrwarr und Spektakel ohnegleichen. Keine der Ameisen tat ein Auge zu. Man schnitt die Puppenhüllen entzwei, half den jungen Ameisen heraus und schleppte die Hüllen fort. Denn es sollte in allen Winkeln fein sauber sein für das große Hochzeitsfest.
Die jungen Arbeiter durften in ihren Kammern sitzen und sich gütlich tun, bevor sie an ihr Werk gingen. Doch die Prinzessinnen und die jungen Herren waren nicht zu bändigen. Sie liefen in den Gängen umher, schlugen mit ihren feinen Flügeln um sich und verlangten, sofort in den Sonnenschein geführt zu werden.
„Die Sonne scheint gar nicht, meine Herr[S. 229]schaften,“ sagte die alte Ameise. „Es ist finstre Nacht, und die Sonne geht erst in zwei Stunden auf. Wenn Sie auf eine alte, erfahrene Ameise hören wollen, so tun Sie am allerbesten daran, wenn Sie ganz still sitzenbleiben und sich allergnädigst ein wenig darin üben, mit den Flügeln zu schlagen. Sie sind ja noch so jung, meine Herrschaften, und kennen so wenig vom Leben!“
Aber die jungen Leute wollten keine Vernunft annehmen.
„Wir wollen hinaus, wir wollen hinauf... verschafft uns Sonnenschein!“ schrien sie.
Am allerschlimmsten benahm sich die Prinzessin, die sich bereits in der Puppe ungebärdig aufgeführt hatte.
„Bin ich eine Prinzessin, oder bin ich es nicht?“ schrie sie. „Sieh zu, daß du sofort Sonnenschein herbeischaffst; oder ich lasse dich hinrichten.“
„Ew. Gnaden verlangen etwas Unmögliches,“ erwiderte die Alte. „Selbst die Machtbefugnis einer Königin hat ihre Grenzen, und die Sonne kann sie nicht kommandieren.“
„Dann will ich keine Königin sein,“ heulte die Prinzessin. „Dann will ich die Sonne sein.“
„Auf die müßt ihr gut achtgeben!“ flüsterte die Alte mehreren jungen Ameisen zu. „Die dürft ihr nicht wegfliegen lassen. In der steckt echtes Königinnenblut... Die behalten wir.“
Dreißig Ameisen schlossen sofort einen Kreis um die Prinzessin und ließen sie nicht mehr aus den[S. 230] Augen. Sie aber lief in den Gängen umher und schimpfte und lärmte, so daß man hören konnte, daß sie wirklich eine vornehme Person war.
„Das beste ist, wir schließen die Türen,“ sagte die Alte. „Sonst riskieren wir, daß die jungen Tollköpfe hinauslaufen und in der Nacht umkommen.“
Schließlich brach der Morgen an.
Die Alte ging hinaus und sah, was für Wetter es war. Der Himmel war blau, und die Sonne lachte.
„Besseres Hochzeitswetter hätten wir nicht bekommen können,“ sagte sie. „Öffnet jetzt!“
Da flogen alle Türen des Hügels auf, und heraus wimmelten Tausende von geflügelten Ameisen. Es waren so viele, daß der ganze Erdboden rings um den Hügel im Nu mit ihnen bedeckt war. Sie liefen und flogen und hüpften, und die Sonne schien auf ihre feinen, durchsichtigen Flügel.
„Das Leben ist herrlich!“ rief die ungebärdige Prinzessin. „Ich will nie mehr in den finstern Hügel hinab.“
„Gebt auf sie acht!“ mahnte die Ameise.
Bald war die Erde um den Hügel herum so voller geflügelter Ameisen, daß sie aufeinander traten. Da rief eine von ihnen:
„Wir wollen in die grünen Bäume hinauffliegen und Hochzeit dort feiern. Wozu haben wir denn Flügel?“
Sofort flog eine große Schar empor. Es sah aus, als schwebe ein Wölkchen über den Wald dahin. Die andern aber starrten ihnen nach.
[S. 231]
„Laßt sie nur fliegen,“ sagte die Alte. „Hier sind noch genug. Gebt nur auf die dreißig acht, ihr wißt ja!“
„Jetzt fliege ich,“ rief die ungeduldige Prinzessin. „Ich habe mir einen Mann ausgesucht und will auf die Hochzeitsreise gehen. Leb’ wohl, du alter Hügel!“
Bei diesen Worten lüftete sie ihre Flügel, aber im selben Augenblick wurde jedes ihrer Hinterbeine von einer Ameise ergriffen; und die sechs Ameisen verneigten sich bis auf die Erde und riefen:
„Ew. Gnaden dürfen uns unter keinen Umständen verlassen. Wir haben beschlossen, daß Sie die erste von unseren dreißig neuen Königinnen sein sollen, und wir würden ganz untröstlich sein, wenn Sie wegflögen.“
„Laßt mich los!“ schrie die Prinzessin. „Ich will oben in den grünen Bäumen Hochzeit halten.“
Da kam die alte Ameise aufgeregt herzugelaufen und rief:
„Nicht daran zu denken... Sofort wird die Hochzeit gefeiert, meine Liebe!“
Doch dann erschrak sie ob ihrer unehrerbietigen Worte; und demütig fügte sie hinzu:
„Wollen sich Ew. Gnaden nicht beruhigen! Nur noch einen Augenblick, und die herrlichste Blattlauslimonade wird für Sie ausgeschenkt werden. Wenn Sie geruhen wollen, Ihre Hochzeit hier beim Hügel abzuhalten, so werden Ihre Getreuen Ihnen sofort als der ersten Königin huldigen.“
[S. 232]
Aber die Prinzessin schrie: „Laßt mich los! Laßt mich los!“
Doch die Ameisen ließen sie nicht los. In der Umgebung des Hügels spielte sich genau der gleiche Vorgang mit den neunundzwanzig andern Ameisen ab, die die Alte zu Königinnen des Hügels erwählt hatte. Sie wollten fortfliegen, aber die Wachen hielten sie zurück.
Als sie eine Zeitlang gewütet hatten, fügten sie sich, und ihre Hochzeit wurde mit großer Feierlichkeit begangen. Blattlauslimonade floß in Strömen, und die alte Ameise hielt eine Rede nach der andern und stellte den jungen Königinnen die verschiedenen Kompagnien vor.
Gegen Abend waren ihre Männer ganz berauscht und ließen die Flügel hängen.
„Bringt die Königinnen zur Ruhe!“ befahl die Alte. „Führt sie in die Gemächer, die für sie instand gesetzt sind; dann wollen wir untertänigst den Augenblick abwarten, da sie gerufen werden, mit dem Eierlegen zu beginnen.“
„Was sollen wir mit den Männern anfangen?“ fragte eine der Ameisen.
„Beißt sie tot,“ erwiderte die Alte. „Was haben wir denn von diesen Vielfraßen!“
Und eins, zwei, drei! waren die Männer ins Jenseits hinüberbefördert; und es begann der feierliche Einmarsch in den Hügel.
Aber wer sich widersetzte, das war jene trotzige, ungebärdige Prinzessin.
[S. 233]
„Ich will nicht in den Hügel hinein,“ sagte sie. „Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie ihr die alten Königinnen habt hungern lassen, und wie ihr sie hernach aufgefressen habt. Und jetzt habt ihr meinen lieben Mann ermordet. Ich will fort.“
Mit einem gewaltigen Satz riß sie sich von der Wache los und schwang sich in die Lüfte.
„Schade, schade!“ seufzte die Alte. „Es war Rasse in ihr. Aber wir haben ja — Gott sei Dank! — noch die anderen neunundzwanzig.“
Dann gab sie Befehl, die Wache, die so schlecht achtgegeben hatte, sofort hinzurichten. Und sobald das geschehen war, verneigte sie sich tief vor den neunundzwanzig jungen Königinnen und sagte:
„Die Majestäten werden es uns verzeihen, daß wir Ihnen jetzt die Flügel ausreißen. Sie würden den Majestäten im Hügel, wo doch kein Platz zum Fliegen ist, nur lästig fallen. Es tut ja zwar ein bißchen weh, aber die Majestäten werden später einsehen, daß es zu Ihrem eigenen Besten geschehen ist.“
Da schrien die Königinnen ganz entsetzlich, aber es half ihnen nichts. In der nächsten Minute lagen alle Flügel neben den Leichen der Männer.
„Und nun gehen wir hinein!“ rief die Alte.
Die Ameisen stellten sich in zwei Reihen auf und verbeugten sich tief mit gekreuzten Fühlern, während die jungen Königinnen in den Hügel hineingingen.
„Jetzt geht alles übrige ganz von selbst,[S. 234]“ meinte die Alte. „Gott sei Dank, daß dieser Tag glücklich überstanden ist! Wir sind eine Masse Pack losgeworden und können hier im Hügel wieder Atem holen. Zum Glück ist im ganzen Hügel keine einzige Mannsperson mehr. Ich hätte bloß gewünscht, daß wir die trotzige Prinzessin behalten hätten. Sie war die beste von allen.“
* *
*
Doch die trotzige Prinzessin flog auf ihren Flügeln durch den Wald, und das Leben erschien ihr gar köstlich.
Sie begegnete vielen anderen geflügelten Ameisen, die sie umschwärmten; und mehr als einer der jungen Herren bewarb sich um ihre Hand.
„Schönen Dank für die Ehre, aber ich bin schon verheiratet! Mein Mann ist tot, und nun ist nichts mehr mit mir anzufangen,“ antwortete sie den Freiern und flog weiter.
Aber als sie einen Tag lang geflogen war, bekam sie das Umherschweifen satt.
„Dieses Vagabundieren hat eigentlich nicht viel auf sich,“ sagte sie sich. „Auch das ruhige Leben hat seine Annehmlichkeiten. Ich glaube, ich gründe einen neuen Ameisenhügel.“
Wie gesagt, so getan.
Sie suchte sich in dem Tannenwalde eine Stelle aus, die ihr gefiel, ließ sich auf der Erde nieder und begann, mit Füßen und Kiefern im Boden zu graben.
„Die dummen Flügel sind mir lästig,“ sagte sie. „Ich weiß eigentlich auch nicht, was für einen Zweck[S. 235] sie jetzt noch haben. Mir ist zumut, als wäre ich jetzt alt und vernünftig und frei von allen Grillen. Ich glaube, ich reiße sie aus.“
Sie legte sich platt auf den Bauch, breitete die Flügel aus, setzte ihre Beine darauf und richtete sich mit einem Ruck empor.
Ratsch... da lagen die Flügel.
Dann grub sie weiter. Am Abend hatte sie ein niedliches kleines Loch zustande gebracht, ungefähr so groß wie eine Walnuß.
„Nun ruhen wir uns von dem Stück Arbeit aus, und morgen legen wir Eier,“ sagte sie.
Und am nächsten Morgen legte sie fünfzig nette Eierchen.
„Hm,“ meinte sie. „Es wäre ganz hübsch, wenn ich das alte Frauenzimmer daheim und ein paar von ihresgleichen hier hätte; die könnten dann auf die Eier achtgeben. Aber nun hilft es nichts, ich muß selber Hand anlegen.“
Und sie griff gehörig zu, als ob sie ein einfacher Arbeiter wäre und nicht eine stolze Königin.
Sie drehte die Eier um, deckte sie zu, wenn es regnete, und trug sie in die Sonne. Als die Larven ausschlüpften, lief sie hin und holte Futter.
„Es reicht nicht,“ meinte sie mißmutig. „Ich kann sie nicht sattbekommen.“
Einen Augenblick dachte sie darüber nach, was sie tun solle. Dann biß sie entschlossen der einen Hälfte der Larven den Kopf ab und warf sie den anderen fünfundzwanzig vor.
[S. 236]
„Eßt,“ sagte sie, „und freut euch des Lebens!“
Die Fünfundzwanzig fraßen, gediehen und verpuppten sich. Und die Königin sorgte für die Puppen, wie sie für die Larven gesorgt hatte, bis der Tag kam, wo sie erwachsen waren. Da biß sie die Hüllen entzwei, und heraus traten fünfundzwanzig niedliche kleine Arbeiterameisen.
„Sieh da,“ sagte sie. „Nun ist das Schlimmste überstanden. Ich hoffe, ihr seid bereit, eurer Königin zu gehorchen?“
Da verneigten sich die Fünfundzwanzig bis auf die Erde.
„Gut. Nun legt Hand an! Ich will einen Hügel haben, so hoch wie den, in dem ich geboren bin. Zunächst baut mir mal einen guten Keller... und dann schleppt Tannennadeln herbei... Seid nur ja recht fleißig!“
Die Fünfundzwanzig sprangen eifrig an die Arbeit.
„Halt!“ rief die Königin. „Sucht mir zuerst ein paar Blattläuse! Ich brauche Limonade.“
Und sie bekam sie.
„Nun sputet euch mit dem Bau!“ sagte sie. „Denn jetzt lege ich Eier!“
Und die Arbeiter bauten, und sie legte Eier. Aus den Eiern wurden Larven und Puppen und Arbeiter; und bald stand ein kleiner Hügel da; und dieser Hügel wuchs und wuchs, bis er ebenso groß war wie der, den die Königin verlassen hatte.
[S. 237]
Es war einmal vor vielen, vielen Jahren draußen im Meer, — im richtigen Meer, das so tief ist, daß man sich gar keine rechte Vorstellung davon machen kann, und so groß, daß der Schiffer tagelang fahren kann, ohne Land zu erblicken; und zwar war es das tropische Meer, wo das Wasser fast ebenso heiß ist, wie bei uns zu Hause in einem warmen Bade.
Aber nur an der Oberfläche scheint die Sonne und erwärmt das Wasser. Tief unten ist es eisig kalt und dunkler als die schwärzeste Nacht. Und das Meer ist auch nicht überall gleich tief, denn auf dem Grunde sind hohe Berge und tiefe Täler, genau so wie auf dem Lande.
Nun war da draußen im Meer eine Stelle, wo ein hoher Berg vom Grunde bis dicht an die Oberfläche reichte. Wenn man hinaufschaute, sah man auf allen Seiten nur Wasser, nichts als Wasser.
Nach unten hin aber war desto mehr zu sehen.
Auf dem Berge wuchsen nämlich ungeheure Tangwälder, die sich meilenweit die Hänge hinan und hinab erstreckten. Wenn die Wogen rollten, dann fächelten die Blätter im Wasser, wie die Blätter der Bäume oben am Lande im Winde wehen. Doch die Stämme der Tangbäume waren bei weitem nicht[S. 238] so dick und steif wie die der Buchen und Eichen, und daher wehten sie mit hin und her, wohin die Wellen sie trieben.
Die Tangbäume waren viel höher als die Bäume am Lande, wuchsen aber nie über die Oberfläche des Meeres hinauf. Denn wenn ihre Blätter an die Luft kamen, trockneten sie ein und verwelkten. Wenn aber das Wasser still war, breiteten sie sich aus und leuchteten in prächtigen Farben, roten und gelben, grünen und braunen, wie sie auch das Laub unserer Wälder im Herbste aufweist. Und zwischen den Kronen der Tangbäume schwammen eine Menge Fische von einem Baum zum andern — gerade so, wie die Vögel im Walde umherfliegen.
Aber das waren keine so langweiligen grauen Burschen, wie Dorsch, Hecht und Aal. Viele von ihnen glänzten wie Gold und Silber; der eine war himmelblau, der andere scharlachrot. Und dann war da der Igelfisch, der sich zu einer Kugel aufblasen, die Stacheln nach allen Seiten kehren und den andern Tieren einen ungeheuern Schrecken einjagen konnte.
Denn es waren noch viele, viele andere Tiere in dem Tangwalde.
Da waren Muscheln mit ganz unglaublich drolligen Schalen und Schnecken mit großen, bunten Häusern. Da waren Tintenfische, die mit riesiger Geschwindigkeit rückwärts durch das Wasser herangeschossen kamen; Krebse, die gleichfalls rückwärtsschwammen und mit ihren großen Scheren schnitten,[S. 239] und schiefe, flache Krabben, die seitlich krochen und trotzdem vorwärtskamen.
Zuweilen kam eine ganze Herde von einigen hundert großen, unbeholfenen Schildkröten, die in dem Tangwalde weideten, wie die Kühe auf der Wiese.
Es kam auch vor, daß ein gewaltiger Walfisch herangeschwommen kam. Dann wurde es dunkel, als ob eine Wolke vor die Sonne träte, wo der Wal den Tangwald durchbrach. Und wenn er mit seinem starken Schwanz um sich schlug, erzitterten die Tangbäume, als ob ein Erdbeben tobte.
Einmal passierte es auch, daß ein Schiff über den Tangwald segelte. Ein Matrose fiel über Bord, und er wurde sofort von einem großen Hai verschlungen, der dann mit dem besten Gewissen von der Welt weiterschwamm.
Ja, es herrschte ein lustiges, buntes Leben und Treiben in dem Tangwalde. Aber still war es, ganz still; denn kein einziges der Tiere schrie oder sang.
Mitten im Walde war ein kleiner, gemütlicher, offener Platz zwischen den Kronen der Bäume, nicht sehr weit von der Oberfläche entfernt. Das Wasser dort war warm und klar, und der Platz lag so, daß selten jemand dorthin kam.
Auf diesem Platze spielten täglich vier Kinder miteinander und unterhielten sich, so gut sie es verstanden.
Alle vier waren so klein, daß man sie nicht mit bloßem Auge sehen konnte. Und selbst wenn einer[S. 240] mit einem Vergrößerungsglase gekommen wäre und sie beobachtet hätte, so würde er trotzdem Mühe gehabt haben, sie voneinander zu unterscheiden, falls er nicht eine ganze Menge Naturgeschichte wußte.
Denn es waren vier runde, durchsichtige Wesen mit feinen Härchen, aber ohne Kopf, Beine, Augen und alles das, was zu einem ordentlichen Tier gehört, und was auch der Mensch nicht gut entbehren kann.
Trotzdem gehörten sie durchaus nicht zu einer und derselben Familie. Das eine der Wesen war das Kind einer Sternkoralle, das zweite war das Kind einer Qualle und das dritte war ein Seestern. Das vierte aber war ein echter kleiner Austernsproß.
Eines Tages sprachen die Vier davon, was sie werden wollten, wenn sie groß sein würden.
„Ich will ein Räuber werden!“ schrie das Seesternkind. „Ich will mich im Tangwald verstecken und auf Muscheln und kleine Fische und alles, was ich kriegen kann, losstürzen und sie bis auf den letzten Blutstropfen aussaugen.“
Die kleine Qualle rief: „Ich will umherschwimmen und hübsch aussehen. Und wenn mir jemand zu nahe kommt, dann wird er sich schön an mir verbrennen.“
„Ich bin zu etwas Höherem bestimmt!“ sagte das Austernkind und spielte sich dabei so auf, wie es nur möglich ist, wenn man weder ein Gesicht noch Augen hat.
[S. 241]
„Sooo?“ fragte der Seestern. „Woher weißt du denn das?“
„Das ist einem angeboren,“ erwiderte die Auster. „Ich will euch etwas sagen: ich bin so eine Art Haustier bei den Menschen. Ihr glaubt nicht, wie sie mich schätzen. Sie liegen alle auf dem Bauche vor mir. Einige von ihnen wissen sogar nichts Besseres zu tun, als mich zu züchten und zu hegen und zu verkaufen; andere wieder tun nichts lieber als mich verspeisen. Die Menschen bauen wunderschöne große Wasserhöfe für mich mit Stöcken, an denen ich mich festsetzen kann.“
„Dann finde ich eigentlich, daß du den Menschen dienst?“ meinte darauf die kleine Qualle. „Aber jeder nach seinem Geschmack! Ich möchte nicht auf so einem Stocke festsitzen.“
Das Austernkind aber erwiderte: „Mir geht nichts über ein ruhiges Leben und Stillsitzen, bis ich gegessen werde.“
Nur das Korallenkind schwieg die ganze Zeit über; es fächelte mit seinen Härchen im Wasser und hörte den andern zu. Und denen fiel seine Schweigsamkeit auch nicht weiter auf, denn die Sternkoralle war als sehr stilles Wesen bekannt; darum nahm auch niemand an, daß jemals etwas Rechtes aus ihr werden könne. Schließlich sagte jedoch der Seestern:
„Na, kleine Koralle, was sagst du denn eigentlich? Was wird aus dir einmal werden? Hast du schon je darüber nachgedacht?“
[S. 242]
„Ich denke nie an etwas anderes,“ erwiderte das Korallenkind.
„I, du Grundgütiger!“ rief der Seestern. „Ist es erlaubt, deine Gedanken zu erfahren?“
„Ihr würdet sie doch nicht verstehen, wenn ich sie euch auch mitteilte,“ war die Antwort der Koralle.
„Versuch es doch einmal!“ sagte der Seestern.
Und die kleine Auster und die Qualle sagten dasselbe.
„Wenn ich groß sein werde, will ich eine Insel bauen,“ erzählte nun das Korallenkind.
„Was willst du bauen?“ fragten alle drei durcheinander.
„Eine Insel!“ wiederholte die Koralle.
„Billiger tust du es wohl nicht?“ sagte lachend der Seestern, so daß sein ganzer kleiner Körper bebte. „Wie willst du das denn anfangen?“
„Das weiß ich noch nicht!“ sagte die Koralle. „Aber eine Insel will ich unbedingt bauen... eine richtige Insel, die über das Wasser aufragt, und die feststeht, wenn die Wellen gegen sie anstürmen.“
„Wie kannst du nur so etwas tun wollen!“ rief die Auster.
Und die kleine Qualle fiel ein: „Es schaudert mich, wenn ich nur davon höre.“
So neckten die drei die kleine Koralle, doch diese machte sich nichts daraus, sie ließ ihre Härchen im Wasser fächeln und fuhr ganz ruhig fort:
„Eine richtige Insel soll es werden. Eine Insel mit Palmen und Vögeln. Rings im Wasser sollen[S. 243] Seesterne und Quallen schwimmen, und die Wellen sollen sie an die Küste spülen, und da sollen sie in der Sonne liegen und verfaulen. Und auf der Insel werden Menschen wohnen, die Austern essen.“
Dann schwieg das Korallenkind; und weil die andern es müde waren, es zu necken, wurden sie wieder gute Freunde, schwammen auf dem kleinen Fleck im Tangwalde umher, fraßen Tiere, die noch kleiner waren als sie selbst, und freuten sich ihrer Jugend und des Lebens.
Nach einiger Zeit waren die vier Kinder im Tangwalde erwachsen.

Die Auster hatte eine Schale bekommen. Sie saß auf einem Felsen auf dem Meeresgrunde, gähnte und ließ das Salzwasser in ihr Inneres hereinströmen. Der Seestern hatte jetzt fünf spitze Arme, die nach allen Seiten ins Wasser ragten, so daß er aussah wie der Stern an der Spitze des Weihnachtsbaumes. Zweimal hatte ein Fisch einen der Arme abgebissen. Aber der Seestern machte sich nichts daraus. Der Arm wuchs immer wieder von neuem, und dann war das Tier wieder so gut wie vorher, es kroch auf den Tangbäumen umher und wurde ein gewaltiger Räuber, wie es in seiner Jugend geträumt hatte.
Der kleinen Qualle war es nicht so gut gegangen. Eines Tages, als sie irgendwo im Tangwalde in einer Kindergesellschaft war, wurde sie von einem Wal gefressen, der mit geöffnetem Rachen herbeigeschwommen kam. Es waren hunderttausend Quallenkinder[S. 244] in der Gesellschaft, und alle verschwanden in dem Schlunde des Walfisches.
Und das Korallenkind? Als das merkte, daß es erwachsen war, schwamm es fort aus der traulichen Gegend, wo es seine Kindheit verbracht hatte, und ließ sich von den Wogen vor den Tangwald tragen.
Lange trieb die kleine Koralle umher und suchte nach einer Stelle, wo sie gerne wohnen mochte. Schließlich fand sie auch einen solchen Ort — ganz auf der andern Seite des Berges. Da wuchs kein Tang. Das Wasser war klar und rein, salzig und wunderschön warm. Dort ließ sie sich nieder.
Sie bekam Arme wie der Seestern, aber viel mehr als dieser, und sie saßen alle im Kranz um ihren Mund herum. Denn jetzt hatte sie einen Mund und auch einen Magen. Allmählich merkte sie, daß sie unten und innen ganz hart und fest wurde; und ehe sie sich dessen versah, hatte sie ein ordentliches Stück Kalk in sich.
„Nun kommt es!“ dachte sie vergnügt. „Das ist der Anfang zur Insel!“
Eines Tages trieb sie eine Knospe auf der einen Seite hervor — genau so wie die Bäume auf dem Lande. Und die Knospe wurde zur niedlichsten Sternkoralle mit Armen, Mund und Magen und einem Kalkstück im Innern. Aber sie hing fest mit der alten Koralle zusammen und saß darauf, wie der Zweig auf dem Baume sitzt.
Die alte Koralle war außerordentlich vergnügt.
[S. 245]
„Nun geht alles gut!“ rief sie aus. „Nun sind wir zu zweien!“
Und dann erzählte sie der neuen Koralle von der Insel, die sie bauen wolle; und die neue Koralle war ganz einverstanden mit ihren Plänen. Und sie trieben beide Knospen auf Knospen, bis eines Tages ein schöner Korallenbaum mit vielen Zweigen dastand, die alle voll Sternkorallen waren. Den ganzen Tag über fächelten sie mit den Armen im Wasser und jagten winzige Tierchen in ihren Mund hinein und fraßen sie.
Als der Seestern vorüberkroch, blieb er verwundert stehen und rief:
„So ein lächerlicher Baum mit Blumen!“
„Ich bin kein Baum,“ erwiderte die Koralle. „Ich bin eine Sternkoralle.“
„Herr Gott, bist du es!“ sagte der Seestern. „Du hast dich aber gehörig verändert! Ich habe dich wirklich nicht wiedererkannt!“
„Mir ist es ebenso gegangen. Erst jetzt sehe ich, wen ich vor mir habe. Aber wir haben uns ja auch nicht gesehen, seit wir klein waren. Ich bin jetzt im Begriff, meine Insel zu bauen.“
„Denkst du noch immer an die Dummheiten?“ fragte der Seestern lachend. „Ich hatte geglaubt, du wärest mit den Jahren vernünftiger geworden. Du hast ja übrigens Gesellschaft bekommen.“
„Ja,“ entgegnete die Koralle. „Ich habe Knospen und Zweige getrieben... Alle die Blumen, die[S. 246] du siehst, sind Korallentiere, die mit mir zusammen die Insel bauen.“
„So so! Du hast ein Aktienunternehmen gegründet! Das ist sehr vernünftig von dir, denn allein hättest du doch nie etwas erreicht. — Kommt ihr gut zusammen aus?“
„Ausgezeichnet! Bessere Familienverhältnisse kann man sich nicht vorstellen. Wir gehen zusammen durch Dick und Dünn. Denk einmal: Wenn einer von uns gut ißt, dann haben auch alle die andern ihr Vergnügen davon.“
„Mir scheint, das heißt die Kompagnieschaft übertreiben! Wenn ich einen Leckerbissen gefunden habe, dann wünsche ich durchaus nicht, daß er in den Magen eines andern spaziert.“
„Du verstehst mich nicht,“ sagte die Koralle.
„Adieu!“ rief der Seestern ihr zu. „Und viel Glück beim Inselbau!“
Die alte Koralle aber, die unten an der Wurzel des Baumes saß, flüsterte derjenigen der Knospen zu, die ihr zunächst war:
„Du bist ich, und ich bin du, und wir können nie voneinander getrennt werden. Wir gehören zusammen und haben ein Ziel vor uns... Wir wollen die Insel bauen.“
Die Knospe sagte es der nächsten Knospe, und die ließ es weitergehen, so daß schließlich alle Korallentierchen auf dem Baume Bescheid wußten.
Und während der Baum immer mehr Zweige bekam, bekamen die Tiere Junge, die ins Wasser hin[S. 247]ausschwammen, winzige, durchsichtige, runde Wesen mit feinen Härchen. Sie genossen ihre Freiheit, solange sie Kinder waren; aber alle hatten die Insel im Kopf. Und sobald sie erwachsen waren, setzten sie sich neben der alten Koralle fest, trieben Knospen und wurden zu Bäumen wie sie.
„Nun kann ich nicht mehr!“ sagte die alte Koralle eines Tages.
Rings um sie herum wuchs ein ganzer Wald von Sternkorallen. Die weißen Zweige waren fest miteinander verbunden, und von allen leuchteten die niedlichsten Sternblumen. Es wuchsen immer neue Knospen, und viele Millionen kleiner Korallenkinder wurden in die Welt gesetzt. Und während die Korallen bauten und bauten, dachten sie beständig an die Insel.
Die alte Koralle konnte auf ihr Werk stolz sein. Denn sie war ja die Ururahne der ganzen Korallenfamilie.
„Vergeßt die Insel nicht!“ schärfte sie ihren Nachkommen bis zuletzt ein.
Dann starb sie. Das Wasser spülte ihre Leiche fort, aber da, wo sie gesessen hatte, blieb auf dem Korallenstamm ein Zeichen wie ein Stern zurück.
*
Viele, viele Jahre vergingen.
Die Wogen des Meeres aber rollten unaufhörlich weiter, die Sonne schien, der Sturm sang, und die Kronen des Tangwaldes fächelten im Wasser.
[S. 248]
Die Tangbäume, zwischen denen das Korallenkind gespielt hatte, waren freilich längst heraufgerückt und fortgespült worden; aber andere waren dort, wo sie standen, aufgewachsen. Die Schildkröten, die dort geweidet hatten, waren längst gestorben, aber neue Schildkröten waren an ihre Stelle getreten. Die Auster war weg, der Seestern war weg, und auch die bunten Fische, die einst zwischen den Bäumen umherschwammen, waren verschwunden. Der gewaltige Walfisch, der alle die Quallenkinder mit einemmal verschlungen hatte, war durch eine Harpune getötet und zu Tran gekocht worden.
Wenn sie aber auch alle fort waren, so waren doch die Nachkommen ihrer Kindeskinder da, und die sahen genau so aus wie sie selbst und benahmen sich auch ebenso, so daß man keine Veränderung im Tangwalde wahrnehmen konnte.
Nur da, wo das Korallenkind sich festgesetzt hatte, um seine Insel zu bauen, sah es anders aus.
Eine ungeheure Menge Korallenbäume standen da, und es kamen immer neue hinzu. Millionen kleiner Korallenkinder schwammen in die Welt hinaus, kehrten wieder heim und setzten sich neben ihren Eltern und Vorfahren fest. Millionen der Tiere starben. In vielen der Korallenbäume war kein einziges lebendes Tier mehr, aber alle die harten Kalkzweige waren dort, wo sie gesessen hatten, voll von Sternen.
Und die Wellen hatten die toten Bäume umgestürzt und in Stücke geschlagen und zwischen und auf die anderen geworfen. Nach und nach wurde das[S. 249] Ganze zu einer großen, starken Kalkklippe, die beständig wuchs; denn die neuen Korallenkinder setzten sich auf den alten Bäumen fest und bauten fleißig weiter.
Eines schönen Tages waren sie bis dicht unter die Oberfläche gelangt.
„Nun haben wir die Insel!“ sagten sie froh zueinander. „Wenn das unsere Ururahne erlebt hätte!“
Aber sie hatten sich etwas zu früh gefreut.
Als sie nämlich über das Wasser emporwachsen wollten, da konnten sie nicht. Die kleinen Tiere konnten nicht vertragen, daß die Sonne auf sie schien; und soviel Mühe sie sich auch gaben, sie kamen und kamen nicht weiter.
„Nun wollen wir euch helfen!“ sagten da die Wellen.
Und die Wellen hoben ein paar große Korallenblöcke aus dem Meeresgrunde herauf und warfen sie auf die andern.
Jetzt endlich lag die Insel da. Groß war sie ja nicht, aber weiß und hübsch glänzte sie in der Sonne, und rings um sie her, soweit man blicken konnte, war nichts als Wasser zu sehen. Und eines Tages kam eine große, weiße Möwe geflogen und setzte sich auf die Insel.

Um dieselbe Zeit geschah es, daß die Erde — die große, runde Erde, die im Weltraum um die Sonne kreist, den Mond immer mit sich ziehend — äußerst schlechter Laune war. Der Mond neckte sie[S. 250] in einem fort, und sie hatte ihren Ärger über den Kometen noch nicht verwunden, der in Stücke ging, bevor er erzählt hatte, was er auf seiner Reise gesehen.
Als nun die Erde eines Tages ihren Bauch anschaute, da entdeckte sie am Äquator einen kleinen Knoten, den sie bisher nie bemerkt hatte.
„Was zum Kuckuck ist das denn nun wieder?“ rief die Erde ärgerlich.
Es war nichts anderes als die Koralleninsel. Als die Erde aber erfuhr, wie die Sache zusammenhing, da wurde sie fürchterlich zornig.
„Jetzt wird es mir denn doch zu toll!“ rief sie aus. „Es war schon arg genug, daß man sich von dem großsprecherischen Kometen zum Narren halten lassen und sich darein fügen mußte, monatlich von so einem elenden Mond ausgelacht zu werden... es genügte gerade, daß die Menschen in meinen Eingeweiden wühlten und Land zu Wasser und Wasser zu Land machten und schalteten und walteten, wie sie Lust hatten... Aber darein will ich mich denn doch nicht finden, daß so ein Korallenjunges, das man nur durch ein Vergrößerungsglas sehen kann, meine Figur umformt und mir eine regelrechte Insel mitten auf meinen Bauch setzt! So ein jämmerliches Weichtier! Der Sache wollen wir ein Ende machen!“
Und im selben Augenblick senkte die Erde da, wo die Koralleninsel lag, den ganzen Meeresboden.
Den Schreck der Korallen kann man sich vorstellen.
[S. 251]
Die Insel verschwand im Meere; und die Möwe, die darauf saß, flog mit einem lauten Schrei empor. Die Korallenblöcke stürzten durcheinander und gingen in Stücke. Fische, Krebse und Schildkröten flüchteten, so schnell sie konnten, und jedes Blatt im Tangwalde zitterte.
Als es im Wasser aber wieder ruhig geworden war, da flüsterten die Korallentiere einander zu:
„Vergeßt die Insel nicht!“
Unverdrossen begannen sie, von neuem zu bauen. Und als einige Zeit vergangen war, waren sie wieder oben an der Oberfläche, die Wellen schleuderten gewaltige Blöcke hinauf, und die Insel lag wieder da.
„Nun soll doch...“ rief die Erde.
Und damit senkte sie den Meeresgrund noch mehr.
„Denkt an die Insel!“ flüsterten die Korallen.
Und nach einiger Zeit lag die Insel wieder da.
„Wollt und könnt ihr das immer so weiter treiben?“ fragte die Erde.
„O, gewiß!“ erwiderten die Korallen.
„Dann ergeb’ ich mich, denn da komm’ ich nicht mit!“ sagte die Erde.
Und nun blieb die Insel liegen, wo sie lag. Die Korallen bauten unaufhörlich weiter, die Wellen schleuderten immer mehr Blöcke an die Oberfläche, und die Insel wurde immer größer.
Eines Tages kam ein großes, rundes, braunes Wesen angesegelt und klopfte an die eine Seite der Insel.
„Wer da?“ fragten die Korallen unten aus dem Wasser her.
[S. 252]
„Ich bin es!“ sagte das Wesen.
„Ja, wer denn?“ fragten die Korallen wieder.
„Kennt ihr mich nicht? Ich bin die Kokosnuß und bin in der ganzen Welt berühmt. Ich baue Inseln, die auf die Landkarten eingezeichnet werden und in der Geographiestunde vorkommen. Sogar Lieder sind über mich gedichtet worden.“
„Das mag alles sein,“ sagten die Korallen. „Davon wissen wir nichts. Wir haben selber eine Insel gebaut und nie Zeit gehabt, Lieder zu singen.“
„Ja, es ist unglaublich, wieviel Unwissenheit in der Welt existiert,“ entgegnete die Kokosnuß. „Na, habt ihr denn Erde genug, daß ich darin Wurzel schlagen kann und zu einer Palme werden kann?“
„Aha!“ flüsterten die Korallen. „Es ist die Palme!“
Da baten sie sie höflich, in einiger Zeit wiederzukommen; dann wollten sie ihr Bestes tun, um ihr Erde zu verschaffen, in der sie wachsen könne.
„Gut!“ sagte die Kokosnuß. „Dann treibe ich mich noch ein bißchen im Meere herum. In einem Jahr ist meine Schale so dick, daß ich alles vertragen kann.“
Mit diesen Worten schwamm sie weiter.
Sooft nun etwas Tang oder tote Fische oder Seesterne im Wasser waren, baten die Korallen die Wellen, es doch auf die Insel zu werfen. Die Wellen taten das auch, und es lag dann da oben, verfaulte und wurde zu Erde. Die Seevögel kamen und sorgten für die Düngung; in dem Dünger war ein Kirschstein,[S. 253] der schlug Wurzel und wuchs zu einem hübschen Bäumchen heran.

Eines Tages kam ein großer, hohler Baumstamm angetrieben. Als er auf der Insel lag und verfaulte, fielen eine Anzahl Grassamen heraus; und nach einiger Zeit war die Insel ganz grün. In dem Baumstamm waren auch zwei Eidechsen gewesen; die bekamen Kinder und fanden die Insel sehr gemütlich und geeignet zum Wohnen.
Und dann kam die Kokosnuß wieder.
„Hebt mich hinauf!“ sagte sie zu den Wellen.
Und sie keimte und wurde ein prächtiger Baum. Ihre Nüsse fielen rings nieder, und bald stand ein ganzer Hain von Kokospalmen auf der Insel. Die Vögel bauten ihr Nest in den Bäumen; und Blumen, Bienen und Schmetterlinge fanden sich ein.
Schließlich kam auch einmal ein Mann in einem Boote gesegelt.
Sein Schiff war untergegangen, und er war viele Tage lang auf dem Meere umhergetrieben worden. Er war sehr hungrig und durstig; und als er die Insel erblickte, geriet er ganz außer sich vor Freude, ging ans Land, aß Kokosnüsse und Austern und baute sich ein Haus, in dem er wohnen konnte, bis ein Schiff käme, das ihn in sein Vaterland brächte.
Unten im Wasser aber bauten die Korallen beständig weiter, denn sie konnten die Insel nicht groß genug bekommen.
„Ach, wenn doch unsere Ururahne das sehen könnte!“ sagten sie zueinander.
[S. 254]
Die Geschichte, die nun kommt, klingt ganz unglaublich.
Darum kann sie aber recht gut wahr sein. Ich kenne viele unglaubliche Geschichten, in denen jedes Wort Wahrheit ist.
Die Geschichte ist auch sehr unheimlich.
Darum kann sie aber recht gut unterhaltend sein. Es gibt unheimliche Geschichten, die sehr unterhaltend sind.
Die Geschichte beginnt ganz friedlich an einem schönen, warmen Sommersonntag um halb neun Uhr morgens.
Da stand eine Mutter in ihrer Haustür und sagte zu ihrem kleinen Jungen, der mit einem Korb in der Hand auf der Treppe stand: „Lauf schnell zum Krämer, mein Junge, und denk daran, daß es Sonntag ist, und daß er um neun Uhr zumacht. Es liegt ein Zettel im Korbe mit allem, was du mitbringen sollst. Du kannst durch den Garten des Schmieds laufen, dann bist du schneller da.“
Der Junge ging, wie die Mutter es wünschte, durch den Garten des Schmieds.

Es war ein sehr netter Junge, aber er sah etwas verschlafen aus. Und das hatte auch seine Richtigkeit, denn er war wirklich schläfrig. Er war[S. 255] spät zu Bett gekommen, weil er eine Waldpartie mitgemacht und daher nicht ausgeschlafen hatte. Das konnte man auch an seinem Anzug sehen, der gar nicht richtig saß. Seine Mutter hatte keine Zeit gehabt, ihn nachzusehen. Denn es war ja Sonntag, und der Krämer schloß um neun Uhr.
Als nun der Junge durch den Garten des Schmieds ging, sah er ein schönes Stiefmütterchen auf dem Rasen.
Er ging darauf zu und pflückte es. Und er kniete nieder und sah sich auch die andern Blumen an. Er guckte in die Luft, einer Libelle nach, die vorbeischwirrte. Und wie es nun zuging, weiß niemand — auf einmal lag er auf dem Rücken und sah in die Wolken hinauf.
Kurz darauf schlief er ein. Neben ihm stand der Korb mit dem Zettel darin. Die Sonne schien. Die Uhr auf dem Kirchturme schlug neun, der Krämer setzte die Läden vor seine Fenster und schloß seine Tür. Die Mutter aber saß zu Hause und wartete.
Das war nun schon ziemlich unheimlich. Aber es kommt noch viel ärger.
Wie der Junge so dalag und in den Tag hinein schlief, setzte sich eine Fliege auf seine Nase. Die Nase wurde krausgezogen; aber die Fliege blieb, wo sie war.

„Der Himmel mag wissen, wozu wir eigentlich hier liegen,“ sagte die Nase. „Das ist ja eine ganz abscheuliche Stelle.“
[S. 256]
„Wir sind zugefallen,“ sagten die Augenlider, „und damit lag das Ganze im Schlaf.“
Als die Augenlider das gesagt hatten, entstand eine merkwürdige Munterkeit in dem ganzen Jungen.
Es war nicht so, wie wenn ein Junge, der wach ist, lacht, auch nicht, wie wenn ein Junge im Schlafe lacht. Es lachte ringsumher in dem Jungen auf die sonderbarste Art. Die Beine lachten, und die Hände lachten, die Zähne grinsten, die Nase schnob, das Herz hüpfte im Leibe vor Lustigkeit, die Ohren lachten, der Magen gluckste... kurz, es war keine Faser an dem Jungen, die nicht vor Lachen über die Wichtigtuerei der Augenlider vergehen wollte.
„Himmel!“ riefen die Beine, als sie sich wieder beruhigt hatten. „Wie können die Leute nur so eingebildet sein! Man muß doch wirklich ein arger Einfaltspinsel sein, wenn man nicht sehen kann, daß wir das Ganze tragen. Wenn wir gehen, geht das Ganze. Und wenn wir den Dienst versagen, dann sitzt ihr sämtlich in der Patsche.“
„Allerdings haben sich die Augenlider lächerlich gemacht,“ sagte der Magen, der langsam und mit großer Würde sprach. „Aber eigentlich seid ihr doch auch nicht viel klüger, ihr guten Beine, wenn ihr glaubt, daß ihr den ganzen Jungen regiertet. Was haltet ihr denn von mir? Was wollt ihr ohne mich anfangen?“
„Wir würden viel geschwinder laufen,“ erwiderten flugs die Beine. „Schon oft haben wir uns[S. 257] darüber geärgert, daß wir an so einem Klotz von Magen zu schleppen hatten.“
„Ihr schwatzt, wie ihr es versteht,“ sagte der Magen. „Von mir habt ihr alle eure Kräfte. Von mir kommt die Nahrung, und die Nahrung sind die Kräfte. Wenn ich nicht will, steht alles still.“
„Du eingebildeter Knirps!“ riefen die Beine.
„Wohl möglich,“ sagte der Magen. „Ich weiß wohl, daß ich klein bin, und ich werde es auch noch geraume Zeit bleiben, solange unser kleiner Junge so klein ist. Aber wartet nur, ihr mißgünstigen Seelen! Seht seinen Vater an! Sein Bauch rundet sich schon recht hübsch unter der Weste. Und seht unseren Onkel Kommerzienrat an. Er ist der vornehmste Mann in der Stadt, und hat den größten Bauch unter allen Einwohnern. Ich kann euch erzählen, daß er niemals Kommerzienrat geworden wäre, wenn er nicht einen so guten, ausdehnungsfähigen Magen gehabt hätte.“
„Uns vergißt du wohl, guter Magen,“ sagten die Zähne. „Wenn wir nicht das Essen kauen, kannst du gar nichts damit anfangen.“
„Wer sieht, wo das Essen steht?“ fragten die Augen.
„Wer hört, wenn zu Tisch gerufen wird?“ fragten die Ohren.
„Wer nimmt das Essen und tut es in den Mund?“ riefen die Hände.

„Wer trägt euch allesamt zum Tisch und setzt euch dorthin?“ fragten höhnisch die Beine.
[S. 258]
Da entstand ein ungeheurer Spektakel in dem Jungen; unbegreiflicherweise wachte er dennoch nicht auf. Das war ärgerlich für ihn, aber gut für die Geschichte. Als es wieder ein bißchen stiller geworden war, sagte das Herz: „Ihr schwatzt alle, soweit euer Verstand reicht. Ich bin der Vornehmste in dem ganzen Jungen. Wenn ich aufhöre zu schlagen, dann ist alles vorbei. Es gibt Leute, die keine Augen haben, und Leute, die keine Beine haben, Leute, die keine Hände haben, Leute, die keine Ohren haben, und Leute, die keine Zähne haben. Es gibt Leute, deren Magen keinen roten Heller wert ist. Aber Leute, die kein Herz haben, sind schlechthin geliefert.“
„Ah!“ höhnten die Beine. „Du bist ja auch immer so voll von edlen Gefühlen und dergleichen.“
„Durchaus nicht,“ erwiderte das Herz. „Das ist Unsinn. Ich bin ein einfaches Pumpwerk, nicht mehr und nicht weniger. Wollt ihr zuhören, so werd’ ich euch alles erklären.“
„Erzähle!“ sagten die Beine. „Aber sei nur nicht zu weitschweifig.“
„Beeile dich, ehe wir uns heben!“ sagten die Augenlider.
Da lachten alle, und dann fing das Herz an zu erzählen: „So ein kleiner Junge, wie der, zu dem wir gehören —“
„Halt mal ein wenig,“ riefen die Beine. „Uns gefällt deine Ausdrucksweise nicht. Du mußt lieber sagen, daß der Junge zu uns gehört. Was wäre[S. 259] er ohne uns? Wenn wir verabredeten, unsrer Wege zu gehen, jeder nach einer andern Seite hin, was würde dann aus dem Jungen?“
„Gut,“ antwortete das Herz. „Das Vergnügen kann ich euch machen. Also: so ein kleiner Junge, wie wir einer sind, gleicht einer sehr verwickelten Maschine mit einer Menge Räder, Stangen und merkwürdigen Apparaten. Unaufhörlich arbeitet die Maschine. Die Räder schnurren, die Stangen gehen ihren Gang. Allerorten werden die Teile abgenützt, allerorten muß nachgesehen und repariert werden; denn wenn nur ein einziges Rad anhält, sieht es schlimm aus für die ganze Maschine.“
„Was für eingebildetes Zeug ist das?“ riefen die Beine. „Das verstehe, wer kann!“
„Wir verstehen es wohl,“ sagten die Augen, die sich in der Welt umgesehen hatten.
„Na also,“ rief das Herz. „Und nun müßt ihr wissen, daß ich die Aufsicht und die Reparaturen besorge.“
„Natürlich — Prahlhans!“ schalt der Magen.
„Was der Bursche sich einbildet,“ riefen die Beine.
„Laßt uns nun die Geschichte zu Ende hören,“ verlangten die Augen.
„Ja,“ fuhr das Herz fort. „Es ist ganz richtig, daß die Augen die Nahrung sehen, und daß die Ohren hören, wenn zu Tisch gerufen wird, und die Beine hingehen und die Hand die Nahrung in den Mund steckt und die Zähne sie kauen und der Magen sie verdaut.“
[S. 260]
„Das ist ja sehr schön,“ sagte der Magen spöttisch. „Aber was tust du denn eigentlich, mein Freund?“
„Das ist nicht schwer zu verstehen,“ sagte das Herz. „Willst du mir einmal sagen, mein lieber Magen — was könnte es nützen, daß die Nahrung wohl verdaut in dir läge, nachdem du und die Zähne und die Augen und die Ohren und die Beine und die Hände ihre Pflicht getan und sie dahin gebracht haben? Das könnt ihr euch an den Fingern abzählen: es nützt nicht ein bißchen! Die Nahrung muß in den Körper hinein, das muß sie — muß in die Runde in dem ganzen Jungen, zu jedem einzigen Rade hin, das schnurrt und sich abnützt. Und das besorge ich.“
Da war es ein Weilchen still in dem Jungen. Dann sagten die Beine: „Darf ich deine Beine einmal sehen? Du mußt gute Beine haben, um so rundherum laufen zu können.“
„Ich habe gar keine Beine,“ erwiderte das Herz. „Ich habe nur mein Blut, und das ist vollkommen hinreichend. Wenn der Magen die Nahrung verarbeitet hat, saugt mein Blut sie auf. Und dann peitscht das Blut mit ihr in dem ganzen Jungen herum. Überall habe ich in ihm Adern angelegt, das sind feine Kanäle, die bis in seine Nasenspitze reichen und in seine kleine Zehe und die Spitze seines kleinen Fingers. Unaufhörlich pumpe und pumpe ich das Blut in die Adern hinaus und wieder zurück. Schlag auf Schlag geht es, — viele[S. 261] Schläge in der Minute. Wohin das Blut kommt, da gibt es ein wenig Nahrung an alle Teile ab. Auf diese Weise wird alles, was in dem Jungen verschlissen ist, repariert, und so wächst er nach und nach, bis er ein ganzer Mann wird. — Was sagt ihr zu der Erklärung?“
Zunächst sagte keiner etwas. Aber dann fingen sie sämtlich an, durcheinander zu schreien, und der Spektakel wurde noch ärger als zuvor. Keiner wollte sich vor dem andern beugen. Jeder meinte, daß er der Wichtigste sei, und wer weiß, was noch geschehen wäre, wenn sich nicht plötzlich eine wohltuend ruhige Stimme hätte vernehmen lassen, die bisher noch nichts gesagt hatte: „Vielleicht darf ich auch ein Wort mitreden!“
Es war das Gehirn. Und ob sie nun im voraus Respekt vor ihm hatten, ob ihnen seine ruhige Stimme imponierte, oder ob sie so sehr geschrien hatten, daß sie nicht mehr konnten, genug: sie schwiegen sämtlich, und es wurde ganz still.
„Das mag ja alles recht gut und schön sein, was ihr da gesagt habt,“ fuhr das Gehirn fort. „Und ich habe den größten Respekt vor euch allen, die ihr zusammen mit mir unsern kleinen Jungen ausmacht.“
„Der spricht doch wenigstens wie ein gebildeter Mensch,“ sagten die Beine.
„Man kann doch verstehen, was er sagt,“ riefen die Ohren.
„Laßt ihn fortfahren,“ sagte der Magen.
[S. 262]
„Wir wollen hören, was er sagt,“ meinten die Ohren.
„Wir versprechen, uns nicht zu heben, ehe er fertig ist,“ versicherten die Augenlider.
„Vielen Dank!“ versetzte das Gehirn. „Zuerst muß ich jetzt bemerken, daß ich alles unterschreiben kann, was mein vortrefflicher Kollega, das Herz, gesagt hat — mit Ausnahme seiner Behauptung, daß es selbst das vornehmste Stück des Jungen sei.“
„Hört, hört! Bravo!“ rief der Magen.
Und sie riefen sämtlich, das sei richtig, nur das Herz natürlich nicht; das schlug und sagte nichts.
„Das vornehmste Stück bin nämlich ich,“ verkündete das Gehirn, „was ich nun die Ehre haben werde der Versammlung zu beweisen.“
„Aa—h!“ riefen da die Beine, und „Aa—h!“ riefen auch alle andern.
Aber sie schwiegen doch und lauschten dem, was nun noch kam.
„Wie das Herz seine Adern in alle Ecken und Enden des Jungen aussendet, so beherrsche ich sämtliche Nerven,“ erklärte das Gehirn. „Nur sind meine Nerven viel zahlreicher und feiner als die Adern. Meine Nerven sind Telegraphendrähte, versteht ihr! Die Hauptstation — das bin ich. Die Endstationen liegen rings in dem Bürschchen. Es geschieht nichts mit ihm, ohne daß ich es zu wissen bekäme. Er unternimmt nicht das geringste, ohne daß ich es bestimmte.“
„Herr im Himmel! — Er ist doch der Ein[S. 263]gebildetste von der ganzen Gesellschaft!“ riefen die Beine.
„Wenn ich bestimme, daß wir gehen sollen, so telegraphiere ich das den Beinen, und dann gehen wir,“ fuhr das Gehirn fort. „Bin ich müde — wupps! so ruhen wir uns aus oder schlafen, wie es nun gerade kommt. Es kostet mich nur einen Befehl, und es geschieht.“
„Sollen wir ihm noch weiter zuhören?“ fragten die Ohren.
„Wir wollen sehen, wie weit er die Sache treiben wird,“ meinten die Augen.
Das Gehirn ließ sich indessen durchaus nicht stören:
„Vielleicht kann ich es am allerbesten an einem Beispiel zeigen. Gestern — vielleicht wissen die Beine es noch — nahm Nachbars Peter eine Stecknadel und stach damit in die Beine unsres Jungen, ganz oben, wo sie am dicksten sind.“

„Sprich nur gerade heraus, du Zieraffe,“ riefen die Beine.
„Welche Ausdrücke ich wähle,“ sagte das Gehirn, „kann euch ganz gleichgültig sein, wenn wir uns nur verstehen und über die Sache einig sind. Also: Peter stach mit der Stecknadel. Das wurde augenblicklich an mich telegraphiert. Ich telegraphierte auf der Stelle an den Mund, der ‚Au!‘ sagte. Und zugleich sandte ich eine Depesche an die Augen ab, daß sie nachsehen sollten, wer der Schlingel sei. Sie gehorchten mir augenblicklich und[S. 264] meldeten, daß es Peter sei, der nicht so groß ist, daß wir ihn nicht recht gut durchbläuen könnten.“
„Das ist richtig,“ sagten die Augen.
„Wir haben ihn schon oft durchgebläut,“ sagten die Hände.
„Sofort traf ich alle Anstalten für Peters Hiebe,“ sagte das Gehirn. „Ich befahl den Beinen, ihm nachzulaufen, der linken Hand, ihn am Kragen zu packen, der rechten, ihm eine tüchtige Ohrfeige zu geben, dem Mund, ihn mit den ärgsten Scheltworten auszuschimpfen, die uns im Augenblick einfielen. — Und geschah das nicht alles?“
„Ja,“ bestätigten die Beine und Hände und der Mund.
„Darf ich mir eine Bemerkung erlauben?“ fragte der Magen.

„Warte bitte einen Augenblick!“ erwiderte das Gehirn. „Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Seht ihr — während Peter seine wohlverdienten Hiebe bekam, befahl ich den Augen, gut aufzupassen, ob jemand käme. Denn ich wußte ja, daß Peter einen großen Bruder hat, der viel stärker ist als unser kleiner Junge!“
„Das ist richtig,“ sagten die Beine. „Wir sind oft vor ihm davongelaufen.“
„Aber ihr konntet ihm nicht weglaufen!“ sagte das Gesäß. „Das bekam ich zu spüren!“
„Er hat uns oft zwischen den Fingern gehabt,“ versicherten die Ohren.
„Wir haben ihn auch gesehen,“ sagten die Augen.
[S. 265]
„Allerdings,“ bestätigte das Gehirn. „Und kaum hattet ihr das an mich telegraphiert, so gab ich auch schon den Händen Befehl, augenblicklich mit den Hieben aufzuhören, und den Beinen, Reißaus zu nehmen, so schnell sie konnten. Und wie wir Reißaus nahmen! Ich ließ die Augen nach allen Seiten hin aufpassen, damit wir die verschlagensten Wege finden konnten. Nicht hinter eine Hecke sprangen wir, nicht hinter einen Strauch krochen wir, nicht einen Sprung machten wir ohne meinen ausdrücklichen Befehl.“

„Das ist richtig,“ sagten die Beine. „Aber es ist merkwürdig —“
„Ich bin noch nicht fertig,“ sagte das Gehirn. „Vielleicht wißt ihr noch, daß wir an Sörensens vorbeikamen, die gerade beim Backen von Apfelschnitten waren.“
„Das weiß ich noch recht gut,“ bestätigte der Magen.
„Freut mich,“ antwortete das Gehirn. „Aber — ich habe eine Endstation in unserer Nase, wie ich sie an allen anderen Stellen in uns habe, und die hat mir ja sofort Nachricht über die Apfelschnitten gegeben. Nun ließ ich die Ohren horchen, ob sie noch die Tritte des großen Bruders hören könnten, und die Augen ließ ich Ausguck halten, ob er noch in Sicht sei. Als ich mich so überzeugt hatte, daß keine Gefahr von dieser Seite her drohte, befahl ich den Beinen, uns zur Tür hin zu tragen, der Hand, höflich anzuklopfen, dem Rücken, vor Mut[S. 266]ter Sörensen eine schöne Verbeugung zu machen, und den Augen, nach den Apfelschnitten zu schielen. — Da bekamen wir denn auch ein paar.“
„Sie schmeckten wunderschön!“ sagte die Zunge.
„Sie lagen etwas schwer in mir,“ meinte der Magen. „Ich hatte grauenhafte Mühe mit ihnen. Es zwickte mich gehörig!“
„Jetzt bin ich fertig mit der Geschichte,“ schloß das Gehirn. „Habt ihr etwas einzuwenden?“

Sie schwiegen alle eine Weile, überwältigt von dem, was das Gehirn gesagt hatte und worin, wie sie ja nicht leugnen konnten, jedes einzige Wort richtig war.
Aber dann fing der Magen an zu knurren:
„Das mag alles wirklich so sein, wie du es erzählt hast. Aber überall hast du nun doch nicht das Kommando, du eingebildetes Hirn! Wenn ich die Nahrung verdaue, frage ich dich nicht um Erlaubnis zu allem, was ich tue.“
„Ich frage dich auch nicht jedes Schlages wegen, den ich tue,“ stimmte das Herz ein.


„Das, was ihr da sagt, ist vollkommen richtig,“ entgegnete das Gehirn, ruhig wie zuvor. „Ich habe auf sehr vieles aufzupassen und muß an vielen Stellen zugleich sein. In Wirklichkeit habe ich noch viel mehr zu leisten, als ich hier erwähnt habe. Ich soll ja zum Beispiel auch dafür sorgen, daß unser kleiner Junge etwas lernt und ein rechter Mann wird. Darum überlasse ich es für gewöhnlich euch, eure eignen Geschäfte zu besorgen. Aber darum[S. 267] müßt ihr euch nicht einbilden, daß ihr tun könnt, was ihr wollt. Ich habe ein Auge auf euch, müßt ihr wissen! Ich habe telegraphische Verbindung mit jedem Stückchen von euch, und sobald das Allergeringste nicht stimmt, werde ich sofort davon in Kenntnis gesetzt.“
„So ein Geschwätz!“ riefen die Augen.
„Die reine Prahlerei!“ schrie der Magen.
„Ihr irrt euch durchaus,“ versetzte das Gehirn. „Und ich kann es euch leicht beweisen. Habt ihr zum Beispiel jemals gehört, daß ein kleiner Junge Magenschmerzen hat, ohne daß er heult? — Da seht ihr’s! Ich bekomme es zu wissen, daß mit dem Magen etwas verkehrt ist, telegraphiere dem Mund, daß er heulen soll — und er heult. Die Mutter des Jungen kommt und erfährt, daß er zu viel Kuchen gegessen hat. — Brauch’ ich noch weiterzugehen?“
„Nein,“ versicherte sehr ernst das Gefäß.
Da sagte das Gehirn nichts mehr, denn nun hatte es gesagt, was zu sagen war. Aber die andern schwatzten weiter und wurden so laut, daß der Junge schließlich aufwachte.
Mit einem Ruck richtete er sich empor und rieb sich die Augen. Er sah zum Himmel und rings im Grase umher. Und er sah auf den Korb, der dastand und ihn mit dem Zettel darin angähnte.
Plötzlich wurde es dem Jungen klar, daß er geschlafen hatte.
Wie lange, wußte er nicht; aber er hatte eine[S. 268] unheimliche Ahnung davon, daß er nun zu spät zum Krämer kommen werde. Es waren keine Leute mehr auf dem Wege. Angenommen nun, der Krämer hätte schon seinen Laden geschlossen....
Mit Blitzesschnelle war er auf den Beinen und stürzte von dannen.
Die Beine sprangen, das Herz schlug, die Augen starrten, die Ohren horchten, die Arme ruderten, das Gehirn telegraphierte....
„Hallo!“ sagten die Beine. „Was ist denn auf einmal los, wer rumort denn da gar so fürchterlich? Wer ist denn das?“
„Das bin ich,“ sagte eine neue Stimme, die keiner vorher gehört hatte.
„Wer bist du?“ fragte der Magen.
„Ich bin unser schlechtes Gewissen,“ sagte die Stimme.
„Wo steckst du?“ fragte das Gehirn.
Aber es war keine Zeit zu weiteren Erklärungen. Es ging im Galopp.
„Ich fürchte, ich werde die ganze böse Suppe, die sich unser Junge eingebrockt hat, wieder einmal ausessen müssen,“ sagte melancholisch das Gefäß.
Und darin behielt es recht.
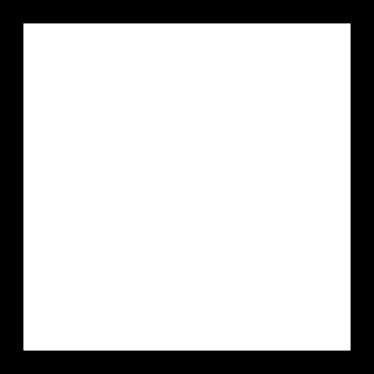
[S. 269]
Am Montag morgen stand der Fischer in seinem Boot, spuckte ins Wasser und fluchte, daß es sich grauenhaft anhörte.
„Nun hab’ ich acht Tage hier müßig gelegen und auf Ostwind gewartet,“ sagte er. „Aber Morgen für Morgen kommt der Wind von Westen. Die Fische verfaulen mir im Schiff, und ich werde ein armer Mann. Willst du dich denn nicht drehen, Wind?“
„Ich kann nicht,“ sagte der Wind betrübt.
„Du böser, garstiger Wind!“ rief der Schiffer.
*
Am Dienstag morgen öffneten sich die Knospen des Apfelbaums.
„Dies ist für mich der wichtigste Tag im Jahre,“ sagte der Baum. „Heute entscheidet sich mein Schicksal. Lieber, guter Wind... heute blühe ich, da darfst du um Gotteswillen nicht wehen. Wenn meine Blüten heruntergeweht werden, bekomme ich ja keine Äpfel. Jetzt sei hübsch still, bloß heute.“
„Ich möchte ja so gern, wenn ich nur könnte,“ erwiderte der Wind.
Damit fegte er über den Apfelbaum hin, und alle die weißen Blüten flogen in die Luft.
„Du bist ein recht, recht böser Wind,“ klagte der Apfelbaum.
[S. 270]
Am Mittwoch morgen stand der Müller auf seiner Mühle und betrachtete den Himmel.
„Jetzt mach’ ein wenig flink, mein lieber Wind!“ sagte er. „Heute müssen wir mahlen. Ich bin nicht so unvernünftig wie der Schiffer. Mir ist es ganz gleichgültig, ob du von Nord oder Süd, Ost oder West kommst, wenn du nur kommst. Ich drehe einfach die Mühlenhaube. Aber wenn du gar nicht wehst, dann werde ich wütend.“
„Hier bin ich, hier bin ich,“ sagte der Wind, und die Mühle ging.
„Braver Wind!“ rief der Müller.
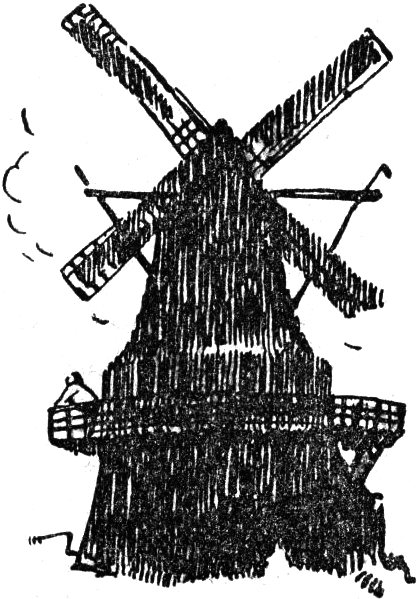
„Ach, nun muß ich mich wieder legen,“ sagte der Wind.
Und weg war er, und die Mühle stand still.
„Du garstiger Wind,“ klagte der Müller.
*
Am Donnerstag morgen stand der kranke Knabe hinterm Fenster und guckte hinaus.
„Woher kommst du heute, Wind?“ fragte er.
„Von Osten,“ entgegnete der Wind.
„Lieber, guter Wind, du mußt dich drehen oder dich legen,“ sagte der Knabe. „Ich bin sehr krank gewesen. Und der Doktor sagt, daß ich bei Ostwind nicht hinaus darf. Und ich möchte so gerne hinaus. Ich bin in diesem Jahre noch gar nicht im Walde gewesen und habe nicht ein einziges Mal mit dem wunderschönen Bogen geschossen, den ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Lieber, lieber Wind,[S. 271] du kannst das einem kranken, kleinen Jungen, doch nicht abschlagen.“
„Ich kann dir nicht helfen,“ heulte der Wind.
Da weinte der Junge und stampfte auf den Fußboden.
„Wie ich dich hasse, du garstiger Wind!“ rief er.
*
Am Freitag morgen hängte die Pfarrersfrau ihre Wäsche zum Trocknen auf die Wiese.
„Der Wind weht gerade richtig so,“ sagte sie. „Heute nachmittag ist alles trocken. Dann können wir wirklich sagen, daß wir diesmal Glück mit der Wäsche gehabt haben.“
Gegen Mittag wurde der Wind zum Sturm.

Die Pfähle stürzten um, die Leinen zerrissen, und die Wäsche flog auf die Erde. Die Pfarrersfrau lief verzweifelt umher und sammelte sie auf.
„Ach, Herrgott, Herrgott!“ sagte sie. „Wie sieht sie aus! Da bleibt mir nichts anderes übrig, als die ganze Wäsche wieder in den Zuber zu stecken. Der Henker soll den elenden Sturm holen.“
„Ich kann nichts dafür,“ brüllte der Sturm.
*
Am Sonnabend morgen waren die Samen des Löwenzahns fertig.
Niedlich saßen sie mit ihren Regenschirmchen da und warteten darauf, daß der Wind sie in die Welt hinaustragen sollte. Es waren ihrer viele, und sie waren recht schön; der Löwenzahn war sehr stolz auf sie.
[S. 272]
„Es ist hübsch, wenn einem die Kinder Freude machen,“ sagte er. „Ich habe für sie geblüht und sie in meinem Schoße genährt. Jetzt müssen sie selbst für das übrige sorgen. Wenn sie gleich auf die Erde fielen, dann würden sie einander beim Aufwachsen ersticken. Darum habe ich jedem von ihnen einen Fallschirm mitgegeben, der sie ein gutes Stück übers Feld dahintragen kann. So zerstreut sich die Familie und beherrscht die Welt. Komm, lieber Wind, und trage sie. Ich verlange nichts als eine schöne kleine Sommerbrise.“
„Ich kann nicht,“ antwortete der Wind. Und er rührte sich nicht. Es blieb still, ganz still.
„Du boshafter Wind!“ schalt der Löwenzahn. „Gestern hast du so gestürmt, daß die ganze Wäsche der Pfarrersfrau verdorben ist, und heute magst du nicht einmal meine leichten Kinderchen ein bißchen übers Feld tragen. Schämen, schämen, schämen solltest du dich!“
„Ich kann nicht anders,“ seufzte der Wind.
*
Am Sonntag morgen lag der Wind hinter der Hecke. Daneben saß eine Maus und leckte ihre Pfötchen.
„Wie du seufzest, Wind,“ sagte die Maus.
„Muß ich nicht seufzen?“ erwiderte der Wind. „Es gibt auf der ganzen Welt kein Wesen, das so unglücklich ist, wie ich.“
„Du übertreibst wohl!“ sagte die Maus. „Ja[S. 273] ... ich kenne dich ja nicht näher. Ich bin nur klein und halte mich an die Erde, so daß du meistenteils über meinem Kopfe dahinfährst. Aber neulich hab ich jemand in anderm Tone von dir sprechen hören.“
„Hat man mir etwas Gutes nachgesagt?“ fragte der Wind. „Wer war es? Geschwind, erzähle!“
„Der Dichter war es,“ sagte die Maus. „Hier hat er mit seiner Liebsten gesessen und ihr Verse vorgelesen, die er über dich verfaßt hatte.“
„Ach, der Dichter,“ sagte der Wind mißmutig. „Was hat in den Versen gestanden?“
„Daß du lind und mild wärest, und daß du ihre Wange umfächeltest und mit ihren Locken spieltest,“ sagte die Maus.
„Gewiß,“ sagte der Wind. „Und neulich hat er geschimpft, weil ich seine Nase blau gefärbt und ihm die Frisur in Unordnung gebracht habe.“
„Es stand auch etwas davon in den Versen, wie schön und stolz du bist, wenn du in all deiner Macht übers Meer braust,“ fuhr die Maus fort. „Er sagte, er kenne nichts Herrlicheres, als wenn du die Wogen peitschst und sie emporschäumen läßt.“
„Vorgestern hat er gesegelt,“ sagte der Wind. „Dabei ist er seekrank geworden und hat mich elendiglich gescholten und verunglimpft. Nein, er ist um kein Haar besser, als die andern.“
„Ja, wenn sie alle so zornig auf dich sind, so muß doch wohl etwas mit dir nicht in Ordnung sein,“ meinte die Maus.
„Ach Gott, ach Gott!“ stöhnte der Wind.
[S. 274]
Und er fuhr fort, zu seufzen und zu jammern, so daß es jämmerlich anzuhören war.
„Vertrau’ dich mir an!“ sagte die Maus. „Das erleichtert immer ein bißchen. Und ich stehe, wie gesagt, außerhalb des Ganzen. Mir hast du niemals Böses oder Gutes erwiesen.“
„Ich bin das unglücklichste Wesen auf der Welt,“ begann der Wind. „Alle betrachten mich als einen mächtigen Herrn und bitten mich bald um dies und bald um jenes. Und doch bin ich nur ein armseliger Diener, der die Befehle seines Herrn erfüllt, und keinen Finger auf eigene Hand rühren kann.“
„Ei, ei,“ sagte die Maus. „Das hätte ich mir nicht träumen lassen.“
„Und doch ist es die reine Wahrheit,“ erwiderte der Wind. „Jeden Tag verunglimpft man mich, weil ich die Wünsche meines Herrn erfülle.“
„Wer ist dein Herr?“ fragte die Maus.
„Mein Herr ist die Sonne,“ sagte der Wind. „Sie ist schuld an all dem Bösen, das ich tue, aber ich bekomme Prügel dafür.“
„Erzähle,“ rief die Maus.
„Das ist bald erzählt. Siehst du, jetzt liege ich hier still und tue keiner Katze etwas.“
„Das ist hübsch von dir,“ sagte die Maus. „Allerdings muß ich dir sagen: wenn ich jemandem etwas Schlechtes wünsche, so ist es die Katze!“
„Es handelt sich für meine Person, gar nicht um hübsch oder nicht hübsch,“ sagte der Wind. „Ich kann nichts von selbst tun. Aber höre zu: wenn die[S. 275] Sonne drüben im Osten recht stark zu scheinen beginnt, dann muß ich augenblicklich fort und muß Westwind sein, ich mag wollen oder nicht.“
„Ich kann dir nicht folgen,“ sagte die Maus.
„Gewiß,“ fuhr der Wind fort. „Die Luft, die von der Sonne erwärmt worden ist, steigt in die Höhe... das tut warme Luft immer, weil sie leichter ist als kalte.“
„Ja, mir ist das gleichgültig,“ sagte die Maus, die sich gekränkt fühlte, weil sie die Sache nicht verstand.
„Aber mir nicht,“ rief der Wind. „Denn da, wo vorher die Luft war, entsteht ein leerer Raum, und dann heißt es sofort: ‚Pst, Wind, komm geschwind mit frischer Luft hierher!‘ Und wenn ich still gelegen habe, so soll ich auf und davon rennen; und wenn ich Ostwind gewesen bin, so soll ich auf die Minute Kehrt machen und Westwind sein.“
„Aha,“ sagte die Maus. „So hängt die Sache zusammen. Da hast bloß zu gehorchen.“
„Ganz richtig,“ sagte der Wind. „Niemals weiß ich, bevor die Order kommt, wohin ich soll. Findet keine Erwärmung statt, so liege ich still und muß mich darein finden, von denen ausgescholten zu werden, die mich brauchen, und nicht begreifen können, wo ich bleibe. Sodann kommt Befehl von Osten, ich fahre von Westen daher und höre unterwegs nichts als die Verwünschungen derer, die mich von Osten erwartet haben.“
[S. 276]
„Ja, das kann nicht gerade amüsant sein,“ sagte die Maus.
„Es ist fürchterlich,“ klagte der Wind. „Und siehst du... wenn die Sonne nun ganz plötzlich den Einfall bekommt, irgendwo zu scheinen, und wenn sie dann sehr stark scheint, dann muß ich rennen wie verrückt, um zeitig genug zu kommen. Dann werde ich zum Sturm und fahre über Meere und Länder dahin; die Bäume stürzen um, die Dächer werden von den Häusern weggeweht, und die Schiffe scheitern. Dann beschuldigen die Leute mich grauenhafter Bosheit und geben mir die Schuld an all dem Unglück. Und ich kann doch gar nichts dafür.“
„Ich gebe zu, daß das ein hartes Los ist,“ sagte die Maus. „Die Sonne verdient also die Prügel und nicht du.“
„Ganz gewiß. Aber die Sonne verehren sie und beten sie an.“
„Könntest du nicht jemand veranlassen, ihnen zu erklären, wie die Sache zusammenhängt?“
„Wer sollte das wohl sein?“ fragte der Wind und schüttelte den Kopf.
„Du solltest einmal mit dem Dichter reden.“
„Das würde viel helfen! Glaubst du, der Dichter macht sich etwas daraus, wie die Sache zusammenhängt? Er richtet die Dinge so ein, daß er sie in Verse setzen kann. Und dazu läßt sich ja auch nichts sagen. Ein jeder stiehlt in seinem Gewerbe. Er schildert mich als mild und sanft und lieblich. Oder als stolzen, übermütigen Herrn. Würde er erzählen,[S. 277] daß ich in Wirklichkeit nur ein elender Diener bin, der auf Befehl seines Herrn von einem Ende der Welt bis zum andern rennt — was, glaubst du, würde dann aus den Versen werden?“
„Daran mag etwas Wahres sein,“ sagte die Maus nachdenklich.
„Gib nur acht! Dort kommen die Leute aus der Kirche. Hör zu, was sie sagen, dann wirst du sehen, daß ich nicht übertreibe.“
Der Wind versteckte sich hinterm Zaun; und die Maus lugte unter einem Huflattichblatt hervor, während die Leute vorbeigingen.

Da kam die Pfarrersfrau und die Mutter des kleinen kranken Jungen. Es kam der Schiffer, und es kam der Müller, und es kamen noch viele andere.
„Wie geht es Ihrem Jungen?“ fragte die Pfarrersfrau.
„Danke,“ sagte die Mutter. „Es geht besser, aber nur langsam. Bei dem scharfen Winde konnte er ja nicht ins Freie.“
„Ach ja, der Wind, der Wind!“ meinte die Pfarrersfrau. „Denken Sie sich... am Freitag morgen hänge ich meine ganze Wäsche auf die Wiese. Es war wunderschönes Wetter, so ein trockener Wind, wissen Sie. Und dann kam ein solcher Sturm, daß mir alles verdorben wurde. Bloß des widerwärtigen Windes wegen müssen wir die ganze Wäsche noch einmal waschen.“
„Entschuldigen Sie, daß Sie das Mehl noch nicht gekriegt haben,“ sagte der Müller zum Bauer. „Es[S. 278] ist nicht meine Schuld, sondern die des Windes. Man kann sich keine Stunde lang auf ihn verlassen.“
„Der Wind ist der unzuverlässigste Geselle von der Welt,“ sagte der Schiffer. „Braucht man Ostwind, so kann man zehn gegen eins wetten, daß Westwind herrscht. Soll der Wind sich legen, so weht er. Soll er wehen, so legt er sich. Will man Stille haben, so bekommt man Sturm.“
Die Leute gingen weiter. —
„Das sind wahre Worte,“ sagte der Apfelbaum. „Dienstag hat mir der Wind alle meine schönen Blüten weggenommen.“
„Der Wind ist das größte Ungeheuer der Welt,“ rief der Löwenzahn. „Sonnabend hat er es mir abgeschlagen, mit meinen Samen in die Welt zu fliegen.“ — —
„Hörst du’s nun?“ fragte der Wind.
„Ich habe es gehört,“ erwiderte die Maus. „Und ich bedaure dich aufrichtig.“
„Und doch gibt es noch Schlimmeres,“ sagte der Wind. „Nun kennst du also mein Schicksal. Du weißt, daß es nicht meine Schuld ist, wenn ich den Leuten Übles zufüge, und daß ich den Zorn über meines Herrn Taten geduldig auf mich nehmen muß. Kann es dich da befremden, wenn ich hier und da einmal zusammenbreche?“
„Nein, wirklich nicht,“ entgegnete die Maus. „Ein anderer könnte es ja überhaupt nicht ertragen.“
„Gut. Ich stöhne auch so manches liebe Mal. Mein unverdientes Geschick quält mich dann so, daß[S. 279] ich brüllend auf dem Meere in der Takelage hause, heulend in die Schornsteine fahre und durch alle Ritzen und Spalten pfeife. Weißt du, was dann die Leute sagen?“
„Nein.“
„Dann sagen sie: Hört, wie böse der Sturm brüllt... hört, wie häßlich der Wind heult.... wie unheimlich er pfeift!“
„Armer Wind!“
Der Wind sagte nichts mehr, sondern seufzte bloß. Auch die Maus sagte nichts, denn sie wußte keinen Trost für ihn.
Da auf einmal kam Unruhe in die Luft.
„Hallo!“ rief der Wind. „Jawohl... nach Süden?... Ich komme, ich komme!“
Die Maus lief hervor, um Ausschau zu halten, wurde aber dermaßen herumgewirbelt, daß sie beinahe den Rückweg in ihr Erdloch nicht wiedergefunden hätte. Als sie schließlich wieder zu Hause war, zitterte sie vor Wut.
„Der garstige Wind!“ sagte sie. „Da sitze ich und höre mir geduldig seine dummen Geschichten an, und dann überfällt mich plötzlich der rohe Bursche. Undank ist der Welt Lohn!“
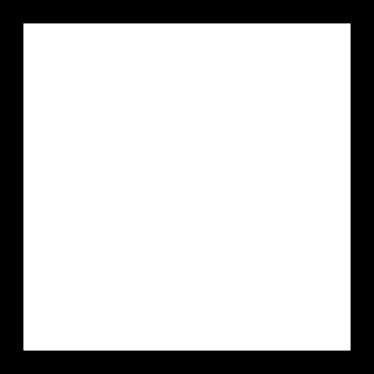
[S. 280]
Es war einmal ein Mann, der war so entsetzlich gut, daß er es nicht aushielt in diesem Leben und in dieser Welt.
Wohin er sah, sah er nichts als Hader und Zank unter den Menschen. Ein jeder sorgte für sich und suchte den Nachbar zu übervorteilen. Krieg tobte zwischen den Königen, Krieg zwischen den Völkern und Krieg auch zwischen den Krämern drüben an der Ecke. Keiner half dem andern. Keiner verzieh dem andern.
Schließlich bekam der Mann die Welt so satt, daß er beschloß, sich irgendwo weit draußen auf dem Lande anzusiedeln, um so wenig wie möglich mit den Menschen zu tun zu haben.
Gesagt, getan.
Er suchte sich ein erstaunlich kleines Haus irgendwo in einem fernen Tannenwalde, dicht am Meer. Das mietete er von dem Bauern, dem es gehörte, und zog auf der Stelle ein. Und da wohnte er nun, rauchte seine Pfeife, saß am Strande und blickte aufs Meer hinaus und dachte, jetzt solle sein gutes Herz nicht wieder gekränkt werden durch Schlechtigkeit und Grausamkeit.

Nun hatte der Mann neben manchen anderen guten Dingen einen prächtigen, mildgesalzenen Schinken mitgenommen, der im Keller stand, damit er[S. 281] nicht verdürbe. Eines Tages bekam der Mann in aller Unschuld Lust auf ein Stückchen Schinken. Doch als er ihn im Keller holen wollte, war der Schinken nicht mehr da, d. h. der Knochen lag noch im Keller, sonst aber auch nichts. Und als er sich im Keller umsah, gewahrte er noch eben den Schwanz einer Maus, die in einem Loche verschwand.
Das war eine überaus ärgerliche Geschichte. Und damit es mit dem nächsten Schinken nicht genau so abliefe, ging er zu dem Bauern hin, von dem er das Haus gemietet hatte.

Auf des Bauern Hoftor saß des Bauern Katze und spann. Die grüßte er und sagte:
„Hör mal, Kätzchen — in meinem Keller sind Mäuse.“
„Ah!“ sagte die Katze.
„Willst du sie fressen?“
„Gewiß!“ rief die Katze.
Da gingen er und die Katze in das kleine Haus, hinüber; und es dauerte nicht lange, so war die Maus gefressen.
„Schönen Dank,“ sagte der Mann.
„Miau-mank,“ sagte die Katze.
Am folgenden Tage ging der Mann unter den Tannen spazieren. Er ging zu einem Vogelnest hin, das sich ein Ende über der Erde befand, und in dem drei niedliche kleine Goldammern lagen. Oft schon hatte er dagestanden und die Jungen betrachtet; nur zu dicht war er nicht herangetreten, damit die Mutter nicht erschrecken und davonfliegen sollte.
Da er nun an das Nest kam, war es leer, ganz leer.
[S. 282]
Er begriff wohl, daß ein Unglück geschehen sein mußte; denn die Jungen waren noch lange nicht flügge gewesen. Die Goldammernmutter saß denn auch im Wipfel der Tanne und piepste gar jämmerlich.
Als der Mann eben traurigen Sinnes fortgehen wollte, gewahrte er die Katze des Bauern, die auf dem Zaune saß und spann.
„Hör’ mal, Kätzchen,“ sagte er. „Gestern lagen drei Goldammern im Nest!“
„Ah,“ sagte die Katze.
„Die hast du gefressen.“
„Ja,“ sagte die Katze.
„Und darum wirst du jetzt Schläge kriegen.“
„Lügen!“ rief die Katze.
Da ergriff der Mann einen Stein und warf nach ihr, traf sie aber nicht. Denn wupps! war sie auf einen Baum geklettert. Da saß sie nun und grinste ihn an.

„Ich kann dir nicht sagen, wie traurig mich dein Benehmen macht,“ sagte der Mann. „Vor der Menschen Bosheit und Grausamkeit bin ich in die friedliche Natur geflohen und stoße da auf einen Banditen wie dich. Du hast wahrlich kein Herz im Leibe; denn du hattest keine Freude an den kleinen unschuldigen Goldammern, die eben zur Welt gekommen waren, und an ihrer Mutter, die so glücklich darüber war. Ehrgefühl kennst du auch nicht... Geziemt sich’s denn für eine alte, ergraute Katze, drei winzigkleine Vogeljunge zu morden?“
Er ergriff wieder einen Stein und warf, traf[S. 283] aber auch diesmal nicht. Die Katze lief höher in den Baum hinauf.
„Hör’ auf mit den Steinen!“ sagte sie. „Du könntest einmal fehlwerfen und mich treffen. Setz’ dich nur auf den Zaun, so will ich dir etwas erzählen.“
„Hast du etwas zu deiner Entschuldigung anzuführen, so soll’s mich freuen,“ meinte der Mann.
„Ich denke gar nicht daran, mich zu entschuldigen,“ erwiderte die Katze. „Ich habe nichts andres getan, als was ich tun darf; dagegen will ich dich angreifen, heuchlerischer Patron du.“
„Was sagst du?“ rief der Mann und setzte sich auf den Zaun.
„Jawohl,“ sagte die Katze, „du bist mir ein nettes Bürschchen. Gestern kamst du zu unsrem Hof hinüberspaziert und holtest mich, damit ich die Mäuse in deinem Keller fräße. Da meintest du, ich wäre eine prächtige Katze und eine gute Katze und gerade so, wie eine Katze sein soll. Als ich mit der Arbeit fertig war, an die du mich gesetzt hattest, da streicheltest du mich und lobtest mich. Keinen Augenblick fiel es dir ein, mich einen Banditen zu nennen. Und heute schiltst und schimpfst du nach Herzenslust, weil ich drei elende Goldammernjunge gefressen habe.“
„Die Maus hatte meinen Schinken verzehrt,“ sagte der Mann.
„Und damit, glaubst du, wäre es gut? Darf ich fragen... was bekamst du gestern zu Tisch?“
„Es gab junge Hähnchen,“ sagte der Mann.
„Allerdings!“ sagte die Katze. „Ich habe selber[S. 284] gehört, wie du beim Bauern warst und sie bestelltest. Und mit diesen meinen Augen sah ich, wie die Magd ihnen den Kopf abdrehte. Willst du nicht so liebenswürdig sein, mir zu erzählen, ob auch die Hähnchen deinen Schinken verzehrt oder dir sonst etwas Böses zugefügt haben?“
„Nein, nein,“ sagte nachdenklich der Mann.
„Brüderlein!“ rief die Katze.
Der Mann ließ den Stein fallen, den er der Katze hatte nachwerfen wollen, und saß mit der Hand unterm Kinn da und dachte nach.
Aber die Katze hörte nicht auf, ihn zu necken: „Vielleicht hast du auch die Freundlichkeit, mir zu erzählen, woher der Schinken stammte, den du für deinen eignen Magen bestimmt hattest, und der in den Magen der Maus kam?“
„Der stammte von einem Schwein,“ sagte der Mann.
„Ganz recht. Ich kannte das Schwein wohl... es hauste drüben auf unserm Hof und grunzte und fraß und krümmte keiner Katze ein Haar. Ich sah auch, wie sie es schlachteten. Darf ich mir die Frage erlauben: Was hat das Schwein dir Böses getan, daß du den Schinken verzehren wolltest?“
„Du hast eigentlich recht,“ sagte der Mann.
„So bist du,“ fuhr die Katze fort. „Mich lobst du, wenn ich Mäuse fresse; und du schiltst mich, wenn ich Goldammernjunge verzehre. Du selbst aber machst dich mit gutem Gewissen über Schweine und Hähnchen her. Und du bist doch ein Mensch und willst klüger sein als wir Tiere!“
[S. 285]
Der Mann sah wohl ein, daß er mit der Katze nicht fertig würde. Da ging er in sein Häuschen und setzte sich hin und sann nach über die Dinge... Er hatte das alles satt. Denn es war gar häßlich anzuhören, wie die Goldammermutter im Tannenwipfel jammerte und schrie. Und auch die Hähnchen hatten eine Mutter, die jetzt umherschlich und ihnen nachtrauerte. Und die Maus hatte vielleicht Kinderchen, die verhungern mußten, weil niemand mehr da war, um für sie zu sorgen. Und auch das war nicht von der Hand zu weisen, daß trauernde Hinterbliebene das Schwein beweinten.
Dem Manne wurde ganz weh um sein gutes, gutes Herz, wenn er daran dachte. Und als er eine Zeitlang nachgedacht hatte, erhob er sich und schlug auf den Tisch.
„Ich will nie mehr Fleisch essen,“ sagte er.
Aber all der Kummer und das Grübeln hatten ihn über die Maßen hungrig gemacht. Er ging darum in seinen Garten, um sich eine Handvoll Salat und ein paar Radieschen zu holen und auch einen Teller mit Erdbeeren zu füllen.
Wie er sich da nun niederbeugte und schon die Hand um ein paar prächtige, saftige Salatpflanzen gelegt hatte, da hörte er eine Stimme rufen:
„O Gott, o Gott! Muß ich jetzt sterben?“
Der Mann wich zurück und starrte entsetzt auf den Salat.
„Bist auch du lebendig?“ fragte er.
„Warum sollt’ ich denn nicht?“ sagte der Salat.[S. 286] „Etwa weil ich nicht fliege wie ein Vogel, oder laufe wie eine Maus, oder miaue wie eine Katze? Siehst du nicht, wie ich wachse und gedeihe? Ich nehme Nahrung auf mit meinen Wurzeln, wie du mit deinem Munde, und verarbeite sie in meinen Blättern, wie du in deinem Magen. Ich freue mich an der Sonne so gut wie der Vogel und du. Läßt man mich am Leben, so treibe ich Blüte und Samen, und die Samen sind meine Kinder. Aber jetzt soll ich also sterben!“
„Nie und nimmermehr,“ rief der Mann. „Nicht um alles in der Welt will ich dir ein Leids antun. Ich begnüge mich eben mit den Radieschen.“
Er machte, daß er zum Radieschenbeet hinüberkam, und zog eines der größten heraus.
„O weh!“ seufzte das Radieschen, und dann starb es.
Mit einem Schrei ließ der Mann es los.
„Warst du auch lebendig?“ fragte er.
Darauf konnte es selber nicht antworten, denn es war tot. Doch eins von den andern, die auf dem Beet standen, nahm das Wort:
„Natürlich sind wir lebendig. Was denn sonst? Aber wir wissen wohl, daß wir sterben müssen. Wir sind bloß ausgesät, um zu wachsen und einst den Menschen als Nahrung zu dienen... diesen fürchterlichen Essern, die nie an etwas anderes als an Magenzufuhr denken und alles verzehren, was in ihre Nähe kommt. Schlimmere Räuber und Mörder gibt es nicht in der ganzen Welt.“
[S. 287]
„Ich bin kein Räuber und kein Mörder,“ versicherte der Mann. „Ich werde euch niemals mehr essen! Ich will meinen Hunger mit ein paar Erdbeeren stillen...“
„Natürlich,“ sagte das Radieschen. „Mord muß sein. Glaubt er, törichtes Menschenkind, daß die Erdbeeren etwa nicht lebendig seien?“
Da lief der Mann aus dem Garten ins Haus, und er setzte sich in seine Stube und weinte. Er meinte, sterben zu müssen vor Hunger, da er nicht zum Mörder werden wollte, seines guten Herzens wegen.
Doch da er nicht gleich starb und der Hunger immer stärker wurde, ging er an seinen Schrank und ergriff einen wunderschönen roten Apfel, den er den ganzen Winter über verwahrt hatte.
„Den werde ich essen können,“ sagte er.
Doch kaum hatte er die Zähne angesetzt, als der Apfel tief und wehmütig zu seufzen begann.
„Ach ja, ach ja!“ sagte der Apfel. „Dacht’ ich es mir doch! Ich wußte es schon damals, als die Mörder mich vom Baum herunterrissen. Nun ißt man mich, und meine Kerne kommen in den Spucknapf anstatt in die gute, schwarze Erde. Niemals werden niedliche Apfelbäumchen daraus werden.“
Der Mann ließ den Apfel fallen, so daß er durchs Zimmer rollte.
Eine Weile saß der Mann da und starrte dem Apfel nach. Dann blickte er auf; drüben vom offnen Fenster her ertönte Geräusch.
[S. 288]

Es war die Katze, die auf das Fensterbrett gesprungen war.
„Na?“ fragte sie. „Wie geht es? Hast du was zu essen gekriegt?“
„Nei—n,“ sagte der Mann.
„Aha, Brüderlein!“ sagte die Katze.
„Ich habe nicht genug Kraft, um nach dir zu werfen,“ rief der Mann.
„Nein,“ erwiderte die Katze, „die hast du nicht. Über ein Weilchen bist du verhungert. Was spekulierst du dich dumm? Lebe, wie der liebe Gott dich geschaffen! Tu du das deine, und laß den andern das ihre! Die Maus frißt den Schinken, wenn man sie gewähren läßt, und die Katze frißt die Maus, wenn sie sie erwischen kann! Das Leben ist Krieg und Kampf und sonst nichts.“
Einen Augenblick starrte der Mann die Katze an.
Dann sprang er auf, öffnete die Küchentür und rief:
„Ane... Ane... koch mein Mittagessen, geschwind! ... Ich bin am Verhungern. Erst will ich Radieschen haben... und dann ein Stück von dem neuen Schinken... und dann Hähnchen... mit Salat natürlich... und dann eine große, große Portion Erdbeeren... mach schnell, Ane!“
Als er dem Mädchen Bescheid gegeben, nahm er den Apfel vom Boden auf und verschlang ihn in drei Bissen.
Das Kerngehäuse warf er der Katze nach, und er traf sie direkt auf die Nase, so daß sie niesen mußte und schleunigst den Rückzug antrat.