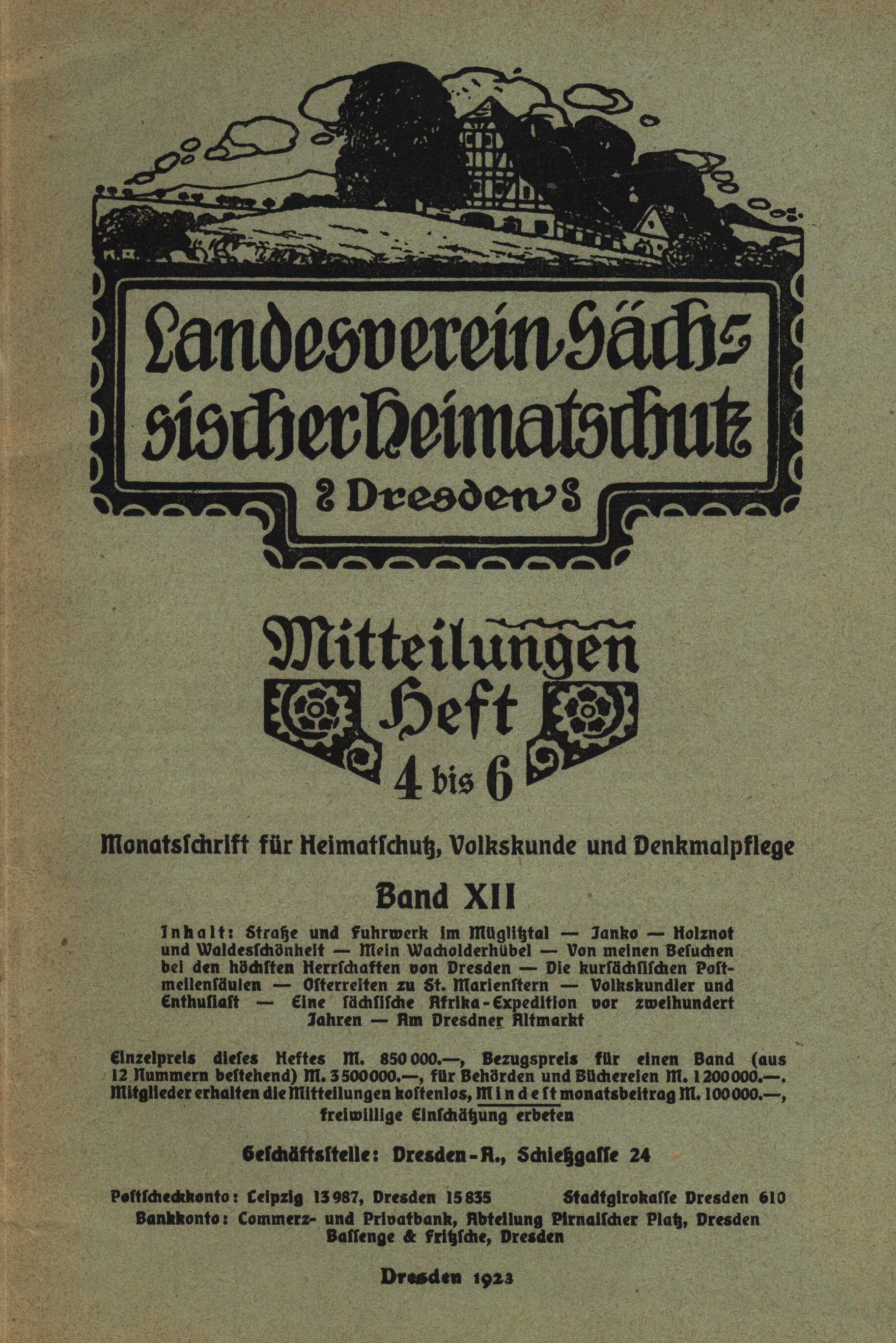
Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XII, Heft 4-6
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Author: Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Release date: March 18, 2023 [eBook #70317]
Language: German
Original publication: Germany: Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
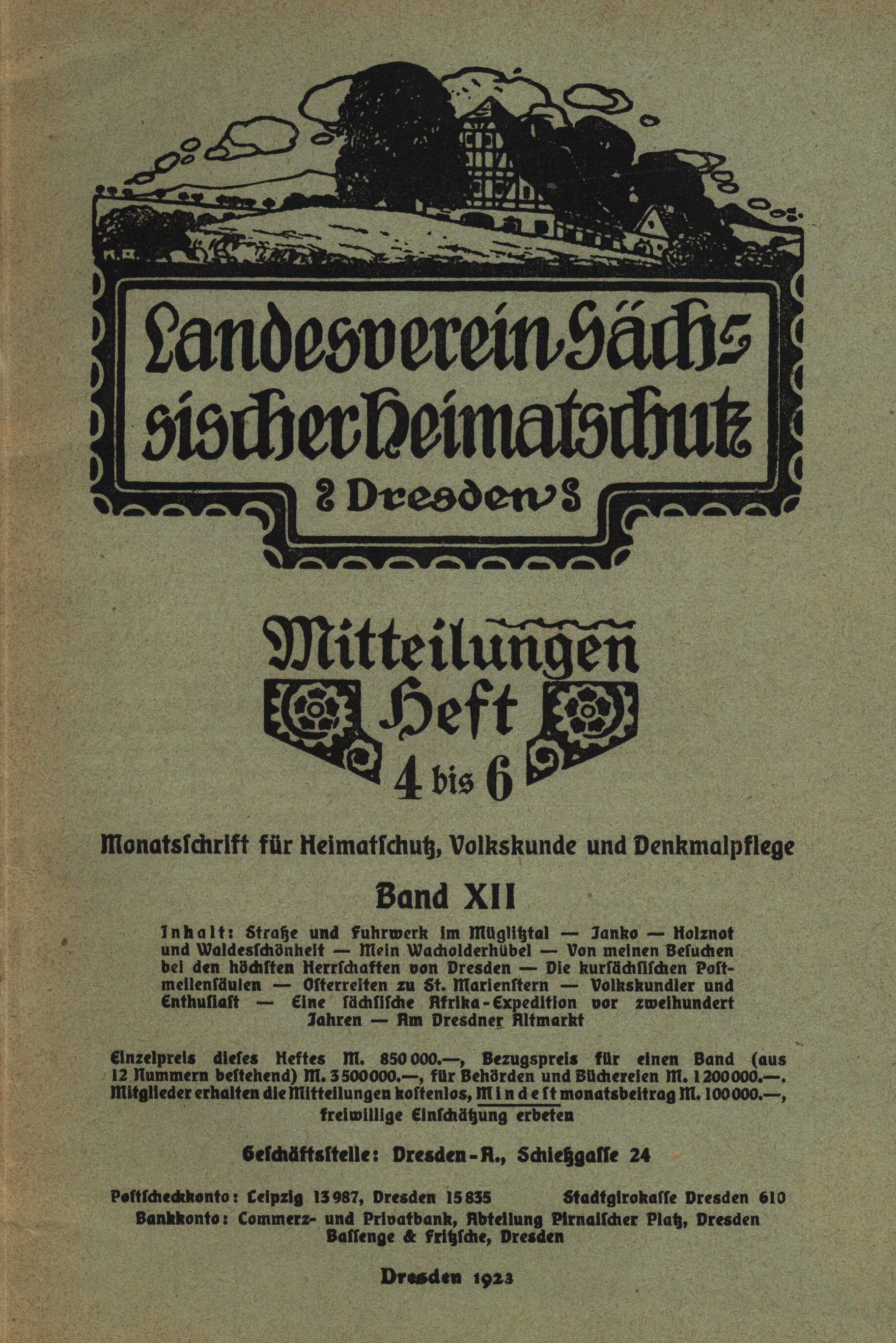
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Dresden
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Band XII
Inhalt: Straße und Fuhrwerk im Müglitztal – Janko – Holznot und Waldesschönheit – Mein Wacholderhübel – Von meinen Besuchen bei den höchsten Herrschaften von Dresden – Die kursächsischen Postmeilensäulen – Osterreiten zu St. Marienstern – Volkskundler und Enthusiast – Eine sächsische Afrika-Expedition vor zweihundert Jahren – Am Dresdner Altmarkt
Einzelpreis dieses Heftes M. 850 000.—, Bezugspreis für einen Band (aus 12 Nummern bestehend) M. 3 500 000.—, für Behörden und Büchereien M. 1 200 000.—. Mitglieder erhalten die Mitteilungen kostenlos, Mindestmonatsbeitrag M. 100 000.—, freiwillige Einschätzung erbeten
Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24
Dresden 1923
Dresden, den 17. August 1923
An unsre werten Mitglieder!
Ein neues Heft und dadurch viel Freude in den Kreisen der Heimatliebenden! Wie sehr unsre Hefte erwartet werden, konnten wir besonders in der letzten Zeit merken. Täglich kamen mindestens fünfundzwanzig bis dreißig Nachfragen; denn es rechneten wohl viele in der jetzigen Zeit äußerster wirtschaftlicher Not mit einem vollständigen Erliegen auch unsrer Mitteilungen. Wir haben in letzter Zeit tüchtig gearbeitet, um Werte zu schaffen, damit uns die Überwindung der jetzigen Zeit ein klein wenig leichter fällt, und wir einen Vorsprung haben, um nichts von dem einzubüßen, was unsre Bewegung seit 1914, seit ihrer Gründung herausgibt und veranstaltet.
Selbstverständlich ist, daß die Monatsbeiträge zu unserm Verein der Geldentwertung entsprechend aufgebessert werden müssen, und wir hoffen, daß sich niemand dieser Erkenntnis entzieht.
Dieses Heft unsrer Mitteilungen, das keine Einschränkung gegenüber früheren Heften aufzuweisen hat, kostet uns mit Papier, Klischees und Druckkosten vier Milliarden Mark; dazu kommen die Versandkosten einschließlich Postgeld in Höhe von einer Milliarde Mark, so daß unsre Selbstkosten für dieses Heft fünf Milliarden Mark betragen.
Den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend, unsren Ausgaben einigermaßen anpassend, mußten wir uns entschließen, einen monatlichen Mindestbeitrag von 100 000 Mark zu erheben und unsre Mitglieder zu bitten, wenn irgend möglich, sofort nach Erhalt dieses Heftes uns den Beitrag für drei Monate, also zusammen mindestens 300 000 Mark auf unser Postscheckkonto (Dresden 15 835, Leipzig 13 987, Stadtgiro 610) zu überweisen. Alle diejenigen Mitglieder, die noch keine laufenden Beiträge in diesem Jahre zahlten, müssen wir bitten, den vom August ab gültigen Beitrag von monatlich 100 000 Mark ab 1. Januar d. J. bereits zum Ausgleich der Geldentwertung zu zahlen.
Wir bitten, beim Lesen dieser Zeilen die Zahlen mit den vielen Nullen nicht als Geldzahlen anzusehen, sondern vielmehr zu bedenken, was wir uns heute für 100 000 Mark kaufen können, dann werden alle unsre Mitglieder sich überzeugen, daß bei der Bemessung auch dieses Mindestbeitrages auf viele andere große Einnahmen Rücksicht genommen wurde; denn sonst könnten wir mit 1/8 Pfund Margarine monatlich nicht auskommen, bieten wir doch unsren Mitgliedern jährlich in unsren Mitteilungen Werte von heute 3 500 000 Mark, denn bei einem Grundpreis von 5 Mark, multipliziert mit der heutigen Schlüsselzahl von 700 000, ergibt sich dieser Tagespreis.
Wir werden wie bisher auf die wirtschaftlich Schwachen, auf die Kleinrentner, auf die vielen Bedauernswerten, die in der Zugehörigkeit zu unsrem Verein, in unsrer Zeitschrift, das letzte Bindeglied mit der Heimat, mit der Scholle, besitzen, mit den Erwerbslosen, mit den Lehrlingen und Schülern, in der Beitragszahlung Rücksicht walten lassen und sozial denken und handeln, so, wie dies stets von uns geübt wurde.
Auch diesmal hoffen wir zuversichtlich, daß uns das Durchhalten ermöglicht wird, und wir wollen nach Kräften arbeiten, damit dem Sachsenland, als einzigen in den deutschen Gauen, die Bewegung, der Verein für die Heimat, mit seinen Veröffentlichungen, mit seinen Vorträgen, mit seinem Wirken und Schaffen erhalten bleibt. – Wir bitten rasch zu handeln und keine Entwertung der Beträge eintreten zu lassen. Denkt, fühlt und handelt für uns, für die sächsische Heimat.
Dank und deutschen Gruß!
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
[65]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
Abgeschlossen am 1. Juni 1923
Von A. Eichhorn, Glashütte
In tiefer Wildnis träumte einst das Tal den »Mogelicz«. Herabgestürzte Felsblöcke vereint mit entwurzelten urhaften Baumleibern stauten oft das Wasser des felsbeengten Waldflusses. Baum, Stein und Wasser machten das Tal unwegsam und zwangen Huf und Rad sich andren Weg zu suchen. Aus den Hammerwerken am blockgefüllten Flusse schleppten sich die Eisenkarren mühsam auf die Höhenwege. Das war zu der Zeit, da rußige Hammerknechte mit schwerem Eisengerät am Schmiedefeuer schafften, das Klingen aus der Hammerschmiede sprang, von den nahen Felsen zurückprallte und sich mit neuem Hammerschall vertönte. Das war in jenen Jahrhunderten, da hier schwarzbekittelte Schatzgräber mit Hammer, Schlägel und Bergeisen die Erze aus dunklem Felsengange lösten und Albinus schrieb: »Das dritte und fürtrefflichste Eisen wird zu Lawenstein vnd Berggießhübel vnd Glaßhütten gemacht«. Lasttiere trugen aus den Mahlmühlen auf dem »Eselssteig« und andren schmalen Pfaden das Mehl in die Bauerndörfer. Über die Höhen liefen Straßen. Aber gar arg waren die Höhenstraßen beschaffen, die vom Elbtal nach dem Erzgebirge führten. Geifernde Zugtiere zerrten unter Fluch und Prügel den Wagen aus schlammigem Loch, um nach wenigen Wagenlängen gleiche Marter zu überwinden. Und war der Höhenweg gezwungen, das wegsperrende[66] Tal zu durchqueren, so folterte steinigter Hangweg, wurzelüberflochten und wasserzerrissen, Mensch und Tier bis zur Erschöpfung. Eine lasttragende Brücke führte selten zum Gegenhang. Durch geröllstrotzende Furt knarrte der Wagen. Und wenn Schmelzwässer im Felsental in tollen Wellensprüngen gurgelten, dann kam zu all den Mühen noch eine qualvollere Wartezeit. Nur eine feste Brücke überspannte schon vor vier Jahrhunderten die Müglitz: die Kurfürst-Moritz-Brücke in Glashütte (Abb. 1). Aus dem Urgestein der Uferfelsen und Sandsteinquadern gefügt, trotzte sie durch Jahrhunderte dem zuzeiten wütenden Wasserprall und dient zur Stunde gleichem Zwecke wie in längst vergangnen Tagen. Aus dem pestbefallenen Freiberg war Herzog Moritz mit Gefolge ins einsame Bergstädtchen Glashütte geflüchtet. Sechs Wochen hindurch genoß er die Gastfreundschaft der Bergleute, die 1545 dafür ihren Lohn in der steinernen Brücke über die Müglitz erhielten.
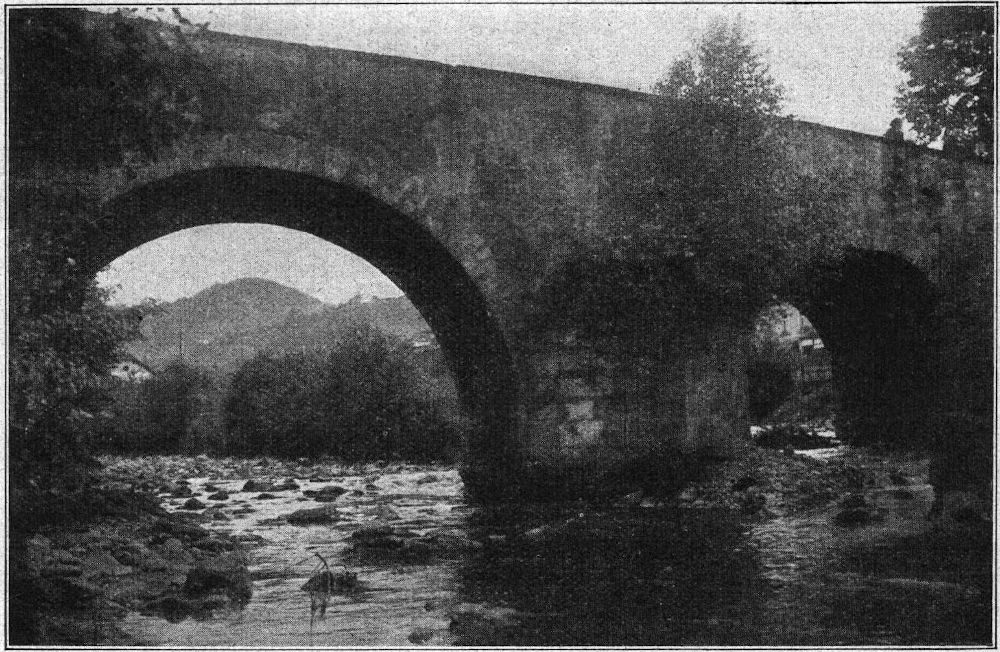
Jahrhundertelang dienten die Höhenstraßen im östlichen Erzgebirge dem Verkehr vom Kamm bis hinab zum Elbstrom und umgekehrt. Da kam auch für das Müglitztal die Stunde, in der ihm seine Unwegsamkeit und Stille genommen ward. Es war im Jahr 1846, als man bei Weesenstein im Tal anfing zu graben, Erde aufzuwerfen und Steine zu klopfen. Achtzehn Jahre hindurch galt es zu graben, Ufermauern zu formen, Felsstücke abzusprengen, Bäume zu fällen, Quarzporphyr aus den Gängen zu brechen, die den Gneis durchziehen, um Straßenschotter zu[67] gewinnen. 1864 wurde die letzte Teilstrecke von Lauenstein bis Geising vollendet. Weit über fünfhunderttausend Mark kostete die neue Talstraße von Mügeln bis Geising, eine gewaltige Summe für jene Zeiten.

Nun bewegten sich die Fuhrwerke von der »Pirnaischen Chaussee« aus im Tale hinauf zum Grenzwald. Bestimmte Rastorte wählten die Botenfuhrleute. Vor dem Gasthof in Häselich hält auf unserm Bilde der Botenfuhrmann (Abb. 2). Eine Ruhepause muß er seinen Pferden gönnen nach anstrengender, talaufgerichteter Zugarbeit. Ein gar langes Fuhrwerk ist solch ein Frachtwagen mit Gespann. Nur auf so wohlgepflegter und allmählich steigender Fahrbahn, wie sie die Müglitztalstraße einst bot, vermochten zwei muskelstramme Gäule die Last zum Gebirgskamm zu bringen. Auch wurde der Wagen von Ort zu Ort von warengefüllten Kisten, Fässern und Säcken entlastet. Dann meisterten zwei Zugtiere auch die steile Straße von Geising nach Altenberg. Wohl waren mitunter mehr als zwei Pferdekräfte notwendig, den überplanten Lastwagen kammwärts zu ziehen, gegen die Mühen auf den einstigen Höhenstraßen war die Fahrt im Tale angenehm.
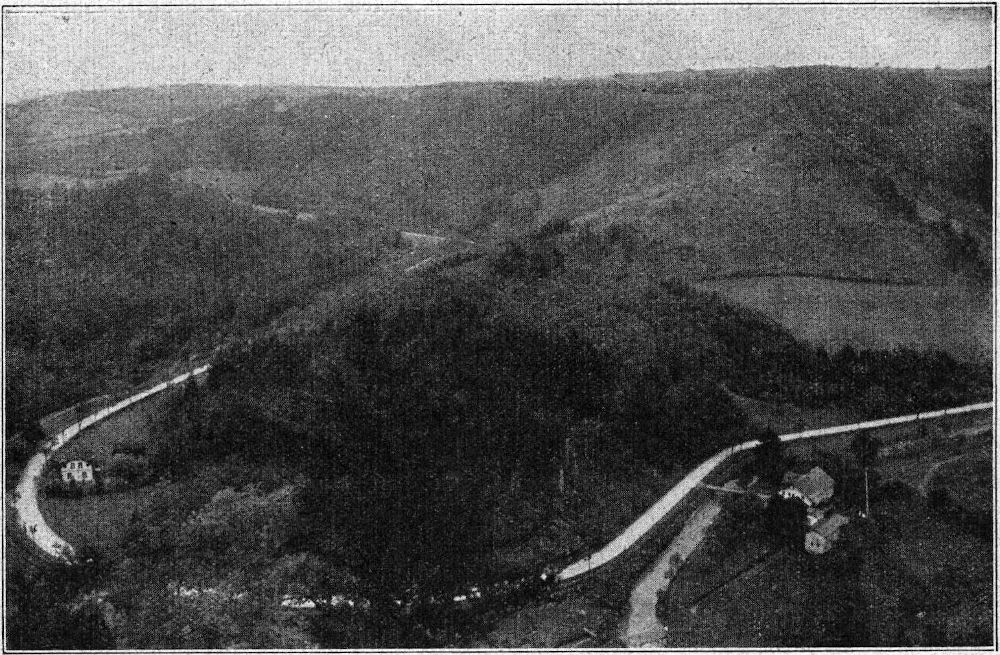
1855 kam auch der gelbe Wagen ins Müglitztal. Sechs Reisenden gab er zur Mitfahrt Platz. Elf Neugroschen forderte der Postillon von jedem Fahrgast für die Strecke von Glashütte nach Mügeln. Die Boten, die ehedem »über die Berge« auf der Straße durch Lungwitz und Kreischa dreimal wöchentlich nach Dresden gingen, um im »Königlichen Hofpostamte« die »Glashütter Post« abzuholen, waren[68] nun ihrer anstrengenden Märsche ledig. An den Dresdner Markttagen rollten auch dreispännig neunsitzige Wagen von Glashütte nach Mügeln. 1857 fuhr am 15. März zum erstenmal die Postkutsche von Glashütte nach Lauenstein. Sieben Neugroschen verlangte der »Schwager« für diese Fahrstrecke. Es waren reizbietende Fahrten für die Reisenden in einem Tale, darinnen die Straße gar oft zum Richtungswechsel (Abb. 3) gezwungen wird und in scharfen Bogen sich krümmt um arg zerfressene, jäh sich verstürzende Felsen; da im Hartung der Frost die felsenüberrieselnden Wasser fesselt, daß sie sich zu vielformigen Eismassen wandeln und die langen Eisstangen mit den wenigen Lichtboten der Wintersonne ein glitzerndes Farbenspiel treiben und der grimme Forstriese die Tröpfchen des flüssigen Elementes, die dem »Ursohn« in die feinsten Äderchen seines geschichteten Körpers dringen, in festen Stoff verwandelt, der das beengende Gehäus sprengt, an glutheißen Sommertagen Millionen anderer Äderchen geweitet werden und das Urgestein stetig zermürben; da Fels und Wurzel sich fest verbrüdern, so daß selten ein Baum vom Felsen nicht widerstand, wenn die baumfällenden Winterstürme ihre Kraft am heimischen Wald erproben; da in Gilbhardtstagen der große Farbenmeister seine kräftigsten Farben verschenkt und den Mischwald an den Talhängen in allen Farbenfeuern auflodern läßt. Sinnende Fahrgäste kamen zum Genuß dieser Talschönheiten, denn sie waren auf der wohlgebauten Müglitztalstraße nicht zu den Leiden verdammt, die Postreisende vergangener Jahrhunderte auf den schlechten Landstraßen erdulden[69] mußten. An einem Nebelungsabend des Jahres 1890 war es, als die Posthalterei Glashütte zum letzten Male eine Fahrpost nach Mügeln und Geising abgehen ließ. Im Tale war die »eiserne Straße« fertig geworden, auf ihr fuhr das »Zügle« und übernahm die Postarbeit. Und mit der Talstraße laufen seit der letzten Jahrhundertwende noch viele metallne Wege parallel, in denen der Mensch mit »Blitzschrift« seine Gedanken talauf und talab jagt. Noch einmal lebte die Postkutschenzeit für kurze Zeit auf, als die niedergehenden Wasser im Heumond 1897 Straße, Brücken und Eisenbahn zerstörten. Nur »über die Berge« konnte der Wagen fahren: Glashütte–Kunnersdorf–Hausdorf–Maxen–Sürßen–Dohna–Mügeln. Nur Postsachen sollten auf diesen Fahrten mitgenommen werden. Doch der »Schwager« konnte die leeren Plätze in seinem Wagen nicht immer leiden und ließ sie durch manchen »blinden« Fahrgast besetzen (Abb. 4). Ja sogar »über den Berg« mußte er einige Tage fahren, um vom Hammergut Gleißberg im Müglitztale, wohin die Postsachen aus den »oberen« Orten gebracht wurden, nach dem zehn Minuten talab gelegenen Glashütte zu kommen, da die Talstraße auf dieser kurzen Strecke gerade nicht befahrbar war. Wenn wir uns auf dem Bilde den steilen, dazu überaus steinigten Weg zum Hahneberg hinauf anschauen und im Geiste sehen, wie die Pferde auf diesem jahrhundertalten Fußweg von Glashütte nach Johnsbach die Postkutsche aufwärts zerren, um aus dem Müglitztal ins Prießnitztal zu gelangen, dann wird uns einmal die große Verkehrshemmung bewußt, die jene gewaltige[70] Wasserflut plötzlich brachte, zum andern auch ein schwaches Abbild dafür, welche Anstrengung zerfurchte und steile Hangwege vergangner Jahrhunderte für Fuhrmann und Zugtier brachten. Erst als das zerstörte Menschenwerk an Straße und Brücken im Tale wieder hergerichtet war, fuhr die Post »unten« und nahm auch Personen mit. Über zwei Monate flackerte »die alte Zeit« noch einmal auf, um dann für immer zu verlöschen. Im Herbstmond des Vorjahres trat auch der Postwagenführer jener Tage heraus aus unsrer Zeit. Nur die Postmeilensäule an der Müglitztalstraße weckt zuweilen die Erinnerung an die ehemaligen Verkehrsverhältnisse. Ursprünglich stand die Säule mitten in der Stadt, wie aus einer Urkunde vom Jahre 1764 hervorgeht (Abb. 5).
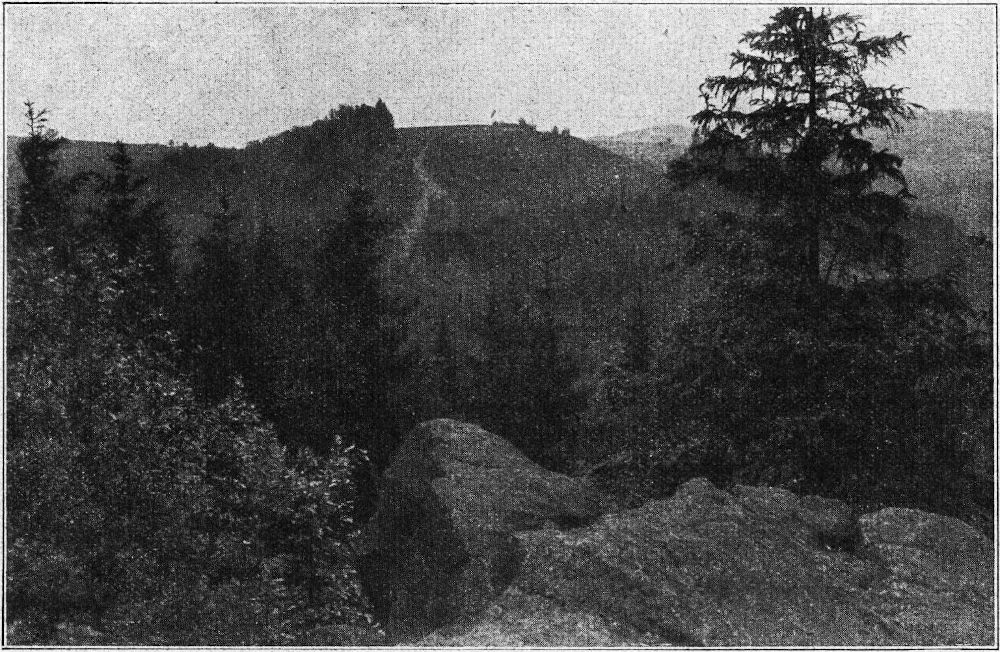
[71]
Gegenwärtig sind Holzstoff-, Rinden-, Heu- und Brotwagen eigenartige Fuhrwerke fürs Müglitztal. Seit dem Kriege kam, wie überall, das Lastauto hinzu.

Abb. 6. Wie Tuchballen wird der Holzstoff gerollt. Hochaufgeschichtet lagert er auf dem Wagen, der nach dem Bahnhof Glashütte fährt. Seitdem Friedrich Gottlob Keller die Holzstoffpapierbereitung erfunden hatte, wandelte mancher Kleinmüller des Tales seine Mahlmühle in eine Holzschleiferei um. Schleifmühlen waren diese Betriebe, denn das Mühlrad bedeutete für sie das Lebensrad. Als aber auf der »eisernen Straße« die Kohle ins Tal gebracht wurde, da bekam das Wasser im Dampf einen gewaltigen Gehilfen, der ihm im trocknen Sommer und kalten Winter die Arbeit abnahm, lange Hauptantriebskraft blieb, bis in unsren Tagen die »über Land gejagte Kraft« den Dampf abzulösen beginnt. Die Eisenbahn ist auch der Grund dafür, daß der Wanderer ganz selten einem Holzstoffuhrwerk auf der siebenstündigen Talwanderung von Mügeln (Heidenau) bis Geising begegnet, da Gleisanschluß den Eisenbahnwagen bis in den Hofraum der Fabrik fahren läßt und hier die Erzeugnisse sogleich hineingeladen werden. Nur auf dem kurzen Wegstück von Glashütte bis Bärenhecke wird es möglich sein, ein Fuhrwerk mit den gelblichen, feuchten Holzstoffballen zu sehen. Die Fahrt zum Bahnhof geschieht aber nicht an jedem Tage.

(Abb. 7.) Fichtenrinden, seltener Eichenrinden, holte der Lohmüller mit seinen Leuten von heimischen Holzschlägen. Unterm Schuppendach und auch auf dem Oberboden des Hauses trocknen die gerbstoffhaltigen Rollschalen. Im düsteren, gebälkigen[72] und gar staubigen Mahlraume wandelt sie das Schneidmesser zu Lohe, die der Häutezurichter als Gerbmittel kauft. Eine besondere Freude ist es für den Heimatfreund, wenn er einen Rindenwagen sieht, denn nur noch zwei Lohmühlen, viertelstündlich geschieden, liegen am oberen Müglitzlauf, und nur an wenigen Tagen im Jahre wird Arbeit fürs Mühlrad geholt.

(Abb. 8.) Vierzig Zentner des kräuterreichen Gebirgsheues ruhen in getürmter Last auf dem Wagen, ästezerrend, mitunter auch ästeknickend, wenn ein Gegenfahrzeug die Hälfte der Fahrbahn verlangt. Und kommt die glückliche Zeit der Obstreife, oh, zu welch einem willkommenen Äpfelpflücker wandelt sich dann der Heuwagen in Kinderaugen! An des Tales geringster Weite, am schwersten Fahrstück für den Fuhrmann hält auf unserm Bilde der Heuwagen. In scharfer Krümmung umläuft die Straße den überhängenden Felsen, und die hohe Ufermauer kündet von schwerer, erdaufschüttender Arbeit. Kommt hier ein andres Fuhrwerk talauf gefahren, dann ritzen die vorspringenden Zacken des Wittigschloßfelsens die heuschützende Plane. Wohnung und Schutz soll dieser Fels dem Raubritter Wittig und seinen Raubbrüdern gegeben haben in jener Zeit, da maßlose Wildnis dieses Land deckte. Eine geschichtliche Heimatschrift erzählt: »In alten Zeiten, als die ›böhmischen Wälder‹ durch ihre Räuberbanden berüchtigt waren und das Faustrecht herrschte, gab es auch viele Raubschlösser, und eins der festesten und verrufensten war das, welches der Raubritter Wittig auf obenerwähnten starken Felsen erbaut hatte. Dieser Wittig machte das ganze Land Meißen unsicher und[73] trieb es mit seiner Bande so frech, daß die Markgrafen von Meißen es deswegen hatten ›öffentlich auskündigen lassen, daß, were diesen Räuber ihnen entweder lebendig oder todt überantwurten würde, derselbe einer großen und möglichen Bitte Vergünstigung haben sollte‹«. Woher kommt der Heuwagen, der hier an geschichtlich denkwürdiger und geographisch eigenartiger Stätte hält? Aus der Bergstadt Altenberg. Im Heumond schreiten die Mäher über die Bergwiesen um den Geising, und all die bunten Gebirgskräuter sterben unter zischendem Stahle. Schnell gilt es auf den Wiesen der Kammorte zu heuen. Die dunkelste Farbe trägt diese Gegend auf Sachsens Niederschlagskarte. Schon im Herbstmond hetzt oft zerfetzter Nebelflug am basaltnen Wetterberge vorüber. Und wenn der Bergwinter auf den Wiesen lastet, dann erinnert der Heuwagen den Talsiedler an ihre Sommerbuntheit, wie sie so wundersam leuchtete kurz vor den Tagen, in denen der Sensentod über die Hänge ging. Mehr als ihr Vieh brauchte, heimsten die Gebirgler an Heu ein, darum brachten Botenfuhrleute den überschüssigen Erntesegen aus Altenberg, Geising, Zinnwald, Fürstenau, Fürstenwalde und Bärenstein an bestimmten Tagen im Wochenlauf in die Hauptstadt des Landes zum Heumarkt. Zwölfmal überholte dabei der lange Weiser den kurzen auf Fuhrmanns Taschenuhr. Und heute? Nur selten fährt noch ein Heuwagen vom Gebirge zum Elbufer. Der Heubedarf nahm auf dem Markt erheblich ab, als das Lastauto die Zugtiere großer Betriebe ablöste. Der Häusler »droben« braucht jetzt meist selbst seine Bergwiesenernte. Immer mehr Sommergäste weilen in den Kammorten, und da er sie mit stärkender Ziegen-[74] oder Kuhmilch bewirtet, so stellt er mehr Vieh in seinen Stall. Da kann kein Heu mehr verkauft werden. Nahe gerückt ist der Tag, an dem das letzte Heufuhrwerk vom Grenzwalde das Tal hinab fährt und damit für den Heimatfreund die wehmutsbange Stunde, in der er ein Stück alte Talschönheit für immer hinwegfahren sieht.

Regelmäßig fährt ein brauner Brotwagen auf der Talstraße. Jeden Dienstag zur bestimmten Stunde rollt er über die Brücke vor der Schüllermühle, um das Mühlenbrot ins Nachbarstädtchen Glashütte zu bringen. Wenn die Seiten- oder Hintertür geöffnet wird, dann gucken aus vielen Fächern die braunen »Laibe« heraus. Ein Geländer auf dem Wagendache läßt die Körbe nicht herunterfallen.

Regelmäßig fährt seit ungefähr einem Jahr ein neues Botenfuhrwerk im Tale, das »Tänzlerauto«. Es kommt aus Dresden und bringt Kisten und Säcke mit Lebensmitteln zu den Kaufleuten, Messing und Eisenstangen in die mechanischen Werkstätten. Vor dem Laden des Ofensetzers werden Ofenkacheln, Ofentüren, Ofenroste und auch eiserne Öfen abgeladen. Auch mit Bierfässern, Benzinkannen, Leiterwagen, Nähmaschinen, Fahrrädern, Möbelstücken und vielen anderen schweren Lasten eilt das neue Botenfuhrwerk zu Berg und zu Tal. Montag, Mittwoch und Freitag sind seine Fahrtage. Auch mit »Anhänger« fährt es seit einiger Zeit. Recht müssen wir dem alten Fuhrmann geben, wenn er uns erzählt, daß seine Gäule einst leichtes Ziehen auf der glatten Fahrbahn der Müglitztalstraße hatten,[75] sich in unsern Tagen aber tüchtig mühen müssen, um die gleiche Last fortzubewegen, denn arg zerfahren wird die Straße von den mancherlei Kraftfahrzeugen.
(Abb. 9.) Will der Heimatfreund noch einmal einen leisen Nachklang an die Einsamkeit des »Mogelicztales« empfinden, so macht er sich zum Gast der Seitentäler, da auch zerfressene Felsen zum Bache treten und Geröll und Blockwerk das Wasser zwingt vom schnellen Lauf ein wenig auszuruhen oder über sich dahinschießen läßt zu kleinem Fall und kreisendem Wirbel. Da wohlgewachsene Baumgestalten die Hänge hinabsteigen und im munter lärmenden Bach ihre Wurzeln baden. Da er den eigenen Reiz der Waldbachpflanzen spürt, als Vogelfreund zuweilen noch den Eisvogel beim Fischen belauschen kann und zuletzt auf sumpfigen Quellwiesen anlangt, wandert er dem Wasser entgegen. Trebnitzgrund, Kohlbachtal, möge euch im Zeitenlauf noch lange eure Schönheit und Stille bewahrt bleiben, kommenden Geschlechtern zu körperlicher und geistiger Gesundung!
Liebe Brüder und Schwestern vom Heimatschutz!
Laßt mich heute mit Euch einen Gewinn teilen, der mir geworden ist! Wenn Ihr dabei denkt, ich hätte in der Staatslotterie gewonnen, dann seid Ihr auf dem Holzwege; denn das ist mir seit zwanzig Jahren noch nicht einmal geschehen, obwohl ich eine Nummer spiele, die meinem verstorbenen Vater als Gesangbuchslied im Traume eingekommen ist. Aber vernehmt meine Geschichte und schreibt wieder, ob mein Gewinn nicht auch des Teilens wert sei.
Im vorigen Sommer unternehme ich eine Ausfahrt ins Storchenland und komme da am Nordostrande unsres Sachsenlandes in so manches Dorf, das leider nur noch kümmerliche Spuren ehemaliger Storchenherrlichkeit aufweist. Bedauerlich ist es ganz besonders, daß für diesen Niedergang auch die Unvernunft so mancher Krone der Schöpfung verantwortlich ist.
Doch hört: In der Woche vom 20. August erhalte ich von einwandfreier und zuverlässiger Storchenseite die bestimmte Nachricht: Wir machen uns auf die Flügel (ein Storch kann nicht gut sagen: wir machen uns auf die Beine oder auf die Socken). Darum losgeradelt.
In den Teichen von Königswartha sehe ich manch stimmungsvolles Storchenbild. Schade, daß ich kein Herr Bernhardt aus Dresden bin, der mit Kamera und Film arbeitet. Es wären herzerquickende Bilder geworden. In der Woche vorher muß es im Orte noch schöner ausgesehen haben. Da haben sich etwa fünfzig Störche vor der Abreise gegen Abend auf Essen, Türmen und auf allem, was sonst noch an hervorragenden Gebäudeteilen aufzutreiben war, niedergelassen, um der Nachtruhe zu pflegen.
Jetzt nach Krinitz bei Neschwitz! Dort lerne ich den Janko kennen. Ihr hättet einen Heidenspaß gehabt, wenn Ihr dabeigewesen wäret, wie er mir vorgestellt wurde. Auf dem Scheunendache des Storchenvaters Trähne klappern im[76] Neste zwei Störche. Unten auf der Düngerstätte liegt auch einer im schönsten Nichtstun. Er hat sich schön bequem ausgestreckt und nimmt ein Sonnenbad. Um ihn her Hühner, Tauben, Gänse, Spatzen, Schwalben, ab- und zugehende Menschen, die der Erntearbeit obliegen. Er mag denken: Ich bin Herr im Hofe. Euch kenne ich alle.
Beim Öffnen des niedrigen Hofgatters hebt er den Kopf und blinzelt mich an. Ich komme ihm näher. Da läßt er ein eigentümlich ziehendes Pfeifen hören. Vater Trähne kommt, nimmt einen kleinen blauen Krug zur Hand, klappert darauf und ruft: Janko. Sofort ist Janko, das ist nämlich der Storchenjüngling, auf den Beinen und mit zwei bis drei Gleitsprüngen steht er vor uns. Mich beachtet er zunächst gar nicht. Ich bin ja auch nicht seinesgleichen, auch nicht einmal ein Frosch. Der Krug ist ihm wichtiger. Sicher fährt sein Schnabel bis auf den Krugboden hinab. Nichts darin, völlig leer! Er pfeift wieder, aber diesmal mit einem etwas ärgerlichen Klang, aus dem auch so etwas wie Enttäuschung zu hören ist. Dann aber verlegt er sich auf gütliches Zureden. Er stellt sich gerade, guckt uns an, verbeugt sich ein über das andre Mal, wobei er streng darauf achtet, daß keiner von uns beiden zu kurz kommt. Dann ein Appell an das Gefühl. Er schreitet auf uns zu, legt seinen Hals an unsre Beine und läßt sich graulen. Wieder geht das Hoftor. Zwei Jungen haben auf den Schwarzwasserwiesen einen Frosch gefangen. Janko kennt seine Lieferanten ganz genau. Schon steht er vor den Jungen und nimmt unter Verbeugungen die Gabe in den Schnabel. Gravitätisch stolziert er vor mir auf und ab. Ich versuche sein Zutrauen zu gewinnen, indem ich ihn im schönsten Hochdeutsch einmal Johann, dann Johannes, Johannchen, Johanneschen, Hans und Hänschen rufe. Er achtet meiner nicht. Ihn muß ich wendisch anreden. Auf Janko hört er sofort. Als ich ihm meinen Ausweis vorzeige, wird er gesprächig und erzählt mir:
»Ich, Janko, wurde geboren im Frühjahr 1922 als das erste von vier Geschwistern im Neste auf der neugedeckten Scheune meines Pflegevaters Trähne. Anfangs ging alles gut. Aber von einem unverständigen Schießer wurde meine Mutter weggeschossen. Mein Vater konnte allein nicht mehr Nahrung für vier hungrige Schnäbel schaffen. Das Geklapper dreier Schnäbel verstummte. Auch meines wurde schwächer und schwächer. Schließlich blieb auch der Vater weg. In der höchsten Not schob sich eine Leiterspitze über den Nestrand. Eine Hand warf meine drei verhungerten Geschwister auf den Dung. Mich nahm sie behutsam zur Erde hinab. Ich wurde gekröpft, geazt, gefüttert mit Kaulquappen, Fröschen, Schlangen, Fischen, Mäusen u. dgl. Alles ist mir gut bekommen. Nur an Heringen vergreife ich mich nicht wieder. Ich bekam davon nicht nur einen gewaltigen Durst, sondern sogar recht schlimme Magen- und Darmbeschwerden. Jetzt sorgt das ganze Dorf vom jüngsten Buben bis zum ältesten Mütterlein für mich. Hunger habe ich einen ganz vorzüglichen. An die sechzig Frösche kann ich verdrücken. Hinaus mag ich nicht gern. Ich bin bei meinen Storchgenossen nicht gut angeschrieben. Also bleibe ich, wo ich bin. Ich verstehe nur nicht, warum meine Pflegeeltern so oft zu mir sagen: ›Janko, Janko! Was machen wir nur mit dir? Der Herbst rückt immer näher, nach ihm der Winter.‹ Neulich wurde die Sache ganz dumm. Da hieß es: ›Janko, entweder[77] du gewöhnst dich an Kartoffeln mit Apern, oder du mußt nach Dresden in den zoologischen Garten!‹ Beides ist so ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. Ich werde lieber abrücken. Und du siehst mir gerade aus, als wolltest du mich vierter Klasse nach Dresden bugsieren. Daraus wird nichts. Nichts für ungut. Gehab dich wohl!« Sprach’s, drehte mir den Rücken zu und stelzte davon.
Er hat auch Wort gehalten. Er fühlte die Kraft seiner Schwingen, lernte sie gebrauchen, zog immer weitere Kreise bei seinen Ausflügen und fand den Anschluß nach dem Süden. Zuvor ward sein Fuß mit einem Ringlein geschmückt.
Vor Ostern dieses Jahres war ich wieder in Krinitz. Die Jugend hatte einen Storchenposten auf den Wiesen gesehen. Sofort erscholl der Ruf: Unser Janko ist wieder da! Von Mund zu Mund ging das Wort. Aber es war kein Janko. Seine Pflegeeltern fragen sich angesichts des Nestes: »Ob er wohl wiederkehren wird?« Hoffentlich kommt er wieder, damit ich noch mehr von ihm erzählen kann. Ich muß ganz offen gestehen, daß mein erster Blick bei Postsachen danach geht, ob eine Nachricht aus Krinitz mir Jankos Wiederkehr meldet.
Liebe Brüder und Schwestern! Das wäre eine Tiergeschichte, wie Ihr sie vielleicht auch in ähnlicher Art selbst erlebt habt. Aber mein Gewinn? Das ist die Bekanntschaft der Pflegeeltern unsres Jankos. Es sind einfache Leute. Aber sie haben einen Idealismus, der nicht häufig anzutreffen ist. Sie reden nicht von Heimat- und Naturschutz, fragen nicht danach, ob das jetzt Mode, ob dabei irgendwelcher Vorteil zu erlangen sei, aber sie handeln aus innerem Triebe heraus für Heimat- und Naturschutz. Aus ihrem Tun spricht eine Selbstverständlichkeit, die rührend ist. Beim Umdecken der Scheune wurde es für ganz selbstverständlich angesehen, daß auf das neue Dach auch wieder ein neues Rad als Unterlage für das Storchnest kommen müsse. Von den dadurch entstandenen hohen Kosten konnte ich von ihnen nichts erfahren, nur von anderer Seite habe ich einige Zahlen zu hören bekommen.
Und wenn Eure Augen auf diesem Hofe die Reihe der besetzten Schwalbennester erblicken, ferner die Schar der ungebetenen Spatzen, die sich als Untermieter unterm Storchnest eingenistet haben, dann die zwei Störche, die als zweite Mieter das verlassene Nest bezogen haben, sich aber auch furchtlos auf dem Hofe bewegen, wenn endlich die Hausfrau noch zeigt, wie ein kleines Maikätzchen darum betteln kann, daß ihm aus einer kleinen Puppenmilchflasche Milch durch den Gummisauger gegeben werden möchte, wenn Ihr schließlich Gelegenheit habt, solche Beispiele praktischen Naturschutzes nicht nur als einen vereinzelten Fall, sondern als verhältnismäßig oft wiederkehrend in den Kreisen der ländlichen Bevölkerung ansprechen zu können, dann müßt Ihr alle glauben an den endlichen Sieg des Heimat- und Naturschutzgedankens und Euch geloben, dafür auch weiterhin Kraft, Zeit und Kosten zu opfern. So ist es mir gegangen. Dieser Aufschwung meiner Begeisterung ist mein Gewinn. Den sollt Ihr teilen mit Eurem
Lucas Karl aus Meißen.
Jeder spürt es am eignen Leibe, wie ungenügend die Holzversorgung ist – trotz den wahnsinnigsten Preisen. Das Baugeschäft liegt still, das einfachste Holzgerät ist kaum mehr erschwinglich, alle Zeitungen klagen über den Mangel an Papierholz, und das Brennholz will erst recht nirgends ausreichen. Früher brauchte sich doch niemand besondre Sorgen zu machen, wie er seinen mittelbaren und unmittelbaren Holzbedarf decke. Warum ist das heute so ganz anders, obwohl doch der Wald eine der wenigen Rohstoffquellen ist, die uns der »Friedensvertrag« gelassen hat? Ist wirklich nur der Waldbesitzer schuld an der Not, der mit dem Einschlag zurückhält, um höhere Preise zu erzielen?
Dieser Vorwurf, der selbst in ernst zu nehmenden Kundgebungen immer wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, zeigt aufs deutlichste, wie wenig die Bedeutung des Waldes für die deutsche Volkswirtschaft, wie wenig die Forstwirtschaft nach Wesen und Eigenart richtig erkannt wird. Trotz aller Liebe zum deutschen Wald, oder vielleicht auch gerade deshalb, weil vielen von uns der Gedanke noch ganz ungewohnt ist, den Wald nicht bloß ideell zu werten, denken wir nicht darüber nach, was der Wald als Ort der Erzeugung von Rohstoffen für uns ist, was er leisten und was er nicht leisten kann.
Deutschland hat vor dem Kriege rund zweiundsiebzig Millionen Festmeter (Kubikmeter) Holz im Jahre selbst verbraucht, also ohne die Ausfuhr an Holz oder Holzwaren zu rechnen. Davon hat es rund ein Fünftel durch Einfuhrüberschuß bezogen, vier Fünftel selber erzeugt. Der Inlandverbrauch verteilte sich auf Bau- und Schnittholz mit zwanzig, Brennholz dreißig, Grubenholz sieben, Papierholz sechs und Schwellenholz drei Millionen; den Rest von sieben Millionen verarbeiteten die Maschinenbauer und Werkzeugschreiner, die Wagner, Fahrzeugbauer, Küfer, Schnitzer und Flechter, die Dreher und Spielwarenhersteller, ferner Landwirtschaft und Gartenbau, Verkohlung und Destillation. Alle diese Zwecke rufen auch heute nach Erfüllung, ja durch die Kriegsfolgen sind neue hinzugekommen, wie die Herstellung der Gerbstoffextrakte und der Stapelfaser. Andre aber haben ihren Bedarf ungeheuer vermehrt, denn, wie ein rasch verbreitetes Schlagwort heißt: »Holz muß Kohle und Eisen ersetzen«. Im ganzen also trotz der Einschränkung der Bautätigkeit und einiger anderer Holz verarbeitender Industrien doch ein gewaltiger Mehrbedarf an Holz gegenüber der Zeit vor dem Kriege!
Nun ist aber unsere eigene Waldfläche durch Gebietsverluste geschmälert. Vor dem Krieg entfiel im Durchschnitt ein Hektar Waldfläche auf vier Einwohner, heute haben sich fünf darein zu teilen; das Verhältnis von Erzeugungsfläche und Verbraucherzahl hat sich also um ein Viertel verschlechtert. Dazu kommen die große Einschränkung der Einfuhr auf der einen Seite, die maßlosen Holzlieferungen an den Feindbund infolge des »Friedensvertrags«, sowie die Ausfuhr von Holzwaren[79] und Holzstofferzeugnissen zur Beschaffung von Devisen auf der anderen Seite, und nicht zuletzt die privaten Schiebungen ins besetzte Gebiet und darüber hinaus, deren Menge sich jeder Schätzung entzieht.
Wer diese Umstände alle bei sich überlegt und dabei daran denkt, daß sein eigener Hausbedarf eigentlich größer ist als früher, der wird sich nicht mehr fragen, warum die Holznot so groß, das Holz so teuer ist. – Aber warum schlägt man denn nicht einfach so viel Holz, bis der Bedarf gedeckt ist, wir haben ja doch Wald genug? Es ist in der Tat versucht worden, diesen Gedanken durch gesetzlich angeordneten Mehreinschlag im ersten Jahre nach dem Kriege zur Ausführung zu bringen. Aber man hat bald gesehen, wohin das führt, und daß die Sachverständigen recht hatten, die davor warnten. Eine geringe Erhöhung des Einschlags in Notjahren kann verantwortet werden in der Hoffnung auf Ausgleich in späteren Jahren. Wollten wir aber den Einschlag so erhöhen, daß der Markt fühlbar für den Verbraucher entlastet würde, dann stünden wir in kurzer Zeit vor dem Nichts. Müßte etwa die Kohle ganz durch Holz ersetzt werden, so müßte innerhalb drei bis vier Jahren der gesamte Holzvorrat unsrer sämtlichen Wälder in den Ofen wandern! Das ist zwar technisch gar nicht durchführbar, aber die Rechnung zeigt deutlich die Größe der Gefahr!
Wenn wir überhaupt Volkswirtschaft treiben wollen, dann dürfen wir unter keinen Umständen davon abgehen, daß nicht mehr Holz jährlich genutzt wird, als zuwachsen kann. Sonst zehren wir vom Kapital, und dessen Ertrag wird von Jahr zu Jahr geringer, während unser Bedarf doch steigt und immer steigen wird. Und die Hoffnung, etwaige Übernutzungen in späteren glücklichen Zeiten durch erhöhte Einfuhr ausgleichen zu können, steht auf recht schwachen Füßen. Denn die Vorräte der Holzüberschußländer schwinden ungeheuer zusammen.
Unsre Wälder sind eben nicht so unerschöpflich, wie wir gern glauben möchten, und das Holz wächst nicht so rasch und nicht so »ganz von selbst«, wie dies die meisten noch immer annehmen. Wer denkt denn daran, daß eine Tanne hundert bis hundertundzwanzig Jahre alt werden muß, bis sie gutes Nutzholz liefert, daß selbst die schwächeren Papier- oder Grubenhölzer, ja auch das Brennholz, im allgemeinen mindestens fünfzig bis achtzig Jahre lang heranwachsen müssen? Und wenn man Waldbestände vorzeitig, in ihrer besten Leistungsfähigkeit, dem Holzhunger zum Opfer bringt, wenn man hochwertige Nutzhölzer kurzerhand im Ofen verbrennt, wer denkt dabei daran, welch unermeßliche Werte dadurch verloren gehen, nicht dem Geldbeutel des Waldbesitzers, sondern dem gesamten Volksvermögen?
Und die bange Sorge erhebt sich, die heute jeden, nicht mehr den Fachmann allein, angeht: Wie werden unsere Wälder in wenigen Jahrzehnten aussehen, wenn die Ansprüche von allen Seiten so weitergehen, so rücksichtslos Erfüllung heischen? Werden wieder wie in früheren Jahrhunderten nach Zeiten der Not und Teuerung Heide und Moor sich recken und die verwüsteten Waldflächen für sich beanspruchen? Wird es unserer Forstwirtschaft gelingen, all den maßlosen Anforderungen einigermaßen gerecht zu werden und das Schlimmste zu verhüten? Und wenn dies gelingt, wie wird es mit der natürlichen Schönheit des deutschen Waldes stehen,[80] des viel verherrlichten, viel gepriesenen Waldes? Wird das dann überhaupt noch Wald sein, oder werden wir nur Holzäcker und Balkenfelder zu sehen bekommen, endlose, haarscharf ausgerichtete Reihen reiner Kiefern und Fichten, deren es heute schon übergenug gibt, zum Schauder aller Natur- und Heimatfreunde?
Ein kurzer Rückblick wird die Antwort erleichtern: Solange die Bevölkerung noch schwach, Industrie und Handel wenig entwickelt waren, brauchte niemand in Deutschland an Holz zu sparen. Der Wald gab, was man brauchte, aus dem Vollen. Erst allmählich im Verlauf der letzten Jahrhunderte, als Kriegslasten und Ausfuhrhandel in bisher unerhörtem Maße die Wälder gelichtet hatten, als die Übergriffe der großenteils ganz auf Kosten des Waldes betriebenen Ausbreitung der Landwirtschaft sein Wiederaufkommen fast unmöglich machten, fing man an einzusehen, wohin die Sorglosigkeit führte. Aus der Not heraus begannen die Anfänge einer Forstwirtschaft zu erstehen, der wiederum sich bald eine Forstwissenschaft zur Seite stellte. Die vielerorts noch bis ins neunzehnte Jahrhundert herein erschreckend verwüsteten Waldungen wurden künstlich ergänzt, die Nutzung nach bestimmten Plänen geregelt. Die neue Erkenntnis, daß man auch die Waldnatur meistern könne, führte, wie immer und überall im Leben, alsbald zur Überschätzung dieser Möglichkeiten. Auf ein Jahrhundert hinaus glaubte man, dem einzelnen Bestand genau vorschreiben zu können, wie er zu wachsen, und wann er erntereif zu sein hätte. Ein geradlinig abgegrenztes Stück des Waldes nach dem andern wurde völlig kahl geschlagen und nachher wieder angesät oder ausgepflanzt, wobei reine, nur aus einer einzigen Holzart bestehende und in sich gleichalte Bestände das Ziel wurden, genau nach dem Vorbild der Landwirtschaft. Das Verfahren hatte gegenüber der alten Raubwirtschaft zweifellos die Vorzüge der Übersichtlichkeit, der leichten Nutzungsregelung und Überwachung. Von Nachteilen aber war zunächst nichts zu spüren; diese traten erst spät und allmählich in Erscheinung.
Zuerst mußte man die Wahrnehmung machen, daß diese gleichförmigen Bestände sehr wenig widerstandsfähig waren gegen Gefahren aller Art, wie sie durch Sturm, Feuer, Schnee, Insekten u. a. bedingt werden. Die Mahnrufe einzelner, die den gemischten Bestand, den mehr naturgemäßen Wald forderten, wurden wieder gehört. Aber zum Durchbruch kam diese Richtung doch erst in jüngster Zeit, als noch der zweite, weit folgenschwerere Nachteil offenkundig wurde: die Verschlechterung des Bodenzustands und damit das Nachlassen der Erzeugungskraft.
Der Ackerboden wird Jahr für Jahr umgepflügt und dadurch auf die ganze Wurzeltiefe durchlüftet, dazu durch Düngung bereichert und durch planmäßigen Fruchtwechsel leistungsfähig erhalten. All das ist im Walde nicht in gleicher Weise möglich und muß daher anderswie erreicht werden. Gewiß sind die Bedürfnisse der Waldbäume bescheidener als die der Feldgewächse, gewiß ist der Wald ein selbständiger Organismus, der sich im großen Ganzen als natürliche Pflanzenformation, im Gegensatz zum Feld, aus sich selber heraus forterhalten kann. Aber wenn wir gewaltsam in seinen Lebensgang eingreifen, seine Lebensverhältnisse künstlich verändern, wie wir das in der steigenden Nutzung tun und noch viel[81] mehr tun müssen, um seine Ertragsfähigkeit zu steigern – dann müssen wir unbedingt auch die Grundlagen seines Gedeihens in unsere Obhut nehmen und dürfen nicht einfach zusehen, wie und was etwa »von selber wächst«.
Und damit kommen wir zum Kernpunkt unserer Frage, nach dem Aussehen des künftigen Waldes. Wenn wir den Ertrag unserer Wälder steigern wollen – und wir müssen das um rund ein Drittel erreichen! – so ist das nur möglich durch sorgfältig verfeinerte Wirtschaft, die den Wald nicht mit den Augen des Mathematikers oder Finanzmannes als toten Stoff ansieht, vielmehr in ihm ein lebendes Wesen anerkennt, dessen Ansprüchen und dessen von Ort zu Ort wechselnden Bedürfnissen sie ins einzelne nachgeht, um ihnen jeweils die günstigsten Bedingungen zu schaffen. Alle die Forderungen, die heute einmütig von den Vertretern der Wissenschaft und der Wirtschaft erhoben werden, wie Bodenpflege, Bestandsmischung, möglichste Naturverjüngung, d. h. Selbsterneuerung der Bestände aus Samen unter Ausschluß minderwertiger Rassen, haben eine gemeinsame Voraussetzung. Das ist die Abkehr vom Großkahlschlag, von jeder künstlichen, das gesunde Wachstum schädigenden Zwangsjacke!
Damit ist aber für das Aussehen unserer Heimat alles gewonnen, was überhaupt gewonnen werden kann. Die rücksichtslos das Gelände zerreißenden Kahlschläge, die schnurgeraden, trostlos öden Balkenfelder ohne Leben und Abwechslung, das an Ausrottung grenzende Zurückdrängen so mancher schöner, eng mit der Heimat verbundener Baumarten, all die mancherlei Vergewaltigungen der Natur, die das Gefühl freien, unberührten Waltens nicht mehr aufkommen ließen, sie sollen alle der Vergangenheit angehören? Die Forderungen höchster Wirtschaftlichkeit und Wahrung natürlicher Schönheit, die so oft scharf aufeinanderprallen, im Wald einmütig auf dem gleichen Wege, nach dem gleichen Ziel? Ist das nicht ein heller Lichtstrahl in trübster Zeit für jeden Freund der Heimat?
Auf die technische Seite dieser Grundforderungen näher einzugehen, ist hier nicht der Platz, aber wie sie sich in unserm Sinne für das Aussehen des Waldes auswirken, soll an einigen Beispielen angedeutet werden. Bodenpflege bedeutet die Aufgabe, dem Boden die Eigenschaften eines guten Waldbodens zu erhalten oder neu zu schaffen, ihn nicht zum Heide-, Grasland- oder Moorboden werden zu lassen. Er soll bedeckt bleiben, geschützt durch das Kronendach der Bäume und, wo das zu hoch oben oder nicht dicht genug ist, durch Unterwuchs. Die jährlichen Abfälle der Vegetation müssen ihm erhalten werden, soweit sie sich zu gutem Humus zersetzen können, denn dies ist die Voraussetzung zur Erhaltung des nötigen Kleinlebens im Boden (Edaphon), ohne das kein Gedeihen möglich ist. Also darf diese »Bodenstreu« nur in den Ausnahmefällen entfernt werden, in denen sie sich nicht zersetzen kann und dem Wald eher schadet als nützt. Die Laubstreu muß dem Walde belassen werden, wenn sein Ertrag nicht zurückgehen soll. Ständig ausgerechte Wälder verarmen unter unseren Augen, die Bodenflora verschwindet und mit ihr alles Kleintierleben. Der Boden wird fest und verdichtet, der ganze Wald verödet. – Daß gemischte Bestände mehr Abwechslung bieten als die öden Gassen reiner Kiefern- oder Fichtenstangen, das bedarf keiner näheren Ausführung. Die beiden genannten Bäume werden nach wie vor unsere wichtigsten Holzerzeuger[82] bleiben; aber die Mischung mit Laubholz, vor allem mit Buche, die heute aus rein technischen Rücksichten zur Steigerung der Erzeugung erstrebt wird, ist gleichzeitig auch rein landschaftlich hochwillkommen. Sorgfältige Bestandspflege, die fortgesetzt die gutveranlagten, zuwachsreichsten Stämme begünstigt, schafft dem Auge erfreulichere Bilder als die Massenanzucht des Mittelmäßigen. Die Begünstigung der Naturverjüngung verlangt das Herausarbeiten schöner Baumkronen, die blühen und fruchten können, unbehindert von Nachbarn, und das »Überhalten« geeigneter Bäume (besonders Kiefern) zur nachträglichen Ergänzung der Bestockung. Der üble Eindruck roher Holzschlächterei kann nicht entstehen, wo der Boden schon von jungem Nachwuchs bedeckt ist, dem das Herausholen des alten Holzes Raum gibt zur Entfaltung.
Freilich von heute auf morgen kann das alles nicht zur Tat werden. Bei dem langsamen Wachstum der Bäume braucht es lange Zeit. Wir dürfen auch nicht übersehen, daß vielfach durch ungünstige Verhältnisse eine waldschädliche Waldbehandlung geradezu erzwungen wird. Da ist einmal der Mangel an geschulten Kräften, nicht bloß an Wirtschaftern, sondern mehr noch an Holzhauern und Holzfuhrleuten, und was noch schlimmer ist, der Mangel an lernwilligen Kräften. Wird das Holz durch Bequemlichkeit und Unfähigkeit des Holzhauers so geworfen, daß die Stämme beim Fallen oder beim Herausbringen an die Wege den vorhandenen Jungwuchs zerstören müssen, so ist die Mühe vieler Jahre und Jahrzehnte umsonst.
Aber die größte Gefahr ist die, daß alle Einsicht und Absicht gar nicht verwirklicht werden kann, daß alle Mühe und Sorge der Wirtschafter durchkreuzt wird durch den unwiderstehlichen Zwang äußerer Not oder durch kurzsichtige Rücksichten innerpolitischer Art, sei’s gegenüber der am Lebensmark des Waldes zehrenden landwirtschaftlichen Bevölkerung, sei’s gegenüber den brennholzheischenden Massen der Städter. Die Erkenntnis, um was es geht in den nächsten Jahren, muß die weitesten Kreise durchdringen. Nicht »nur« die Schönheit unserer Wälder steht auf dem Spiel, nicht »nur« das natürliche Aussehen des Teiles unsrer Heimat, der den allermeisten Volksgenossen noch den einzigen Zusammenhang mit der Kraft des Mutterbodens verleiht, nein, um viel mehr noch wird es gehen, um das Fortbestehen der Wälder überhaupt, um die Frage, ob Deutschland die in seinem Waldboden steckenden Kräfte erhalten kann, oder ob es der gleichen Waldverödung anheimfallen soll, wie längst schon die Länder seiner westlichen Nachbarn und die Länder am Mittelmeer.
[1] Wir entnehmen diese sehr beachtenswerten Ausführungen, mit Erlaubnis des Verlags dem »Kosmos«, Heft 2, 1923 (Franckesche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart).

[83]
von Paul Apitzsch, Ölsnitz i. V.
(Aus dem bei Franz Neupert, Plauen, im Herbst erscheinenden südvogtländischen Wanderbuche: »Wo auf hohen Tannenspitzen«)
Ein moderner österreichischer Schriftsteller, Arman Reis, stellt die Behauptung auf, daß »der Gegenwartsmensch in der Länderkunde der reine Gehirnathlet sei und daß er das Ungesehene und Unbegriffene kübelweis seinem Gedächtnisse einverleibe«. Und in der Kenntnis der Heimat, füge ich hinzu, krankt er an chronischer Überbescheidenheit, so daß er die Hydrographie und Topographie Afghanistans, die Zoologie und Mineralogie Belutschistans besser kennt als die pflanzlichen und tierischen Lebewesen des Straßengrabens, der an seinem Hause vorüberführt. Es wird höchste Zeit, daß eine starke und allem Anschein nach erfolgreiche und nachhaltige literarische und pädagogische Strömung heranbraust, um die Überschätzung fremder und die Unterschätzung heimischer Natur, Kultur und Kunst in gesunde Bahnen zu leiten. Mag das Auge sich weiden am Firnglanze des Hochgebirges. Es soll sich auch freuen können beim Anblicke der bescheidenen Waldkuppen des deutschen Mittelgebirges. Mag das Ohr sich berauschen am Branden der Adria. Es soll auch Gefallen finden am murmelnden Bächlein des Heimatwaldes. Mag der Mund preisen die stolzen steinernen Zeugen der vergangenen Kultur Italiens. Er soll auch Worte finden zum Ruhme der Schönheit heimischer Kunstwerke und Kulturwerte. Und sie ist so schön, die Heimatscholle. Nicht nur in ihren Glanzstücken und anerkannten Sehenswürdigkeiten. Auch in ihren abseits gelegenen und unbeachtet schlummernden Einzelheiten und Kleinigkeiten.
Vom Hohen Kreuz, südwestlich der Teppichstadt Ölsnitz, senkt sich die nach Bayern führende Staatsstraße hinunter zum Schwarzen Teich. Jenseits desselben steigt sie mählich zum Walde empor. Da, wo der Wald zur Linken aufhört, steige ich, die Straße hinter mir lassend, den schwach geneigten Abhang hinauf. Aus dem gebänderten cambrischen Tonschiefer erheben sich zwei Diabaskuppen, die auf der geologischen Generalstabskarte Sektion Bobenneukirchen–Gattendorf die Höhenbezeichnungen 535,4 und 534,2 tragen. Erstere nenne ich meinen Wacholderhübel, letztere meinen Quarzhübel. Ich pflege Punkte, die ich auf einsamen Wanderungen öfter besuche, zu benennen. Es brauchen dies nicht immer Namen zu sein, die, wie hier, ein charakteristisches Merkmal der betreffenden Erdstelle zum Ausdruck bringen. Sie sind mitunter entstanden in Anlehnung an kleine, völlig unbedeutende, rein persönliche Erlebnisse und Erinnerungen. Und so habe ich denn, außer den allgemein bekannten und von alters her festgelegten geographischen Ortsbezeichnungen, eine Sammlung eigner Benennungen, die keine Karte kündet, kein menschliches Wesen außer mir kennt.
Also Wacholderhübel. Eine einsame Heidekuppe. Kaum merklich gewölbt, tragen Höhe und Hang vereinzelte Kiefern und Birken. Einen geschlossenen Waldbestand zu ernähren, würde der kärgliche Boden wohl schwerlich imstande sein. Das überaus langsame Wachstum der wenigen Holzgewächse ist eine natürliche Folge des Steinreichtums, der dünnen Humuskruste und der Nahrungsarmut des[84] Untergrundes. Kiefern und Birken wachsen mehr in die Breite als in die Höhe. Die ungeschützte Lage und der rauhe Nordwind haben ihnen gelehrt, bescheiden in ihrem Streben nach oben zu sein. In ihren Ansprüchen hingegen läßt die Birke die Bescheidenheit völlig missen. Sie saugt den an und für sich dürren Boden derart aus, daß eine junge Nadelholzanpflanzung, die von Birken durchsetzt ist, an Wassermangel leidet und schließlich schonungslos zu Grunde gehen muß. –
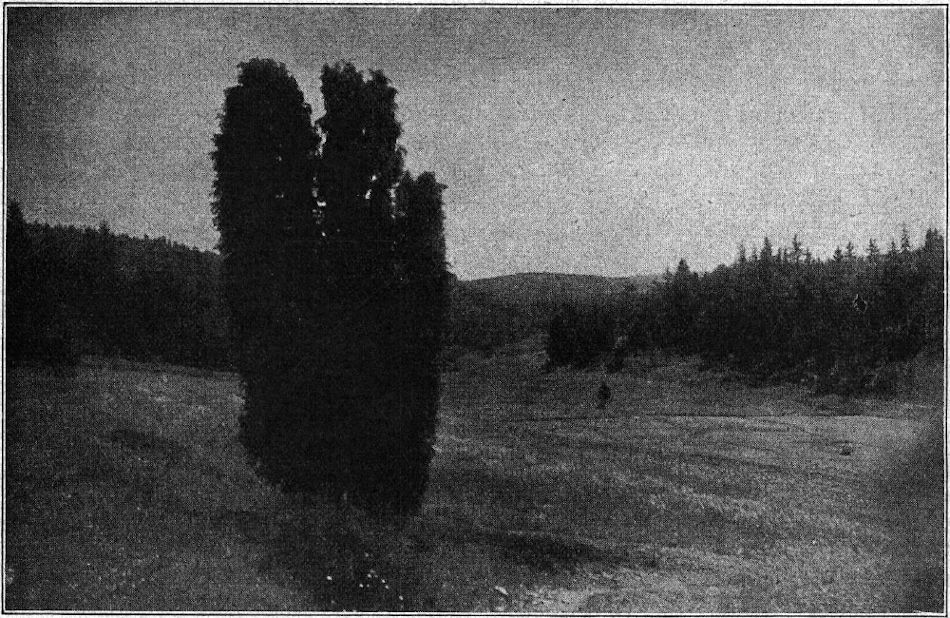
Die weiße Birke und die weiße Taube: Symbole der bedrängten und bescheidenen Unschuld. So schön beide Vergleiche klingen, so falsch sind sie; und ihre immer wiederkehrende Anwendung in Poesie und Prosa zeugt von wenig Naturbeobachtung. Es gibt kaum ein unverträglicheres, selbstsüchtigeres, liebloseres Geschöpf als das »unschuldige Täubchen«. Und im Unschuldskleide der keuschen Birke verbirgt sich der krasseste Egoismus eines rücksichtslosen Räubers und Mörders.
Wacholderhübel. Schwarzes Gestein steht an. Vor Jahren mögen hier Steine gebrochen worden sein. Genau auf dem Gipfel des Hügels ist so ein Bruchloch beständig mit Wasser gefüllt. Buntbauchige Kammolche beleben an sonnigen Vorfrühlingstagen den Tümpel. Eines der vielen Naturrätsel, wie diese typischen Wassertiere hier heraufgekommen sein mögen. Kätzchen von Salweiden[85] treiben auf der unbewegten kleinen Wasserfläche. Keck wippt eine Bachstelze auf dem einzigen inselartig herausragenden Felsblock. Im Sommer wuchert weißer Hahnenfuß an den Rändern. Das dunkle Gestein ringsum ist mit zierlichen Becherflechten und dünnwebigen Flechtenflecken besät. Und rundherum hochstämmige Wacholderbüsche. Aus dem Gewirr von Heidekraut und Brombeergerank, aus dem Teppich von Preiselbeerlaub und Katzenpfötchengefilz recken zwei bis drei Meter hohe, ernste Wacholderbäumchen kerzengerade empor. Sie schauen weit hinaus ins Waldland.

Ich liebe ihn, den kraftvollen, wetterharten Wacholder. Nicht das Ruppige und Struppige, nicht das Stachelige und Widerspenstige, nicht das Düstere und Unheimliche seines Wesens ist es, was mir ihn wert macht, sondern seine Anspruchslosigkeit, seine eiserne Zähigkeit, sein stolzes Selbstbewußtsein im Vertrauen auf ureigene Kraft. Er verschmäht es, Schutz zu suchen unter dem tiefhängenden Kieferngeäst. Verächtlich schaut er auf das niedere Pflanzengewirr, das hilfeheischend dort unterkriecht. Nur vor den beiden gleich wetterfesten Genossen draußen am Feldrande, vor Schlehdorn und Wildrose, hat er Achtung. Und noch höher steht der Wacholder als beide. Denn Schlehdorn und Heckenrose wachsen in Gruppen und Sippen beieinander, nicht allein der lieben Geselligkeit willen, sondern[86] um gemeinsam den Unbilden und Fährnissen entgegentreten zu können, während der Wacholder auch dieses Hilfsmittel von sich weist. Er ist das Sinnbild des starren, zähen, unbeugsamen Selbstbewußtseins; und auch das Symbol der hastlosen, besonnenen Entwicklung. Während jede andre Pflanze den Zeitraum vom Frühling bis zum beginnenden Winter benötigt, um die Früchte zur Reife zu bringen, braucht der Wacholder zwei Jahre dazu. Im ersten grünt, im zweiten bläut er sie. Ebenso bedächtig ist er im Wachstum. Die kaum fingerstarken Stämmchen guckten schon übers Heidekraut, als die jetzt manneshohen Fichten geboren wurden. Diese Wacholderbäumchen kommen mir immer vor wie die Liliputaner, jene kleinen Menschen mit den alten Gesichtern, die mit klugen Augen und feinspöttischer Überlegenheit den Dünkel der größeren Menschen belächeln.
Im Preiselbeergeäst des Waldbodens sind zahllose Spinnengewebe ausgespannt. Ich beuge mich nieder und betrachte so ein wagerecht gehängtes Fangnetz. Drinnen liegt ein dicker Tautropfen. Mit unheimlicher Schwere zieht die quecksilberne Kugel nach unten. Jeden Augenblick kann die Katastrophe eintreten. Klopfenden Herzens hockt der kleine Textilarbeiter am Rande und harrt des Zusammenbruchs seines kunstvollen Gewebes. Jetzt schießt ein Sonnenstrahl heran und läßt den gefangenen Tropfen in allen Regenbogenfarben erglühen. Aber das Spinnlein hat keinen Sinn für Romantik und schwärmt nicht für Rückert und Robert Schumann, deren Ritornell
es völlig kalt lassen würde; denn es ist ihm schließlich gleichgültig, ob der dicke Tautropfen als graue Perle oder als roter Rubin das Netz durchbricht.
Über den schmalen Heidepfad hastet ein prachtvoller Carabus. Der glänzende Leib dieses Goldlaufkäfers will mit seinem exotischen Gefunkel gar nicht in das Ewiggrau des deutschen Heidebodens passen. In seinem raschen Laufe bemerkt er nicht, wie sein Vetter, der stahlblaue Roßkäfer, sich um eine eiförmige Pille Hasenlosung bemüht, die auf dem Heidewege liegt. Die unästhetischen Menschen nennen ihn verächtlich »Mistkäfer« und vergessen ganz und gar, daß er, in Gemeinschaft mit Totengräber und Ameise, die Sanitätskolonne des Waldes verkörpert. Da steht doch der ungebildete Beduine der marokkanischen Wüste kulturell höher als der dünkelhafte Europäer. Der Sohn der Sahara zollt einem nahen Verwandten des Mistkäfers, dem pillendrehenden heiligen Skarabäus göttliche Verehrung. Trotz der hohen Verwandtschaft und ungeachtet des prächtigen Kleides erfreut sich der Mistkäfer keiner bedeutenden Hochachtung. Denn einmal umgibt er sich als Mitglied der Düngerabfuhrgesellschaft mit wunderbarem Parfüm, und zum andern wird die haarige Unterseite seines Leibes von kleinen, grauen Parasiten bewohnt. Also in jeder Beziehung ein sogenannter »netter Käfer«. –
Ein auffliegender Trauermantel hebt unsern Blick aus der schwülen Atmosphäre der Erdnähe in die unbegrenzte Höhe des Äthers. Das Auge ist geblendet und[87] muß erst, nachdem es die winzige Kleinwelt des Waldbodens aus kürzester Entfernung beobachtete, auf das weite Gesichtsfeld eingestellt werden. Es ist eine wundersame Eigenschaft des menschlichen Auges, daß es befähigt ist, urplötzlich den Übergang vom Sehen in die Nähe zum Schauen in die Ferne und umgekehrt herzustellen. Die einzige Unvollkommenheit des Sehorgans, die Begrenztheit des Gesichtsfeldes, hat menschliche Denkkraft durch Erfindung der vergrößernden Linse zu mindern gesucht. Mikroskop und Teleskop geben die Möglichkeit, die Zwerggestalten der Nähe zu erforschen, die Riesengebilde der Ferne zu bewundern.
Ich starre ins Weite. Waldwelle hebt sich über Waldwelle. Waldkuppe reiht sich an Waldkuppe. Und da packt sie mich doch, die Sehnsucht nach der weiten Welt. Ich sträube mich vergebens. Ich bin nicht wert, ein Verkünder heimischer Schönheit zu sein. Hinter den Waldbergen gegen Süden schaue ich ferne Schneehäupter und sehe Pinien und Zypressen an blauen Seegestaden.
War die Betrachtung der nahen Umwelt zufriedenes Genießen, so löst der Blick in die Ferne qualvolles Sehnen aus. Glücklich der Mensch, der wunschlos in die Weite zu schauen vermag. Beneidenswert nennen ihn die einen – bedauernswert die andern. Sonnenfrohe, zufriedene Alltagskinder, der lichten, leichtblättrigen Birke vergleichbar. Schwerblütige Grübler und Träumer, Wacholdernaturen, tiefwurzelnd im Mutterland und doch behutsam tastend zur Höhe strebend. Eng beieinander wohnen so wesensfremde Menschen. Und so steht auch neben dem düstern Wacholderhübel mit seinem dunklen Gestein und seinen an Friedhofszypressen gemahnenden Wacholderpyramiden ein lichter, freundlicher Gesell: mein Quarzhübel. Blendendweißes Gestein steht an. Hier beginnt im Kambrium ein merkwürdiger Quarzzug, der sich in einer Breite von wenigen Metern und in einer Länge von 2,4 Kilometern in genau nordsüdlicher Richtung hinzieht. Der Quarzgang ist nicht leicht zu verfolgen, da dichte Walderde ihn deckt. Nur wo gerodet worden ist, liegen zu tausenden die hellen Kiesel wie bleichendes Gebein. –
Drunten im Tal hebt das Feierabendglöcklein an zu klingen. Über den Waldkämmen des Haselrainer Platzerberges und des Bobenneukirchner Pfaffenberges liegt mattgolden der Schimmer des scheidenden Tages.
Und drüben auf meinem Wacholderhübel schluchzt liebesselig eine Amsel ihr Abendlied.
Von Bernhard Hoffmann
Die freundlichen Leser und vielleicht mehr noch die Leserinnen dieser Zeilen werden von vornherein gespannt sein zu erfahren, wer die »höchsten Herrschaften« von Dresden sind und wo sie wohnen. Es sind nicht etwa die »höchsten Herrschaften« im alten Sinne, denn die gibt es auf Grund des allerhöchsten Volkswillens[88] heute nicht mehr. Auch diejenigen, welche jetzt die höchsten Stellen bekleiden, sind nicht gemeint. Man könnte ferner an den Kreuztürmer und seine Familie denken, aber man ist da ebenfalls auf dem Holzwege. Vielmehr handelt es sich um ein Ehepaar, das von auswärts, und zwar wahrscheinlich von sehr weit her – möglicherweise gar aus dem Auslande – zugezogen ist und sich inmitten der Altstadt niedergelassen hat, ohne erst beim Wohnungsamt um Zuweisung der entsprechenden Räumlichkeiten nachzusuchen. Das soll ja auch sonst manchmal vorkommen. Aber das Unerhörteste dabei ist, daß sich das betreffende Ehepaar dem Wohnungsamt auf – oder besser über die Nase gesetzt hat, so daß es sich tagaus tagein in geradezu herausfordernder Weise den Herren des Wohnungsamtes vorstellt und »von oben herab« auf sie niederblickt. Dabei genießt das Paar die herrlichste, schönste Fernsicht; es ist dem Lärm, Staub und Ruß der Stadt entrückt, badet sich alltäglich im klarsten Sonnenschein oder im reinsten Regenwasser, und für alles das zahlt es weder Steuern noch Abgaben! Ja, das Ehepaar hat sich sogar bald nach seiner Ankunft eine Wochenstube eingerichtet, in der nach der üblichen Zeit – es ist kaum zu glauben – Fünflinge zur Welt gekommen sind. Doch da habe ich schon recht vertrauliche Dinge berührt. Deshalb ist es wohl an der Zeit, daß ich Namen und Wohnung der höchsten Herrschaften verrate. Es handelt sich um ein Ehepaar namens Turmfalk, welches in der Höhe des neunten Stockwerks vom Rathausturm – d. h. etwas über fünfzig Meter vom Erdboden entfernt – eine, wenn auch bescheidene Wohnung bezogen hat, wobei es dem Kreuztürmer tatsächlich noch um ein beträchtliches Stück »über« ist. Schon Anfang März stellte ich Turmfalkens Ankunft fest. Obgleich ich sonst höheren und höchsten Herrschaften gegenüber immer eine gewisse Zurückhaltung gewahrt habe, verlangte ich diesmal doch nach einer näheren Bekanntschaft, natürlich nicht eher, als bis ich annehmen konnte, daß das Paar hier seßhaft geworden war. Das dauerte allerdings ziemlich lange, so daß ich erst Anfang Mai einen Besuch wagte. Zunächst galt es, die Wohnung von Turmfalkens aufzufinden, da eine polizeiliche Meldung bisher nicht erfolgt war. Ich vermutete die Wohnung schließlich in einer, meinen Blicken leider nur äußerst wenig zugänglichen Vertiefung zwischen den Unterbauten eines mächtigen Säulenpaares an der Wetterseite des Turms. Und richtig! Als ich mich zwischen einer Brüstung und der Turmmauer etwas emporgearbeitet hatte und den Kopf ein wenig hinter die eine Säule zu schieben suchte, strich Frau Turmfalk, die ich sofort an dem Fehlen des Aschgrau in der Farbe ihres Kleides erkannte, höchst ungehalten ab. Ihrem Ärger gab sie durch verschiedene Scheltrufe unverhohlenen Ausdruck. Ich vernahm von h3 an stark hinaufgezogene wriiiiii und kurze, in der Höhenlage wechselnde kjig, kjig, oder kig usw. Im ganzen bewegten sich diese Rufe zwischen gis3 und e4. Wohl wagte Frau Turmfalk einmal, in ihr Heim zurückzukehren, aber eine geringe Bewegung meinerseits verscheuchte sie sofort wieder, so daß ich selbstverständlicherweise »nicht weiter stören« wollte und den Rückzug antrat. Nur über ihren Verbleib wollte ich vorher noch Gewißheit haben. Ich entdeckte sie schließlich mit dem Glase drüben auf dem Kreuzturm, hoch oben auf der stark gewölbten Steinkuppel, welche die metallne Turmspitze trägt. Hier saß sie nicht weit von ihrem Herrn Gemahl, den meine[89] Aufdringlichkeit und die Erregung seiner Gattin völlig gleichgültig zu lassen schien. In seiner Nähe sah ich auf den Steinen zahllose weiße und grauweiße abwärts verlaufende Streifen; es waren die Kotüberreste des Turmfalkenpaares, das da drüben – naturalia non sunt turpia – seinen Abort angelegt hatte; er entbehrte sogar der Spüleinrichtung nicht, die allerdings nur bei Regengüssen in Tätigkeit trat. Der Abort war zwar von der eigentlichen Wohnung recht weit entfernt; aber einmal kommt das auch in den Behausungen der Menschen – besonders auf dem Lande – vor, und zweitens war diese Entfernung für Turmfalkens ja nur ein – Katzensprung!
Als ich am elften Mai meinen Besuch wiederholte, flog das Weibchen abermals sofort laut schreiend ab, diesmal weit über Friedrichstadt hinaus. Ich benutzte die Gelegenheit, die Wohnung von Turmfalkens soweit als möglich in Augenschein zu nehmen. Leider gelang mir das, da der Spalt zwischen Mauerwerk und Säule nur ungefähr elf Zentimeter breit war, sehr wenig. Doch konnte ich feststellen, daß die ganze Wohnung aus einem einzigen, langgestreckt-rechteckigen, vorn und oben offenen Raum zwischen den Sockeln des schon erwähnten Säulenpaares bestand; solch bescheidene Verhältnisse sind ja in Anbetracht der jetzigen allgemeinen Wohnungsnot leicht verständlich. Bei ihrer Rückkehr landete Frau Turmfalk an der bewußten Stelle des Kreuzturms in »seiner« Nähe. Sie hatte sich von draußen ein zweites Frühstück, wahrscheinlich eine Feldmaus, mitgebracht und verzehrte sie nun auf ihrem hohen Sitz, indem sie die Beute mit den Krallen festhielt und ab und zu ein Stück davon losriß. Der Raum zwischen den bewußten zwei Säulensockeln war demnach nur Wohn-, nicht aber auch Speisezimmer. Freilich allzustreng war die geschilderte Trennung nicht durchgeführt. In einer Ecke des »Wohnzimmers« bemerkte ich eine Anzahl vorwiegend grau gefärbter, länglich ovaler Gebilde von ungefähr zweieinhalb Zentimeter Länge und reichlich ein Zentimeter Breite, sogenannte »Gewölle«, die im Magen der Vögel aus unverdaulichen Teilen der aufgenommenen Nahrung gebildet und durch Speiseröhre und Schnabel wieder ausgespien worden waren. Bei näherer Untersuchung einiger Gewölle fand ich, daß sie zum größten Teil aus Mäusehaaren bestanden, deren Abstammung außerdem durch einen darin steckenden sehr kleinen Nagezahn erwiesen wurde. Doch ergab sich leider, daß auch sehr zarte und ein paar derbere Federchen, ja sogar unter anderem ein Unterschenkelknochen eines kleinen Singvogels in den Gewöllen enthalten waren, was meiner freundschaftlichen Gesinnung gegen Turmfalkens einen starken Stoß gab; sie »wilderten« gelegentlich, statt nur ihres Amtes als »Flurschützen« zu walten! Bald stellte sich eins von Turmfalkens in ihrem Heim wieder ein. Höchst vorsichtig schlich ich nochmals heran und hatte diesmal das Glück, den unteren Teil des Obergewandes in fast greifbarer Entfernung zu sehen, wobei ich bestätigt fand, daß ich auch diesmal Frau Turmfalk vor mir hatte. Alles andre blieb mir leider verborgen. Beim Fortgehen wollte mir deshalb keine volle Befriedigung kommen. Wenn zum Beispiel Frau Turmfalk schon die Wiege für ihre Kinder hergerichtet oder gar bereits für Zuwachs gesorgt hätte? Wie sollte ich das sicher feststellen? – Ich hätte ja wohl etwas weiter emporklettern können, um so einen tieferen Einblick in Turmfalkens Wohnung zu bekommen. Aber einmal war das bei der gewaltigen Höhe, in der die Wohnung lag, doch recht gefährlich,[90] und dann hätte man meine Kletterei von unten aus bemerken und mich für einen, der Selbstmord begehen will, halten können, wozu ich aber nicht die geringste Lust verspürte, da das Leben jetzt so überaus schön ist, daß man nicht ohne weiteres von ihm Abschied nimmt. Es mußte demnach zu obigem Zweck eine ungefährlichere Methode ersonnen werden. Endlich war der Ausweg gefunden. Zu Hause wurde alles sorgfältig vorbereitet, und als ich am siebzehnten Mai zum dritten Male bei Turmfalkens antrat, schob ich einen, an einem schmalen Brettchen sicher befestigten Handspiegel, der um ein Scharnier drehbar und deshalb leicht verstellbar war, zwischen Mauerwerk und Säule hindurch und möglichst weit vor. Groß war jetzt meine Freude, denn Plan und Vorbereitungen erwiesen sich als vorzüglich. Ich erblickte sofort im Spiegel bei geeigneter Stellung desselben die Wiege fürs junge Volk und in ihr zunächst fünf verhältnismäßig große Eier!
Die Wiege bestand aus einem etwas lockeren, flachen Kranz von dünnen Zweigen und Ästchen, die mit der etwas erdigen Unterlage mehr oder weniger verschmolzen waren. Im Innern der Wiege fehlte aber ein wärmendes Federbett vollständig; hingegen bestand der flach muldenförmige Boden wiederum aus erdigen Teilen. Die Eier waren mehr rundlich, statt spitz eiförmig, ungefähr vier Zentimeter lang und drei Zentimeter breit. Sie zeigten eine hell rostbräunliche Färbung mit vielen dunklen Flecken, Schattierungen usw. Hochbeglückt von dem Gesehenen zog ich nach wenig Augenblicken den Spiegel zurück und verbarg mich etwas, um eine baldige Rückkehr von Frau Turmfalk zu ermöglichen. Andernfalls hätte der starke und verhältnismäßig kühle Wind die Eier leicht zu sehr erkalten und die Entwicklung des darin bereits vorhandenen Lebens unterbinden können. Zunächst freilich blieb Frau Turmfalk noch »drüben«, nicht weit von Herrn Turmfalk, der seine Kleidung mit dem Schnabel etwas in Ordnung brachte. Dabei sah ich, daß die schon erwähnten weißgrauen großen Flecken und Streifen auf der steinernen Wölbung in zwei Gruppen zerfielen. Es schien also dort ein Abort für Männer und einer für Frauen eingerichtet zu sein, was mir in den nächsten Augenblicken tatsächlich ad oculos demonstriert wurde. Bald danach kam Frau Turmfalk herüber. Während sie beim Abfliegen mit lautem kikikikikikekeke gescholten hatte, gab sie jetzt ihrer Befriedigung darüber, daß in ihrem Heim kein Einbruch oder Raub stattgefunden hatte, durch einzelne langgezogene und leisere kieg und kiej Ausdruck, so daß ich beruhigt in den Lärm und Strudel der Straßen zurückkehrte.
Da die Eier sicherlich erst nach dem 11. Mai gelegt worden waren und die Brutzeit der Turmfalken ungefähr vier Wochen dauert, war mit einer Veränderung der Lage vor dem 8. oder 9. Juni nicht zu rechnen. Nur auf Augenblicke weilte ich in der Zwischenzeit einmal auf dem Rathausturm, um nachzusehen, ob nicht irgendeine Störung bei Turmfalkens eingetreten war; ich fand aber alles in bester Ordnung. Sonach hätte ich vollauf zufrieden sein können; und doch bewegte mich schon wieder ein neuer Gedanke, ein neuer Wunsch! Wie herrlich wäre es, wenn ich trotz aller Schwierigkeiten von der Wochen- und Kinderstube Turmfalkens ein paar photographische Aufnahmen machen könnte!
Gedacht – getan! Am 8. Juni ging ich zum ersten Male mit meiner Kamera an die Arbeit. Beim Anschleichen konnte ich feststellen, daß Frau Turmfalk[91] auf dem Neste stand und sich langsam im Kreise drehte, was jedenfalls eine Lagenveränderung der Eier zur Folge hatte. Nach Abflug der Alten verriet mir der Spiegel, daß sich sonst nichts besonderes ereignet hatte: Keines der Jungen war ausgeschlüpft. Trotzdem wollte ich schnell noch eine Aufnahme machen, aber mein Apparat war ein wenig zu groß., so daß ich ihn nicht durch die Spalte zwischen Säule und Mauer in eine geeignete Stellung bringen konnte. Ich tröstete mich mit der Hoffnung, daß es vielleicht noch ein paar Tage dauern würde, ehe die Jungen auskämen.
Als ich am 11. Juni höchst erwartungsvoll zu Turmfalkens aufstieg, gab es zunächst einen starken Schreck und meine alte, wohlbegründete Vorstellung von Turmfalkens Verhalten gegenüber ihrer befiederten Mitwelt erhielt einen neuen Stoß. Auf der inneren Ecke des Sockels der zweiten Säule stand Frau Turmfalk und zerfleischte einen kleinen Vogel. Nur ein paar Augenblicke zögerte ich – dann trat ich näher, die Alte verscheuchend. Und nun sah ich auf der erwähnten Ecke die Reste von drei Vögeln liegen! Es waren nur noch die hintersten Rumpfteile und die Beine übrig. Konturfedern fehlten vollständig, so daß an ein Erkennen der Arten aus der Ferne nicht zu denken war. Ich gestehe, daß mir in diesem Augenblicke wenig daran gelegen war; dagegen trieb mich ein aufkommender Gedanke dazu, nachzusehen, was während meiner Abwesenheit vermutlich im Neste geschehen war; und richtig: Es waren zwei Junge ausgekommen, das zweite wahrscheinlich erst kurz vor meinem Eintreffen, da noch die Eischale im Neste lag, die gewöhnlich kurz nach dem Auskriechen der Jungen von den Alten vorsichtshalber aus dem Nest entfernt wird. Die beiden Jungen verlangten heftig, wenn auch mit recht schwacher und heiserer Stimme nach Nahrung, und das bot mir zugleich die Erklärung für die unerhörten Mordtaten der Eltern! Sie wurzelten in der Fürsorge der Alten um die Jungen, deren Hunger zu stillen, oder kurz, deren Erhaltung auch bei den Vögeln ein so starker Naturtrieb ist, daß sie selbst vor dem Schlimmsten nicht zurückschrecken. Ich erwog ferner, daß die so überaus ungünstige kalte und nasse Witterung unter den sonst in Überzahl auftretenden Feldmäusen sehr stark aufgeräumt hatte, daß der oft fette und hohe Stand der Wiesen und Felder die wenigen Feldmäuse ebenso barg wie die Käfer usw., die gleichfalls gern von Turmfalkens verspeist werden. Ja, ich dachte auch daran, daß es gerade jetzt einem Bruchteil des deutschen Volkes ähnlich erging wie Turmfalkens, indem er lediglich aus drückender Not Diebstähle oder vielleicht noch Schlimmeres begeht, um das eigene Leben und das der Kinder zu retten! – Nachdem ich mich auf diese Weise selbst etwas beruhigt hatte, widmete ich meine Aufmerksamkeit den beiden neuen Ankömmlingen, natürlich mit Hilfe des Spiegels. Sie trugen zunächst nur ein schneeweißes Hemdchen, das aus sehr zarten Flaumfedern bestand, von denen die verhältnismäßig großen schwarzen Augen des einen Nestlings auffallend abstachen, während die des andern noch geschlossen waren. Hilflos lagen die Kleinen im Nest neben den übrigen drei Eiern, dazu tobte ein sehr kalter Sturmwind durch das offene »Kinderzimmer«, so daß ich die Rückkehr der fürsorglichen, schützenden und wärmenden Alten nicht länger verzögern wollte und eiligst wegging.
[92]
Zwei Tage später fiel mein erster Blick auf einen auf der bewußten Ecke liegenden, wiederum fast aufgezehrten Vogel; es war allem Anschein nach eine Lerche. Im Nest dagegen gewahrte ich einen dritten Nachkommen. Die zarten, fast tonlosen Stimmen klangen mir wie gjeg und gjej.
Am Sonnabend, dem 16. Juni, fand ich kein Beutetier vor, dafür aber lagen auf dem Boden von Turmfalkens Wohn- beziehungsweise Kinderzimmer zahlreiche Federn, von denen der Sturm mir einige zutrieb. Es waren die Schwanzfedern eines Grünfinken, der sicherlich kurz vorher von den Jungen verspeist worden war. Ihre Zahl war auf vier gestiegen, während das fünfte Ei noch keinerlei Veränderung zeigte.
Montag, den 18. Juni, traf ich zum ersten Male Herrn Turmfalk, der eine graublaue Kopfbedeckung trug, bei seinen Kindern an. Auf der mehrfach erwähnten Sockelecke, die entschieden die Rolle eines Anrichtetisches spielte, lag endlich einmal eine Maus, und zwar eine Waldwühlmaus. Es war ein schönes Stück mit braunrotem Pelz, aber ohne Kopf, der wie mit einem Messer abgeschnitten zu sein schien. Sonst war an dem Tiere nichts geschehen. Das Kleid der jungen Turmfalken war noch schön weiß, der Schnabel ganz hell, die Wachshaut gelb, die Augenlider heugrünlich. Der Hunger schien, dem andauernden Schreien nach, sehr groß zu sein. Es dauerte auch nicht lange, da kam der Alte, der kurz nach meiner Ankunft unter zahlreichen ki…-Rufen (a3–h3) abgestrichen war, zurück, und zwar mit den Resten eines Vogels. Ich hörte noch einige leise gjij und gjäj des Alten; von der Fütterung konnte ich leider nichts sehen. Einige Zeit danach saß das Elternpaar wieder drüben an der bekannten Stelle des Kreuzturms.
Bei meinem nächsten Besuch am 21. Juni traf ich Frau Turmfalk beim Füttern ihrer Jungen an, die schon lebhaft auf sie einstürmten, obgleich sie auf den Beinen noch sehr schwach waren. Vorsichtig gab die Mutter einem jeden die Bissen unter Kreuzung der Schnäbel in die weit aufgesperrten Rachen. Was verfüttert wurde, konnte ich aus meinem Versteck jedoch nicht erkennen. Nach der Fütterung deckte die Alte das junge Volk wieder mit ihrem wärmenden Körper zu, was bei der naßkalten Witterung sehr nötig war. Leider wurde die Alte nach einiger Zeit meiner ansichtig und strich ab, wobei sie jedoch nicht mehr so erregt war wie früher; erst vom Kreuzturm her drangen ein paar ki…-Reihen und wriiii-Rufe an mein Ohr. Auf dem »Anrichtetisch« lag wieder das letzte Überbleibsel eines kleinen Vogels. Dann trat natürlich der Spiegel in Tätigkeit, und da entdeckte ich sofort, daß außer dem Ei nur noch drei junge Turmfalken da waren! Wohin das vierte Junge gekommen war, blieb rätselhaft. Es gab wohl nur zwei Möglichkeiten: entweder war es krank gewesen beziehungsweise verendet und die Alten hatten es dann beseitigt, oder es war, vielleicht als das Jüngste und Schwächste, von den Dohlen, die sich gerade in jenen Tagen viel um den Rathausturm herumtrieben, geraubt worden. Die übrigen drei Kleinen hatten schon wieder Fortschritte gemacht; besonders das eine – wahrscheinlich älteste – sah schon andauernd sehr gespannt zu mir herauf: in dem kleinen Vogelköpfchen war das Bewußtsein beziehungsweise das Erkenntnisvermögen erwacht und der Geist begann seine Tätigkeit.
[93]
Am 25. Juni war wiederum der Vater am Nest. Es beteiligten sich also – wie es sich gehört – beide Eltern an der Aufzucht der Kinder. Von Beute war nichts zu sehen. Die immer grauer gewordenen Flaumfedern waren ebenso wie der ganze Körper stark gewachsen. Vom späteren Obergewand, den sogenannten Konturfedern, ragten nur die Schwanzfedern etwas hervor und zeigten bereits die breite schwarze Binde vor dem schmalen sehr hellen, aber nicht weißen Endsaum. Da das letzte Ei immer noch nicht ausgebrütet war und es außerhalb des Nestes lag, fischte ich es mittels eines an einem langen Stabe befestigten kleinen Pappkästchens, wie sie zum Aufbewahren von kleinen Filmrollen dienen, heraus. Es zeigte keine Spur der Bebrütung. Eiweiß und Dotter waren noch tadellos erhalten und völlig geruchlos; es war also ein sogenanntes Windei, das seinerzeit nicht befruchtet worden war. Die Länge betrug 4,0 Zentimeter, die Breite 3,2 Zentimeter.

Interessant war das Verhalten der jungen Vögel, über die ich weglangen mußte. Sie suchten den Eindringling abzuwehren, indem sie die Schnäbel so weit wie möglich aufsperrten und fauchende Geräusche hören ließen. Ja, sie lehnten sich sogar stark rückwärts und arbeiteten mit hackenden Bewegungen des scharfen Schnabels und mit rasch sich folgendem blitzartigen Vorschnellen der krallenbewaffneten Beine gegen den vermeintlichen Feind. Ich gestehe, daß ich glücklich war, nicht mit der Hand in die Nähe der Jungen gekommen zu sein; sie hätte sicher ein paar tüchtige »Treffer« erhalten. Nachdem die kleine Gesellschaft sich etwas beruhigt hatte, wagte ich eine Aufnahme mittels einer mir freundlichst zur Verfügung gestellten »Icarette« (6×6). Es geschah auf gut Glück, da einmal eine sehr freihändige Augenblicksaufnahme nötig und dabei ein sicheres Einstellen in bezug auf Richtung und Entfernung kaum möglich war. Dazu hing der Himmel voll schwerer, dunkler Wolken. (Siehe Abb. 1.)
[94]
Von den späteren Besuchen, bei denen ich die Jungen in der Regel allein antraf, so daß ich nicht mehr in dem Maße störte wie früher, sei nur noch einiges erwähnt. Am 2. Juli hatte die Natur an dem Hauptkleide schon wieder weiter gearbeitet. Die Schwung-, Eckflügel- und Schulterfedern ragten schon stark aus dem Daunenkleide heraus, nur ihr unterer Teil steckte noch in der Scheide. Während ich den photographischen Apparat zur neuen Aufnahme vorbereitete, kam die Alte und fütterte. Mit der nötigen Zurückhaltung konnte ich wieder schön beobachten, ohne jedoch die Art der Nahrung selbst feststellen zu können. Die Jungen ließen dabei ihre Stimme reichlich hören, die früheren kjej und kjij waren zu kiiiiije geworden (mit etwas sirrender tonlicher Beigabe). Der Apparat erregte später die gespannteste Aufmerksamkeit der Jungen. Sie reckten erstaunt die Hälse und nahmen teilweise auch sofort die bereits erwähnte Verteidigungsstellung ein, doch hatten sie sich in dem Augenblick, in dem ich den Apparat in die richtige Stellung gebracht zu haben glaubte, schon wieder etwas beruhigt. (Leider ist die Aufnahme infolge des sehr trüben, regnerischen Wetters mißlungen.) Am 4. Juli erhielt mein Besuch eine sehr schmerzliche Einleitung. Als ich am Fuße des Turms kurze Zeit wartete, bemerkte ich in einer Ecke des Hofs einen toten jungen Turmfalken, der sicherlich abgestürzt war. Tatsächlich traf ich oben nur noch zwei Jungvögel an, welche je auf einer inneren erhöhten Ecke der Säulensockel saßen. Der dritte mochte wohl eine äußere Ecke erklommen haben und vielleicht beim Herabspringen über den Rand hinabgestolpert sein, waren doch die Jungen auf den Beinen noch sehr unsicher, und irgend etwas zum Anklammern war nicht vorhanden. Auf ihrem erhöhten Sitze konnte ich die zwei Jungvögel durch den gegenüberliegenden Spalt recht gut beobachten. Neue, in der Hauptsache rotbraune Federn waren zum Beispiel auf dem Oberrücken durchgekommen und auf der Unterseite verlief je ein ganz schmaler Federstreifen neben der Mittellinie und von den Seiten des Halses nach den Weichen. Kopf und Unterrücken, Bürzel, Oberschenkel und fast die ganze Unterseite waren ebenso wie die Flügelhäute noch von dichten und auffallend großen Flaumfedern bedeckt, die den Vögeln ein verhältnismäßig recht struppiges Aussehen gaben. Die so sehr starke Entwicklung des Daunenkleides dürfte mit der überaus kalten und nassen Witterung in Verbindung stehen, ist doch die diesjährige Junidurchschnittstemperatur um 4,21° hinter der des Vorjahres zurückgeblieben![3] Ein bescheidener Annäherungsversuch meinerseits ließ besonders den einen fauchenden Jungvogel die schon oben geschilderte Verteidigungsstellung einnehmen und dazu sehr energische wriiiii-, wriiiii-Rufe ausstoßen. Also auch die Stimme hatte Fortschritte gemacht!
Hiernach sammelte ich noch ein paar zum Teil ältere Gewölle, die sich durch ihre Größe als von den Eltern herrührend erwiesen. Sie enthielten neben Mäusehaaren wieder einige Knochenreste, darunter besonders einige Oberschnäbel (Os intermaxillare) von Kleinvögeln, sowie spärliche chitinöse Überbleibsel von einem Lauf- und einem Mistkäfer.
[95]
Am 9. Juli war das Oberkleid der beiden Jungen so weit fertig, daß das graue Hemd nur noch an einer Stelle – nämlich am Unterrücken – heraussah. Nicht ohne Mühe konnte ich ein paar Unterschiede in der Kleidung der Jungen feststellen. Bei dem einen war auf dem Schwanz ein bläulicherer Schein sichtbar als beim andern. Außerdem zeigten seine Wangen einen vom vorderen unteren Augenrand hinter dem Schnabelwinkel schräg nach unten und hinten verlaufenden schwarzen Streifen, der bei dem andern Jungvogel weniger hervortrat. Im übrigen trugen die beiden Geschwister die gleiche Kleidung, und zwar eine ganz ähnliche wie ihre Mutter, wobei daran erinnert sei, daß auch bei uns Menschen die kleinen Knaben oft mädchenhafte Kleider tragen. Sehr interessant war der Charakterunterschied der beiden Jungen. Während das eine sich mehr oder weniger gleichgültig, ja stumpf verhielt, war das andre sehr leicht erregbar; es setzte sich beim geringsten Anlaß zur Wehr und fauchte, als ob es schon ans Leben ginge. Eine photographische Aufnahme ließ es sich dagegen, obschon unter gespanntester Aufmerksamkeit, ruhig gefallen. (Siehe Abb. 2.)
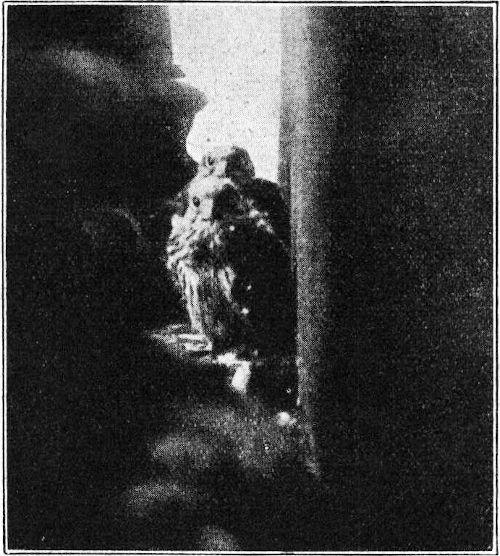
Weitere Beobachtungen verschob ich auf einen späteren Tag, da ich fürchtete, durch allzu starke Beunruhigung die Jungen zu einem zu zeitigen Abflug zu veranlassen, der einen tödlichen Absturz zur Folge haben könnte. Doch hatte ich die Rechnung ohne die beiden Jungen gemacht; denn als ich wiederkam, war das eine schon ausgeflogen und das andre schien auch nicht mehr lange daheim bleiben zu wollen. Ohne daß ich ihm zu nahe getreten wäre, begab es sich bald nach einer vorspringenden Ecke eines der Säulensockel, wohin ich ihm nicht einmal mittels des Spiegels folgen konnte.
So setzte es meinen Beobachtungen ein Ziel und es wäre eigentlich nichts weiter zu berichten, wenn der fast völlig erwachsene letzte Sproß von Turmfalkens[96] mir nicht noch ein paar ansteigende dsiririririririri wie zum Abschied zugerufen hätte, als wolle er damit zugleich kundtun, daß er nunmehr die Sprache seiner Eltern völlig beherrsche und fähig sei, an ihrer Seite ins Leben hinauszutreten.
In der Tat hatte er bei meinem letzten Besuch den ersten Schritt in die weite Welt gewagt. Er saß drüben allein auf dem Kreuzturm an einer andern Stelle, als die Eltern für gewöhnlich einzunehmen pflegten. Diese waren wahrscheinlich mit dem andern Jungen auf die Jagd nach dem täglichen Fleisch weit über das Weichbild der Stadt hinausgeflogen, wohin unser Nesthäkchen noch nicht zu folgen wagte.
Mir blieb sonach nichts weiter übrig, als der verlassenen Wohnung von Turmfalkens einige Blicke zu widmen und ein paar herumliegende Gewölle der Jungen zu sammeln. Das erstere machte keine Freude: Der Boden und die Wände waren in einer fürchterlichen Weise beschmutzt. Ich fand keinen Vergleich; nur französische Kulturvertreter sollen stellenweise an der Ruhr in ähnlicher Weise »gehaust« haben! Regen, Wind und Schnee werden hoffentlich das ihrige tun, um Turmfalkens Wohnung bis zum nächsten Frühjahr wieder in den Stand zu setzen. Die Gewölle bestanden zu meiner Freude fast durchweg aus Haaren der Feldmaus, was wahrscheinlich mit der für die Jagd derselben günstiger gewordenen Witterung zusammenhing. Nur in dem einen fand sich ein Zwischenkiefer eines sehr kleinen Vogels. Mit diesem Befund stimmte überein, daß ich bei meinen letzten Besuchen bei Turmfalkens auf dem Anrichte- beziehungsweise Vorratstische nur je eine tote Feldmaus hatte liegen sehen.
Zum Schluß noch eine Bemerkung: Viel Glück und Freude haben ja Turmfalkens mit ihren Kindern nicht gehabt. Das eine wird totgeboren, das andre ist schwächlich und stirbt oder wird gar geraubt und das dritte stürzt tödlich verunglückend ab, so daß von fünf Kindern nur die kleinere Hälfte am Leben bleibt! Doch wollen wir uns trösten. Wie bei uns Menschen die Natur immer wieder ausgleichend wirkt, wenn nicht die verruchte menschliche Entsittlichung dazwischen tritt, so gibt es auch bei den Vögeln viele Fälle, wo die an sich zahlreiche Nachkommenschaft durch alle Unbilden und Fährnisse der ersten Zeit glücklich hindurchkommt, so daß trotz mancher störender Vorkommnisse die Erhaltung der Art dauernd gewährleistet bleibt. Möge unsre Turmfalkenfamilie alle Nöte des Winters glücklich überstehen, so daß sie wenigstens in einem Paare zu der alten Wohnstätte auf dem Dresdner Rathausturm zurückkehren kann; möchten aber auch die allgemeinen Witterungsverhältnisse des nächsten Jahres derart sein, daß Turmfalkens nicht nötig haben, ihren Speisezettel noch einmal in bedenklicher Weise abzuändern![4]
[2] Nachdruck nur mit Einwilligung des Verfassers gestattet.
[3] Nach Berechnungen des Statistischen Amtes waren die in Betracht kommenden Temperaturen 1922: 16,52° und 1923: 12,31°.
[4] Nicht unterlassen möchte ich, auch an dieser Stelle der Hausverwaltung des Rathauses für das freundliche Entgegenkommen und die Erleichterungen meiner Beobachtungen auf dem Rathausturm meinen besten Dank auszusprechen.
[97]
Erster Nachtrag mit vier Aufnahmen des Verfassers von Dr. Kuhfahl, Dresden-A 1
Das Postwesen Augusts des Starken, das ich samt seinen steinernen Überresten vor Jahresfrist zu schildern versuchte (Heft 4 bis 6, 1922), hat in heimatliebenden Kreisen augenscheinlich großes Interesse erregt, so daß mir in vielen Dutzenden von Zuschriften eine Menge von Ergänzungen aus allen Teilen des einstigen kursächsischen Staatsgebiets zugegangen sind.
Bekanntlich liegen die Anfänge eines geordneten Postverkehrs jetzt zweihundert Jahre zurück. Gegenüber andren unklaren geschichtlichen Vorgängen zählt diese Frage also zu den jüngsten, und man kann angesichts ihres geringen Alters wohl gar nicht einmal von einer wirklichen Erforschung der steinernen Postmeilenzeichen sprechen. Obendrein sind wir durch die aktenmäßigen Unterlagen, die uns bis auf wenige Ausnahmen erhalten blieben, über die Absichten und die Maßnahmen Augusts des Starken und seines Landesgeometers Zürner seit 1722 bis in die Einzelheiten genau unterrichtet, so daß sich eine geschichtliche Darstellung des ganzen Unternehmens mit voller Sicherheit und Vollständigkeit geben läßt.
Tatsächlich liegen seit hundert Jahren auch bereits die verschiedensten Schilderungen vor, aber die praktische Seite der Sache ist bis heute lückenhaft geblieben, denn es fehlen bereits aus augusteischer Zeit urkundliche Belege oder andere Anhaltepunkte dafür, inwieweit die kurfürstlichen Befehle im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte wirklich in die Tat umgesetzt, d. h. wieviel und an welchen Punkten nun wirklich die verlangten Postmeilenzeichen errichtet worden sind.
Die dreiundachtzig Aktenhefte aus den Jahren 1722 ff., die heute in den Staatsarchiven von Dresden, Berlin und Magdeburg aufbewahrt werden, sind alphabetisch nach Städtenamen und Amtsbezirken geordnet. Einige Dutzend mögen verloren gegangen sein, denn es fehlen nicht allein die ersten drei Buchstaben, sondern auch viele Orte, die sicherlich schon damals mit dem Poststraßennetz in Beziehung gestanden haben oder in Wirklichkeit, wie Altenberg, Aue, Bärenstein, Bischofswerda, Krakau bei Königsbrück, Pegau usw., mit Distanzsäulen versehen worden sind.
Wenn es einerseits also verschiedene Städte mit Postsäulen gibt, deren Entfernungsangaben, Inschriftsentwürfe, Kostenanschläge oder dergleichen urkundlich nicht auf uns gekommen sind, so kann man anderseits freilich aus dem bloßen Vorhandensein eines Aktenfaszikels noch längst nicht mit Sicherheit darauf schließen, daß die städtische Distanzsäule oder die Reihe der Straßenzeichen nun auch tatsächlich in der anbefohlenen Weise errichtet worden sei, denn die kostspieligen Pläne des prunkliebenden Fürsten fanden bei den Untertanen eine ziemlich abfällige Kritik.
Während Zürner ursprünglich die Weisung hatte, in jeder Stadt vor jede Torausfahrt eine große Wegsäule setzen zu lassen, auf der die Entfernungen der auslaufenden Straßen dutzendweise eingemeißelt werden sollten, mußte dieser Plan angesichts der ablehnenden Haltung sämtlicher einzelner Stadtverwaltungen stark eingeschränkt werden. Fast alle Aktenfaszikel enthalten nämlich einen ehrerbietigsten Protest des betreffenden Bürgermeisters, in dem die Leere des Stadtsäckels und die Armut der Bürgerschaft dargestellt und um Befreiung von der neuen Last[98] gebeten wird. Der Bescheid des Kurfürsten geht dann nach Zürners eigenhändigem Entwurfe zumeist dahin, daß gnadenweise statt mehreren Torsäulen nur eine Marktsäule angeschafft oder daß in besonderen Fällen nur zwei bis drei der wichtigeren Tore besetzt werden sollten. Die meisten Aktenhefte schließen mit diesem Bescheid und nur selten finden sich Kostenanschläge, Steinmetz- und Maurerrechnungen, Fuhrlohnquittungen, Gesamtabrechnungen oder ähnliche Papiere, aus denen man auf die wirkliche Aufstellung der Distanzsäulen in der Stadt schließen kann.
Auch über den Ausbau der Meilenbezeichnung an den Poststraßen geben die Akten nur vereinzelt sichere Auskunft.
Interessante ausführliche Baurechnungen und Aktengebühren enthält z. B. das Faszikel Frauenstein (XXXI. F 26 35547) über die drei Meilensäulenmodelle an den Straßen nach Dippoldiswalde und nach »Döplitz«. Wir finden da für Viertelmeilsäule Nr. 53 folgende Posten:
| 5 Th. | 8 gl. | Lohn für ¼ M Säule einschl. Maler und Bildhauer | |
| 4 gl. | Ladtegeldt beim Aufladen im Steinbruch | ||
| 2 gl. | 4 ₰ | Neubefestigung der Säule | |
| 9 gl. | 3 eiserne Dübel | ||
| 16 gl. | Einmachen der Dübel | ||
| 1 Th. | 12 gl. | Lohn an Maurermeister für Grund, beim Auf- und Abladen zugegen zu sein u. s. w. |
|
| 9 Th. | 22 gl. | 4 ₰ | |
In andren Akten werden vom Fiskus auch die Werkzeichnungen und Kupferstiche (vgl. Mitt. Abb. 1, S. 72, 1922) noch mit drei Groschen in Rechnung gesetzt und umfängliche Gebühren für die Aktenführung eingestellt.
Neben andern ausführlichen Abrechnungen liefern uns ferner die Reiseberichte Zürners aus späteren Jahren manchen Beweis über Vorhandensein und Beschaffenheit der Straßenzeichen. 1724 wurde z. B. auf einer Revisionsfahrt Dresden–Dippoldiswalde–Frauenstein festgestellt: »Die Säulen 4 bis 10 wackeln. Schrift schlecht. Schlecht gestrichen.« Der Viertelmeilenstein mit der Zahl neun und dem Jahr 1723 ist heute inmitten Dippoldiswalde selbst aufgestellt und stammt zweifellos von einer Außenstrecke. Ein Ratsbericht vom 27. Juli 1725 erwähnt eine Distanzsäule vor dem Obertor und eine Viertel- und eine Halbmeilensäule auf der Dresdner und Gebirgischen Hauptlandstraße im Weichbild. Mit einer zweiten Distanzsäule vor dem Niedertor wird die Stadt durch Reskript vom 18. September 1725 jedoch nach vielen Verhandlungen verschont.
Ähnliche Berichte über Verfall, Zerstörung, Wiederaufrichtung und Vorhandensein der Straßensäulen finden wir zwar noch in mehreren Aktenstücken; ein Gesamtbild von der planmäßigen Besetzung der Poststraßen läßt sich aber daraus nicht entnehmen, so daß wir auch hier, ähnlich wie bei den Stadtsäulen, über den einstigen Bestand völlig im Unklaren bleiben.
Wenn man also heute nach zweihundert Jahren ein Verzeichnis der übriggebliebenen Postzeichen aus allen Teilen des Landes aufstellen will, so ist man trotz ihres geringen Alters doch genau wie bei einer wirklichen Altertumsforschung darauf angewiesen, allerwärts aufs Geratewohl zu suchen und zu fragen. Neben der Umschau in der Natur können Bilder, Reisebeschreibungen, Pressenotizen und[99] Ansichtskarten vielleicht auf die richtige Spur leiten. So finden wir z. B. auf Aquarellbildern im Oschatzer Museum die beiden verschwundenen Distanzsäulen vor dem Spitaltore und vor der Gottesackerkirche oder auf einem Stadtbild von Nossen einen Halbmeilenstein am rechten Muldenufer abgebildet. Bei manchen persönlichen Mitteilungen ist zumeist Vorsicht geboten; so hatte ich ohne eigne Nachprüfung aus der Literatur zwei Distanzsäulen am Parktor von Schloß Lichtenwalde bei Chemnitz unter Nr. 22 und 23 meines Verzeichnisses von 1922 aufgenommen. Als ich sie nachträglich noch aufsuchen wollte, war nichts von ihnen zu sehen und der Schloßherr versicherte mir, daß auch nie eine solche Säule auf seinem Besitztum gestanden habe. Hier liegt wahrscheinlich eine Verwechslung mit den zwei Säulen am Moritzburger Schlosse vor; jene beiden Nummern sind also zu streichen.
Gleichfalls nicht zu finden ist die Viertelmeilenplatte Nr. 73 an der Wasserschänke bei Röhrsdorf. Nach Auskunft der Bewohner soll sie überhaupt nicht dort gestanden haben und ist infolgedessen ebenfalls im Verzeichnis zu tilgen.
Mit solchen Fehlern, denen ich später noch andre anzufügen habe, muß man erfahrungsgemäß bei allen Erkundigungen rechnen, die nicht ausschließlich auf eignem Augenschein beruhen, aber trotzdem bleibt solche Umfrage das einzig wirksame Mittel und die Forschung läßt sich – besonders in heutiger Zeit – nur betreiben, wenn es gelingt, eine möglichst große Zahl ortskundiger Helfer für die Sache zu interessieren. Da dies aber nur auf dem Wege durch die Presse möglich ist, so mag es nicht verwunderlich erscheinen, wenn meine erste Veröffentlichung, bei der ich insgesamt neunundsiebzig Distanzsäulen und Meilenzeichen zusammengebracht hatte, nicht nur zu verbessern, sondern auch verschiedentlich zu ergänzen ist.
Neben steinernen Bruchstücken in Museen oder Privatbesitz oder neben Meilenzeichen an entlegenem Orte haben sich drei wohlerhaltene städtische Distanzsäulen gefunden, die zwar an ihrem Platze täglich von allen Einheimischen gesehen werden, in der heimatlichen Literatur aber für den Sammler bisher nicht zu finden waren. Infolgedessen glaube ich auch heute nicht, daß die Sammlung mit diesem ersten Nachtrag völlig erschöpft sein wird, sondern bitte, mit wiederholtem Dank an alle Einsender, auch künftig um Beschreibung weiterer Funde. – Ergänzende Mitteilungen über die Jahreszahlen einiger Distanzsäulen hat mir Eisenbahninspektor Bernhard Meinke gemacht. Demnach ist in Tabelle A a, b, Heft 4/6, 1922 nachzutragen:
Johanngeorgenstadt 1728, Jöhstadt 1730, Königstein 1727, Marienberg 1727, Penig 1733, Guben 1736, Ullersdorf am Queis 1725.
Zur Fortsetzung meiner früheren Listen von Distanzsäulen und Meilenzeichen sei auf die heutige Anlage verwiesen und hierzu noch folgende Bemerkungen angeknüpft.
Für das Städtchen Frankenberg gibt ein kurfürstlicher Erlaß vom 20. November 1773 (Akten XXXI F 25 35547) auf Ansuchen die Genehmigung, daß an Stelle mehrerer Torsäulen nur eine Marktsäule mit sämtlichen Entfernungsangaben zu errichten sei. Die Verhandlungen darüber zogen sich aber dann noch mehrere Jahre hin und die Akten endigen schließlich, ohne ein Ergebnis erkennen zu lassen. In Übereinstimmung mit der mündlichen Überlieferung, die noch heute in der Stadt fortlebt, kann man also annehmen, daß der Obelisk ursprünglich am[100] Marktplatz gestanden hat. Um 1820 ist er bei Errichtung des Marktbrunnens nach der Altenhainer Straße gebracht und vor etwa vierzig Jahren nochmals nach seinem heutigen Platz südlich der Kirche versetzt worden. Ausbesserungen sind 1909 und 1922 mit großem Geschick vorgenommen worden, sodaß die Inschriften bis heute lesbar blieben. Da sie ein besonders interessantes Bild von den Verkehrsbeziehungen und Verkehrsmöglichkeiten eines sächsischen Landstädtchens in damaliger Zeit bieten und nebenbei auch die Schwierigkeiten der brückenlosen Straßen bei den regelmäßigen Überschwemmungen der Gebirgsflüsse kennzeichnen, seien sie hier wiedergegeben:
1. an der Seite nach der Kirche:
| Beym Baue nauß | |||
| Von Frankenberg nach | |||
| Sachsenburg | St. | 5/8 | |
| Mittweyda | 2 St. | ¾ | |
| Rochlitz | 6 St. | ¼ | |
| 1) | Leipzig | 16 St. | ¼ |
| Merseburg | 27 St. | 3/8 | |
| 9) | Langensalza | 53 St. | |
| 7) | Halla | 29 St. | 1/8 |
| 1) | Colditz | 9 St. | ½ |
| Grimma | 13 St. | ||
| Leißnig | 7 St. | 7/8 | |
| Wermsdorff | 11 St. | 5/8 | |
| 1) | Torgau | 8 St. | |
| 3) | Wittenberg | 28 St. | ½ |
| Waldheim | 4 St. | ||
| Haynichen | 3 St. | ||
| Döbeln | |||
| 1) | Nossen | 3/8 | |
| 2) | Meißen | 0 St. | ¾ |
| 2) | Dresden | 13 St. | ¾ |
| 4) | Budissin | ||
| 1) | Moritz | ||
2. an der Seite nach der Stadtbrauerei und
3. wiederholt an der Seite nach der Kirchgasse:
| Am Gasthoffe nauß | |||
| Von Frankenberg nach | |||
| 1) | Freyberg | 6 St. | |
| 2) | Dressden | 13 St. | ¾ |
| Oederan | 2 St. | 7/8 | |
| Sayda | 8 St. | ||
| Brix | 16 St. | ||
| Zur Altenh. Gasse nauß | |||
| Augustburg | 3 St. | ||
| 1) | Marienberg | 8 St. | |
| Grenze | 11 St. | ||
| Commothau | 14 St. | ||
| Prag | 36 St. | ||
| Bey großen Wasser | |||
| Flöhbrücke | 1 St. | ½ | |
| 1) | Chemnitz | 4 St. | 1/8 |
| 1725 | |||
4. an der Seite nach dem Handelschulgarten:
| Durchs Wasser von Frankenberg nach |
|||
| 1) | Chemnitz | 3 St. | 1/8 |
| 2) | Annaberg | 10 St. | 5/8 |
| Schlettau | 11 St. | ||
| Wiesenthal | 15 St. | 1/8 | |
| Grenze | 11 St. | ||
| Carlsbad | 21 St. | 6/8 | |
| 2) | Stollberg | 7 St. | 1/8 |
| 3) | J. G. Stadt | 16 St. | 1/8 |
| 3) | Schneeberg | 11 St. | 7/8 |
| 2) | Zwickau | 10 St. | ¾ |
| 1) | Reichenbach | 15 St. | 7/8 |
| 4) | Plauen | 20 St. | ¾ |
| Grenze | 11 St. | ||
| 5) | Hoff | 26 St. | ¾ |
| Nürnberg | 62 St. | ||
| 1) | Poenig | 6 St. | |
| Zeitz | 16 St. | ||
| 3) | Naumburg | 22 St. | |
| 2) | Mittweida | 2 St. | 7/8 |
| 1) | Leipzig | 16 St. | |
Die zweite Distanzsäule ist für das Städtchen Grünhain nachzutragen. Im Aktenstück Grünhayn (rep XXXI G 45 35553) finden wir die Nachbarorte Schlettau, Zwönitz, Elterlein und Geyer mitbehandelt. Von der Schlettauer Säule, die nach einem Erlaß vom 21. Februar 1727 an Stelle von drei Torsäulen auf den Markt gesetzt werden sollte, habe ich bis jetzt keine Spur entdecken können. Dagegen wurden die drei andern Stadtsäulen bereits früher als vorhanden aufgeführt.
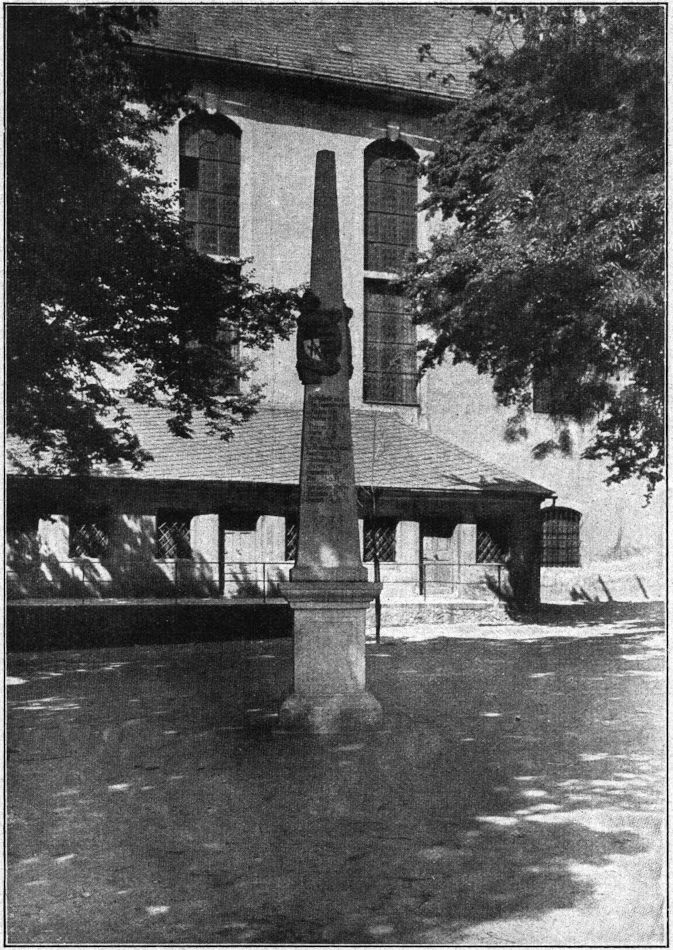
Das Grünhainer Stück ist aus weißem Granit gefertigt und zeigt die Formen eines Distanzobelisken ohne den plastischen Wappenzierat; es sollte nach einem Befehl vom 20. Dezember 1723 vor dem Amtshaus aufgestellt werden, ist also augenscheinlich später nach dem jetzigen Platz an der Straße versetzt worden. Der Streit um die Kosten, der übrigens auch durch einen umfänglichen Schriftwechsel[102] aktenmäßig bestätigt wird, lebt im Volksmunde, wie man mir mehrfach berichtete, in folgender Gestalt weiter: Der Staat habe die versprochene Beihilfe verweigert. Daraufhin hätten die Grünhainer das Wappenstück mit dem kurfürstlichen und königlich polnischen Schildern zerschlagen, auch habe man die Entfernungen gegen Chemnitz, Lößnitz und Schneeberg nicht einmeißeln lassen und die Säule am Amtshaus weggenommen, um sie auf städtischen Boden zu stellen.
Auf eine dritte wohlgepflegte Distanzsäule stoßen wir schließlich in Pegau an der Elsterbrücke. Ein Aktenheft von Pegau ist nicht vorhanden, doch ergibt sich aus verschiedenen örtlichen Mitteilungen, daß der Obelisk seit 1723 hier am Leipziger Tor gestanden hat, während ein zweiter sich am Obertor befand. Der letztere ist seit 1873 verschwunden, während der andere durch den Verschönerungsverein unter Beihilfe des Stadtsäckels und des Landesamts für Denkmalspflege mehrere Male sorgfältig ergänzt und erneuert worden ist. Dabei hat man im Jahre 1898 zum Regierungsjubiläum des Königs Albert, das verstümmelte Wappenstück durch ein neues aus Nebraer Stein ersetzt und im Jahre 1922 farbig bemalt.
Diese drei städtischen Distanzsäulen sind bezeichnenderweise die einzigen nachgemeldeten Funde von guter Beschaffenheit; alles übrige stellt nur Bruchstücke und verstümmelte Reste dar. Da aber auch diese geeignet sind, das einstige Bild vervollständigen zu helfen, so mögen sie kurz geschildert werden.
Die Tharandter Säule ist mit einem sechzig Zentimeter hohen, leidlich erhaltenen Wappenteil erhalten, das am Mühlgraben gegenüber dem Kurhaushotel bei einer kleinen Brücke aufgepflanzt ist.
Von einer der Meißner Torsäulen steht der sechsundachtzig Zentimeter hohe konische Teil mit Wappen und Inschriften jetzt im Privatgarten Liebenecke bei Cossebaude. Angeblich stammt das Stück vom Lommatzscher Tor und aus dem Jahre 1722.
Ein zwei Meter langes Bruchstück der Stadtsäule hat sich in Frauenstein in einem Privatgarten am Treffpunkte von Bahnhof und Freiberger Straße erhalten. Auf Grund eines kurfürstlichen Erlasses vom 7. Oktober 1723 wurde dem kleinen Bergstädtchen nachgelassen, eine einzelne Marktsäule an Stelle von vier Torsäulen anzuschaffen. Dieselbe Genehmigung erhielt nach dem gleichen Aktenheft im Jahre 1727 auch der Nachbarort Sayda; bei beiden Orten fehlt aber der aktenmäßige Anhalt dafür, ob die Befehle ausgeführt worden sind. Während in Sayda sich augenscheinlich nichts von der Distanzsäule erhalten hat, ist in Frauenstein durch privates Interesse des früheren Bürgermeisters das Wappenstück und der anschließende konische Stein mit verwitterten Inschriften aus dem Schutt des großen Stadtbrandes von 1869 gerettet worden.
Das Wappenstück einer Distanzsäule erwähnte ich früher als Nr. 5 des Verzeichnisses im Hausflur des Rathauses von Elstra bei Kamenz. Der Stein zeigt einen seltsamen rhombischen Durchschnitt und weist noch einen eisernen Bolzen auf, mit dem er auf dem unteren Stück des Obelisken eingelassen gewesen ist. Aktenmäßige Unterlagen sind hier ebensowenig vorhanden, wie für das meterhohe Mittelstück einer Distanzsäule, das im Heimatmuseum der benachbarten Stadt[103] Bischofswerda steht (Nr. 60 des Verzeichnisses, Heft 4/6, 1922). Die Inschrift 1724 und viele Entfernungsangaben, z. B. Reichenbach 36 Stunden, Hof 46 Stunden usw., sind gut erhalten und lassen darauf schließen, daß der Stein wirklich aus Bischofswerda stammt.
Einige kümmerliche Bruchstücke des Wappenteiles wurden mir aus Lommatzsch gemeldet. Nach der allgemeinen augusteischen Anweisung sollten auch dort zunächst vier große Distanzsäulen vor den vier Toren aufgestellt werden; auf das Gesuch des Rates vom 1. September 1725 genehmigte der Kurfürst jedoch, daß nur eine Säule am Markt und »tüchtige Armensäulen vor den Toren« gesetzt würden. Die handgroßen Trümmer von Krone und Wappenspiegeln, die seit vierzig oder fünfzig Jahren im Giebel einer Scheune des Apothekengrundstücks an der Promenade eingemauert stecken, stammen also zweifellos von dieser Marktsäule, die man hier, wie an manch anderem Orte, bei den fiskalischen Chausseebauten um die Mitte des vorigen Jahrhunderts beseitigt hat. Da sich aber doch nach den Beispielen von Frauenstein und Lommatzsch auch anderwärts hier und da ein vernünftiger Mensch gefunden haben könnte, der ein altersgraues Kunstwerk vor der Vernichtung bewahrte, so verlohnt es sich vielleicht in mancher kleinen und mittleren Stadt noch weitere Nachsuche nach solchen Teilstücken zu halten.
Man mag dabei besonders auf die konischen Längsteile der Distanz- und Meilensäulen achten, die mehrmals schon als Steinbank oder Türschwelle wiederentdeckt worden sind.
Von den Postmeilenzeichen an der Straße sind gleichfalls noch eine Anzahl unbekannter aber meistenteils unvollständiger Stücke zum Vorschein gekommen.
Der schlanke Obelisk für die ganze Meile steht in Schönfeld an der »hohen Straße« von Großenhain nach Königsbrück, an der übrigens auch noch eine Halbmeilensäule bei Sacka und ein Viertelmeilenstein bei Quersa neu entdeckt wurden. Die Schönfelder Säule trägt gleich den andern beiden den Namenszug und die Zahl 1722. Sie dient als Wegweiser in der Nähe der Kirche und besteht nur noch aus dem konischen Teil, während der Unterbau fehlt.
Eine andere Meilensäule wurde mir aus Frankenhausen an der Pleiße gemeldet. Posthorn und Jahreszahl 1726 sind sichtbar; der Rest der Inschrift dagegen stark verwittert. Von dem leidlich erhaltenen Denkmal ist die Spitze in etwa Meterlänge verschwunden und nur der eiserne Verbindungsdübel noch sichtbar.
Über Halbmeilensäulen außerhalb Sachsens ist mir eine Meldung aus Halle zugegangen, die ich nicht selbst nachprüfen konnte. An der Landsberger Kunststraße, drei Kilometer nördlich Kölsa, soll sie bei P. 109 der Generalstabskarte am nördlichen Straßenrand stehen und der Deckplatte beraubt sein.
Über die Halbmeilensäule im Wermsdorfer Staatsforstrevier (Nr. 77 des Verzeichnisses von 1922) sei bemerkt, daß ich bei einem Besuch im Herbst 1922 die Deckplatte am Boden liegend fand, so daß auch dies einzige vollständige Stück nun nachträglich Schaden erlitten hat.

Eine andere Halbmeilensäule, die beim Kunststraßenbau ausnahmsweise nicht zu Schotter gehackt worden ist, findet sich an der »Hohen Straße« Großenhain–Königsbrück, und zwar wenige Schritte westlich des Wegkreuzes Sacka–Glauschnitz,[105] Tauscha–Röhrsdorf. Der Stein steht ohne den üblichen Unterbau und ohne Deckplatte am Grabenrand und trägt die Inschrift 1722.
Ein völlig modellgerechtes Stück, das am Fuß und Kopf ergänzt worden
ist, trifft man seit Herbst 1922 an der Kunststraße Freiberg–Oederan bei Kilometer
6,4, gegenüber dem Oederaner Schützenhaus. Es verdankt dem Architekten
Reinhard Kempe in Oederan seine Auferstehung. Das Mittelstück hatte dort seit
undenklichen Zeiten als Bank gedient und fiel dem Entdecker durch seine konische
Form auf. Beim Umwenden kam die nach unten liegende Inschrift »AR. Oederan
½ St., Chemnitz 5¼ St.  1722« zutage und ließ den Ursprung erkennen. Der
Erzgebirgsverein Oederan und das Landesamt für Denkmalpflege stellten die
Geldmittel für die Ergänzung und Wiederaufstellung zur Verfügung und so ist
durch gemeinsame Bemühungen dort an der großen erzgebirgischen Querstraße,
inmitten einer schönen Baumgruppe wenigstens ein vollständiges Beispiel für die
Nachwelt erhalten worden.
1722« zutage und ließ den Ursprung erkennen. Der
Erzgebirgsverein Oederan und das Landesamt für Denkmalpflege stellten die
Geldmittel für die Ergänzung und Wiederaufstellung zur Verfügung und so ist
durch gemeinsame Bemühungen dort an der großen erzgebirgischen Querstraße,
inmitten einer schönen Baumgruppe wenigstens ein vollständiges Beispiel für die
Nachwelt erhalten worden.

Noch größer als die Zahl der Halbmeilensäulen, ist die der wiederentdeckten Viertelmeilensteine.
Außerhalb Sachsens wurde mir – in Verbindung mit einer Halbmeilensäule – eine Viertelmeilenplatte am Westrande der Kunststraße Halle–Landsberg bei Gerbisdorf, und zwar hundert Meter nördlich vom Südwestende des Dorfes[106] gemeldet. Sie soll dem einstigen Modell in Umriß, Profilierung und Größenverhältnissen durchaus ähnlich sein. Die Sockelplatte liegt daneben im Grase und die Inschriften erscheinen kaum noch leserlich.
Ein anderes Viertelmeilenzeichen mit der Zahl 1722 steht an der schon mehrmals erwähnten »Hohen Straße« auf Flur Quersa am Wegkreuz Schönfeld–Quersa, Lampertswalde–Mühlbach. Es ist stark verwittert und ohne Unterbau und Oberteil einfach am Feldrand aufgerichtet.
Ein guterhaltener Viertelmeilenstein vom Jahre 1724, dem jedoch die dreieckige Oberplatte fehlt, findet sich bei Schwarzenberg am Wegkreuz Antonstal–Unterrittersgrün, Crandorf und Breitenbrunn. Er hält die richtige Entfernung zu dem Meilenobelisk von Crandorf ein und dürfte zu einem alten Gebirgsübergang gehört haben. Vielleicht lohnt es sich, gerade dort in den einsameren Gebirgswäldern, die vom Kunststraßenbau verschont blieben, noch eine Suche nach weiteren Steinen in südlicher Richtung vorzunehmen.
Eine Porphyrplatte mit Posthorn, Namenszug und 1722 steht jetzt im Rittergutsgarten zu Kötteritzsch bei Großbothen. Der Rittergutsbesitzer Dr. Becker hat das Teilstück vor etwa fünfundzwanzig Jahren im Straßengraben des Weges Kötteritzsch–Großbothen in halbversunkenem Zustand aufgefunden und auf sein Grundstück gerettet. Das Viertelmeilenzeichen mag, ebenso wie die Meilensäule von Ballendorf (am Weg Lausigk–Colditz), zu einer Verbindung von Leipzig über Grimma nach Colditz gehört haben.
Ein andres rechteckiges Hauptstück mit Posthorn, Namenszug und 1727 ist in die Stützmauer an der Straße von Bahnhof Wolkenstein nach Drehbach in etwa fünfhundert Meter Entfernung vom Bahnhof eingebaut. Mehrere andere Funde sind noch aus dem Verzeichnis, Anlage b, zu entnehmen.
Neben all diesen neuentdeckten Postmeilenzeichen, von deren Vorhandensein ich mich entweder zumeist persönlich oder durch vorgelegte Photographien überzeugt habe, sind mir noch eine Anzahl weiterer Stücke gemeldet worden, deren Zusammenhang mit der augusteischen Poststraßenbezeichnung fraglich erscheint und noch der Prüfung bedarf. So sah ich bei meinem nachträglichen Besuch im Wermsdorfer Staatsforst, daß die vermeintliche Viertelmeilenplatte auf Forstabteilung 25 (Nr. 78 des Verzeichnisses von 1922) dem vorigen Jahrhundert und seinen Chausseebauten entstammt und nichts mit August dem Starken zu tun hat. Auch sonst werden diese Meilensteine von 1830, die im Gegensatz zum originalgetreuen Viertelmeilenzeichen keine Spitze sondern einen walzenförmigen Abschluß und zwei gußeiserne Kronen an den Seitenflächen tragen, sehr häufig mit der kurfürstlichen Poststraßenbezeichnung verwechselt, so daß ich manches der mir mitgeteilten Fundstücke nicht aufnehmen konnte. –
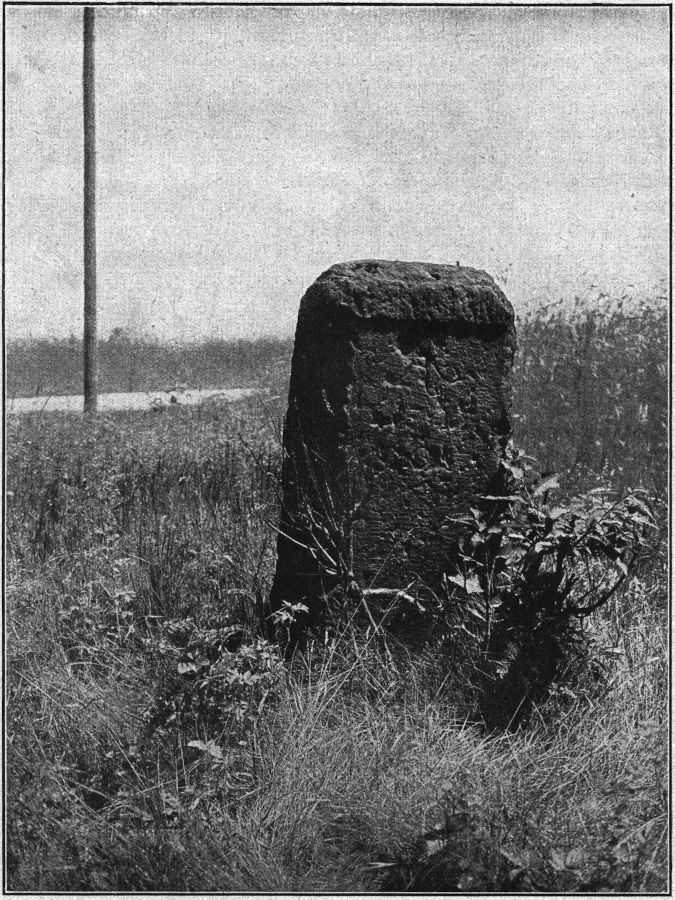
Neuere Drucksachen über die Postzeichenfrage im allgemeinen sind mir nicht zu Gesicht gekommen, sehr groß dagegen ist die Zahl älterer Kupferstiche, Holzschnitte und Gemälde, auf denen verschwundene oder vorhandene Meilensteine als Schmuckstück des Landschafts- und Städtebildes erscheinen. Ich muß es aber – schon aus Sparsamkeitsrücksichten – unterlassen, das frühere unter B b begonnene Literaturverzeichnis fortzuführen, zumal die Aufzählung all dieser schwer erreichbaren[108] Bücher oder Einzelblätter wohl wenig praktischen Wert hätte. Besondere Entdeckungen wären damit heutzutage ebensowenig in der Landschaft zu machen, wie mit Hilfe der Standorte, die aus einigen Akten hervorgehen; habe ich doch sogar auf vielen Fußwanderungen, Rad- und Autofahrten bereits vergeblich nach denjenigen lückenhaften Reihen von Meilenzeichen gesucht, die der Oberreitsche Landesatlas zu Anfang des vorigen Jahrhunderts – also hundert Jahre nach ihrer Errichtung – noch als vorhanden nachweist. Wenn es also auch sehr interessant sein mag zum Beispiel auf den Dresdner Stadtplänen Heßlers von 1833 noch die Distanzsäulen am Pirnaischen Schlag, am Bautzener Platz und Leipziger Tor durch M. S. bezeichnet zu finden, oder in einer Chemnitzer Stadtbeschreibung von E. Weinhold die Obelisken an der Annaberger Straße und Zwickauer Straße abgebildet zu sehen, so steht bekanntermaßen dort nirgends ein Stein mehr.
Weiteres planmäßiges Forschen auf Grund bildlicher und literarischer Unterlagen hat also keinen Zweck, dagegen mögen die bekanntgewordenen und die noch ans Licht kommenden Stücke aller Art und Größe in Zukunft um so sorgfältiger erhalten bleiben.
Anlage I
80. Aue. Bruchstück, Granit. Mitt. XI 7./9. Früher am Markt.
81. Frankenberg 1725. An der Kirche. 1909 und 1922 erneuert. Frankenberger Tageblatt vom 26. September 1909.
82. Frauenstein. Ohne Spitze und Postament. Im Privatgarten an der Freiberger Straße beim Bahnhof.
83. Grünhain. Früher am Amtshaus. Jetzt an der Hauptstraße. Weißer Granit.
84. Lommatzsch. Unbedeutende Bruchstücke des Wappenstücks. Eingemauert in der Apothekenscheune an der Promenade.
85. Pegau 1723. An der Leipziger Straße bei der Elsterbrücke. Sandstein. 1898 und 1922 erneuert. Pegauer Zeitung vom 4. Juni 1923.
86. Tharandt. Wappenstück. Am Mühlgraben in der Nähe des Kurbadhotels. Sandstein.
87. Breitenbrunn 1724. bei Schwarzenberg. Viertelmeilstein. Ohne Deckplatte. Am Wegkreuz Breitenbrunn–Krandorf, Antonstal–Unterrittersgrün.
88. Frankenhausen 1726. an der Pleiße. Meilensäule ohne Spitze.
89. Gerbisdorf bei Halle. Viertelmeilplatte an der Kunststraße Halle–Landsberg. Nördlich des Dorfes.
90. Großhennersdorf bei Herrnhut. Meilensäule an der Straße nach Bernstadt, südlich der Fichtelschenke. 3,20 Meter hoch.
Kölsa bei Halle. Halbmeilensäule? An der Kunststraße bei P 109 der Karte 1 : 100 000.
Kötteritzsch bei Lausigk. Viertelmeilplatte ohne Spitze und Unterbau. Seit fünfundzwanzig Jahren im Rittergutsgarten.
Neukirchen an der Pleiße. Meilensäule? Zwischen Friedhof und Rittergut.
Oederan. Halbmeilensäule. An der Kunststraße nach Freiberg bei Kilometer 6,4.
Quersa 1722. bei Großenhain. Viertelmeilstein ohne Auf- und Untersatz am Wegkreuz Quersa–Schönfeld, Lampertswalde–Mühlbach.
[109]
Sacka 1722. bei Königsbrück. Halbmeilensäule ohne Deckplatte und Unterbau. Achtzig Meter westlich vom Straßenkreuz Sacka–Glauschnitz, Tauscha–Röhrsdorf.
Schönfeld 1722. bei Großenhain. Meilensäule. Ohne Unterbau. Als Wegweiser bemalt. An der Dorfstraße bei der Kirche.
Wolkenstein. 1727. Viertelmeilplatte. Eingemauert in der Straßenböschung nach Drehbach. Fünfhundert Meter vom Bahnhof Wolkenstein.
Zschopau. Zerbrochene Meilensäule. An der Straße Marienberg–Zschopau bei Einmündung der Straße von Börnichen. In zwei Teilen am Boden liegend.
Von Karl Lucas, Meißen
Kindheitserinnerung steht vor mir: Osterreiter auf der Straße nach Schwarzadler zwischen Storcha und Radibor. Wie habe ich damals erstaunt und verwundert die schönen Pferde mit den wundervollen Mähnen und Schweifen, mit dem feinen Zaumzeug und dann die bunten Fahnen beschaut. Das andre war mir Knirps von acht bis zehn Jahren unverständlich. Dann bin ich immer stolz gewesen, wenn vom Osterreiten in der Wendei die Rede war. Ich konnte sagen: »Ja, das habe ich schon gesehen.« Da stieg mein Ansehen unter den Chorschülern der Sophienkirche zu Dresden. Ich mußte manches davon erzählen. Ob ich dabei ganz wahr[110] geblieben bin, ob meine Phantasie mit mir durchgegangen ist, ich vermag es heute nicht mehr zu sagen; die es damals mit angehört haben, wohl auch nicht mehr. Es ist schon lange her. Die Heimat sah mich wieder, neun Jahre lang. Dann trug mich das Lebensschifflein an ein andres Ufer. Doch ich weiß meinen Fuß immer wieder nach der alten Heimat zu lenken. Sind es die Berge, sind es die Täler, die Wasser, die Lebenden, die Toten? Ich vermag es nicht zu sagen. Die Heimat hat mich, ich habe sie. Und ich bin froh dabei. Salve Lusatia!

Kloster Marienstern wollte ich schauen, und zu mehreren Malen habe ich dort geweilt. Die Stille des Klosterhofes nahm mich gefangen. Links die Kirche mit ragendem Turme. Dann die Klosterhäuser, profanem Besuche verschlossen, der Löwenbrunnen (böhm. Löwe, aus der Zeit der Zugehörigkeit der Lausitz zu Böhmen), Bäume, Blumenbeete, ein Rasenrondel, ragende Heilige. Rechts stehen die Gebäude, die des Leibes Notdurft sichern helfen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt auch nicht vom Wort allein. Hinterm Sägegatter der feine stille Garten: schmiegsame Wege, stille Weiher, dazu ein Kranz von Wiesen und Büschen; da und dort versteckt ein Ecce homo, eine Maria benedicta und doch auch mater dolorosa. Im Kircheninnern gedämpftes Licht, Sonnenglanz an bunten Scheiben, schlanke Pfeiler, Weihrauchdüfte, stille Beter, auf einer Bank im Angesichte des Hochaltars ich Weltkind mitten innen. Nicht schlug das Kreuz mir meine Hand, nicht netzt’ geweihtes Wasser mir die Stirn. Das Knie ging nicht zur Beuge mir, kein Rosenkranz, der durch die Finger glitt. Und doch! Ich hatt’ mich selbst vergessen, war nicht mehr ich, war irgendwer, war irgendwas, war irgendwo. Die Nonnen eilten still geschäftig mit Blumen da und dorten hin, nie fehlend der befohlnen Ehrerbietung vor dem und jenem, das mir rätselhaft verblieb. Mit Blumen schmückten sie des Altars Stufen, die Simse und wo sonsten Platz noch war. Weiße, reichgestickte Decken wurden ausgewechselt. Alles still, auch ich.
Sind es die strebenden Pfeiler, die den Sinn vom Boden in die Unendlichkeit hinaus zu lösen vermögen, daß wir uns fühlen, frei von allen Schranken unsers Ichs, als ein dienend Glied in dem Zusammenhang des Weltenalls? Ich weiß, daß das gleiche Gefühl bei mir einkehrte in der Oybiner Ruine, über deren dachlose Mauern die Baumkronen zu einem grünen Baldachin zusammenstrebten; in der Bautzener Nikolairuine, in der zur Winterszeit der weiche Schnee alles abrundend deckte, und über der der dunkle Himmel in seltner Sternenpracht mit den ragenden Wänden in der Finsternis zu einem Bauwerk von unendlicher Höhe zu verschmelzen schien; im hohen Walde zur frühsten Morgenstunde, wenn goldne Tinten den Himmel übergossen, wenn Sonnenfünkchen im Taubehang der Baumwipfel sich badeten, während über See und Heide noch der düstre Nebel dampfte.
Wieder sah ich Marienstern, als ich am Karfreitag vom Wohlaer Ländchen her nach Osten fuhr. Auf den Feldern, in denen reiche Sonnenwärme neues Leben weckte, stampften schweren Schrittes stattliche Pferde mit eingeflochtenen Mähnen und Schweifen. Ostersamstag. In Bautzen zeigten sich Wagen, vor denen Pferde gelöste, schön gekräuselte Mähnen und lange Schweife im Lockengewirr zur Schau trugen. Euch werde ich morgen alle wieder schauen!
[111]

Der Himmel schlug einen grauen Mantel um. Der Wind pfiff kälter und kälter. Beim Osterwasserholen am Ostermorgen war es empfindlich frisch. Aber nach dem Kloster wird gefahren. Über Feldwege geht es zur Kamenzer Straße. Sie ist belebter als je: Radfahrer, Motorfahrer, Automobile vom Zwergwagen bis zum Ungetüm, Pferdegeschirre, Fußgänger beiderlei Geschlechts, Gruppen von Wandervögeln mit bunten Wimpeln und Klampfen, alles in buntem Wechsel, alles in einer Richtung. Von allen Wegen und Stegen biegen sie ein nach dem Kloster. Einzelne Reiter im Festgewand auf geschmückten Rossen werden überholt. Wendische Frauen und Mädchen in Volkstracht zu Fuß und zu Rade geben der hastenden Masse eine neue Abwechslung. Deutsche, wendische Laute klingen an unser Ohr. Aber auch in andren Zungen der Welt wird gesprochen. Je näher wir ans Kloster herankommen, desto beängstigender schwillt die Menge, desto größer wird der Lärm. An der Klostermauer entlang steht Kraftwagen an Kraftwagen. Auf der Straße staut sich die Menge. Man muß die Feste feiern, wie sie fallen. Man muß Geschäfte machen, wenn sie gehen. So denkt jeder in Marienstern, in Kuckau. Gärten aller Art, Schuppen, Hausfluren, alles muß heute zinsen: Einstellung von Fahrrädern. Wir sind froh, daß uns Einwohner mit einnehmendem Wesen der Sorge um unsre acht Stahlrosse entheben wollen. Der Obolus ist valutagemäß. Vor dem Eingang zum Klosterhof eine Menschenmauer. Nur schwierig ist der[112] Eingang zu gewinnen. Nur langsam, ganz langsam weicht die Mauer, wenn Autohupen das Stimmengewirr übertönen. Der Klosterhof ist heute glatt verwandelt. Kopf an Kopf staut sich die Menge an dem Straßenring um das Rasenrondel. Rasenflächen, Gebüsche, alles wird betreten. Wo sonsten Ruhe Wohnung hat, wo fromme Übung nur des Tagewerks Gleichmaß unterbricht, da schwirrt, da lärmt die Menschenmenge. Sie wogt und brandet, sie drängt zur Kirchenpforte. »Dem Nächsten zur Wehr!« Ja warum, du Feuerwehrmann, hast du diesen Wahlspruch? Nun wehre dem und der lieben Nächsten den Zugang zum Innern der Kirche, der stürmisch, fast widerlich stürmisch unter Ausnutzung sämtlicher Ellenbogen und dergleichen begehrt wird. Pure Neugier heißt die meisten sich den Eingang erzwingen und denen, die zur Andacht wollen, die ernste Stimmung stören. Zum Seitenpförtchen an der linken Seite tritt die Menge nach kurzer Zeit wieder aus. Stelle dich hinter diese Leute und höre, wovon ihnen der Mund übergeht. Schweigen darüber ist wirklich Gold, Reden davon nicht einmal Papier. Zu einem wirklichen Erlebnis religiöser, künstlerischer oder sonst welcher Art ist bei dieser Unruhe niemand gekommen. Auf dem Straßenring halten die Osterreiter. An die siebzig Paare mögen es sein. Prächtige Pferde mit ausgesprochenen Ramsesnasen sind vorhanden. Not ist keinem anzusehen. Faltenlos strafft sich die Haut über dem Fleisch. Der Mähnenbusch und der wallende Schweif tragen zur Zier noch hellfarbene Schleifen und bunte Blumen. Der Kopf schwenkt auf und nieder. Das Zaumzeug klirrt. Des Reiters Hand tätschelt den Pferdehals. Aber die Unruhe ist nicht zu dämpfen. Die Vorderhufe scharren den Boden, die Nüstern schnauben. Eins dreht im Kreise. Das Zaumzeug der meisten ist mit Pilgermuscheln besetzt. Die Satteldecken zeigen in ihren Ecken das Bild des kreuz- oder fahnetragenden Lammes. Die Reiter, alte wie junge, sind ganz Würde. Manchem sieht man es an, daß er einst als Gardereiter gedient hat. Auf den breiten Ackerpferden ist es gewiß keine Kleinigkeit, eine stramme Haltung zu bewahren. Andre verraten auf den ersten Blick, daß sie einen solchen festlichen Aufzug vor so zahlreichen Zuschauern zum erstenmal mittun. Die bunten Kirchenfahnen schlagen im scharfen Winde. Vom Kruzifixus, den einer trägt, weht es weiß und goldig. Endlich kommt das Glockenzeichen. Der Vorsänger setzt plötzlich mit weittragender Stimme ein. Bald wird der Klang von allen Reitern aufgenommen und
[113]
tönt litaneienhaft über den Klosterhof. Der Lärm der andren verstummt. Manche versuchen den Text zu erfassen und sind schier verwundert, daß ihnen das nicht gelingt, bis auf das Halleluja. Nach und nach kommt das Bewußtsein, daß wendische Worte erklingen. Der Sang ebbt ab. Er erhebt sich wieder in neuer Kraft, zweimal, dreimal, vielmal. Inzwischen hat sich der Zug in Bewegung gesetzt. Dreimal reiten sie um das Rondel und verlassen dann den Hof, um hinauszureiten in die Fluren. Da kommt auch wieder Leben in die Massen. Die Eindrücke werden in Worte gekleidet. Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches wird vom Osterreiten berichtet. Zumeist werden Bemerkungen daran geknüpft, die nur zu gut verraten, daß die meisten von dem tiefen Sinn, der in dem Saatreiten verborgen liegt, keine Ahnung haben. Auch Ausrufe der Enttäuschung werden laut. Neben mir steht ein Ehepaar aus Frankfurt a. M., wahrscheinlich zur Verwandtschaft derer von Neureich und Raffke gehörig. Beide sind in die zahlreichen Umhüllungen gewickelt, die einen Automobilbesitzer, der da weiß, was er seinem Auto schuldig ist, notwendigerweise zunehmen lassen müssen an – Umfang. »Nun, wenn es weiter nichts ist!« so flötet sie ihr Männchen an, »das ist ja schade um das viele Benzin!« Auch ein Gesichtswinkel, in dem man sich zum Osterreiten einstellen kann.

[114]
Ein Zug Saatgänger bahnt sich durch die Menge. Auch hier Gesang in Oktavenabstand von barhäuptigen Männern, von Frauen und Kindern. Sie verschwinden im Innern der Kirche. Wieder war vorübergehend Ruhe. Wieder erhebt sich der mühsam gedämpfte Lärm der Zuschauer. Nach geraumer Zeit kommen die Crostwitzer Osterreiter an. Dasselbe Bild wie vorher. Die Reiter sitzen aber schon lange im Sattel. Ihre Stimmen haben schon viel hergeben müssen. Darum wird in einer Pause ein frischer Trunk Klosterbier gespendet. Frisch war der Trunk auf alle Fälle. Wenn das Bier noch so ist wie früher, dann war er auch gut.

Nachdem auch diese Reiter den Klosterhof wieder verlassen haben, verläuft sich die Menge. Autohupen, Fahrradklingeln, Peitschen, menschliche Stimmen lassen sich im freien Wettbewerb der Kräfte hören. Froh ist, wer endlich dem Gewühle entronnen ist und die freie Straße erreicht hat. Von links schallen die Klänge der »Stanył je horje Jězus Khryst, alleluja!« herüber. Auf einem Feldwege tauchen erst bunte Kirchenfahnen, dann Reiter und endlich der ganze Zug auf, der als erster Marienstern verlassen hat.

Osterreiten, Saatreiten. Es ist eine schöne Sitte aus alter Zeit, so sagen die einen. Andre meinen, daß es eine rein katholische Sitte sei, die mit Bittgängen,[115] Wallfahrten usw. auf eine Stufe zu stellen sei. Da bei uns in Sachsen dieser Brauch sich nur in den katholischen Gegenden erhalten hat, so scheint diese Ansicht auch begründet zu sein. In der Hauptsache aber sind Urteile und Ansichten zu hören, die eine völlige Verständnislosigkeit gegenüber diesem Brauch im besonderen wie gegenüber den Osterbräuchen im allgemeinen ohne Einschränkung ausdrücken. Auch ein großer Teil der ländlichen Bevölkerung hat das Bewußtsein des tieferen Sinnes dieser Bräuche verloren. Das wird den, der die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, ja Jahrhunderte aufmerksam betrachtet, nicht verwundern. Die große Masse des Volkes ist dem Boden entfremdet, von ihm entwurzelt. Die Entwicklung der Städte und Industriebezirke brachte eine Anhäufung der Menschen auf beschränktem Raume mit sich. Auch die ländliche Bevölkerung hat einen ähnlichen Prozeß durchgemacht. Nachdem das Joch der Hörigkeit von ihr genommen worden war, haben es einzelne verstanden, durch Bauernlegen immer mehr Grund und Boden in ihre Hand zu bringen. Es ist berechnet worden, daß in Preußen etwa ein Drittel des Bauernlandes in die Hand des Großgrundbesitzes geraten ist. Eine Änderung im Grundeigentum konnte in der Hauptsache nur durch Enteignungsgesetze vorgenommen werden, wenn der reichlich enggefaßte Begriff des öffentlichen Interesses gegeben war. Straßenbau, Bahnbau usw. waren solche Dinge, die ein erfolgreiches Eingreifen ermöglichten. Die Spekulation machte aus dem Grund und Boden ein Spekulationsobjekt. Die persönliche Verpflichtung dem Grund und Boden gegenüber fehlt solchen Spekulanten ganz. Dagegen waren in alteingesessenen Bauerngeschlechtern, auch wenn die Betriebe noch so ökonomisch geleitet wurden, diese Bindungen rein gefühlsmäßiger Art vorhanden. Eine Verbesserung oder »Melioration«[116] des Besitzes wurde mehr um des Bodens selbst willen vorgenommen als in der Hoffnung, durch diese eine Wertsteigerung herbeizuführen und daraus möglichst bald einen rein persönlichen Gewinn herauszuschlagen. Der Besitz war nicht jedem Meistbietenden gegenüber feil. Der Erbe, das Geschlecht verspürte den Segen dieser großzügigen Auffassung. Dieses Gefühl, ich bin nur der Sachwalter meines Besitzes für die, die nach mir kommen, schuf die Eigenschaften, die dazu berechtigten, den Beruf des Landwirtes als den edelsten unter den rein praktischen Berufen anzusprechen. Der Bauer war bodenfest. Leider geht diese verpflichtende Auffassung mehr und mehr verloren. Heute wird auch die Landwirtschaft industrialisiert, amerikanisiert. Stand früher nur der amerikanische Landwirt mit diesem rein geschäftsmäßigen Brauch mit dem Industriellen Europas auf einer Stufe, so können wir heute dasselbe Bestreben bei uns wahrnehmen. Das aber will uns noch nicht in den Kopf, daß wir so das alte Bauerntum zum Industrierittertum übergehen sehen sollen. Wir vermissen dann gerade am Bauer die Eigenschaften, die ihn sonst auszeichneten. Mit Recht wird darum in Bauernkreisen gegen diese Landflucht und Stadtsucht geeifert. Bodenständigkeit im Sinne der Alten, Verpflichtung der einzelnen gegen die Familie, der Familie gegen das Geschlecht, des Geschlechts gegen den Stamm, des Stammes gegen das Volk, des Volkes gegen seinen Grund und Boden, ohne den es ohnmächtig ist, aus dem es durch die einzelnen Familien seine Kraft schöpft. So stellt der jeweils Lebende dann nichts andres dar als das Sinnbild des lebenden Bodens, der in der Vergangenheit das erwachsen ließ, was heute lebt. Der Lebende ist die Summe der erfüllten oder nicht erfüllten Pflichten der Vergangenen. Er soll sie tragen und sich verpflichtet fühlen von Familie über Geschlecht und Stamm dem Volk und dessen Grund und Boden.
Nun muß offen zugestanden werden, daß sich in der Jetztzeit auch Umwälzungen vorbereiten und vollziehen, die gerade das Verhältnis des einzelnen zum Grund und Boden bessern wollen. Bodenreform, Siedlung, Eigenheim, Erbbaurecht, um nur einiges zu nennen. Es ist das alte Lied, daß dann harmonische Ruhe besteht, wenn Form und Inhalt einer Sache im Einklang stehen. So auch hier.
Wenn die Form den Inhalt, der eine andere Form verlangt, in ihr zu bleiben zwingt, dann entstehen notwendigerweise ebensolche Reibungen, wie wenn eine neue Form einem alten Inhalt aufgezwungen wird. Je verständnisvoller der Schrei nach dem Boden von den maßgebenden Stellen vernommen wird, desto ruhiger wird sich der Umwandlungsprozeß vollziehen, um so eher wird ein harmonischer Zustand wieder herbeigeführt werden können zum Besten für alle.
Dann wird vielleicht einmal der einzelne, der jetzt solchen alten Bräuchen verständnislos gegenübersteht, dieselbe oder ähnliche innerliche Bewegungen erleben, die als Ausgangspunkt dieser Bräuche anzusprechen sind, nämlich die Sicherung der eigenen Scholle vor feindlichen Einflüssen. Dann werden diese alten Bräuche nicht absterben, sondern – wenn auch in andren, zeitgemäßen Erscheinungsformen – ihre Auferstehung feiern.
Wir wissen, daß unsre Vorfahren einst den erworbenen Grund und Boden mit Feuer umschritten, wenn sie ihn in Besitz nahmen. Er sollte gereinigt werden. Alle schädigenden Dämonen sollten verbannt werden. Diese anfänglich nur einmalige[117] Handlung wurde schließlich jährlich beim Beginn der Feldarbeit und des Weideauftriebes vorgenommen, also im Frühling. Darum auch die verschiedenen Termine von vor Ostern bis zum Himmelfahrtstage. Man umschritt nicht mehr die Felder, man umritt sie unter strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Einzelhandlungen. Nach nordgermanischen Quellen wurde Feuer umhergetragen, nach altdeutschen Quellen können auch Götterbilder an die Stelle des Feuers getreten, auch beides verwendet worden sein. Die Kirchenversammlungen eifern fortgesetzt gegen diese Flurumgänge. Das Volk läßt nicht ab davon. Darum verzichtet die Kirche auf die Ausrottung und hieß den Priester mit dem Kruzifixus oder dem Schutzheiligen des Ortes oder der Maria im feierlichen Zuge die Fluren segnend durchwandeln. Gesang, Glockenklang begleitete die Schar. Lärmen, Poltern, Schlagen, Feuern, Fegen dienten aber bereits in vorchristlicher Zeit zur Vertreibung der schädigenden Dämonen oder Geister oder Seelen, die gerade vor Ostern eine ihrer Urlaubszeiten hatten. In evangelischen Gegenden verblaßten die Bräuche nach und nach. Am längsten hat sich das Ostersingen der Kinder noch gehalten.
Wenn es unsrer Zeit gelingen sollte, den Landhunger zu stillen, dann wird mancher dieselben Gedanken und Gefühle in sich verspüren, wenn er sein Besitztum umschreitet, wie die Saatgänger und Saatreiter von ehedem und von heute. Jedes Jahr wird er wünschen, daß der Boden den in ihn verarbeiteten Fleiß und Schweiß mit guter Ernte segnen möge. Ob das mit dem Priester oder ganz allein oder mit der Familie geschieht, spielt dabei keine Rolle. Es bleibt eine Zwiesprache mit seinem Besitz, der ihm neue Kraft, neues Leben schenken soll, also ein religiöses Erlebnis: Verbundensein und Verpflichtetfühlen der Scholle gegenüber als Nutznießer der Vergangenheit, als Vorarbeiter der Zukunft.
Noch eins ist mir beachtlich. Das ist der soziale Zug im Saatreiten. Nicht der einzelne wünscht den Segen für seine Flur, sondern das ganze Dorf, zwei Dörfer, eine ganze Landschaft. Einer fühlt sich dem andern verpflichtet. Gleichmäßig soll der Boden den Segen auf die verteilen, die er trägt.
Mag auch unsere Zeit, wenn sie den Landhunger einzelner zu stillen vermag, dafür sorgen, daß diese nicht satt werden und träge und die andern vergessen, sondern daß in allen das Verbindlichkeitsgefühl den andern gegenüber wachbleibe wie unter den Saatreitern von Marienstern und anderwärts.
Weite Kreise unsres Volkes bringen in der Gegenwart der Volkskunde und ihren Stoffen mehr oder weniger aufrichtige Teilnahme entgegen. Ja, wer den literarischen Markt als einen Gradmesser der vorhandenen seelischen Bedürfnisse betrachtet, kann mit gutem Gewissen von einer Hochkonjunktur der Werte sprechen, die von den Komplexen Heimat und Volkstum bezeichnet werden. Der Grund dieser Erscheinung ist leicht zu erkennen. Ein Volk, das vom Mutterleibe aus beherrschend seine Glieder über die ganze Welt ausstreckte, mußte seine Hauptenergien auf die Expansionsbewegungen der Glieder verwenden, hatte nicht Zeit, dem[118] Herzschlage seiner Brust zu lauschen. Nun ist die weltumspannende energische Gestalt unsrer Volkskraft in ein klägliches Gebilde zusammengeschrumpft, nun ist der Erdleib unsres Landes verstümmelt worden; grausam zurückgeworfen von allem Drängen nach außen, finden wir uns fassungslos in unserm Innern wieder. Und wie aus schwerer Betäubung Erwachende greifen wir mechanisch nach dem, was uns am nächsten ist. Und erst als die Starre unsrer Augen weicht, erkennen wir, daß wir in unsern Händen Köstlichkeiten halten.
Die Menschen, die in einem innern Verhältnis zur Volkskunde stehen, scheiden sich in zwei Typen. Der eine ist der des Volkskundlers. Er tritt mit Objektivität und wissenschaftlichem Rüstzeug an seinen Gegenstand heran. Seine Haupteinstellung ist im weitesten Sinne kulturhistorisch. Dabei ist der Begriff kulturhistorisch nicht nur im Sinne des Vergangenen zu verstehen. Für den wahrhaften Volkskundler ist die Erkennung und Darstellung der unzähligen Lebensformen mit ihren Ausstrahlungen innerhalb des lebendigen Volkes eine mindestens ebenso wichtige Aufgabe wie Sammlung und Bearbeitung der Niederschläge der Vergangenheit. Der Volkskundler leistet der Soziologie und Volkswirtschaft wertvollste Dienste. In der seelischen Struktur des Volkskundlers ist neben der theoretischen Einstellung ein starker Gefühlseinschlag erkennbar. Diese Gefühlsschwingungen schaffen den liebenswürdigen, lebenverstehenden und darum belebenden Typus des gelehrten Volkskundlers, den wir alle kennen. Aber diese Gefühlsmomente sind gebändigt in kritischer Beherrschung.
Neben dem Volkskundler steht heute als eine weitverbreitete Erscheinung der Enthusiast. Besonders in gewissen Kreisen der Jugendbewegung ist er zu finden. Seine Einstellung den volkskundlichen Werten gegenüber ist durchaus gefühlsmäßig. Zwei Seelenhaltungen kreuzen sich und ballen sich zu einer Einheit in seinem Innern: die ästhetische und die nationale. Dieser Komplex wird von einem schwärmerischen Willen in überwiegender Weise in die Vergangenheit getrieben. Da in dieser Seelenstruktur gewisse Ähnlichkeiten mit der einiger Vertreter der romantischen Bewegung vor reichlich hundert Jahren liegen, wollen wir diesen Typus den romantischen Enthusiasten nennen. Der romantische Enthusiast flieht die harte, nüchterne, individualistisch zerstiebte deutsche Gegenwart. Er haßt die Zivilisation. In der deutschen Vergangenheit, wie er sie sieht, findet er Kultur. Da herrschen strenge Bindungen im Staatsleben, in Religion, Kunst, Gesellschaft. Und in diese würdig-heiteren Zeiten sehnt er sich zurück. Allen Denkmalen irgendwelcher Art, die aus diesen vergangenen Jahrhunderten bis zu uns gekommen sind, zollt er rückhaltlose Bewunderung, stumme oder laute Ehrerbietung. Elegisch ist die Grundstimmung seines Geistes. Sein Wille wird aktiv, wenn er altes Volksgut zu neuem Leben zu erwecken sucht.
Von diesem romantischen Enthusiasten wollen wir einen andern enthusiastischen Typus scheiden. Auch dieser wendet seine seelische Kraft der deutschen Vergangenheit zu, aber er kennt nicht die schwärmerische Melancholie des erstgeschilderten Typus. Sein Wille erstrebt Gestaltung der deutschen Gegenwart und Zukunft durch deutsche Vergangenheit. Da suchen die überschwenglichsten Geister in schauender Ekstase die Urform deutschen Wesens zu erfassen, da trachten die kühleren, besonneneren[119] danach, die Kristallisationsgesetze der Leibwerdung deutschen Geistes zu erkennen, beide aber beschauen die deutsche Vergangenheit, um mit den gewonnenen Einsichten als Richtlinien die deutsche Gegenwart zu gestalten. Nichts Abgestorbenes, Entblutetes soll wieder verlebendigt werden, aber die machtvolle Kraft deutschen Wachstumgesetzes soll neue Ringe, neue Äste, Laubwölbung und Früchte hervortreiben. Wir grüßen dich, deutsche Jugend- und Manneskraft, die an diesem Werke wirkt.
Friedrich Sieber, Löbau.
Von Dr. Martin Große, Dresden
Heimatboden und Heimatgeschichte gehören unauflöslich zusammen, und so ist es recht und billig und dankenswert, daß der Landesverein Sächsischer Heimatschutz nicht nur die heimatliche Landschaft »allen Gewalten zum Trotz« zu erhalten sich bestrebt, sondern daß er auch die Förderung heimatlicher Geschichte sich angelegen sein läßt und seine »Mitteilungen« bereitwilligst der Erörterung kulturgeschichtlicher Fragen öffnet. Dadurch lernt der außerhalb der grün-weißen Grenzpfähle so gern bespöttelte Sachse sein Land und Volkstum lieben und stolz sein auf das, was vergangene Jahrhunderte an wertvollem und erhaltenswertem Kulturgut geschaffen haben.
Schon von diesem allgemeinen Gesichtspunkt aus gesehen, ist es sehr verdienstlich, daß Dr. Koepert die Geschichte des Jägerhofes zu Dresden bearbeitet hat. Der in Heft 10/12 (Bd. XI) veröffentlichte Aufsatz, der die Baugeschichte, die kurfürstliche Menagerie, das Jagdwesen usw. behandelt, führt aber auch aus der sächsischen Heimat hinaus in den dunkeln Erdteil Afrika, indem er sich ziemlich ausführlich mit der Hebenstreitschen Expedition nach Nordafrika (1731/33) befaßt. Der Verfasser stützt sich dabei ausschließlich auf den im Jahre 1865 von dem damaligen Archivdirektor K. von Weber im Archiv für sächsische Geschichte (Bd. III) veröffentlichten Bericht, während ihm eine im Jahre 1902 erschienene Arbeit[5], die ausschließlich jene Reise zum Gegenstande hat, unbekannt geblieben zu sein scheint.
Von den Hebenstreitschen Reisebriefen an den Kurfürsten August den Starken erschien die eine Hälfte gedruckt 1783, die andere, wichtigere gar erst 1865 in dem erwähnten Weberschen Auszuge. Einer von Hebenstreits Reisebegleitern war Christian Gottlieb Ludwig, damals stud. med. in Leipzig. 1709 in Brieg (Schlesien) geboren und aus dürftigsten Verhältnissen stammend, verlebte er eine sorgenschwere Kindheit und Studienzeit. Nach der afrikanischen Reise vollendete[120] er seine Studien und starb 1773 in Leipzig als Professor der Medizin, Dekan und Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Die literarischen Fähigkeiten des jungen Ludwig erfreuten sich der wohlwollenden Förderung Gottscheds. 1765/66 war der junge Goethe regelmäßig Tischgast des Ludwigschen Hauses und hat dort vor allem in naturwissenschaftlicher Beziehung mancherlei Anregung erhalten.
Erst zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts führte ein glücklicher Zufall zur Entdeckung des von Ludwig verfaßten, wertvollen handschriftlichen Reiseberichts in der Universitätsbibliothek zu Leipzig (»Observationes miscellaneae Durante Itinere Africano Scriptae, 1731/33«). Dieses Reisetagebuch von vierhundert engbeschriebenen Quartseiten Umfang als Hauptquelle und andere neuaufgefundene Akten und Handschriften lassen die sächsische Afrikaexpedition von 1731/33 in einem ganz anderen Licht erscheinen als früher. Die von einem sächsischen Fürsten ausgesandte, aus sechs wissenschaftlich gebildeten Mitgliedern bestehende, in einem großen Stil angelegte und nur zu wissenschaftlichen Zwecken bestimmte Expedition eröffnet das Zeitalter der wissenschaftlichen Forschungsreisen.
Es kann nicht Zweck dieses Aufsatzes sein, auf die Reise selbst einzugehen, so wichtig ihre Stellung in der Geschichte der Entdeckungen ist, wohl aber dürfte manchen unsrer engeren Landsleute die Vor- und Nachgeschichte jener einzig dastehenden sächsischen Afrika-Expedition interessieren.
Das Archiv der Generaldirektion der Staatssammlungen enthält ein bisher unveröffentlichtes Aktenstück, das sich auf die Hebenstreitsche Afrikareise bezieht. Es umfaßt u. a. eine Zusammenstellung Hebenstreits über seine und seiner Reisebegleiter Pflichten, eine »Beylage derer Sachen, welche insonderheit anzuschaffen mich äußerst bemühen werde« (Quadrupedia, Volabilia, Insecta, Pisces, Partes animalium, Vegetabilien, Marinische Gewächse, Mineralien). Der in demselben Aktenstück befindliche ausführliche Reiseplan, den Hebenstreit dem König überreichte, läßt uns einen Begriff gewinnen, welche vielseitigen Aufgaben die Reisegesellschaft zu erledigen sich vorgenommen hatte. Da dieser Reiseplan für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Forschungsreisen gleich wichtig ist, sei er hier in seiner ganzen Ausdehnung wiedergegeben, und das um so mehr, als er bisher noch niemals veröffentlicht worden, also gänzlich unbekannt geblieben ist. Er hat folgenden Wortlaut:
»Nachdem ich auf allerhöchsten Königl. Befehl die Reiße nach Africa übernommen und zu gewißenhafter Verwaltung meines Ampts bereits den Eyd der Treue abgelegt, habe ich zu Ausfertigung meiner Instruktion nach Vorschrifft theils derer von Ihro Königl. Majesté erhaltenen Befehle, theils derer von dem Herrn Hoffrath und Leib Medico von Heucher gegebene Nachrichten folgende puncte entworffen:
Ich soll zwar in allen Reichen der Natur das seltsamste und der attention eines Königs würdigste aufnehmen, vornehmlich aber ist Ihro Kgl. Maj. allerhöchster Wille, lebendige Tiere von allen möglichst zu erhaltenden Arten zu übersenden, von welchem Hauptpunkte als der vornehmsten Absicht ich durchaus nicht abweichen soll. Darnach werde ich mich bemühen, nachdem ich verstanden, daß dieses des Königs Wille sey
[121]
1.) Einige wohlgewachßene junge gesunde, meiner Statur gleich seyende oder auch übertreffende Mohren auf dem Sklaven Handel zu Guinea oder sonst woher zu erkauffen, und werde ich mich, wegen der Anzahl dieser, nach der Bequemlichkeit des Transports richten.
2.) Barbarische Pferde, von der wahrhaften Race, so wie solche in denen Ställen derer Deys und Könige allein unterhalten werden, zu erhandeln, wobey ich mich des Raths der Sache Kundiger bedienen und da bekandt, daß gedachte Pferde gegen Gewehre vertauscht werden, den Handel mit Zuziehung eines Consuls einer Europäischen Nation, welcher die Garantie über sich nehmen soll, zu seiner Richtigkeit bringen werde.
3.) Ich werde etliche Elephanten erkauffen, die ich baldmöglichst in denen Europa näher gelegenen Küsten aufnehme, umb diesen Thieren die Ihnen beschwehrliche Schiff Fahrt kürtzer zu machen, und da ein weiter Weg zu Lande biß hieher gleichfalls zu evitieren, werde ich solche auf Amsterdam gehen laßen, und soll ich zu dererselben und anderer Thiere und Sachen, deren ich soviel als möglich eine Anzahl auf einmahl senden will, Begleitung einen meiner Gefehrten mitsenden, welcher die Verpflegung, Speiße, Gewohnheiten und Krankheiten derer Thiere und deren Cur erlernet habe; bemeldetem Studioso kan ein oder mehrere Thier Wärter zugeordnet werden.
4.) Ich will einige Strauße verschiedenes Geschlechts aufnehmen, und diejenigen Nachrichten einziehen, welche zu der Vermehrung dieser Thiere allhier etwas beytragen können.
5.) Ich werde mich bemühen, junge Löwen beiderley Geschlechtes, junge Leoparden, Panther, seltene Arten von Affen und Pavians, Africanische Esel und Maulthiere, Afrikanische Hirsche und Rehe, insofern solche von denen bereits gegenwärtigen unterschieden sind, Rhinocerose, auch Casuarios, Vauvaux, oiseaux de Couronne, auch andere Thiere wie sie Nahmen haben mögen, daferne sie frembde und in denen Königlichen Thier Häußern noch nicht vorräthig sind, zu bekommen, welche alle ich doppelt nehmen und wohl besorgen will.
6.) Gedachter Thiere Squelette, Häute, sonderlich schöne Vögel so wie sie Nahmen haben mögen, will ich auf möglichste Art und Weiße zu acquirieren suchen, und diejenigen, welche unmöglich lebendig zu überbringen sind, ausgestopft oder gemahlt, auch genugsam beschrieben einsenden.
7.) Ich will die Historie derer Fische auf das genaueste untersuchen, und nach dem mir dießfalls gemachten Entwurf dieselben getrocknet oder in Spiritu Vini conserviret, samlen, auch mich bemühen, von denen großen Meer Fischen zum wenigsten einige Theile zu erhalten.
8.) Hiernächst will ich nach dem schon bemeldeten Haupt Entzwecke große Thiere zu erhalten, die Conchylien, auch fliegende oder kriechende Insecta, insonderheit Schlangen und dererselben verschiedene Arten, genau observiren, und was von denenselben ganz oder in Theilen oder genau gezeichnet überkommen werden kan, sammlen und wohl verwahren und überhaupt nichts verabsäumen, was zu der Vollkommenheit der Natürlichen Historie von denen Thieren einigen Beytrag thun kan.
[122]
9.) Insonderheit befehlen Ihro Königliche Majestät, aller Nationen, welche ich zu sehen Gelegenheit haben werde, Kleidungen, Getränke, Speiße und darzu und zu andern Verrichtungen bei Ihnen übliches Geräthe, auch Kriegs-Instrumente, Bogen, Pfeile und Gewehr, wie es Nahmen haben mag, wie nicht weniger die aus Häuten verschiedener Thiere bei Ihnen gemachte impenetrablen Schilder, die daselbst gewöhnlichen Vergifftungen derer Pfeile und dergleichen, auch Pagoden, und was sonst zum Heydnischen Gottesdienst gehört, wie auch Musikalische und zu denen Spielen gebräuchliche Instrumente, nebst Betten und Haußgeräthe und andere die Sitten und Gewohnheiten derer Völker angehende Dinge aufzunehmen und einzubringen.
10.) Aus dem Reiche der Vegetabilia werde ich die frembden Africanischen Kräuter in möglichster Vollkommenheit auflegen, dererselben Saamen frisch sammeln und zu künfftigem Wachßthum frembder Kräuter in Ihro Majestät Garten Anstalt machen, auch von denen eßbaren Früchten, die bey uns nicht bekandt sind, die Arten zu bekommen trachten, die fruchttragenden und andere seltene Africanische Bäume, so viel es sich tun läßt aufnehmen, sonderlich die Cultur des Zucker Rohrs und deßen Zubereitung erlernen, überhaupt alles thun, was zu Vermehrung der Kräuter Wißenschaft dienen kan.
11.) Die Meergewächse will ich genau untersuchen und große Cabinet-Stücke von allen Arten derer Corallen, Schwamm und Horn Gewächße, wie auch Botanophyta und was vermöge der in Händen habenden Notiz von diesen Sachen zu Vermehrung derer Samlungen in denen Königlichen Cabinets gereichen kann, aufnehmen und übersenden.
12.) In dem Reiche derer Mineralien will ich die vorfallenden Gelegenheiten allerhand Stuffen und Berg Arten, Quartze, Drußen, Steine, Marmor, Achat, Jaspis und was in diese Sammlung gehört, zu erhalten, wohl inacht nehmen, insoferne hierinne etwas gefunden werden kan, das in dem Berg-Cabinet Ihro Königl. Majestät noch nicht vorräthig ist.
13.) Hiernächst werde ich besorgt seyn, die vorkomenden Antiquitäten, Monumenta, Inscriptiones, Manuscripta, Mahlereyen, auch Contrefaits derer Königlichen und anderer der attention würdigen Persohnen zu acquiriren, wie nicht weniger die alten Punischen, Vandalischen und andern Nummos (Münzen), nach einer besonderen von Herrn Hoffrath Fritschen gegebenen Instruction aufzunehmen.
14.) Sollte ich auf meiner Reiße durch Europa biß Marseille in einigen Cabinets derer Curiosen etwas seltenes observiren, werde ich, umb die Zeit nicht zu verliehren, von demselben an des Herrn Geheim Raths von Brühl Excellentz genaue Nachricht geben, oder auch nach Beschaffenheit der Sache dasselbe würcklich ankauffen.
15.) Und da ein mehreres Gelegenheit, Zeit und Art angeben dürffte, werde ich auf alle Umbstände genau acht haben, und was auch gegenwärtig nicht übersehen werden kan, dennoch sobald sich der Fall ereignet, ohne Vorschrift nach Pflicht und Gewißen untersuchen und aufbringen.
16.) Zu dieser Reiße haben Ihro Königl. Majestät mir dreyer Jahre Zeit allergnädigst ohngefähr vorgeschrieben.
[123]
17.) Auch habe ich Erlaubniß erhalten, nach vorfallenden Umbständen in einigen Orten nach Erforderung der Nothwendigkeit zu bleiben oder auch von dem ordentlichen Wege hier oder dahin abzuweichen, wenn Ihro Königl. Majestät Nutzen dadurch befördert werden kann.
18.) Und da ich in Erfahrung bringen könnte, daß in denen entlegenen Provinzen mit einigen Waaren vortheilhaftig gegen andere Seltenheiten könte umbgesetzt werden, haben Ihro Königl. Majestät erlaubt, einigen Vorrath statt baaren Geldes in Marseille oder sonst zu nehmen.
19.) Es haben Ihro Königl. Majestät die Gnade gehabt zu versichern, daß dieselben die ohngefehren Unglücks Fälle bey möglichst gebrauchter Vorsicht mir oder meiner Gesellschaft nicht zurechnen wollen.
Es haben Ihro Königl. Majestät aus dero Procuratur Amte mir jährlich 200 Rthlr. pension allergnädigst ausgemacht.
Es haben Ihro Königl. Majestät zu meiner Verpflegung mir täglich 2 Rthlr., jedwedem derer Gefehrten 16 Gr. allergnädigst angewiesen, über welche tägliche 16 Gr. ich einen jedweden zu fernerer Nothwendigkeit jährlich 200 Rthlr. reichen soll.
Ich soll die auf Voiture, Quartiergeld und würckliche Ankäuffe gewendete Gelder berechnen und ordentlich, soviel es die Gelegenheit erlaubet, die Belege und Rechnungen hiervon einschicken.«
Auf Grund dieses Reiseplans ist nun, vielleicht vom Hofrat von Heucher, von dem der Gedanke der Afrikareise zu stammen scheint, eine Instruktion[6] ausgearbeitet worden, die sich in ihren wissenschaftlichen Bestimmungen ziemlich eng an Hebenstreits Reiseplan anschließt. Als neu dem Reiseplan gegenüber tritt auf, daß Hebenstreit seine Untersuchungen in der Barbarei beginnen soll: »Von dar soll er nach Guinea, und nach vollbrachter Expedition daselbst nach Capo di Bonna Espenanza abgehen und von dar nach denen andern Ländern, wie er vor gut befinden wird.« –
Dreizehn Monate (vom 16. Februar 1732 bis 14. März 1733) dauerten die Landreisen durch Algerien, Tunesien und Tripolis, über deren Ergebnisse Hebenstreit sagt: »Wir kamen glücklich nach Tunis zurück nachdem wir Alles gethan, was ein Frembder in einem feindseeligen Lande verrichten kann, gestalten wir biß an das Ende des bewohnten Africa 60 Teutsche Meilen gegen Süd gereiset und einen Vorrath von seltenen Kräutern, Versteinerungen, alten Römischen Aufschrifften und Nachrichten von den Sitten und Gewohnheiten dieser Völker erlanget hatten.«
Am 17. April 1733 reiste Ludwig, dessen Gesundheitszustand eine Weiterreise verbot, mit einem Transport lebender Tiere zu Schiff von Tunis über Gibraltar nach Hamburg (Ankunft am 15. Juli). Dort wurde er belästigt »durch die Neugier der Leuthe, die vorwitzig waren, die mitgebrachten Sachen zu sehen.« Er dang einen magdeburgischen Schiffer zum Transport der Tiere nach Dresden; die Fahrt elbaufwärts dauerte vom 6. August bis 12. September. »Er übergab am 13. September die Thiere im Beyseyn Ihro Excellenz des H. Oberlandjägermeisters H. von Erdmannsdorff und den 14. geschahe ein gleiches mit den Curiosis welche in die[124] Gallerien unter der Aufsicht des H. Hofraths und Leib-Medici Baron von Heuchers kamen.« Außer den lebendigen Tieren sind also »allerhand Curiositäten, an ausgestopften raren Vögeln, Insecten, Fischen, Kräutern, Zeichnungen, Abriß und dergleichen mehr« nach Dresden gebracht worden.
Am gleichen Tage wie Ludwig verließ auch Hebenstreit mit seinen Begleitern den afrikanischen Boden. Er ging zunächst nach Marseille, um von dort aus mit einem Schiffe der »Compagnie des Indes« die Weiterreise nach Westafrika anzutreten. Inzwischen war (am 1. Februar, nicht am 1. Dezember) August der Starke gestorben. Der Kunde davon folgte bald der Befehl zur Rückreise zugleich mit der Ernennung Hebenstreits zum Professor an der Universität Leipzig. In Briefen aus Marseille (vom 15. Mai) an den Kurfürsten und an den Grafen Brühl bat Hebenstreit unter Hinweis auf den unsterblichen Nachruhm, den die Ausführung der Reise in dem geplanten Umfang, also bis Guinea und Kap der Guten Hoffnung, »Ihro Höchstseeliger Majestät« bringen werde, und unter Betonung der Bedeutung der Reise für die Wissenschaft, seinem ursprünglichen Plane folgen zu dürfen, »zumahl ich von der noch übrigen Summa derer 7000 fl. Holl. das Werck auszuführen gedächte,« aber die Bitte fand kein geneigtes Ohr. Enttäuscht trat der kühne Forscher, dessen Berichte von nun an verstummen, mit seinen Gefährten die Rückreise nach Dresden an, wo sie am 20. September eintrafen.
Die Gesamtkosten der Reise beliefen sich auf 14 958 Rthlr. 17 Gr. 1 Pf. Die Bitte Hebenstreits, den Überschuß der Reise (1304 Thaler) verwenden zu dürfen »zur Anfertigung einer Reisebeschreibung mit Kupfer-Stichen nach dem Sinn und Meinung Höchstseeligster Majestät und zum Andencken einer der großen Thaten Augusti, gestalten diese Reise von aller Welt dazu gezählet wird,« wurde nicht gewährt. Ist es unter diesen Umständen zu verwundern, daß die Afrikaforscher und ihr Werk vergessen wurden? Leider vernichtete ein unglückseliges Schicksal auch die Sammlungen, die den Ruhm der sächsischen Afrikareisenden späteren Geschlechtern hätten künden können; sie befanden sich in dem Teile des Zwingers, der bei den Dresdner Maiunruhen 1849 durch eine Feuersbrunst zerstört wurde. Unersetzlich ist vor allem der Verlust der zahlreichen Zeichnungen des Malers der Expedition, Christian Friedrich Schubarth. Daß die mitgebrachten Samen afrikanischer Pflanzen zur Bereicherung der botanischen Garten verwendet worden sind, läßt sich von Dresden annehmen, für Leipzig nachweisen. Die Ansicht jedoch, daß die ältesten Stämme der jetzt in Pillnitz und Großsedlitz befindlichen Orangerie ein »Mitbringsel« von der afrikanischen Reise seien, ist unhaltbar. Nicht nur, weil zeitgenössische Zeugnisse fehlen, sondern auch wegen der Unmöglichkeit der physischen Voraussetzungen muß man es als Legende bezeichnen, daß Hebenstreit »eine Anzahl (400) von Orangenbäumen, zu Drechselholz bestimmt, mitgebracht habe, welche in Dresden umgekehrt eingepflanzt, Wurzel geschlagen hätten.«
So müssen wir uns bescheiden, in den handschriftlichen Berichten der beiden Reisenden die einzigen, und daher um so wertvolleren, uns übermittelten Reiseergebnisse zu sehen. Die obenerwähnte Arbeit aus dem Jahre 1902 hatte sich nur das Biographische über die Teilnehmer, ferner Vorgeschichte, Verlauf und Nachgeschichte der Reise sowie das Schicksal der Sammlungen, endlich die Stellung der[125] Expedition und der Reiseberichte in der Wissenschaft zum Ziele gesetzt. Von dem reichen naturwissenschaftlichen, völkerkundlichen und geographischen Inhalt der Hauptberichte ist noch nichts wissenschaftlich bearbeitet worden außer den Inskriptionen. Die von Hebenstreit gesammelten sind 1881 im Corpus Inscript. Latin. erschienen. Das Tagebuch Ludwigs enthält zweiundfünfzig römische Inschriften, von denen zwölf nur in seinen Abschriften erhalten zu sein scheinen. Diese hat Professor Dr. Fiebiger, Dresden, in den Jahresheften des Österreich. Archäol. Instituts veröffentlicht. (Wien, 1902.)
Trotz zahlreicher kürzerer Erwähnungen in der sächsischen Literatur, die allerdings die Bedeutung der Hebenstreitschen Forschungsreise nicht ahnen ließen, hat sich niemand veranlaßt gesehen, sie näher zu erforschen. Kein Wunder also, wenn die Geschichten der Entdeckungsreisen Hebenstreit gar nicht erwähnen oder nur mit wenig Worten abfertigen. Für Ludwig dasselbe nachzuweisen, erübrigt sich, da dessen Reisebericht bis vor zwei Jahrzehnten unbekannt geblieben ist. Von der Naturwissenschaft sind die beiden Forscher mehr gewürdigt worden. Ihr großer Zeitgenosse Linné (1707/78) hat den Reisenden Pflanzengattungen gewidmet, eine Hebenstreitia und eine Ludwigia. Auch tragen nach einer Mitteilung Georg Schweinfurths, des Nestors der deutschen Afrikaforscher, verschiedene Pflanzenarten Ludwigs Namen, so u. a. die in Nordafrika und Syrien weitverbreitete Wüstenpflanze Althaea Ludwigii.
Daß Hebenstreit wie Ludwig Deutsche waren, daß sie gerade an unsrer sächsischen »alma mater« gelernt und gelehrt haben, erfüllt uns mit freudigem Stolz. In Sachsen und seiner Hauptstadt, die einen wesentlichen Teil ihrer Schönheit August dem Starken verdankt, feiert man diesen Fürsten naturgemäß in erster Linie als genialen Bauherrn und Veranstalter von prunkvollen Festen. Es ist mir eine Freude, daß ich ihn im vorstehenden auch als Förderer der Naturwissenschaften habe bezeichnen und das Interesse weiterer Kreise auf die von ihm ausgesandte Afrika-Expedition habe lenken dürfen, die in der kulturgeschichtlichen Entwicklung unsres engeren Vaterlandes einzig dasteht.
[5] Dr. Martin Große: Die beiden Afrikaforscher Johann Ernst Hebenstreit und Christian Gottlieb Ludwig, ihr Leben und ihre Reise. (Leipz. Diss. v. 1902.) Anmerkung des Herausgebers: Der Verfasser hat eine beschränkte Anzahl Exemplare für Heimatschutzzwecke zur Verfügung gestellt; sie können von der Geschäftsstelle (Schießgasse 24) zu einem Grundpreise von 0,75 M. (multipliziert mit der jeweiligen Teuerungsziffer) bezogen werden.
[6] Siehe »Die beiden Afrikaforscher Hebenstreit und Ludwig« …, S. 26–28.
Von Cornelius Gurlitt
Eines Tages besuchte mich Prof. William Lossow, der Mitbesitzer der Architektenfirma Lossow und Viehweger, und zeigte mir den Entwurf zu einem Geschäftshaus für die Firma Herzfeld, das am Altmarkt zu errichten sei. Bedingung sei, daß die Fassade als Reklame für die Firma wirke, und daß das alle Geschosse in Anspruch nehmende Warenhaus möglichst ein großes Schaufenster darstelle, also möglichst viel Glasfläche biete. Lossow hatte den damals üblichen Barockstil gewählt, d. h. den Stil, der sich im Überbieten des heimischen Barock gefiel. Er erklärte, daß er versucht habe, die Firma Herzfeld zu einem Herabstimmen ihrer Anforderungen an Aufwand und Auffälligkeit zu bewegen, daß das aber vergeblich gewesen sei.
[126]
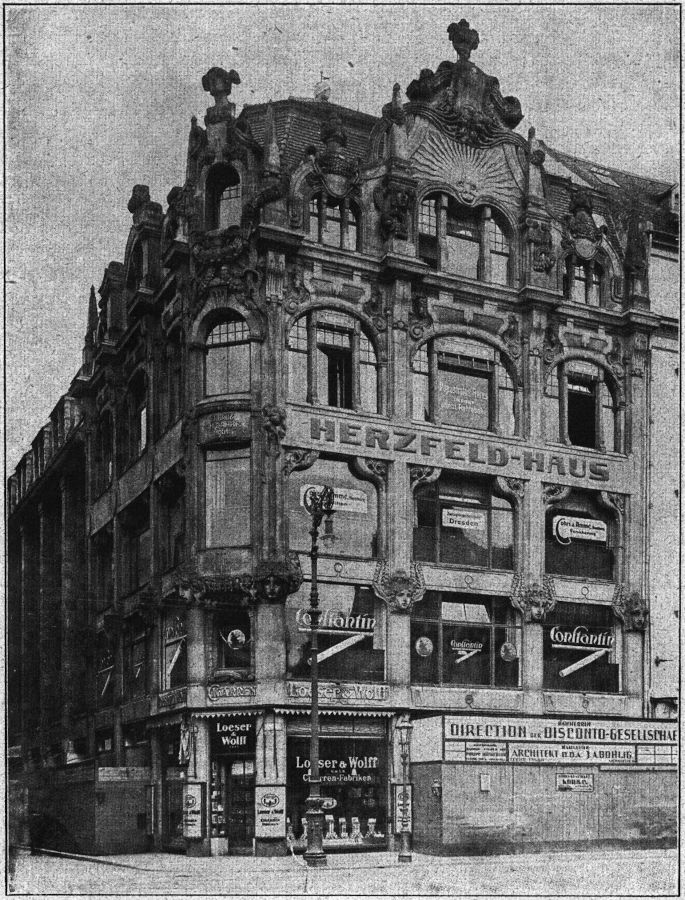
[127]

Es war wohl auf Lossows Einfluß zurückzuführen, daß mich die Baupolizei einlud, an der entscheidenden Sitzung teilzunehmen. Wenigstens ist dies der einzige[128] Fall geblieben, in dem ich gehört wurde. Der Dezernent, Stadtrat Kretschmar, stellte mir nach dem Wortlaut der Bauordnung für die Stadt Dresden die Frage, ob der Bau »der Stadt zur Unzierde gereiche«. Ich wies auf einzelne Punkte hin, nämlich zunächst auf die Gestalt der Öffnungen und die praktischen Fehler, die die Kaufleute machen, wenn sie zu große Glasflächen verlangen. Wer heute solche an anderen Bauten betrachtet, wird sehen, daß sie in den Obergeschossen bis zu zwei Meter vom Fußboden mit Teppichen oder dergleichen verhängt sind, weil sie die Benutzung des Innenraumes beeinträchtigen, ohne für den Beschauer von außen nur einigermaßen ersprießliche Schaufläche zu bieten. Zweitens, daß an Schmuckwerk gespart werden könne. Allerdings seien ähnlich überladene Schauseiten nicht lange vorher am Rathausplatze genehmigt worden. Und drittens bat ich, daß die Abschrägung der Ecke unterbliebe, da sie die Geschlossenheit der Marktwand beeinträchtige. Sollte die Schauseite etwa am Ende einer Straße als Abschluß stehen, so sei ihre Ablehnung nicht berechtigt. Aber da sie durch Maßstab und Formgebung den älteren Bauten des Altmarktes widerspreche, lautete mein Gutachten: Die Fassade gereicht nicht der Stadt, wohl aber dem Altmarkt zur Unzierde!
Dabei sprach ich mein Bedauern darüber aus, daß nicht auf Grund des Gesetzes gegen Verunstaltung von Stadt und Land ein Ortsregulativ für den Altmarkt geschaffen worden sei. Man sagte mir, dies sei im Augenblick nicht möglich und die Bewilligung oder Ablehnung der Fassade dränge. Ich mußte zugeben, daß dies berechtigt sei. Denn es hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn man in die Feuerversicherungsgesellschaft geht mit dem Ruf: Schnell versichern, mein Haus brennt schon! Mein Gutachten wurde als »unstatthaft« abgelehnt, die Fassade genehmigt.
Nun hat J. A. Bohlig, Architekt (BDA.), mit verständnisvoller Unterstützung der Bauherrin, der Disconto-Gesellschaft, den Bau umgestaltet, und zwar dabei so gründlich als möglich mit dem Beiwerk aufgeräumt. Es ist nichts mehr »dran« an der Schauseite, aber sie ist ruhig, einfach, der Umgebung angemessen geworden, hat somit an sich und als Teil der Wand des Marktes in künstlerischer Beziehung ganz außerordentlich gewonnen. Die Schäfte sind breiter, die Teilungen der Fenster schlichter und würdiger geworden, das Ganze hat Ruhe und Vornehmheit erlangt. Das zu erreichen war auch in technischer Hinsicht keine Kleinigkeit. Aber Dresden kann sich beglückwünschen, nun dort ein Haus zu haben, das dem Altmarkt nicht zur Unzierde gereicht, wie so manche andere es noch tun.
Wann aber kommt das Ortsgesetz für den Altmarkt? Dabei handelt es sich viel weniger um die Erhaltung der einzelnen Formen: Es ist nicht mehr eben viel, was an ihm Altertumswert hat. Aber es handelt sich um die Fortsetzung seiner Entwicklungsgeschichte: Im Mittelalter umgaben ihn Häuser mit einem Obergeschoß und Giebeln; Renaissance, Barock und Rokoko bauten auf diese mehrere Geschosse auf. Ich halte es nicht für unkünstlerisch, wenn die Not an umbauten Raum drängt, in diesem »Aufstocken« noch weiterzugehen, wenn dabei nur eine feste Hand unkünstlerische Lösungen verhindern kann, wenn nur ein einheitlicher Wille den verschiedenen zum Bau berufenen Architekten nicht etwa Formen aufzwingt, sondern sie vor lästigen Eigenbrödeleien des Bauherrn schützt.
Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden
Herausgegeben und verlegt vom Reichsamt für Landesaufnahme,
Berlin NW 40, Kronprinzenufer 15
Wir hatten schon öfter Gelegenheit festzustellen, in welch erfreulicher Weise es das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Unterabteilungen verstanden haben, sich der neuen Zeit anzupassen und Kartenwerke herauszubringen, die den Bedürfnissen des Wanderers ebenso entgegenkommen wie den Wünschen des Heimatforschers und Erdkundelehrers. Ich erinnere nur an die vielen bereits erschienenen Einheitsblätter (Zusammendrucke von je vier »Generalstabskarten«), die Spezialkarte des Schrammsteingebiets 1 : 10 000 und ähnliche Erscheinungen. Das ist um so erfreulicher, als durch die Volkshochschule, die Schule (vgl. z. B. die neuen sächsischen Lehrpläne) und die Wander- und Jugendorganisationen die amtlichen Karten zu einer Verbreitung gelangt sind wie nie zuvor. Schon vor dem Kriege war eine Sammlung von vierzig Blättern der Karte 1 : 100 000 erschienen, die der Berliner Verein für Erdkunde durch seinen Assistenten Dr. Walter Behrmann mit hervorragenden Erklärungen für Unterrichtszwecke hatte erscheinen lassen. Es dürfte heutzutage keine Schule und keinen Verein, der Bildungsarbeit treibt, mehr geben, der diese Sammlung nicht in seinem Besitz hätte. Ihr stellt sich nun die neue Sammlung von dreißig Meßtischblättern würdig zur Seite. Auch derjenige, der sich täglich mit Karten und ihrer Ausdeutung beschäftigt, ist erstaunt, wenn er eine solche Sammlung von topographischen Karten aus den verschiedensten deutschen Gegenden vor sich hat, wieviel sich aus ihnen herauslesen läßt. Die Steilküsten Rügens wie die Flachküsten der Nordsee, Marsch und Geest, Heide und Moor, das Weichseldelta, der Oderbruch und das Wassergeäder des Spreewalds, die Dünen Borkums und die Diluvialhügel Holsteins, die abenteuerlichen Schlingen der Mosel und die Altwässer des Rheins, die sanften Höhen von Harz, Thüringer Wald und Odenwald wie die Steilformen von Jura und Sächsischer Schweiz ziehen an uns vorüber, deutlicher und eindrucksvoller als im schönsten Bilderbuch. Daneben kommen die Werke des Menschen nicht zu kurz: Die verschiedensten Siedlungsformen, vom germanischen Haufendorf und Einzelhof bis zur modernen Industrie und Bergwerkssiedlung, kommen ebenso zur Darstellung wie die Häfen von Ruhrort, alte und neue Straßen, Talsperren und der Nordostseekanal.
Leider konnte diesem Werk nicht ein Erläuterungsheft beigegeben werden wie der oben genannten Sammlung, indessen lassen die auf dem festen Umschlag gegebenen Hinweise den einigermaßen Eingeweihten zur Genüge ahnen, was er auf den verschiedenen Blättern dieser Sammlung und einer Reihe zur Ergänzung vorgeschlagener Sektionen finden wird. Da die Karten verschiedenen Bundesstaaten entstammen, kann an dieser Sammlung jeder die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Bearbeitungen gegeneinander abwägen. Dringend zu wünschen ist, daß bei einer Neuauflage auch bayrische Blätter Aufnahme finden (warum fehlen sie hier?), damit auch die Formen des Hochgebirgs vorgeführt werden können, die bei der Generalstabskartensammlung einen so erfreulich breiten Raum einnehmen. Ebenso wäre es zu begrüßen, wenn von den sächsischen Blättern statt Mittweida ein Blatt eingefügt würde, das den interessanten Südabfall des Erzgebirges zeigt. Trotz dieser kleinen Ausstellungen wünschen wir der Sammlung allerweiteste Verbreitung, denn monatelang können sie Klassen und Arbeitsgemeinschaften in Schulen und Vereinen als Grundlage der Betrachtung dienen. Wer an diesen Karten arbeiten, sehen und denken gelernt hat, wird mit Freuden der Aufforderung folgen, die auf der Rückseite des Umschlags steht: Deutscher, lerne die Heimat kennen, wandre mit Karten der Landesaufnahme!
Dr. Kurt Schumann, Dresden
Einbanddecken in Leinen
| Einzelbände | Grundpreis M. –.70 |
| Doppelbände | Grundpreis M. –.80 |
Grundpreis mal Schlüsselzahl des Börsenvereins Deutscher Buchhändler
(am 17. August 1923 700 000) = jetziger Preis
Heimatbücherei des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz
Band I (2. Auflage): Gerhard Platz »Vom Wandern und Weilen im Heimatland«
Grundpreis M. 3.50
Band II: Max Zeibig »Bunte Gassen, helle Straßen«
Grundpreis M. 3.50
Band III: Edgar Hahnewald »Sächsische Landschaften«
Grundpreis M. 3.50
Band IV: Martin Braeß »Meine Brüder im stillen Busch, in Luft und Wasser«
Grundpreis M. 4.—
Grundpreis mal Schlüsselzahl des Börsenvereins Deutscher Buchhändler
(am 17. August 1923 700 000) = jetziger Preis, davon 331/3% Nachlaß
für unsre Mitglieder
Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-A.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 102: Meter → Zentimeter
der sechsundachtzig Zentimeter hohe konische Teil