
Title: Hochtouren im tropischen Amerika
Author: Hans Meyer
Editor: Karl Heinrich Dietzel
Release date: May 16, 2023 [eBook #70774]
Language: German
Original publication: Germany: F. A. Brockhaus
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Im Original unterschiedliche Schreibweisen insbesondere von Ortsnamen wurden beibehalten.

Hans Meyer

Leipzig / F. A. Brockhaus / 1927
Copyright 1925 by F. A. Brockhaus, Leipzig
| Seite | |
| Hans Meyer. Von Dr. Karl H. Dietzel | 5 |
| Einleitung | 12 |
| Der Chimborazo | 23 |
| 1. Der Berg | 23 |
| 2. Der Anmarsch | 35 |
| 3. Die erste Besteigung | 50 |
| 4. Die zweite Besteigung | 67 |
| Der Cerro Altar | 83 |
| Der Antisana | 104 |
| 1. Der Anmarsch | 104 |
| 2. Die Besteigung | 112 |
| Der Cotopaxi | 128 |
| 1. Der Berg | 128 |
| 2. Der Anmarsch | 136 |
| 3. Die Besteigung | 145 |
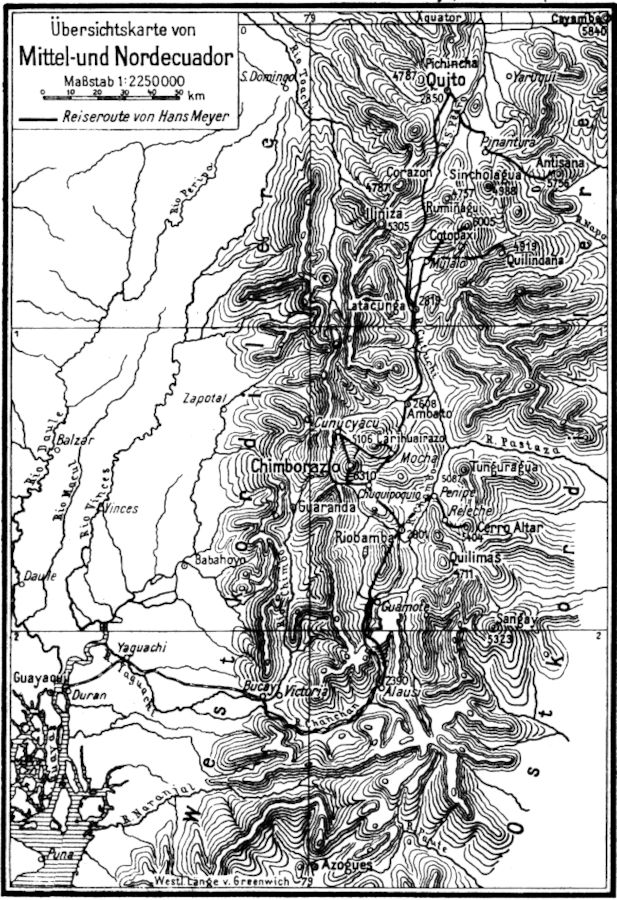
[5]
Das vorliegende Buch »Hochtouren im tropischen Amerika« ist die Fortführung des Bandes 25 dieser Sammlung, der Hans Meyers Hochtouren im tropischen Afrika gewidmet war. Der Lebensgang Hans Meyers ist dort ausführlich geschildert worden, und deshalb seien hier die Hauptdaten nur kurz wiederholt.
Hans Meyer wurde am 22. März 1858 in Hildburghausen (S.-Meiningen) geboren und kam 1874 mit der Übersiedlung des väterlichen Verlagsunternehmens, des Bibliographischen Instituts, nach Leipzig. Seine Studentenjahre, in denen er sich hauptsächlich der Geographie, der Geschichte und den Staatswissenschaften widmete, führten ihn nach Leipzig, Berlin und nach Straßburg, wo er auch promovierte. Dem väterlichen Verlag hat er den Hauptteil seines arbeitsreichen Lebens bis zum Jahre 1915 geweiht, dann erhielt er einen Ruf als Professor der Kolonialgeographie und Kolonialpolitik und als Direktor des Kolonialgeographischen Instituts an die Universität Leipzig, an der er noch heute wirkt.
In die Zeit vor seiner akademischen Tätigkeit fallen seine zahlreichen und weiten Reisen. Sie führten ihn 1881–1883[6] um die ganze Erde, 1886/87 nach Südafrika und Ostafrika, 1888 und 1889 ebenfalls dorthin, wobei es ihm gelang, als Erster den Gipfel des 6010 Meter hohen Kilimandjaro zu erklimmen. 1894 weilte er auf Tenerife und bestieg den Pik, 1899 arbeitete er abermals am Kilimandjaro, 1903 in Ecuador und 1911 zum letzten Male in Ostafrika, das seiner Länge nach durchquert und in seiner nordöstlichen Ecke, dem Zwischenseengebiet, näher untersucht wurde. Auch diesmal wurden zwei Hochgipfel, der 4500 Meter hohe Karissimbi und der aktive Niragongovulkan, bezwungen.
Die Früchte dieser Reisen hat Hans Meyer zunächst in mehreren größeren Reisewerken niedergelegt. Der Band 25 dieser Sammlung und auch der hier vorliegende Band bringen Auszüge davon. Aber darüber hinaus hat der Gelehrte eine umfassende rein wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet. Sie nahm ihren Ausgang anfänglich von seiner literarischen Arbeit im Bibliographischen Institut. Die Sammelwerke »Das deutsche Volkstum«, zu dem er selbst einen einleitenden Abschnitt schrieb, und die Sieverssche »Länderkunde« verdanken ihm ihre Entstehung, und grundlegend wurde sein »Deutsches Kolonialreich«, zu dem er den starken Band Deutsch-Ostafrika beisteuerte. Neben diese rein wissenschaftlichen Arbeiten treten zahlreiche mehr praktisch eingestellte Aufsätze und Bücher. Durch seine Tätigkeit als Mitglied des Kolonialrats, als Vorsitzender der Landeskundlichen Kommission des Kolonialamts, als Vorstandsmitglied der Kolonialgesellschaft und des Kolonialwirtschaftlichen Komitees hat er jahrzehntelang zu den maßgebenden Persönlichkeiten der deutschen Kolonialpolitik gehört, zahlreiche Ehrungen dafür empfangen und, abgesehen[7] von den großen Kosten seiner sämtlich aus eigenen Mitteln bestrittenen Reisen, auch große persönliche Opfer gebracht durch reiche Stiftungen an die Berliner und Leipziger Museen und Universitäten. Sein schönes Leipziger Heim, in dem seine liebenswürdige Gemahlin, eine Tochter Ernst Haeckels, waltet, ist wohl den meisten der führenden deutschen und außerdeutschen Geographen und Kolonialpolitiker in freundlicher Erinnerung.
Nach drei großen Gesichtspunkten läßt sich Hans Meyers Lebensarbeit gliedern. Er begann mit tropischen Vulkan- und Hochgebirgsstudien; daraus erwuchs ihm, weil sich diese Arbeit zu einem wesentlichen Teil in den deutschen Kolonien abspielte, die Beschäftigung mit anfangs nur deutschen kolonialpolitischen Fragen, und sie wiederum führten ihn zur Länderkunde, die er für die deutschen Kolonien begründet und seit seiner Berufung an die Leipziger Universität zu einer selbständigen kolonialgeographischen Disziplin ausgebaut hat, wo sie von ihm nunmehr auf alle Kolonialländer der Erde ausgedehnt und in erster Linie als überseeische Länderkunde gelehrt wird.
Die Hochgebirgsforschung des Gelehrten wurzelt in den Glazialstudien, die Penck und Brückner seit den achtziger Jahren in großzügiger Weise und mit den überraschendsten Ergebnissen für die Alpen durchführten und bei denen sie eine einstmals viel stärkere Vereisung des Gebirges zur Eiszeit, die in mehrmaligen Intervallen auf- und abebbte, feststellten. Die Lösung der Frage, ob diese Eiszeit sich nur auf die gemäßigten Zonen beschränkt oder ob sie die ganze Erde umfaßt hatte, ob sie sich abwechselnd auf der Nord- und der[8] Südhemisphäre abgespielt oder gleichzeitig den ganzen Erdball betroffen hat, war die Hauptaufgabe, die sich Hans Meyer setzte. Gefunden werden konnte diese Lösung nur durch eine eingehende Untersuchung der wenigen tropischen Gebirge, die sich bis in so große Höhen erstrecken, daß sie noch heute einen Schneemantel tragen, also in erster Linie am Kilimandjaro und an den Vulkanen Hochecuadors und Kolumbiens. Die hochragenden Schneegipfel des Ruwenzori in Afrika und des innern Neuguinea waren gegen das Ende des 19. Jahrhunderts noch sehr wenig bekannt.
Die Voraussetzung für solche Untersuchungen waren Eigenschaften des Forschers, die nicht ohne weiteres für jeden Reisenden zutreffen. Es handelte sich zunächst um ein Arbeiten in sehr großen Höhen, die nur selten von Menschen erreicht werden und die eine durchgebildete alpinistische Technik und einen außergewöhnlich kräftigen Organismus erfordern. Das zweite hatte Hans Meyer eine gütige Natur mitgegeben, das erste hat er sich in langem und ausdauerndem Training in europäischen Hochgebirgen erwerben müssen. Als eine weitere, viel größere Schwierigkeit kam aber hinzu die Lage dieser Bergriesen in den abgelegensten Teilen der Tropen. In den achtziger Jahren war eine Expedition schon zum Fuß des Kilimandjaro ein umständliches und keineswegs gefahrloses Unternehmen; es führte den Reisenden in wochenlangen Märschen durch tropisches Fieberland, das einen europäischen Organismus schwächen mußte, und am Ziel waren schließlich in wenigen Tagen klimatische Unterschiede zu überwinden, die sonst nur in wochenlanger Anpassung allmählich erträglich gemacht werden. Weiter erschwerend wirkte in diesen Gegenden[9] auch das Fehlen aller Hilfsmittel, die sonst dem europäischen Bergsteiger als selbstverständlich erscheinen und die eine Organisation des ganzen Unternehmens erforderten, die bis dahin noch nicht erprobt war und von Hans Meyer erst geschaffen werden mußte. In den Hochanden Ecuadors waren die Verhältnisse nicht so primitiv, die Schwierigkeiten türmten sich nicht ganz so hoch auf, aber ihre Überwindung verlangte doch eine praktische Erfahrung, Umsicht und Willensstärke, über die nur wenige verfügen.
Hans Meyer hat die Ziele, die er sich gesteckt hatte, in vollem Umfang erreicht. Es ist von ihm der Nachweis erbracht worden, daß das Phänomen der Eiszeit mit ihren Intervallen eine allgemeine, wohl in kosmischen Vorgängen ihre Ursache findende Erscheinung der ganzen Erde gewesen ist, und auf seinen Schultern haben Nachfolger eine ganze Wissenschaft entwickelt und haben entdeckt, daß auch in früheren Abschnitten der Erdgeschichte, die weit vor der letzten Eiszeit liegen, bereits Kälteperioden mit ganz ähnlichen Erscheinungen unsere Mutter Erde heimgesucht haben.
Die Reise in die Hochanden Ecuadors ist der Schlußstein dieser Untersuchungen Hans Meyers gewesen. Sie führte ihn und seinen Begleiter, den Münchner Landschaftsmaler und Alpinisten Rudolf Reschreiter, im Jahr 1903 über die Landenge von Panama nach dem Hafen von Ecuador, Guayaquil, dann auf das Hochland nach Riobamba hinauf zunächst in die Westkordillere auf den Chimborazo und an den Carihuairazo, die über der Mulde von Riobamba thronen, weiter hinüber zur Ostkordillere auf den Cerro Altar, fernerhin im interandinen Längstal nach Latacunga und von da auf[10] den Cotopaxi und an den abseits stehenden, schwer zugänglichen Quilindaña; dann längs der Hochlandstraße an den Vulkanen des mittleren Ecuador, dem Iliniza, Corazon und Rumiñagui, vorbei nach der Landeshauptstadt Quito; von Quito quer über die interandine Mulde zum Antisana auf der Ostkordillere und wieder zurück zur Hauptstadt. Danach ging es denselben Weg nach Riobamba zurück, nochmals zum Chimborazo hinauf, und hiernach mit der Bahn wieder hinab nach Guayaquil; endlich über Panama nach New York und heimwärts nach Deutschland.
Die ganze Reise hat nur ein halbes Jahr in Anspruch genommen, überrascht aber durch die Vielseitigkeit ihrer Ergebnisse, die sich nicht bloß auf die Glazialmorphologie beschränkten, sondern eine Fülle neuen vulkanologischen, geologischen, botanischen und völkerkundlichen Materials beibrachten. Möglich war das nur dank der großen Reiseerfahrung Hans Meyers, die mit verhältnismäßig geringem Kraftaufwand die Erreichung auch weitgesteckter Ziele gestattete. Der vorliegende Band bringt aus dem darüber veröffentlichten Reisewerk »In den Hochanden von Ecuador« die Episoden der Hochtouren auf den Chimborazo, Cerro Altar, Cotopaxi und Antisana zum Abdruck.
Die Gabe Hans Meyers, ein gründliches theoretisches Wissen praktisch auszuwerten, hat den Erfolg dieser Reise verbürgt und ist, wie schon betont, einer der Hauptcharakterzüge des Gelehrten. Seine eigenartige Laufbahn, die ihn von der Wissenschaft zur Praxis und von der Praxis wieder zurück zur Wissenschaft führte, hat diesen wesentlichsten Teil seiner Gelehrtenpersönlichkeit noch schärfer zur Ausbildung kommen[11] lassen. Auf ihm beruhen letzten Endes auch die Erfolge seiner Dozententätigkeit, die er trotz seiner 67 Jahre mit erstaunlicher körperlicher und geistiger Frische ausübt und in der er schon eine stattliche Anzahl von seinen Idealen erfüllter und in seinem Sinne auch weiter tätiger Schüler herangebildet hat. In seinen literarischen Arbeiten kommt diese Gabe zum Ausdruck in der großen Klarheit und Anschaulichkeit der Darstellung, die auch die Schilderungen dieses Buches auszeichnen.
Leipzig, im August 1925.
Dr. Karl H. Dietzel.
[12]
Im südamerikanischen Freistaat Ecuador, der seinen Namen vom Äquator hat, der ihn durchschneidet, betreten wir ein Land, das mit rund 300 000 Quadratkilometer Fläche zwanzigmal so groß ist wie Sachsen, aber kaum anderthalb Millionen Bewohner hat, also nur ein Drittel soviel wie Sachsen. Er gliedert sich in drei ganz verschiedene Teile: 1. das dem pazifischen Ozean benachbarte Küstenland, 2. das mittlere, gebirgige Ecuador und 3. das etwa dreimal größere Tiefland im Osten, den sogenannten Oriente. Das letztere Gebiet ist ein ungeheueres, von den Amazonaszuflüssen durchschnittenes Waldland, heiß, feucht, fieberdrohend und nur dünn bewohnt von wilden Indianerstämmen, zwischen denen sich einige wenige Missionsstationen angesiedelt haben, im übrigen unerforscht und unbekannt. Der mittlere, kleinere, gebirgige Teil Ecuadors ist das Land der Kordilleren und der Hochebenen, die heute, wie einst zur Zeit der Inkas, das Gebiet der Kultur sind. Vom breiten tropisch-fruchtbaren Küstenstrich steigen wir auf mehreren, von großartigem Urwald bedeckten Stufen zum kühlen Hochland an, das in der ganzen Erstreckung Ecuadors von zwei parallelen Gebirgsketten, der West- und der Ostkordillere, und den zwischen beiden eingebetteten, durchschnittlich 3000 Meter hohen Hochebenen[13] oder Hochbecken gebildet wird. Wegen seiner Lage zwischen den beiden Andenketten wird das Hochland das »interandine« Hochland genannt. Wie der Abfall der Westkordillere nach Westen zum Küstenland, so ist der Abfall der Ostkordillere nach Osten zum Amazonastiefland hoch und steil, so daß das interandine Hochland wie eine umgestürzte riesenhafte Schüssel auf der Kontinentalmasse Südamerikas liegt.
Von den beiden Kordilleren ist die Ostkordillere die ältere. Sie besteht, soweit sie nicht von jungvulkanischen Eruptivmassen bedeckt ist, aus kristallinen Schiefern, Gneisen, Tonschiefer, schiefrigen Diabasen, Grünschiefer usw., die von Graniten und Dioritmassen durchbrochen sind. Sehr wahrscheinlich sind in den genannten kristallinen Gesteinen paläozoische, triassische, jurassische und zum Teil auch kretazeische Formationen in einem Zustand dynamomorpher Umwandlung zu finden. Diese Ostkordillere ist durchschnittlich die höhere und wird deshalb von den Landesbewohnern gewöhnlich Cordillera real (Hauptkordillere, nicht »Königskordillere«) genannt.
Die Westkordillere ist die jüngere. Sie ist, soweit sie nicht jungvulkanisch ist, hauptsächlich aus dunklen Schiefern, aus Sandsteinen, Kalksteinen und Konglomeraten aufgebaut, die alle der Kreideformation angehören und von wahrscheinlich ebenfalls kretazeischen Eruptivgesteinen, wie Diorit, Diabas, Porphyrit u. a., durchsetzt werden.
Auf diese beiden alten Kordilleren und teilweise auch auf die Hochbecken zwischen ihnen sind die gewaltigen Vulkane aufgesetzt, die dem Hochland von Ecuador seinen besondern Charakter geben. Sie sind geologisch jung, wahrscheinlich alle quartär, und haben mit ihren Ausbruchsmassen[14] einen großen Teil der Kordilleren, auf denen sie stehen, und fast das ganze Hochplateauland dazwischen verschüttet und unter sich begraben. Auf den Faltenzügen der ungeheuer langen Andenketten sitzen sie obendrauf wie Reiter auf dem Sattel oder wie Schornsteine auf dem Dachfirst. In Reihen von kolossaler Ausdehnung und bis zu 300 Kilometer von der Küste entfernt, stehen sie da nebeneinander. Diese Bindung an das riesige Faltengebirge können wir einfach so erklären, daß hier durch die gewaltigen Falten der Zusammenhang der Erdrinde gelockert ist und innere Zerreißungen oder Aufblätterungen der Schichtenkomplexe stattgefunden haben, die dem von unten aufdringenden Magma geringern Widerstand leisten als die durch keine Faltenbildung gestörten Teile der Erdkruste.
Bei der großen Längenausdehnung der Kordilleren stehen in Ecuador die Vulkane so weit voneinander entfernt, daß sie nicht das Bild einer zusammenhängenden Kette, sondern einer von sehr weiten Lücken unterbrochenen Reihe ausmachen. Die Landschaft bietet deshalb kein so großartiges Panorama wie ein schneebedecktes Kettengebirge, etwa der Kaukasus oder Himalaja. Die ungeheure Flächenentwicklung des Hochlandes, die langen sanften Linien der vulkanischen Aufschüttung, der Mangel an Bergketten mit ewigem Schnee, die Seltenheit von schroffen, zackigen Bergformen, die Monotonie der alles überziehenden, olivenbraunen Farbe der Gras- und Tuffdecken, die geringe Ausdehnung der Bodenkultur: alles vereint sich zu einem Landschaftscharakter, der mit dem alpinen wenig gemein hat. Er ist »andin«. Aber jeder einzelne der Vulkankolosse ist eine unvergleichlich grandiose Erscheinung, am meisten gerade jene, die allein stehen, wie der Chimborazo oder der Cotopaxi. Diesem Eindruck kann[15] auch der Umstand nur wenig Abbruch tun, daß die Riesenberge, die im Chimborazo bis zu einer Maximalhöhe von 6310 Meter aufragen, auf dem bereits durchschnittlich 3000 Meter hohen Hochland als Basis aufsitzen; denn die Mehrzahl ist tief herab mit Firn und Gletschern bedeckt, am meisten der Chimborazo, der Antisana und der Cayambe. Durchschnittlich liegt die Firn- und Eisgrenze, die hier im tropischen Hochgebirge meist zusammenfallen, bei 4700 bis 4800 Meter, die untere Grenze einzelner Gletscherzungen aber noch 3–400 Meter tiefer. Auch die drei tätigen Vulkane des Landes, der Sangay, der Cotopaxi und der Tunguragua, sind großenteils in einen Eismantel eingehüllt, und zwar sind es auf allen Bergen die Ost- und Nordostseiten, die die mächtigsten Eisdecken tragen, weil das ganze Jahr hindurch die vorherrschenden Winde im Hochland als Passate aus Osten kommen, von wo sie aus den weiten warmfeuchten Amazonasniederungen beständig große Wasserdunstmengen mitbringen und in Stürmen und furchtbaren Gewittern meist auf den Ostflanken der Gebirge als Regen, Hagel und Schnee niederschlagen.
Die regenreichste, wärmste Jahreszeit im Hochland sind die »Invierno«-Monate März bis Mai, in geringerm Maß Oktober und November. Die schönsten, regenärmsten, kühlsten Monate sind der Juni, Juli und August, der sogenannte »Verano«. Diese Verano-Monate sind für die Hochgebirgstouren insofern günstig, als dann auf der Westkordillere und im ganzen interandinen Hochland bei vorherrschendem Ostwind relativ milde Witterung ist und weniger Stürme und Gewitter wüten. Ich hatte deshalb meine Reise auf diese drei Monate verlegt; demzufolge haben wir von den Wettergewalten relativ wenig zu leiden gehabt.[16] Nur auf der viel niederschlagreichern Ostkordillere trafen wir es meist schlecht, denn dort ist in den hohen Regionen gerade der Verano die Periode der Stürme, der Regengüsse, der Nebel und Schneefälle.
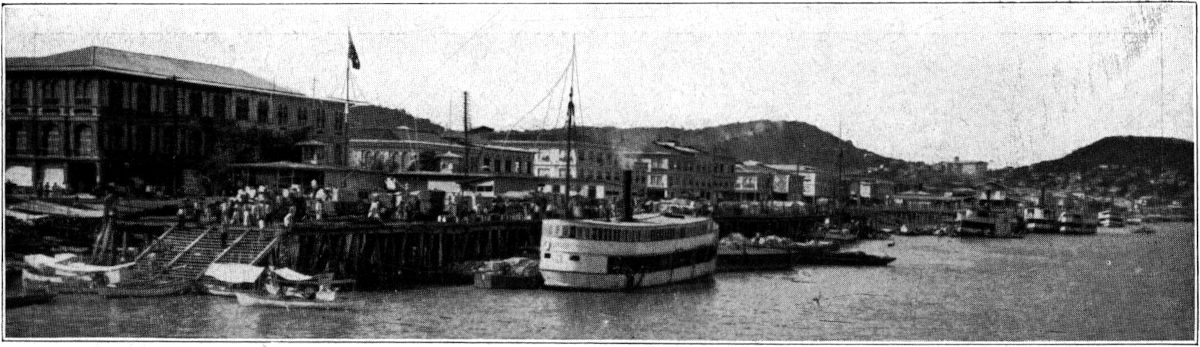
In den Sturm- und Gewittermonaten März bis Mai ist der Reisende im andinen Gebiet über den Hochebenen so gut wie schutzlos dem Toben der Elemente preisgegeben, weil kein Wald, kaum ein Baum in den Regionen über 3800 Meter steht und das ganze Land in dieser Höhe, alle Ebenen, Hügel und Berge bis zu 4500 Meter hinauf, infolge der den Baum- und Strauchwuchs verhindernden Winde, Trockenheit und Kälte nur mit harten Gräsern und niedrigen Stauden bewachsen ist. Das ist die immer graubraune Region der Páramos, der Hochsteppen, die gefürchtet ist wegen ihres rauhen, wechselvollen Klimas, das einem permanenten deutschen März-April gleicht. Die Páramoregion ist ganz ungeeignet zum Feldbau, sie wird nur bewohnt von wenigen indianischen Viehhirten, die hier die halbverwilderten Schaf- und Rinderherden ihrer weißen Herren beaufsichtigen, und durcheilt vom flüchtigen Páramo-Hirsch und dem König der Lüfte, dem Kondor.
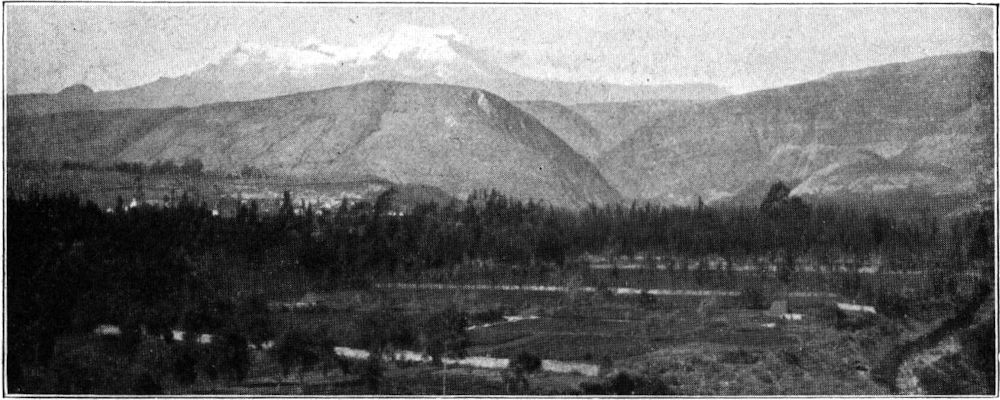
Aber auch in der Trockenzeit sind die Reisen im interandinen Hochland dadurch beschwerlich, daß der Reisende unausgesetzt auf elenden Maultierwegen mit heftigem Wind und widerwärtigem Staub zu kämpfen hat und nach des Tages Arbeit nur in den wenigen größeren Ortschaften und Städten Gasthäuser findet, die aber nach europäischen Begriffen meist Spelunken vierten und fünften Ranges sind. Im übrigen ist der Reisende auf »Tambos«, die Unterkunftshütten der Lasttiertreiber (Arrieros), angewiesen, wo man höchstens den landesüblichen Locro (Wasserkartoffeln[17] mit Zwiebeln) zu essen bekommt und in einem von Ungeziefer wimmelnden Raum auf dem nie gereinigten nackten Lehmboden neben Indianern, Hunden und Schweinen schlafen muß, wenn man nicht sein eigenes Zelt, Feldbett und Proviant mit sich führt. Dies aber tat ich auf meiner ganzen Reise, was mich von ecuatorianischer Gastlichkeit unabhängig machte.
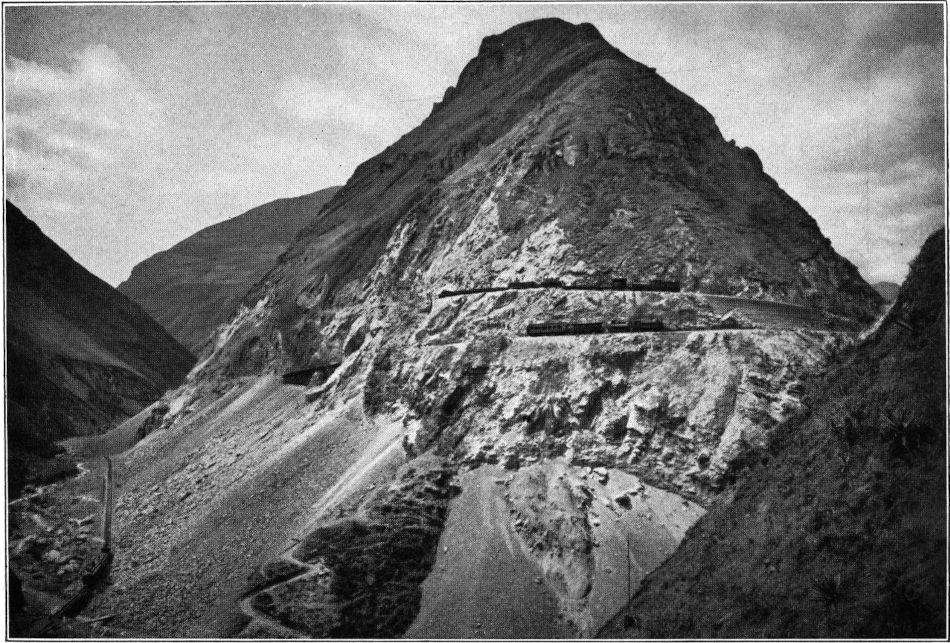
Es war mir schon im Gegensatz zu meinen afrikanischen Reisen als eine ideale Reiseart erschienen, daß man nicht wie dort mit einem schwerfälligen Troß von menschlichen Trägern umherziehen muß, sondern daß man nur mit wenigen Pferden und Maultieren reist, die von zwei oder drei Treibern besorgt werden, und bloß in den den Tieren unzugänglichen Hochgebirgsregionen einige indianische Träger braucht, die aber an jedem Ort neu angeworben und nach der betreffenden Bergtour gleich wieder entlassen werden. Auch die acht bis zehn Last- und Reittiere, die ich regelmäßig mitführte, hatte ich anfangs nur für eine Tour gemietet; da aber sie und ihre zwei Treiber, die Kolumbianer, nicht Ecuatorianer waren, sich als außerordentlich leistungsfähig erwiesen, behielt ich sie während der ganzen Reise und konnte ihnen schließlich das Schwerste unbedenklich zumuten.
Wir waren gewöhnlich von Sonnenaufgang bis Spätnachmittag unterwegs, und wenn wir dann zu einem Tambo oder Hato (Hirtenhütte) kamen oder im einsamen Páramo die Zelte aufschlugen, wurden die Tiere losgelassen, um sich ihre Nahrung selbst zu suchen. Stallfütterung gibt es nicht, aber Gras wächst überall in Unmasse; freilich ist es so hart und trocken, daß man die Grasländer der Páramos allerwärts nur Pajonales, Strohfelder, nennt. Es ist »Heu auf dem Halm«, wie ein Reisender die Gräser in Südwestafrika genannt hat.[18] Nur wenn man in bewohntere Gegenden kommt, finden die Tiere in den umzäunten, künstlich bewässerten »Potreros« besseres Gras, oder sie bekommen ein Bündel »Alfalfa« (Medicago sativa) oder »Cebada« (körnerhaltiges, ungedroschenes Gerstenstroh) zu fressen, wofür natürlich besonders zu zahlen ist.
Proviant für uns selbst brauchte ich immer nur für acht bis vierzehn Tage mitzunehmen, da wir nach jeder einzelnen Tour wieder in eine der Hochlandstädte Riobamba, Latacunga und Quito als Standquartier zurückkehrten, wo wir uns neu verproviantieren konnten. Alkohol haben wir auf den Touren nur in medizinischen Dosen getrunken, auch Tabak nur im Quartier oder Lager geraucht, und auch dann nur sehr wenig.
Wegen der 1903 schon Mitte August beginnenden Regenzeit hat unser Aufenthalt im Hochland selbst nur 2½ Monate gedauert. Aber durch äußerste Anspannung aller beteiligten Kräfte von Mensch und Tier vermochte ich in dieser kurzen Zeit des »Verano« doch mein Programm durchzuführen. Die Herren Ecuatorianer im Hochland kennen und wissen von der großartigen Gebirgswelt, die sie umgibt, gar nichts. Niemals hat ein Ecuatorianer aus eigenem Antrieb einen Schneeberg bestiegen, und für das, was wir dort wollten, zeigten nur ganz wenige Verständnis und wirkliches Interesse. Nur die Winke, die mir deutsche Landsleute und zwei oder drei ecuatorianische Herren in Riobamba und Quito aus langer Erfahrung geben konnten, waren mir wirklich von Nutzen, aber auch sie erstreckten sich nicht in die eigentliche alpine Region des Gebirges. Dort ist man einzig und allein auf sich selbst angewiesen.
[19]
38 Tage Seefahrt, davon die Hälfte der Zeit auf einem schmierigen, überfüllten Küstendampfer im Pazifischen Ozean, der das Reisen zur Qual machte, hatten mich und meinen Begleiter, Herrn Maler Rudolf Reschreiter, endlich am 8. Juni 1903 nach dem ecuatorianischen Haupthafen Guayaquil gebracht. Nach nur dreitägigem, den nötigsten Vorbereitungen gewidmetem Aufenthalt dampften wir in der Frühe des 10. Juni auf einem stark besetzten Raddampfer den breiten Guayasfluß in reißender Strömung aufwärts und zum anderen Ufer hinüber, wo der Ort Durán liegt, der Ausgangspunkt der Kordillerenbahn. In regelmäßigem Betrieb war damals die weitaus schwierigste Strecke durch das sumpfige Unterland und am urwaldbedeckten, tief zerschluchteten Westabfall der Kordillere empor bis Alausi (2390 Meter), und im Ausbau die bereits im interandinen Hochland gelegene Strecke von Guamote nach Riobamba (2801 Meter). Erst durch sumpfig-heiße Niederung, dann in einem dichten Blättermeer, so daß wir weithin wie in einem dunkelgrünen Tunnel durch die Laubmassen fahren, dann wieder in einem von tropischem Bergurwald erfüllten Tal, schließlich in unglaublichen Zickzacks an steilen Felswänden hinauf zieht die Bahn nach Alausi empor. Von dort brachte uns ein zweitägiger Ritt durch hügeliges grasiges Tuffland über den breiten Rücken des Salarunespasses (3603 Meter) in die weite graubraune Muldenebene von Riobamba und nach der kleinen gleichnamigen Stadt (12 000 Einwohner), die mit ihren gepflasterten Straßen, ihren meist einstöckigen, aus Tuffquadern erbauten Häusern, einigen steinernen Kirchen und einer Reihe kleiner Läden einen zivilisierteren Eindruck macht, als ich nach den Schilderungen früherer Reisenden vermutet hatte.
[20]
Unsere Ankunft in dem verkehrslosen Städtchen war ein großes Ereignis. Der Gobernador empfing uns infolge meiner amtlichen Empfehlung mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit, stellte mir ein Rundschreiben an alle »Jefes politicos« seiner Provinz in Aussicht und versprach Begleitung, wohin wir wollten; aber er tat nichts. Auch von den anderen Spitzen der Riobambaer Gesellschaft, bei denen ich Empfehlungsbriefe abgab, ward uns die allerhöflichste Aufnahme zuteil, und abends wimmelte es in unserm Gasthaus von Besuchern, die neugierig unsere Ausrüstung musterten und rätselhafte Dinge, wie Theodolit, Eispickel und Steigeisen, anstaunten. Aber nicht ein einziger war imstande, uns einige Auskünfte darüber zu geben, wie und wo man am besten dem Chimborazo zu Leibe gehen könnte, um seine Schneeregion zu erreichen. Kein einziger wußte, wie es oberhalb der Schneegrenze aussieht.
Eine rühmliche Ausnahme machten die Herren Gebrüder Cordovez, smarte Geschäftsleute kolumbianischer Abkunft, die sich viel in der Welt umgesehen hatten, perfekt Englisch sprachen und Interesse für unsere wissenschaftlichen Ziele zeigten. Zwar wußten auch sie nichts Näheres vom Chimborazo, aber sie halfen uns beim Engagement der nötigen Leute und Tiere. Da waren vor allem zwei zuverlässige kolumbianische Arrieros, namens Moran und Spiridion, mit guten Reit- und Lasttieren, die ich während der ganzen Ecuadorreise behielt; dann ein Angestellter der Herren Cordovez, ein vielgewandter junger Dalmatiner, Don Alfonso Santiago, der über Peru nach Ecuador verschlagen worden war, Englisch, Spanisch und das Kitschua der Hochlandindianer sprach und mir auf der ganzen Reise als Reisemarschall und Dolmetscher (Mayordomo) diente, wenn ich auch[21] oft nahe dran war, ihn wegen seiner üblen Charaktereigenschaften wegzujagen. Und schließlich verschafften sie mir Empfehlungen an die Wirtschafter einiger um den Chimborazo verstreuter Haciendas und Hatos, die sich sehr nützlich erwiesen.
Endlich hatte auch der, dem alle unsere Vorbereitungen galten, um den sich seit Wochen unsere regsten Gedanken, unsere sehnlichsten Wünsche und Hoffnungen gedreht hatten, nach dem wir seit acht Tagen von jedem Paß und Hügel ausschauten, die königliche Gnade, sich uns in seiner ganzen Größe zu zeigen: der Chimborazo. In stiller, schlichter Majestät, wie die Kuppel von St. Peter über dem niedern Rom, ragt der Schneedom über seine Umgebung empor.
Wie vor zwanzig Jahren der erste Anblick des Kilimandjaro, so ergriff mich auch das erste Erscheinen des Chimborazo mit der Macht einer plötzlichen Offenbarung. Demütig stehen wir kleinen Menschen vor dem Erhabenen und lassen es klopfenden Herzens zu uns in seiner Sprache reden, die man nur in solchen Weihestunden recht versteht. Und wenn dann das Herz wieder zur Ruhe gekommen ist, werden die Augen scharfsichtig, der Geist hellseherisch und er begreift von der Erscheinung mehr als sonst. Es war schon Spätnachmittag, als uns der Berg erschien. Schnell zog das tropische Dämmerlicht herauf. Langsam verglomm am violetten Westhimmel die silberne ungeheuere Kuppel. Die uns zugekehrte Ostseite lag schon im blauschwarzen Schatten, aber noch schimmerte es geheimnisvoll um den schneeigen Scheitel, und als auch diese letzten Töne verklungen waren, stand noch lange die finstere Silhouette am verlöschenden Abendhimmel wie eine riesenhafte Sphinx.
Übrigens darf man sich das Gebirgspanorama[22] von Riobamba nicht alpin im europäischen Sinn vorstellen, nicht als ein Amphitheater oder als eine Kette von Schneegipfeln. Es ist nicht das »großartigste Diorama der Welt«, wie es der Reisende Boussingault in französischer Überschwenglichkeit im Jahr 1831 genannt hat; sondern in weiter Entfernung, so daß Einzelheiten nur mit dem Glas zu erkennen sind, zieht im Westen des weiten Riobambabeckens der lange Gebirgswall der Westkordillere, im Osten der der Ostkordillere nordsüdwärts, und vereinzelt sitzen auf, respektive an ihnen die schneeigen Vulkankegel in großen Abständen: auf der Ostkordillere der zackige Altar mit der matterhornähnlichen Obispo-Spitze und der von hier der Königsspitze gleichende Tunguragua; auf der Westkordillere der mehrgipfelige Carihuairazo und der gewaltige Chimborazo-Dom. Im ganzen kein zusammenschließendes, einheitliches Hochgebirgspanorama, sondern weitverstreute Einzelbilder.
In zweieinhalb Tagen waren wir dank fleißiger Arbeit mit allen Vorbereitungen fertig. Nun konnte es losgehen. Zuletzt entdeckte ich noch einen eingewanderten italienischen Handelsmann, der in seinem Laden die besten Dinge hatte, die ich für Bergtouren brauchen konnte und in Riobamba nicht vermutet hatte: vortreffliche italienische Makkaroni, feinkörnigen italienischen Reis, verschiedene Biskuitsorten, guten, rotgelben Käse, in Blechbüchsen eingemachte Früchte, namentlich kalifornische und chilenische Pfirsiche und Birnen, und anderes Gute mehr. So waren wir für unser bevorstehendes Lagerleben viel besser ausgestattet, als ich nach unseren bisherigen Gasthaus- und Reiseerfahrungen hatte hoffen können. Das war ein Glück, denn es kamen Tage schwerer Arbeit und harter Entbehrung.
[23]
Der höchste und größte Berg der ecuatorianischen Anden ist der Chimborazo (6310 Meter). Jahrhundertelang galt dieser Bergriese für die höchste Erhebung von ganz Amerika, und wenn ihm auch dieser Rang von der fortschreitenden Landeskenntnis genommen worden ist, so bleibt ihm doch der Nimbus, mit dem ihn der Besuch und die begeisterten Schilderungen des größten deutschen Forschungsreisenden, Alexander von Humboldts, umwoben haben. Seit Humboldts vor einem Jahrhundert unternommener Erforschung und versuchter Besteigung des Chimborazo haben gerade wir Deutsche immer ein sozusagen landsmännisches Interesse an dem Berg genommen. Die Mehrzahl seiner wissenschaftlichen Besucher und Erforscher auch nach Humboldt sind Deutsche gewesen, vor allem Wilhelm Reiß und Alfons Stübel (1870–74).
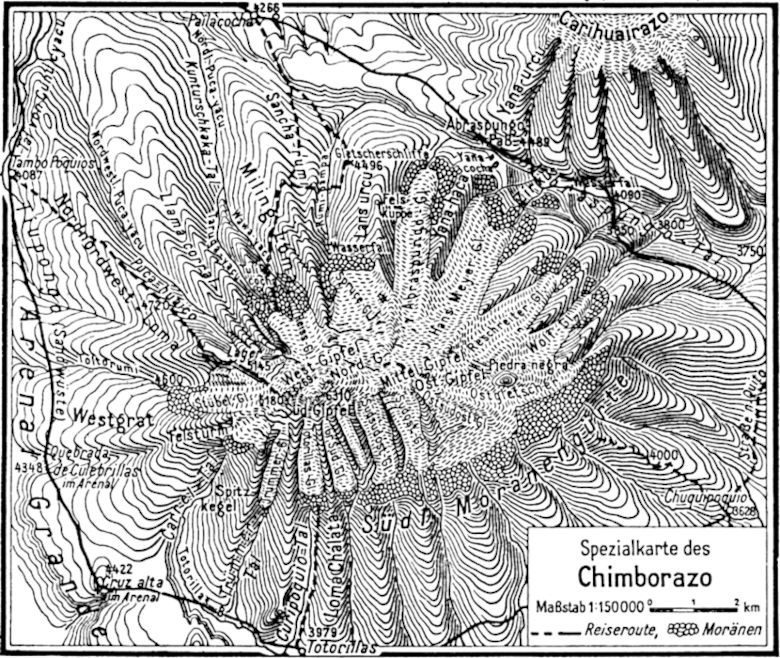
Der Naturforscher wie der Naturfreund, der Künstler wie der Alpinist, der ecuatorianische Stadtbewohner wie der indianische Bauer, alle, die den gewaltigen Schneeberg sehen, an ihm weilen oder arbeiten, erkennen ihn als den König der ecuatorianischen Anden an. Er ist das Wahrzeichen Ecuadors. Schon seine Erscheinung ist einzigartig. Am[25] weitesten von allen großen Vulkanen Ecuadors auf der Westkordillere nach Süden vorgeschoben, ist er der einzige Schneeberg des Hochlandes, von dem im 133 Kilometer entfernten Hafenplatz Guayaquil bei sehr klarem Wetter ein Stück sichtbar ist, eine Erscheinung aus einer andern Welt; und er ist der erste, der den vom tropisch-heißen Tiefland auf der meistbegangenen Route über Guaranda zum kühlen Hochland aufsteigenden Reisenden mit dem Zauber nordischer Schneelandschaft begrüßt oder aber ihn beim Übergang über den berüchtigten, am Südwestfuß des Chimborazo gelegenen Hochpaß des »Arenals« mit wildem Páramowetter, mit tobenden Gewittern, mit eisigem Regen und Schneesturm empfängt. Ganz allein thront er am Westrand der Hochebene von Riobamba. Der nördlich neben ihm 10 Kilometer entfernt stehende kleinere Carihuairazo (5106 Meter), obwohl an sich ein sehr respektabler Schneeberg, verschwindet, von Westen, Süden und Südosten gesehen, neben der himmelstürmenden Titanengestalt des Chimborazo fast ganz. Es ist, als ob sich von den anderen großen Vulkanen des Hochlandes keiner in seine Nähe wagte.
An sich ist der Vulkanbau des Chimborazo mit seiner im Mittel nur 3000 Meter betragenden relativen Höhe nur wenig höher als der des Cotopaxi über seiner Basisebene, er ist sogar kleiner als der des Ätna (3313 Meter) oder gar der des Pik von Tenerife über ihren Fußpunkten. Gänzlich verschieden aber ist die Architektur des Chimborazo von der des Cotopaxi. Hier gibt es keine so weit ausholende, fast mathematische Profilkurve wie im Aufbau des Cotopaxi, keine gleichmäßig abgestutzte Kegelform wie dort, sondern es ist ein Komplex von kolossalen miteinander verwachsenen Stumpfpyramiden, über den sich eine Gruppe von fünf[26] Schneedomen als Gipfel wölbt. Man könnte von einem »romanischen« Stil dieses Riesenberges sprechen, so gut wie man vom »gotischen« Stil der granitischen Sierra Nevada gesprochen hat.
Der Chimborazo zeigt sich auf jeder Front in einer gänzlich andern Gestalt. Am großartigsten entwickelt er sich vor dem Beschauer auf der breiten Südostseite. Hier ist er breiter, höher und steiler als auf den anderen Seiten. Als ein mächtiger vereister Gebirgsrücken hebt er sich aus dem Hochbecken von Riobamba empor, am Fuß welliges und hügeliges Gelände von großer Monotonie, alte übereinandergelagerte Lavaströme, Tuffschichten und alte Moränen unter einer alles überziehenden graubraunen Decke von Páramogras. Darüber geht das Massiv mit stärkerer Steigung in die Zone junger Moränen über, die als ein Gürtel runder Wälle, Dämme und Kegel die Südhälfte des Berges zwischen etwa 4700 und 5200 Meter umfassen; und von da an stürmt der Berg in jähen, dunklen Felswänden himmelwärts, über die sich von oben die Eisflut in einer Reihe steiler, graublauer Gletscher und wildzerrissener Eisstürze ergießt. Über diesen aber wölben sich in olympischer Ruhe die breiten runden Firndome der Gipfelregion.
Auf der Ostseite haben wir, wenn wir nördlich vom Tambo Chuquipoquio stehen, den Berg in seiner Schmalseite vor uns. Die mächtige runde Firnkuppel des Ostgipfels beherrscht hier das Bild, hinter der die westlicheren Schneegipfel großenteils verdeckt liegen, und läßt den Berg als einen einfachen großen Vulkandom erscheinen mit gleichmäßig konisch nach allen Seiten abfallenden Hängen. Ein großer primärer Gletscher fließt weit nach Nordosten hinab.
Sobald man aber nach der Nordseite des Berges umgebogen[27] ist, ändert sich das Bild total. Der Berg breitet seine vielgliedrige Längsansicht vor uns aus, und jetzt sehen wir über dunklen Schuttmassen und Felswänden die fünf runden Firngipfel auf dem langen Schneerücken thronen. Die Nähe des benachbarten vereisten Carihuairazo stört freilich die Einheitlichkeit des Bergbildes; dagegen erhöht sie mächtig den Gesamteindruck der großen alpinen Landschaft. Sie packt und fesselt uns um so mehr, als die Vergletscherung des Chimborazo auf keiner andern Seite des Berges so großartig ist wie auf den dem Carihuairazo zugewandten Flanken.
Von der Nordseite steigt die Basis des Chimborazo immer mehr nach Westen an. Dort stehen wir 4400 Meter hoch auf der wüstenhaften Lapilli-Ebene des »Großen Arenals«, das im Süden von dem nach Guaranda führenden Saumpfad überschritten wird, und sehen den Chimborazo wieder in seiner kürzesten Achse. Keine andere Seite des Berges ist so einsam und öde wie diese; nichts als Stein- und Eiswüste. Auf keiner andern Seite erscheint er so als regelrechter schneebehelmter Vulkankegel wie von der Westseite. Hier ist es der Riesendom des Westgipfels (6269 Meter), der den ganzen Berg auszumachen scheint; nur ein wenig wird rechts neben ihm von dem noch etwas größern Südgipfel in der Überschneidung sichtbar. Zwischen beiden ist auf der Südwestseite der Kegelmantel in der untern Berghälfte durch ein breites steiles Gletschertal bis zum Fuß herab aufgerissen, einer der größten Massendefekte am ganzen Chimborazo, der einen tiefen Einblick in den vulkanischen Bau des Berges gewährt.
Seit Äonen ist der Chimborazo kein tätiger Vulkan mehr. Nur noch einige um seinen Fuß zerstreute heiße Quellen[28] verraten Rückstände schwacher innerer Glut. An seinen dunklen Andesitwänden nagen seit ungezählten Jahrtausenden die Sonnenstrahlen, Nachtfröste, Winde, Gewässer und Gletscher, und die tiefen Wunden, die sie dem Bergriesen schlagen, werden wohl nie wieder vernarben, wohl nie wieder durch einen neuen verjüngenden Lavaerguß ausgeheilt werden. Auch er, der stolzeste und größte der ecuatorianischen Andenberge, unterliegt dem Schicksal alles Irdischen, der Vernichtung. Aber noch steht er in göttlicher Größe und Schönheit da, noch für unermeßliche Zeiten empfänglichen Augen und Seelen zur Erhebung und heiligen Verehrung, dem geistig Schwachen aber zur Beklemmung und Furcht, wie man überall von den Ecuatorianern hören kann.
Wir bewundern an ihm außer seiner Größe vor allem die reiche orographische Gliederung seiner gewaltigen Massen. Wie der Cotopaxi erscheint uns auch der Chimborazo als eine geschlossene Bergpersönlichkeit, aber ihr Charakter ist ein anderer als der des symmetrischen, eleganten Cotopaxi. In seinen Profilen und Formen verbinden sich die starre harte Geradlinigkeit seiner hohen Felswände und die vielfältig gebrochenen und gekrümmten Linien seiner Grate und Spitzen mit den sanften Kurven seiner Schutthalden und mit den weiten, ruhigen Wölbungen seiner himmelhohen Firne zu einer wunderbaren Harmonie von Strenge und Milde, von Ehrfurcht gebietender Erhabenheit und ernster Freundlichkeit. Während der Cotopaxikegel in seiner Einfachheit sich mehr der kristallinischen Grundform nähert, setzt sich der Chimborazo aus mehreren Einzelbergen und Stufen zu einer höhern Einheit zusammen. Er nähert sich durch seine mannigfaltige Gliederung mehr den organischen Gebilden, mehr dem Lebendigen als jener. Es ist[29] ein unbewußter Ausdruck dieser Empfindung, wenn man im Lande seine langgestreckte Gestalt mit der eines ruhenden Löwen vergleicht, und es ist darin auch richtig ausgesprochen, daß er trotz seiner Mannigfaltigkeit eine geschlossene majestätische Berggestalt ist. Sie ist, um mit F. Ratzel zu reden, nicht romantisch, sondern klassisch. Zur Einheitlichkeit des Ganzen trägt am meisten die ungeheuere, zusammenhängende und zusammenfassende Schnee- und Eisdecke bei. Sie gleicht mit ihren auf und ab schwellenden Wogen alle schroffen Trennungen aus und vereint unter sich alle Spitzen und Grate zu einem Schneeberg.
Von der grauen Monotonie seiner Fußhügel weg zieht der Berg unser schauendes Auge immer wieder an den dunkelfarbigen, steilen Hängen und Wänden seines Felsenbaues und an seinen mattblauen Gletscherbrüchen empor in die lichte Schneeregion und läßt es langsam über die weiten Flächen der im Sonnenschein silbern schimmernden Firnfelder und Firndome gleiten. Dort ist Ruhe, Einsamkeit, erhabene Größe. Sie können wir nicht mehr schildern, nur fühlen in tiefer Ergriffenheit, nur »still verehren«, wie Goethe vom großen Unerforschlichen der Natur sagt. Wir begreifen, daß auch kein Künstler einem so erhabenen Naturbild beikommen kann; schon an der Raumgröße würde seine Kunst scheitern. Nur wenn er von dem unendlichen Reichtum der Einzelerscheinungen absieht, das Ganze vereinfacht, das Typische heraushebt und von Form und Linien im großen ganzen ein richtiges Abbild gibt, kann er eine so gewaltige Bergpersönlichkeit wie den Chimborazo malerisch bezwingen. Vollständig gescheitert an diesen Schwierigkeiten ist Alexander von Humboldt, dessen Chimborazobilder dem modernen Beschauer als Karikatur erscheinen, und auch Stübels sonst unvergleichliche[30] Panoramen sind in ihrer Überhöhung nicht korrekt; erst meinem Begleiter Reschreiter sind künstlerisch und wissenschaftlich zugleich einwandfreie Bilder des Berges gelungen.
Bekanntlich ist es Alexander von Humboldt, der zuerst von allen wissenschaftlichen Reisenden am Chimborazo eine bedeutende Höhe bestiegen hat. Dies war im Jahr 1802. Humboldt galt dadurch für viele Jahre als »Höchstgestiegener« der ganzen Welt, was zu seiner Popularität weit mehr beigetragen hat als seine übrigen Reisen und seine wissenschaftlichen Schriften bis zum Erscheinen des »Kosmos«.
Humboldt wählte als Ausgangspunkt das noch heute bestehende Dorf Calpi im Südsüdosten des Chimborazo und glaubte, von dort mit seiner kleinen Karawane in einem Tag zum Gipfel des Berges und zurück nach Calpi kommen zu können. Eine solche naive Verkennung der Schwierigkeiten war nur in der frühesten Jugendzeit der Alpinistik möglich; hatte man doch zu bedenken, daß man eine Höhendifferenz von rund 3000 Meter, eine Horizontaldistanz von etwa 19 Kilometer, steile Schutthalden, kolossale Felswände, riesige Gletscherbrüche, die Wirkungen der dünnen Höhenluft usw. zu überwinden hatte. Zum mindesten wären drei Tage für das Unternehmen in Anschlag zu bringen gewesen, wenn der Berg überhaupt von dieser Seite zu bewältigen ist, was ich angesichts der furchtbaren Zerklüftung des Eises und des Firnes auf dieser Seite bezweifle. Ein erfahrener Alpinist wird nie auf den Gedanken kommen, der schwierigen Südseite des Chimborazo den Vorzug vor den alpinistisch leichteren Südwest- oder Nordwesthängen zu geben. Aber freilich hatte Humboldt die Nordfront des Berges überhaupt nicht gesehen.
[31]
So ritt er denn mit seinen Begleitern Aimé Bonpland und dem jungen Ecuatorianer Carlos Montufar am 23. Juni 1802 von Calpi über das stufenförmig ansteigende Basisgelände, am kleinen See Yana-cocha vorüber zur Grenze des frischgefallenen Schnees (4377 Meter). Hier begann seine Fußtour, während seine Kameraden erst an der »perpetuierlichen« Schneegrenze (4820 Meter) ihre Reittiere verließen. Nun folgte man einem steilen, »gegen den Gipfel gerichteten, schmalen Felskamm« von »sehr verwittertem bröckeligen Gestein«. Bald kehrten die Eingeborenen zurück, und es blieben mit Humboldt nur Bonpland, Carlos Montufar und ein Mestize »aus dem nahen Dorf San Juan«. Der Grat wurde sehr schmal, oft nur 8–10 Zoll breit, links sank eine »dünneisige Spiegelfläche« mit etwa 30 Grad Neigung ab, rechts gähnte ein Abgrund von 800 bis 1000 Fuß Tiefe. Immer schwieriger wurde das Balancieren, das Klettern mit Händen und Füßen, so daß die Hände an den Felsen »schmerzhaft verletzt« wurden; und dazu wurde Humboldt durch eine Wunde gehindert, die er »seit mehreren Wochen am Fuß« hatte. Bei 5612 Meter wurde eine barometrische Höhenmessung vorgenommen. Nach weiterm einstündigen Steigen stellte sich bei allen die Bergkrankheit ein: »große Übelkeit«, »Bluten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen«(!); auch die »Augen waren blutunterlaufen«. Ringsum lag dichter Nebel. Bei seinem Aufreißen sahen sie den »domförmigen Gipfel des Chimborazo ganz nahe«, aber bald – es war 1 Uhr geworden – setzte »eine Art Talschlucht von etwa 400 Fuß Tiefe« dem Unternehmen eine Grenze. »Mit vieler Sorgfalt« wurde mit dem Quecksilberbarometer die Höhe gemessen: 13 Zoll 112/10 Linien bei –1,6° C, woraus Humboldt 5881 Meter[32] berechnete. »So fehlten noch bis zum Gipfel senkrecht 1224 Fuß oder die dreimalige Höhe der Peterskirche in Rom.«
»Nach kurzer Zeit« kehrten die Reisenden auf demselben Felsgrat zurück, »vorsichtig wegen der Unsicherheit des Trittes«, Gesteine sammelnd, von Hagel und Schneegestöber begleitet. Trotzdem waren sie schon um »2 Uhr und einige Minuten« wieder an der Schneegrenze, wo die Maultiere zurückgeblieben waren (4820 Meter). Sie waren also trotz der genannten Schwierigkeiten in nur einer Stunde die 1061 Meter von 5881 Meter zu 4820 Meter (= 17,7 Meter pro Minute) hinabgestiegen! Durch den Páramo de Pungupala ritten sie nach Calpi zurück, wo sie schon um 5 Uhr nachmittags wieder eintrafen. »Die Expedition oberhalb des ewigen Schnees hatte nur 3½ Stunden gedauert.« In 3½ Stunden will somit Humboldt die 1061 Meter hohe schwierige Strecke von 4820 Meter zu 5881 Meter hinauf- und hinabgestiegen sein, d. h. rund 300 Meter in der Stunde. Das wäre eine Arbeit, die sich der beste moderne Bergsteiger auf nicht schwierigem Terrain und in normaler Höhe kaum zutrauen würde; 200 Meter auf und ab sind da pro Stunde schon eine recht respektable Leistung. Aber bei Humboldts Besteigungsversuch handelte es sich um gänzlich ungeübte, höchst mangelhaft – ohne Seil, Eisäxte, Nagelschuhe usw. – ausgerüstete Männer, um schwieriges Terrain auf schmalen steilen Graten, um eine Riesenhöhe mit der aus ihr folgenden starken Verminderung der Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit, um lähmende Bergkrankheit, Verletzungen, Aufenthalte zum Beobachten und Sammeln usw.

Diese vielfachen Widersprüche in Humboldts Darstellung[33] sind schon früher mit Recht kritisiert worden. Da aber die große Spärlichkeit von Zeitangaben in Humboldts Bericht eine Kontrolle der einzelnen Zeitabschnitte unmöglich macht, so ist schwer zu sagen, wo der Irrtum oder Fehler liegt. Am einfachsten ist die Annahme, daß das Quecksilberbarometer, dem die Höhenmaße entnommen wurden, in völlige Unordnung geraten war. Legen wir für die Wirklichkeit einen Durchschnitt von 150 Meter Auf- und Abstieg pro Stunde zugrunde, was der Leistungsfähigkeit dieser Reisenden und den von Humboldt geschilderten Umständen am meisten entsprechen dürfte, so hätte Humboldt mit seinen Begleitern in 3½ Stunden von der Schneegrenze (4820 Meter) aus und wieder dahin zurück die Höhe von etwa 5350 Meter erreicht. Und diese Höhe stimmt vollkommen zu der von ihm geschilderten Situation seines Endpunktes, während es bei 5881 Meter, wo er seiner Messung nach gewesen sein will, ganz anders aussieht. Dort würde er oberhalb der Felswände mitten in der Gletscherregion gestanden haben. Er ist nach alledem noch unterhalb der riesigen Felswände geblieben, die den gewaltigen Firndom tragen, und fast 1000 Meter unter dem Gipfel selbst.
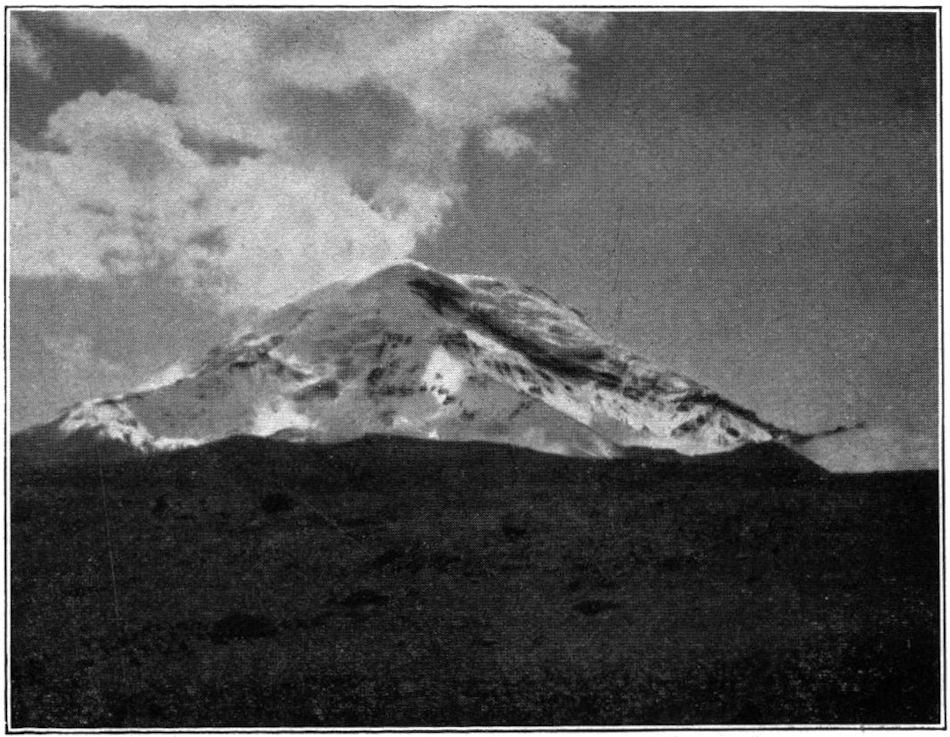
Als Humboldt seinen ersten Bericht über diesen Besteigungsversuch veröffentlichte, lag die Reise schon 35 Jahre hinter ihm, und er war ein Greis geworden, in dem die Erinnerung an die einstigen Vorgänge offenbar stark verblaßt war, obwohl er die Hauptdaten dazu seinen Tagebüchern entnommen hatte. So konnte sich allmählich die Legende von »der Chimborazobesteigung« Humboldts ausbilden, während in Wirklichkeit das Unternehmen Humboldts da aufgehört hat, wo die wahren Schwierigkeiten[34] des Felskletterns und der Eisarbeit erst beginnen, wo die Gipfelbesteigung des Chimborazo im alpinistischen Sinne erst anfängt, wo ein Bergsteiger sein oberstes Zeltlager aufstellen müßte, wie es dann Whymper an der Südwest- und Nordwestseite, ich an der Nordwestseite des Berges getan haben.
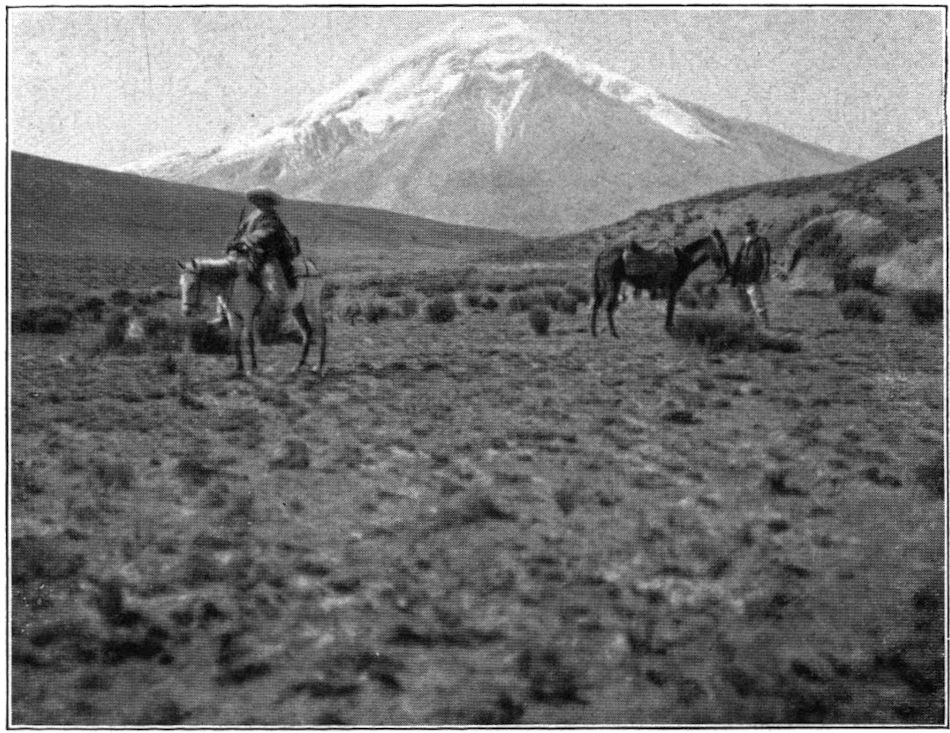
Nach Humboldt haben der Franzose Joseph Boussingault und der amerikanische Oberst Hall im Jahr 1831, die Deutschen Moriz Wagner 1859 und Alfons Stübel 1872 den Gipfel zu ersteigen versucht; bezwungen aber hat den Hauptgipfel (6310 Meter) bisher nur der Engländer Edward Whymper mit den beiden Schweizer Führern Gebrüder Carrel in zwei glänzend durchgeführten Touren am 4. Januar und am 3. Juli 1880. Alle anderen Ersteigungsgeschichten sind sensationelle Erfindungen.
Selbstverständlich hätte auch ich mit Herrn Reschreiter bei meiner Andenreise den höchsten Gipfel gern »mitgenommen«, aber es war uns nicht beschieden. Vielleicht wäre für uns der Anreiz größer gewesen, wenn es sich um eine Erstersteigung gehandelt hätte, wie ich sie seinerzeit nach dreimaligem Anlauf am Kilimandjaro ausgeführt habe, oder wenn am Gipfel selbst so viel Interessantes zu sehen wäre wie auf dem des Cotopaxi. So aber standen für mich wissenschaftliche Ziele im Vordergrund, denen sich auch mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehende beschränkte Zeit das alpinistische Interesse unbedingt unterordnen mußte, und unsern Arbeiten konnte es nur zum Vorteil gereichen, daß sie nicht durch sportlichen Zeit- und Kraftaufwand und durch alpinistische Unternehmungen verkürzt worden sind, die mehr hätten sein wollen als Mittel zum Zweck der wissenschaftlichen Hochgebirgsforschung.
[35]
Wir haben den Chimborazo zweimal von Ost über Süd und West nach Nord in der Páramoregion von durchschnittlich 4000 Meter Höhe umkreist, an allen vier Seiten Vorstöße in seine Gletscher- und Firnregion gemacht und von der Nordnordwestseite her den Westdom (6269 Meter) bis 90 Meter unter seinen Gipfel bestiegen. Die erste Tour vollführten wir Mitte Juni bei Beginn der für die Westkordillere besten, ruhigsten Jahreszeit, die zweite Tour, welche die bei der ersten gelassenen Lücken in der topographischen Aufnahme, in der Beobachtung der meteorologischen Vorgänge, der Hochgebirgsflora, der Schnee- und Eisverhältnisse usw. möglichst ergänzen sollte, in der zweiten Augustwoche am Schluß der guten Jahreszeit. Dazwischen liegen die Hochtouren auf den anderen großen Vulkanbergen.
Am 16. Juni 1903 ritten wir mit meinem Mayordomo Santiago, den beiden Arrieros Spiridion und Moran und sieben Lasttieren von Riobamba nach dem am Ostfuß des Chimborazo 3628 Meter hoch gelegenen Tambo Chuquipoquio. Dieser am Camino Real liegende Tambo ist der höchste ständige Wohnplatz auf der Ostseite des Chimborazo, die einzige Rast- und Nächtigungsstelle in jenen Höhen. Auf der Südseite liegt der Hato Totorillas 350 Meter höher (3979 Meter), auf der Nordseite der Hato Pailacocha sogar in 4266 Meter.
Von Riobamba nach Chuquipoquio geht ein breiter, bequemer Reitweg; in vier Stunden kann man bei flottem Reiten die Strecke zurücklegen. Wir ritten auf der vom Wind glattgefegten, von endlosen Agavenhecken gesäumten[36] Straße meist im Trab voraus, die »Carga«, d. h. die Lasttiere mit den zu Fuß gehenden Arrieros, folgte im Schritt nach. Langsam hebt sich das meist aus Tuff und Lapilli aufgeschüttete Hügelland zum Chimborazo und der Westkordillere hin, monoton, vom Wind zerzaust und von Staub und Flugsand verweht, gegen dessen erstickende Anhäufung sich die wenigen kümmerlichen Mais-, Gersten- und Lupinenfelder durch Agaven- und Kakteenzäune zu schützen suchen. Dazwischen stehen weit verstreut wenige Indianerhütten, graubraun wie die ganze Landschaft und von ein paar dürftigen Capuli- oder Eukalyptusbäumen umstanden, wenn ein Wasserlauf in der Nähe ist. Wasserläufe gibt es aber wenige in dieser Landschaft, immerhin mehr als in größerer Nähe des Chimborazo, denn die Schmelz- und Niederschlagswässer des Berges versinken dort im lockern Geröll seiner Schutthalden und Fußhügel und kommen erst weiter nach der Riobamba-Ebene hin zum Vorschein, wo oft undurchlässiges Gestein nahe unter der Bodenoberfläche liegt.
Wir hatten es mit dem Wetter gut getroffen, denn während des größten Teils des vierstündigen Rittes zeigte uns der Chimborazo seine majestätische südöstliche Breitseite in nur geringer Bewölkung. Unter der steigenden Sonne funkeln seine Firndome wie verglast, und darunter ziehen sich in schönster Plastik die durch steile Felsgrate voneinander getrennten Gletscherbecken herab, in denen die Eismassen als wild zerrissene Hängegletscher abfließen. Moränenwälle von enormer Mächtigkeit begleiten und umgeben sie und setzen talwärts die Gletscherrichtung in einer die einstige Ausdehnung der Eisströme deutlich markierenden Erstreckung bis in die braungrasige Páramoregion hinein fort.
Gegen 2 Uhr trafen wir an der obern Grenze des Feldbaues[37] (Gerste 3450 Meter) auf die große, von Guamote nach Quito führende Fahrstraße, folgten ihr nordwärts und waren in kurzem vor einem mit verfallenden Tuffmauern umfriedeten Gehöft von drei großen viereckigen Lehmhütten angelangt, dem Tambo Chuquipoquio (3628 Meter). Er liegt schon in der unwirtlichen Region des Páramo. Schon wartete unser der im voraus benachrichtigte Mayordomo und präsentierte mir ein Dutzend junger und alter Indianer, von denen ich die acht kräftigsten als Träger (Peones) für die Chimborazotour aussuchte. Die Kosten waren mäßig. In einem dunkeln, mit zwei wackeligen Bettstellen bestandenen Verschlag richteten wir uns nach Möglichkeit mit unseren Schlafsäcken und Decken ein, während sich auf dem Hof ein neugieriges Gesindel von Arrieros und Peones herumtrieb, die hier mit ihren Karawanen von Eseln, Pferden und Maultieren auf der Reise von oder nach Quito nächtigten. Aber keine Zudringlichkeit, kein Lärmen genierte uns; das liegt nicht in der passiven Art der ecuatorianischen Indianer und Mischlinge.
Am nächsten Morgen um 7 Uhr ging es südwestwärts fort mit dem Ziel Totorillas, dem am Südfuß des Chimborazo 3979 Meter hoch gelegenen Tambo, von dem der Saumweg über die Páramos und das »Große Arenal« nach dem westlichen Unterland führt. Sechs Stunden lang umritten wir die Ost- und Südostseite des Berges, immer auf und ab über Schluchten und Rücken durch gleichförmiges Páramogelände mit kniehohem Stipagras (Pfriemengras, Stipa Hans Meyeri Pilger) und ohne Busch und Baum. Von den Tücken des Páramocharakters hatten wir nichts zu fühlen. Rauheit und Unbeständigkeit des Wetters, häufige und schroffe Wechsel zwischen den Extremen, zwischen[38] strahlender Hochgebirgssonne und wütendem, eisigem Regen- und Schneewind, sind ja die Eigentümlichkeiten der Páramoregion, die sie zur unwirtlichsten Region zwischen Tropenküste und Schneegrenze stempeln. Aber wir hatten günstige Sommertage getroffen. Zwar umwirbeln uns öfters Nebelfetzen und umsprühen uns mit leichten Regenschauern (Paramitos), während der Wind zischend über das Gras faucht, es zu Boden drückt und uns mit Sand und Steinchen bewirft, doch dauert der Spuk nur viertelstundenlang, worauf die Sonne über uns und über die graugrünen Grashügel sowie droben über die Felsen- und Schneewelt des Chimborazo um so herrlichere Lichtfluten ausgießt.
An vielen Stellen sahen wir in den Talsenken und an den Hügellehnen kleine Herden von Schafen, Rindern und Pferden weiden; meist ohne sichtbare Hirten. Darin bilden eben die Páramos den Reichtum des Hochlands und seiner armen Indianerbevölkerung, daß sie in jeder Jahreszeit dem Vieh eine sichere, wenn auch nicht fette Weide bieten. Die besten Teile haben sich freilich die Großgrundherren auch von den Páramos weggenommen, aber es bleibt noch genug für den Bedarf des »kleinen Mannes« und seiner kleinen Herde, noch genug auch für seinen bescheidenen Holzbedarf (Krummholz der Sträucher) und für seine Jagdlust (Kaninchen, Wachteln, Enten, Füchse usw.). Von solchen jagdbaren Tieren sehen wir freilich beim flüchtigen Durchreiten nur Spuren. Unser Weg, der »Camino«, wird aus mehreren tief eingeschnittenen Pfaden gebildet, die nebeneinander herlaufen, ineinander übergehen und sich wieder verzweigen. Oft sind im Tuff übermannstiefe Hohlwege ausgetreten und von Wasser und Wind weiter ausgefurcht, in denen nicht zwei Tiere aneinander vorüberpassieren können.[39] Wer zuerst eintritt, ruft und pfeift, damit eine etwa von der andern Seite sich nähernde Karawane wartet.
Da das Wetter meist klar war, hatten wir nach Osten einen schier unermeßlichen Überblick über die weite, nach Riobamba hinabsinkende Hochmulde bis an die ferne Ostkordillere, über deren blaudunstige Kette die Schneespitzen des Cerro Altar herüberleuchteten. Weiter südlich quoll plötzlich hinter der Ostkordillere eine ungeheuere, teils blaugraue, teils kupferbraune Wolkenmasse empor, die Ausbruchswolke des von hier unsichtbaren Sangayvulkans, den man gleichzeitig dumpf donnern hört. Sie streckt und breitet und rundet sich wie eine kolossale Lokomotivrauchwolke, steigt in ihren obersten Wölbungen bis zu 10 000 und 11 000 Meter in die Höhe und wird dort oben von einer nordöstlichen Luftströmung in langem Zug nach Südwesten geweht, wobei sie ihre Asche in graubraunen Schwaden und Schleiern gleich dem schief streichenden Regen einer fernen Gewitterwolke über das Land ausstreut.
Zu unserer Rechten aber an den Steilhängen des Chimborazo, zu denen unsere Páramoregion in schneller Steigung emporzieht, sehen wir weiterreitend einen Gletscher an den andern sich reihen, eine kleine und fünf größere Eiszungen zwischen Chuquipoquio und Totorillas: auf dem Osthang über Chuquipoquio eine kleine, auf der Südostseite zwei größere, auf der Südseite drei. Die Gletscher liegen in ihren unteren Teilen weit herab unter ihrem eigenen Moränenschutt begraben, so daß ihre Eisgrenze nur durch nähere Untersuchung festzustellen ist. Von einer freien Gletscherstirn ist nichts zu sehen. Der Auslauf ist bei den meisten ganz flach. Jeder Gletscher hat sich in eine Mulde eingebettet, die er sich im Berghang selbst gegraben hat,[40] und alle sind voneinander durch steile Felsgrate getrennt, in denen man deutlich die stehengebliebenen Reste des im übrigen durch die Gletschererosion abgetragenen Mantels des Bergmassivs erkennt.
Teilweise sind die Felsgrate durch Schutt verdeckt, der sich ihnen als Seiten- und Ufermoränen der Gletscher an- und auflagert. Aber jeder Gletscher hat vor seiner Zunge eine große bogenförmige Endmoräne abgesetzt. Nach außen fallen diese Endmoränen in steilen Kegeln bis zu 250 Meter hoch ab, und mit ihren aneinandergereihten Bogen umkränzen sie oberhalb des Graslandes von etwa 4600 Meter Höhe an die Ost- und Südflanken des Berges wie mit einer kolossalen, freilich nimmer grünen Girlande. Aber auch das daran anschließende Grasland zeigt noch bis 3900 Meter hinab überall die unruhigen Formen von Wällen und Dämmen in teilweise großartigster Ausbildung, verwachsene und leicht verwischte, aber noch deutlich erkennbare Spuren einer einst viel größern Ausdehnung der Vergletscherung, die in der Eiszeit sich volle 600 Meter weiter am Berge hinab erstreckte.
In ihren oberen Partien, die dem steilsten Teil des Bergmassives anliegen, sind die Gletscher echte Hängegletscher, teilweise Eiskaskaden von wahrhaft unheimlicher Zerrissenheit, und bei 5200 bis 5600 Meter Höhe enden, respektiv beginnen sie in senkrechten Eiswänden von 50 bis 100 Meter Dicke, an denen da und dort die frischen Abbruchstellen in wundervoll zartem Indigoblau schimmern. Sie sind in zahllose Pfeiler, Türme, Rampen und Bastionen zerschnitten, die den Druck, den Schub, den Wind, die Sonne und den Frost zum Erzeuger haben. Die darüber sich hoch und herrlich wölbenden Gipfeldome blinkten an vielen Stellen wieder glasig, während[41] mir an anderen eigentümliche mattgraue Oberflächen auffielen, die sich im Fernglas als weite Felder von zacken- und spitzenförmigen Firngebilden erwiesen. Sollte das »Nieve penitente« sein, dessen Vorkommen bisher in der Äquatorialzone bestritten worden war? Oder karrenartige Firn- und Eisformen, wie ich sie auf den Kilimandjarogletschern gefunden hatte? Die Frage machte mich auf unsere von der Nordwestseite geplante Besteigung der oberen Firnregion in hohem Grad gespannt.
Zwei Bachtäler von offenbarer Glazialentstehung werden gequert, dann reiten wir über einen mächtigen Schutt- und Lavarücken immer höher hinan, bis wir eine Stunde später am Südfuß des Berges dicht am Tambo Totorillas – mit 3979 Meter die zweithöchst gelegene Wohnstätte am Chimborazo – im flachen, etwa 250 Meter breiten Totorillastal anlangen.
Der Tambo Totorillas ist nur eine große Lehmhütte mit einem bis auf den Erdboden reichenden Grasdach, viel elender als der Tambo Chuquipoquio auf der Ostseite, aber trotzdem dauernd von einer Cholofamilie (Mischlinge aus Weißen und Indianern) bewohnt, die das Vieh der umliegenden weiten Páramos beaufsichtigen soll. Die Behausung und der Haushalt sind typisch für diese Mischlingsrasse der Hochregion. Im Innern der Hütte sind durch eine Flechtwand nur zwei Räume abgeteilt; der eine mit der Feuerstelle und den Schlaflagern der Besitzer, der andere für allerlei Vorräte, für Hunde, Hühner und etwaige Gäste. Tische, Stühle, Bänke oder gar Bettstellen gibt es nicht. Die Menschen schlafen neben den Tieren auf trockenem Páramogras auf dem Erdboden zwischen Haufen von Kartoffeln und Maissäcken. Auch ein Feuerherd ist nicht vorhanden, sondern »des Hauses trauliche Flamme« flackert, von[42] trockenem Kuhmist und Wurzelstöcken des Chuquiraguastrauchs genährt, ebenfalls auf dem Erdboden zwischen ein paar zusammengeschobenen Steinen. Der Rauch zieht durch das Grasdach ab oder durch die einzige, aus rohen Stammstücken gefertigte Türe, wenn diese offen ist. Wenn sie geschlossen ist, ist es stockfinster im »Haus«. Das wenige Hausgerät, d. h. ein paar Töpfe und Schüsseln, Hacken und Messer, steht auf dem Erdboden oder hängt an Pflöcken an den Lehmwänden. Für einige Schweine, die gehalten werden, ist draußen im Tuff des Talhangs eine kleine Höhle gegraben; das Rindvieh aber und die Schafe bleiben Tag und Nacht in der Páramowildnis. Das Ganze ist eine so primitive Behausung, daß dagegen eine tiroler Sennhütte für eine komfortable Villa gelten kann. Und luxuriös ist das Leben eines Senners jenem der Páramobewohner gegenüber.
So sieht es in allen Tambos, Hatos und Vaquerias (Hirtenhütten) aus, die ich in Hochecuador gesehen habe. Ich ließ gleich unsere Zelte vor der Hütte am Bachufer aufstellen und überließ den Tambo den Arrieros und Peones.
Während Herr Reschreiter sich ans Zeichnen und Malen machte, ließ ich mich von meiner braven Mula in das hier an der Südflanke des Chimborazo emporsteigende Curipoquiotal bis auf eine alte Moräne bei 4350 Meter hinauftragen. Dort hört der Graswuchs, das Pajonal, auf und überläßt der merkwürdigen äquatorial-alpinen Andenflora das rauhe Terrain. Zwischen den zerstreut wachsenden, halbmannshohen, schuppenblättrigen und orangerot blühenden Chuquiraguasträuchern hindurch, über Tausende von kleinen violetten und zinnoberroten Gentianen, von gelben tannenreisförmigen Loricarien, edelweißartigen Culcitien usw. stieg[43] ich auf den rutschigen Schutthängen der alten und dann der jungen Moränen bis an die Eisgrenze empor, allmählich die Vegetation hinter mir lassend. Das Eis ist weit von dickem Moränenschutt bedeckt, aber an mehreren Stellen unschwer zugänglich.
Vom rezenten Moränengürtel zieht sich die alte Moräne gleich einem Lava- oder Schlammstrom in das Curipoquiotal hinab, und die Eingeborenen nennen auch diese sowie die meisten anderen Moränenwälle ihrer Berge »Volcanes« wie die ihnen äußerlich oft täuschend ähnlichen wirklichen Lavaströme.
Die Firnregion des Berges hatte sich von Mitte des Nachmittags an in schwere Wolken gehüllt, die immer tiefer sanken. Gegen Abend fing es an zu regnen, und in der Nacht folgte ein kurzes Gewitter, dessen Guß wir in unseren Schlafsäcken mit Behagen auf das Zeltdach prasseln hörten. Der ringsum geschlossene Canvasboden des Zeltes hielt vollkommen wasserdicht, so daß wir mit Ruhe den weiteren Stürmen der nächsten Woche entgegensehen konnten. Der Morgen war naß, kalt, nebelig, windig; man kannte das sonnige, ruhige Tal vom vorigen Mittag kaum wieder.
Unser Pfad, der uns um die ganze Westseite des Chimborazo über das große Sandfeld nach dem Gehöft Cunucyacu im Nordwesten des Berges führen sollte, klettert westlich von Totorillas erst durch abscheuliche Hohlwege empor und mündet dann plötzlich ohne merklichen Übergang in eine total veränderte Landschaft, in die Wüste des »Arenal grande«: auf der ganzen Westseite des Chimborazo von der Schneegrenze an bis meilenweit nach Westen hinunter eine leicht abfallende, wenig gewellte, öde, steinige Fläche. Nichts mehr von der Hügellandschaft der grasigen[44] Páramos der Süd- und Ostseite des Berges mit ihrem großartigen Gletscherhintergrund, sondern ausgeebnete, graue Flächen von Bimsstein, vulkanischem Sand und vulkanischer Asche in trübseliger Monotonie.
Ein paar Trockentäler sind in die Bimssteinplatten eingefurcht, aber sie haben nur bei starken Gewitterregen oder Schneeschmelzen für kurze Zeit etwas Wasser. Die intensive Sonnenstrahlung, die Wasserlosigkeit und Öde des Bodens, die ausgeglichene Oberflächengestalt des Geländes, die enorme Trockenheit und Klarheit der Luft, die Zwerghaftigkeit der weit zerstreuten Pflanzen, das Fehlen von Tieren und Menschen: alles vereinigt sich zum Bilde der Wüste. Die Pflanzen sind den Extremen des Wüsten- und Hochgebirgsklimas zugleich angepaßt, denn sie müssen sich ebenso gegen übermäßige Insolation, ausdörrende Winde und Sandwehen wie gegen Schnee und Nachtfrost schützen. Die einen schmiegen sich als einfache Rosetten platt an den bei Sonnenschein wärmenden Boden, andere hüllen sich in einen hellgrauen Haarpelz wie unser Edelweiß, wieder andere verdicken ihre Oberhaut zu einem wenig durchlässigen Panzer, alle aber reduzieren möglichst ihre Atmungs- und Verdunstungsorgane und strecken desto riesigere Wurzeln in den Boden aus, um das spärliche Naß zu suchen. Von den meisten Arten stehen die Individuen in niedrigen runden Büscheln dichtgedrängt beisammen, um einander Schutz gegen den trockenen Wind und die Kälte zu bieten. Die Landschaft ist gleichsam betupft mit solchen Polstern, die von fern wie graue oder grellgrüne Maulwurfshaufen aussehen.
Da wir jetzt im Juni zur eigentlichen Blütezeit durch diese alpine Wüstenlandschaft reiten, strahlen uns von allen[45] ihren Blütenpflanzen, von Gentianen, Valerianen, Senecien, Wernerien, Malvastren, Baccharis, Arenaria, Alchemilla, Lupinus und anderen Tausende zierlicher weißer, gelber, roter, violetter Blumen entgegen, die in ihrem Kontrast zu der wüstenhaften Umgebung dem Landschaftsbild einen unbeschreiblichen Reiz verleihen.
Der Wind weht kalt, steif und regnerisch aus Südosten hinter uns her, so daß wir uns in unsere Gummiponchos hüllen und die Kapuzen überklappen. In den Invierno-Monaten (November bis Mai) liegt hier oft fußtief Schnee. Auch jetzt im Verano vergehen nur wenige Tage ohne Schneefall, aber die weiße Decke verschwindet schnell wieder. Der Reitweg ist hart wie eine Tenne und zieht sich, wie immer in Ecuador, in einem halben Dutzend nebeneinanderlaufender Pfade dem Ziele zu. Vom Chimborazo ist bis gegen 10 Uhr in den dunklen Wolkenmassen keine Spur zu sehen. Nach links dagegen wird zuweilen unter der dicht über uns lastenden Wolkendecke weg der Ausblick in das ferne sonnige, dunkelwaldige Bergland der Chimborazokordillere frei, zu der unsere Hochebene allmählich absinkt.
Den höchsten Punkt (4450 Meter) unseres Wegs erreichten wir um Mittag bei einem Steinhaufen von Lapilli, schlackigen Bomben und Bimssteinbrocken, auf dem fromme Furcht vor Sturm und Verderben ein kleines Holzkreuz errichtet hat. Ein paar zerfallene Eselgerippe in der Nähe mahnen »memento mori«. Cruz alta heißt der Punkt.
Von hier trat ein schneller Wetterwechsel ein, da wir in den Windschatten des Chimborazo getreten waren. Der heftige Südostwind, der uns bisher von hinten getrieben hatte, und das Nebelwehen hörten auf, und zu unserer Rechten wurden in großer Klarheit die Fels- und Eiswände des[46] West-Chimborazo sichtbar. Der Berg ist hier, auf der Mitte der Westseite, die wir ganz überblicken, gar nicht wieder zu erkennen. Er hat sich in einen breiten Kegel mit einer einzigen runden Kuppel verwandelt: eine wahre Schulform eines schneebedeckten Vulkans. Diese Kuppel ist der von einem felsigen Unterbau getragene domförmige Westgipfel, hinter dem die übrigen Gipfel versteckt liegen. Von Südwesten her sehen wir einen mit einigen bizarren Türmen und Nadeln besetzten Felsgrat zum Unterrand des großen Firndoms hinaufziehen. Wo der Grat endet, hängen rechts und links zwei von den oberen Eisbrüchen genährte Gletscher in ihre Täler herab, die beiden einzigen der Westseite; im Südwesten der »Trümmergletscher«, im Westen der »Thielmanngletscher«. Nach Nordwesten aber läuft ein langgestreckter Grat mit felsiger Schneide zum Arenal herunter, der oben im Firngewölbe des Westgipfels verschwindet. Zerfetzte graue Wolken jagen um die dunkelbraunen Felsen und die wunderbaren blaugrünen Eisschründe der Westseite des Berges, und darüber blitzt das äquatoriale Sonnenlicht auf den weißen Schneefeldern des Westgipfels, daß die Augen sich geblendet abwenden.
Je weiter wir nach Norden reiten, desto ungestümer bläst uns wieder der Ostwind, gegen den uns der Chimborazo eine Zeitlang geschützt hatte, seitlich von vorne an. Zwei Stunden haben wir uns mühsam um die Nordwestseite des Chimborazo herum durch ein vom Wind wild und wüst verwehtes Gebiet durchzuschlagen; Tiupongo heißt es. Der vulkanische Sand ist hier in den Mulden der weiten Bodenwellen zu langen Dünen angeweht, auf denen Mensch und Tier nur schwer vorwärts kommen. Es ist ein Stapfen, Rutschen und Wälzen wie in tiefem, pulvrigem Schnee.[47] Der uns nun von vorn packende Ostwind peitscht uns den Sand wütend ins Gesicht, so daß wir die Augen mit Schneebrillen schützen müssen.
Als wir durch dieses Dünengewirr allmählich auf die Nordwestseite des Berges kamen, steckte dieser bereits wieder in dicken, düsteren Wolken, die unaufhörlich von Nordosten heranströmten. Darunter aber guckte eine lange, flache Eiszunge hervor, deren Stirn ein mächtiger Moränenkegel umgrenzt: das Ende des »Stübelgletschers«. Bald danach betraten wir endlich wieder grasigen Páramoboden und erreichten an einem klaren, kalten Wasserlauf den kleinen Hato Poquios (4087 Meter) im Tal von Cunucyacu, die Nordostgrenze der Sandwüste Tiupongo und des Arenal grande. Von hier führt im Bachtal der Pfad nach der Hacienda Cunucyacu hinunter, wo wir gegen Abend im neuen »Herrenhaus« unter einem großen Strohdach vier rohe fensterlose Lehmwände und einen mit trockenem Páramogras beschütteten Lehmfußboden als Fremdenzimmer bezogen.
Die Hacienda Cunucyacu, das Standquartier für unsere Besteigungen und Untersuchungen der Nordgletscher des Chimborazo, ist mit 3759 Meter die höchstgelegene Hacienda an der Nordseite des Berges. Wir sind zwar hier ziemlich fern von ihm – zweieinhalb Stunden flotten Reitens bis zum Fuß, und in Luftlinie zirka 15 Kilometer zum Gipfel –, aber wir haben keine andere Wahl. Auf der ganzen West- und Nordseite des Chimborazo ist es oberhalb 3000 Meter die einzige menschliche Siedlung, wo für uns, unsere Leute und Karawanentiere genügende Nahrung und Unterkunft zu finden ist. Sonst gibt es auf der Nordseite zwar noch ein paar zu Cunucyacu gehörende einsame, dem Bergfuß nähere Hirtenhütten oder Vaquerias,[48] z. B. den Hato Pailacocha (4266 Meter), aber dort ist bestenfalls ein Trunk saurer Schafmilch zu haben, und das ganze übrige Gebiet bis zum Tambo Chuquipoquio am Ostfuß des Gebirges, so groß wie mancher deutsche Kleinstaat, ist unbewohnt, menschenleer und nur von einigen halbwilden Schaf-, Lama- und Rinderherden durchstreift, die sich in den rauhen Páramos ihre Nahrung und ihr Nachtlager selbst suchen müssen. Überall nur fahles, steifes Páramogras oder Sumpf oder Sand und vulkanischer oder glazialer Gesteinschutt, nirgends ein Baum oder Busch.
Bloß neben der Hacienda Cunucyacu, die sich wohlweislich gerade da hingelagert hat, wo das Hochtal des Pucayacubaches (puca = rot, yacu = Wasser) sich zu einem ziemlich tiefen geschützten Kessel erweitert, grünt es innerhalb einer Umfriedigung (Potrero) frisch von Alfalfa (Luzerne) für das Jungvieh und von Kohl für den Haushalt des Mayordomo. Aber sonst ist die Hacienda in schlimmem Zustand. Wohnhaus, Gesindehaus und Ställe sind vor einem halben Jahr ein Raub der Flammen geworden – was diesen größtenteils aus trockenem Páramogras aufgeführten Baulichkeiten alle paar Jahre einmal zu passieren pflegt – und die ausgebrannten Grundmauern stehen trauernd neben unserer neuen Strohhütte. Der Mayordomo behilft sich mit einigen Strohhütten auf den benachbarten Hügeln und erweist sich uns gegenüber als Wirt so zuvorkommend und hilfreich, wie es ihm seine engen Verhältnisse nur gestatten. Auch ist es in diesen gottverlassenen Gegenden von Wichtigkeit, daß sein junges Weib außer Locro (Kartoffelsuppe) auch noch einiges andere kochen kann, was ein genügsamer Europäer zu genießen vermag.

Bei unserm »Herrenhaus« fand sich am nächsten Tag[49] bald eine Versammlung von Vaqueros (Rinderhirten) ein, die der Mayordomo aus der Umgegend hatte zusammenrufen lassen, um mich daraus einen Führer für die Bergtour wählen zu lassen. Lauter famose Gestalten, teils reine Indianer, teils Halbblüter, alle von untersetzter Figur und muskulös, alle grauenhaft schmutzig, alle in verwettertem Filzhut, Poncho und langhaarigen Lamafellhosen und mit nackten Füßen, an welche wahre Ungeheuer von Sporen geschnallt sind. Auf ihren kleinen struppigen, mageren Pferden jagen die Kerle wie die Teufel über ein Terrain, vor dessen Löchern, Rissen, Sümpfen und Steinblöcken sich ein preußischer Kavallerieleutnant zehnmal überlegen würde, ob er seinen Gaul nicht lieber am Zügel führen solle. Ich wählte mir einen strammen, braunen, gutmütig dreinschauenden Burschen aus und habe meine Wahl nicht zu bereuen gehabt. Nicolas hieß der Brave.

Von der Talsohle aus, auf der die Hacienda Cunucyacu liegt, sieht man gar nichts vom Chimborazo. Vom obern Talrand aber hat man bei klarem Wetter einen wundervollen Überblick über den Berg; am besten frühmorgens und spätnachmittags. Pyramidenförmig baut sich die Nordwestfront vor uns auf. Rechts und links ziehen zwei Steilgletscher herab, rechts der längere »Stübelgletscher« vom Westgipfel, links der kürzere »Reißgletscher« vom Nordgipfel, zwischen ihnen das tief in das Bergmassiv wie ein großes Kar hineingeschnittene Kesseltal Pucahuaico (»rotes Tal«), über dessen oberen roten Felswänden die Eismauern des Gipfelfirns aufsteigen. West- und Nordgipfel rücken in dieser Ansicht nahe zusammen, getrennt und zugleich verbunden durch einen leicht gesenkten Firnsattel, über dem die weiße Kuppe des Südgipfels, des höchsten von[50] allen (6310 Meter), noch hindurchblickt. Von der Ostflanke des Stübelgletschers, zwischen diesem und dem tiefen Pucahuaico, streckt der Berg nach Nordnordwesten einen hohen langen Fels- und Schuttkamm, die Puca Loma, wie einen riesigen Strebepfeiler auf Cunucyacu herab aus, auf dessen Rücken man ohne wesentliche Hindernisse bis zur Eisgrenze aufsteigen kann; diese liegt dort über 5700 Meter, höher als irgend woanders am Chimborazo, und der Übergang auf den Firnmantel der Gipfeldome schien nicht schwierig zu sein. Die Wahl dieser, wie auf den ersten Blick zu sehen war, direktesten Aufstiegroute ergab sich für mich von selbst.
Am frühen Morgen des 20. Juni, nach einer stürmischen Nacht, in der ich an bohrendem Kopfschmerz, Herr Reschreiter an Atembeklemmungen merkte, daß unsere Höhenanpassung noch unvollkommen war und die Bergkrankheit (Soroche) sich anmeldete, ritten wir durch das Tal des Pucayacu dem Chimborazo entgegen. Ich hatte sechs Lasttiere, den geländekundigen Indianer Nicolas aus Cunucyacu und die acht in Chuquipoquio angeworbenen Indianer mitgenommen, die weiter oben bei Beginn des schwierigen Terrains die Lasten von den Tieren übernehmen sollten. Auf dem flachen Talboden des Pucayacu weideten kleine Herden von Schafen und Lamas und wurden bei unserm Nahen flüchtig. Lamas als zahme Herdentiere in den Páramos sind immer eine sonderbare Erscheinung, an die man sich auch bei längerm Aufenthalt nur schwer gewöhnen kann; so sehr machen die wie Rehe oder Antilopen dastehenden, äugenden und sichernden Tiere den Eindruck[51] von Wild, daß sich schon mancher erfahrene Reisende täuschen ließ.
Nach zweistündigem Ritt beim Hato Poquios (4087 Meter) angelangt, ließ ich für uns zwei kleine Fässer mit Trinkwasser füllen, da es oben auf dem Nordnordwestgrat keine Quellen mehr gibt. Ein kurzes Stück danach beginnt bei 4100 Meter die starke Steigung der Nordnordwest-Loma (Puca Loma) und damit im orographischen Sinn der Nordfuß des Chimborazomassivs. Sobald wir hier den steilern Anstieg begonnen haben, lassen wir das Grasland (Pajonal) hinter uns und treten in eine geognostisch, klimatisch und botanisch ganz andere Landschaft ein. Diese vom Berg ausgestreckten Steilrücken (Lomas) bauen sich teils aus Felsleisten und -graten, teils aus zersplittertem Felsschutt, Bimsstein und Sand auf, in dem nur wenige zähe Gewächse aushalten können. Der Vegetationscharakter ist derselbe wie auf dem Wüstenplateau der West- und Westnordwestseite, nur die Pflanzenarten sind weiter oben, wo die klimatischen Extreme noch viel größer werden, andere als dort. Über die exponierten Hänge und Kämme braust den größten Teil des Tages ein kalter heftiger Wind, entweder als Fallwind von den Eisgipfeln des Berges herab oder als Steigungswind vom westlichen Unterland herauf oder als Passat von Osten her. Mit sausendem Getöse wirbeln uns dicke Staubtromben entgegen, zum Entsetzen unserer Mulas, die jedesmal kurz kehrtmachen und auszureißen versuchen. Wie auf dem Wüstenplateau der Westseite weht auch hier der Wind den Flugsand zu langen welligen und tausendfach gerippelten Dünen zusammen. Vom windgepeitschten Flugsand geglättete und geschliffene Steine (Dreikanter) liegen in Mengen umher. Der Wind begräbt[52] einerseits die niedrige Vegetation im Sand, andererseits entblößt und tötet er die Polsterpflanzen und das Knieholz durch Deflation. Oft sehen die abgestorbenen sonnengebleichten Wurzelstöcke aus, als seien sie künstlich herauspräpariert.
Aber die lebenden kleinen Pflanzen stehen auch jetzt hier im Frühlingsschmuck ihrer zahllosen zarten Blüten und verleihen dem sonst so düstern Bild einen freundlichen Schönheitsschimmer. Zu Millionen sind in der Region zwischen 4100 und etwa 4500 Meter innerhalb des Gesichtsfeldes die kleinen krokusartigen oder sternförmigen weißen, violetten, purpurroten und gelben Blumen der schon genannten Arten über die Sand- und Schuttflächen verstreut. Über dieser Region, etwa zwischen 4500 und 4800 Meter, treten die knorrigen, niedrigen Chuquiraguasträucher zur obersten Vegetationsformation des Berges zusammen, nicht sowohl durch Vermehrung ihrer Individuen, als durch Verschwinden der vielen kleinen Gewächse, die sie bis hierherauf begleitet haben. Auch sie stehen jetzt im Flor und beleben mit ihren daumengroßen rotgelben pinselförmigen Blüten die einsame Landschaft. Da und dort schießen um die Blütenstände ein paar winzige Kolibris wie Diamantblitze hin und her, grün und rot metallisch schillernde Tierchen (Oreotrochilus).
Gegen Mittag rasteten wir in 4720 Meter Höhe unter einigen uns gegen den Ostwind schützenden Felsen. Mehrere von ihnen sind vom sandbeladenen Wind geschliffen und gefurcht, so daß man zuerst an Gletscherwirkung denken könnte. Hier leuchtete uns aus einigen geschützten Standorten, wo der Sandboden ein wenig feucht ist, die merkwürdigste und schönste aller hochandinen Pflanzen entgegen,[53] das in einen dichten hellbraunen Haarpelz gekleidete, etwa 30 Zentimeter hohe, großblätterige, dickstengelige Culcitium rufescens, das abgesehen von seinen fahlgelben quastenförmigen Blüten einem riesigen Edelweiß unserer Alpen gleicht.
Unter einem stürmischen Schneegestöber, das uns den ersten hochalpinen Gruß des im Wolkengewirr versteckten Chimborazogipfels brachte, ritten wir steil weiter hinan über grobes Trümmergestein. Bald aber war unserm Vordringen im Sattel Halt geboten. Die Tiere, von denen wir abgesessen waren, rutschten in dem lockern Schutt immer wieder um die Hälfte des Schrittes zurück, blieben nach jeden weiteren paar Metern prustend und mit fliegenden Weichen stehen und versagten schließlich ganz. Sie unterlagen sichtlich dem Einfluß der dünnen Höhenluft. Bei 4920 Meter ließ ich absatteln und abladen und den acht Indianern so viel aufpacken, wie jeder schleppen konnte. Der Rest des Gepäcks blieb liegen, um am Spätnachmittag von den Peones nachgeholt zu werden. Von uns Weißen trug jeder seinen vollgefüllten Rucksack nebst allen möglichen Zutaten. Während sich die Arrieros mit den Tieren schleunigst nach Cunucyacu hinab aus dem Staube machten, mühten wir uns auf den abschüssigen Schutthängen langsam weiter bergan; auch wir alle zwei bis drei Minuten kurz im Stehen rastend, um der Atemnot Herr zu werden, die jetzt in 5000 Meter bei der schweren Anstrengung und Belastung mit Macht über uns kam. Sonstige Beschwerden von Bergkrankheit blieben noch aus. So brauchten wir zwei gute Stunden, um 250 Meter zu bewältigen.
Mitte des Nachmittags trafen wir auf dem Rücken des Nordnordwestgrates bei 5145 Meter auf einen einigermaßen[54] ebenen Fleck neben einem Haufen großer Felsblöcke, der unseren beiden kleinen Zelten einigen Schutz gegen den stürmischen Ostwind und gegen die von den Schneegipfeln herunterblasenden Fallwinde gewähren konnte. Der übrige Teil der Nordnordwest-Loma bis an die Eisgrenze bei 5700 Meter lag als ein einziger langer Schuttwall sturmfrei über uns. Also wurde in dem geschützten Winkel das Lager aufgeschlagen, die Zeltstricke mit großen Steinen fest verankert, und was nicht in den Zelten untergebracht zu werden brauchte, zwischen den Felsen verstaut. Während wir zwei Europäer mit Santiago das Lager herrichteten, holten die Peones die unten an der Abladestelle zurückgelassenen übrigen Lasten nebst einem Vorrat von Knüppelholz herauf und trollten dann, belohnt durch einen Extraschnaps, mit dem Befehl von dannen, uns in zwei Tagen wieder abzuholen. Bei uns im Lager blieb außer dem unvermeidlichen Santiago nur der in Cunucyacu angeworbene Indianer Nicolas.
Kaum hatten wir unsern Unterschlupf fertig, als es von Osten her so stark zu wehen und zu schneien begann, daß an weitere Unternehmungen fürs erste nicht zu denken war. Wir hockten und lagen den Rest des Nachmittags im Zeltchen, tranken Tee, rauchten, schrieben Tagebuch und plauderten. Als es am Abend klarer wurde, hatten wir etwa 15 Zentimeter Neuschnee um uns, und nach oben hin war am Berg noch viel mehr gefallen. Dort oben aber sahen wir jetzt anstatt des westlichen Schneedoms eine ungeheuere helle runde Wolkenhaube, die vom Oststurm fortwährend nach West gejagt wurde und sich von Osten her immer wieder über den Schneegipfeln erneuerte.
In der Nacht stellte sich auch in unserer Region der Oststurm[55] wieder ein, und zwar mit verdoppelter Gewalt und mit Schneetreiben; zornig stieß und riß er an unseren Zelten, »denn die Elemente hassen das Gebild von Menschenhand«. Wir mußten mehrmals in die schneidige schneeige Kälte hinaus, um die gelockerten Zeltstricke neu zu verankern. Zum Schlafen kamen wir nur wenig, denn sobald wir uns zur Ruhe ausstreckten, begannen die Nöte der Bergkrankheit, des »Soroche«, uns zu quälen. Um die Lungen zu erleichtern und das Herz zu beruhigen, mußten wir uns immer wieder aus der gestreckten Lage halb aufrichten und in tiefen Atemzügen den geringen Druck und Sauerstoffgehalt der Luft unserer 5145-Meter-Höhe zu paralysieren suchen.
Gegen Morgen stand das Thermometer auf 5½ Grad unter Null, und das in unseren Metallbechern im Zelt stehengebliebene Wasser war zu Eisklumpen gefroren. Das Wetter blieb sich gleich. Der eisige Ost heulte nach wie vor und trieb den am Vortag gefallenen Schnee in langen fliegenden Fahnen über unsern Grat. Oben über der Gipfelregion zog noch immer die runde, breite, weiße Wolkenmasse eilig dahin. Unter diesen Umständen mußten wir uns mit einer bloßen Rekognoszierung auf unserm Grat hinauf begnügen, die uns in drei Stunden bis an die großen »Roten Nordwestwände« (5715 Meter) brachte und uns zeigte, daß dort der Übergang auf den Firn des Stübelgletschers mit Steigeisen gut ausführbar war.
Als wir am folgenden Morgen (22. Juni) gegen 6 Uhr zur Besteigung des Westgipfels aufbrachen, der sich noch 1000 Meter über uns wölbte, war der Neuschnee großenteils weggeblasen und weggetaut, aber der Ostwind stürmte noch und machte uns das Steigen in dem losen, steilen[56] Schutt sehr sauer. Besonders Santiago, der ebenfalls einen vollen Rucksack tragen mußte, klagte über Kopf- und Ohrenschmerzen, Atmungs- und Herzbeschwerden und hinkte stöhnend hinterher. Besser ging es, als wir vom Schutt auf die Schneefelder kamen, die noch auf der obern Strecke unserer Loma lagen. Der Indianer Nicolas zögerte erst vor dem Betreten des Schnees, da er nur seine gewohnten Bastsandalen (Alpargatas) über einem Paar meiner Wollstrümpfe trug. Aber eine Prämienzulage gab den Ausschlag, und er hat sich nicht den mindesten Schaden getan; eine unerhörte Abhärtung.
Die Schneehänge waren hier in lauter schmale, flachkonkave Stufen von Handbreite wie die »Schneegangeln« unserer Berge gegliedert, die ziemlich horizontal von Ost nach West, also fast senkrecht zum Neigungswinkel des Berghanges verliefen und uns, da der Schnee jetzt fest gefroren war, das Steigen wie auf Treppen erleichterten. Dank ihnen erreichten wir trotz des stürmischen Windes schon nach zwei Stunden den Fuß der großen »Roten Wände«, wo der Übergang auf den Firndom des Westgipfels beginnt.
Auf den »Roten Wänden« lagert die gewaltige Firn- und Eisdecke des Gipfeldoms mit senkrechten, sechzig und mehr Meter hohen Abbruchmauern, an denen die Schichtung des Schnees und die Bänderung des Eises zutage tritt, wie die Lagen und Bänke der Laven und Agglomerate an den unter den Eiswänden abstürzenden Felshängen. Die beiden großen Massen werden äußerlich miteinander durch die gefrorenen Schmelzwasser, die riesengroßen Eiszapfen, Eisstalaktiten und Eisstalagmiten verbunden, die, 50 bis 60 Meter lang und 10 bis 15 Meter dick, über die Wände herabstarren: ein Bild von grotesker Großartigkeit.
[57]
Unsere beiden Begleiter kehrten hier, in 5715 Meter Höhe, zum Zeltlager zurück. Westlich vor uns lag jetzt der Oberteil des Stübelgletschers, der bergauf in den Firnmantel des Westgipfels übergeht. Der Übergang auf den Firnhang war mit unseren Steigeisen nicht besonders schwierig. Fernerhin trafen wir nur an wenigen Stellen auf ausgeapertes Eis; meist hatten wir eine gut tragende, von der Sonne schalenförmig angeschmolzene Firnschicht unter den Füßen, ganz ähnlich den Schneehängen, über die wir heraufgekommen waren. Das war der Anfang eines Schmelzprozesses, der, wie wir sieben Wochen später sahen, bei Fortdauer der nämlichen schmelzenden Faktoren allmählich die Firn- und Eisdecken zu den wunderlichen, wilden Formen des »Nieve penitente« oder »Zackenfirns« ausgestaltet, der uns bei unserer spätern Besteigung die allergrößten Schwierigkeiten bereitete. Auf diesen welligen Firnfeldern traversierten wir nun nach Westen hinüber, weil ich mutmaßte, daß wir es dort mit weniger steilen Abhängen zu tun haben würden. Dies war jedoch ein Irrtum. Es dauerte nicht lange, so gerieten wir in eine Zone kolossaler Spalten, die uns Halt geboten. Bei einer Breite von 20 bis 30 Meter erreichen sie eine Tiefe von mehr als 150 Meter, ohne den Felsgrund zu treffen. Durch mannigfache Querklüftung sind Eistürme von 50 bis 60 Meter Höhe stehengeblieben, aber meist schief und bereit, jeden Augenblick auf die tieferen Partien des Stübelgletschers hinunterzustürzen, wo ihre Trümmer massenhaft angehäuft sind. In wunderbarer Schönheit hebt sich in den gigantischen, von blitzendem Sonnenlicht übergossenen Massen die weiße und hellblaue Schichtung und Bänderung des Firnes und Firneises ab, hier und da getrennt durch dünne Staubschichten, die, soweit[58] es nicht Verwitterungsstaub ist, wohl teilweise vom immer tätigen Sangayvulkan, zum Teil auch vom Cotopaxi stammen. Nur in den tieferen Lagen, 20 bis 30 Meter unter der Oberfläche, kommt ein dunkelblaues, dichtes Gletschereis zum Vorschein.
Vom Unterland war aus unserer großen Höhe von fast 6000 Meter nichts zu sehen; es war verdeckt durch ein unabsehbares weißwelliges Wolkenmeer, das langsam aus Westen nach Osten hinwallte und nur selten den rötlichen Bergfuß durchschimmern ließ. In unserer Region aber wehte aus entgegengesetzter Richtung der übliche Ostpassat der Höhe, und zwar oben mit noch stark zunehmender Heftigkeit; denn über den Gipfel weg fluteten die Nebel in geschlossener runder Masse, einem ungeheuern weißen Wasserfall gleich, auf die Westseite zu uns herab, wo sie sich nahe über uns in scheinbares Nichts auflösten. Das ganze Phänomen ist von föhnartigem Charakter und sehr ähnlich dem sogenannten Tafeltuch auf dem Tafelberg bei Kapstadt, wo ich es vor Jahren tagelang in schönster Entfaltung beobachten konnte.
Nach Westen gab es für uns wegen des Spaltenlabyrinthes kein Weiterkommen. Also schwenkten wir direkt auf den steilen Gipfelhang ein, der hier über 40° Neigung hat. Dank unseren Steigeisen brauchten wir nur wenig Stufen zu schlagen. Trotzdem begann infolge des abnehmenden Sauerstoffgehalts und Luftdrucks in der 6000-Meter-Höhe das Steigen uns beiden sehr schwer zu werden. Wir mußten alle zehn Schritt einige Sekunden pausieren, um die Lungen wieder aufzufüllen und den übermäßigen Herzschlag zu beruhigen. Unseres Willens aber bemächtigte sich, ohne daß wir uns körperlich ermüdet fühlten, eine eigentümliche Erschlaffung, deren Überwindung die höchsten Anforderungen[59] an den Intellekt stellte. Nur in so großen Höhen von 5000 bis 6000 Meter habe ich an mir und anderen diese nervöse Energielähmung erlebt, die zweifellos mit der Sauerstoffverminderung zusammenhängt. Wie früher auf dem Kilimandjaro, so wiederholte sich diese Erfahrung später auf dem Cotopaxi.
Langsam ging es so bis zu etwa 6050 Meter hinauf. Da tat sich vor uns eine breite Eiskluft auf, die die ganze Westseite des Gipfels umspannte und, wo wir auch den Versuch machten, keine haltbare Überbrückung bot. Hier ging es mit menschlichen Kräften nicht weiter. Zum Suchen einer neuen Anstiegsroute von der Eisgrenze aus reichte aber die Zeit nicht mehr hin; es war 2 Uhr vorüber, und die Nebel wurden immer dichter. Schweren Herzens mußten wir deshalb, 200 Meter unter dem Gipfel, den Entschluß zur Umkehr fassen. Wir brachten noch eine halbe Stunde mit Untersuchen der Firn- und Eisstruktur in dieser Höhe, mit Messen, Skizzieren und Photographieren nützlich hin und traten dann den Rückzug an. Der Abstieg ging, wie immer auf gutem Firn, sehr rasch. Eine Stunde später schnallten wir bei den Felswänden an der Eisgrenze unsere Steigeisen ab und rutschten im losen prasselnden Schutt auf der Nordwestloma zu unseren Zelten hinunter.
Bald nach unserer Rückkunft ins Lager steckte der obere Berg wieder ganz in einem wildbewegten Wolkenchaos, und die Nacht bescherte uns einen neuen kräftigen Schneefall, der, bis zum Morgen andauernd, alle weiteren Unternehmungen in den oberen Regionen für die nächsten Tage vereitelte. Und da die Peones, die am Vormittag, wie verabredet, heraufkamen, um uns eventuell abzuholen,[60] einmütig erklärten, sie würden bei so schlechtem Wetter nicht noch einmal heraufsteigen, ließ ich das Lager in der Hoffnung abbrechen, daß wir es ein paar Wochen später mit Wind und Wolken besser treffen würden. Was wir diesmal von Wind und Schnee und Eis, von Gesteinen und Pflanzen und anderen interessanten Dingen hier oben gesehen, untersucht und gesammelt hatten, lohnte ja auch schon die Mühe.
Eine Entschädigung für die total vernebelte Aussicht nach oben gewährte uns aber vor unserm Aufbruch das unvergleichliche Panorama, das sich unter uns in der abgeschneiten, kristallklaren Atmosphäre nach Osten und Norden hin öffnete. Vom Cayambe im Norden bis zum Cerro Altar im Osten standen sie alle, die Schnee- und Eisriesen Hochecuadors, im milden Glanz der Morgensonne in langen Reihen vor uns, lauter Viereinhalb- und Fünf- bis Sechstausender. Ich nenne das Panorama unvergleichlich, nicht um damit einen Superlativ des Eindrucks auszusprechen, sondern weil diese hochandine Vulkanlandschaft Ecuadors so eigenartig ist, daß keine andere, auch nicht im übrigen Südamerika, mit ihr verglichen werden kann. Im Gegensatz zu einer europäischen oder asiatischen Alpenlandschaft mit ihren zusammenhängenden Gebirgsketten und langen, von ewigem Schnee bedeckten Firsten und Kämmen sehen wir hier lauter große, meist kegel- oder pyramidenförmige Einzelberge, die durch Intervalle von viel größeren Dimensionen, als sie die Berge selbst haben, voneinander getrennt sind und nur von sehr günstigen Standpunkten aus die riesigen Reihen erkennen lassen, zu denen sie angeordnet sind. Dem großen Bild mangelt nicht bloß die Mannigfaltigkeit der Formen und die reiche Bewegtheit der Linien, die ein Faltengebirge wie die Alpen oder den Kaukasus so reizvoll machen,[61] sondern auch der belebende Wechsel von schneeigem und felsigem Hochgebirge mit dunklen Wäldern, grünen Weidetriften und freundlicher Kulturstaffage, die wir nur selten in einer Alpenlandschaft vermissen.
Diese ecuatorianische Andenlandschaft ist von erhabener Schönheit durch die große Einfachheit ihrer Gestalten, durch die klassische Ruhe ihrer Linien, durch die ungeheuere Weite ihrer Ausdehnung, durch den tiefen Ernst ihrer gleichmäßigen, meist düstern Farbenstimmung und ihrer unendlichen Einsamkeit. Wie die Steppe oder die Wüste ist sie aber als Ganzes durchaus unmalerisch und kann deshalb auch als Ganzes vom Maler nicht in ihrer Erhabenheit wiedergegeben werden. Um die Größe der Natur zu bewältigen, muß die Kunst auch in diesem Fall zusammenfassen, verallgemeinern; sonst muß sie sich mit Ausschnitten, mit Teilen begnügen. Und solche Teile sahen wir auch dort von unserer alles überragenden, hohen Warte im berückenden Zauber malerischer Beleuchtungen und Wolkeneffekte. Wenn ich aber das Ganze überschaute, wie da die violettbraunen, weißgipfeligen Pyramiden und Kegel bis in unabsehbare Ferne emporragten über das flache hellgraue Wolkenmeer, das allmählich alle dazwischenliegenden Ebenen und niederen Berggruppen verdeckte, so hatte ich den Eindruck einer großen polaren Insellandschaft und dachte an die eisbeladene Vulkaninsel Jan Mayen und an Bilder aus dem Kurilen-Archipel.
Das herrliche Schauspiel dauerte kaum eine Viertelstunde, dann zogen die Ostnebel, von den Firnhörnern des nahen, mit Neuschnee völlig überzuckerten Carihuairazo herüberwogend, den Vorhang wieder zu, und wir eilten unsern Leuten nach, die inzwischen mit den Zeltballen, Blechkoffern und Kasten bergab gerannt waren, wo an dem[62] früheren Wechselplatz (4920 Meter) die Arrieros mit den Maultieren uns erwarteten.
In Cunucyacu gab es bis in die Nacht hinein viel Arbeit mit dem Verpacken der Sammlungen, Neuordnung der Lasten, Revision der Instrumente usw. Aber am nächsten Morgen war die Karawane schon wieder fix und fertig auf den Beinen, um der Nordseite des Chimborazo einen Besuch abzustatten, wo der Reiß- und der Sprucegletscher schon längst aus der Ferne mein Interesse erregt hatten. Unser Führer war wieder der junge Indianer Nicolas.
Das Wetter war nebelig und regnerisch. Je näher wir dem Carihuairazo und der Gegend des ob seiner Stürme berüchtigten Abraspungopasses kamen, desto kälter sauste uns wieder der Wind von Osten entgegen. Schweigend und bis über die Ohren in die Regenponchos eingehüllt, ritten wir einer hinter dem andern auf dem kaum fußbreiten, tief ausgetretenen Pfad durch den triefnassen Graspáramo hinan.
Bei einigen am sumpfigen Weiher Pailacocha liegenden Grashütten, die mit 4266 Meter Höhe die höchstgelegene Ansiedlung (Hato) am ganzen Chimborazo darstellen, ließ ich die Karawane mit den Arrieros zurück, ordnete das Aufschlagen der Zelte an und ritt, da es noch ziemlich früh am Tag war, mit Herrn Reschreiter und dem Indianer Nicolas zum Nordhang des Chimborazo fort, wo uns der Reißgletscher entgegenleuchtete. Gleich hinter unserm Lagerrücken geht es leicht hinab in ein weites, wannenförmiges, grasiges Tal, das Pailacuchu, das zum Berg hin in ein mehr steiniges, flachsohliges Tal mit amphitheatralischem Talschluß[63] übergeht, das Sancharumi. Runde, flache Hügel und lange niedrige Bodenwellen, großenteils mit Azorellapolstern bewachsen, aber an vielen Stellen auch den nackten, typischen Moränenschutt darunter hervortreten lassend, ziehen über den Talgrund hin; lange und kurze Wälle von Schutt liegen an und auf den felsigen Seitenrücken des Tals, die es von den Nachbartälern trennen, und an den Felsen der östlichen Tallehne bei 4496 Meter entdeckte ich bald eine vom Gletscher abgeschliffene und geschrammte Wand. Das ganze Tal, das eine mittlere Höhe von 4300 Meter hat, ist ein altes Gletscherbett; es zieht sich nordostwärts in der Richtung zum Abraspungopaß hin und hat einst seinen eisigen Inhalt allem Anschein nach dem großen Gletscher zugeführt, der zwischen Chimborazo und Carihuairazo nach Osten hinabfloß. Im Hintergrund dieses Sancharumi-Tales ragt die Zungenspitze des Sprucegletschers herein.
Zum Sprucegletscher ging aber nicht mein Weg, sondern in das höhere, westlichere Nachbartal hinauf, in dessen Talschluß der breite, steile Reißgletscher seine beiden Zungen hineinstreckt. Er nährt sich teils von den Firnmassen des Norddoms, zum kleinern Teil vom Westgipfel, dessen Firnpanzer 1000 Meter über dem Gletscherende am Oberrand der nördlichen Felswände abbricht und die abgebrochenen hausgroßen Blöcke in einem einzigen Sprung auf die Gletscherzunge hinunterstürzen läßt, wo sie, in Millionen von Splittern zerberstend, die Gletschermasse vermehren.
Wir reiten über enorme alte Moränenmassen, die das Reißtal zum größten Teil erfüllen, dem Gletscher entgegen. Die farbenreiche, reizvolle Flora der obersten alpinen Zone, die uns so oft schon entzückt hat, begleitet uns auch hier[64] bis zu etwa 4800 Meter hinauf, wo die jungen Moränen beginnen. Auch hier schwirren blitzende Kolibris um die honigreichen Chuquiraguasträucher und »stehen« mit vibrierenden Flügeln vor den Blüten in der Luft wie Nachtfalter. Kaum 100 Meter über uns ziehen zwei Kondore ihre großen Spiralen und spähen nach einem gefallenen Stück Vieh oder nach einem achtlosen Andenhasen. Ein kleiner Bach, Tarugayacu, fließt von der Stirn des Reißgletschers ab; alles übrige Schmelzwasser, soweit es nicht schon auf dem Gletscher verdunstet, versickert schnell im Moränenschutt und kommt erst 600 bis 800 Meter tiefer auf festem Gestein wieder zum Vorschein.

Während hier Herr Reschreiter zurückblieb, um trotz der Regenschauer und der Schneewirbel ein Temperabild des Gletschertals und der Eiszunge zu malen, kletterte ich mit dem immer bereiten Indianer Nicolas über die verwünscht rutschigen, jungen Moränenhügel und -halden noch über 300 Meter hinauf zum Gletscher selbst. An der Gletscherstirn (5101 Meter) kommt der Abflußbach nicht aus einem Gletschertor hervor, sondern in mehreren kleinen Wasserfäden aus verschiedenen Teilen des der Grundmoräne aufliegenden Eisbodens. Sein Wasser ist von der Grundmoräne der rotbraunen Laven rötlich gefärbt, weshalb er Pucayacu (Rotwasser) genannt wird. Rotbraun ist auch die ganze Stirn der Gletscherzunge bis zu 100 Meter höher hinauf vom auflagernden Moränenschutt. Diese satten Farbentöne vereinen sich mit dem Silbergrau des Gletschereises, dem reinen Weiß der Firnhänge, dem tiefen Blau des Hochgebirgshimmels und dem millionenfachen Flor der kleinen Gebirgsblumen zu einem wundervollen Bild andiner Symphonie und Harmonie.

Nach stundenlangem Zeichnen, Malen, Messen, Photographieren, Sammeln kamen wir bei Sonnenuntergang totmüde ins Lager zurück und merkten in unserm festen, kleinen Zelt und in den warmen Schlafsäcken nicht, daß es in der Nacht stürmte, regnete, hagelte, schneite, bis die Morgensonne dem Aufruhr ein Ende machte. Bei schönster Beleuchtung konnte ich den jetzt absolut wolkenlosen nördlichen Chimborazo ein halbes dutzendmal photographieren und vieles sehen und messen, was am Tag vorher unsichtbar gewesen war. Auch der Carihuairazo (5106 Meter) stand einige Minuten ganz frei vor uns und überraschte mich vor allem durch die außerordentlich große Ausdehnung des Firnmantels seiner Südwestseite.
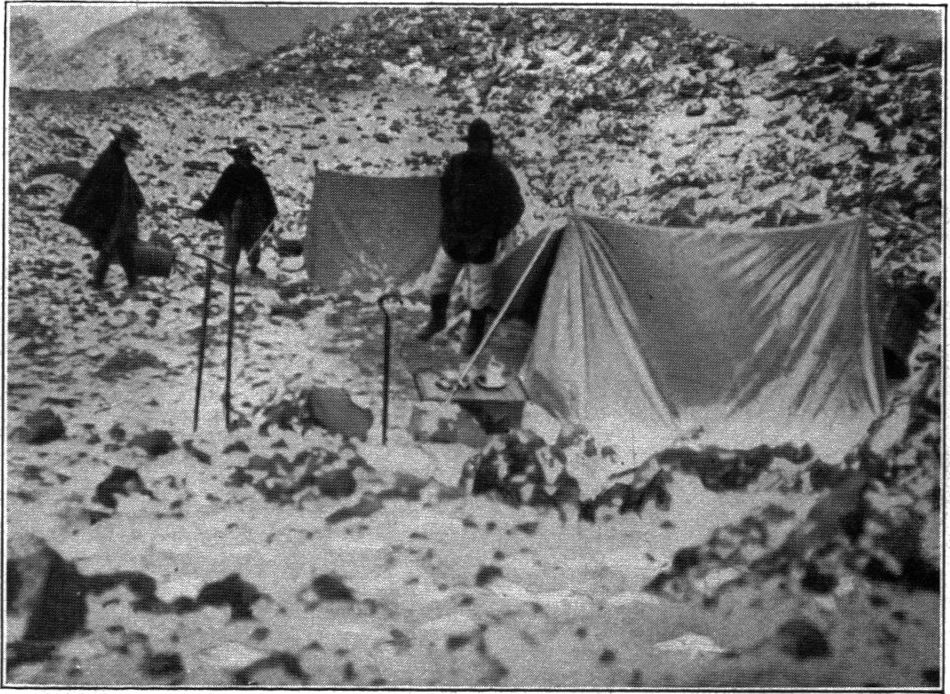
Als wir zum Abraspungo aufbrachen, um über den Paß und durch das Abras-Tal nach dem Städtchen Mocha am Ostfuß des Carihuairazo zu gelangen, rüstete sich der Wetterhimmel bereits, uns auf der Paßhöhe würdig und landesüblich zu empfangen. Über den obern Chimborazo legte sich wieder eiligst von Osten her die bekannte weiße Sturmwolkenhaube. Auch vom Carihuairazo kamen die dicken Nebel wie Sturzbäche herüber- und heruntergeströmt, und bald brausten die kalten Ostwinde mit Nebel, Regen und Schnee über den Paß und über uns selbst, daß uns Hören und Sehen verging. Den ganzen Tag kämpften wir dem Hundewetter entgegen, bis wir aus dem Abras-Tal in die Páramos der Ostseite hinabkamen; ein böses Stück Arbeit für uns und ein noch böseres für unsere Tiere.
Der Abstieg durch das Abras-Tal nach Osten ist viel steiler als der Anstieg auf der Westseite zum Abraspungo-Paß. Ohne den ortskundigen Indianer Nicolas wäre uns ein Durchkommen ganz unmöglich gewesen.
[66]
Eine Zeitlang führte unser Pfad auf offenbaren Moränenhügeln jüngern Alters entlang, und wo er an anstehendem Gestein vorbeiging, waren die Felsen gletschergeschliffene Rundhöcker; aber das unsichtige Regen- und Nebelwetter verbot jeden Einblick in die weitere Umgebung. Und bald verlangte auch der Weg selbst – wenn man diesen von braunen Regenbächen durchrauschten, steilen, steinigen oder lehmigen Graben, in dem wir ritten oder zu Fuß fortstampften, einen Weg nennen will – unsere ganze Aufmerksamkeit. Alle Augenblicke rutschten die Tiere auf den glitschnassen, lehmbedeckten Steinblöcken aus und setzten sich mit der Hinterhand ins Wasser, oder sie sanken bis an den Bauch in den zähen Morast und blieben stecken, bis wir ihnen zu viert mit Ziehen, Schieben und notgedrungen unbarmherzigen Hieben heraushalfen. An Reiten war da nicht mehr zu denken, und unser Aussehen spottete bald aller Beschreibung. Die Arrieros mit den Lasttieren blieben immer weiter hinter uns zurück.
Nach Überwindung einer unter solchen Umständen lebensgefährlichen Steilstufe betraten wir endlich bei 4160 Meter festen grünen Talboden und kamen, nun wieder im Sattel, rascher vorwärts. Auch die Regen- und Nebelschleier wurden lichter; bald erschien freundlichere Vegetation, vereinzelte niedrige, mit Bartflechten behangene Bäume und Sträucher von Berberitzen und Fuchsien, die jetzt sämtlich Blüten trugen. Trotz der alpinen Zwerghaftigkeit wachsen die Pflanzen hier auf der immer feuchten östlichen Passatseite doch viel üppiger als drüben auf der westlichen Leeseite des Berges. Mehrere Wildbäche brausen von links (Carihuairazo) und rechts (Chimborazo) dem Abrasbach zu, der allmählich zu einem »Rio« anschwillt. Sie kommen in Wasserfällen über die[67] steilen Seitenwände des Tals herab, das die typische Trogform eines übertieften alten Gletscherbettes hat.
Da uns nun unser Weg gewiesen war, nahm unser Führer Nicolas Abschied, um sofort wieder über den stürmischen Paß allein mit seinem Pferdchen nach Cunucyacu zurückzukehren. Ich lohnte dem braven Burschen seine guten Dienste und versprach ihm baldige Wiederkehr, die denn auch einige Wochen später erfolgte. Bei 3930 Meter verließen wir das sich plötzlich zur Schlucht verengende Bachtal und traten auf die weiten welligen Graspáramos hinaus, die langsam zur Hochebene von Riobamba absinken. Bald erreichten wir, nun wieder an Schaf- und Rinderherden vorbeireitend, die große nach Quito führende Landstraße (Camino real), auf der es in langsamem Trab zwischen den Bergen Carihuairazo und Igualata hindurch ins Tal des Rio de Mocha hinüberging. In tiefer Dunkelheit langten wir endlich in dem auf steiler Hügelhöhe gelegenen Städtchen Mocha (3300 Meter) an. Es war der Ausgangspunkt von Touren auf den Carihuairazo und in nördlichere Bergregionen.
Sieben Wochen waren seit unserer ersten Chimborazotour verstrichen. Sie hatten uns in die Ostkordillere zum Cerro Altar (s. S. 83), dann das interandine Längstal entlang nach Latacunga, hinauf zum Cotopaxi (s. S. 128) und an den abseits stehenden, schwer zugänglichen Quilindaña geführt. Dann waren wir längs der Hochlandstraße an den Vulkanen des mittlern Ecuador, dem Iliniza, Corazon und Rumiñagui vorbei nach der Landeshauptstadt Quito geritten, hatten über die interandine Mulde von Quito quer hinweg einen Abstecher zum Antisana auf der Ostkordillere gemacht (s. S. 104) und waren[68] schließlich nach Riobamba zurückgekehrt. Nun brachen wir von hier aus am 7. August zum zweiten Male zum Chimborazo auf.
Die gute Jahreszeit war dicht vor ihrem Ende, die Monate der alltäglichen Gewitterstürme standen vor der Tür, und der Wetterhimmel machte bereits ein finsteres Gesicht. Die Riobambeños meinten, es sei nun in den »Cerros« nichts mehr zu machen und wir sollten uns die Mühe sparen; aber ich wollte es auf einen Versuch ankommen lassen, da sich meine Reise dem Ende näherte. Meine kleine Karawane, Menschen und Tiere, war jetzt auf meine Reisezwecke und Anforderungen so gut eingearbeitet, daß es jammerschade gewesen wäre, wenn ich mit ihr die letzte Gelegenheit, vor unserm Abschied aus Ecuador noch einmal die Chimborazogletscher zu besteigen und die Chimborazofirne zu untersuchen, nicht voll ausgenutzt hätte.
Unter zweifelnden Glückwünschen der Riobambeños ritten wir um 10 Uhr morgens aus der Stadt, direkt nach der Südseite zum Tambo Totorillas. Vor 5 Uhr sattelten wir unsere Mulas bei der Totorillashütte (3979 Meter) ab. Der dicke Nebel ließ uns nichts anderes vornehmen als in der nächsten Nachbarschaft botanisieren und im Bett des Totorillasbaches Steine sammeln, die hier von den drei Hochtälern des südwestlichen Chimborazo zusammengeschwemmt liegen. Am Abend brach doch noch der Mond durch das finstere Gewölk und ließ da und dort ein Stück der beiden Hauptgipfel des Chimborazo in wundersamem Silberglanz hervorschimmern. Das bleiche Licht und die schwarzen Schatten übertrieben alle Höhen und Tiefen ins Fabelhafte und verliehen dem Berg einen Zug von Wildheit und sozusagen arktischer Schrecklichkeit, den er bei Tageslicht nicht hat.
[69]
Unter dem Einfluß des Mondlichts entpuppte sich mein einer Arriero Spiridion, dem ich bisher nicht die mindeste Sentimentalität angemerkt hatte, plötzlich als ein höchst gefühlvoller Gitarrespieler und guter Sänger. Auf meine Frage, warum er seine Künste nicht schon früher gezeigt habe, antwortete er lachend: »Solange du am Tage arbeitest, Padrón, will ich dich nicht stören oder habe ebenfalls zu arbeiten; und wenn du am Abend aufhörst, bin ich so müde, daß ich nicht mehr an Musik denke.« Schade um das wochenlange vergebliche Mitführen des Saitenspiels. Übrigens war der Mann, wie schon erwähnt, ein Kolumbianer; bei Ecuatorianern findet man solche brotlosen Künste wie Hausmusik nur ganz ausnahmsweise.
Weniger stimmungsvoll als der Abend war unser nächtliches Lager. Um den blutdürstigen Flohlegionen im Innern der Hütte zu entgehen, legten wir uns, da es ziemlich windstill war, unter das Vordach des Tambo, anstatt unser Zelt weiter draußen aufzuschlagen. Aber in 4000 Meter Höhe soll auch ein wetterharter Hochgebirgsreisender vorsichtig sein. Bald sprang eine kalte Brise auf und wehte uns direkt die greulichen Miasmen eines nahe beim Tambo liegenden Pferdekadavers zu, den, wie ich am Nachmittag gesehen, die Hunde schon zur Hälfte aufgefressen hatten. Auch in der Nacht waren sie bei der eklen Arbeit und knurrten einander ohne Unterlaß um die besten Bissen an. Ich retirierte mit meinem Schlafsack in einen andern Winkel, geriet aber in Haufen feuchter Kuhfladen, die hier als Brennmaterial gesammelt und getrocknet werden. So wurde die Nachtstimmung zwischen Kuhmist, Aasgestank, Schweinegrunzen, Feuerknistern, Bachrauschen, Gitarreklimpern, Lawinendonner, Windsausen und Mondschein eine wunderliche[70] Mischung von Beethoven, Lenau und Zola. Leider gewannen allmählich die häßlichen Bestandteile das Übergewicht. Als ich beim Hähnekrähen erwachte, war mir übel und weh zumute von all der Pestilenz, und der kalte Wind hatte mir einen bellenden Husten beschert, den ich wochenlang nicht wieder loswurde.
Bei Sonnenaufgang weiterreitend, fanden wir auf dem Arenal grande Schnee in reichlicher Menge liegen. Mitte Juni war davon nichts zu sehen gewesen. Damals schmückten viele Tausende weitverstreuter kleiner Blumen die grauen Bimssteinflächen mit der Anmut des jungen, farbenfrohen Frühlings. Aber die Herrlichkeit war kurz; jetzt waren die zarten Kinder Floras verblüht, und es herrschte wieder für die übrigen elf Monate des Jahres die tiefernste, dem Leben feindliche Starrheit der alpinen Wüste. Dieses schnelle Aufflackern des Frühlings, unter dem sich der Charakter der Landschaft für kurze Zeit total verändert, ist in den äquatorialen Hochanden eine Eigentümlichkeit der obersten Region der Blütenpflanzen. In der nächsttiefern Region, in den Graspáramos, merkt man davon nichts. Der Páramo bleibt immer »Pajonal« (paja = Stroh), in dem die Mehrzahl der Halme und Rispen verdorrt ist; er prangt nie in frischem Grün, und die angebliche »Primavera eterna« dieser Zonen ist mit gleichem Recht ein ewiger Sommer oder ewiger Herbst zu nennen. »Ewig« ist nur die Monotonie der Erscheinung in diesen Graspáramos.
Nach Nordwesten hin nahm der Schnee schnell wieder ab, und bei der Hacienda Cunucyacu sah alles genau so aus wie Mitte Juni. Nur hatte der Schnapsteufel von den Bewohnern Besitz ergriffen. Ein Besucher hatte nach Landesbrauch einen tüchtigen Vorrat Mallorca-Branntwein mitgebracht[71] und die ganze Familie so gründlich alkoholisiert, daß nichts mit ihnen anzufangen war. Erst nach zwölf Stunden bekam ich den Hausherrn so weit, daß er in der elegischen Stimmung eines ungeheueren Katzenjammers meine Wünsche nach Trägern und Proviant erfüllte.
Am 9. August vollführten wir von Cunucyacu unsern Aufritt und Aufstieg zu unserm alten Zeltplatz über der Vegetationsgrenze in 5145 Meter Höhe. Allerwärts waren noch Spuren unseres ersten Aufenthalts zu erkennen. Bald waren wir wieder mit den beiden Eingebornen von damals in unseren beiden Zeltchen installiert.
Im Lauf des Nachmittags hatte ich wohl ein dutzendmal den Donner der Eislawinen gehört, die von den Abbruchwänden des Firnrandes in die tiefen Talrunsen der Nordseite des Berges stürzten. Gegen Abend wurde es mit dem Sinken der Temperatur unter 0° still in den Eisregionen, aber um unser Lager pfiff der kalte östliche Nebelwind und bombardierte das Zelt mit körnigem Schnee. Wenn draußen ein Unbeteiligter die beiden stummen kleinen Zelte im stürmischen Schneewehen der über 5000 Meter hohen Gebirgswüste hätte liegen sehen, er hätte sie für verlassen halten müssen. Wenn er aber durch die Türklappe gelugt hätte, hätte er in unserm Zelt ein eigenartiges Stilleben entdeckt. In der Mitte ein länglicher niedriger Stahlblechkoffer, und rechts und links davon, in den Schlafsäcken halb vergraben, zwei hockende Europäer in Wolljacken und Wollmützen, die beim trüben Schein einer alpinen Kerzenlaterne Notizen schrieben, ihre zerrissenen Hosen flickten, Tabak rauchten und über die Aussichten des kommenden Tages plauderten. In allen Ecken des Zeltes alpines Gerät, Kleidungsstücke, Proviantbüchsen und dergleichen: das Ganze[72] die primitivste, engste, einsamste Heimstätte europäischer Kulturmenschen, die in eine große lebensfeindliche Natur für kurze Zeit hineingezaubert ist; und gerade im Gegensatz zu dieser starren Natur gibt uns das kleine Heim ein so freundliches Gefühl von Gemütlichkeit und Sicherheit, daß ich es dem vielseitigen Reiz eines opulenten Zeltlagers in der weiten, freien, afrikanischen Steppe für kurze Zeit mindestens gleichschätze.
Im hellen Mondenschein ging es um 5 Uhr früh bei 5° Kälte fort. Im Osten dämmerte es schon leise. Der obere Chimborazo lag frei im fahlen ersten Frühlicht, finstere Schatten zu uns her ausstreckend, aber auf dem ganzen Unterland lag ein graues, welliges Wolkenmeer, das sich langsam zu heben schien. Da der Wind eingelullt war und der Nachtfrost den Schutt auf unserm alten nordnordwestlichen Aufstieggrat gefestigt hatte, kamen wir schnell vorwärts.
Nach Sonnenaufgang kam schnell Bewegung in die Luft, und bald wehte der Ostwind mit immer dichter werdenden Nebeln über die Firnfelder der Gipfelregion. Gegen 8 Uhr standen wir unter den »Roten Wänden« (5715 Meter) am Unterrand der Firnhaube des Westgipfels. Das dicke Firnpolster, das noch sieben Wochen vorher auf der Oberkante der Felswand gelegen hatte, war jetzt weggeschmolzen, aber die Felsen waren dadurch nicht zugänglicher geworden. Wir mußten sie wie damals westwärts umgehen, um auf den Firnhang selbst zu kommen. Da hier aber unsere beiden Begleiter streikten, gab ich ihnen den Laufpaß. Geschwind trollten sie sich zum Lager hinunter.
8 Uhr 20 ging es mit den Steigeisen los. Wir überschritten den Ostteil des Stübelgletschers, dessen Eis hier zum großen Teil von einer ¼ bis ½ Meter dicken Decke[73] rötlichen, von den Felswänden herabgefallenen Schuttes überzogen war, und standen, als wir die Felswände unter uns hatten, vor der seltsamsten Schnee- und Eislandschaft, die ich je gesehen. Da es in dieser Zeit in den obersten Regionen offenbar keinen gründlichen Neuschnee mehr gegeben hatte, hatten Sonne und Wind einen wahren Vernichtungskrieg unbehindert führen können. Die vordem so gut begehbaren, wellig angeschmolzenen Firnhänge waren bis zum Gipfel hinauf in einen furchtbaren Stachelpanzer verwandelt, der dem andringenden Bergsteiger die stärkste Gegenwehr leistete. Die Oberfläche des Gletschers, soweit sie aus Firn bestand, und des ganzen Gipfelfirns starrten von eisigen Zacken, Schneiden, Säulen, Tafeln und Klippen, die, ½ bis 1½ Meter hoch, zu Millionen nebeneinanderstanden, und zwar so dicht, daß man sich oft nur mit großer Mühe dazwischen durchzwängen konnte. Sie sind alle in mehr oder minder deutliche ostwestliche Reihen angeordnet, haben am Fuß eine Dicke von 10 bis 30 Zentimeter, verjüngen sich nach oben und sind an der Spitze von einem wahren Filigran dünn geschmolzenen Eises gekrönt, das unserer Phantasie alle nur denkbaren Figuren und Gestalten vorgaukelt. Wir haben das typische Bild des »Nieve penitente«, des »Büßerschnees« oder »Zackenfirns« vor uns, wie er zuerst von den südlicheren und dann auch von den nördlicheren Kordilleren Amerikas bekanntgeworden ist und wie ich ihn auch am obern Kilimandjaro neben eisigen Karrenbildungen angetroffen hatte.
Der Eindruck dieser Penitenteslandschaft war um so ernster, als ihr jetzt die Sonne fehlte, die fahl durch die hoch ziehenden Nebel schimmerte. Man begreift die Entstehung des Namens »Büßerschnee«. Einer unabsehbaren[74] Schar grauer Mönchsgestalten vergleichbar, stehen die Eisfiguren da, eine so phantastisch wie die andere und alle in langen parallelen Reihen aneinandergeschart wie in tausendköpfigen Prozessionen. An anderen Stellen dagegen glaubt man ein großes Ruinenfeld zerstörter alter Städte vor sich zu sehen, von denen nur die Mauerstümpfe in gleichmäßiger Höhe stehengeblieben sind, oder einen ungeheuern Friedhof voll halbverfallener Grabsteine. Und wieder an anderen Stellen sehen die zerfurchten und zerzackten Firnfelder in der perspektivischen Verkürzung aus wie schäumende Wellenzüge, die in wilder Bewegung plötzlich erstarrt sind.
In Anbetracht dieser Firnbeschaffenheit war es einerlei, wo wir den Einstieg begannen. Ohne auf unserer frühern Route weiter nach Westen abzuschwenken, hielten wir uns direkt auf den westlichen Gipfeldom zu. Der Aufstieg ist aber hier so steil, daß ein Fortkommen ohne Steigeisen absolut unmöglich ist, wenn man nicht stundenlang Stufen schlagen will. Jeden Schritt und Tritt mußten wir uns zwischen den bis an den Unterleib oder die Brust reichenden Firnzacken und Eistafeln suchen, was uns außerordentlich viel Zeit kostete. Etwas besser wurde es, als wir auf eine trümmerbedeckte felsige Strecke kamen, die aus dem Firnmantel ausgeschmolzen war. An ihre obere Kante vortretend, gewahrte ich unter mir die kolossalen Felsabstürze, die wir von tief unten östlich über unserm Aufstiegsgrat thronen und drohen gesehen hatten; und neben uns in erdrückender Nähe und Größe brachen die Massen des Gipfelfirns zu jenen Felsabhängen hin in 60 bis 80 Meter hohen prachtvollen, gleichmäßig gebänderten und durchschichteten Eiswänden senkrecht ab, überzogen von 20 bis 30 Meter langen baumdicken Eiszapfen oder gefrorenen Wasserfällen. Durch[75] Spalten hatten sich Blöcke von Hausgröße schon teilweise von der Gesamtmasse losgelöst und drohten jeden Augenblick 600 bis 1000 Meter tief in die Abgründe des Tales Pucahuaico zu stürzen, wo sie sich, wie wir unten sahen, zu einem regenerierten Gletscher vereinigen, der fast ganz unter Schutt begraben liegt.
Um 10 Uhr waren wir am Westende dieser Eiswände angelangt (5986 Meter). Immer steiler hebt sich nun der Firnhang, immer tiefer zerschnitten und zersägt wird seine Oberfläche, immer höher und dichter das Gewirr der Penitentes. Langsam und mit häufigen Unterbrechungen arbeiten wir uns aufwärts. Die Lungen pfeifen, der Atem röchelt, die Schleimhäute sind trocken und hart wie Leder. Plötzlich erscheint über uns eine mächtige Querspalte, die mit 5 bis 15 Meter Breite wie ein Festungsgraben den Westgipfel auf der Nord- und Nordwestseite umringt und gleich einer Randkluft mit einer 2 bis 3 Meter hohen Stufe absetzt. Es ist dieselbe, die uns vor sieben Wochen weiter westlich Halt geboten hatte. Sie ist zwar hier von mehreren Firnwällen überbrückt, aber auch diese Brücken sind so stark zerfressen, durchlöchert und von Penitentes verbarrikadiert, daß ein Weiterdringen schlechterdings undenkbar ist; es sei denn, man könnte fliegen. So blieb uns nichts anderes übrig, als hier in 6180 Meter Höhe auf die uns noch vom Scheitel des Gipfels trennenden 90 Meter zu verzichten und uns mit dem zu begnügen, was wir in diesen obersten Regionen an sonderbaren Erscheinungen der Firn- und Eiswelt zu sehen und zu untersuchen hatten. Wäre der Firn so beschaffen gewesen wie sieben Wochen vorher, wir hätten vermittelst der Schneebrücken ohne große Schwierigkeit den Gipfel erreichen können, denn es war erst wenig über[76] 11 Uhr, und wir waren beide noch bei guten Kräften. Für meine Firn- und Eisstudien war die jetzige Jahreszeit die allergünstigste, aber für eine Gipfelbesteigung ist der August zu spät, da die Zerstörung der Eisoberflächen durch die Sonne zu weit fortgeschritten ist.
Kaum hatten wir dem Gipfel den Rücken gewandt, als die Nebelschwaden, die uns bisher vereinzelt von Osten herab umflattert hatten, in dichten Haufen aus Westen von unten her auf uns eindrangen und uns mit einem so stürmischen Schnee- und Graupelwetter überfielen, daß wir bald keine drei Schritt weit sehen konnten. Wie die Spürhunde hatten wir die Nase am Boden, um in dem Labyrinth der Penitentes die Schuh- und Eispickeleindrücke unseres Aufstiegs nicht zu verlieren. So kamen wir gegen 1 Uhr wieder am Westfuß der »Roten Wände« an, und anderthalb Stunden später waren wir, Kleider und Bart noch von Eiskrusten und Eiszapfen überzogen, zurück am Zeltlager bei unseren beiden Kameraden.
Im warmen Schlafsack fühlten wir nicht, daß uns die Nacht bei steifem Ostwind ein Minimum von –9,6° bescherte, die tiefste Temperatur, die wir in Ecuador erlebt haben. An den Innenseiten unseres Zeltes hatte sich am Morgen infolge unserer Atmung eine fingerdicke Reifschicht angesetzt, die uns durch ihr prächtiges Glitzern und Funkeln viel, durch ihr Auftauen aber wenig Freude machte, und unsere Stiefel waren hart gefroren wie Bretter. Draußen stürmte es aus Osten wie nie zuvor. Wäre am Tag vorher solches Wetter gewesen, wir hätten von jedem Besteigungsversuch abstehen müssen. Unter solchen Umständen sieht sich die Poesie des alpinen Lagerlebens anders an als bei heißem Tee im warmen Pelzsack. Und so betrüblich uns beiden auch bei dem Gedanken zumute war, daß dies unser letztes[77] Lager in den Anden sei, daß damit die schöne reiche Zeit des Ringens und Gewinnens in dieser großen Gebirgswelt vorüber sei, so angenehm war uns doch auch die Vorstellung, daß uns nun bald wieder ein anderes Leben blühe als wochenlange physisch und psychisch aufreibende Arbeit, schlechte Ernährung, schlechter Schlaf, immer froststeife Finger, Mangel an Waschwasser, Anfälle von Soroche und dergleichen mehr.
Forschungsreisen im Hochgebirge werden vom Publikum der Laien und vieler Geographen, die dann die Resultate vor sich haben, gemeinhin nicht anders eingeschätzt als Reisen im Mittelgebirge oder im Flachland. Ja, man ist im Publikum leicht geneigt, in der sportlichen Seite, ohne die es kein erfolgreiches Reisen im Hochgebirge geben kann, das Wesentliche bei solchen Reisen zu sehen und das für den Zweck zu halten, was nur das Mittel zum Zweck wissenschaftlicher Gebirgsforschung ist. Nur wer sich selbst mit Ernst der Hochgebirgsforschung gewidmet hat, weiß, ein wieviel größerer Einsatz und Aufwand von Kräften und Energie erforderlich ist, um eine wissenschaftliche Hochgebirgsreise erfolgreich zu machen, als eine die gleiche Summe von Beobachtungen und neuer Erkenntnis einbringende Reise im Mittelgebirge oder Flachland. Ich begreife es sehr wohl und finde es entschuldbar, wenn in so vielen Fällen die wissenschaftlichen Resultate von Hochgebirgsreisen in gar keinem Verhältnis stehen zu den darauf verwandten Summen von Zeit, Kraft und materiellen Mitteln. Eine Forschungsexpedition in den afrikanischen Steppen und Wäldern, so mühsam sie im einzelnen oft sein mag, ist, wie ich aus langer Erfahrung weiß, meist ein Kinderspiel gegenüber einer die Lösung wissenschaftlicher Probleme erstrebenden[78] Hochgebirgsreise, insbesondere einer Hochgebirgsreise in der Tropenzone, wo die Schwierigkeiten in jeder Hinsicht noch viel größer sind als in den allermeisten Hochgebirgen außertropischer Gebiete.
Gegen Mittag endlich erschienen unsere Peones im Lager, pfeifend vor Anstrengung und Unbehagen, wie die Hochlandindianer dann immer zu tun pflegen. Schnell war alles Bewegliche zusammengepackt und aufgeladen, worauf die Kerle, um der ungemütlichen Höhe zu entgehen, einen so ununterbrochenen Dauerlauf bergab über Schnee und Geröll und Felsen ausführten, daß wir, nachdem wir weiter unten die uns entgegenkommenden Maultiere bestiegen hatten, schon um 4 Uhr wieder in der windgeschützten Mulde von Cunucyacu anlangten. Der biedere Mayordomo gab seiner Freude, uns gesund wiederzusehen, dadurch Ausdruck, daß er ein Kalb schlachten ließ; ein unerhörter Luxus, den wir im rinderreichen Ecuador noch nicht erlebt hatten. Leider nahm mein von den strapaziösen Hochtouren geschwächter Magen diese Extravaganz übel, und in der Nacht kam zu allem Überfluß noch eine stundenlange Belästigung durch Soroche hinzu. Auch Herr Reschreiter hatte mit Atembeschwerden, Kopf- und Kreuzschmerzen zu tun.
Über den Soroche, die Bergkrankheit Ecuadors, mögen hier ein paar Worte eingeschaltet werden. Er befällt früher oder später jeden, der die Anden aufsucht. Seine Symptome treten verschieden auf, vom leichten Kopfweh bis zur schweren Störung aller Körper- und Geistesfunktionen, aber zur ernsten Erkrankung oder gar zum Tode wird es beim normalen Menschen kaum kommen. In Höhen von über 5000 Meter freilich erfordert die Überwindung seiner Beschwerden ein beträchtliches Maß von Energie. Die Atemnot wird besonders bei[79] anstrengendem Aufstieg immer größer, der Kopf immer dumpfer, die Beine werden immer schwerer. Da man stets mit offenem Munde atmen muß, um den Hunger nach Luft zu stillen, deren Sauerstoffgehalt in 5000 Meter nur etwa halb so groß ist wie in Meereshöhe, so dörrt der Hals in der außerordentlich trockenen Höhenluft total aus, jede Schluckbewegung schmerzt, und schließlich befällt den Bergsteiger ein heftiger, keuchhustenartiger Krampfhusten, der tagelang andauern kann und erst beim Absteigen wieder verschwindet. Nur ein möglichst gleichmäßiges und langsames Aufeinanderfolgen aller Körperbewegungen, möglichstes Vermeiden jedes plötzlichen Ruckes kann da Erleichterung bringen. Aufstiege auf steilem lockern Geröll oder auf Hängen von pulverigem Schnee mit dem unvermeidlichen Zurückrutschen werden deshalb ganz besonders zur Qual.
Die Mechanisierung aller Bewegungen und die Konzentration aller Kräfte des Organismus auf die rein körperliche Steigarbeit üben dabei eine betäubende Wirkung auf das Bewußtsein aus. Die Benommenheit des Kopfes trübt die Gedanken oder löst verworrene Vorstellungen aus, die ohne jede Beziehung zum augenblicklichen Tun sind. Ein kaum überwindliches Bedürfnis, sich niederzulegen und zu schlafen, stellt sich ein. Es bedarf des Aufwandes der letzten Energie, um der gemütlichen Depression nicht zu erliegen, den Überblick über die Situation sich zu wahren und das Ziel fest im Auge zu behalten. Im Lager über 5000 Meter leidet man darüber hinaus noch an lästigem Auftreiben des Leibes, an Aufstoßen der Magengase, an Appetitlosigkeit, Darmverstopfungen, Brustbeklemmungen, Herzklopfen und schweren Träumen während des Schlafs. Erbrechen, Nasenbluten oder gar Bluten aus dem Zahnfleisch und den Lippen,[80] wie es A. von Humboldt berichtet, habe ich dagegen niemals beobachtet, weder an mir noch an anderen.
Hauptursache dieser Erscheinungen ist zweifellos die ungenügende Zufuhr des für die Lebenstätigkeit notwendigen Sauerstoffs zum Nervensystem und zu den arbeitenden Organen. Sie erzwingt starke Atmungsbewegungen, die durch die Abnahme des Luftdrucks mit zunehmender Höhe noch weiter erschwert werden, und bewirkt Blutstauungen in den Lungen. Übermüdung durch allzu große Anstrengung mag ihr Teil mit beitragen, ist aber nicht ausschlaggebend. Es sind Erscheinungen, wie sie ähnlich auch bei Blutarmut zu beobachten sind. Wirksam werden sie vor allem in Funktionsstörungen des Nervensystems mit ihren psychischen Folgen. Nervenanregende Mittel wie Kola und Champagner sollen deshalb gute Wirkung haben, aber ich habe sie nicht ausprobiert. Der beste Schutz gegen den Soroche bleibt jedenfalls der eigene feste Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen. Planvolle Selbstzucht kann viel dazu tun.

Nach den Mühsalen unserer Chimborazobesteigung hätte ich gern einen Tag mehr in der Hacienda Cunucyacu Rast gehalten. Aber zum Ausruhen hatten wir keine Zeit mehr; die Tage bis zur Abfahrt nach Europa waren uns knapp zugemessen. Drum ging es schon am übernächsten Morgen wieder früh in den Sattel und bei immer noch stürmendem Ostwind auf dem Pfad, den wir schon Anfang Juni geritten waren, zum Paß Abraspungo zwischen Chimborazo und Carihuairazo hinan. Damals hatte uns der berüchtigte Abras-Paß mit so abscheulichem Wetter traktiert, daß wir von der uns umgebenden Landschaft sehr wenig zu sehen bekommen hatten. Diesmal sah es anfänglich dort oben nicht viel besser aus. Aber als wir die Paßhöhe betraten, lag zu unserer freudigen Überraschung das Abras-Tal mit seiner nächsten Gletscherumgebung ziemlich frei vor uns. Bei jedem Schritt fand ich vollauf meine im Juni aus wenigen Beobachtungen gewonnene Mutmaßung bestätigt, daß wir uns hier im Abras-Tal durch ein altes Gletscherbett von großartiger Ausbildung bewegten.

Jetzt sahen wir auch auf dem Oberrand der südlichen Talwände die Stirnen dreier vom Nord-Chimborazo her kommender Gletscher liegen. Der westlichere streckt seine hochumwallte Zunge in der Richtung zum Abraspungo hin aus; es ist der »Abraspungo-Gletscher«. Der östlichere, breitere und längere, hat noch vor relativ kurzer Zeit bis in den Taltrog hineingereicht, wie seine Endmoräne zeigt. Diese mächtige, jetzt bei 4400 Meter endende Eiszunge ist auf keiner Karte zu finden und bisher namenlos. Einer spontanen Regung folgend, rief darum vor diesem Eisstrom Herr Reschreiter aus: »Von nun an soll er Hans-Meyer-Gletscher heißen!« Bald darauf konnte ich mich revanchieren, indem ich seinen weiter östlichen Nachbar, der ebenfalls noch auf den Karten unbekannt und unbenannt war, »Reschreitergletscher« taufte.
Vom Carihuairazo her, dessen Gletscherzungen hier kaum mehr als 5 Kilometer von denen des Chimborazo entfernt sind, münden vom Abraspungo an in schneller Folge ebenfalls vier Seitentäler in das Abras-Tal, alle steil zu Eiszungen im Hintergrund ansteigend, mit schroffen Seitenwänden und flachem Boden, der großenteils von Moränen bedeckt ist. Das Abras-Tal war die gemeinsame Sammelrinne aller dieser Gletscher des Nordost-Chimborazo und Süd-Carihuairazo und muß einst von einem gewaltigen Eisstrom erfüllt gewesen sein. Auch die untrüglichen Merkmale einer zweimaligen[82] Vergletscherung waren im Abras-Tal zu erkennen, worauf aber hier nicht eingegangen werden soll.
Vom Ausgang der »Abras-Furche« ritten wir über die hügeligen grasigen Ausläufer des Ost-Chimborazo hinab, auf den Tambo Chuquipoquio zu, wo wir mit unseren müden Tieren zwei Stunden später anlangten. Der Hof war angefüllt von einer Horde angezechter Arrieros, die mit vielen Lasttieren und Haufen von Kisten und Säcken nach Quito unterwegs waren und, wie wir, hier nächtigen wollten. Zum letztenmal hantierte ich nun angesichts des Chimborazo mit meinen Meßinstrumenten, Herr Reschreiter mit Bleifeder und Skizzenbuch, zum letztenmal wurden für den nächsten Tag die Bergstiefel geschmiert, und dann ging es zum letztenmal hinein in den Schlafsack, der so hübsch dicht gegen die Widrigkeiten der Außenwelt abschließt.
Der nächste Vormittag führte uns dann in dreistündigem Ritt über die staubige, windige Tuffebene am Südostfuß des Chimborazo in das Städtchen Riobamba zurück, von dem unsere Hochtouren ausgegangen waren. Die Chimborazoreise war zu Ende.
[83]
Wenn wir aus der zirka 25 Kilometer breiten Hochmulde von Riobamba (2801 Meter) nach Norden schauen, haben wir zur Linken die Westkordillere mit dem gewaltigen Firndom des Chimborazo, gerade vor uns den breit hingelagerten, nur zeitweilig schneetragenden Vulkankegel Igualata (4452 Meter) und rechts von ihm den Einschnitt des Rio Chambo, durch den das Auge nach Nordosten bis zum trotzigen eisgekrönten Kegel des Tunguragua (5087 Meter) schweift. Also drei mächtige einzelne Vulkanberge, während hinter uns, im Süden, die langen dunkelbraunen Tuffrücken von Yaruquiés die Hochmulde absperren.
Ganz anders ist zu unserer Rechten die östliche Begrenzung der Riobamba-Ebene. Nur 5 Kilometer östlich von der Stadt zieht der Rio Chambo, der auch die Riobambamulde entwässert, seine tiefe Erosionsfurche nach Norden, und unmittelbar hinter dem Flußlauf, größtenteils sogar aus dem Flußbett heraus, hebt sich die langgezogene, altkristallinische Bergkette der Ostkordillere durchschnittlich 1000 Meter über die Ebene empor. Meist ist die Flußgrenze am Kordillerenfuß so scharf gezogen, daß die linke hohe Uferwand von den vulkanischen Gesteinen der Riobamba-Ebene, die rechte vom Glimmerschiefer der alten Ostkordillere[84] gebildet wird. Zahlreiche Seitentäler schneiden in diese östliche Gebirgskette hinein, da und dort tragen Gipfel und Grate ewigen Schnee, aber im ganzen ist dieses Stück der Ostkordillere eine höchst einförmige Gebirgsbildung, schön und groß nur durch das wunderbare Spiel ihrer Wolken, der Beleuchtung und durch die beiden auf ihr und über ihr am Himmel stehenden Erscheinungen: geradeaus im Osten die Felstürme und Firngrate des Cerro Altar (5404 Meter), und im Südosten die zu noch viel größerer Höhe aufsteigende, immer ihre Gestalt ändernde Eruptionswolke des hinter der Kordillere verborgenen Sangayvulkans. Hier im Sangay die lebendige Gegenwart, dort im Altar die tote Vergangenheit, die Ruine eines kolossalen Vulkanberges, dessen aufbauende und vernichtende Tätigkeit einst noch viel machtvoller gewesen sein muß als die des gegenwärtig Ecuador am meisten in Angst und Schrecken setzenden Sangay.
Auch der Cerro Altar sitzt, wie so viele der ecuatorianischen Vulkane, auf der aus kristallinischen Gesteinen erbauten Kordillere obenauf wie ein Reiter auf dem Pferd. Aber er hat die altkristalline Basis nur teilweise zugedeckt, so daß sie auf der interandinen Seite noch meilenweit offenliegt. Nach seinem Erlöschen ist der Vulkan während des Erkaltens durch Sackung seiner dem Krater benachbarten Mittelteile, später durch Verwitterung und durch Erosion der Gewässer und Gletscher bis auf den Rest der Kraterumwallung zerstört worden. Dieser Rest ist aber immer noch so gigantisch, daß seine Felszacken und Firngipfel in ihrer höchsten Spitze, dem »Obispo«, 5404 Meter hoch zum Himmel ragen und kreisförmig einen über 1000 Meter weiten Kessel umschließen, der, mit Schnee und Eis[85] halb angefüllt, einem mächtigen Gletscher Ursprung und Nahrung gibt.
Von Riobamba aus sieht man bei klarem Wetter den Cerro Altar wie eine breite, hell leuchtende Krone auf dem dunklen Scheitel der Ostkordillere ruhen und erkennt zwischen den beiden hohen Hauptzacken der westlichen Front den weiten, tiefen Einschnitt, hinter dem die Eismassen des Kraterkessels sichtbar werden. Ein wundervolles Bild, namentlich wenn nach Sturm und Wetter der dunkle Wolkenvorhang sich teilt und der Berg bis auf den Rücken der Ostkordillere herab im blinkenden Neuschnee dasteht. Schlechtes Wetter ist freilich dort die Regel, wie auf der ganzen Ostkordillere. Am besten soll noch der Oktober sein, also die Jahreszeit, die für die Westkordillere am ungünstigsten ist. Aber es blieb uns keine Wahl, und deshalb trafen wir es nicht gerade gut mit dem Altar, als wir ihm Anfang Juli unsern Besuch abstatteten.
Der beste Weg von Riobamba zum Altar führt am ersten Tag nordöstlich über die Riobamba-Ebene nach dem am Rio Chambo gelegenen Dorf Penipe, am zweiten Tag von Penipe in die Ostkordillere hinein und am Rio Collanes hinauf zur Hacienda Releche, und am dritten Tag von Releche steil hinauf in die Páramoregion bis zum Fuß des großen Altar-Kratereinschnittes im obersten Collanes-Tal. (S. Karte S. 130.)
Am 1. Juli ritten wir mit dem Mayordomo Santiago, den beiden auf der Chimborazotour bewährten Arrieros und acht ihrer Lasttiere (lauter Mulas) nach Nordosten ab. Nach fünf Stunden waren wir in Penipe. Die ganze Landschaft dahin, die östliche Riobamba-Ebene mit ihren Hügeln und Stufen und der Ostfuß des Igualata bis zum Chambofluß ist die gleiche sandige, staubige, windige, dunkelgraue Wüstensteppe[86] wie westwärts zum Chimborazo hin. Es geht auf schattenlosem Weg, auf dem die Tiere bis über die Hufe im Sand versinken, bergauf bergab meist zwischen Hecken von Agaven und graugrünen Kaktussäulen fort. Unter dem Sand liegen, wie am besten an den Wänden einiger vom Igualata kommender tiefeingeschnittener, trockener Wasserrisse, die wir durchreiten müssen, zu sehen ist, schlackige Lavaströme vereinzelter benachbarter Eruptionsstellen, zersprengte Lavabänke, grobe Konglomerate, Gerölle und Tuffe in mannigfaltigstem Wechsel.
Auf offenen Flächen ist der Sand und Staub zu langen Dünenzügen mit gerippelter Oberfläche zusammengeweht, die oft bis zu 2 Meter hoch werden. Wo aber der Staub an geschützten Stellen zur Rast kommt und von den nächsten Regengüssen festgemacht wird, bildet er einen dichten Löß, der oft vielfältig gebändert ist, allerlei vegetabile und andere Einschlüsse hat, und in mächtigen Schichten von den durch direkte Ablagerung vulkanischer Aschen entstehenden Tuffschichten kaum zu unterscheiden ist. In diesen verfestigten Löß- wie in den Tuffschichten fassen die Pflanzen am ersten wieder festen Fuß. Aber der Machthaber des andinen Klimas, der Wind, läßt ihnen nirgends dauernde Ruhe. Wenn er wieder zugepackt hat, nagt er ein Sand- oder Staubkorn nach dem andern los und entblößt allmählich den ganzen Wurzelstock der Pflanze, so daß sie vertrocknend abstirbt.
Regellos durch die Landschaft verstreut, meist mitten in ihren Feldern, stehen die Strohhütten der indianischen Bauern. Es sind pyramidenförmige Bauten aus den bis 10 Meter langen, armdicken Blütenstengeln der Agave, über die ein hohes, breitfirstiges Dach aus dem langhalmigen Sigsiggras (Arundo nitida) bis zum Erdboden herab gelegt[87] ist. Darin gibt es weder Fensteröffnung noch Rauchfang. Vorn ist durch einen Ausschnitt im Dach und einen kurzen vorspringenden Dachansatz eine kleine Vorhalle hergestellt, wo die Türe angebracht ist und am Tag die häuslichen Arbeiten verrichtet werden. Der Innenraum ist gewöhnlich durch eine Zwischenwand geteilt, auf deren einer Seite die Feuerstelle und Schlafstätte, auf der andern der Wirtschafts- und Vorratsraum, der Aufenthalt der Hunde und Hühner ist. Die Schlafstätte ist nur eine mit Schaffellen belegte Schütte dürren Grases, die Feuerstelle nur ein auf dem Erdboden liegender, mit ein paar Steinen umstellter Aschenhaufen, das Hausgerät nichts als einige Matten, ein paar unglasierte Töpfe, Kürbisschalen, ein Wasserkrug und eine Bank; nichts was einen Schritt über das Maß des Allernotwendigsten und Primitivsten hinausginge; nichts, was auch nur eine Spur von Schmuck und Zier an sich trüge.
Bei der Hütte treiben sich gewöhnlich ein paar schwarze Schweine oder einige Ziegen umher und fressen, was ihnen vors Maul kommt. Seltner sind schon Schafe und noch seltner Rinder, die hier im eng bemessenen Kulturland nicht frei umherlaufen dürfen, sondern neben der Hütte fest angepflöckt stehen und gefüttert werden. Einige Hühner fehlen fast nie und ebensowenig ein paar ruppige, windhundartige, kurzhaarige Köter, die jedem Fremden mit wütendem Gebell entgegenstürzen, aber niemals beißen. Sie müssen selbst zusehen, wo sie etwas zu fressen finden, denn gefüttert werden sie nicht. Sie sind deshalb erbärmlich ausgehungert und stehlen, was sie erwischen können. Ein ekles Gezücht, aber gute Wächter.
Die ganze Menagerie mit Ausnahme der Rinder wird nachts mit in die Hütte genommen. Und da diese nie[88] gereinigt wird und die darin hausenden Indianer sich ebensowenig waschen wie ihr Vieh, so wimmelt die dreckige Behausung und ihre Bewohnerschaft dermaßen von Flöhen und Läusen, daß man nach einmaliger Erfahrung lieber draußen in Wind und Wetter bleibt als drinnen am »traulichen Herd«. Solche Prachtexemplare von Flöhen, wie in den Indianerhütten Hochecuadors, habe ich selbst in den deshalb verschrienen italienischen Alpenhütten nicht gesehen. Den Wanzen dagegen scheint das Hochlandklima nicht zu bekommen. Ich machte nur ein einziges Mal intime Bekanntschaft mit ihnen. Um so besser gedeihen die Läuse. Überall sieht man Männer, Weiber und Kinder bei der gewohnten Beschäftigung des gegenseitigen Lausens, und wie in vielen anderen Ländern, so knackt auch hier der glückliche Finder die Tierchen mit den Zähnen tot.
Halbwegs zwischen Riobamba und Penipe durchreiten wir das tiefliegende breite Tal des vom Igualata kommenden Rio Guano; ein unpoetischer Name für ein Bergflüßchen, aber dem Äußern nach berechtigt, weil der Fluß an seinen Ufern hellgraue Kalksinterbänke abgesetzt hat, wie Guanodecken auf einer Vogelinsel. Der im übrigen zwischen engen, hohen Steilwänden forteilende Fluß erweitert an dieser Stelle sein Tal zu einer etwa 400 Meter breiten grüngrasigen Mulde, einer wahren Oase in der Wüste. Jenseits von ihr erreichten wir in einer Stunde die Paßhöhe am Südostfuß des Igualata und ritten steil auf miserablem Weg in das enge schluchtige Tal des Rio Chambo hinab, während westlich an den schroffen Wänden des Igualata mächtige Mauern von säulenförmig abgesonderten Lavabänken wie alte Festungsruinen zu uns herunterdrohten. Von der andern, östlichen Seite des Rio Chambo aber winkten[89] grüne Wiesen und gelbe Felder von den steilen unteren Hängen der Ostkordillere herüber, die nun als ein mächtiger, wolkenschwerer Wall sich vor uns ausstreckte, und unter uns auf einer Bodenterrasse am Fuß der Ostkordillere leuchteten über den Fluß her die weißgetünchten Häuschen von Penipe.
Am Chambofluß gab es für uns einen langen, lästigen Aufenthalt. Einige Dutzend Indianer von Penipe waren unter Aufsicht eines Beamten dabei, die uralte Hängebrücke auszubessern, die viele Stunden weit den einzigen Übergang über den Fluß bildet. In derselben Verfassung, in der sich dieses wunderliche Bauwerk heute befindet, hat es bereits Humboldt in seinem Atlas »Vues des Cordilleres« (freilich fälschlicherweise in einer prächtigen Palmenlandschaft) abgebildet. Das beweist, daß das Bauwerk haltbar ist trotz seines bedenklichen Aussehens. Es ist der Typus einer ecuatorianischen Hängebrücke: zwei armdicke Agavenbastseile sind etwa zwei Meter voneinander von einem Ufer zum andern gezogen. Auf jedem Ufer sind sie durch starke Holzböcke straff gespannt, so daß sie einige Meter über dem Wasser bleiben. An den Seilen hängen zahlreiche Baststricke, und diese tragen rohbehauene Bohlen, die außerdem noch auf einem Netzwerk von Stricken liegen. Über diesen schwebenden, schwankenden Knüppeldamm traversieren behutsam Menschen und Tiere; ein Fehltritt ist gefährlich, denn die dunklen Wasser des Chambo, der hier etwa 20 Meter breit ist, sind tief und reißend.
Steil und auf steinigem Weg geht es auf dem rechten Ufer des Chambo zur Terrasse von Penipe (Kirchplatz 2520 Meter) hinauf, das, von zahlreichen künstlichen Wassergräben durchzogen, zwischen grünen, ummauerten Feldern, Obstgärten und riesigen dunklen Eukalypten daliegt wie eine kleine[90] Burensiedlung im südafrikanischen Steppenland. Nur sieht es hier viel ärmlicher und schmutziger aus als weiland in Südafrika.
Wir kamen, da es in dem Nest keine »Casa posada« (Wirtshaus) gibt, in einem wegen seiner Baufälligkeit verlassenen stallartigen Gartenhäuschen eines der Dorfhonoratioren unter, das wir erst ausmisteten, ehe wir unsere Schlafsäcke auf dem Lehmfußboden ausbreiten konnten. Aber es bot wenigstens Schutz gegen Wind und Regen der Nacht.
Steil, steinig und sandig wie vom Chambotal nach Penipe, so geht es auch am nächsten Tag von Penipe zum Berggrat, der Loma de Nabuso, hinauf, wo in der Tiefe der Rio blanco aus der Ostkordillere in den Chambo einmündet. Es ist ein stellenweise verteufelt heikles Reiten. Wenn hier einmal ein Tier ausgleitet, rollt es rettungslos ein paar hundert Meter den jähen, kahlen Berghang hinunter in den reißenden Chambo. Die Maultiere bezwingen das schwierige Terrain in ruhigem, stetigem Klettern, langsamer, aber sicherer als die Pferde, die an schlimmen Stellen dem Reiter oder der Last durch heftige Bewegung gefährlich werden können. Mit jeder weitern Viertelstunde weicht der Landschaftscharakter mehr von dem des vulkanischen Terrains ab, das wir am Tage vorher durchzogen haben. Alle Bergformen sind hier schroffer, energischer, die Täler tiefer und doch breiter als drüben im Vulkangebiet. Von der Loma de Nabuso (2931 Meter) geht es wieder steil ins Tal des Rio blanco hinunter.
Nach anderthalb Stunden von Penipe aus hatten wir die Talsohle des Rio blanco erreicht (2610 Meter) und folgten seinem Lauf aufwärts. Der Bach braust und springt über Stock und Stein wie ein echter Wildbach[91] irgendeines Tiroler Bergtals, und wie seine Tiroler Verwandten so führt auch er hellgrau getrübtes Wasser als Zeichen seiner Abstammung aus vergletscherten, moränenreichen Bergeshöhen; daher sein Name Rio blanco, weißer Bach. Die Luft ward frischer, kühler, feuchter, je weiter wir talauf ritten. Kehle und Lunge schwelgten. Allmählich vollzieht sich auch ein Wechsel in der Vegetation. Die Charakterpflanzen der trockenen, warmen Hochebene, die Agaven, Opuntien, Euphorbien, verschwinden, und es erscheinen feuchtigkeitsliebende Formen. Wald aber gibt es auch hier nur in schmalen Strichen und Säumen an den tiefgeschluchteten Bachläufen, die dem Rio blanco von Osten her zueilen. Leider wimmelt es in diesen feuchten Dickichten von Moskitos. Wir waren deshalb froh, als es nach Passieren des Rio Tarau wieder auf grasigen, freien Berglehnen hinauf zu einer Talstufe ging, wo zwischen Mais-, Bohnen- und Kartoffelfeldern ein halb zerfallenes Landhäuschen und einige Hütten stehen: es ist die Hacienda Candelaria (2765 Meter), deren Besitzer uns mit frischer Milch labte – ein seltener Genuß im viehreichen Ecuador! Das Tal erweitert sich weiterhin auffallend; es wird muldenförmig mit ziemlich flachem Boden, in den der Rio blanco tief und steil eingeschnitten ist. Hier wird das Land belebter, kultivierter. Es erscheinen Felder und weitzerstreute Hütten.
Die Talform, die Strohhütten, das zahlreiche weidende Vieh, die Kartoffelfelder, die erquickend frische Luft, die klare Beleuchtung und vor allem die Vegetation an den Wegen und Rainen versetzten uns in eine subalpine Landschaft Europas oder Nordamerikas. Freudig begrüßten wir unter den Pflanzen gute alte Bekannte aus der Heimat: Brombeeren, Berberitzen,[92] Fuchsien, Salbei, Ranunkeln, Alchemillen, Brennesseln, Wegerich, Adlerfarn usw., ja an einer Wiesenecke lachte uns sogar ein Büschel wilder blaugelber Stiefmütterchen entgegen. Dann stiegen wir im Zickzack zu einer Talstufe hinauf, wo die vereinzelten Hütten von Releche (Hacienda 3117 Meter) liegen, und betraten oberhalb davon eine Waldparzelle, in der sich plötzlich eine wunderhübsche Wiese öffnete. Daneben blinkten zwei kleine Seen.
Die Waldwiese auf der Terrasse von Releche ist ein wirklich idealer Lagerplatz (3323 Meter). Schnell waren am Waldsaum unsere beiden Zeltchen aufgestellt, während sich die Peones im Dickicht selbst einrichteten. Wieder einmal genossen wir den Reiz eines stillen Gebirgslagers und stiller häuslicher Enge inmitten einer großen Natur: die Zelte, Feuer, Menschen und Tiere dicht beieinander, Wasser und Holz in bequemer Nähe, während ringsum die große einsame Bergwildnis uns teilnahmlos anzuschauen schien.
Gegen Sonnenuntergang legte sich eine wundersame ruhige Stimmung auf die Landschaft. Gänzliche Windstille ringsum, aber hoch über den uns schützenden Bergrücken segelten die abendlich geröteten Wolken eilig nach Westen. Wie am Abend eines deutschen Vorfrühlingstags pfiff von einem fernen Baumwipfel eine Drossel ihr kurzstrophiges Lied, andere Drosseln hüpften pickend auf der Wiese umher, und auf dem nächsten See flatterten ein paar kleine Enten. An den Blüten der Fuchsiensträucher aber, die auf den verwetterten Berberitzenbäumen am Waldesrand schmarotzen, schwirrten hurtig einige Kolibris und ließen ihre grün metallischen Brustfedern und ihre rotschillernden Schwanzfedern im Licht der Abendsonne wahrhaft Funken sprühen.
Nach Sonnenuntergang begann im Wald der schrille Gesang[93] unzähliger Zikaden, und während wir, von leichtem Paramitoregen ins Zelt getrieben, lagen, lasen und rauchten, schwirrten um die trüberleuchteten Zeltwände große Käfer, und in ihren brummenden Baß klangen die hohen klaren Glockenstimmchen der Laubfrösche hinein, die uns leider noch viel Regen prophezeiten.
In der Nacht trommelten denn auch stundenlang die Tropfen auf unser Zeltdach, und am Morgen lag alles in dichtem nässenden Nebel, als wir mit acht Peones zum Cerro Altar aufbrachen. Unsere Arrieros, die wegen der Steilheit mit den Tieren zurückblieben, richteten sich für die nächsten zwei Tage in einer kleinen Laubhütte möglichst regensicher ein. Die oberste Bergwaldzone, durch die wir nun weiter stiegen, machte uns viel zu schaffen. Von Schlinggewächsen, grünen Epiphyten, langen grauen Bartflechten und dicht wucherndem Unterholz ist der Wald durchsponnen und gleichsam verfilzt. Bis an die Knöchel versinkt der Fuß in dem schwarzen Morast des Pfades, den das oben in den Páramos weidende Vieh beim Auf- und Abtrieb zertrampelt, und über gestürzte Baumstämme weg müssen sich die Peones mit ihren Lasten abmühen. Bald wird der Anstieg so steil, daß an Stelle des Pfades Stufen und Löcher treten, in denen der Fuß Halt sucht. Alles trieft von Nässe, und auf dem schlüpfrigen lehmigen Boden gleitet einer nach dem andern fluchend aus. Trotzdem ließen die Peones ihre Lasten nicht liegen. In 3490 Meter Höhe überschritten wir die obere Waldgrenze. 200 Meter höher hatten wir über dem letzten Fuchsiengestrüpp die Grasregion des Páramo bei 3700 Meter erreicht, wo der Boden etwas fester war. Aber die Steilheit hielt an, und dazu gesellte sich auf der freien Höhe kalter Wind mit fortdauerndem Nebeltreiben.
[94]
Bei 4200 Meter Höhe traten wir in die Region der Polsterformation ein. Weithin verdrängen an feuchteren, leicht gesenkten Stellen die dunkelgrünen, bis zu ½ Meter hohen runden Kissen von Werneria, Pectophytum und Azorella den Graswuchs fast gänzlich. Die Polster der dichtgedrängten kleinen Pflanzen sind so fest, daß man mit dem eisenspitzigen Stock nur oberflächlich eindringen kann, aber neben ihnen heben sich zahlreiche kniehohe Blütenstengel einer goldgelben Senecio empor, wie freundliche Lichtgestalten aus schwerer träger Materie. Die Sonne, die sie hervorgezaubert, ließ uns jedoch im Stich. Der Nebel teilte sich zwar etwas, aber der Blick reichte nicht weit: nur braungrasige Kuppen und Berglehnen. Dazu begann es gegen Mittag bei 4230 Meter lustig zu schneien.
Jetzt war es an der Zeit, die tiefgesunkenen Lebensgeister meiner Peones durch eine reichliche Spende von Maisbranntwein (Chicha) zu heben, den ich zu diesem Behuf in gehöriger Menge mitgenommen hatte. Das Zeug schmeckt abscheulich, ist aber den Indianern der höchste der Genüsse. Die Kerle folgten denn auch dem großen strohumflochtenen Schnapskrug wie die Sarazenen der Fahne des Propheten.
Glücklicherweise waren wir bald danach auf der Höhe des langgestreckten, dem Altar vorgelagerten Bergrückens (Loma de Tunguraquilla). In tausendfachen Windungen läuft der Pfad nahe seinem Grat um kleine Sümpfe und Bachrisse herum nach Osten, immer durch struppiges, büscheliges Páramogras, bis er in 4275 Meter Höhe plötzlich steil nach Südosten in ein breites trogförmiges Tal abbiegt, dessen tiefgeschluchteten, unpassierbaren Mittellauf wir hier oben auf diesem Umweg hatten umgehen müssen. Es ist das Val de Collanes.
[95]
In Regen, Wind und Schnee stiegen wir an den abschüssigen grasigen Hängen auf dem von Nässe und Lehm glitschglatten Pfad zur sumpfigen Ebene des Collanes-Tales hinab, ein typisches altes Gletscherbett, das nach Osten in ein ungeheures, von Schnee und Eis erfülltes Felsen-Amphitheater übergeht: die Caldera des Altar. Ein wundervolles hochalpines Diorama im Treiben der Nebel. Hier endlich beginnt das vulkanische Gestein des Cerro Altar. Unten scheuchten wir eine Herde halbwilder Rinder auf, die stürmisch entflohen wie ein Rudel Hirsche. Wir folgten dem festen Geröllsaum des Baches, dessen grautrübes Wasser die »Gletschermilch« verrät, bis an den Fuß der vordern Calderawand, wo sich oben rechts und links von den Eismassen her zwei alte Moränenwälle in die Talebene vorschieben und an den Enden miteinander verschmelzen. Dichter, von Moos und Flechten fast erdrückter niedriger Buschwald hat ihre Blockhaufen überwuchert, und dort, am untern Rand der südlichen Moräne, wo es Brennholz und Wasser gibt, fand sich bald ein geeignetes Plätzchen (3964 Meter) für unsere beiden Zelte, während die Peones sich abseits eine Zweig- und Grashütte bauten. Es war ein trüber, nasser, kalter Lagerplatz. Wetter und Weg hatten uns allen tüchtig zugesetzt, neun volle Stunden waren wir von Releche an auf den Beinen gewesen, und es versteht sich, daß wir nach Einnahme unserer üblichen Reissuppe uns schleunigst in die trockenen, weichen, warmen Schlafsäcke verkrochen, mit dankbaren Gefühlen für die seligen Opossums, die uns ihren molligen Pelz im Dienst der Wissenschaft geopfert hatten.
Am nächsten Morgen war bei hellerm Wetter die Situation klarer. Wir sahen uns in einem ungeheuern Taltrog, dessen steile, himmelhohe Felswände sich im Osten[96] zum Kraterzirkus des Altar halbkreisförmig zusammenschließen. Der gletscherbedeckte Calderaboden (Plazabamba genannt) liegt etwa 340 Meter über unserm Lagerplatz, und von uns hinauf ziehen die beiden hochgewölbten Schutt- und Blockwälle, die uns bekunden, daß die Gletscherzunge, die jetzt dort oben in 4300 Meter Höhe auf einer steilen Felsstufe endet, sich einst bis hierherunter zu 3960 Meter Höhe erstreckt hat. In dieser Ausdehnung ist der Gletscher lange Zeit stationär gewesen, während deren er diese großen Schuttmassen an seinem Rande absetzen konnte. Als dreißig Jahre vor mir die deutschen Geologen Reiß und Stübel hier weilten und in wiederholten längeren Besuchen den vulkanischen Bau des Cerro Altar studierten, reichte der Kratergletscher noch in einer imposanten Eiskaskade bis an den Fuß der Felsstufe herab.
Die bezeichneten alten Moränenwälle stellen aber nicht die äußersten Grenzen der einstigen Gletscherausdehnung dar, sondern der Eisstrom erstreckte sich in einer noch frühern Periode bedeutend weiter in das Collanes-Tal hinaus. Wenn wir oberhalb unseres Lagers vom Kamm der alten südlichen Moräne talabwärts schauen, sehen wir etwa 1½ Kilometer weiter draußen an der südlichen grasigen Steilwand des trogförmigen Collanes-Tals bis zu etwa 200 Meter hinauf vier terrassenartige Stufen ziemlich parallel übereinander und parallel dem Talgrund entlang ziehen, die mit großen und kleinen Blöcken besetzt sind und offenbar Abstufungen alter Ufermoränen darstellen. Noch weiter draußen, am Ende des Taltrogs, schließt ein mehrfach gestufter, bogenförmiger Schuttwall, eine alte Endmoräne schönster Ausbildung von ungefähr 20 Meter Höhe, das trogförmige, flachsohlige Collanes-Tal querüber ab.

[97]
Bis hierher haben wir also in dem »U-Tal« das vollkommene Bild eines alten Gletscherbettes, in dem der von den Firnmassen der Caldera genährte Altargletscher vor Jahrtausenden, aber immer noch in einer geologisch jungen Vergangenheit – denn der Altar selbst ist nicht älter als pleistozän – als ein bis 300 Meter dicker und bis 2½ Kilometer langer Eisstrom das Tal erfüllt, ausgeräumt und ausgeschliffen hat. Dann hat er sich, wie die Moränen zeigen, in mehreren Abschmelzungsperioden mit dazwischenliegenden Ruhepausen zurückgezogen, zuletzt bis in den Kraterkessel des Altar, indem er das rezente Rückzugsgebiet mit frischen Schuttdecken überzog.

Aber noch eine weitere Eigentümlichkeit fällt uns von unserm Aussichtspunkt aus auf. Die Seitenwände des Tals sind bis zur Höhe von etwa 300 Meter über dem Talboden an allen Vorsprüngen und Kanten abgerundet und ausgeglichen. Darüber rücken die Wände in einer schiefen Terrasse oder Leiste etwas zurück, und oberhalb von dieser sind sie in allen ihren Formen eckig und rauh. Der untere Teil der Talmulde mit den abgerundeten Formen ist ganz offenbar ein »Tal im Tale«, und die Talleiste am Fuß des obern Talniveaus ist ein »Trogrand«, der Rest eines alten Talbodens, in den der jüngere, tiefere, schmälere Taltrog eingesenkt ist. Diese und andere glaziale Anzeichen, z. B. die Hängetäler der Seitenbäche, bestätigten meine Vermutung, daß das Collanes-Tal das Erzeugnis einer zweimaligen Vergletscherung ist. Näher will ich hier nicht darauf eingehen.

Nach beendeter Umschau über das Collanes-Tal stiegen wir auf der südlichen alten Ufermoräne zum Rand des Kraterbodens (Plazabamba) empor, wo die Gletscherstirn bei 4300 Meter liegt. Noch deckte Nebel die Caldera und die sie[98] krönenden Felstürme, als wir uns aufmachten. Der Anstieg war anfangs bequem durch Geröll, niedriges Gestrüpp und über grasige Lehnen; aber im letzten Drittel gab es steile Felswände, und erst gegen 9 Uhr waren wir am Oberrand der Felsstufe, über die das Gletscherbächlein ins Collanes-Tal hinabrinnt, und betraten frischen Moränenschutt und Eis. Neben uns ragte die südliche Felswand des Caldera-Eingangs vertikal auf, bis über 30 Meter hoch hinauf prachtvoll geschliffen und geschrammt, als hätten viele Tausende schwerer Lastwagen ihre Radspuren daran zurückgelassen. Auf dem höchsten der schuttbedeckten Eishügel machten wir im Kraterkessel halt.
Während wir uns zu orientieren suchten, wichen allmählich die Nebel und gaben den ganzen Kraterzirkus mit Ausnahme der höchsten Grate und Spitzen frei. Wir stehen wie in einem ungeheueren Kar mit 1000 Meter hohen Steilwänden, aber dieses Kar hat nicht die uns bekannte Lehnsesselform, die Karwände werden nicht von der Rückenlehne nach den Seitenlehnen hin niedriger, sondern gerade am Eingang türmen sich rechts und links die beiden Hauptgipfel empor, der »Canonico« auf der Nordseite, der »Obispo« auf der Südseite, die mit 5355 Meter und 5405 Meter Höhe alle anderen Teile der Zirkuswände weit überragen. In der Runde senken sich von den Felswänden große Firn- und Eismassen zum Zirkusboden hinab, ein im Durchmesser über 1000 Meter weites Eis- und Schuttfeld. Fünf niedrige, runde Felsbuckel gliedern dieses Eisfeld in sechs primäre, kleine Gletscher, die zur tiefer gelegenen Mitte sich vereinen und nun als ein einziger Eisstrom zum Ausgang des Kessels fließen, der am Ende unter seinem Moränenschutt ganz verschwindet.
Ein auffallender schneebedeckter, etwa 200 Meter hoher[99] Felskegel, der sich im Kraterzirkus dem Fuß des »Canonico« anlehnt, scheint ein Eruptionskegel in der Caldera zu sein, durch den sich die letzten vulkanischen Zuckungen des Berges Luft gemacht haben. Wie in einem Flußbett nach Ablauf des Hochwassers ein langes Band von allerlei Rückständen, Schlamm, Sand, Holzstücke usw., am Uferhang liegenbleibt, bis sie vom Regen abgespült werden, so liegen hier, als Flutmarken des einstigen Gletscherhochstandes, allenthalben Moränenschuttbänder bis 100 Meter hoch über der jetzigen Gletscheroberfläche an den felsigen Berglehnen. Rück- und Niedergang des Eises, wohin man blickt!
Die Sonne brannte in der windstillen Caldera nachgerade so kräftig auf uns herab, daß wir trotz der 4344 Meter Höhe die Röcke auszogen und unseren Arbeiten hemdsärmelig oblagen. Nach Mittag schien die ganze Umgebung in langsame Bewegung geraten zu wollen; überall rieselten dünne Schmelzwässer und knisterte und prasselte der ausgeschmolzene Sand und Geröllschutt, überall gab nun die Moränendecke rutschend nach, wenn man sich auf ihr bewegte. Und als wir um ½3 Uhr zur Rückkehr nach den Zelten aufbrachen, hatte sich das Gletscherbächlein, das am Morgen nur dünn geflossen war, in einen stattlichen Bach verwandelt, der sich aus dem niedrigen Gletschertor durch alle die Schuttmassen Bahn brach und unmittelbar danach als brausender Wasserfall in das Collanes-Tal hinabstürzte.
Am späten Nachmittag wurde es auch in den höchsten Regionen des Altar klarer und lichter, und schließlich stand der ganze riesige Berg im goldenen Licht der Abendsonne vor uns. Die beiden vordersten Ecktürme, der Obispo und der Canonico, ähneln in ihrer trotzigen Gestalt und wilden Schönheit dem Eiger und dem Matterhorn. Über 1000 Meter[100] starren ihre jähen, nur wenig Firn festhaltenden inneren Wände über dem Calderaboden empor, während die äußeren in zahllosen Steilstufen abfallen und in mehreren Karen kleine Hängegletscher tragen, die in den herrlichsten Blaubändern leuchten. Die schönste Firnkuppel des Altar ist aber die hinter dem Obispo mitten auf der südlichen Zirkuswand aufgetürmte »Monja grande« (große Nonne). Man begreift schlechterdings nicht, wie sich die mächtige Firnkappe auf dem steilen Felsturm halten kann.
Auf der Hinterwand des Zirkus thront gerade gegenüber dem breiten Eingangstor ein kolossaler, dreizackiger Felsklotz (5294 Meter), der den Namen »Tabernaculo« erhalten hat. Er liegt auf dem Altar wie ein Tabernakel zwischen zwei riesigen Kerzenträgern, was wohl die Herren Reiß und Stübel zu dieser Namengebung veranlaßt haben mag; denn die hübschen Namen Canonico, Obispo, Monja, Tabernaculo usw. für die einzelnen Gipfel sind keine landesüblichen, sondern von Reiß und Stübel verliehene, da es keine einheimischen gibt. Auch auf dem Tabernaculo und auf vielen Zinnen der nördlichen Zirkuswände lagern mächtige Firnmassen in hoher Wölbung und mit weit überstehenden Wächten, die der ständige Ostpassat herübergebogen hat.
Daß der Altar so, wie er heute dasteht, nichts Ursprüngliches ist, sondern nur die Ruine eines noch größern Berggebildes, haben selbst die Eingeborenen mit ihrer geringen Beobachtungsgabe gesehen und gedeutet. Ich habe von Bewohnern Riobambas oft die Meinung gehört, der Berg sei früher noch höher gewesen als der Chimborazo, sei aber vor einigen Jahrhunderten durch Erdbeben zum Einsturz gebracht worden. Sie haben wohl darin, daß der Berg einst höher gewesen und dann zerstört worden sei, das Richtige[101] getroffen, aber die Zeit haben diese kurzlebigen, kurzdenkenden Menschen erklärlicherweise viel zu kurz bemessen. Was können sie wissen, was geologische Zeiträume bedeuten! Der Legende, daß der Berg gegen Ende des 15. Jahrhunderts in sich zusammengesunken sei, ist übrigens auch kein Geringerer als A. von Humboldt zum Opfer gefallen. Er berichtet von einem alten indianischen Manuskript, das diese Katastrophe beschrieben habe, aber der deutsche Reisende Moriz Wagner hat später nachgewiesen, daß Humboldt sich »eine Lüge hat aufbinden lassen«.
Naturgewalten haben allerdings den Berg zu der heutigen Ruine gemacht, aber diese Zerstörung hat sich allmählich in riesigen Zeiträumen vollzogen. Sein kolossaler Kraterzirkus, seine Caldera, ist in seiner Anlage ein Werk vulkanischer Kräfte; er ist dadurch entstanden, daß mit dem Erlöschen der Eruptionen ein großer Teil der Magmamassen in den weiten Eruptionsschlot zurücksank, weil die Kraft fehlte, sie über den Kraterrand hinauszuheben. Es ist der Vorgang der »Sackung«, wie er an so vielen Vulkanen gerade der Hochanden Ecuadors zu beobachten ist. Den so entstandenen Kraterzirkus haben aber dann in unablässiger, jahrtausendelanger Arbeit Wind und Wetter, vor allem das Eis ausgeweitet, sie haben die steilen Felswände geschaffen, die ihn jetzt umgeben, sie haben, von innen und von außen angreifend, die hohen Zinnen und die schmalen Grate geschliffen, die ihn jetzt bekrönen. Die Ruine des Altar ist ihr Werk.
Als am Abend die gelben, violetten und rosaroten Töne auf Fels und Firn verblaßten, wurde es sehr schnell kühl (6 Uhr +3°). Aus den nahen Sümpfen des Collanes-Tales erklang vielstimmiges, melancholisches Unkenkonzert, und bald drangen von dort Scharen kleiner Stechmücken zu uns herüber,[102] vor deren Angriffen wir uns in unsere dichtschließenden Zelte und Schlafsäcke zurückzogen. Als ich in der Nacht, durch den Donner einer Lawine geweckt, nach dem Wetter sah, lag die stille große Landschaft in zauberhaftem Mondlicht, und gerade vor uns im Einschnitt des hochwandigen Collanes-Tals funkelte der Jupiter so blendend und riesengroß am wolkenlosen Nachthimmel, daß ich zuerst ein Meteor zu erblicken glaubte. Wer den Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht sehen will, muß in große Bergeshöhen der Äquatorialzone gehen.
Als wir mit steigender Sonne dem Altar Lebewohl sagten und den Rückweg nach Releche antraten, hatte der Gletscherbach im Collanes-Tal noch eine dünne Eisdecke. Wir folgten dem Pfad, auf dem wir hergekommen, und als wir, aus dem Tal auf den Nordhang heraussteigend, die ersten Kuppen umkreisten, kam plötzlich die Nordwestfront des Canonico in Sicht, die uns auf dem Herweg im Nebel verborgen geblieben war. Wie da die prachtvolle Pyramide sich aus den Wolken aufbäumte, entrang sich uns beiden ein lautes jubelndes Hurra! Auf ihren riesigen schroffen Südwänden halten sich keine größeren Firnlager, aber auf der uns voll zugewandten Nordwestfassade steigen Firn und Eis in unzähligen Stufen und Brüchen über die Felswände zum schuttbedeckten Sockel herab, wo das Eis in zwei kleinen Gletschern ausläuft.
Beim Aufstieg zur Loma de Tunguraquilla konnte ich wieder einmal die Leistungsfähigkeit der Peones bewundern. Mit ihren 40 bis 60 Pfund schweren Lasten auf dem Rücken stürmten diese Burschen eine Stunde lang ohne Rast den steilen, grasigen Berg hinauf in einem Tempo, daß uns beiden nur mit Eispickel und Rucksack beschwerten Europäern[103] der Atem ausging und das Herz zu springen drohte. Oben angelangt, vergossen die Leute zwar Ströme von Schweiß, waren aber sonst nicht im mindesten von der Anstrengung ermattet; sie haben Herzen wie eiserne Pumpen.
Diesmal war unser Marsch über diese Páramohöhen sonnig, warm und aussichtsreich. Ein frischer Wind fauchte im hohen Sigsiggras, wie in einem heimatlichen Fichtengehölz, kleine Hasen huschten blitzschnell durch die Grasbüschel, und ein auf Rücken und Seiten blaugrau, an Kehle und Bauch rotbraun gezeichneter Fuchs jagte über die Hänge. Links, am fernen Horizont, dehnen sich zwei parallele lichtgraue Bänder in unabsehbare Weite: die Westkordillere, deren Einzelheiten auf diese Entfernung schwinden und nur eine unendlich lange gleichförmige, horizontale Mauer übriglassen; und über ihr in geringem Abstand, ebenso gleichförmig, ebenso lang, ebenso horizontal, die Schichten der alltäglichen Mittagswolken. Aber über die endlose Wolkenbank hinaus ragt als einzige und höchste Landmarke der Gipfel des Chimborazo mit seiner silberblanken Firnkuppel.
Um ½3 Uhr kam tief unter uns die Mulde von Releche mit den blaugrünen Seenaugen und der blauen Rauchsäule des Lagerfeuers unserer Arrieros in Sicht. Um 4 Uhr waren wir unten und verabschiedeten mit einer reichlichen Libation Feuerwasser und einer klingenden Extrazulage unsere unermüdlichen Peones, die am selben Nachmittag und Abend noch bis nach Penipe hinabliefen. Wir selbst folgten am nächsten Tag nach einer ruhevollen Lagernacht. Um Mittag waren wir wieder in Penipe, und nach kurzer Mittagspause für Mensch und Tier eilten wir weiter nach Riobamba.
[104]
Südlich von Quito, eine halbe Stunde von der Stadtgrenze entfernt, steht auf der Fußebene des Pichincha eine kleine, 200 Meter hohe Vulkankuppe von auffallend regelmäßiger Gestalt: Panecillo, das Zuckerhütchen, nennen die Einheimischen den Hügel. Seine freie, dominierende Lage (3050 Meter) macht ihn zu einem Aussichtspunkt ersten Ranges. Der droben Stehende sieht sich von einem mächtigen Bergkranz umgeben. Im Rücken hat er den breiten, von tiefen Quebradas zerschluchteten Pichincha, an den sich nach Süden und Norden in langer Linie die Vulkanberge der Westkordillere anreihen, fast lauter Viereinhalbtausender und noch höhere, und nach Osten schweift der Blick über die weite, nach Süden und Osten ansteigende Mulde des Rio San Pedro und seiner Nebenflüsse weg auf die lange Bergmauer der Ostkordillere, die hier nicht so viele einzelne große Vulkangipfel trägt wie die Westkordillere und geschlossener, finsterer, unzugänglicher erscheint als jene.
Auf keiner Seite hat der Beschauer Schneeberge in seiner Nähe. »Ewige Schneehäupter« tauchen erst in weiter Entfernung von Quito auf. Im großen, von breiten Lücken unterbrochenen Halbkreis umziehen sie im Süden und Osten das Panorama des Panecillo; es sind von Süden her der[105] doppelzackige Iliniza (5305 Meter), dann der Riesenkegel des Cotopaxi (6005 Meter), daneben der kleinere Sincholagua (4988 Meter), weiter östlich die große Stumpfpyramide des Antisana (5756 Meter), darauf der niedrigere, aber stark vergletscherte Sara-urcu (4725 Meter) und zuletzt der dem Chimborazo ähnelnde mehrgipfelige, von Eisströmen übergossene Cayambe (5840 Meter).
In dem großen Halbkreis dieser ragenden Schneehäupter imponierten mir der Antisana und der Cayambe am meisten, und der Antisana zog mich vermöge seiner herrlichen Gestalt und seiner starken Vergletscherung mit magischer Gewalt an.
Für eine Besteigung und Untersuchung des Antisana gibt es nur ein geeignetes Standquartier am Fuß des Berges, den Hato Antisana an der Westsüdwestseite. Die Reise dorthin von Quito läßt sich in zwei Tagen über den Rio San Pedro und die Orte San Rafael, Pintac, Hacienda Pinantura und den Paß Puerta de Guamani machen. Am 26. Juli früh brach ich mit Herrn Reschreiter und meiner alten Karawane von drei Einheimischen und zehn Mulas nach Osten auf. Zuerst führte die Straße, die theoretisch auch zum Fahren bestimmt ist, steil zum Bergrücken Poingasi hinan.
Droben öffnet sich plötzlich vor uns das Land zu unseren Füßen. Das Auge schweift freudig über die sonnige, weite Quitomulde mit ihren unzähligen Hügeln und grünen Feldern, Haciendas und Dörfern, Baumgruppen und Bachschluchten. Ein ungewohntes Kulturlandschaftsbild im ecuatorianischen Hochland.
Auf einem fürchterlich gepflasterten Serpentinenweg geht es dann zum Rio San Pedro hinunter. Die Mulas rutschen und stolpern; wer hier stürzt, bricht unfehlbar das Genick.[106] Aber wäre der Weg nicht gepflastert, so wäre er an dem steilen Berghang in der Regenzeit monatelang überhaupt nicht passierbar. Das läßt man sich wohl in der »Provinz« gefallen, aber nicht hier in der Nähe der Hauptstadt, deren reiche Leute ihre Haciendas draußen in der Quitomulde haben und jederzeit mit ihnen verkehren wollen.
Eine alte Steinbrücke führt uns unten über die tiefe, kaum 10 Meter breite Quebrada eines Nebenflusses des Rio San Pedro, in deren Grund die tuffbraunen Fluten gurgeln. Lotrecht und glatt wie mit dem Spaten sind die Wände des Cañons in den Tuff eingeschnitten, und diese Tuffmassen, diese klammartigen Erosionsschluchten treffen wir fernerhin überall in der Quitomulde, wo wir Bäche zu passieren haben. Jenseits des Dorfes Conocoto (2594 Meter) überschritten wir auf einer neuen Eisenbrücke die schäumenden Wasser des stattlichen, 20 Meter breiten Rio San Pedro und kamen durch Staub und Glut nach Mittag im Städtchen Sangolqui (2561 Meter) an, wo uns die übliche Staffage der ecuatorianischen Provinzstädtchen umgab: baufällige, wegen der Erdbeben nur einstöckige Häuser; Schmutz, Schweine und Hühner auf den Straßen, wenige und lumpige Menschen.
Ganz allmählich hebt sich unser Terrain ostwärts. Zur Linken haben wir den frei in der Talebene stehenden, stark abgestumpften Vulkankegel Ilaló (3161 Meter), weiter zur Rechten erheben sich die breiten Sockel des Pasochoa (4255 Meter) und des Sincholagua (4988 Meter). In der Lücke zwischen beiden erscheint aber in der Ferne der Wunderberg Cotopaxi mit seinem ungeheuern, schnurgerade nach Osten hinausflatternden Wolkenschleier. Auf seiner wolkenfreien Nordwestflanke glitzern drei Gletscher im Sonnenlicht.
[107]
Die Sonne stand schon tief zwischen dem Pichincha und dem Atacatzo, als wir in das kleine Kirchdorf Pintac (2925 Meter) einzogen. Da aber das Nest bitterwenig einladend aussah, ritten wir ohne Aufenthalt nach der Hacienda Pinantura weiter, die nur eine kleine Stunde entfernt sein sollte. Erst ging es auf langgestreckten, buschbewachsenen Höhenrücken entlang, in deren graugelbe Tuffmassen der Reitpfad durch langjährige Benutzung oft mehrere Meter tief eingeschnitten war. Darauf wurde die Landschaft mehr und mehr páramoartig. Schon schlichen nächtliche Schatten aus den Niederungen an den Bergen empor. Plötzlich standen wir am scharfen Rand einer düstern Talschlucht, der Quebrada Guapál, die in der Dämmerung nur noch tiefer erschien, und sahen im Abendschein am jenseitigen Rand die Hütten der Hacienda Pinantura. Da hinabzureiten wäre in der Dunkelheit für einen Ortsunkundigen Selbstmord; nur unser Führer riskierte es. Wir andern tappten und rutschten zu Fuß auf dem steinigen, tiefgefurchten, buschbewachsnen Pfad hinter ihm her, unsere Tiere am Zügel nachziehend. Es war stockfinstere Nacht geworden, und der dünne Schimmer der Mondsichel drang nur mit vereinzelten Blinklichtern ins Dickicht. Alle paar Minuten lag einer von uns am Boden und machte seinem Zorn und Schmerz durch einen kräftigen Fluch Luft. Wer das letztere noch nicht gekonnt hat, der lernt es in Ecuador. Endlich brausten unter uns die Wasser im Talgrund. Ohne eine Spur davon im Dickicht zu sehen und ohne zu ahnen, wohin es ging, kletterte ich in der Finsternis auf meine herangezogene, widerstrebende Mula und ließ sie gottbefohlen ihren Weg im Dunkeln suchen. Sie folgte, vorsichtig tastend und laut schnaubend, dem Tier des Führers, aber langsam landete mich das brave Tier am andern Ufer[108] ohne Sturzbad. So ging es dicht hintereinander durch vier reißende Bacharme. Beim vierten half schon das einfallende Mondlicht mit, und allmählich näherten wir uns dem jenseitigen Oberrande der Quebrada, wo die Hütten der Hacienda Pinantura (3174 Meter) vor uns auftauchten. Ein altes Weib öffnete auf des Führers Zuruf das verrammelte Tor. Wir nahmen vom sogenannten Zimmer des Mayordomo Besitz, wo neben Haufen von Kartoffeln und Mais ein zerbrochener Tisch und ein Möbel standen, das einst vermutlich ein Sofa gewesen war, und in der Ecke sogar eine Art Bettstelle mit Strohsack. Alles klebte von Schmutz; die aus Lehm zusammengepatzte Stubendecke war, wie gewöhnlich, halb heruntergefallen, und natürlich war es hundekalt, da ebenso natürlich kein Ofen vorhanden war. Aber unsere Schlafsäcke halfen uns über alle Widrigkeiten hinweg.
Vor Sonnenaufgang des nächsten Morgens trat ich vor die Haciendamauer an den Rand der düstern Quebrada Guapál. Darüber hinweg weitet sich eine wundervolle Aussicht nach Westen über die große, langsam westwärts sich senkende Ebene der Quitomulde bis zum fernen dunstigen Pichincha, der langgestreckt und mit sanften Hängen das Panorama im Westen abschließt. Seine breiten Gipfel heben sich nur wenig über die flache Wölbung des schildförmigen Massivs, der höhere Südgipfel (Guagua-Pichincha 4787 Meter) mit ein wenig Schnee, aber ohne die leiseste Spur eines Kraterwölkchens.
Nach Osten schweifte der Blick über die leicht ansteigende Ebene bis zum breitbuckeligen, felsigen Sincholagua, dessen kleiner Gipfelgletscher im Morgenlicht rosig schimmerte, und südwestlich hinter seinen langen dunklen Ausläufern leuchtete aus der Ferne die oberste Firnkuppe des Cotopaxi herüber,[109] der eine zarte orangerote Dampfwolke entflatterte wie eine feingetönte Straußenfeder.
Die schnell aufsteigende Sonne mahnte zum Aufbruch. Mit nur fünf Peones im Gefolge, die am Antisana unser Gepäck von den Maultieren übernehmen sollten, ritten wir los. Der Pfad führt langsam an der steilen Innenwand der Quebrada bergan. Unsere ganze Aufmerksamkeit war aber nun von einem auf der Talsohle liegenden Lavastrom, dem Volcan de Antisanilla, gefesselt, dem größten Lavastrom Ecuadors.
Sein Ende liegt bei 3045 Meter im Talgrund, und bis dahin zieht der »Volcan« (Lavastrom) wie ein riesiger Damm oder wie ein hochgewölbter Gletscher in der Quebrada entlang. Im Endteil hat er noch eine Mächtigkeit von etwa 130 Meter bei etwa 200 Meter Breite. Seine Oberfläche erreicht aber nirgends ganz das Niveau der oberen Talränder. Oft ist er in der Mitte seiner Laufrichtung eingesunken und rechts und links von großen Längskämmen überragt. Man sieht dem Volcan überall die allmähliche Erstarrung in langsamer Bewegung an. Er ist dick mit Trümmern bedeckt, so daß man das Ganze leicht für bloße Schuttmassen halten kann.
Hell hebt sich bei Sonnenlicht der graubraune Lavastrom von den grünen baum- und buschbewachsenen Talwänden der Quebrada Guapál ab. Seine Oberfläche hat aber doch trotz seiner Jugend schon einen grünlichen Anflug, stellenweise sogar einen Überzug von Vegetation. Es sind Flechten, kleine Gräser, Farne, Steinbrechstauden und niedriges Gestrüpp, die sich auf seinen harten Blöcken, Schlacken und Sanden angesiedelt haben. Für die Dauer dieses stillen, aber harten Kampfes der Pflanzen um neuen Boden haben wir gerade[110] im Lavastrom von Antisanilla einen guten Maßstab an seinem ziemlich genau festzustellenden Alter. Wie Theodor Wolf nachgewiesen hat, war der Lavastrom 1767 schon vorhanden, und da Humboldt eine Eruption des Antisana aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, »wahrscheinlich von 1728«, erwähnt, aber von weiteren Ausbrüchen nichts berichtet wird, so kann man mit ziemlich großer Sicherheit das jetzige Alter des Volcan auf 1¾ Jahrhunderte berechnen.
Nach kurzem Ritt schwenkten wir aus der Quebrada Guapál südwärts ab und kamen draußen auf dem Plateau wieder in eine Zone von bösartigen Tuffen, in die sich die Reitwege noch tiefer eingeschnitten haben als in die Tuffe zwischen Pintac und Pinantura. Steil geht es dann über grasige Páramohügel hinauf, wo die höchsten kleinen Gerstenfelder der ganzen Gegend bei 3380 Meter liegen, und endlich durch ein primitives, das Vieh abhaltendes Holzgatter, die Puerta de Guamani (3544 Meter). Hier stehen wir plötzlich wieder am Rand der Quebrada Guapál und haben darin von neuem den Lavastrom von Antisanilla vor uns, und zwar in seiner großartigsten Mittelpartie. Hier wälzt er sich auf der uns gegenüberliegenden nördlichen Talseite, unsichtbar woher, einem versteinerten Katarakte gleich, über den Rand der Quebrada und über die hohe Talwand hinab in den Talgrund.
Breit und mächtig wie der Niagarafall kommt er über den Talrand herunter. Es muß ein Schauspiel sondergleichen gewesen sein, als hier seine Schlacken und Blockmassen in furchtbarem, unaufhörlichem Drängen und Schieben, getrieben von der unsichtbaren Gewalt des glühenden Magmainnern, mit Knirschen, Krachen und Donnern in die Tiefe des Tals stürzten, wo der wütende Kampf mit den Bachwassern begann, und als dann im Tal die ungeheure höllische[111] Schlange dampfend und lärmend, träge, aber unaufhaltsam weiterkroch.
Die Sonne hatte es den ganzen Vormittag gut mit uns gemeint. Dann hatten verdächtige lange Cirrusstreifen immer dichter den Zenit umschleiert, und nun begann es, je weiter wir auf die offenen Páramos hinaufkamen, immer steifer aus Osten vom Antisana her zu blasen. Dort hing dickes Gewölk tief herunter und gönnte uns keinen einzigen Blick auf den nahen Schneeriesen. Bei 4000 Meter rasteten wir in einer flachen Mulde inmitten einer wunderbaren Flora von kniehohen Culcitien, die hier zu Hunderten ihre hellgrauen pelzumhüllten, von faustgroßen grauen Blütenköpfen beschwerten Gestalten zwischen dem dunklen Grün der Werneriapolster emporstreckten.
Jenseits der Culcitienmulde erschien endlich vor uns im wehenden Nebel die längliche strohgedeckte Steinhütte des Hato del Antisana (4095 Meter), die wir um die Mitte des Nachmittags erreichten. Nachdem die Hacienda, die früher hier gestanden hatte, in den neunziger Jahren abgebrannt war, benutzt man jetzt die daneben in einer windgeschützten Bodensenke gelegene Hütte als Hato. Er ist mit 4095 Meter eine der höchstgelegenen menschlichen Wohnungen Ecuadors. Als Bewohner fanden wir drei indianische Hirten vor, die den mittlern Raum für uns freigaben. Es sind nur vier rohe Steinmauern mit dem Grasdach darüber, ohne Fensteröffnungen und ohne Rauchabzug. Hier machten wir Standquartier für unsere Antisanatour.
Zwischen uns und dem Berg zieht welliges Páramogelände, eine grünlichbraune Hochsteppe, leicht hinan, durchwunden vom rötlichgrauen Band eines mächtigen jungen Lavastroms, des Guagraialina-Volcans. An der Stelle, wo[112] dieser am westlichen Bergeshang hervorkommt, legt sich um die uns zugekehrte südwestliche und westliche Bergseite zwischen 4500 und 4800 Meter Höhe ein breiter Gürtel von hellgrauem frischen Moränenschutt, und darüber strebt das schneeige Bergmassiv des Antisana zu zwei runden Gipfeldomen himmelan; rechts der steilere, von schroffen Felswänden getragene Südgipfel (5620 Meter), links der höhere, breitere Nordwestgipfel (5756 Meter), dazwischen ein etwas niedrigerer zackiger Sattel mit dem kleinen, spitzen Westgipfel; alles überzogen von einem ungeheuern Firn- und Eismantel, der, in den oberen Bergpartien wild zerrissen, in den unteren sanft ausgeglichen, bis zur Moränenzone bei 4800 Meter herabwallt.
Den ersten vergeblichen Versuch, den Antisana zu besteigen, hat Alexander von Humboldt 1802 gemacht. Nach ihm ist Alphons Stübel am 25. September 1871 bis zu 5493 Meter Höhe gelangt. Bezwungen worden aber ist auch dieser Berg bisher nur durch Edward Whymper am 10. März 1881. Wir haben vom 28. bis 30. Juli 1903 an und auf dem Eis des Antisana gearbeitet und die Westseite bis über Stübels höchsten Punkt auf dem Mittelgrat bestiegen.
(Siehe Karte, Seite 130.)
Wir hatten in aller Klarheit auf dem offen vor uns ausgebreiteten Bergpanorama die Richtung ausfindig gemacht, in der ein Vordringen in die höchsten Regionen möglich erschien, und wollten oben von der Ursprungsstelle des Guagraialina-Lavastroms, der hier unten am Hato del Antisana endet, über die Firnfelder hinauf zum Sattel zwischen den beiden Gipfeln aufsteigen, um dann eventuell[113] nordwärts dem Hauptdom zuzustreben. Das war im allgemeinen auch Stübels und Whympers Route.
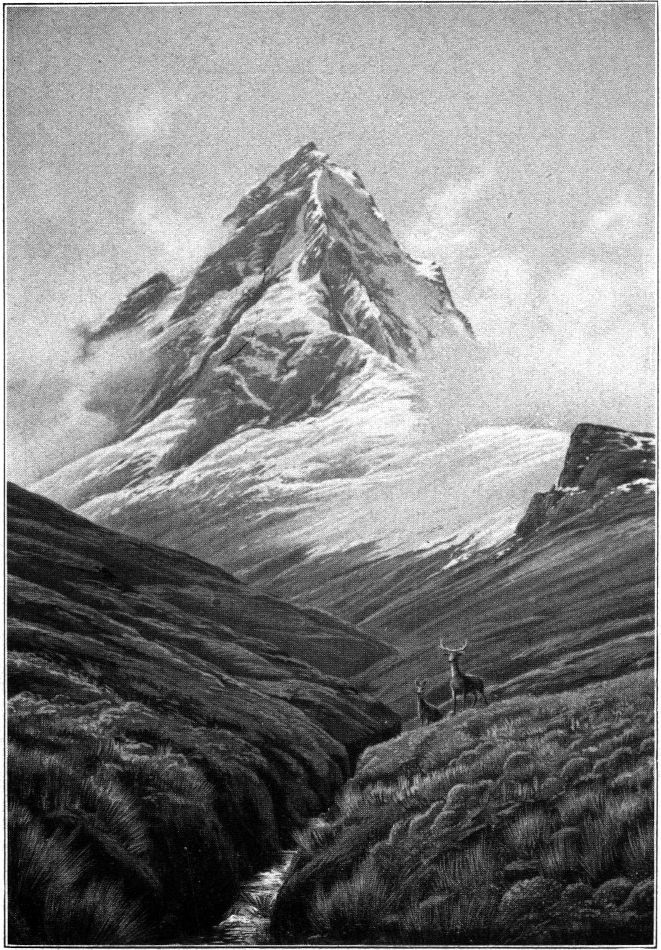
In der Frühe des 28. Juli lag um unsern Hato dicker Reif bei 2° Kälte, und die Luft war unsichtig von Nebel. Als aber um 7 Uhr die Sonne über den Eiskamm des Antisana herüberblitzte, brachen wir auf und ritten an der Westseite des Lavastroms entlang über ebene Páramoflächen bergan. Der Pfad war gut, das Wetter schön, der Wind noch linde. Der Antisana hatte eine prachtvoll kuppelförmige, weiße Wolkenhaube über seine beiden Gipfel gestülpt, die ihn als einen einzigen ungeheuern Schneedom erscheinen ließ. Vom Rand der Haube flossen fortwährend kleine Wolkenzüge nach der Westseite herab und verflatterten schnell; das nämliche schöne, aber nichts Gutes versprechende Spiel, wie wir es am obern Chimborazo erst angestaunt und dann schmerzlich zu fühlen bekommen hatten.

Zu unserer Rechten zog der Guagraialina-Volcan hochgewölbt und blockig einher. Nach einer Stunde kletterte unser Pfad an einer günstigen, sattelartigen Stelle über den Lavawall weg. Und da lohnte es sich wahrlich, eine kurze Umschau über dieses merkwürdige Gebilde der jüngsten vulkanischen Tätigkeit des Antisanakegels zu halten. Wie eine dunkelbraune, grüngefleckte Riesenschlange windet sich der Lavastrom von der mittlern Westseite des Antisana auf den leicht abfallenden unteren Berghängen herab. Wir sehen ihn oben (bei 4700 Meter) unter den Moränenhalden der Eisgrenze hervorkommen. Er ähnelt im Aussehen und in der Gestalt sehr dem Antisanilla-Volcan, aber er ist weder so lang noch so hoch noch so breit wie jener; seine Länge mißt etwa fünf Kilometer, seine Höhe in den mächtigsten Teilen 40 bis 50 Meter, seine Breite bis zu 500 Meter. Auch dieser[114] Volcan erscheint wulstförmig, dammartig, hat steile Seitenböschungen und eine unregelmäßig hügelige Oberfläche. In der Mittelachse seiner ganzen Längserstreckung ist er mehr oder weniger eingesunken, so daß er eine breite Rinne mit höheren Seitendämmen bildet. Die Entstehung ist klar: Während die Seitenteile des Lavastroms schnell erkaltet und erstarrt sind, ist die glühende Lava zwischen ihnen weitergeflossen. Allmählich erstarrte auch die ganze Oberfläche, und die Lava floß, immer zäher und träger werdend, wie in einem Tunnel weiter. Als dann der Inhalt des Tunnels ausgeflossen war, sank die Oberfläche des Tunnels ein.
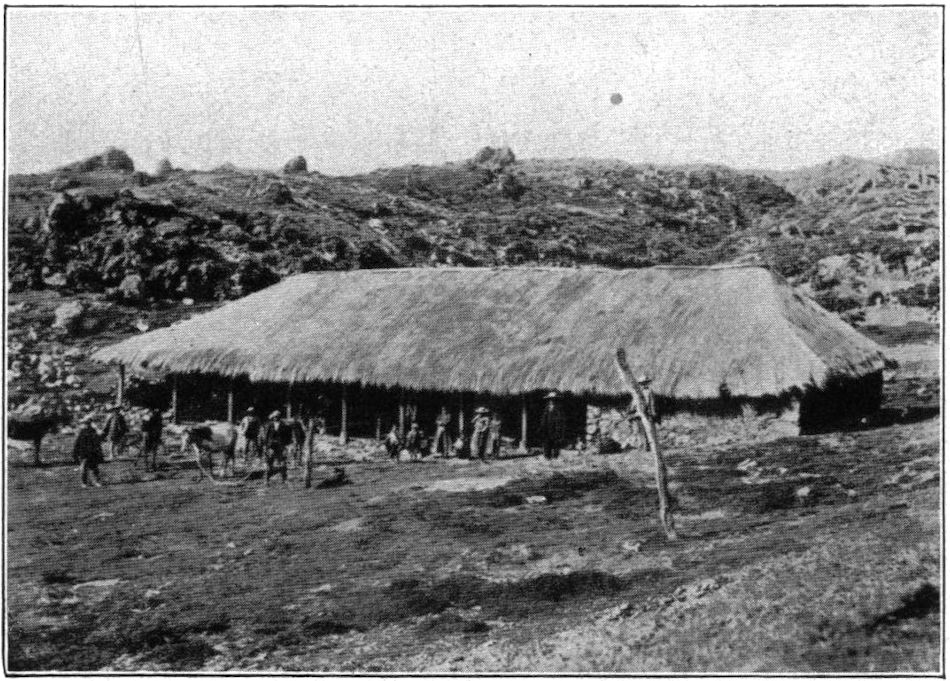
Der Guagraialina-Volcan ist aber nicht der einzige seiner Art am Antisana. Von seinem Rücken aus sehen wir am Südwesthang des Berges, nahe der Eisgrenze, ebenfalls unter dem hellgrauen Kranz von jungen Moränen einen zweiten, kürzern, aber im Endteil breitern Volcan herauskommen, der dem unsern in seiner ganzen Erscheinung gleicht. Seinen Namen Sarahuazi (Maisberg) führt er von den vielen gelblichen Bimssteinbröckchen, die an seinem obern Ende (4715 Meter) aufgeschichtet liegen.
Schließlich trifft nördlich von uns unser suchendes Auge auf einen dritten Lavastrom, den Yana-Volcan (yana = schwarz oder dunkelbraun), den höchstragenden von allen, der wie eine schwarze zackige, 50 bis 60 Meter hohe Mauer aus der Eisdecke des Antisana bei 5050 Meter heraustritt und das weiße Firnfeld durchschneidet, aber nahe unter der Eisgrenze mit etwa 300 Meter Breite endet. Er sieht noch frischer aus als der Guagraialina und hat noch mehr als dieser eine ausgeprägte Rinnenform.
Vom Ostfuß des Guagraialina eilten wir in einem breiten Bachtal dem Westgletscher des Antisana entgegen, der oben[115] in das Tal mündet. Links von der Gletscherzunge wurde auf den obersten Felsen des Guagraialina-Volcan unser in Aussicht genommener Lagerplatz sichtbar. Dorthin hatten wir eine alte grasbewachsene Ufermoräne des einst so viel längern Gletschers zu erklettern, die mit schönen Aufschlüssen bis zu etwa 4200 Meter Höhe herabreicht. Um ½11 Uhr waren wir nach längerm Stolpern und Steigen über Schlacken und Sande mit unseren Tieren auf dem obersten kleinen Grasfleck angelangt, wo im Schutz einiger großer Lavablöcke die Zeltchen aufgeschlagen wurden (4695 Meter). Ich schickte die Karawane nach dem Hato hinunter, von wo sie uns in zwei Tagen abholen sollte. Bei uns blieben Santiago und unser indianischer »Führer«, der aber nie vorher hier oben gewesen war.
Der Pflanzenwuchs dringt auf unserm Volcan in einer langen Zunge weit in die vegetationslose Zone der jungen Moränen vor, die rechts und links von unserm Lavadamm sich bergab erstrecken. Am ganzen westlichen Antisana rückt die Vegetation in ziemlich geschlossener Gras- und Staudendecke bis dicht an die Moränengrenze hinan. Es fehlt hier jener öde Gürtel von Bimssteinanhäufungen, der am Chimborazo und am Cotopaxi von der Moränengrenze an noch einige 100 Meter tiefer am Berg hinabreicht und dem Andrang des vegetabilen Lebens äußerst lange und zähe Widerstand leistet. Es fehlt aber auch, da die Schneegrenze des Antisana wegen seiner großen Feuchtigkeit verhältnismäßig tief liegt, jene sterile Zone von Gehängeschutt, die sich auf Bergen mit hochliegender Schneegrenze, wie dem Chimborazo, zwischen die Moränen und die Vegetationsgrenze aus klimatischen Gründen einschiebt. Auf unserm in die Eiswelt eindringenden Lavastrom, der wie eine schmale Halbinsel in ein[116] Polarmeer hineinragt, verschwinden mit zunehmender Höhe von etwa 4300 Meter an allmählich die höheren Gräser; die geselligen Kräuter überwiegen, aber kleine Gräser und Zwergsträucher sind noch zahlreich eingestreut. Von 4500 Meter an wird die Vegetationsdecke immer offener und dünner, aber noch am Rand der sterilen, den Oberteil des Volcans verschüttenden Moränen bei 4700 Meter ist das Wachstum so kräftig, daß man annehmen muß, diese Formation, die man wohl am besten als Fels- und Geröllformation bezeichnet, würde, wenn der Lavastrom noch 100 bis 200 Meter höher hinauf reichte, in langsamer Auflösung ebenso hoch hinaufgehen, ehe sie an den klimatischen Extremen ihre letzte Schranke findet. Nur die tiefliegende Eisgrenze des Antisana, nicht extreme Temperaturen oder extreme Trockenheitsgrade lassen hier die Vegetation nicht höher steigen.
Es ist eine prächtige Gletscherlandschaft, die unser Zeltlager in der Runde umgibt. Zum Berg hingewandt haben wir rechts von uns und über unserm Lavastrom die lange Eiszunge des Westgletschers, links einen höher am Berg endenden kürzern Eisstrom, beide auf mächtigen Moränenkegeln ruhend, und weiter das große Firnfeld, dessen weite Flächen sich zum Sattelkamm zwischen den beiden Antisanagipfeln hinanheben.
Während Herr Reschreiter ein farbiges Bild des Westgletschers zu malen begann und unser Cholo zwischen Felsblöcken eine Küche zurechtmachte, stieg ich mit Santiago, der allerlei tragen mußte, auf den Moränenhügeln zum Eis des Westgletschers empor. Dabei bemerkte ich etwa 50 Meter unterhalb des offenen Gletscherfußes an Wasserrissen, daß unter dem Schutt das pure Eis liegt. Auf dem rutschigen Schutt kamen wir in einer Stunde auf das Eisfeld selbst hinauf[117] (bei 4900 Meter), wo nach rechts und links der West- und der Guagraialinagletscher abzweigen; aber nördlich vom Guagraialinagletscher tritt nun noch ein anderer längerer Eisstrom hervor, der dort gegen den dunklen Yana-Volcan anströmt und von ihm in zwei wildbewegte Arme gespalten wird. Ich nenne ihn Yanagletscher. Die blauweißen Eismassen kontrastieren scharf mit dem dunkelbraunen Lavastrom, den sie umschließen. Trotzdem spricht sich in der langgezogenen, gewundenen Gestalt und in den schrundigen, zackigen Oberflächen beider eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem erstarrten Feuerstrom und dem erstarrten Wasserstrom aus. Aber das ganze Landschaftsbild sagt uns, daß die Erstarrung des Wasserstroms keine Bewegungslosigkeit ist. An geologischen Zeitmaßen gemessen, erscheinen die Firn- und Eisfelder des Antisana in ihrem großen Zusammenhang als ein bewegtes Meer, das gegen den breiten Küstensaum der Moränenzone anbrandet und ihn da und dort mit der mächtigen Spritzwelle einer Gletscherzunge überflutet. Auch dieses Meer hat seine Gezeiten, in denen es als Ganzes zurückweicht oder vordringt, aber ihre Dauer rechnet nach Tausenden von Jahren.
Diese Gletscher des westlichen Antisana sind nicht in Tälern eingezwängte Eisströme wie unsere alpinen, sondern Zipfel des großen, den Antisanakegel umhüllenden Eismantels, die da über den im ganzen gleichmäßig verlaufenden Saum des Mantels vorspringen, wo in kaum bemerkbaren Bodenvertiefungen das Eis mehr hindrängt als an anderen Stellen. Lange Gletscherzungen können sich nicht bilden, da wegen der Kegelgestalt der Berge das Zehrgebiet der Eisdecke breiter ist als das Nährgebiet. Es handelt sich also am Antisana um sogenannte »Firngletscher«.
Auf dem schneebedeckten Eisfeld über dem Westgletscher[118] wanderten wir wie im bequemen Spaziergang bergan. Es ist lauter Gletschereis, was wir unter den Füßen haben. Wohl ein Kilometer breit und fünf bis sechs Kilometer lang, bedeckt dieser untere Saum des großen Antisana-Eismantels die schwachgeneigten niederen Hänge des Berges. Bergaufwärts ist das Eisfeld anfangs ganz spaltenlos, geht dann aber mit dem Beginn der starken Steigung in große Eisbrüche über, die für den obern Antisana charakteristisch sind. Der Schneeüberzug unseres Eisfeldes war körnig und fest und trug vorzüglich. Weithin glänzte die Oberfläche von blankem »Eisfirnis«. Ich sah, daß wir am nächsten Tag anfangs leichtes Spiel haben würden. Das Nebeltreiben um die Gipfel beruhigte und lichtete sich zeitweilig, so daß ich photographieren und mit dem Fernglas die Firnfelder der Gipfelregion und des Sattelgrates inspizieren konnte. Da sah ich u. a., daß dort oben viele der dem Wind und der Sonne stark exponierten Firnkuppen und Hänge jene eigenartige, in zahllose Klippen und Zacken zerfressene Oberfläche (Nieve penitente, Büßerschnee, Zackenfirn) hatten, wie wir sie schon in den obersten Regionen des Chimborazo beobachtet hatten. Sie sind hier wie am Chimborazo auf die oberste Region von etwa 5400 Meter an beschränkt, wo der Wind, die Sonnenstrahlung, die Lufttrockenheit und die Verdunstung am stärksten und wo die durchlässige Firndecke am dicksten und noch am wenigsten fest vereist ist.
Von dem flachen Schneefeld, wo der Westgletscher abzweigt, stiegen wir auf die Zunge des Gletschers; sie ist von der Wurzel (etwa 4900 Meter) bis zum Ende (4580 Meter) etwa anderthalb Kilometer lang. Mit steilen, oft senkrechten Seitenwänden von 10 bis 15 Meter Höhe hebt sich die langgestreckte Eismasse über die Schutthalden, die[119] ihren Fuß bedecken. Der Gletscher schmiegt sich nicht wie unsere Alpengletscher mit flachgeböschter Oberfläche in sein konkaves Bett, sondern ragt dammartig daraus empor wie einer der oben geschilderten Lavaströme. Querspalten sind zahlreich, aber nicht tief und meist mit Schnee gefüllt. Je näher dem Zungenende, desto mehr zerklüftet und an den Seiten zerschmolzen ist der Gletscher, und schließlich löst er sich in ein großes Haufenwerk von Séracs und bizarr gestalteten Schmelztrümmern auf, unter denen der Eisfuß wie ein zäher Teig breit ausläuft.
Vor der Gletscherstirn (4580 Meter), die sich auf einem hohen Schuttkegel erhebt, liegen vier konzentrische Moränenbögen und bezeichnen vier Haltepunkte im Rückgang des Gletscherendes. Die unterste Grenze dieser jungen Endmoränen ist bei etwa 4500 Meter zu ziehen. Und darunter dehnt sich ein Rundhöckergebiet älterer Gletscherwirkung, deutlich erkennbar bis zu ungefähr 4200 Meter hinab und etwa 600 Meter breit, zum südlich benachbarten Lavastrom Sarahuazi hinüber aus.
Ins Lager zurückgekehrt, fanden wir zwei zufriedene Menschen vor: Herr Reschreiter war vergnügt, weil ihm seine Farbenskizze des Westgletschers vortrefflich gelungen war, und der Cholo schmunzelte, weil er einen delikaten Locro zustande gebracht hatte. Als wir den beiden Kunstwerken die gebührende Ehre angetan hatten, legten wir uns an den Felsen in die warme Sonne, schauten den Rauchwölkchen unserer Tabakspfeifen nach und dachten an weiter nichts als an die Schönheit der Welt. Den ganzen Tag war es auffallend windstill und warm gewesen. Nirgends auf unserer Reise in Hochecuador haben wir einen so windstillen Lagerplatz gehabt wie hier. Obwohl wir oben die vom[120] Ostwind getriebenen Wolken über den Firnsattel wie einen breiten Wasserfall herabgleiten und zerfließen sahen, spürten wir doch hier in 4700 Meter Höhe kaum einen Hauch. Wir waren im Windschatten des Berges. Erst spät am Nachmittag gewannen die aufsteigenden Luftströme die Oberhand, und mit ihnen zogen schwere Nebel von unten herauf und umwirbelten uns gegen Abend erst mit Graupeln und dann mit feinflockigem Schnee, so daß wir bald ein weißes Zeltlager hatten. In der Nacht klärte es sich auf, aber nun fegte der allnächtliche Fallwind stoßweise vom Berg herunter und drückte die Temperatur auf –2°.
Am Morgen waren die Zelte steif gefroren, der Schnee draußen hart. Aber die erhoffte Klarheit war mangelhaft. Der Berg hatte seinen üblichen großen runden Wolkenhelm und überschüttete uns schon wieder mit einzelnen Graupelböen. Im Westen hingegen, nach dem interandinen Hochland und seinen Vulkanbergen hin, war es herrlich klar. Dort präsentierte der Cotopaxi im rosaroten Morgensonnenglanz seine beschneite Nord- und Ostseite. Auf der Nordseite strecken einige lange Lavaströme ihre dunklen Grate bis zu etwa 5000 Meter Höhe in den Schneemantel hinauf, während auf der Ostseite der dort nur wenig gezackte Saum der Firn- und Eisdecke bis etwa 4400 Meter und stellenweise 4300 Meter herunterreicht. Ein feiner Puder von Neuschnee lag auf der Ostseite des Cotopaxi bis zu etwa 4000 Meter herab; auf den Osthängen des Sincholagua ungefähr ebenso tief, aber auf denen des Rumiñagui, des Corazon und des Iliniza, die schon nahe an oder auf der Westkordillere stehen, beträchtlich höher.
Während es bei uns leise weitergraupelte, setzte ich mich nach 7 Uhr mit Herrn Reschreiter und Santiago bergauf in[121] Bewegung. Sobald wir aus unserm Felsenschutz heraus waren, überfiel uns gleich der pfeifende, eisige Wind und der uns entgegenstiebende körnige Neuschnee. Um 8 Uhr waren wir über die Moränen weg an der Eisgrenze bei 4900 Meter Höhe, und nun ging es mit dem Seil auf dem festgefrorenen Schneefeld flott bergan. Das ganze Firnfeld schien gegen uns in Bewegung zu sein: in Tausenden von kleinen Strömen floß der windgetriebene Hochschnee auf uns zu. Noch legten sich uns keine Spalten in den Weg, und noch hatten uns die vom Mittelgrat herabflutenden Wolken nicht erreicht. Aber nach einer Stunde begannen mit der stärkern Steigung des Berghanges die Spalten bei 5100 Meter Höhe. Da sie großenteils mit Neuschnee verweht waren, hieß es vorsichtig sein. Herr Reschreiter, der hier als vorderster am Seil ging, sondierte mit dem Pickel Schritt für Schritt, aber plötzlich brach er durch und saß bis an die Brust in einem Loch, während sein Unterkörper frei über der Tiefe hing. Glücklicherweise fand er für seine Fußspitze einen Stützpunkt in der Spaltenwand. Behutsam verankerte er sich seitwärts mit dem Pickel im festen Eis, langsam drehte er sich auf die Seite, langsam zogen wir mit gegengestemmten Pickeln am straffen Seil, und nach ein paar Sekunden konzentrierter Kraftanspannung standen wir wieder beieinander.
Nun ward von uns noch vorsichtiger, noch langsamer vorgegangen. Wir hielten die Richtung auf einen großen Eisturm nahe unter dem Sattel zu, von wo ein Traversieren durch das Klüftegewirr ostwärts zum Kamm hinauf möglich erschien. Der Schnee war nun, als wir in die Region der jagenden Wolken kamen, oft zu brett- oder schindelartigen, ein bis zwei Finger dicken, flachliegenden Wehen[122] angeblasen, die aber ganz gut gangbar waren. Spalte nach Spalte wurde überschritten oder übersprungen oder umgangen. So oft die Luft etwas klarer wurde, machte ich eine photographische Aufnahme mit der Handkamera. Gegen 11 Uhr standen wir mitten in dem großartigsten Eisgeklüfte. Rechts und links und vor uns klafften dunkle Schlünde und starrten Wände und Türme und Zinnen von 20 bis 35 Meter Höhe empor, alles um so phantastischer, als es, von Nebeln mehr und mehr umweht, gespenstig da und dort plötzlich auftauchte und wieder verschwand. In den Spalten schimmerte das Eis je nach der Dichte und Beleuchtung hellblau und meergrün und in größerer Tiefe ultramarin und braunviolett.
In vielen Windungen die Séracs und Spalten umgehend oder auf vereisten Schneebrücken überschreitend, gelangten wir allmählich in das Niveau des großen Eisturms, der uns von Anfang an die Richtung gewiesen hatte; aber der Firnhang wurde immer steiler und schwieriger, der Wind immer wütender, der Nebel immer dichter, das Schneestieben immer toller. Trotz der schweren Arbeit fühlte keiner von uns besondere, aus der Bergeshöhe resultierende Beschwerden. Santiago, der sich mit Tüchern wie ein altes Bauernweib eingebunden hatte, wimmerte bisweilen ein wenig, aber er hielt aus. Unsere dicken Schneehauben bewährten sich wieder vortrefflich. Darüber aber waren wir von Schnee und Eis inkrustiert wie der berühmte Eispeter im Bilderbuch von Wilhelm Busch. Endlich betraten wir einen ziemlich breiten Firnrücken vor einem Steilabsturz; unter uns ein graues, düsteres Nebelchaos. Das war die Caldera des Antisana und unser Standpunkt der Sattel zwischen den beiden Gipfeln (5505 Meter). Zu sehen war aber hier so gut wie nichts. Nur das stand fest, daß wir bei dem Wetter[123] nicht daran denken konnten, über die Klüfte und Wände, die uns noch vom Hauptgipfel trennten, wegzukommen. Der erste Versuch, den ich machte, führte uns gleich an einen Schrund von über 20 Meter Breite und unsichtbarer Tiefe, so daß wir ohne langes Zögern umkehrten.
Von unseren heraufführenden Spuren war schon nahe unter dem Sattel nichts mehr zu erkennen. Der Wind hatte sie weggefegt oder mit Kornschnee ausgeglättet. Wir begannen daher nach dem Kompaß und nach der Erinnerung eine »ice-navigation« – wie es Whymper nennt –, die im Nebel und Sturm verteufelt heikel war und unsere Aufmerksamkeit auf das höchste anspannte. Aber glücklich wandten wir uns wieder zwischen den bösartigen Spalten durch und erreichten nach einer Stunde unterhalb der Bruchregion das große Firnfeld, wo wir in flottem Tempo ausgreifen konnten. Der Schnee fiel aber jetzt auch hier so dicht, daß eine Orientierung nach außen unmöglich war. Es entstand erst eine Meinungsverschiedenheit über die einzuschlagende Richtung, doch ich bestand auf strengstes Befolgen meines Kompasses, dessen Weisungen ich schon beim Aufstieg öfters notiert hatte, und in dieser Richtung steuernd, landeten wir um 2 Uhr richtig an derselben Stelle, wo wir am Morgen das Eis betreten hatten. Des Seiles ledig, eilten wir nun hurtig über die Moränenhalden hinab und standen bald, immer noch von etwas Schnee, von Regen und von Wind begleitet, wieder bei unseren Zelten. Die triefnassen Wettermäntel flogen herunter, und unser enges, aber stets von neuem gebenedeites Bergheim nahm uns wieder auf.
Im stillen Zeltchen Tee trinkend, gerösteten heißen Mais kauend und Cigarillos rauchend, warteten wir in Geduld,[124] bis uns der Verabredung gemäß unsere Arrieros mit den Mulas abholten. Trotz des nichtsnutzigen Wetters kamen die Braven mit nur wenig Verspätung um Mitte des Nachmittages an. Die beiden Männer waren ganz friedlichen, freundlichen Sinnes, obgleich sie wieder einmal stundenlang mit ihren Bastsandalen im schneeigen Schlick patschen mußten. Diese heitere Seelenstimmung war, wie ich schnell merkte, durch gründliche Imprägnierung mit Chichaschnaps hervorgerufen. Weniger vergnügt waren die »Bestias« über das Wetter. Das hatte aber das Gute, daß sie mit uns unaufhaltsam freundlicheren Gefilden am Bergesfuß zudrängten und auf dem Pfad der Páramos von selbst einen Trab anschlugen, der uns noch vor Dunkelwerden zum Hato Antisana zurückbrachte. Schneidender Ostwind und strömender Regen verfolgten uns bis unter das schützende Dach. Der Antisana hatte es offenbar darauf abgesehen, sich uns auch einmal in seiner ganzen, als »brava« verschrieenen Abscheulichkeit zu zeigen und uns für unsere Frechheit, daß wir seinen Rücken betreten hatten, einen gründlichen Denkzettel zu verabreichen.
Am nächsten Morgen stand der Berg wieder mit seinem großen weißen Wolkenhut vor uns wie am Morgen vorher. Gern hätte ich noch einen oder zwei Tage drangewandt, um die nordwestliche lange Gletscherzunge am Yana-Volcan oder die Eisverhältnisse auf der Südseite zu untersuchen, aber unsere Zeit war auf das knappste bemessen. Ich mußte mich deshalb, während die Karawane sich zur Rückreise rüstete, mit einem kurzen Vorstoß zum Südfuß des Antisana hin begnügen, um von den dortigen Zuständen etwas mehr zu sehen, als es vom Hügel am Hato aus möglich war. Jenseits des Guamanihügels erreichte ich bald eine zweite[125] Bodenschwelle, die eine ziemlich freie Übersicht über die Südwestseite des Berges gewährte.
Ich sah nun den Sarahuazi-Volcan östlich vom Westgletscher unter den Moränenhalden hervorkommen und in ein breites niedriges Hügelland auseinanderlaufen, und ich sah östlich davon die Eisgrenze des Antisana sich leicht zum Südfuß des Berges senken, wo mit einem mächtigen vorspringenden Felssporn die riesigen Felswände des Südgipfels beginnen. Ich sah aber auch, daß dort die Felswände zu einem großen amphitheatralisch in den Bergkörper hineingewölbten Kar abfallen, das die charakteristische Lehnsesselform und einen ebenen Boden hat. Cuchu ist die indianische Bezeichnung für diese typische Talform, die immer ein Merkmal einstiger stärkerer Gletscherwirkung ist. Das vor uns liegende heißt Corral-cuchu, weil die Hirten des Hato dort einen Viehzaun (corral) haben. Ein noch größeres Kar von ganz ähnlicher Gestalt liegt südöstlich daneben; es ist das San Simon-cuchu. Beide Karböden gehen weiter draußen in enge Bachtäler über, durch welche die Gletscherwasser abfließen. In jedem der beiden Kare liegt ein breiter, kurzer, steiler Gletscher mit großen Spalten und Stufenbrüchen.
Zum Hato del Antisana gegen 9 Uhr zurückgekehrt, fand ich die Karawane reisefertig. Sofort setzten wir uns zum Rückmarsch in Bewegung, der uns an diesem Tag über Pinantura hinaus bis zur Hacienda Rosario in der Quitomulde bringen sollte. Ich schlug aber diesmal bis zum Antisanilla-Volcan einen etwas südlichern Pfad ein als auf der Herreise, der sich als etwas kürzer erwies. Dabei passierten wir im Anfang eine breite, flache Bachmulde, in der sich Scharen scheuer Rinder tummelten und Schwärme von ibisartigen, krummschnäbeligen Vögeln schreiend umherflogen.[126] Es ist der von den Einheimischen »Bandurria« (Thersiticus caudatus) genannte Vogel, ein möwengroßes, dunkelgraues Tier mit weißen Bändern über den Flügeln, das der Ostkordillere, namentlich dem Antisana, eigentümlich ist und mit seinem Schnepfenschnabel in den Sümpfen der Páramos nach Nahrung wühlt, aber auch im Mist der Rinderherden nach freßbarem Inhalt sucht.
An der Quebrada Puyurima bekamen wir einen guten Ausblick auf die Ost- und Nordseite des Sincholagua. Ganz langsam hebt sich von uns aus die braungraue Páramofläche 10 Kilometer zur breiten Felspyramide dieses alten Vulkanes hin, ein Landschaftsbild von trister Einförmigkeit und Leblosigkeit. Droben schimmern Schneeflecken auf den Wänden. Die steile, lange Ostwand hat keine Gletscher, aber auf der Nordseite hängt zwischen den beiden felsigen Gipfeln nahe dem Nordgipfel ein kleiner Steilgletscher in die weite, nach Norden offene und einem großen Kar gleichende Caldera hinab, deren obere rechte Hälfte der Länge nach ausfüllend. Rechts und links von seiner Stirn ziehen je zwei parallele Ufermoränen bis zum Kargrund in etwa 4200 Meter Höhe, wo eine dreistufige Endmoräne die jüngeren Glazialbildungen abschließt.
Der Quebrada Puyurima folgend und weiter wieder am Lavastrom von Antisanilla entlang reitend, trafen wir vor Mitte des Nachmittags in der Hacienda Pinantura ein, kreuzten wieder die Quebrada Guapál, die jetzt bei vollem Tageslicht nicht mehr die Schrecken hatte wie auf dem Nachtmarsch der Herreise, und eilten jenseits durch die Tuff- und Lößschluchten nach Pintac hinab, von wo wir gegen Abend in der Hacienda Rosario zum Nachtquartier anlangten.
[127]
Am Abend setzte die untergehende Sonne den ganzen Himmel in Flammen, als ob sie noch im Erlöschen einen Weltenbrand entzünden wollte. Vor der glühenden gelb-rot-violetten Dämmerungslohe standen im Westen die schon nächtlich schwarzen Silhouetten der langgestreckten Vulkane Pichincha, Atacatzo und Corazon, während über ihnen dunkle, goldgesäumte Wolkenbänke, an der Oberseite zu ungeheueren Höhen aufgetürmt, an der Unterseite wagerecht abgeschnitten und seitlich durch lange Ausläufer miteinander zu einem Ganzen verbunden, noch ein Gebirge über dem Gebirge, ein himmlisches über dem irdischen, ins Dasein zu rufen schienen. In diesem Lande der großen Monotonie, der Einförmigkeit der Linien und Flächen, der Eintönigkeit der Farben und Stimmungen, scheint der Himmel mit seiner abendlichen und frühmorgendlichen Farbenpracht dem Landschaftsbild die Schönheitsreize verleihen zu wollen, die ihm die Erde versagt hat. Wir standen stumm in Anschauen versunken, bis die Nacht dem zauberischen Schauspiel ein Ende machte.
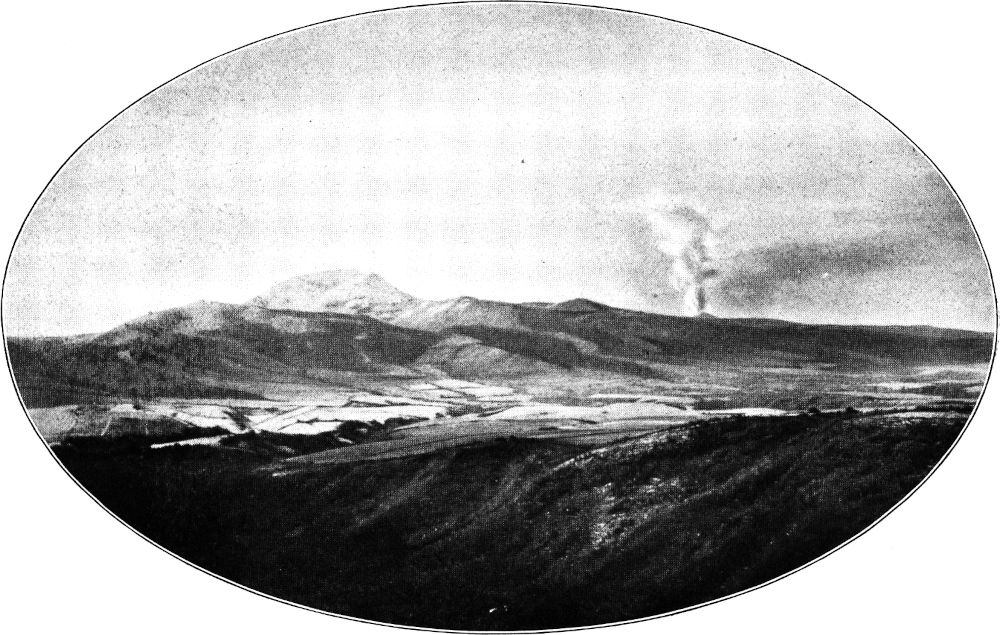
Am Morgen regnete es in Strömen. Aber je weiter wir aus dem Bereich der nassen Ostkordillere nach Westen kamen, desto heller wurde es; die Westkordillere lag in schönster Klarheit. Von der Höhe des Poingasi-Rückens warfen wir einen Abschiedsblick auf die durcheilte weite Quitomulde und stiegen dann, ihr den Rücken wendend, vom Tuffrücken des Poingasi westwärts nach Quito hinab, das in lethargischer Ruhe und Stille unter uns lag. Um 7 Uhr waren wir von der Hacienda Rosario weggeritten, nach 12 Uhr zogen wir wieder in die Hauptstadt ein.

[128]
Von allen Schneebergen Ecuadors hat von jeher keiner so sehr das Interesse der Ecuatorianer selbst erregt wie der Cotopaxi. Das verdankt er seiner Lage, seiner Gestalt und seiner vulkanischen Tätigkeit. Einer die Ost- mit der Westkordillere verbindenden Vulkanreihe (Quilindaña-Cotopaxi-Rumiñagui-Corazon) angehörend, ist er so weit in die interandine Hochebene vorgeschoben, daß er vom Norden und Süden des Hochlands gut zu sehen ist. Wo wir auch im Hochlande reisten, fast überall trat, sobald sich die Fernsicht öffnete, der wundervolle weiße Riesenkegel des Cotopaxi aus den Wolken hervor, einzig in seiner Art, nie zu verwechseln mit einem der anderen großen Schneehäupter, der majestätische Zentralvulkan von Hochecuador. Ganz frei vom Fußpunkt bis zum Gipfel, ohne Vorberge und Zwischenstufen, präsentiert er sich auf der Westseite, und dort zieht stundenlang über seine Basisebene die einzige große Verkehrsstraße des Hochlands hin, von Latacunga nach Quito, auf der jährlich viele Tausende im vollen Angesicht des Berges von Norden nach Süden oder umgekehrt wandern.
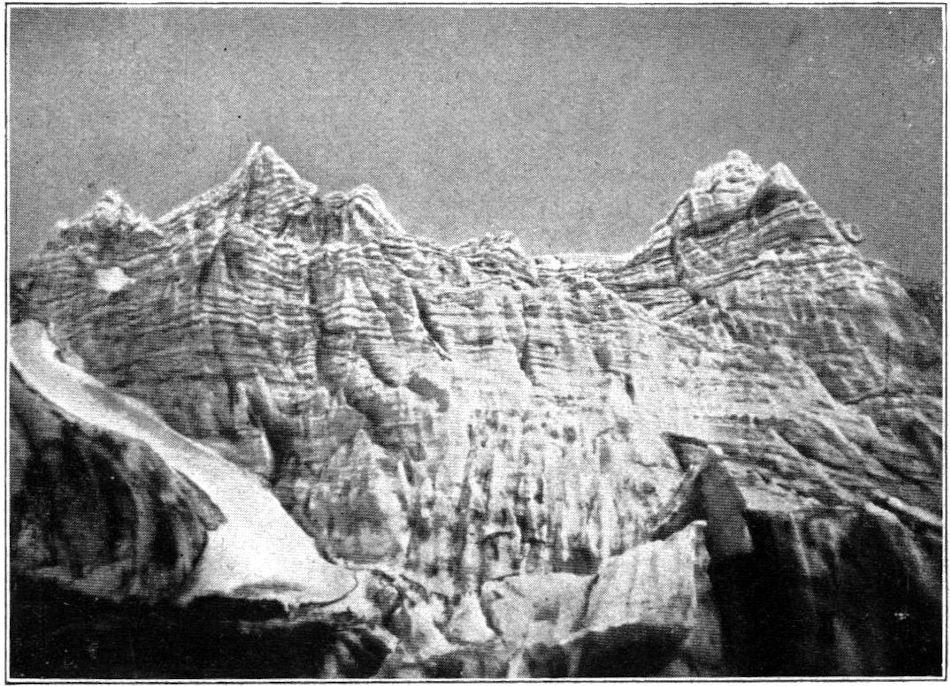
Den Cotopaxi kennen die Hochlandsbewohner alle, während sie über die anderen Bergerscheinungen sehr oft im ungewissen sind. Für die gewaltige Größe und Schönheit dieser[129] Berggestalt sind sogar die für Natureindrücke so stumpfen Ecuatorianer empfänglich: »hecho como al torno« (wie auf der Drehbank gemacht), sagten vom Cotopaxi schon zu Humboldt die Eingeborenen bewundernd. Freilich, bei solcher gelegentlichen Bewunderung aus der Ferne ist es immer geblieben. Nur wenige Ecuatorianer haben die Schneeregion des Berges betreten, und diese wenigen immer nur in Begleitung von europäischen Reisenden. Gewöhnlich waren es indianische Träger, die es um des klingenden Lohnes willen taten. Von den »Gebildeten« des Landes, die sich mehr aus Neugierde oder Eitelkeit als aus ernstem Wissens- oder Tatendrang einem der europäischen Forscher angeschlossen haben, ist erst ein einziger (A. Sandoval mit Theodor Wolf) zum Gipfel gelangt, weil weder ihre physische Kraft noch ihr Mut noch ihre Energie ausreichten.
[130]
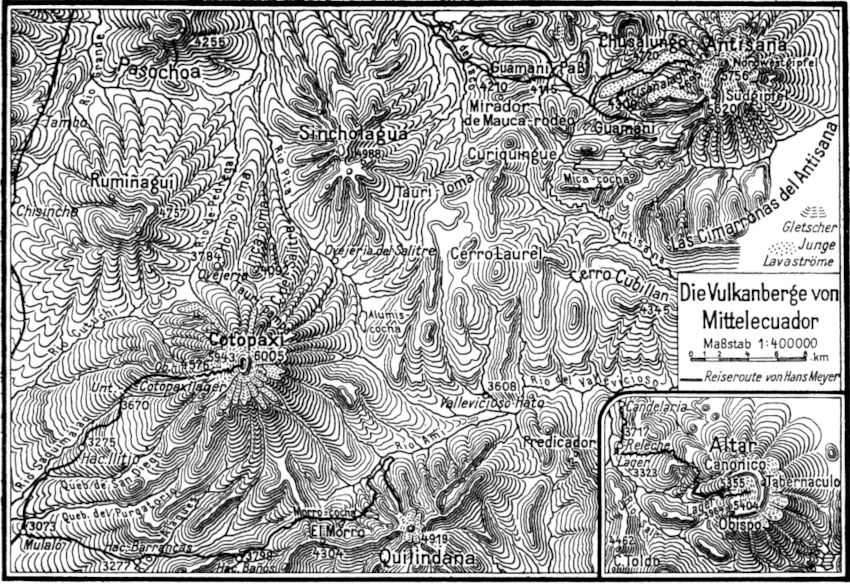
Der Cotopaxi erhebt sich zu seiner 6005 Meter messenden Höhe (mit der mächtigen Firnhaube des Jahres 1903) aus der etwa 3000 Meter hohen Ebene des Rio Cutuchi im Westen, während auf den anderen Seiten sein Fuß auf dem Vorland in 3700 bis 3800 Meter Höhe steht. Auf der höchsten, der Westseite, gemessen, ragt sein Haupt also nur etwa 3000 Meter über seine Hochebenenbasis empor; er gehört somit nach seiner relativen Höhe als Bergindividuum trotz seiner rund 6000 Meter betragenden Gipfelhöhe nicht zu den Riesen seines vulkanischen Geschlechts, unter denen zum Beispiel der Kilimandjaro von einer etwa 700 Meter hohen Ebene zu 6010 Meter emporsteigt, also eine relative Höhe von rund 5300 Meter hat. Aber kein anderer aktiver Vulkan der Welt hat eine größere absolute Höhe als der Cotopaxi. Über seine Umgebung erhebt[131] er sich gleich der Zitadelle eines gewaltigen Festungsvierecks, dessen vorgeschobene Werke die kleineren Nachbarvulkane Rumiñagui, Pasochoa und Sincholagua sind.
Dem Anblick der großen Zahl seiner Beschauer entrückt und am wenigsten bekannt ist die Ostseite des Berges. Sie ist die steilste und kürzeste Seite, da ihre Basis schon bei 3800 Meter dem vor- und untergelagerten Fußgebirge aufsitzt. So große Aschenfelder wie auf den anderen Seiten des Berges gibt es hier nicht, denn die vorherrschenden östlichen Winde tragen die leichten Auswürflinge des Gipfelkraters nach Westen. Aber um so gewaltiger ist im Osten die Überflutung von Lavaströmen, da der östliche Kraterrand etwas eingeschartet ist und die flüssige Glut am ersten übertreten läßt. In neuerer historischer Zeit hatten sich die Laven mehr nach der Westseite ergossen, aber gerade dadurch ist jetzt der Westrand des Kraters wieder höher geworden als der Ostrand. Nicht nur die Lavaströme haben die Hänge der Ostseite wild zerrissen und, am Abhang erkaltend, ohne den Bergfuß selbst zu erreichen, zahllose Stufen und Dämme aufgebaut, sondern auch die von den plötzlichen Schneeschmelzen herabgesandten Wasser- und Schlammströme haben diese Bergseite tief gefurcht und ihre großen Massen von Gesteinstrümmern ostwärts in das weite Hochtal »Valle vicioso« gewälzt. Aber nur in den unteren Teilen der Osthänge treten diese Zerstörungen und Neubildungen zutage; in den oberen größeren Partien umhüllt den Kegel jetzt ein mächtiger Firn- und Eismantel, dessen Randgletscher hier infolge der von Osten kommenden starken atmosphärischen Niederschläge sich weiter bergab (bis etwa 4300 Meter) ausdehnen als auf den anderen Seiten. Der Firnmantel ist aber in der Mitte seiner ganzen Vertikallänge etwas[132] eingebogen und verdeckt dort mit Eis und Schnee die breite steile Bahn, die von den über den Kraterrand quellenden und am jähen Berghang abstürzenden Lavamassen im Massiv des Kegels ausgefahren ist. Frühere Besteiger haben diese Formation auf der Ost- wie auf der Westseite ohne Schneebedeckung gesehen.
Weniger tief als auf der Ostseite reicht auf der Südseite die Firn- und Eisdecke herab. Sie endet in ungefähr 4650 Meter Höhe am Fuß der Felsmasse »Picacho«, die schroff, verwittert, ruinenhaft aus dem Südhang des Berges hervorragt und ein vereinzeltes Überbleibsel des ältern, vom Cotopaxi verschütteten vulkanischen Fußgebirges ist. Sie hat zum Cotopaxi dasselbe Verhältnis wie die Somma zum Vesuv. Auch von jüngeren Lavaströmen, Schlammströmen, Wasserrissen bemerkt man auf der südlichen Bergseite relativ wenig, da der hochgewölbte südliche Kraterrand seit langem ein Überfluten der Laven nach Süden verhindert hat. Flach läuft der Südfuß bei 3700 Meter in die südlichen, schildförmigen, älteren Vorberge aus, die, von jüngerer Asche bedeckt, sich unabsehbar nach Süden dehnen.
Auch auf der entgegengesetzten, der Nordseite, steht der Fuß des Cotopaxi in etwa 3700 Meter Höhe auf dem ältern Grundgebirge. Dorthin aber in den weiten Binnenraum zwischen ihm selbst und seinen drei kleineren Nachbarn Rumiñagui, Pasochoa und Sincholagua hat der große Vulkan ungeheuere Ausbruchmassen, Lavaströme, Schlammfluten und Aschenregen, entsandt; und über dieser Wildnis thront der höchste Gipfel des Berges, die schneeige runde Nordkuppe, von der aus sich der weite Firnmantel bis zu 4700 Meter herabsenkt. Wegen dieser hohen Gipfelkuppe und weil man hier den elliptischen Kraterrand von der[133] Schmalseite sieht, hat die Nordseite des Berges die ausgeprägteste Kegelform, während auf der Westseite, wo sich der elliptische Kraterrand in der Längsansicht zeigt und keinen hochragenden Gipfel trägt, der Kegel stark abgestumpft und breiter erscheint.
Am gleichmäßigsten in seiner Ausdehnung und Begrenzung legt sich der Schneemantel um die Westseite des Berges. Bis zu durchschnittlich 4700 Meter breitet er sich hier bergab aus, wird in der Mitte oben bloß von zwei dunklen Felsflecken durchbrochen und ist am Rande nur von wenigen einspringenden Lavawällen und vorspringenden ganz kurzen Gletscherzungen gesäumt. Darunter aber sinken die dunklen Berghänge noch weitere 1700 Meter bis zu seiner Basis ab, die hier auf der Westseite nicht wie auf den anderen Seiten ein bergiges, ödes Vor- und Unterland ist, sondern die interandine Hochebene selbst, durch die sich gemächlich der Cutuchifluß windet, und von deren Wiesen, Feldern, Gehöften und Dörfern sich einzelne Ausläufer zu dem großen Vulkan vorschieben wie Vorposten gegen den Feind. Seine Feindschaft gegen alles Lebendige offenbart sich gerade auf dieser Westseite furchtbar durch die Aschenfälle und Schlammströme, die er weit über das Kulturland entsandt hat. Und wie ein unablässig mahnendes Warnungssignal flattert in kurzen Intervallen am Gipfel eine kleine weiße Fahne von Kraterdämpfen. Aber gerade dieses harte Nebeneinander von Lebensdrang und Todesgefahr macht den Anblick des Berges von der Westseite so eindrucksvoll. Und dazu zeigt er sich von keiner andern Seite dem Beschauer so breit, so groß, so ebenmäßig in seinem Aufbau wie von dieser, von der ihn weitaus die meisten Menschen des Hochlandes sehen.
Von Westen gesehen, hat der Cotopaxi keinen andern[134] großen Berg als Nebenbuhler neben sich. Auf keiner andern Seite holt die wundervolle vulkanische Kurve seines Profils, deren Schönheit uns auch auf den anderen Seiten begeistert, so weit aus wie auf dieser. Der kraftvolle Nachdruck dieser Kurvenführung liegt in dem letzten obersten Schwung, wie in einem titanischen, von der Erde zum Himmel geführten Hieb. Unwiderstehlich zieht diese Bogenlinie den Blick zuerst nach oben. Dann gleitet er mit den abwärts führenden Firnrinnen, Lavaströmen und Wasserrissen langsam zum Bergesfuß zurück, wo die große Kurve ganz sanft in die Horizontale der Basisebene ausklingt. »Bergschleppe« nennen die Japaner in treffendem Vergleich bei ihren Vulkanen den unmerklichen Übergang des untern Berghangs in die horizontale Richtung. In diesem breiten festen Aufruhen auf seinem Fundament empfinden und erkennen wir ein weiteres Element seiner Größe. Es ist nicht wie am Ätna, wo der Eindruck der Breite über den der Höhe überwiegt, sondern die Höhenwirkung dominiert am Cotopaxi entschieden. Aber wie am Ätna und ähnlichen Vulkanen sagt uns zugleich dieses breite Auslaufen seines Sockels, daß dieser Berg nicht durch hebende Kräfte erbaut ist, sondern durch die von oben herabfließenden Lavaströme und Aschenregen, deren Massen immer mehr abnehmen müssen, je weiter sie sich vom zentralen Ausbruchspunkt entfernen.
Diesen eigenartigen bauenden Kräften verdankt der Cotopaxi seinen Stil. Seine Form verrät zugleich seinen Bau und seine Jugend. Er ist, aus einiger Entfernung gesehen, ein Vulkankegel von architektonischer Symmetrie. Auch die Schar von kleinen parasitären Eruptionskegeln fehlt ihm, wie sie zum Beispiel den Kilimandjaro umringen und ihm teilweise aufsitzen. Deshalb ist eine große Ruhe und eine ruhige[135] Größe in der Erscheinung des Cotopaxi, die durch den riesigen, gleichmäßigen, drei Viertel der Bergeshöhe umschließenden Schnee- und Eispanzer noch mehr gesteigert wird. Daß die symmetrische Gestalt nicht starr wirkt, verhindert das lebendige Spiel der Wolken, des Lichtes, der Farbe und die bewegte Umfassungslinie der Pflanzen- und Schneedecke. Dabei überlegen wir, daß die kolossale absolute Höhe dieses Berges von rund 6000 Meter noch längst nicht erreicht würde, wenn wir den Ätna und den Vesuv und den Stromboli übereinanderstellen könnten. Wir ahnen die große Ursache, die dieser Erscheinung zugrunde liegt; die Vorstellung von den ungeheuren vulkanischen Kräften, die diesen ebenmäßigen Riesenbau errichtet haben, flößt uns das Gefühl des Erhabenen ein und löst in uns neben den ästhetischen auch ethische Geistesregungen höherer Ordnung aus.
Die Versuche, den Gipfel dieses höchsten tätigen Vulkans der Erde zu besteigen, beginnen mit Alexander von Humboldt. Seinem im Mai 1802 unternommenen Versuch folgten Boussingault und Hall im Dezember 1831, der deutsche Reisende Moriz Wagner im Dezember 1858, aber erreicht wurde der Gipfel von Santa Ana am Westfuß aus erst am 27. November 1872 durch Wilhelm Reiß. Seinem Reisegefährten Alphons Stübel glückte der Versuch wenige Monate später ebenfalls. Vier Jahre danach, nur ein Vierteljahr nach dem furchtbaren Ausbruch vom 26. Juni 1877, nahm der an der Universität Quito als Geolog tätige Deutsche Theodor Wolf den Berg abermals in Angriff und erreichte den Krater auf einer neuen Route im September 1877, wobei auch die höchste Spitze des Kraterrandes, der Nordgipfel, zum ersten Male betreten wurde. Auf der gleichen Route hatte der spätere deutsche Staatssekretär des Reichsschatzamtes,[136] Freiherr von Thielmann, im Januar 1878 Erfolg. Der Klassiker des Alpinismus, Edward Whymper, hat den Berg, den Wolf-Thielmannschen Spuren folgend, mit Schweizer Führern gleichfalls bezwungen. Das war im Februar 1880; seitdem hatte bis auf meine Zeit keines Menschen Auge wieder den Krater gesehen.
Das Wetter war regnerisch und nebelig, als wir am 11. Juli 1903 von Latacunga nach dem Dorf Mulaló am Südwestfuß des Cotopaxi ritten; meist über ebenes Terrain. Zuerst ging es an braunwässerigen eiligen Bächen zwischen ummauerten Gärten und Feldern entlang, dann über das breite, flache Schwemmtal des vom Cotopaxi kommenden Rio Aláques, wo uns die ungeheuren Massen von Geröll, Kies und großen Blöcken, die der Fluß zu beiden Seiten seines jetzigen Bettes ausgebreitet hat, zum erstenmal einen Begriff von der furchtbaren Wirkung der Schlammströme geben, die der Berg bei Eruptionen durch seine Schmelzwasser entsendet. Über 4 Meter hoch liegen hier noch die Schottermassen der Eruption des Jahres 1877.
Den Verlauf dieser »Avenida« (Schlammstrom) vom 26. Juni 177 schildert recht anschaulich Wilhelm Reiß: »Mit dumpfem Brausen, fast mit fernem donnerähnlichen Getöse wälzen sich die mit vulkanischer Asche, Gesteinstrümmern, glühenden Lavablöcken und großen Eismassen vermischten Gewässer am Abhang herab. An den unteren Gehängen drängen sie sich in den dort eingeschnittenen Schluchten zusammen, dieselben bis zu Höhen von 60 bis 100 Meter erfüllend, über die Seitenwände sich ergießend und auf den Abhängen Schutthügel[137] bis zu 20 und 30 Meter Höhe absetzend. Am Fuß des Berges aber, wo die Wasserläufe nur wenig eingeschnitten sind, überschreiten sie die Talbetten und dehnen sich als wilde Schlammfluten über das Land aus, alles vernichtend und zerstörend. Häuser, Haciendas, Fabriken, Menschen und Vieh mit sich fortreißend, bildeten 1877 die Schlammfluten zwischen Mulaló und Latacunga einen weiten See von ungefähr 28 Kilometer Länge und 1,6 Kilometer Breite, in dessen ganzer Ausdehnung das Land nach Ablauf der Gewässer etwa ein Meter hoch mit Schlamm, Schutt und Detritus bedeckt war. Alle Straßen wurden zerstört, alle Brücken weggerissen; in der Umgegend von Latacunga berechnete man den Verlust an Menschenleben auf etwa 300 Personen, obgleich der Ausbruch bei Tage erfolgte und viele sich retten konnten. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Meter in der Sekunde (!) brausten die Fluten dahin. Drei Stunden nach seinem Eintreffen in Mulaló zerstörte der Schlammstrom bereits die 15 geographische Meilen entfernte Brücke über den Rio Pastaza am Fuß des Tunguragua; er erhob sich dort 100 Meter hoch in dem 12 Meter breiten Flußbett. Ähnlich einem Lavastrom, seitlich wie von einer Mauer oder einem hohen Damm begrenzt, bewegten sich die Schlammassen vorwärts; sie überstürzten sich wie hohe Wellen, die sich fortwährend nach vorn überschlugen.«
Auf einer wegen der Unsicherheit des Flusses immer interimistischen Brücke von Balken, Rohrgeflecht und Kiesbewurf setzten wir über den 12 Meter breiten Aláquesfluß, folgten jenseits dem Ostrand der interandinen Hochebene, die hier sumpfig und binsenbewachsen ist wie ein alter Seeboden, und stiegen dann gemächlich durch etwas reichlicher bebautes Land zum Dörfchen Mulaló (3073 Meter)[138] an, das mit seiner kleinen Kirche und seinen 20 bis 30 Häusern auf einem niedrigen Hügel liegt, wodurch es bisher von der Zerstörung durch die Schlammströme des Cotopaxi bewahrt geblieben ist, die dicht daneben das Land überschwemmt und verwüstet haben. Aber die Aschenregen und Steinbombardements seines furchtbaren Nachbars Cotopaxi haben den Ort ebenso getroffen wie die übrige Umgebung, am verderblichsten wohl im April 1768, wo die Häuser durch die glühenden Schlacken in Brand gesetzt, elf Personen durch vulkanische Bomben erschlagen wurden und wo der Aschenregen eine anderthalb Fuß dicke tödliche Schicht auf die Gegend legte. Die Ruine der damals zerstörten alten Kirche steht noch neben der neuen. Im Haus des freundlichen »Padre Cura« (des Pfarrers) stiegen wir ab.
Der Aufforderung des Pfarrers folgend, meldeten sich am Morgen nach unserer Ankunft eine größere Zahl Peones zu unserer Begleitung, als wir brauchten. Die engere Auswahl traf der Vater des Priesters. Der alte Herr machte mit den Leuten kurzen Prozeß. Er bestimmte einfach die kräftigsten zum Mitgehen, und als einer von ihnen einen Einwand erhob, schrie er ihn wütend an, entriß ihm den langen Stock, den die Peones zu tragen pflegen, und hieb ihm damit über den dicken Filzhut, daß es krachte und stäubte. Die Logik dieses Verfahrens war zwingend; in fünf Minuten waren wir handelseinig.
Vom Cotopaxi bekamen wir auch hier nichts weiter zu sehen als die untere Region bis zur Grenze des ewigen Schnees (bei 4700 Meter), von dem kurze, spitze Zungen ausliefen. Darauf und darunter bis tief in die Páramoregion herab lag dichter Neuschnee. Der Pfarrer versicherte, der Berg werde nach starkem Neuschnee meistens ganz klar und[139] bleibe es zwei bis drei Tage. Äußerst wechselvoll ist am Berg das Spiel der Wolken. Am Morgen bis gegen 9 Uhr zieht bis zur Höhe von 4000 Meter ein langer schmaler Ring von Stratuswolken aus Osten über Süden nach Westen dicht um den Cotopaxi. Darüber ist ein Raum von etwa 1000 Meter Höhe ziemlich wolkenfrei, und über ihm steigen auf dem Westhang des Berges einzelne Wolkengruppen von Westen her bergan. Ganz oben kommt der Wolkenzug wieder aus Osten. Allmählich aber gewinnt von 9 Uhr an der östliche Luftzug die Oberhand, und bald ziehen alle Wolken des Berges nach Westen.
Am Mittag des 12. Juli ritten wir mit unserer kleinen Karawane und einem noch in letzter Stunde als Führer engagierten alten Hirten, der angeblich die ganze Süd- und Westseite des Berges bis zur Firngrenze hinauf kannte, nach Norden weg. Gleich hinter Mulaló betraten wir das Gebiet der Schlamm- und Schuttströme, die sich, ungeheuren Muren unserer Alpen gleich, durch die südwestlichen Bachschluchten des Cotopaxi herabgewälzt und nach Austritt in die Ebene zu riesigen Trümmerfeldern ausgebreitet haben. Furchtbar ist die Vermurung im Bereich des Rio Saquimálag mit seinen Zuflüssen. Unter den jüngeren Eruptionen haben die von 1853, 1877 und 1881 am meisten zu diesen Verwüstungen beigetragen. Dreiviertel Stunde ritten wir über das Trümmerfeld, das sich westwärts noch viel breiter ausflacht. Kolossale Blöcke verschiedenster Gesteinsarten sind zu Tausenden darüber verstreut und geben uns eine annähernde Vorstellung von der Gewalt dieser Schlammfluten.
Weiterreitend stiegen wir bald in die Quebrada des Rio Saquimálag (3145 Meter) hinab, der in einem etwa 150 Meter breiten Cañon zwischen 25 bis 30 Meter hohen[140] Steilwänden von Tuff und Lapilli nach Südwesten fließt. Die Talsohle ist durch Geröll und Sand zu einer Ebene ausgefüllt, in der sich der Fluß fortschlängelt. Wenn aber bei Eruptionen die Schmelzwasser mit ihren Schlammfluten kommen, erfüllen sie in wenigen Minuten den ganzen 150 Meter breiten Cañon bis zum Rand.
All dieses Land ist begreiflicherweise nur sehr wenig mit Pflanzen bewachsen. Es ward erst allmählich besser, als wir aus der Quebrada Saquimálag auf die Hochterrasse hinaufkamen, wo die kleine Hacienda Ilitio (3275 Meter) inmitten von Lupinenfeldern steht.
Mehr als vorher merkten wir beim Weiterreiten, daß das Gelände in Stufen ansteigt. Die lange, aus der Ferne ganz ungebrochen erscheinende Kurve der Vulkanböschung ist in Wirklichkeit eine lange Folge von kurzen und langen Stufen, die zum Berggipfel hin immer steiler werden. Teils sind sie durch die übereinandergeflossenen, an der Stirn steil abbrechenden Lavaströme entstanden, teils durch die rückwärts einschneidende Erosion der Bäche. In einer solchen Erosionsbucht, Hondon de León genannt, ging es nun durch Busch und Gras auf eine Stufe hinauf, wo nur noch vereinzelte, von Wind und Wetter zerzauste Berberitzenbäume und wenige Sträucher der rotweiß blühenden Fuchsie im hohen grauen Grase stehen.
Kaum hatten wir diesen Páramo betreten (3450 Meter), da erschienen auch schon in Scharen die lieblichsten Kinder der alpinen Flora Ecuadors, die Gentianen. Da die Lasttiere erschöpft waren und Wasser in der Nähe war, während es weiter oben bis an den Schnee keines mehr gab, ließ ich hier im hohen Gras die Zelte zum ersten Cotopaxilager aufschlagen (3670 Meter), so daß uns für den[141] nächsten Tag bis zur Schneegrenze noch etwa 1000 Meter übrigblieben.
Während sich die Peones an der Baumgrenze für die Nacht ein dürftiges Schutzdach aus Zweigen zusammensteckten und meine beiden Arrieros eine Biwakküche improvisierten, trat endlich der langersehnte Moment ein, wo wir den Bergriesen, dem wir nun schon so nahe auf den Leib gerückt waren, in Wirklichkeit zu sehen bekamen. Nach einem prasselnden Regenschauer riß das graue Gewölk im Nordosten auseinander, und da stand der Cotopaxi in seiner ganzen Größe, frei vom Scheitel bis zur Sohle. Wieviel hundertmal ich auch seit Jahren Bilder des Cotopaxi betrachtet und studiert hatte, wie oft ich auch von seiner Schönheit und Erhabenheit gelesen und gehört hatte, so hatte ich ihn mir doch nicht vorgestellt. Und Freund Reschreiter ebensowenig. Die plötzliche Erscheinung ergriff uns wie ein Zauber. Wir schauten hinauf, in Andacht versunken. Dann löste sich die Gemütsspannung in hellen Jubel aus; doch bald gewannen wieder Verstand und Wille die Oberhand, und jeder tat, was seines Amtes war: Reschreiter zeichnete und malte (siehe buntes Umschlagbild), und ich photographierte, maß und suchte den ganzen Berg mit dem Fernglas ab.
Von uns aus bergauf läuft nach wenigen 100 Metern die Páramovegetation in ihre letzten Zungen und Flecken aus, dann folgt ein breites Band von graubrauner Bimsstein- und Schuttwüste, durchzogen von zahllosen Neuschneestreifen, und darüber schwingt sich der gewaltige Schneekegel zum dunkelblauen Himmel auf, in so blendender Weiße, daß sich die Augen von Zeit zu Zeit abwenden müssen. Lückenlos lag der ungeheure Firnmantel um den Berg, einzig unterbrochen durch zwei relativ kleine dunkle Felspartien an der obern[142] Westseite. Von vielen Seiten schien der Aufstieg zum abgestumpften Gipfel möglich, am direktesten im Westnordwesten, am nächsten aber für uns im Westsüdwesten auf die Südwestkuppe zu. Alles dies erweckte uns frohe Hoffnungen für die nächsten Tage.
Unterdessen war es im Lager wohnlich geworden. Die Arrieros lagen vor ihren primitiven Zeltchen im Gras und rauchten, die Peones kauerten unter ihrem schnell hergerichteten Laubdach um ein qualmendes Feuer und verzehrten schmatzend und schweigsam ihren gerösteten Mais, den »Mote«, und wir setzten uns vor unser kleines Zelt an den Klapptisch auf unsere beiden Blechkoffer, tranken Tee, ließen uns die warme Sonne behaglich auf den Rücken brennen, weideten uns an der unvergleichlichen Aussicht hinauf zum schneeigen Bergriesen oder hinunter in die bräunlich violette, von silbernen Wasserfäden durchwobene Ebene, hinüber zum breiten dunklen Rumiñagui und zum doppelzackigen firntragenden Iliniza und fern hinaus zum herrlichen Kuppeldom des Chimborazo und gingen wieder einmal auf in der ewig jungen Schönheit unserer alten Mutter Erde. Hoch über uns zog ein Kondor – die sich regelmäßig einzustellen pflegten, wenn wir irgendwo ein Lager aufgeschlagen hatten – seine Kreise am dunkelblauen Firmament, und am nahen Bach flatterten wilde Tauben und girrten im Liebesspiel. Das ist die Poesie dieser Gebirgslager, die man gegen keinerlei Bequemlichkeiten der Welt eintauschen möchte!
Am nächsten Morgen bannte uns zunächst ein kräftiger Regen stundenlang ins Lager. Gegen 9 Uhr aber blitzte plötzlich die Sonne durch die nassen Nebel, und sofort waren wir auf den Beinen zum Weitermarsch. Bis zur nächsten Hügelhöhe kannte sich unser alter Führer noch aus; wir indes[143] ebenfalls. Dann aber hörte seine Wissenschaft auf, und die unserige begann, soweit sie uns nun der Berg selber lehrte.
Bis hierher hatte uns offener alpiner Busch begleitet. Von 4000 Meter an bis 4250 Meter finden sich nur noch wenige weit versprengte, dicht an den Boden geschmiegte Polsterchen von Alchemillen und kleine Büschel eines violetten Grases, dann durchreiten wir bis 4700 Meter eine hochalpine Wüste, ein »Arenal«, ein wellig ansteigendes Gelände von Lapilli, Schlacken, Bimsstein, vulkanischer Asche und Staub, dunkelgrau bis rotbraun in der Gesamtfärbung und größtenteils so fest, daß Menschen und Maultiere ohne viel Rutschen und Einsinken darauf fortkommen können. Nur selten ragt aus der Schuttdecke ein großer zackiger Felsklotz darunterliegender Laven.
Am Unterrand dieser wasserlosen Lapilliwüste brandet das Meer des vegetabilen Lebens empor, gewinnt da und dort etwas Terrain, weicht an anderen Stellen zurück, immer in Bewegung, immer wechselnd, aber in meßbaren Zeiten doch stets an ein bestimmtes Strandniveau gebunden wie der Ozean an der Festlandsküste. Das Bild vom unaufhörlichen schweren Kampf des Lebens gegen die feindlichen Gewalten der anorganischen Natur tritt uns nirgends in solcher Größe und Anschaulichkeit entgegen wie an der Vegetationsgrenze hoher Gebirge. Und wir selbst stellen uns mitten hinein, indem wir durch die Wüstenzone der Schnee- und Eisgrenze entgegenziehen, die als eine zweite vielbewegte Strandlinie das andere, von oben herabwogende Meer der Firnfelder und Gletscher säumt. Auch dort ein ewiges Fluten und Zurückebben, und zwischen den beiden großen einander entgegenstrebenden Massenbewegungen, zwischen dem Leben und dem Tod, der schmale trennende Streifen vermeintlichen Festlandes,[144] das unbewegt und unbeweglich erscheint, aber doch ebenso in fortwährender Bewegung ist.
Nun begannen wir auch die Gewalt des Windes zu fühlen. Mit wachsender Stärke braust er aus Osten vom Berg herab uns entgegen, böenartig und stoßweise, und zwingt uns bald, von unseren Tieren zu steigen, da diese nicht mehr vorwärts zu bringen sind, sondern bei jedem neuen Windstoß kehrtmachen und dem Sturm die unempfindlichere Rückseite entgegenstemmen. Wir werfen den Tieren die Zügel über den Hals und gehen voran; sie folgen langsam, weit hinter ihnen die beiden Arrieros mit den Lasttieren, die ihre Bürden immer noch weiter bergan schleppen, so sauer ihnen auch das Atemholen in der dünnen Höhenluft mit Schnauben und Keuchen und zitternden Flanken wird. Weit hinter den Tieren der Trupp meiner zum Lastentragen angeworbenen Peones, die wegen der Ausdauer der Tiere überhaupt nicht in Tätigkeit traten, und am Schluß der träge Dolmetscher Santiago und der alte »Führer«, der nie vorher in dieser Bergeshöhe gewesen war.
Mein etwas nördlicher Kurs brachte uns bald an den Steilrand der tiefen Schlucht des Puca-huaico. Ich sah, daß sie sich hier nur mit großem Zeit- und Kraftverlust traversieren ließ, darum blieb ich auf unserer bisherigen Seite und stieg ostwärts, den Schneefeldern entgegen, weiter bergan.

Wir blieben auf dem »Arenal« bis zur Höhe von 4576 Meter, wo das erste Neuschneefeld begann und die hohe Stirn eines ältern Lavastroms ein kleines, ziemlich ebenes Aschenfeld halb umschließt. Hier an den Felsen, bergwärts einigermaßen geschützt gegen den scharfen Wind, wurden die beiden Zeltchen aufgestellt und mit schweren Steinen ringsum verankert. Kochwasser lieferte uns der Schnee, Trinkwasser hatten wir in einem Fäßchen mitgebracht, und Feuerholz hatten wir von den letzten verwetterten Chuquiraguasträuchern mitgenommen. In unserer Zeltumgebung wuchs nichts mehr als ein versprengtes Exemplar von Senecio microdon, ein zwerghaftes, pelzhaariges Polsterchen, und eine einzige Hypochaeris sessiliflora, eine kaum 2 Zentimeter hohe kleine Rosette.
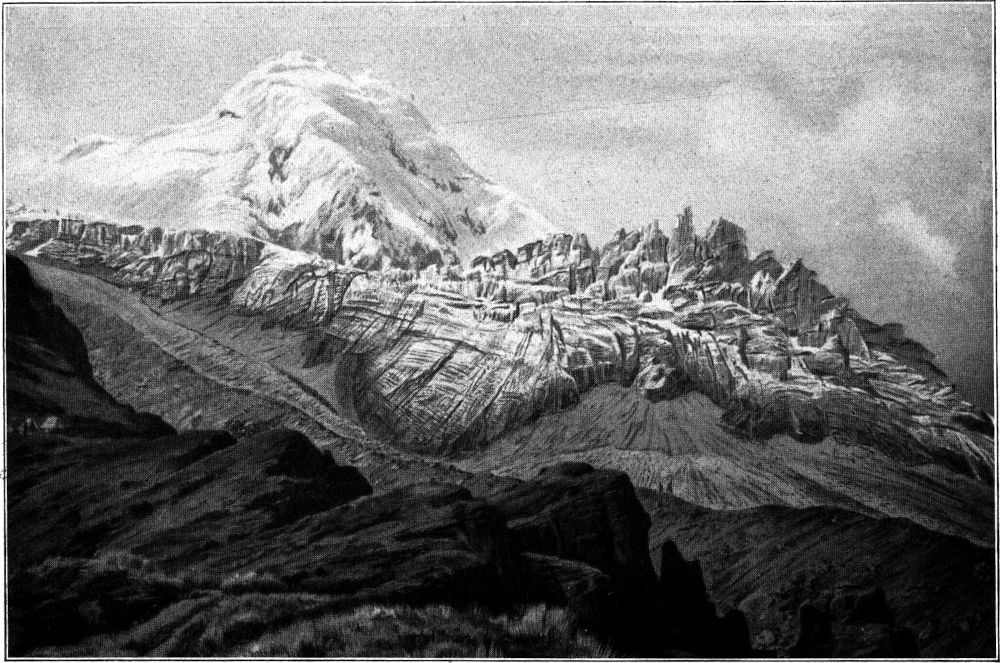
Sobald alles in Ordnung gebracht war, schickte ich Menschen und Tiere nach der Hacienda Ilitio zurück, von wo aus sie uns in zwei Tagen wieder abholen sollten. Wir waren unser vier geblieben; außer uns beiden Europäern mein Faktotum Santiago und ein junger gutmütiger, in Wollponcho und doppelte Schaffellhosen gepackter Indianer, der Feuer machen, Schnee schmelzen, Reis kochen und während unserer Hochtour das »Haus« hüten sollte.
Am Abend ward uns ein unbeschreiblich farbenzauberischer Sonnenuntergang zuteil. Der sinkende Sonnenball verwandelte den Himmel in ein wahres Feuermeer von Rot, Purpur, Gelb, Orange, Violett und Grün und versetzte die alten Vulkane und ihre Lavaströme in rote Glut, als wären sie wieder lebendig geworden wie vor Jahrtausenden. Langsam erstarb dann das Feuer in immer blaueren Tönen und wurde schließlich durch pechschwarze Wolken ganz ausgelöscht, die vom interandinen Hochland heraufzogen. Wir erwarteten ein schweres Gewitter, aber bald begann es bei stillem Wetter leicht und friedlich zu schneien. Die Nacht im warmen Zelt verlief in guter Ruhe. Nur weckte mich mehrmals ein tiefes[146] Brummen und Donnern (Bramidos), das vom Krater oben herabkam, am meisten vergleichbar dem dumpfen Brausen einer fernen Meeresbrandung. Gegen Morgen klärte sich das Wetter ganz auf, aber damit stellte sich bei –2° ein schneidender Fallwind aus den oberen Bergregionen ein, der uns hart anpackte. Bei Tagesgrauen um ¾6 Uhr machten wir uns auf den Weg. Ich nahm diesmal als dritten Mann Santiago mit, der ja schon auf dem Firn des Chimborazo Proben ganz tüchtiger Leistungsfähigkeit abgelegt hatte – wenn er mußte – und uns jetzt durch das Tragen des Proviants und einiger Instrumente entlasten sollte. Ich hatte ihn in meine alpine Reservekleidung gesteckt und mit einem festen langen Stock versehen und band ihn trotz seines Widerstrebens mit an das Gletscherseil.
Zwei Stunden ging es auf den unteren, mit 20 bis 30° Neigung noch mäßig steilen Schneehängen ganz gut. Der Schnee war fest und ließ sich gut treten. Einen Fuß tief unter der Oberfläche lag das blanke Eis. Dann aber begann der kalte, um die Ostseite des Berges herum uns direkt entgegenfauchende Wind, der uns bisher nur lästig gewesen war, uns mit steigender Stärke wirkliche Beschwerden zu machen. In der Höhe tobte er noch viel heftiger. Wir sahen, wie er oben den feinen pulverigen Hochschnee in langen grauen Fahnen wie Nebel über die Firnkämme blies und wie der windgepeitschte Schneestaub in Tausenden von schmalen Rieselbändern über die Firnhänge förmlich herabgeflossen kam. Gleichzeitig führte uns der Wind einen penetranten Geruch von schwefeliger Säure entgegen als ersten unfreundlichen Gruß von dem noch 1000 Meter über uns verborgenen Gipfelkrater.
Bisher waren wir auf der Südwestseite des Berges im[147] Morgenschatten gewesen. Gegen 8 Uhr blitzten die ersten Sonnenstrahlen gerade über den Gipfelrand herüber und zauberten unter Mitwirkung der aus dem Krater aufsteigenden Wasserdämpfe eine wunderbare orangegelbe Aureole um den silberweißen Scheitel des Vulkans. Die Atmosphäre flimmerte und zuckte wie über unseren heimatlichen sommerlich erhitzten Feldern und Wegen. Der Reflex des Sonnenlichts auf den Firnfeldern wurde bald so enorm, daß wir trotz allen Einsalbens im Gesichtsausschnitt unserer Schneehauben einen starken Gletscherbrand davontrugen und die Augen trotz der grauen Schneebrillen sich röteten. In den mittleren Bergesregionen sahen wir nun die Firnhänge im Sonnenlicht wie Spiegel funkeln, so daß mir lebhaft das Märchen vom gläsernen Berg und der verwunschenen Prinzessin in den Sinn kam, die von dem hinaufkletternden Ritter unter Preisgabe seines kleinen Fingers erlöst wird. Die Firnhänge waren dort, wie wir beim Näherkommen erkannten, auch an der Oberfläche total vereist. Darum begann nun das Stufenschlagen. Stellenweise war auf dem eisigen Firn der feine Hochschnee in zackigen Lappen angeweht, die sich oft in langen Reihen hinzogen wie eine vielbewegte Barometerkurve und unter dem Fuß leicht wegbrachen. Entsprechend der Gleichmäßigkeit des unter dem Eis liegenden Bergkörpers war die Zahl der Spalten gering; erst weit oben, wo es sehr steil wurde, nahmen sie zu.
Das spröde Eis splitterte beim Stufenhauen wie Glas. Das gab oft schwere Arbeit für Herrn Reschreiter, der die längste Zeit als vorderster Mann am Seil das Stufenschlagen besorgte, während ich meist als zweiter für meinen mit weniger guten Nagelschuhen versehenen Hintermann die Stufen vertiefte, gelegentlich den Ausgleitenden festhielt[148] und im übrigen Notizen schrieb, Instrumente ablas und mit der Handkamera Aufnahmen machte. Wir haben trotz möglichster Vermeidung der ganz aperen Stellen über 2000 Stufen geschlagen, und so ging es recht langsam im Zickzack mit 35 bis 40° Steigung weiter aufwärts.
Rückwärts gewandt, traf der Blick auf das blendend weiße wallende Wolkenmeer unter uns, das nur durch wenige Lücken die tief darunter versenkten, in violette Schatten getauchten Hochebenen durchschimmern ließ, und im Süden in weiter Ferne auf den inselgleich aus dem Wolkenmeer aufragenden Schneedom des Chimborazo. Östlich aber von ihm hob sich über die weiße Wolkenschicht eine noch viel höhere, teils dunkelgraue, teils kupferbraune pilzförmige Masse gegen den lichtblauen Horizont, die ungeheuere Eruptionswolke des Sangayvulkans (5323 Meter). Ihre Höhe konnte ich auf annähernd 10 000 Meter schätzen.
Um 10 Uhr, nach viereinhalbstündigem Steigen, hielten wir kurze Rast; wir waren mit 5278 Meter Höhe dem Gipfel, den wir am Tag vorher in 4 bis 5 Stunden zu bezwingen gedacht hatten, genau zur Hälfte nahegerückt: rund 700 Meter lagen unter uns bis zum obersten Lager, rund 700 Meter über uns bis zum Kraterrand. Noch waren wir gut bei Kräften, aber die Einwirkung der großen Höhe spürte ich doch in gänzlicher Appetitlosigkeit und in heftiger, auch beim Ausruhen fortdauernder Herzpulsation: 125 Schläge in der Minute. Dazu stellte sich bald ein anderer Feind ein, der Nebel. Schon lange hatte die wachsende Sonnenwärme die Dünste der unteren Bergregionen in wallende Bewegung gebracht. Langsam waren die Nebelschwaden bergauf vorgerückt, aber immer wieder vom Ostwind der Höhe zurückgeschlagen worden. Nun waren sie, während der Wind etwas[149] nachließ, plötzlich da und gaben das eroberte Terrain stundenlang nicht wieder frei. Auf unseren vorherigen Hochtouren hatten wir die Erfahrung gemacht, daß man in den Gipfelregionen der Kordilleren zwischen 10 oder 11 Uhr vormittags und 4 Uhr nachmittags fast immer mit Nebel rechnen muß. Ein ganz klarer Tag ist eine außerordentliche Seltenheit, die uns auch in der besten Jahreszeit nicht ein einziges Mal beschert war. Hier aber auf dem Cotopaxi waren wir besser daran als auf den anderen Schneebergen, weil hier am Tag ein Irregehen im Nebel kaum möglich ist. Bei der ungemein gleichmäßigen Form des Bergkegels führt ein konsequentes Aufsteigen auf dem steilsten Firnhang sicher zum Ziel, falls die Kräfte ausreichen und falls man nicht auf offene, brückenlose Spalten trifft, die in der Nähe des Kraterrandes häufiger werden.
Wir hielten also unsern bisherigen Kurs auf dem steilsten Schneehang vier weitere Stunden voll mühseliger Steigarbeit ein, bis wir gegen 2 Uhr bei einem Aufreißen der Nebelhüllen nördlich von uns einige dunkle Wände aus dem Firn emporragen sahen, die wir schon am Morgen von unten als eine dem westlichen Oberrand des Berges ziemlich naheliegende Felsmasse beobachtet hatten. Jetzt erkannten wir, daß von dort aus inmitten der Westseite die Erkletterung des Kraterrandes weniger schwierig war als auf unserer Südwestseite, wo uns weiterhin große Spalten entgegendrohten. Also wurde vorsichtig über halb verwehte Firnklüfte hinüber traversiert und am Fuß der Felsen in 5828 Meter Höhe eine Viertelstunde gerastet. Die Steilwand ist ein schneefreies, kleines Stück der Berglehne selbst, etwa 30 Meter hoch und 100 Meter breit, eine dunkelgraue zermürbte Lava, die an vielen Stellen von hellgrauen,[150] strohgelben und lichtgrünen Krusten überzogen ist. Zu meiner Überraschung fühlte sich das Gestein heiß an, und nun sah ich auch aus vielen schmalen Rissen und Löchern dünne Dampfstrahlen austreten. Daher also die Schneefreiheit und die Krustenbildung. An den Rändern der Felsen hingen große Eiszapfen und lagen dicke Eisharnische, und darüber stieg der Firnhang steil weiter zu dem noch unabsehbaren Gipfel hinauf.
Hier erklärte unser dritter Mann, Santiago, er sei am Ende seiner Kräfte, er könne nicht weiter mitgehen und wolle auf unsere Rückkehr warten. Er streckte sich an den warmen Fels und schlief ein. Wir ließen die Rucksäcke mit Mänteln und Proviant bei ihm, steckten nur das Allernötigste zu uns und lösten das Seil, da auch für uns beide ein Zusammensteigen am Seil über die brüchigen Felsen unpraktisch war. Dieses Stück Felsenkletterei war, obgleich an und für sich eine greuliche Arbeit, doch durch die Abwechslung der Bewegung und der Umgebung eine wahre Erholung nach dem bisherigen achteinhalbstündigen unaufhörlichen Schneetreten und Eishacken. In den oberen Teilen der Felsen wurde die Lava ganz schlackig und löste sich beim Anstoßen in Schollen ab. Es sind Reste der Lavaströme, die sich vom Kraterrand über die Steilwände herabgewälzt haben und nach Zerreißung ihres Zusammenhangs den jähen Berghang hinuntergerutscht sind. Die Hände bekamen hier mehr zu tun als die Eispickel; oft ging es nur auf allen vieren. Darüber im Schnee ließ es sich wieder besser an. Selbstverständlich spürten wir nachgerade die große Luftdünne und eine starke Ermüdung, ich noch mehr als mein zehn Jahre jüngerer 35jähriger Kamerad, aber von den schlimmen Erscheinungen des Soroche, der eigentlichen Bergkrankheit, blieben wir verschont. Auf die große Lufttrockenheit reagierten[151] von Zeit zu Zeit die Lungen und der Kehlkopf mit einem stoßhaften, krampfartigen Husten.
Der oberste Bergkegel steigt von etwa 5750 Meter an mit 40 bis 42° empor. Da das Nebelwehen nachgelassen hatte, konnten wir minutenlang die noch zu bewältigenden Firnfelder bis zu einem feinen Grat der hohen Nordwestkuppe übersehen. Das Ziel schien noch so weit, daß mir einige Momente ernstliche Zweifel aufkamen, ob wir bei der vorgerückten Stunde – es war ½3 Uhr geworden – den Kraterrand erreichen könnten, ohne uns der Gefahr einer nächtlichen Verspätung auszusetzen, denn die Sonne geht ja hier unter dem Äquator um 6 Uhr unter, und um ½7 Uhr ist bereits finstere Nacht; man hat also höchstens 13 Stunden Tageshelle von ½6 Uhr früh bis ½7 Uhr abends. Der Gedanke jedoch, nach soviel Arbeit so nahe am Ziel ohne schwere Widerstände in Eis oder Fels oder Luft die Waffen strecken und sieglos umkehren zu sollen, trieb uns vorwärts.
So kamen wir in kurzem in die oberste Region, wo die Steilhänge in große Firnstufen und diese in lange Rücken und Hügelreihen übergehen, lauter Schnee und Eis von sonderbaren, blumenkohlartigen Oberflächenformen, die immer phantastischer wurden, je mehr wir uns dem Gipfelkrater näherten. Die Stufenbildung des Firns ist zweifellos durch darunterliegende Lavawülste und Lavatreppen verursacht, die von den Magmaergüssen des Kraters hier oben am Rande erkaltet hängengeblieben sind, während die Hauptmassen hinabgerutscht sind.
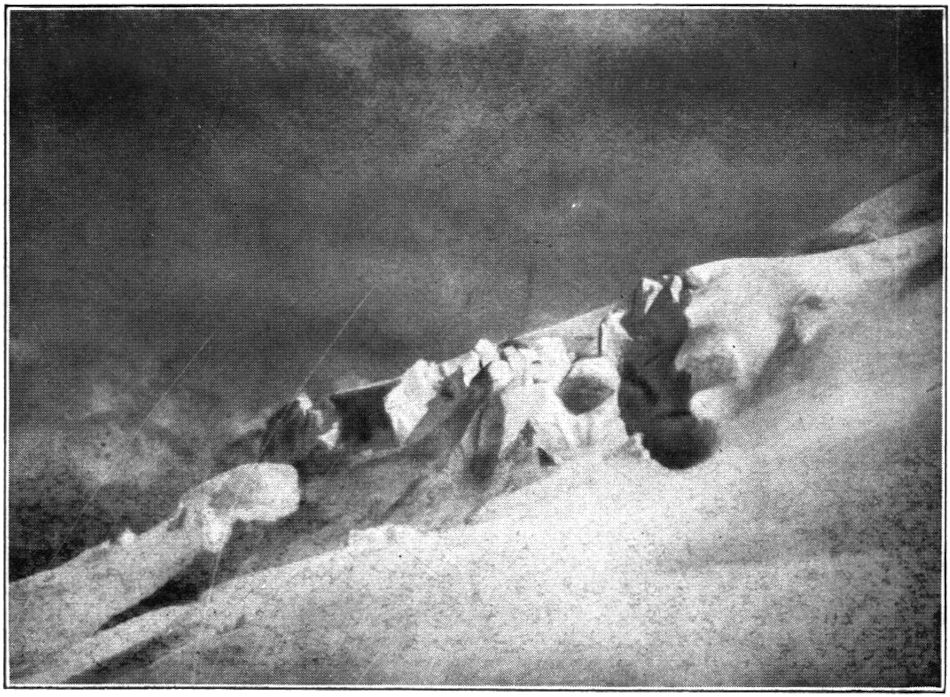
Noch eine Viertelstunde lavierten wir mit äußerster, nach Pausen der Ermattung immer wiederholter Konzentration von Kraft und Willen durch die wie riesige Wogen immer wieder vor uns aufsteigenden Firnhügel. Aber die[152] Oberfläche war fest und ließ den Fuß sicher auftreten. Herr Reschreiter war ein Stück voraus, ich zurück beim Photographieren der wundersamen Firngebilde, die hier die Form von weißen Korallenbänken hatten. Da höre ich unfern über mir seinen Ruf: »Der Krater ist da!« und bin in einigen Minuten bei ihm.
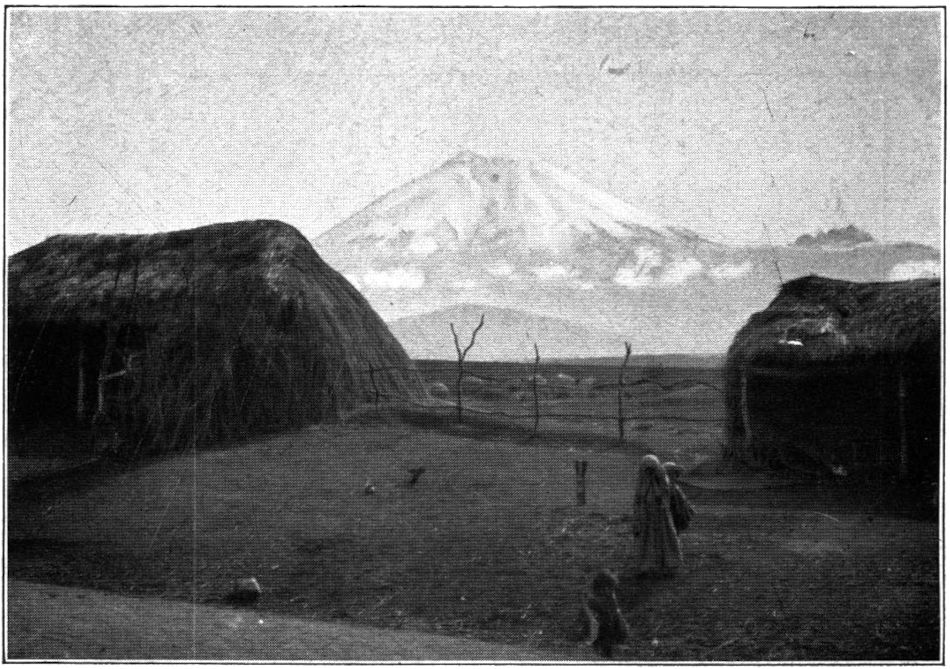
Unmittelbar vor uns öffnet sich die Erde, und aus schwindelnder Tiefe gähnt uns der ungeheure Schlund des Gipfelkraters an. Mit einem Seufzer der Erleichterung und Genugtuung stoßen wir die Eispickel in den Firn und setzen uns zu ruhigem Schauen auf einen Schneehügel. In wenigen Minuten ist alles körperliche Unbehagen verschwunden; eine angenehme körperliche und geistige Abspannung, nicht Ermüdung, kommt über mich, während die Sinne und die Beobachtungslust in alter Weise wieder rege werden. Und damit wächst auch erst das rechte Triumphgefühl über den schwer erkämpften Sieg empor, das mir im Moment der Zielerreichung gänzlich gefehlt hatte.
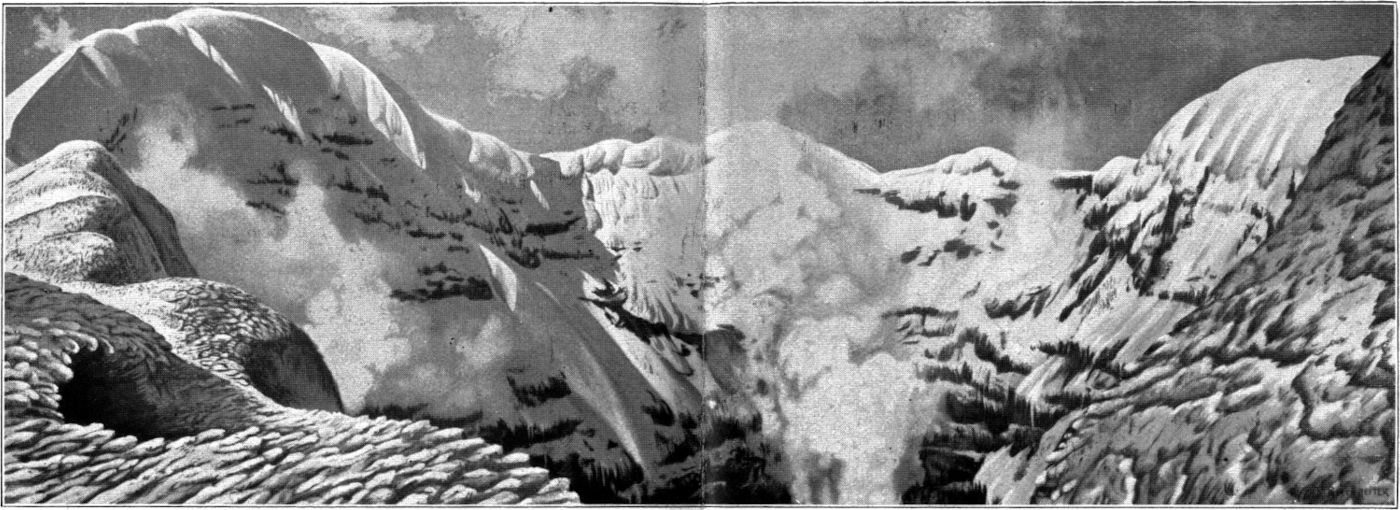
Zuerst stehen wir ratlos vor den ungeheuren Dimensionen, für die uns jeder Maßstab in dieser Landschaft fehlt. Wir können nur unser eigenes Körpermaß auf unsere Umgebung übertragen. Der Krater ist etwas elliptisch, seine längste Achse (Nord-Süd) 750 bis 800 Meter, seine kurze Achse (Ost-West) 500 bis 550 Meter lang. Dabei hat er, soweit man hinuntersehen kann, eine Tiefe von 400 bis 500 Meter, d. i., um einen geläufigen Vergleich zu ziehen, etwa die dreifache Höhe des Kölner Doms. Zu dieser Tiefe fallen von allen Seiten die inneren Kraterwände jäh mit 60 bis 80° Neigung ab, nach unten trichterförmig zusammengezogen, mehrfach in Stufen übergehend und auf diesen Stufen und zahllosen Gesimsen so viel Raum lassend, daß[153] sich auf ihnen wieder Schnee- und Eisbänke festsetzen können. Von ihnen wie von den Firnhügeln des Kraterrandes hängen gigantische Eiszapfen von 20 bis 30 Meter Länge und 2 bis 3 Meter Dicke, stellenweise in wahren Baldachinen, über den finsteren Abgrund hinunter. Im Gegensatz zu den hellen Schnee- und Eismassen stehen die felsigen Kraterwände in düsteren vielfältigen Farben da. Jede der horizontal übereinanderliegenden Bänke von Lava und von Tuff- und Lapillischichten ist anders gefärbt. In den oberen Lagen herrschen rötliche Töne vor, darunter sind graue in der Mehrzahl, und unter diesen, wo die aufsteigenden Dämpfe noch heiß sind, den Fels zerfressen und Krusten absetzen, dämmert das Gestein graugrün, hellgrau, gelb und auch weiß. Gips und Inkrustationen von Schwefel scheinen dort stark vertreten zu sein.
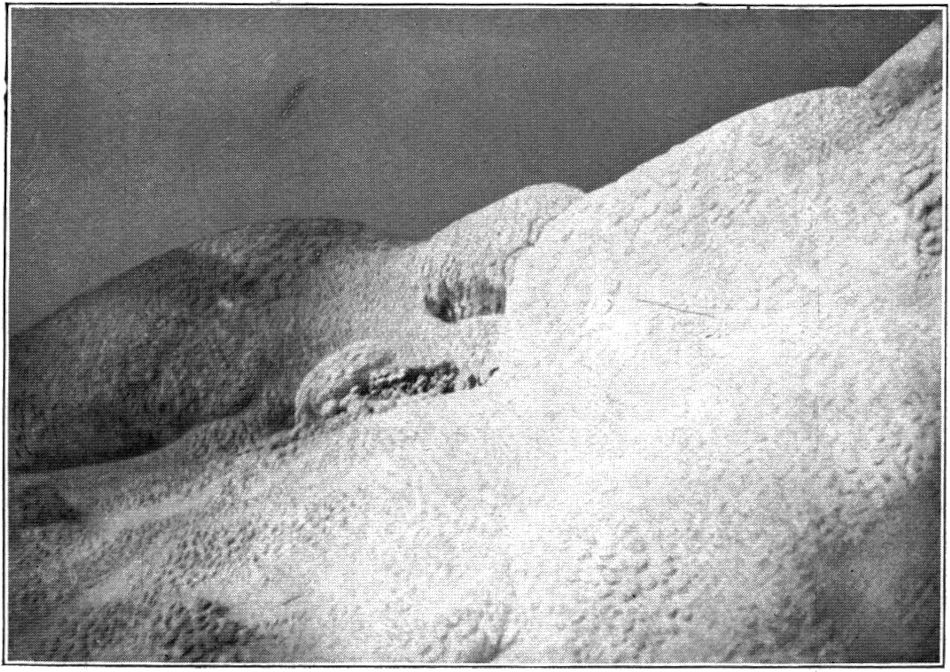
In der Tiefe von etwa 400 Meter ist nichts mehr zu erkennen als emporquellender weißer und hellgrauer Dampf; doch ist dieser jetzt nicht besonders dicht und stark. Von Zeit zu Zeit läßt sich im Innern ein dumpfes Grollen vernehmen, wie wir es schon beim Aufstieg an der Außenseite gehört hatten. Auch war einmal ein lautes rollendes Getöse vernehmbar wie von einer fernen niederbrausenden Lawine, worauf eine große Dampfwolke emporquoll, den ganzen Krater erfüllte und uns einige Sekunden in eine penetrante Atmosphäre von schwefeliger Säure einhüllte. Dann aber blieb es wieder bei dem ununterbrochenen mäßigen, meist geräuschlosen Aufsteigen von balligen Dampfsäulen wie aus einem riesigen, ruhig siedenden Kochkessel. Ob die Hauptmasse des Dampfes im Grund des Kratertrichters aus einem einzigen, weit hinein offenen Schacht aufsteigt, oder ob er aus einem verschütteten Kratergrund durch zahllose[154] Fumarolen und Solfataren zwischen Schutt und Blöcken hervordringt, konnten wir nicht klar erkennen. Mir schien das erstere der Fall zu sein.
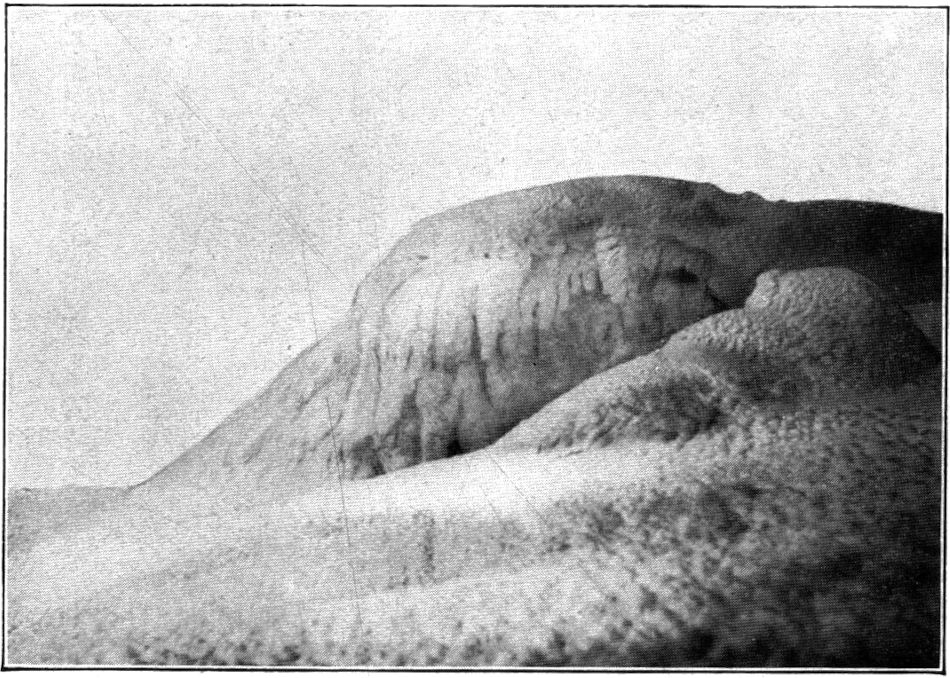
Ein wundervoller Kontrast: dieser ungeheure heißdampfende Kraterschlund und seine obere Firn- und Eisumwallung. Wir können sie auf den uns gegenüberliegenden Kraterrändern auch von ihrer Innenseite überblicken. Hatten unsere Vorgänger hier oben nur relativ wenig oder infolge neuer Eruptionen gar keinen Schnee angetroffen und den Kraterrand als einen 5 bis 6 Meter breiten Wall von nackten Lavablöcken oder Auswürflingen gesehen, so umschließen jetzt auf allen Seiten Firnkuppen und Eisgrate den Kraterkessel als eine Krone, wie sie so groß und so herrlich nur des Königs aller Vulkane würdig ist. Die Schneeansammlungen haben den Kraterrand oft um das Doppelte verbreitert. Von 10 bis über 60 Meter hoch lagern die Firn- und Eismassen auf dem Gestein und brechen zum Krater hin in steilen, oft überhängenden Wänden ab. An mehreren Stellen sieht man frische Brüche, von denen gewaltige Eislawinen in die kochende Tiefe hinabgestürzt sind[1].

Was aber diese über 6000 Meter hohe Schneelandschaft des Cotopaxigipfels in ihrem äußern Aussehen von allen anderen mir bekannten alpinen Schneelandschaften unterscheidet, das sind die höchst seltsamen Oberflächenformen dieser hügeligen Firnmassen. Alle diese runden, breiten Firnhügel[155] und Firnrücken bis etwa 150 Meter weit auf den Außenmantel des Kraters hinab sind überzogen von Millionen runder finger- bis armlanger Firnblätter, die gleichmäßig die Hügel und die Mulden bedecken und aussehen wie dicke hellgraue Schuppen oder Schindeln. Meist sind die einzelnen Blätter wieder mehrfach gelappt gleich den Blättern der Feige oder des Weinstockes. An anderen Stellen gleichen sie hängenden Straußenfedern, wieder an anderen den Korallenbänken der Madreporen. Alle Formen sind gerundet, nirgends eckig, und überall ist ihre Oberfläche krustig und pelzig, nicht glatt vereist wie die Firnoberfläche in den tieferen Regionen des Bergkegels. Auch in Ecuador habe ich diese eigenartigen Firngebilde nirgends wieder gesehen. Es sind sicherlich nicht Schmelzformen der Sonne oder des Windes, sondern Kristallisationen des aus dem Krater aufsteigenden Wasserdampfes, also eine Art Rauhfrost, wie er ähnlich auch bei uns daheim einmal vorkommt. Hier und da, wo in diese immer in Bewegung befindlichen Firnmassen Spalten und Klüfte gerissen sind, sind auch diese oft von den Rauhfrostblättern überzogen und teilweise überbrückt, was ganz wunderbare Effekte von Schneegirlanden und Schneelauben hervorzaubert. An einigen anderen Stellen wieder sind tiefe dolinenartige Löcher oder Höhlen von ein bis zwei Meter Durchmesser teils lotrecht, teils schief in den Firn eingesenkt, die ebenfalls von solchen Schneeblättern überhangen sind, aber ihre Entstehung, wie mir scheint, weder Bewegungen im Firn noch von oben einwirkenden Schmelzagentien verdanken, sondern warmen Stellen des felsigen Untergrundes, wo heiße Dämpfe aus Löchern und Spalten austreten.
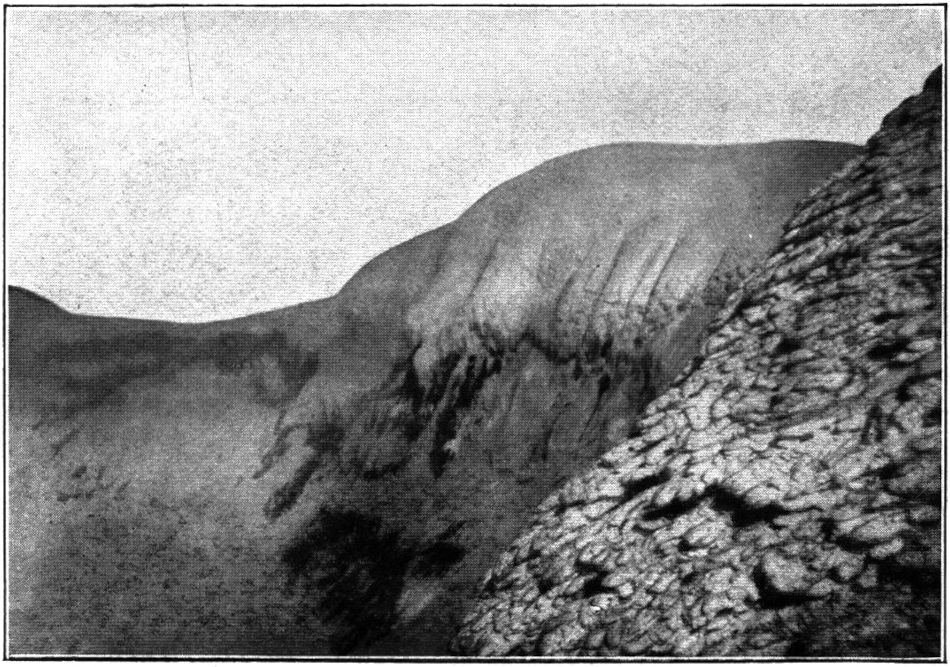
Die mächtigste Auftürmung der Firnmassen und damit[156] der höchste Gipfel des Berges liegt auf der Nordseite des Kraterrandes. Dort erhebt sich der Firn in einer stolzen Pyramide etwa 65 Meter hoch über den Kraterrand, dessen felsige Oberkante wir an dem innern Absturz deutlich erkennen können. Von der westlichen Böschung dieses höchsten nördlichen Schneegipfels zieht eine wundervolle scharfe Firnschneide zu dem flachen Firnrücken der Westseite hinab, auf deren mittlerm Teil wir stehen. Unser Standpunkt, dessen Höhe ich barometrisch auf 5940 Meter gemessen habe, ist ungefähr 65 Meter niedriger als die höchste nördliche Gipfelkuppe. Dieser würde damit eine Höhe von 6005 Meter, etwas mehr oder weniger je nach der aufliegenden Firnmenge, zuzusprechen sein.
Während unseres Aufenthalts auf dem Kraterrand blies der Ostsüdostwind stetig, aber mäßig, so daß es bei –2° ganz gut auszuhalten war. Beim Schauen, Messen, Schreiben, Photographieren, Skizzieren hatte aber keiner von uns beiden an das Schwinden der Zeit gedacht. Ich bekam deshalb einen gelinden Schreck, als ich, endlich nach der Uhr sehend, fast 4 Uhr ablas. Wir hatten also nur noch 2½ Stunden Tageslicht für den Abstieg, wo uns der Aufstieg 9½ Stunden gekostet hatte. Eilig traten wir über die oberen Firnhügel den Rückzug an und rutschten bald über die obenerwähnten Felsen zu unserm wartenden Begleiter hinab, der sich unterdessen wieder erholt hatte. Ohne längern Aufenthalt, als die Seilbefestigung erforderte, ging es weiter und in unseren noch guterhaltenen Spuren flott bergab, indem wir auf den weicher gewordenen Firnhängen mit Springen und Gleiten die zahllosen Zickzacks abschnitten, die wir bergaufwärts hatten treten und hauen müssen. Der Nebel hatte sich sehr gelichtet, aber von Westen her rückte eine kolossale[157] schwarze Wolkenmauer auf uns los, als wollte sie uns erdrücken. Auf den unteren Schneefeldern der Westseite fußend, stieg sie vor uns kerzengerade himmelan, so hoch wie der Cotopaxi selber und von der dahinterstehenden Sonne mit einem schmalen weißglühenden Rand umsäumt; ein wunderbares, nie vorher gesehenes Phänomen von unheimlicher Größe, Gestalt und Farbe. In unseren Alpen würde eine ähnliche Erscheinung einen fürchterlichen Gewittersturm verkündet haben, hier auch in den Monaten der Regenzeit; aber jetzt im Verano löste sich das drohende Phantom in ein wirbelndes Schneegestöber auf, das unsere Schritte nur noch mehr beflügelte. Einige Male verloren wir unsere alte, kaum mehr zu erkennende Spur, fanden sie aber nach einigem Kreuz- und Quergehen wieder und erreichten ohne weitern Zwischenfall wirklich vor Sonnenuntergang bei ganz klar gewordenem Wetter die Schneegrenze.
Nachdem wir das Seil abgelegt hatten, mußten wir uns einige Zeit mit Santiago abgeben, der sehr erschöpft war. Dann bummelten wir über die Felsen an unseren den Weg zeigenden Steinmännern vorbei zum Lagerplatz, dessen Rauchsäule wir längst bemerkt hatten, und waren noch vor gänzlicher Dunkelheit bei unseren Zelten, wo uns der zurückgebliebene Indianer mit Bangen erwartet hatte. Der Appetit, der mir den ganzen Tag gefehlt hatte, stellte sich nun in beängstigender Stärke wieder ein, und nach Vertilgung alles vorhandenen Eßbaren schliefen wir, während es draußen wieder schneite und der Bergwind unsere steifgefrorenen, knisternden Zeltwände peitschte, in unseren molligen Pelzsäcken zwölf Stunden ohne Unterbrechung. Gegen Mittag des nächsten Tages kamen, wie verabredet, unsere Arrieros trotz fortdauernden Schneegestöbers mit den Tieren wieder[158] herauf und brachen unser Lager ab, während wir gemütlich vorausschlenderten.
Weiter unten enthüllte sich uns noch einmal der Cotopaxi in seiner ganzen Schönheit, und dankbar kehrte unser Blick immer wieder zu seinen silberschimmernden Höhen zurück. Das Schneegestöber der letzten Nacht hatte nicht viel ausgerichtet. Die Sonne hatte seine Spuren und die der Schneefälle der beiden Vortage in den unteren Regionen größtenteils weggewischt. Darum zeigte sich jetzt der Rand des Schneemantels tief gezackt und eingeschnitten. Jeder der schwarzen Einschnitte ist ein wallförmiger Lavastrom. Wie die Fangarme eines gigantischen Polypen halten alle diese dunklen Lavabänder den Bergkörper umklammert. Ihr zerklüftetes, durchlässiges Gestein und bei den jüngsten vielleicht noch etwas Eigenwärme lassen den Schnee der niederen dünneren Randlagen nicht lange auf ihnen liegenbleiben. Die Höhe dieser zur Zeit der größten Abschmelzung sich zeigenden »wirklichen« Schneegrenze habe ich gemessen: auf der Ostseite bei 4550 Meter, Südseite 4730 Meter, Westseite 4850 Meter, Nordseite 4900 Meter; d. h. sie hat sich, seit sie vor 30 Jahren zuletzt gemessen wurde, um 100 bis 180 Meter aufwärts verschoben. Von alten Gletscherspuren ist am Cotopaxi nichts zu bemerken. Er ist dafür zu jung.
Am Spätnachmittag des 15. Juli ritten wir, schwerbeladen mit geologischen Handstücken, Pflanzen und sonstiger Ausbeute, wieder im Pfarrhof von Mulaló ein. Der Pfarrer nahm lebhaftes Interesse an unserm Erfolg und Bericht. Die Dorfbewohner aber, die sich auf die Nachricht von unserer Rückkehr einfanden, um ihre Neugierde zu stillen und zu klatschen, zogen, nachdem sie viel Dummes gefragt, uns wenig zugehört, viel geschwatzt, viel getrunken, geraucht[159] und gespuckt hatten, abends wieder heim mit Kopfschütteln und Achselzucken. Keiner von ihnen glaubte unseren Berichten. Ich hörte, wie einer draußen sagte: »Kein Mensch ist noch auf dem Cotopaxi gewesen. Vor 20 bis 30 Jahren erzählten es auch schon einige Europäer, aber sie haben alle gelogen. Und nun lügen diese beiden Alemanes ebenfalls. Solche Berge kann kein Mensch ersteigen, und wenn einer doch hinaufkäme, würde er oben sterben.« Das ist die Überzeugung der bergscheuen Ecuatorianer von jeher gewesen, und sie wird es voraussichtlich immer bleiben.
[1] Während des Ausbruchs von 1911 schmolz diese Eiskrone weg und ließ die nackten Felsen des Kraterrandes zutage treten, wodurch sich auch die Höhe des Berges etwas verminderte. Inzwischen dürfte sich die Firnhaube zum Teil wenigstens wieder neu gebildet haben.
Alte Reisen und Abenteuer
Bd. 1 Fornão de Magalhães, Die erste Weltumseglung. Bearbeitet von Dr. H. Plischke
Bd. 2 Ulrich Schmidel, Abenteuer in Südamerika. Bearb. von Curt Cramer
Bd. 3 J. Cook, Die Suche nach dem Südland. Bearbeitet von Dr. H. Damm
Bd. 4 Peter Kolb, Zum Vorgebirge der Guten Hoffnung. Bearbeitet von Dr. P. Germann
Bd. 5 Christoph Kolumbus, Die Entdeckg. Amerikas. Bearb. v. Dr. H. Plischke
Bd. 6 Kapitän Phillip, Gründung der Strafkolonie Sydney. Bearbeitet von Dr. H. Plischke
Bd. 7 Carl Friedrich Behrens, Der wohlversuchte Südländer. Reise um d. Welt 1721/22. Bearb. v. Dr. H. Plischke
Bd. 8 Hans Egede, Die Erforschung von Grönld. Bearb. v. Dr. M. Heydrich
Bd. 9 Hernando Cortes, Die Eroberung v. Mexiko. Bearb. v. Dr. H. G. Bonte
Bd. 10 Francis Drake, Als Freibeuter in Spanisch-Amerika. Bearbeitet von Dr. H. Damm
Bd. 11 Marco Polo, Am Hofe des Großkhans. Reisen in Hochasien u. China. Bearbeitet von Dr. A. Herrmann
Bd. 12 Mungo Park, Vom Gambia zum Niger. Bearb. von Dr. P. Germann
Bd. 13 Vasco da Gama, Der Weg nach Ostindien. Bearb. v. Dr. H. Plischke
Bd. 14 Francisco Pizarro, Der Sturz des Inkareichs. Bearb. v. Dr. H. G. Bonte
Bd. 15 John Smith, Unter den Indianern Virginiens. Bearbeitet von Dr. H. G. Bonte
Bd. 16 Georg Wilhelm Steller, Von Kamtschatka nach Amerika. Bearbeitet von Dr. M. Heydrich
Bd. 17 Herodot, Reisen und Forschungen in Afrika. Bearb. von Dr. H. Treidler
Bd. 18 Tacitus, Germania. Bearbeitet von Dr. H. Philipp
Reisen und Abenteuer
Bd. 1 Sven Hedin, Abenteuer in Tibet
Bd. 2 Sven Hedin, Transhimalaja
Bd. 3 Kapitän Scott, Letzte Fahrt (Scotts Tagebuch)
Bd. 4 Georg Schweinfurth, Im Herzen von Afrika
Bd. 5 H. M. Stanley, Wie ich Livingstone fand
Bd. 6 Kapitän Scott, Letzte Fahrt (Abenteuer der Gefährten)
Bd. 7 Sven Hedin, Durch Asiens Wüsten
Bd. 8 Sven Hedin, Zu Land nach Indien
Bd. 9 A. E. Nordenskiöld, Umseglung Asiens und Europas
Bd. 10 H. M. Stanley, Im dunkelsten Afrika
Bd. 11 Georg Wegener, Erinnerungen eines Weltreisenden
Bd. 12 Gustav Nachtigal, Sahara u. Sudan
Bd. 13 Ernest Shackleton, Im sechsten Erdteil
Bd. 14 Walter v. Rummel, Sonnenländer
Bd. 15 W. H. Gilder, Untergang der Jeannette-Expedition
Bd. 16 Slatin Pascha, Feuer und Schwert im Sudan
Bd. 17 Einar Mikkelsen, Ein arkt. Robinson
Bd. 18 H. M. Stanley, Mein erster Weg zum Kongo
Bd. 19 Sven Hedin, General Prschewalskij in Innerasien
Bd. 20 Sven Hedin, Meine erste Reise
Bd. 21 H. M. Stanley, Auf dem Kongo bis zur Mündung
Bd. 22 Henry G. Landor, Auf verbot. Wegen
Bd. 23 Sven Hedin, An der Schwelle Innerasiens
Bd. 24 Otto Sverdrup, Neues Land
Bd. 25 Hans Meyer, Hochtouren im tropischen Afrika
Bd. 26 Douglas Mawson, Leben und Tod am Südpol
Bd. 27 Arthur Berger, Auf den Inseln des ewigen Frühlings
Bd. 28 Vilhjalmur Stefansson, Jäger des hohen Nordens
Bd. 29 Prinz Max zu Wied, Unter den Rothäuten
Bd. 30 Emil Holub, Elf Jahre unter den Schwarzen Südafrikas
Bd. 31 L. B. Mansilla, Die letzten wilden Indianer der Pampa
Bd. 32 Hans Meyer, Hochtouren im tropischen Amerika
Bd. 33 Rickmer W. Rickmers, Die Wallfahrt zum wahren Jakob
Bd. 34 Wilhelm Junker, Bei meinen Freunden den Menschenfressern
Bd. 35 H. v. Foller, Unter Javas Sonne
Bd. 36 Philipp Berges, Wunder der Erde
Jeder Band enthält 160 Seiten Text, etwa 30 Abbildungen und 2 Karten, ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich / Beide Sammlungen werden fortgesetzt
Ausführliche Prospekte auf Verlangen kostenlos
Verlag F. A. Brockhaus / Leipzig
F. A. Brockhaus in Leipzig.