
Title: Quer durch Amerika
Ein Reisetagebuch
Author: Karl Augst Busch
Release date: April 17, 2025 [eBook #75888]
Language: German
Original publication: Dresden: Dresdner Verlagshandlung M. O. Groh, 1926
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1926 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.
Einige Ausdrücke wurden in verschiedenen Schreibweisen wiedergegeben, verschiedene englischsprachige Benennungen sind nicht ganz korrekt. Sofern die Verständlichkeit des Texts davon nicht berührt ist, wurden diese Ausdrücke aber belassen wie im Original angegeben.
Die Fußnoten wurden am Ende des betreffenden Kapitels zusammengefasst.
Das Buch wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden in dieser Fassung, mit Ausnahme der Bildunterschriften, kursiv dargestellt.

Copyright 1926 by Dresdner
Verlagsbuchhandlung
M. O. Groh, Dresden-N. 6.
Alle Rechte,
einschließlich das der Übersetzung, vorbehalten.
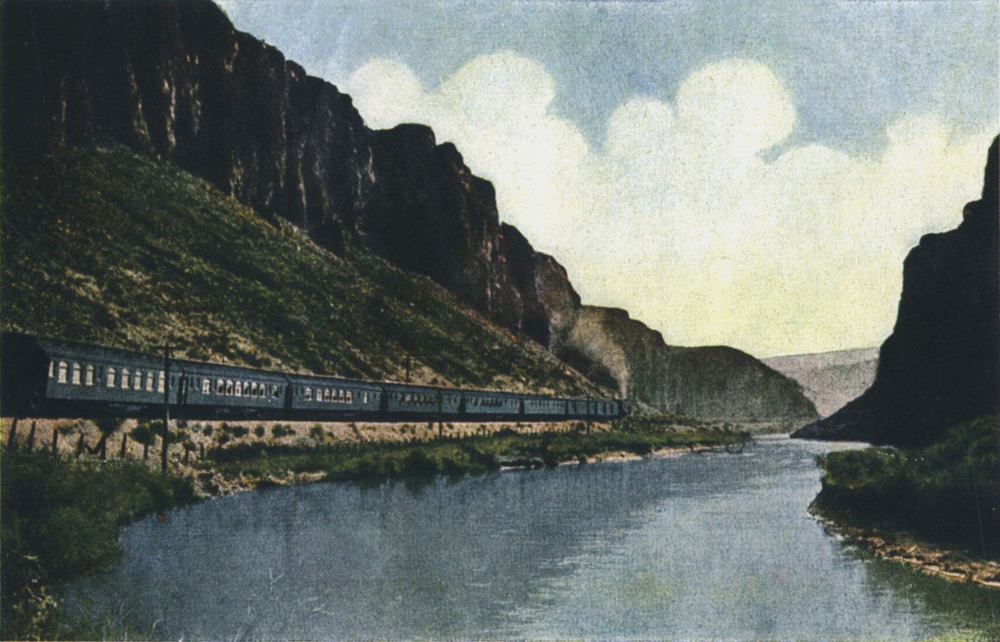
Ein Reisetagebuch
von
Dr. Karl August Busch
1926
Dresdner Verlagsbuchhandlung
M. O. Groh, Dresden-N. 6
[S. 4]
Z. R. III hat seine Siegesfahrt über den Atlantischen Ozean längst vollendet. Er kreiste um die Freiheitsstatue in Neuyork und das Kapitol in Washington und wurde als Zeichen deutschen technischen Geistes und deutscher Tatkraft überall stürmisch bejubelt. Die tiefen Wunden, die uns im Weltkrieg das Dazutreten Amerikas zu unseren Feinden schlug, beginnen langsam zu vernarben. Völker noch eher als Einzelmenschen müssen immer wieder miteinander leben.
So ist das Interesse bei uns für Amerika wieder erwacht. Man fragt wieder interessiert: Wie sieht es drüben wirklich aus? Handbücher der Erdkunde, der Politik, des wirtschaftlichen Lebens usw. Amerikas gibt es dafür genug. Was ich im folgenden biete, will nichts als eine anschauliche Schilderung persönlicher Eindrücke und Erlebnisse in der Union von Neuyork bis San Francisco sein, die mir ein volles Studienjahr bot: Es will dem Leser, vor allem auch der weltbegierigen und wanderlustigen reiferen Jugend, schildern, wie es „drüben“ aussieht und wie es „drüben“ zugeht.
Natürlich kann ich es nur so sagen, wie ich es erlebt und gesehen habe, und werde auch nur das beschreiben, was ich erlebt habe. Aber das Persönliche wird hier gerade das Reizvolle sein. Darum hat dabei hier und da wohl auch der Humor sein Recht. Nebenbei aber wird der aufmerksame Leser bald merken, daß er auch aus dieser Schrift allerlei Wissenswertes über das Leben des amerikanischen Volkes und das Land im ganzen lernen kann, so daß er bei der Lektüre das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet.
Dresden, den 10. November 1925.
Karl August Busch
Dr. phil.
B. D. (Harvard University).
[S. 5]
|
Seite
|
|
|
Vorwort
|
|
|
1. Wie ich dazu kam. Was ich
drüben wollte. Der wanderlustige Großvater. Lehrjahre, Wanderjahre.
Wohin in die Welt? Auf nach Amerika! Aber woher das Geld? So etwas wie
Austauschstudent. Englischlernen und Kofferpacken. Die Fahrt nach Hamburg
|
|
|
2. Die Abreise. In Hamburg.
Die Hapag. Im Hafen. St. Pauli. Beim Rathaus. Auf der Alster. Im „Rauhen
Haus“ und im Volksheim. Letzter Tag in Deutschland. Blankenese. Mit dem
Sonderzug nach Kuxhaven. Zum erstenmal auf Deck des Ozeandampfers.
Die Abfahrt
|
|
|
3. Auf dem Atlantischen Ozean.
Bordleben. In der Kabine. Morgen und Abend auf See. Allerlei wohlgemeinte
Ratschläge! Vor Boulogne-sur-mer. Eddystone und die Scilly-Inseln.
Bordspiele. Kulturgeschichte des Meeres. Sozialismus auf dem Meer. In
Erwartung der Landung. In der „upper bay“.
In Hoboken. In den Zollhallen
|
|
|
4. Neuyork. Auf dem Broadway.
Im „subway“. Die Yankees. An der Battery.
Gründungsgeschichtliches. „Wallstreet.“ In Ostneuyork. Auf dem
Metropolitan-Tower. In den Museen und dem Zentralpark. Coney Island, der
größte Vergnügungspark der Welt. Auf Staten Island, in Hoboken, in Bronx.
Die Jahrhundertfeiern auf dem Hudson
|
|
|
5. Boston. Die Eisenbahnen.
Durch Connecticut. Bostons Geschichte im Freiheitskampf. Bostons Bildung.
Die religiösen Denominationen. Ein amerikanischer Sonntag. Im Tempel der
„Christian Science“. „Testmeetings.“ Amerikanisches und deutsches
Kirchentum. Der große Neger Booker T. Washington. Ein wunderbar
wiederentdeckter Onkel
|
|
|
6. An der Harvard-Universität in
Cambridge (Mass.). Unter den Ulmen Harvards. Mein
„furnished room“. In der
Studentenspeisehalle am Klubtisch. Der neue Universitätspräsident.
Amerikanischer Universitätsbetrieb. Fackelzug im Stadium. Im
amerikanischen Kolleg. Vivant professores!
Im kosmopolitischen Klub. Deutsches Kneipen und amerikanische Studenten.
Die Geschichte meines Fracks. Allerlei Herbst- und Winterspaziergänge:
Salem, Bunker Hill usw. Concord, das amerikanische Weimar
|
|
|
7. Ein Fußballspiel und
Weihnachten drüben. Das große Harvard-Yale-Spiel im Harvardstadium.
Harvard unterliegt! Im Vereinshaus des Y. M. C. A.
Thanksgivingday. Heiligabend allein. Weihnachten im Bürgerhaus, bei den
Reichen, im Settlement. Silvesterabend
|
|
|
8. Über den Niagara nach Chikago.
Geld zur Weltreise? Im Pullmann. Die erste nächtliche Fahrt. Am Lake
Erie. In Buffalo. Im deutschen Pfarrhaus zu North-Tonawanda. Ausflug zum
Niagara. Vereist! Eindrücke [S. 6]
des Falls. Auf der amerikanischen und kanadischen Seite. Über Detroit
nach Chikago. Im Auswandererzug. „Der Zug westwärts.“ In Chikagos
Wolkenkratzerschluchten. Nationalitäten. Verkehr. Im Zirkus und im
„Hull-house“. Bei den Spiritualisten.
Geistererscheinungen? Wahrsagerei
|
|
|
9. Über den Mississippi ins
Felsengebirge. Das grüne Land in Illinois. Über den Mississippi und
Missouri. Die Prärie. Kansas City. Ein Reiseschreck! „Mountain-Time.“ In
altspanischem Siedlungsgebiet. In den „Rockies“. Santa Fé. Auf
Indianerpfaden. In der Indianerschule. Unter den San Franzisko-Bergen.
Am Grand Cañon des Colorado River. Abstieg in den Cañon. „Schwarz
Amsels“ Tod
|
|
|
10. Nach Kalifornien. Durch
die Wüsten Arizonas, das Land der schönen Sonnenuntergänge. Im Italien
Amerikas. Los Angeles, ein Paradies. Nach San Pedro. Auf dem Stillen
Ozean. Auf Santa Catalina, dem kalifornischen Capri. Im Theater. „Die
City.“ Mit der „Linie der 1000 Wunder“. An der kalifornischen Riviera.
St. Barbara. Die spanische Gründung. An der Montereybucht. Auf dem
17-Meilenweg. Im Sand des Stillen Ozeans. Die Riesenbäume. Das
Lick-Observatorium. Die Stanford-Junior-Universität. In San Francisco,
der Stadt des Erdbebens. Am „Golden Gate“. Über die Bai nach Oakland.
Auf dem Telegraphenhügel. Das Chinesenviertel
|
|
|
11. Am Großen Salzsee und in
Kolorado. Über die Schneepässe der Sierra Nevada. Durch die Wüsten
Nevadas. Reno und seine Ehescheidungen. Die Frau in Amerika. In Utah.
Über den Salzsee. Ogden. Das mormonische Zion. Im Tempelblock. Der
„Prophet“ J. Smith. Aus der Geschichte des Mormonismus. Die Mormonenbibel.
Nach Kolorado. Durch alpine Kañons und Pässe. Entlang dem Arkansas. Die
„Royal Gorge“. Colorado Springs. Aufstieg zum Pikes Peak. Der
Göttergarten. Manitou. Wieder 36 Stunden durch die Mississippiebenen.
Wieder in Chikago im Schneetreiben!
|
|
|
12. Über Pittsburgh nach
Washington. In Ohio. Im Kohlen- und Eisendistrikt. Das rauchende
Pittsburgh. Beim alten Prediger. Durch die Alleghenies ins Tal des
Monongahela. Harpers Ferry. Ankunft in Washington. Eine adlige Stadt.
Das Kapitol und „Weiße Haus“, die Institute des Staats. Ausflug nach
Mount Vernon. An Washingtons Grab
|
|
|
13. Baltimore, Philadelphia.
Baltimores Gründung und heutige Bedeutung. Die Geschichte der
Quäkerstadt. William Penn und Benjamin Franklin. Germantown.
Pennsylvanien. Auf dem Turm der City Hall. John Hopkins. Über den
Delaware nach Newark und Hoboken. In der deutschen Kirche in Neuyork.
Zurück nach Harvard
|
|
|
14. Kanada. Ein französisches
Kolonialland. Unermeßlichkeit. Die Landschaft der Nordstaaten. In
Montreal. Ankunft und Abfahrt. Auf dem St. Lorenz. An Quebek vorbei. Die
nördliche Route an Labrador. Eisberge. In fünf Tagen nach Schottland. In
Glasgow gelandet
|
[S. 7]
Ich bin nicht nach Amerika gegangen, weil ich etwa in Deutschland etwas „ausgefressen“ hatte oder hier nicht mehr guttat oder weil es mir bei uns nicht mehr gefiel. Ich wollte auch weder Goldsucher noch Farmer werden noch mich gar drüben reich verheiraten. Sondern daß ich hinüberging, das kam so:
Einst kramte ich als dreizehnjähriger Junge auf unsrer Bodenkammer. Da fand ich zwischen dem Kaufmannsladen, dem Prachtstück aller Weihnachtserwartungen in unsrer Kindheit, der ehrwürdigen Puppenstube meiner Mutter, auf die mein Bruder ein schönes zweites Stockwerk aufgesetzt hatte, so daß nun unten im Erdgeschoß Empfangszimmer, Wohnstube und Damensalon, im ersten aber die Küche mit gelbschwarzen Fliesen und die Schlafzimmer angeordnet waren, einer mit sechs Türmen bewehrten trutzigen Festungsburg, in deren Innerem ganze Regimenter Soldaten verstaut werden konnten und deren dicke Mauern den stärksten Kanonen trotzten, zwischen einem alten wohlabgebrauchten Kinderwagen, dessen Radgestell allein noch intakt war, mehreren Reihen verstaubter Einmachgläser, überzähligen Bettdecken und Federbetten, einem Knäuel Wäscheleinen und dgl. auch einen Kasten voller alter Papiere und vergilbter Karten. Ich war allzeit wißbegierig. Die Papiere waren in vergilbten Umschlägen wohlsortiert, wohlgefaltet und ein wenig wurmstichig, aber in haarfeiner sauberster Schrift geschrieben und alle mit einem seltsamen „Ich“ gezeichnet. Die gelblichen Karten waren sauber auf Leinwand gezogen und wohlnummeriert.
„Ich“ war, wie ich erfuhr, das Signum meines Großvaters mütterlicherseits, Johann Carl H., mit dem er alle seine Schriftstücke, selbstverfaßte[S. 8] Gedichte und Briefschaften an Familienangehörige und nächste liebe Verwandte zu unterzeichnen pflegte. Diesen meinen Großvater habe ich nun zwar selbst nie gekannt. Elf Jahre vor meiner Geburt ist er gestorben. In dem nationalen Unglücksjahr Deutschlands 1806 war er geboren. Als bedächtiger Mann von 42 Jahren hat er meine Großmutter geehelicht, also gerade im Revolutionsjahr 1848, und zwar dazu in der Stadt der Paulskirche und des Parlaments, der er als eines ehrsamen Bürgers Sohn entstammte; aber gespürt habe ich ihn in meinem Fühlen, Reisen und Wandern immer.
Lange Jahre war er auf Wanderschaft in der Welt draußen gewesen. Daher stammten die vielen Karten. Er muß ein sehr genauer und auch recht ästhetisch empfindender Mann gewesen sein, denn haargenau war seine Handschrift, wohlabgezirkelt und klar. Und wohlaufbewahrt sind alle seine Gedichte nach Geburtstagen wohldatiert, nach Weihnachtsfesten und Jubiläen in der Verwandtschaft. Und so wanderte er auch, genau und akkurat in allem, nie ohne Karte — schon vor hundert Jahren! Heute läuft jeder Fünfzehnjährige draußen mit einer Generalstabskarte im Kartenhalter auf der Brust herum, aber damals in der Zeit, wo man noch mit der Postkutsche fuhr und die allerersten Eisenbahnen sich schüchtern hervorwagten, war es ein Zeichen selbständiger Akribie und Bildung.
So hat mein Großvater Bayern, Oberitalien, Nordfrankreich und Belgien durchwandert. Wie anders lagen damals noch die Grenzen Europas. Da gab es noch kein Deutsches Reich! Preußen und Bayern lagen noch wie auf zwei verschiedenen Halbkugeln der Erde. Und die freie Reichsstadt Frankfurt a. M. lag stolz und selbständig mitten innen, und ihr weißer Adler auf rotem Grunde regte noch seine eigenen Schwingen! Das habsburgische Österreich aber reichte weit und mächtig gebietend bis tief nach Oberitalien hinein. Mailand und Venedig waren Habsburg untertan. Als ein letzter Rest von jenem Reich Karls V., in dem die Sonne nicht unterging! Belgien war noch kein blutiger Feind für das deutsche Volk, sondern Brüssel ein klein Paris,[S. 9] zu dem der lernbegierige und nach Bildung und feiner Form strebende junge Frankfurter der Biedermeierzeit bewundernd aufsah.
Blut soll ja dicker als Wasser sein. Blut der Vorfahren rollt in unseren Adern, mehr als wir ahnen, und bestimmt uns vielleicht öfter, als wir es uns vorzustellen wagen. Denn wir kommen uns doch immer so frei und selbständig vor! Je mehr wir aber die Eigenart unsrer Ahnen studieren, um so mehr verstehen wir uns selbst und um so mehr erkennen wir, wieviel wir von ihnen ererbt haben. Es war derselbe Großvater, der nach seinem Dienst auf dem freien Frankfurter „Römer“ mit seinen Kindern fast täglich nachmittags in den Stadtwald ging und sie des Abends auf die Waldwiese leitete, wenn das Wild heraustrat zu äsen, der mit ihnen des Sonnabends und Sonntags zu Fuß in das nahe Taunusgebirge zog, als noch keine überfüllten Bahnzüge leicht und schnell Zehntausende dahinführten. Es war derselbe Großvater, der eine echte Schwäbin heimführte, und deren Tochter wieder aus ganz andrer Ecke Deutschlands von der Wasserkante aus altem friesischen Bauerngeschlecht. So wurde in mir Süd, Nord und Mitte Deutschlands wohlverbunden, noch ehe ich auf die Welt kam.
Was Wunder, daß es mich nun in meiner Jugend in alle Gaue Deutschlands zog, daß ich in der Schwabenheimat mich zu Hause fühlte wie kaum wo sonst und daselbst anfing zu studieren! Und daß ich durchaus an der Wasserkante mein erstes Amt versah! Was wunder, daß Schwarzwald und Nordsee mich gleicherweise beglückten und ich aber auch gleich dem Großvater nicht ruhte, bis ich alle Gebirge Deutschlands schon in der Jugend durchwandert hatte. Wir Jungen standen als Obersekundaner auf dem Donon und dem Sulzer Belchen, als die Welt noch an keinen Weltkrieg dachte, auf dem Brocken und dem Kickelhahn, auf der schwäbischen Alb und dem fränkischen Jura als Studenten. Waren das nicht immer noch die Karten des Großvaters, die in mir rumorten?
Merkwürdig, als ich noch in Quarta war, da war, wie meine Zensurbücher ausweisen, mein allerbestes Fach natürlich die Geographie, wo[S. 10] ich sehr oft eine blanke Eins bekam. Die Städte an der Elbe konnte ich damals besonders gut und rasch bei unserm Geographielehrer — von dem ich noch nicht ahnen konnte, daß er nach beinahe zwanzig Jahren ganz woanders zum Oheim meiner künftigen Frau werden würde! — herunterschnurren, als noch niemand mir zu prophezeien wagte, daß ich ausgerechnet in einer unter ihnen, dem unvergleichlichen Dresden, mein Domizil aufschlagen und von einer andern aus in die neue Welt fahren würde. Es liegen anscheinend mehr Weissagungen schon in unsrer Jugend verborgen, als wir oft auch nur zu ahnen wagen würden.
So kam für mich die Zeit, da es in Deutschland anscheinend nichts mehr zu durchwandern gab. Nun mußte man eben als guter Deutscher ins Ausland gehen. Denn das Ausland gilt dem rechten Deutschen immer mehr als die Heimat! War es uns nicht auch, auch wenn nicht schon die Abstammung dahingewiesen hätte, immer in der Schule an den Großen eingeprägt worden, was sie nicht erlernt, das hätten sie erwandert?! Und beim Wandern lerne man mehr als in der besten Lehre! Sollen nicht in guter Reihenfolge in jedes rechtschaffenen Menschen Lauf auf Lehrjahre Wanderjahre folgen? Auch schon darum durfte ich von dieser Regel nicht abgehen.
Aber wohin ins Ausland? Meine Examina waren gemacht, der Eintritt in den Beruf stand bevor. Dazwischen hinein ließ sich noch das Ausland einschieben, selbst auf die Gefahr hin, daß man ein oder zwei Dienstjahre später einrückte. Die Jugend hat Idealismus! Nur nicht zu pedantisch! Was kümmern zwei Jahre? Der Trott in den wohlausgefahrenen Dienstgeleisen konnte noch bald und lange genug kommen! Also hielt mich nichts! „Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir erblüht!“ Dem jungen Menschen steht die ganze Welt offen. Der Alpdruck der Prüfungen war überwunden; die Tore der neuen Lebenszwingburgen hatten sich noch nicht aufgetan. Zum letztenmal war man noch ungebunden und jung. Also hinaus in die Welt!
So war es mir fast zur Selbstverständlichkeit geworden: Ich gehe[S. 11] ins Ausland. Gleich, wohin! Nur einmal hinaus! Einer meiner Ahnen ist als württembergischer Gefolgsmann Napoleons I. in Rußland geblieben. Aber an Rußland — war es zu bolschewistisch? — dachte ich gar nicht. Südwärts oder westwärts konnte es gehen, in die alte oder in die neue Welt!
Den humanistisch einst wohlgebildeten Gymnasiasten lockte Italien und Griechenland, das heilige Land oder Ägypten! Nun waren wir als Oberprimaner schon einmal bis zum Gardasee vorgedrungen und hatten — ich weiß es noch gut — als gute Deutsche vom Gardasee die erste, natürlich italienisch geschriebene Postkarte nach Hause gesandt. Als Studenten waren wir bis ans römische Forum und bis zu St. Peter gekommen, tasteten uns durch die Kallistkatakomben und besichtigten eingehend alle heiligen sieben Mutterkirchen Roms. Jetzt hätte es heißen müssen: Athen oder Jerusalem! Das wäre ein folgerichtiger Bildungsgang gewesen. Aber so folgerichtig geht’s nicht immer im Leben. Das Leben enthält vielmehr Zufälle und Sprünge — und hinterher scheinen sie auch ganz folgerichtig zu sein! Wer weiß, ob mir nicht die neue Welt beschieden war!
Ich arbeitete damals gerade an den Schriften eines bedeutenden amerikanischen Psychologen, um auf echte deutsche Art ihn zu einer Doktordissertation zu „verarbeiten“. Aber nicht bloß der Geist, auch das Blut drängte nach Amerika. Zwei Schwestern meines Vaters waren schon früh in ihrem Leben nach Neuyork übergesiedelt und waren „Bindestrich-Amerikaner“ geworden, wie Wilson die Deutschamerikaner im Weltkriege so geschmackvoll zu definieren beliebt hat. Beide hatten sich mit ihren Männern und Familien der Musik verschrieben, die eine schrieb allerlei in Zeitungen und Romanen.
Aber wie nach Amerika kommen? Ebenso wie zum Kriege gehört zum Reisen Geld und nochmals Geld und zum dritten Male Geld. Erst recht ins Land des Dollars. Aber daran fehlt’s gewöhnlich gerade denen, die es ganz ideal zu verwenden am ehrlichsten geloben könnten. Sollte ich als blinder Passagier hinüberfahren? Aber das war zu unsicher und mir auch nicht „ehrlich“ genug. Und wie hätte[S. 12] das drüben weitergehen sollen? Oder vielleicht als Kohlenschipper? Dazu fehlten mir Muskeln und Übung. Eine studierte Schreiberseele führt schlecht die Schaufel. Auch sieht man bei dieser nützlichen, wenn auch rußigen Tätigkeit zu wenig vom Meer und seinen Schönheiten. Aber vielleicht als Steward? Nicht, daß mich ein falscher Standeshochmut abgeschreckt hätte. Ist doch heute dem Werkstudenten alles recht und billig und hatte ich auch eine liebe und treffliche entfernte Verwandte, die fast neunzigjährig starb, mit fünfundzwanzigjährigem Fahren auf einem großen Lloyddampfer ein kleines Vermögen für ihre alten Tage verdient, das sie bis ans Ende ehrlich ernährte. Aber ob ich bei tüchtigem Seegang nicht alle Tassen und Teller hinwerfen würde? Dafür konnte ich keine Garantie übernehmen. Davor hätte auch kein Studium der Philosophie oder was sonst mich bewahrt, wenn ich auch als kleiner Junge daheim zeitweilig mit Vorliebe den Tisch gedeckt und gleich meinem Ältesten heute mit Vorliebe in der Mutter Puppenstube die Möbel umgeräumt habe und noch heute am liebsten immer selbst angebe, wie und wo die Möbel stehen sollen. Also etwas Anlage zum Steward lag vielleicht auch in mir, aber ob sie reichte?
Ich fing es lieber doch so an, wie es zunächst meiner Lehre entsprach, und hielt es mit dem Sprichwort: „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“ Vielleicht glückte es irgendwo in amerikanischen Wüsten oder Küsten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Hauslehrer in einer wohlhabenderen deutschen Familie zu werden? Die würden dann schon das Reisegeld schicken.
Ich war damals dabei, wie gesagt, meinen Doktor rechtschaffen mit dem amerikanischen Psychologen zu bauen. Während ich morgens über Spinoza, Kant und Hegel nachdachte, mein Hirn mit den Problemen der „Kritik der reinen Vernunft“ strapazierte, hielt ich es des Nachmittags ein wenig mehr mit der „praktischen Vernunft“ und schrieb Briefe und Bewerbungen in alle Welt hinaus, wo nur ein Privatlehrer, Erzieher, Lehrer oder wer weiß was gesucht wurde; wo es war, war mir gleich, mochte es Kairo oder Konstantinopel, Chikago[S. 13] oder Tokio sein. Nur wurde in entfernteren Ländern meist eine mehrjährige Verpflichtung verlangt! So ernst wollte ich es aber gar nicht mit dem Auswandern nehmen. Etwa auf fünf Jahre mich zu verpflichten, schien mir sehr gewagt und viel zu lang. Wie lang erscheinen fünf Jahre der Jugend! Die Auslandsfahrt sollte mehr nur so ein recht großer Ausflug zwischen Examen und Berufsbeginn sein, so ein bißchen Globetrotter auf Zeit ...
Da lese ich eines Tages in einer unsrer Zeitschriften ein großes amerikanisches Stipendium gerade der Universität ausgeschrieben, an der mein Doktorthema noch als lebendiger Mensch und angesehener Professor lebte und lehrte. Es war mir sofort so, wie wenn jemand zu mir gesagt hätte: „Das ist für dich, schreib nur hin — du kriegst das.“ Man soll doch manchmal ruhig etwas auf vernünftige Ahndungen und Eingebungen halten!
Ich schrieb also hübsch sauber, wie sich das in solchen Fällen wohl gehört, auf einen blanken Foliobogen meinen Lebenslauf und auf andere meine Zeugnisse, ließ einige Bittbriefe an hohe und gelehrte Herren in Deutschland, die mir trauten und drüben etwas galten, aus dem stillen idyllischen Universitätsstädtlein, in dem ich saß, in die Welt hinausflattern. Und die hohen und gelehrten Herren hatten alle ein gutes und wohlwollendes Herz und stimmten offenbar dem Willen zu den „Wanderjahren“ in mir aufrichtig zu und müssen mich wohl recht dem hohen amerikanischen Universitätskuratorium empfohlen haben ... denn nach einigen Wochen kriegte ich es wirklich, wie ich es gleich in mir gefühlt hatte. Ein Telegramm hatte es mir vorher per Kabel — NB: jedes Wort kostete eine Mark! — angezeigt. Aber auch ohne das wußte ich es innerlich schon längst, seit ich die Ausschreibung gelesen hatte. So also kam es, daß ich nach Amerika hinüberging, obwohl mir das nötige Reisegeld durchaus dazu fehlte. Ein bißchen Glück gehört eben auch zum Leben immer dazu.
Als ich meinem besten Freunde die Entscheidung mitteilte, da sagte er bloß trocken: „Nun mußt du hin!“ Ja, nun mußte ich hin! Da fühlte ich zum erstenmal, daß es doch ein Entschluß war, als[S. 14] junger Mensch allein in die neue Welt zu fahren. Was würde ich alles sehen? Was alles erleben? Ich freute mich unbändig.
Viele sagen, das Schönste am Verreisen sei das Plänemachen. Da ist auch sicher etwas daran. Die Vorfreude auf Weihnachten ist ja oft schöner als nachher Weihnachten selbst. Wie manchmal stieg es bei den Vorbereitungen heiß in mir herauf: „Jetzt wird es ernst!“ Alle die fremden Menschen und Städte, die fremde Sprache tauchten wie flimmernde Bilder vor der Seele auf, und mitten hinein rauschte schon das gewaltige Meer ...
Meinem Vater war es nicht ganz recht. Er hielt es mehr mit dem weisen Wort: „Bleibe im Lande und nähre dich redlich!“ Es wäre ja nun auch an der Zeit gewesen, selbst daheim Geld zu verdienen, statt neues auszugeben. Aber da er selbst an der Wasserkante aufgewachsen war, steckte auch in ihm genug Hanseatengeist, um sich schnell damit abzufinden.
Vor allem lernte ich zunächst fleißig wieder Englisch, denn der rechte Deutsche setzt doch seinen Stolz darein, firm in der fremden Sprache an den fremden Strand zu treten. Die englischen Schulbücher wurden wieder hervorgeholt und emsig Vokabeln und unregelmäßige Verba gepaukt: „think — thought — thought, fall — fell — fallen usw.“. Dazu las ich englische Schriftsteller der Schulzeit noch einmal: Kipling und Irving, ein bißchen Walter Scott und Shakespeare, den mir ein alter lieber Professor, der von den Hugenotten stammte, auslieh, und zum Überfluß ging ich als großer Mensch noch einmal in eine Sprachprivatschule, um nicht nur Wörter und Sätze zu verstehen, sondern auch sprechen zu können und eine gute Aussprache zu haben. Wie begeistert war einst mein Bruder aus ihr heimgekommen, daß dort der Lehrer gleich englisch angefangen hatte und kein Wort deutsch sprach: „This is a pencil. What is this? A pencil usw.“, indem er belehrend seinen Bleistift zur allgemeinen Ansicht in die Höhe hielt und sich nur durch Zeichen mit seinen Schülern verständigte. Wir in der Schule hatten bieder Deutsch und Englisch durcheinandergeredet[S. 15] und brav erst Vokabeln und Grammatik gelernt. Aber trotz allem — o weh — wie ging es mir zuerst drüben! Ich las zwar ganz flott Bücher und Zeitungen, aber das Verstehen fiel mir doch schwer. Sie redeten drüben nachher alle so schnell! Wie der Wind war es um die Ecke, was sie gesagt hatten! Das Ohr war noch nicht an die fremden Laute gewöhnt. Und mit dem Antworten war es auch nicht so ganz einfach, denn die alleralltäglichsten Redensarten hatte man doch noch nicht gleich fertig auf der Zunge liegen.
Zu Hause wurde währenddem viel für mich genäht; eine ganze Woche war die Näherin, die schon Jahrzehnte in der Familie erlebt, allein für mich da. Dann sollte auch noch ein Reiseanzug herbei, natürlich in Schnitt und Falten etwas „englisch“, desgleichen der Mantel und die Reisemütze. Sie flog mir allerdings gleich am ersten Nachmittag auf See bei einem kräftigen Windstoß an der Ecke des Decks ins Meer, gewiß weil sie zu sehr englisch war. Dahin war dahin, sie ruht nun wohl schon manches Jahr auf dem Grund des Ozeans, wenn sie nicht der Golfstrom wer weiß wohin entführt hat. Aber da ja in der Welt nichts an Stoff und Energie verlorengehen kann, sondern sich höchstens in andere Formen verwandelt, so existiert meine Mütze ganz gewiß auch noch. Nur weiß man nicht, wo und wie. Vielleicht dient sie heute einem Haifischgroßpapa als Kopfkissen beim Mittagsschläfchen oder wem sonst ...
Mein Schiffsbillett hatte ich auch schon bestellt. I. Kajüte war natürlich für mich bescheidenen Nichtsverdiener zu teuer. Blieb Zwischendeck oder „Zweiter“? Es hätte nur verhältnismäßig wenig — ich glaube fünfzig Mark — Unterschied gemacht, wenn ich Zwischendecker geworden wäre. In der Zweiten fuhr man menschlich, sogar mehr wie menschlich, für meine Erstlingsansprüche recht feudal. Ich habe es auch nicht bereut, als ich später das Menschengewürfel von Italienern, Slowaken, Russen und Griechen im Zwischendeck und ihr gegenseitiges Zusammenleben sah!
So gingen die Wochen der Vorbereitung hin. Eines Frühmorgens hieß es um vier Uhr aufstehen. Die Koffer waren längst sorglich gepackt.[S. 16] Ein großer ehrwürdiger Familienkoffer, mit dem schon meine Eltern mit uns Kindern allen vor vielen Jahren an die See gereist waren, für den Gepäckraum, und ein flacherer neuer für unter das Bett zu schieben, wie es die Hapag verlangte. Dann ging es an den Bahnhof, ein letzter Kuß und Händedruck ... Wann und wie würde man sich wiedersehen ...? Eigenartige Gefühle überkommen einen. Man schluckt etwas hinunter ...
Ich fuhr durch das freundliche hessische Land, wie schon so manches Mal. Die so malerisch gelegene hessische Universitätsstadt Marburg grüßte mit ihrem alten Landgrafenschloß und der feinen Kirche der heiligen Elisabeth mich noch einmal als Marburger. Dort oben bei der hohen Pfarrkirche hatte ich in aussichtsreicher Studentenbude gewohnt. Da drüben hatten wir in den alten gotischen Kreuzgewölben zu Füßen unsrer akademischen Lehrer gesessen, und hier oben am Waldsaum waren wir gar manchmal zum Kaffee zum „Hansenhaus“ hinaufgestiegen. Vor Kassel türmte sich hoch oben auf dem Habichtswald der mächtige Herkules über Schloß Wilhelmshöhe ... In Göttingen kreuzte uns der Gegenzug. Ich kannte die Strecke. Als neunjähriger Junge war ich sie zum erstenmal gefahren, als es zur Hochzeit ins große Hamburg ging. Es war damals ein Freitag, weiß ich noch. Sonntags sollte Hochzeit sein. Und am Sonnabend entgleiste derselbe Zug, mit dem wir tags zuvor fuhren, in der Lüneburger Heide, da ein von einem Güterzug gefallener Querbaum die Geleise verbogen hatte. Ein Freitag soll ja immer ein Glückstag oder ein Unglückstag sein. Und mich hatte es nicht getroffen. Diesmal rasten wir ohne Unfall durch die Lüneburger Heide. Sand, Kiefern, Moore ... Blauäugige, blondhaarige Menschen und rotgedeckte Ziegelhäuser flogen an uns vorüber. Dann donnerten wir über die großen Harburger Elbbrücken. In Rauch und Dunst lag Hamburg da. Hoch überragte der schlanke gotische Turm der Nikolaikirche die mächtige Stadt. Links fauchten auf der breiten Elbe die Ostafrikadampfer der Woermann- und der Levantelinie. Ich stellte mir im stillen ihre Maße vor und wünschte mir unser Schiff noch[S. 17] etwas größer. Alles rauchte, fauchte und tutete, die Sirenen heulten. Kleine Boote und Dampfer schossen hin und her ...
Der Hafen war ein Gewirre von Masten und Schornsteinen, großen und kleinen Booten, Ozeandampfern und Elbschiffen, Schleppern und Passagierdampfern. An dem langen Uferkai Lagerhäuser an Lagerhäuser, Brücken, Krane, Kraftwagen ... Welch mächtiger Verkehr! Dann waren wir in die riesige Halle des neuen Hamburger Hauptbahnhofes eingefahren. Nun gab es kein Zurück mehr. In zwei Tagen ging es über den Atlantischen Ozean ...
Wer bei uns einen Vorschmack vom Weltverkehr haben und Luft von Übersee einmal in die Nase ziehen will, muß wenigstens ein paar Stunden in Hamburg herumlaufen ...
Ich trat aus dem Hauptbahnhof und nahm zuerst meinen Weg über die breite Lombardbrücke, die die Innen- von der Außenalster scheidet. Immer aufs neue von hier war der Blick prächtig über die weite von flinken Dampferchen belebte schimmernde Seefläche. Was wäre Hamburg ohne seine Alster und ohne seinen „Jungfernstieg“, die Promenade der feinen Welt an dem kleineren Becken der Innenalster, mit seinen kostbaren Läden und „fashionablen“ Cafés!
Ich suchte mir zunächst Quartier, freilich nicht in einem der großen internationalen Hotels, sondern in einem bescheidenen, sauberen Heim, wo ich mit Stewards, Kellnern aller Art und allerlei anständigen jungen Seeleuten zusammentraf. Es war alles im Hause sauber und gut ...
Ich setzte mich des Abends zu den andern Gästen an den Tisch und ließ mir von ihren Reisen erzählen, von Quebek und Brasilien, von Petersburg und Neuyork! Wo die schon alles in ihren jungen Jahren in der Welt herumgekommen waren! Sie erzählten vom Leben an Bord, von hartem Dienst, von Scherz und Spiel, von Sturm und heiterer Fahrt, von seekranken Damen und trinkgeldgeizigen Herren, von ordentlichen und unordentlichen Kameraden, die ihren Lohn[S. 18] drüben in wenigen Stunden verliedert und verludert hatten, die mit keinem Cent in der Tasche wieder an Bord gingen, ja ihre Uhr als letzten Besitz noch als Pfand dalassen mußten. Zum Schluß setzte sich einer von ihnen ans Klavier und in trefflichem Ton sangen alle die flachsblonden, blauäugigen, hochgewachsenen friesischen jungen Menschen: „Schleswig-Holstein, meerumschlungen ...“, daß es nur so eine Art hatte. Was für ein Unterschied war doch zwischen den Schwarzwälder oder oberbayrischen Bauernburschen und diesen blonden Holsteinern!
Am andern Morgen war mein erster Gang in das mächtige Geschäftsgebäude der Hapag, mein Schiffsbillett zu holen, um dann an den Hafen zu den Gepäckhallen zu gehen und nachzusehen, ob auch mein großer grüner Koffer mit den vielen Büchern wohl angekommen und bereit sei, mit mir nach Amerika zu fahren. Welch ein Getriebe überfiel mich am Hafen! Hatte ich ihn tags zuvor nur flüchtig und aus der Eisenbahn von oben überschaut, so nahm er sich jetzt von unten, wenn man mitten drin war, noch ganz anders aus! Die vielen Boote, Kanäle und Brücken, Krane und Frachtwagen, die himmelhohen Lagerhäuser! Welch ein Durcheinander von Pfeifen, Signalen, Schreien, Rufen, Schelten, Fahren, Rasseln der Ketten ... und über allem dicker Dunst, Rauch und Teergeruch. Wahre Kompanien von Schauerleuten und Lademannschaften und dahinter die Kontore, Bureaus, Magazine und Ladehallen mit einem Heer von Angestellten, Schreibern, Zollbeamten ... Da sah und horchte die Landratte auf: Das war Hamburg! Das war Weltverkehr!
Ich hatte mich glücklich bis zu der richtigen Lagerhalle durchgefunden und durchgefragt. Berge von Koffern türmten sich vor mir auf; es sah aus, als wollte ganz Deutschland mit einem Male auswandern ... Und wirklich — richtig, da drüben zwischen hundert andern stak auch mein großer grüner mit dem gewölbten Deckel, auf dem die nächsten etwas unsicher balancierten, und lachte mich wie ein guter Kamerad freundschaftlich an. Trotz all seiner Vielbenutztheit und seinem Abgeschabtsein — er hätte getrost singen können: „Schier dreißig Jahre[S. 19] bist du alt“ — hätte ich ihm jetzt um den Hals fallen mögen: „Da bist du ja, guter Freund, hab Dank, daß du mich nicht im Stich gelassen hast ... nun wollen wir auch weiter treulich zusammen übers Meer fahren und drüben zusammenhalten ... und gebe Gott, auch beide wieder gesund heimkommen ... vor allem aber, alter Freund, krach’ mir ja nicht unterwegs, der du den Bauch voll vieler schwerer Bücher hast, auseinander!“ —
... „Nein, nein, was du nur von mir denkst, so alt bin ich denn doch noch nicht, hab immer noch Kräfte genug zusammenzuhalten“, schmunzelte er behäbig zurück. „Du kannst dich auf mich verlassen!“ Und er hat seinen Schwur gehalten! Es sei ihm heute noch gedankt. Als ich so beruhigt und vollkommen getröstet aus der Halle wieder hinausging, scholl hinter mir ein erschütterndes Gelächter her. Tiefe Baßstimmen von den schwersten Reisekörben bis zu den hellen hochmütigen Stimmen der feinen Damenkoffer. Oder war es eine Gruppe von Schauerleuten? Was lag mir daran ...
Ich bestieg einen der flinken Hafenrunddampfer von Käses berühmter Hafenrundfahrt und ließ mich ¾ Stunden lang für einen einzigen Groschen in allen Richtungen im Hafen herüber und hinüber, an allen Molen und Landestellen, auf allen Hafenarmen und auch auf der freien Elbe umherfahren. Die Elbe warf dabei oft recht stattliche Wellen. Das kleine hochbordige wackere Dampfboot stieg auf und nieder; aber manchmal brach auch ein tüchtiger Guß über den Bug herauf aufs Vorderdeck und überschüttete die allzuweit Vornanstehenden mit einem nicht gerade immer willkommenen Bade.
An den St.-Pauli-Landebrücken stieg ich aus und klomm zur Seewarte empor und in ihr bis auf das aussichtsreiche Dach. Welch ein majestätischer Rundblick sich von oben bot! Drunten die breiten im Sonnenschein herrlich glitzernden breiten Elbarme mit ihren Hunderten von hin und her schießenden Booten, weiter hinaus die Docks und Werften, die rauchenden Schlote bis hin zu den sanften Linien des grünen Hinterlandes. Über der Stadt selbst der übliche Rauch und Qualm — darin tut’s Hamburg London gleich —, aus dem richtunggebend[S. 20] hoch und schlank der Nikolaiturm emporstieg. Eindrucksvoll präsentierte sich von hier oben Lederers fast zyklopisches Bismarckdenkmal auf der Elbhöhe, ein unübertreffliches Symbol deutscher Kraft, deutschen schaffenden Willens und hoffnungsfreudigen Blickens in eine neue Zukunft: Deutschland kann seine Söhne allein nicht mehr ernähren, wenn es nicht wieder mit der ganzen Welt handelt und für sie arbeitet. Ist auch das Werk des Alten im Sachsenwalde eingerissen worden, aber sein Geist lebt fort und wird wieder auferstehen.
Ich schlenderte durch St. Pauli, die berüchtigte Schiffer- und Arbeitervorstadt Hamburgs, übel berühmt durch ihr loses und leichtfertiges Vergnügungsleben. Hier will der von schwerer Seefahrt heimgekehrte und entlohnte Matrose sich „erholen“, d. h. austoben und ausleben, nachdem ihn wochenlang harter Dienst und strammes Kommando in Fesseln gehalten hat. Und wie verführerisch lockt des Abends die lichterfüllte, überall orgelnde, tönende, schreiende „Reeperbahn“, an der Kino an Kino, Varieté an Varieté sich reiht mit all ihren dunklen Gassen seitabwärts ...
Aus diesem St. Pauli ging es zurück durch die Stadt und ihre breiten und belebten Geschäftsstraßen, wie sie nun nach gewaltigen Durchbrüchen am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Ich warf einen Blick in die ehrwürdige Nikolaikirche. Vom hohen Turm von St. Nikolai klang um Mittag das melodische Glockenspiel, das bis vor kurzem ein hoch in den siebziger Jahren stehender Onkel von mir zu spielen hatte, der täglich durch Jahrzehnte hindurch die 400 Turmstufen emporstieg, um auf seiner Spielbank da oben im luftigen Reiche Platz zu nehmen. Und er behauptete immer, sooft man ihn begleitete, diese tägliche Turnübung allein habe ihn bis in sein hohes Alter so gesund erhalten ...!
Die herrlichen Säle des Rathauses mit ihren kostbaren Gemälden sah ich gern einmal wieder. So machts doch der gute Deutsche: Wenn er einen einzigen Tag in einer fremden Stadt zubringt, besieht er sich emsig und umsichtig, ein ausführliches und gelehrtes Reisehandbuch in der Hand, alle Sehenswürdigkeiten, und es schmerzt ihn nachher[S. 21] sehr, irgend etwas Wichtiges und Berühmtes vielleicht doch übersehen zu haben. Aber in der Geburtsstadt kann es einem passieren, daß man — wie mir selbst — zum ersten Male in Goethes Geburtshaus hineinkommt, wenn man es von auswärts zugereisten Verwandten zu zeigen hat!
Sooft ich in Hamburg war, konnte ich es mir auch nicht versagen, wenigstens einmal über die Alster zu fahren. Eine Alsterfahrt gehört immer zu den idyllischsten Erinnerungen. Die Alster ist immer schön, am strahlenden Sommertag und ebenso im herbstlich früh einbrechenden Abenddunkel, wenn die Alsterboote mit ihren Lichtern wie Leuchtkäfer im Nebel hin und her flitzten. In trauter Erinnerung stand bei mir seit den Kindertagen auch das Uhlenhorster Fährhaus, von dessen herrlicher Terrasse man einen solch entzückenden Blick über das weite Alsterbecken bis hin zu den vielen fern und schlank aufragenden Türmen Hamburgs genießt.
Hinter Uhlenhorst liegt der Vorort Horn. Er war mir auch seit meiner Kindheit bekannt, seit in seiner kleinen Kirche einst mein ältester Bruder getraut worden war ... Ich sehe noch immer die nach Althamburger Sitte lange Wagenreihe vor mir, die da mit der großen Verwandten- und Bekanntenschaft hinausstrebte. Und ich durfte damals als kleiner viel verhätschelter Junge mitten zwischen den Brautjungfern sitzen! Und dann defilierten wir durch die vielen neugierig an der Eingangstür wartenden Vorstadtkinder ... und oben auf der Orgel intonierte der siebzigjährige Onkel L., dessentwegen das kleine Kirchlein zur Trauung gewählt worden war, derselbe, der täglich zum Glockenspiel auf den Nikolaiturm hinaufstieg.
In Horn steht bekanntlich auch Wicherns berühmtes „Rauhes Haus“, darin einst der Kandidat Wichern und seine Mutter Wohnung nahmen, um selbstlos arme verwahrloste Knaben zu erziehen. Jetzt sind es mächtige ausgedehnte Erziehungshäuser der „Inneren Mission“. Die Anstalt erfüllt heute einen gar weiten Komplex, in dem sich aus freundlichem Grün die einzelnen Häusergruppen familiär und traulich erheben. Als „Familien“, von Brüdern und Helfern betreut, leben hier[S. 22] die Zöglinge zusammen. Wie mancher mag hier fürs Leben wirklich „gerettet“ worden sein, so daß die Anstalten mit Recht ihren Namen tragen.
Für soziale Arbeit habe ich mich schon früh immer stark interessiert. Gerade in Hamburgs Straßen blickte ich manchem hungrigen Straßenhändler oder armen streichhölzerverkaufenden elternlosen Kinde in die Augen ... Ich weilte in des gottbegnadeten Pastor Clemens Schulz’ Lehrlingsverein, der dem alten Herrn die Familie ersetzte, und sah mich um in den sozialen „Volksheimen“ und fühlte mich jedem Eckensteher und „Halbstarken“ ein bißchen verwandt. Waren sie nicht alle auch Menschen und Brüder? Was können sie für das Elend, in dem sie aufgewachsen sind, für Not und Irrtum, die sie in Schuld getrieben? Zeitweilig hatte ich einmal ernstlich die Absicht, mich ganz der verwahrlosten Jugend in St. Pauli zu widmen ...
So strich ich damals von Horn aus in Rothenburgsort und Hammerbrook umher. Vor 30 Jahren war hier noch grünes Marschland. Jetzt reihen sich grauschwarz und schmutzigberußt die langen traurig-öden Straßenzeilen mit ihren Mietskasernen, ihren dunklen Höfen und düstern Hinterhäusern aneinander. Hier wohnen die Menschen so dicht, daß oft ein einziger Straßenblock 4000 Menschen mit etwa 1700 Kindern, genug für eine 32-(!)klassige Volksschule, beherbergt. Hier wächst eine Jugend auf, deren Spielplatz die Straße, deren Hauptbildner das Kino ist, die von blauem Himmel, grüner Marsch und singenden Vögeln nur wie von Sagen und Märchen hören. Ihre Ahnen waren einst selbständige wackere Holsteiner Bauern, Handwerker und Fischer; jetzt zerreibt und zermahlt sie die Großstadt zwischen Schloten und Maschinen, zwischen seelenloser Fabrikarbeit und brutalsinnlichen Vergnügungen zu einer einförmigen, grauen Masse, „Proletariat“ genannt, oft ohne jeden Glauben an Innerlichkeit. Denn im Rauch, Getöse und Herdendasein der Großstadt stirbt das Persönliche. Und mit ihm stirbt Lebensfreude und -glück. Aber im „Volksheim“, da suchte man wieder den Menschen zu wecken. Da turnten fröhlich die Knaben, da wurde gutes Theater gespielt; naturwissenschaftliches[S. 23] Kränzchen und Billardklub, Rezitation und Bücherei, Bastel- und Schnitzabend, Schachspiel und Schlagball blühten und gediehen friedlich und fröhlich miteinander. Zeigt nicht ähnliche Zustände die Großstadt überall, sei es Berlin oder Hamburg, Neuyork oder Chikago? Die Großstadt ist am allermeisten und im bösesten Sinne „international“. Überall frißt sie das Land und die Seele der Menschen zugleich.
In die innere Stadt zurückgekehrt, umflutete mich wieder das Leben der großen Geschäftsstadt, die Warenhäuser mit ihren wimmelnden ein- und ausströmenden Menschen, die fliegenden Straßenhändler, die klingelnden Straßenbahnen und tutenden Autos, die Laufjungen und Portiers, all die vielen kleinen Theater und Spielhallen, die Ewerführer auf dem Kohlenkahn die düstern Fleets entlang, die Wirte der Hafendestillen, die Fuhrleute und Packer, die Börsenmänner und Geldleute und endlich im Alsterpavillon die schlemmenden gelangweilten feinen „Damen“. Welch eine gegensätzliche Welt! Welch eine Sachenkultur! Elend und Reichtum, Verdorbenheit und Selbstsucht dicht beieinander.
Aus der stickigen Großstadtluft trieb es mich am Nachmittag mächtig hinaus nach dem Land. Ich fuhr daher nach dem so reizvollen Blankenese an der unteren Elbe, Hamburgs Perle, hinaus. Aus den dunkeln, dumpfigen Winkeln und Kellern, Straßen und Hinterhöfen voll pestilenzialischer Gerüche und verbrauchter Luft ging es zu Schiff hinaus in die frische freie Luft des breiten Stroms und des saftgrünen Landes, dahin, wo einem schon Salzluft der Nordsee entgegenweht. Am alten Michel vorbei, St. Pauli vorüber, entlang den Reihen der vornehmen Landhäuser der Großkaufherren in Kleinflottbeck ... Am Strande des Flusses lagen vergnügte und sorglose Menschen in ihren hellen Kleidern im weißen Sande; Kinder plantschten im Wasser und ließen ihre kleinen Segelboote schaukeln ... In der Sonne gebräunt-leuchtende, badende Jungen, schwammen hinter dem Dampfer her und tauchten fröhlich in seinen spritzenden Wellen ... und drüben lag behäbig und unentwegt das satte, saftige grüne Marschland, und draußen wartete auf uns das blaue Meer.
[S. 24]
Oben vom Süllberg aber und seiner weitblickenden Aussicht konnte man sich kaum trennen. Eine Musikkapelle spielte lustige Weisen. Es war prächtig, da oben zu sitzen und über den weiten meerarmartigen Strom und das weite grüne Land zu schauen. Die Musik war die Auslöserin der rechten Abschiedsgefühle. Deutsche Lieder würden wohl sobald nicht mehr an mein Ohr klingen ... Langsam spülte die Flut herein. Allerlei flache Inseln und Sandbänke im Strome tauchten unter. Mit Sonnenuntergang versank für mich auf lange ein letzter Tag auf deutschem Boden ...
Ebenso strahlend brach dann der Augustsonntag an, der mich der alten Welt entführen sollte. Auf dem Hamburger Hauptbahnhof war ein furchtbares Gewühl von Menschen, wie an schönen Sommertagen auf allen deutschen Großstadtbahnhöfen. Tausende von Ausflüglern flohen aus der heißen Großstadt in die Lüneburger Heide, in den Sachsenwald, ins Holsteinische. Dazwischen wimmelten noch die Ozeanpassagiere zu Hunderten. Unser Sonderzug dampfte punkt sieben Uhr zunächst mit den Passagieren der zweiten Kajüte aus der Halle, bis zum letzten Platz besetzt ...
Im hellen Sonnenschein ging es durch die grüne Marsch der Elbe entlang — doch war sie selbst selten sichtbar — über Stade nach Kuxhaven. Im Wagen redete alles bereits deutsch und englisch durcheinander. Die echten Deutschamerikaner redeten ihr Deutschamerikanisch: „Well, think, wir gehn nach vorn“ u. ä. Deutsche Kinder antworteten ihren deutschredenden Eltern prompt auf englisch. Übrigens war mein letztes deutsches Erlebnis gewesen, daß der Gepäckträger mir schnell noch vor der Abfahrt zu wenig herausgab! Immer noch besser als jenes erste deutsche Erlebnis des Japaners Utschimura, dem auf dem Hamburger Hauptbahnhof gleich sein ganzes Portemonnaie nebst wohlgefülltem Inhalt gestohlen wurde ...!
Nach zweistündiger flotter D-Zug-Fahrt lenkten wir plötzlich wieder der Elbe zu. Die grüne Marsch, die grasenden Rinderherden entwichen ... Dort drüben dicht vor uns strahlend gelb und weiß im[S. 25] hellen Sonnenglanz lag unser Schiff, und hinter ihm dehnte sich bis an den Horizont tiefblau die Nordsee ...
Schon liefen wir in die Bahnhofshalle von Kuxhaven ein. Ich faßte mein Handgepäck. Blaugekleidete Stewards mit goldenen Knöpfen und weißen Handschuhen sprangen uns gar artig bis auf den Bahnsteig entgegen und nahmen uns das Handgepäck ab. Ich hielt aber in übertriebener Vorsicht das meine ziemlich fest in der Hand und schleppte es lieber im Schweiße meines Angesichts und meines Reisemantels am warmen Hochsommersonntagmorgen selbst bis zum Schiff hinauf. Einige Schritte ging es noch durch die langen Zollhallen, dann von der Halle bis an die Kaimauer ... zuletzt an einer Reihe Schutzleute vorüber die Schiffstreppe hinauf: für die Landratte ein eigenartiger Moment! Weil alle es so machten, machte man es auch so. Noch einmal wurde der Fahrschein kontrolliert ... oben an der Schiffstreppe standen die Schiffsoffiziere in weißen Handschuhen, die Hand grüßend an der Mütze. Von der Kommandobrücke sah der Kapitän, eine Menge goldener Streifen um den Arm, prüfend herab ... Hinter einem Seile auf dem Vorderdeck wie Vieh eingesponnen und zusammengedrängt standen die Zwischendecker, darunter Physiognomien wie aus einer Verbrecherkolonie, Russen, Polen, Italiener, Griechen, Juden aller Herren Länder ... Sie waren mit dem Gepäck schon in Hamburg eingeschifft worden.
Durch merkwürdig schmale Gänge wurde man auf dem Schiffe selbst in die Kabine gewiesen. Unser Kabinensteward war ein freundlicher, hilfsbereiter junger Mensch. Die Kabine fand ich recht geräumig; sie enthielt je vier Betten, zwei übereinander, und einen hübschen Waschtisch mit zwei Becken. Man legte schnell ab. Ein Mitpassagier, ein wohlbeleibter Schauspieler aus Philadelphia, Deutscher von Geburt, wurde zunächst mein Berater. Als dritter Kabinengenosse gesellte sich ein stockamerikanischer „Coiffeur“ aus Chikago hinzu, der kein Wort Deutsch verstand. Der vierte war, wie sich nachher zeigte, ein alter Wiener Jude, der seine Tochter, eine Sängerin, in „Neffiorck“, wie er aussprach, besuchen wollte. Um etwaigen üblen Explosionen vorzubeugen,[S. 26] wählte ich ein oberes Bett, das auf einer kleinen Leiter zu ersteigen war.
Wir gingen schnell, nachdem wir abgelegt, wieder nach oben, um ja den reizvollen Augenblick der Abfahrt nicht zu versäumen. Mehr und mehr sammelten sich die Passagiere auf dem Promenadendeck, um sich noch von oben mit ihren Angehörigen auf dem Kai, soweit sie bis nach Kuxhaven mitgekommen waren, möglichst lange zu unterhalten. Jetzt wurde in gewaltigen Netzen unser Gepäck vom Land aufs Schiff balanciert. Dann lief der zweite Sonderzug von Hamburg mit den Passagieren der ersten Kajüte ein. (Vornehme Leute kommen bekanntlich in der Welt immer zuletzt oder sogar, wenn sie besonders vornehm sind, zu spät!) Auch diese dreihundert waren, schnell von hilfreichen Stewards geleitet, an Bord gebracht. Mittlerweile war es ¾12 Uhr geworden!
Immer strahlender schien die Sonne wie mit Festglanz vom Himmel herab. Tiefblau war Himmel und Meer. Nun ertönte ein Kommando; die Haltetaue wurden losgewunden. Die Musik setzte ein: „Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus“ ... Langsam drehte das gewaltige Schiff ein wenig vom Kai ab. Die am Ufer begannen zu winken, Taschentücher flatterten bald hundertfältig oben und unten, herüber und hinüber ... einige Damen schluchzten auf ... da und dort sah man rotgeweinte Augen ... auch ich biß ein wenig die Zähne zusammen, aber das Fehlen von Angehörigen machte den Abschied mir nicht so schwer. Auch war meine Brust geschwellt von all dem Neuen, was da kommen sollte. Immer breiter wurde schon der Wassergraben zwischen Kai und Schiff. Die Schraube arbeitete spürbar, der ganze Schiffsrumpf erbebte unter ihren Drehungen, die Maschinen stampften, durch den ganzen Schiffskörper ging ein leises Zittern ... So löste sich das Schiff langsam vom Lande ... Zehn ... zwanzig Meter rückte es vom Ufer ab ... Alles rief, schrie, winkte, weinte ...! Dann wurden es fünfzig, hundert Meter! Die Menschen wurden immer kleiner ... Kreischend umflogen uns Schwärme von Möwen ... Zuletzt waren Kuxhavens Türme klein wie Spielzeug. Die Musik[S. 27] hatte aufgehört zu spielen ... Alles strömte in die Speisesäle, um sich vom Obersteward einen Tischplatz anweisen zu lassen ...
Ich wählte lieber den „zweiten Tisch“, wie mir der spätaufstehende Schauspieler aus Philadelphia riet, und mußte nun zwölf Tage lang zweimal täglich anderthalb Stunden zusehen, wie bereits der „erste Tisch“ fröhlich speiste. (Bei voller Belegung des Schiffes reichen nämlich die Speisesäle nicht zugleich für sämtliche Passagiere.) Das war bei dem besonderen Appetit auf See und der Langeweile, die am schönsten von den Mahlzeiten unterbrochen wird, jedesmal eine Leistung. Auch sonst war mein wohlbeleibter Berater wie ein böser Dämon neben mir, der für die Rührung der Abschiedsszenen nur Spott hatte und auch schon am ersten Tage mir von Amerika und den Amerikanern fortgesetzt nur Ungünstiges zu erzählen wußte: „Dollarjagd und Bigotterie sei drüben alles. Der Freiheitsstatue hätte man lieber eine Dollarnote statt einer Fackel in die Hand geben sollen u. ä.“, während ich in vollstem Jugendidealismus wie ein kleiner Kolumbus mir eine neue ideale Welt erobern wollte ...
Als man endlich aus den Speisesälen und Schiffsgängen wieder hinaufkam — schon prägte man sich etwas die Topographie des Ganzen ein — da schwammen wir bereits mitten auf der weiten, klaren, blauen Nordsee. Von Land war nirgends mehr eine Spur. Aber eine breitaufgewühlte Furche zog das Schiff wie eine Wasserlandstraße hinter sich her, die den zurückgelegten Weg deutlich und lange anzeigte ... Immer noch folgten uns kreischende Möwenschwärme tauchend und elegant die zugeworfenen Brocken auffangend ...
Das Essen mit seinen vielen und reichlichen Gängen mundete stets vorzüglich. Die frische Seeluft tat das ihrige dazu. Vom Schwanken des Schiffs war keine Spur zu merken, obwohl am Nachmittag eine frische Brise eingesetzt hatte und der Wellengang stärker wurde. Gemütlich lag man auf Deck auf seinem gemieteten Deckstuhl wie auf der Veranda eines aussichtsreichen komfortablen Hotels und sah auf die nie ermüdende unendliche Wasserfläche hinaus und fühlte sich glücklich als Weltpassagier ...
[S. 28]
Es begann das regelmäßige Leben an Bord.
Am Mittag war das Meer tiefblau, am Abend nach Sonnenuntergang aber wurde es tiefgrün. Der aufkommende Wind rüttelte an Tauen und Segeltüchern. Purpurrot war die Sonne im Westen versunken ...
Silberne Streifen warf bald der Mond über das Wasser. Rings ein chaotisches Wasserrund. Welche Fluten erfüllen doch die Erde! Von fern her blitzten die Leuchtfeuer von den deutschen Inseln ...
Wir waren jetzt etwa auf der Höhe von Borkum. Helgoland war zu weit ab und nicht sichtbar. Das Schiff ging noch immer sicher und ruhig, obwohl ringsum schon weiße Kämme aufspritzten. Viele, die bereits mehrmals herüber und hinüber gefahren waren, rühmten unsern „alten Kasten“ sehr, er fahre zwar nicht so rasch wie die großen Schnelldampfer, aber dafür ruhiger und sicherer, zumal wenn er wie diesmal voll und schwer geladen sei ...
Es trompetete zum Abendessen. Nach der salzigen Seeluft schmeckte das Essen jedesmal vorzüglich. Die Stewardbordkapelle spielte dazu flotte Weisen im Speisesaal. Die Stewards erwiesen sich überhaupt als recht vielseitige Burschen. Erst traten sie als galante Pagen und Kofferträger auf, dann waren sie Zimmermädel in Hosen und servierende Kellner, für jeden Wunsch und jede Laune dienstfertig bereit, und zuletzt talentvolle Musikanten. Alle Achtung vor solcher Vielseitigkeit! Aber welche Versuchung zur Unzufriedenheit für sie, während ihrer Arbeit um sich ständig nur nichtstuende, schmausende, scherzende, geldverzehrende und vergnügungssüchtige Menschen zu sehen! Denn daß wir Passagiere vor und nach unsrer Seefahrt auch etwas Rechtschaffenes arbeiteten, das sahen sie ja nicht, und vielleicht glaubten sie es auch nicht. In ihren Augen waren wir alle „reiche“ und nichtstuende Leute.
Als man vom Abendkonzert vor Schlafengehen noch einmal auf Deck kam, rauschte rings um uns ein tiefschwarzes Meer. Man hatte[S. 29] in den erleuchteten Gängen und Sälen fast vergessen, daß man auf dem weiten Meere schwamm ...
Es kam die erste Nacht. Ich konnte mich gar nicht genug wundern, wie seelenruhig man sich in sein Bett legte. Freilich sah man einmal der Ordnung wegen nach, wo die Rettungsgurten lagen. Ganz Ängstliche haben sie wohl auch einmal heimlich, wenn sonst niemand in der Kabine war, „für alle Fälle“ anprobiert. Der schreckliche Untergang der „Titanik“ oder die Torpedierung der „Lusitania“ mit ihren etwa 1500 im Wasser versinkenden Menschen hat uns Bilder genug des Schreckens vor Augen gemalt! Ich wußte mich auch aus meiner Kindheit eines schweren Zusammenstoßes eines Bremer Lloyddampfers mit einem englischen Kohlendampfer im Nebel des Kanals sehr wohl zu entsinnen. Der Engländer hatte von der Seite kommend und mit Kurs nach Frankreich den im Kanal längsfahrenden Lloyddampfer mitten entzweigeschnitten. Eine einzige Dame, eine Bremerin, dazu noch eine gute Bekannte unsrer Familie, war damals gerettet worden.
Rechtzeitig pflegte ich immer mein Oberbett zu erklimmen, denn das lange Spielen, Trinken und Rauchen der Herren liebte ich gar nicht. Mit mir ging gewöhnlich der kleine ältliche Wiener schlafen, der ja seine Tochter besuchen wollte und der nachher noch sehr unter der Seekrankheit litt. Er pflegte sich aus Vorsicht gar nicht ganz auszukleiden. Gut, daß er unten und ich oben schlief, denn die See hatte es ihm bald angetan! Der Chikagoer, der kein Deutsch verstand, sondern nur „good morning“ und „good night“ sagte, kam gewöhnlich erst ein oder zwei Stunden später herein, und zu allerletzt und oft wohlgeladen wie unser getreues Schiff, aber doch nicht so ruhigen Kurses wie es, kam der deutsche Philadelphier, der glücklicherweise nicht nach oben zu klimmen hatte. Er hatte seine Wahl recht getroffen. Mit einem mächtigen Plumps fiel er auf seine Lagerstatt. So schlief man nicht eher ein, bis alle Mann an Bord der Kabine waren. Zudem leuchtete über der offenen Türluke der helle Schein der Ganglampen herein, so daß es in der Kabine nie recht finster wurde. Außerdem lag neben unsrer Kabine, die freilich mittschiffs nicht weit vom Maschinenraum[S. 30] am wenigsten die Bewegungen des Schiffs verspüren ließ, einer der Schlafräume der Stewards, die abends nach ihrem Dienst und früh vor ihrem Aufstehen einen Heidenlärm machten. Da wurde gelacht, getanzt, gescherzt, Mundharmonika gespielt und fröhlich gesungen. Ich gönnte ihnen ihre Lustigkeit und Munterkeit von Herzen und wollte mich auch nicht griesgrämig beschweren; nur beförderte ihr Treiben gerade den ersehnten Schlaf nicht. So lag ich oft noch manche Stunde wach und sah gleichsam zum Lohn dadurch auf einmal, wie — ich traute meinen Augen nicht — gemächlich vom Gang herein oben durch die breite Türluke eine große, feiste Ratte in unsre Kabine hereinspaziert kam, an den Holzleisten der Wandverschalung gemächlich entlanglief und dann auf demselben Wege wieder verschwand. Nach andern Nächten fand ich sogar ihre Grüße und Spuren auf meiner weißen Bettdecke, die ihr vielleicht bei leerer Kabine als Ruheplatz diente. Sie hatte also, nach den Spuren zu schließen, während wir von den Wellen gewiegt selig schliefen, uns sehr nahe Besuche abgestattet. Nach dieser Entdeckung hielt ich es für ratsam, abends beim Emporklimmen in die „upper berth“ wenigstens einen Pantoffel mitzunehmen und ihn als schußbereite Waffe in der Hand haltend einzuschlummern und hatte so das sichere Gefühl, gegen etwaige noch nähere Besuche der nächtlichen Freundin notdürftig gewappnet zu sein. Als ich meine Entdeckung erstaunt am andern Morgen dem Kammersteward mitteilte, meinte er lakonisch: „Ratten gibt’s auf jedem Schiff.“ Und erfahrene Seereisende trösteten mich mit der Weisheit: „Nur ein sinkendes Schiff verlassen die Ratten.“ Zum runden Kammerfenster aber wehte die ganze Nacht erfrischend luftiger Nordwest herein, so daß man immer Seeluft genoß. Mußten freilich die Luken wegen hohen Wellengangs einmal geschlossen werden, dann entwickelte sich bald eine recht dumpfe Atmosphäre, untermischt mit allerlei Küchen- und andern Dünsten.
Früh halb sechs verließ ich meist als erster schon unsre Kabine, oft drei bis vier Stunden vor dem gutgeladenen Philadelphier. Kam man aufs Deck hinauf, so war da oben gewöhnlich noch groß Reinemachen.[S. 31] Das Schiff schwamm nicht bloß von unten her, sondern auch in Strömen von oben. Matrosen barfuß, in hochgekrempelten Hosen, spritzten und gossen mit Eimern und Schläuchen, wuschen und scheuerten, daß es nur so eine Art hatte ... Sie sahen es auch gar nicht gern, wenn man gar zu früh schon ihre Arbeit inspizierte. Aber gerade die Morgenstunden waren besonders schön auf Deck. Die Sonne und das Meer glänzten noch heller und frischer als sonst. Frei und unbehindert durch die vielen Mitreisenden konnte man sich überall ergehen vom Hinterdeck an, wo gelotet wurde, wieviel Faden wir liefen, bis zum Bug, wo man wie auf scharfkantiger Bastion das hochaufspritzende Wasser durchschnitt, das unwillig dem hochbordigen Schiff sich entgegenwarf.
Wir fuhren jetzt in Höhe von Holland. Der Wellengang hatte zugenommen. Das Schiff stieg hinten und vorn recht erheblich auf und nieder. Schon fehlten einige der Bekannten am Frühstückstisch; andere schlichen mit ängstlichen und bleichen Gesichtern umher, drückten sich möglichst in der Nähe der Schornsteine auf ihrem Deckstuhl in die Ecke oder eilten ein ums andre Mal verstohlen an die Reeling, um Poseidon zu opfern ... Wir andern machten tapfer unsre Runde, zwanzig Deckrunden, um — wie ein munteres Fräulein neben mir spottete — „uns die Seekrankheit auszulaufen“.
In der Tat läßt sich, glaube ich, mit ein bißchen festem Willen viel gegen die Seekrankheit machen. Viele werden zweifellos bloß aus Angst oder vom Sehen seekrank. Es ist wohl auch ein Stück Anlage, ob man ihr leicht erliegt oder nicht. Es soll ja sogar alte Kapitäne geben, die sie bei jeder halbwegs unruhigen Fahrt immer wieder packt. Gar spaßig waren die weisen Unterhaltungen und mancherlei Ratschläge darüber zu hören. So rieten die einen: „Immer tüchtig essen, aber ja nichts trinken!“ Die andern mit scheinbar einfacher Logik: „Den Magen ganz leer lassen, dann hat er kein Material zum ...!“ Wieder andere mit medizinischer Kennermiene: „Nur einen Kognak trinken, aber sonst nichts genießen!“ Die vierten meinten besonders ängstlichen Damen gegenüber: „Ruhig hinlegen und die Augen fest schließen und an etwas Schönes denken, das hilft!“ Wieder andere: „Hinlegen,[S. 32] aber die Augen gen Himmel richten und nur nicht aufs Wasser sehen!“ Auch ein Rat aus der Praxis! Die sechsten aber mahnten zum Gegenteil: „Immer tüchtig herumlaufen, viel lachen und spielen!“ Die siebenten ergänzten gar dazu: „Nur nicht hinuntergehen in die dumpfe Kabinenluft, da kriegt man es gleich!“ Und noch andere: „Recht lange im Bett liegen bleiben, da spürt man das Stampfen und Rollen nicht so sehr!“ Endlich die letzten orakelten: „Man muß einfach weder davon reden noch daran denken“ — und doch sprachen bald alle davon, von dem einen Thema, die einen offen, die andern verstohlen. Und wer nicht davon sprach, der dachte daran.
Jeder versah sich auf seine Weise „für alle Fälle“ mit einem guten Rat. So spotteten die einen und lachten, die andern verkrochen und fürchteten sich. Ich selbst philosophierte über die Möglichkeit einer seekranklosen Lage und fand sie in einer kardanisch, d. h. von oben zentral wie eine Hängelampe aufgehängten Hängematte, die sofort vermöge des Gewichts des darin liegenden Menschen alle Schwankungen des Schiffs korrigierte und darum stets in der richtigen, zum Erdmittelpunkt zentripetalen Lage bleibt! Leider bin ich nur bis heute noch nicht zur Patentierung meiner Erfindung gekommen ... Möchte auch jeden Leser vor ihrer vorzeitigen Ausbeutung warnen!
Gegen 11 Uhr fuhren wir auf der Höhe von Dover. Deutlich zeichneten sich rechter Hand die weißen Kreidefelsen der englischen Küste ab. Wer noch ungebrochener Gesundheit war, schrieb eifrig im Speisesaal, Rauchsalon oder Spielzimmer Briefe und Karten an die Lieben daheim, denn in Boulogne-sur-mer wurde von einem französischen Tender Post abgenommen. Ich konnte noch immer unter anderem stolz berichten: „Nicht seekrank!“ Und ich habe mit festem Willen und einer ungeänderten Lebensweise bis zuletzt auch gut „durchgehalten.“
So näherten wir uns langsam von Albions stolzer Küste hinüber dem Land der uns so sehr liebenden Franzosen. Bald erkannte man durchs Glas Wiesen und weidende Rinderherden ...! Eine eigentümliche Sehnsucht nach Land entstand in mir. Die reichlich vierundzwanzig[S. 33] Stunden, die wir jetzt unterwegs waren, dünkten mich wegen der vielen neuen Eindrücke ebensoviel Tage zu sein.
Um Mittag hielten wir weit draußen auf der Reede von Boulogne. Unsre Sirenen heulten mehrmals laut hinüber, daß wir da wären. Still stand der weithin sichtbare Leuchtturm auf seiner stolzen Höhe, aber der Tender mit den Parisern ließ noch eine ganze Weile auf sich warten. Fast zwei Stunden zu früh waren wir angekommen. So rasch war unser alter Kasten gefahren! Während wir still lagen, ließ sich drüben der französische Strand mit seinen großen Hotels, seinen vielen Strandkarren und die Kuppel der katholischen Kathedrale gut durchs Glas erkennen. Endlich kam auch tüchtig auf und nieder tanzend der französische Tender herübergedampft.
Es war ein kleines Kunststück, die Passagiere heil zu übernehmen. „Halb zog sie ihn, halb sank er hin.“ Nach dieser Weise kamen sie alle zu uns herauf. Die Matrosen hatten dabei allerlei Arbeit. Zuletzt wurden wiederum die Koffer im Krannetz hoch über dem freien Wasser schaukelnd herüberbalanciert. Dann flogen unsre Postsäcke hinüber — und der Franzose drehte wieder um ...
Es war 4 Uhr nachmittags geworden, als wir uns wieder der englischen Küste näherten. Abends winkten uns die langen Lichterreihen von Southampton, der paradiesischen Insel Wight und dem Kriegshafen Plymouth, der so groß ist, daß er die ganze englische Kriegsflotte in sich aufnehmen kann. Wie „fliegende Holländer“ glitten im Dunkel bald näher, bald ferner kleinere Küstendampfer mit grünen und roten Signallichtern an uns vorüber. Am Himmel aber standen ruhig und feierlich die blitzenden Sterne ...
Mit Anbruch des nächsten Tages passierten wir den letzten Punkt Europas, die felsigen Szillyinseln. Der Leuchtturm Eddystone, an dem hoch die schäumende Gischt emporbrandete, entbot den allerletzten Scheidegruß Europas. Nun würden wir kein Land mehr sehen bis zur Küste der Neuen Welt. Wir fuhren jetzt erst in den offenen Atlantik hinein.
Länger und höher wurden die Wellenzüge. Bis zur halben Schiffslänge[S. 34] tauchte unser Schiff in die Wellentäler, um dann gehorsam vom nächsten Wellenberg wieder aufzusteigen. Ein ewiger, erhabener Rhythmus. Wir hatten unsre Deckstühle ziemlich weit hinten und sausten dabei manchmal recht tüchtig und plötzlich mit ihnen in die Tiefe. Das Rundengehen war aufgegeben, denn man mußte zu oft einhalten und sich festklammern. Man lag lieber und las, so gut es ging. Das muntere spottende Fräulein lag dicht neben mir. Nicht lange — so entpuppte sie sich als Kusine einer meiner liebsten Studienfreunde, als eine muntere Badenserin aus dem schönen Freiburg im Breisgau. In Neuyork wollte sie ihren unverheirateten Onkel aufsuchen, ihm den Haushalt führen und, wenn möglich, sich drüben gut verheiraten. Gewiß hat sie es inzwischen auch getan.
Wir haben auf der ganzen Reise zusammen viel Spaß gehabt. Sie gab mir ihre Bücher zum Lesen und ich ihr die meinigen. Dann tauschten wir unsre Urteile ungehemmt aus. Vielleicht hat unser gegenseitiges helles Lachen und Fröhlichsein auch als Medizin gegen die seasickness gewirkt, der immer mehr Passagiere erlagen. Immer leerer wurden die Decks und Speisesäle, immer lauter das Seufzen der Seekranken. Auch uns hob es manchmal so ganz eigentümlich von unten herauf ... Ich las jetzt mit viel Interesse aus der Schiffsbibliothek die trefflichen Werke von Professor Hötzsch, Lamprecht und Münsterberg über „Amerika und die Amerikaner“ und wurde so auf meine Studienfahrt durch die Union aufs beste und zugleich geistvollste vorbereitet.
Mehr und mehr Schiffsreisende hatte man kennengelernt. Alle Schichten waren dabei vertreten: Farmer, Schauspieler, Sänger, Zirkusleute, Familien mit Kind und Kegel, die schon lange drüben waren und nur vom Verwandtenbesuchen heimkehrten, und einzelne, die zum erstenmal hinüberwollten, wie meine Partnerin, Deutsche und Stockamerikaner bunt durcheinander. Ebenso sprachlich gemischt war am Tisch meist die Unterhaltung, aber das Deutsche herrschte doch noch entschieden vor.
Jeden Tag war das Meer anders. Bald bewegt, bald glatt wie ein[S. 35] Spiegel, aus dem lustig Delphine in hohem Bogen emporsprangen. Manche wünschten sich prahlerisch „mal so einen richtigen Sturm“ zu erleben! Aber es kam keiner. Dazu war es noch zu sommerlich in der Jahreszeit.
Eines Morgens ½7 überholte uns eins der schönsten deutschen Schiffe, die „Kronprinzessin Cecilie“. Rauschend wie eine Königin fuhr sie an uns vorüber, eine mächtige Schleppe quirlender Wasser hinter sich lassend. War das ein Grüßen, Winken, Rufen und Jubeln hinüber und herüber! Aber so schnell wie sie gekommen, war sie auch wieder vor uns verschwunden. Mehr als doppelt so groß wie wir war sie und auch fast doppelt so schnell fuhr sie. Später rückte von rückwärts her die „Adriatic“ von der White-Star-Linie an unsre Seite, um geraume Zeit vor uns in Neuyork einzutreffen. Aber uns kümmerte das nicht. Im Gegenteil, je länger auf dem Meer, desto schöner. Ich hatte ja nichts zu versäumen. Allerlei Spiele — solange man nicht aß, lief, las, lag oder saß — vertrieben schnell die Zeit. Auf Deck spielten sie „shuffle-board“, eine Art Deckkegelspiel, Ringwerfen, richtigen Nachlauf und „Kriegen“. Eine Gruppe handfester norddeutscher Burschen übte sogar „Schinkenkloppen“ zur größten Heiterkeit aller eifrig Spalier bildenden deutschen und amerikanischen Dämchen. Je tüchtiger es auf den gestrammten Hosen klappte und je seltener einer den Missetäter herausfand, desto lauter wurde das Vergnügen. Im Rauchzimmer saßen die ganz unentwegten Skatdrescher, von denen einer kurz vor der Ankunft in Neuyork mit den bezeichnenden Worten aufs Deck trat: „Jetzt muß ich mir schnell noch einmal das Meer ansehen.“ Tabaksqualm und ein Schoppen frisch Angestecktes ging doch über alles ...
Zweimal war auch abends Bordfest. Die Decks waren mit Segeltüchern geschützt und alles mit Glühbirnen, Wimpeln und Flaggen umzogen. Und zu den fröhlichen Weisen der Bordkapelle drehten sich bis Mitternacht tanzlustig die Paare ...
Keinen Tag fehlte auch die Bordzeitung, die täglich neu in der Borddruckerei mit den neuesten drahtlosen Depeschen aus aller Welt[S. 36] gedruckt wurde. Die Bordzeitung brachte auch Bilder und einen fortlaufenden Roman! Großes Interesse erregte auch jedesmal die Bekanntgabe der täglich zurückgelegten Meilenzahl, die gewöhnlich nach dem Mittagessen erfolgte: Meist liefen wir pro Tag zwischen 320 und 340 Seemeilen, legten also etwa eine Entfernung wie von Dresden nach Hamburg täglich zurück, die freilich der Schnellzug in einem Drittel der Zeit meisterte. In künftigen Zeiten wird man mit dem Zeppelin etwa vier- bis fünfmal so schnell nach Amerika fliegen, als unser alter Kasten lief. Aber Kolumbus hätte schon unsre 11 Tage Überfahrt als unerhörten Rekord empfunden. Es ist ja alles in der Welt nur relativ!
Ehe die Bouillon zum zweiten Frühstück auf Deck gereicht wurde, pflegten der Kapitän, der Erste Offizier und der Schiffsarzt ihre Runde zu machen und mit jedem Passagier ein kurzes freundliches Wort zu wechseln ...
Sonst passierte nichts von Bedeutung. Nur einem Unglücksraben unter den Mitreisenden wurde seine gesamte Barschaft von elfhundert Mark gestohlen. Tags zuvor hatte er erzählt, daß er davon drüben eine kleine Farm kaufen wolle. Wie sollte man den Dieb ausfindig machen? Was wurde nun aus dem Armen und seinen Plänen?
Regelmäßig verlief unser Leben. Aus Abend und Morgen wurde stets ein andrer Tag geboren. Die Tage hatten ihre Stunden, unter denen die Mahlzeiten immer die wichtigsten und frohbegrüßten festen Punkte waren. Mit Essen, Schlafen, Spielen, Lesen und Unterhalten ging die Zeit hin. Aber das Meer selbst wurde man nie müde:
Der Ozean mit seiner unergründlichen Weite und unbezwinglichen Majestät regte immer zu neuen und großen Gedanken an. Aber dazu mußte man auf ihm auch Stunden allein verbringen können, nicht wie die Skatdrescher und Schinkenklopper. Gegen Abend, wenn die Sonne in die Goldbronze des Meers tauchte, dann wurde es mir immer besonders feierlich zumute. Noch glühte der Abendhimmel wie von einem Weltbrand erleuchtet. Auf den Wellen spielte Silber und Gold, eine märchenhafte Pracht. Jede Woge war wie ein heranrollendes Gebirge, jeder Wellenberg wie eine Farbensymphonie. Aus dem langsam blauschwarz verdunkelnden Himmel aber blitzten die ersten Sterne auf. Rötlich stieg langsam der Mars empor und warf eine matte Lichtstraße über das Wasser. Zuletzt leuchtete das Siebengestirn des großen Wagens in voller Majestät. Welche Abendpracht über der Wasserwüste!
Eine wahrhaft grandiose Einsamkeit sprach zu einem, wie man sie ähnlich nur auf den Schneehäuptern des Hochgebirges erleben kann. Wie dort hoch oben über den letzten Hütten der Menschen und weit fort von den tiefeingeschnittenen, in Schatten getauchten Tälern, so war man hier Tage entfernt von der Alten und Tage von der Neuen Welt.
Wasser, Wasser, so weit man sah, Wasser und Himmel — und die ewigen Sterne! Noch heute rast hier das Chaos, noch heute blitzt hier Jupiter und zürnt Poseidon. Und Kastor und Pollux geleiten freundlich den Schiffer, der ihnen vertraut.
Graus und Schrecken war das Meer einst, Dienst und Treue ist es heute. Aber drunten liegen die bleichenden Gebeine vieler mutiger Helden und die Masten ihrer geborstenen Schiffe. Wer war es, der den ersten Baumstamm höhlte und zuerst sich aufs Meer wagte? Welcher Held schnitzte das erste Ruder und spannte das erste Segel[S. 38] auf? Wer strandete in all den Jahrtausenden auf der Sandbank und zerschellte am Riff, wo heute Feuerschiffe und Leuchttürme warnen?
Sie alle lebten, sannen, kämpften, wagten und unterlagen für uns heute, damit wir heute in schwimmenden Palästen sicher durch alle Ozeane gleiten. Wo am wildumhertreibenden Mast sich einst der Schiffbrüchige angstvoll klammerte, sind wir heute bei Spiel und Tanz festlich in hellerleuchteten Sälen versammelt. Salons erstrahlen in Lichterfülle, ausgesuchteste Mahlzeiten sind bereitet ...
Aber in welch unmeßbaren Zeitläuften wurde solche „Kultur“ errungen! Welche Zeitperioden schritten auch über das Meer! In welchen gewaltigen Zeitstufen wurde die Gegenwart der Schiffahrt errungen: Das Kanoe, die Galeere, der Schoner, der Schraubendampfer! Wie lang dauerte jedesmal ihre Herrschaft! Fischfang, Seeraub, Kolonialzeit, Weltverkehr lösten einander ab. Jahrhunderte tauschten über den Ozean ihre Güter von den Glasperlen der Neger und den Pelzen der Eskimos bis zu unsern Maschinen und Büchern. Aber wie schnell vergessen wir, was wir vergangenen Geschlechtern verdankten!
Und wie schließen wir auch auf dem uns bedräuenden Meer uns in Kasten voneinander ab! Droben in den glänzenden Salons Ball und Konzert bei strahlenden Toiletten und einem Meer von Licht, blitzende Edelsteine und rauschende Seide. Drunten im Zwischendeck abgearbeitete Männer in zerschlissenem Rock und abgezehrte Mütter, die kaum mit dem Lebensnotwendigsten versehen mühselig eine neue Heimat suchen. Und doch werden die da drunten Wälder roden, Kohlen schaufeln und Farmen gründen, Erze fördern, ohne die da droben nicht handeln, spekulieren, verdienen und leben können. Den Kaffee und Reis auf unserm Tisch werden sie pflanzen, den Mastbaum haben ihre Väter gefällt, unser Fleisch stammt aus ihren Herden und von ihrer Schafe Wolle unsre Kleider. Und was bieten wir ihnen? Auch eine Meerfahrt kann uns zu sozialem Denken erziehen!
Sicher und unentwegt zog derweilen unser gutes Schiff seine Bahn. Das Abendlicht verglomm. Schwarze Nacht war es geworden. Venus strahlte hell voran. Westwärts ging unser Kurs. Westwärts geht überhaupt[S. 39] der Kurs der Menschheit, von Indien nach Babylon, von Babylon nach Griechenland und Rom, von Rom nach Deutschland, Holland und England. Von England nach Amerika ... Und von da wieder zum fernen Osten zurück. Dann ist der Kreis der Erde ausgemessen.
Die Kunde verbreitete sich geschwind: „Morgen, Donnerstag, den 9. September, einen Tag früher als erwartet, kommen wir an.“ Alles geriet in Unruhe. Die schönen genußreichen Tage, da man sich so recht und behaglich hatte „ausfaulenzen“ können, gingen zu Ende. Die Fähnchen auf der ausgehängten Seekarte waren dem amerikanischen Festland bedrohlich nahegerückt.
Es war auch immer wärmer geworden, je mehr wir uns „drüben“ näherten. Der Reisemantel war längst abgelegt. Der wohlbeleibte Philadelphier hatte wenigstens mit der einen Hälfte seiner Prophezeiungen recht behalten: Entweder Sturm im Kanal oder Nebel bei den Neufundlandinseln. Richtig, es kam noch anderthalb Tage lang ganz dicker Nebel, daß man auf dem Schiff von hinten nicht bis nach vorne sah. Höchst unheimlich! Das Schiff wurde wegen etwaiger Zusammenstöße auf halbe Fahrt gesetzt. In regelmäßigen Abständen heulte unaufhörlich das Nebelhorn und lauschte auf Antwort. Aber[S. 40] es kam keine. Auch nachts — noch schauriger — ertönte dasselbe Tuten; noch im Traum vernahm man es, bis der Nebel wich und im Sonnenglanz bald wieder eine spiegelglatte See vor uns lag. Drüben rechts sah man schon die ersten amerikanischen Feuerschiffe ...
Am letzten Morgen, an dem wir noch in der Frühe landen sollten, war alles unerwartet zeitig auf den Beinen, und zwar die meisten in sehr verändertem Habit. Die Reisemützen der Herren waren verschwunden — meine schwamm ja sowieso in der Nordsee oder im Golfstrom — weiche oder steife Filzhüte für die Weiterreise zu Lande waren an ihre Stelle getreten. Die Schiffsanzüge waren von Straßenkostümen verdrängt, und manchen der Reisegenossen kannte man zuerst in dem ungewohnten Gewand kaum wieder.
Währenddem glitten wir in der Morgendämmerung schon an der hellbeleuchteten Küstenlinie von Long Island entlang — wir waren also dicht vor dem Ziel! Amerika! Seltsames Gefühl!
Das Lotsenboot nahte und brachte den Lotsen an Bord, der nun das Schiff durch die „Narrows“[1] und die Neuyork-Bai in den Hudson steuern sollte. Links blitzten die Leuchtfeuer von Sandy Hook übers Wasser. Bis hierher gerechnet sind es von Southampton 3100 Seemeilen, von Hamburg 3500.
Der Morgen graute. Der Morgennebel nahm zu, aber doch so, daß man etliche Schiffslängen bequem voraus sehen konnte. Aber leider verhüllte er uns doch den bezaubernden Gesamteindruck der Hafeneinfahrt von Neuyork.
Wir fuhren jetzt sehr langsam. Bald glitten wir sacht vorwärts, bald stoppten wir ganz. Rechts zeichneten sich die Umrisse des weltberühmten Vergnügungsortes bei Neuyork, Coney Island, ab, links näherten wir uns dem reizend frisch grünen mit Landhäusern und Villen der Reichen übersäeten Staten Island, auf das die ferry boats,[2] die heulend wie ungetüme Wassertanks aus dem Nebel tauchten, die Neuyorker in 20 Minuten bringen ...
[S. 41]
Der Nebel wich etwas. Die Sonne machte Anstrengungen, aus dem Dunst emporzutauchen. Das letzte Frühstück wurde gereicht ... Wir lagen jetzt vor Staten Island und erwarteten „den Doktor“ auf dem Quarantäneboot, den allmächtigen Mann, der bei 12500 Dollar Jahresgehalt entscheidet, wer in das gelobte Land Amerika hereindarf und wer postwendend auf Kosten der Schiffahrtsgesellschaft, die ihn herüberbrachte, wieder heimgeschickt wird! Vor uns lag die „Adriatik“, die uns kürzlich überholt hatte und wurde gerade „bedoktert“, dann legte sich uns ein Regierungsdampfer längsseit.
Alles hatte sich an Deck gedrängt. Die Koffer waren zu Bergen geschichtet. Die ganze Nacht hatte es gerollt, gedröhnt und gerasselt, bis alles Gepäck oben war ...
Wir fuhren wieder ein Stück. Der Nebel nahm wieder zu. Wir glitten jetzt nach Passieren der „Narrows“, die mit ihren schweren Befestigungen leicht den Eingang nach Neuyork sperren können, in die innere Bucht, die sog. „Upper-Bay“, hinein. Links erschienen die Umrisse eines riesigen Kolosses auf einer kleinen Insel. Es war die berühmte „Freiheitsstatue“, die mit ihrer Fackel in der Hand die Welt mit der „Freiheit“ erleuchtet, ein Geschenk Frankreichs an die älteste republikanische Schwester. Jedenfalls ein recht imponierendes Denkmal an einer einzigartigen Stelle der Welt, denn fast alles, was nach Amerika hereinwill, passiert hier die „statue of liberty“. Rechts tauchten auch schon die Umrisse der andern ebenso berühmten Wahrzeichen Neuyorks auf, der „Wolkenkratzer“. Wirklich von märchenhafter Größe und Gewalt trotz der riesigen Breite des Hudsonflusses, der in die Upper-Bay mündet, und im Morgennebel von fast trutzigem Aussehen ...
Es war gegen halb acht Uhr geworden. Wir dampften langsam noch ein kleines Stück den breiten, meeresarmartigen Hudson hinauf, um dann links auf der Neujerseyer Seite in Hoboken anzulegen. Nun waren wir also wirklich „drüben“! Immer noch unfaßlich! Wirklich in der Neuen Welt! Und ein Ozean trennte mich von der Heimat!
Heulend schossen vollbesetzte, schwere, breite Ferryboote vor uns[S. 42] und hinter uns vorüber. Links stieg der Turm der Pennsylvania-Railroad auf. Nicht weit davon liegen die deutschen Piers (Landebrücken). Von den Anlegebrücken winkten schon viele Tücher. Vom Balkon desselben aus dirigierte ein Beamter der Hapag die Landung. Ein ganz winziger Dampfer, wie ein Knirps anzusehen, zog die Riesenschwester in das Dock hinein.
Alles, was auf der Landebrücke und an Bord stand, rief, schrie, winkte, lachte und weinte vor Freuden des Wiedersehens und der glücklichen Ankunft. Ich suchte auch meinerseits, wie alle ihre Verwandten, meinen Onkel, der mich abholen wollte und hielt eine ganze Weile einen älteren weißhaarigen Herrn dafür, bis ich auf einmal mit großer Enttäuschung meines Fehlschlusses gewahr wurde. Wie, wenn nun niemand da war —? Die Musik spielte, wie wir in Kuxhaven abfuhren. Mit Tauen wurde jetzt das große Schiff festgemacht. Nun schlugen sie auch die große Brücke hinunter. Die zweite Klasse durfte an Land gehen ... Ich war unter den Ersten.
Eben wollte ich den Fuß auf amerikanischen Boden in die große Zollhalle setzen, als ich auch schon angehalten und zurückgeschickt wurde!! O weh, was hatte ich denn verbrochen? Ich war mir gar keiner Schuld bewußt! Sollte ich etwa wieder unverrichteter Sache heimgeschickt werden? Das wäre ja furchtbar gewesen! Diese Blamage daheim, wenn ich überall gefragt wurde, wie es in Amerika war und wie es mir dort gefallen hätte!! Oder sollte ich etwa vier Wochen mit den Zwischendeckern und Einwanderern nach dem berüchtigten Ellis Island geschickt werden? Ich war doch weder krank noch ein Verbrecher! Mein Onkel war ein unbescholtener American citizen, ich selbst ein wißbegieriger Weltreisender und ein mehrmals akademisch geprüfter Deutscher, vor dem die Amerikaner doch sonst einige Achtung zu haben pflegen! Meine Papiere waren in Ordnung. Ich hatte weder mit dem Kapitän einen Zusammenstoß gehabt noch war ich etwa der Dieb des unglücklichen Mitreisenden. Ich kam auch nicht ganz mittellos, wenn auch gar nicht vermögend. Mein Reisebillett war auch richtig bezahlt ... Was es nur war? So schossen mir blitzschnell hundert[S. 43] Möglichkeiten durchs Hirn, und schon war ich im Begriff, dem kaltherzigen Beamten eine lange Rede zu halten und zu bedeuten, wen er vor sich habe. Freilich, ob mein Englisch in diesem Fall der inneren Aufregung schon zugereicht hätte? Da hörte ich seine Erklärung: Ich sei weder vor dem Doktor noch vor dem Regierungskommissar gewesen, deren Stempel auf meiner Karte fehlten!!
Tausend und Doria, wahrhaftig, ich hatte von Deck aus so genau alle Einzelheiten der Landung und der Einfahrt beobachtet — damit mir für mein Reisetagebuch ja nichts entgehe — daß ich es ganz übersehen und überhört haben muß, wann und wo man sich den beiden hohen Herren vorzustellen hatte. Und aus Deutschland hätte ich doch wahrhaftig an Ordnung und Gehorsam gegen die hohe Obrigkeit gewöhnt sein können! Wirklich, die Neue Welt hatte auch ihre Gesetze und Rechte und ließ sie nicht ungestraft übertreten!
So mußte ich zurück — und wäre doch so gern der erste bei der Landung gewesen! — durch Gänge und Treppen, davon viele jetzt verschlossen waren, wo man sonst ein- und ausging, bis ich endlich den Arzt und den Regierungsbeamten im Speisesaal fand, noch von einer dichten Menge Passagiere umlagert. Erst wurde hier vom „Doktor“ jedem in die Augen geschaut, ob man auch gesund war. Gottlob, ich war es! Dann fragte die Einwanderungskommission nach Name, Stand, Herkunft, Reiseziel, sogar wieviel Geld man bei sich führe und dergleichen. Wer nicht wenigstens 25 Dollar bar vorzuzeigen hatte — die Verpflegung für die ersten Tage — wurde gar nicht ins Land hereingelassen, ebensowenig wer etwa mit einer Frauensperson reiste, die weder seine nahe Verwandte noch seine Frau war. Auch alleinreisende Mädchen kamen nur nach Amerika herein, wenn sie drüben Verwandte besaßen. Glücklicherweise konnte ich auf alle Fragen der Kommission eine befriedigende Antwort geben — ich radebrechte zum erstenmal kühn auf englisch drauflos — ich war weder ein alleinreisendes Mädchen noch hatte ich kranke Augen. Ich hatte auch ein bestimmtes Reiseziel, besaß mehrere American citizens als Verwandte und konnte sogar den letzten Trumpf ausspielen, daß ich 25 Dollars in bar vorzuweisen[S. 44] vermochte. Andernfalls hätte ich wohl noch einige Tage auf Ellis Island sitzen und über die Nützlichkeit und gerechte Weisheit der amerikanischen Einwanderungsgesetze nachdenken können, die unangenehme Gäste aus der Alten Welt und insonderheit aus Osteuropa dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten am liebsten jetzt ganz fernhalten wollen. Kurz, ich kam heil aus dem Fegfeuer, kriegte den ersehnten Stempel und durfte die ersehnte Brücke zum Festland überschreiten und den Boden des gelobten Landes — zunächst in Gestalt riesiger Zollhallen — betreten!
Vor den Preis haben die Götter nun einmal den Schweiß — und auch die Geduld gesetzt. Ich, der ich am liebsten gleich über den Hudson nach Neuyork hineingestürmt wäre, sah von Amerika in den Zollhallen zunächst noch gar nichts weiter als Berge von Koffern meiner Mitreisenden, Hunderte von wartenden Menschen und einige völlig rasierte gum-kauende amerikanische Zollbeamte in Zivil. Am Strohhut die Regierungskokarde war ihr einziges Abzeichen! Jeder Ankömmling hatte sich zunächst bei seinem Buchstaben aufzustellen, die in Riesengröße von den Wänden hingen und dort auf das Heranbringen seiner Koffer geduldig zu warten. Waren sie alle angelangt, so hatte man sich zur „office“ zu begeben, sich in sehr langer Polonäse daselbst anzustellen und zu warten, bis man seinen Zollzettel und seinen Zollbeamten kriegte. Der nahm dann genau und gemächlich die Revision vor. Alles, was daheim mit soviel Liebe und Akuratesse zusammengepackt war, flog jetzt gleichgültig durcheinander, die Hemden aus den Falten, die Anzüge zum Teil in den Staub des Hallenfußbodens. Auch war es nachher eine wahre Kunst, alles wieder einigermaßen richtig hineinzupacken und den Deckel wieder richtig zuzukriegen. Zu Hause war das mit vereinten Kräften und in Ruhe erfolgt. Hier mußte alles schnell und allein geschehen. Wie mancher sah sich da hilfesuchend nach mitleidigen Seelen um! Zollpflichtiges wurde bei mir nicht gefunden, ich hatte weder Seide noch Perlen noch Zigarren.
Aber was nun? Manche weinten schon, weil ihre Angehörigen aus Chikago oder wo sonst her noch nicht da waren und sie kein Wort der[S. 45] fremden Sprache verstanden! Wir waren ja einen ganzen Tag zu früh eingetroffen!! Und die Freude darüber verkehrte sich bei vielen jetzt schnell in weinende Wehmut. Als ich gerade darüber nachdachte, was ich nun wohl in dem fremden Erdteil mutterseelenallein in einer mir völlig fremden Sechsmillionenstadt zuerst anfangen würde, entdeckte ich am Eingang einen liebenswürdigen alten Herrn mit goldener Brille, der jemand eifrig zu suchen schien. Ich hätte ihm gleich vor allen Leuten um den Hals fallen mögen. Es war ja Onkel, mein Retter!
Jetzt brauchte ich nicht mehr alle meine englischen Vokabeln und Phrasen zusammenzukramen — ich konnte erst noch einmal ein paar Tage meinem Herzen auf deutsch Luft machen und alle meine Eindrücke deutsch verstauen und verdauen. Mein Onkel hatte mich auch erst am nächsten Tag abholen wollen — da las aber zufällig sein Enkel diesen Morgen in der Zeitung, unser Schiff werde wahrscheinlich schon diesen Vormittag docken, läuft zum Onkel, teilt es ihm mit; der stürzt zum „subway“ (Untergrundbahn) und versucht mich noch in Hoboken zu erwischen. Und er kam noch gerade recht.
Wir schüttelten uns herzlich und lange die Hände. Die Fremde war mit einem Schlag Heimat geworden! Wie gut, daß ich so lange bei dem Doktor, bei den Koffern und beim Zoll warten mußte, sonst hätte mich Onkel in Hoboken gesucht und ich ihn derweilen in Neuyork! Man sieht wieder, „wozu das Mißgeschick gut war“!
Das erste, was mir, als wir nun endlich nach Übergabe meines Gepäckscheins an eine „Transfer-Company“[3] die Tore der Zollhalle verlassen konnten, auf dem amerikanischen Pflaster Hobokens auffiel, war — ein Neger. Bald sah ich sie überall, die man bei uns vielleicht nur einmal in Zoologischen Gärten bestaunt, als Portiers, Gepäckträger, Droschkenkutscher, Handwerker, Hilfsschaffner und dergleichen. Und eine der großen Nationalfragen der Union tauchte schon am Zolltor[S. 46] Hobokens vor mir auf: die Negerfrage. Mitten durch die demokratische Union zieht sich wie ein Riß die Farbenlinie zwischen Schwarz und Weiß. 14 Millionen Schwarze und Farbige gibt es heute in der Union, im Süden noch weit mehr als im Norden. Der große Bürgerkrieg in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war um ihretwillen entbrannt. Ich sah auch bald, wie sich Weiße und „colored people“ ängstlich scheiden, wie die Schwarzen vielfach ihre eigenen Bahnabteile, Restaurants, Theater, Varietés — ja Kirchen haben! ... Und ich sah sie bald, vom Negerbaby mit seinem reizenden schwarzen Stumpfnäschen in seinen blendend weißen Kißchen bis zur behäbigen schwarzen Amme oder dem ergrauten niederen Handwerker, vom tiefsten Tintenschwarz, aus dem nur die Zähne und die Augen hervorleuchten, bis zum häßlichsten hellen Braungelb, je nach der Blutmischung. Ich gedenke aber heute auch noch gern zweier persönlicher Negerfreunde. Der eine war unser getreuer „Jack“ in der großen Universitätsspeisehalle in Cambridge, der uns alle unsere Lieblingsgerichte auf besonderen Wunsch in doppelten Portionen brachte — die gute Seele! — und der andere war ein strebsamer Negerstudent, mit dem ich mich manchmal an den Ufern des Charles River in Boston in freien Stunden erging ... Nur ihr Rassenduft war manchmal nicht gerade erwünschteste Beigabe ...
Mamas kleine schwarze Rose.[4]
Nach diesem Empfang umtoste mich nun der Lärm der Weltvorstadt: Autos, Omnibusse, Straßenbahnen, Droschken, Agenten, Schutzleute, Reisende ... alles lief, sprach, klingelte, schrie ... ein sinnverwirrendes Durcheinander. Der gute Onkel geleitete mich sicher zum Tunnel der Untergrundbahn, und mit ihr fuhren wir dröhnend und rasselnd in prächtigen, hellerleuchteten, strohgepolsterten D-Zug-ähnlichen Wagen unter dem breiten Hudsonfluß nach dem eigentlichen Neuyork auf die langgestreckte Insel Manhattan hinüber. Als wir drüben wieder ans Tageslicht stiegen, waren wir mitten auf der Hauptgeschäftsstraße Neuyorks, dem berühmten „Broadway“.
Ich mußte unwillkürlich an die Häuserwand treten, um erst einmal einen ruhigen Standpunkt zu gewinnen. Da waren sie ja nun wirklich dicht vor mir die Wolkenkratzer und erhoben sich mit ihren 24, 30, 40 usw. Stockwerken bis 100, 150 und mehr Meter Höhe! Der an sich breite Broadway wand sich wie eine enge Schlucht zwischen ihnen hindurch. Auf dem Asphalt aber ein unübersehbares Gewühl von Lastwagen, Autos, Straßenbahnen, Hochbahnen auf mächtigen eisernen Gerüsten, und unter uns in der Tiefe raste der „Subway“[5]. Auf den Gangbahnen aber eilten die Menschen geschäftig und unablässig wie in Berlin und Hamburg hin und her. Die Herren waren alle rasiert. Nirgends sah ich einen Schnurr- oder gar Vollbart! Die Gesichter schienen mir etwas eigenartig Scharfkantiges, ja fast etwas Rechteckiges an den Kieferknochen zu haben; auch ihr Blick schien mir[S. 48] starrer und fester als bei uns. Es prägte sich deutlich auf diesen Gesichtern eine noch größere Arbeitsunrast als bei uns aus, ja wie eine Unfähigkeit zum gesunden Genießen: „Taylorsystem!“ Bummelnde Amerikaner habe ich überhaupt nicht gesehen. Selbst im Schaukelstuhl daheim schaukelt man wenigstens noch, um nicht ganz untätig zu sein, und in der Straßenbahn kaut man zur Unterhaltung und Beschäftigung „Chewing gum“. Infolgedessen ringsherum auf dem Pflaster ein ständiges unappetitliches Ausspucken. Das Pflaster der Gangbahnen des Broadway war von Hunderten kleiner Spuckpfützchen übersät!!
Nach wenigen Schritten standen wir vor einem riesigen turmartigen Gebäude der Metropolitan-Lebensversicherung und ihrem 48 Stockwerk (über 200 Meter, höher als die höchsten Dome Europas!) hohen „Metropolitan Tower“, den eine vergoldete Kuppel krönte. Den mußte ich bald besteigen und von oben auf das Riesenbabel niederschauen! Das stand mir jetzt schon fest. Aber das hatte noch ein bißchen Zeit. Ihn überragt heute noch das 58 Stockwerk (228 Meter) hohe Woolworth building, dessen Platz allein 4½ Millionen Dollars kostete, wo also jeder Quadratmeter etwa hunderttausend Mark wert war. Daneben ist der Eiffelturm kein Riese mehr! Aber zunächst erst einmal heim zur Tante, die uns gewiß sehnlichst erwartete ...
Wir saßen im Broadway subway, in dem es in der Tiefe ab und zu einmal furchtbare Unglücksfälle gibt; in dem stets aber eine wie im Bergwerk atembeklemmende Luft herrscht! Er hat vier Schienenstränge, in der Mitte für „Schnellzüge“, an den Seiten für „Personenzüge“. Neuyork ist auf der Insel Manhattan an 19 Meilen lang. Zu Fuß würde man 4½ Stunden zum Durchschreiten seiner Länge brauchen. Die Untergrundschnellbahn aber, die nur ein paarmal hält, durchfährt die ganze Strecke in etwa 25 Minuten! Man steigt unterwegs um in den „Personenzug“, um am richtigen Straßenblock aussteigen zu können. Ähnlich dem Betrieb in der Horizontalrichtung in der Stadt ist der in der Vertikalrichtung in den höchsten Wolkenkratzern! Auch hier fährt man erst mit einem Schnellaufzug, der nur jeden 5. Stock hält, etwa bis zum 35., um von da noch mit dem „Personenzug“[S. 49] etwa bis zum gewünschten 39. Der „Expreß“ aber fährt meist gleich ganz in zwei Minuten bis zum Aussichtsbalkon durch ...
An der 137. Straße stiegen wir aus. Querstraßen in den amerikanischen Städten sind einfach (zwar praktisch, aber höchst prosaisch!) meist nach Nummern benannt, die Längsstraßen werden vielfach als Avenuen u. dgl. gezählt. Daher hat auch die berühmte „Fifth avenue“ der Multimillionäre in Neuyork ihren Namen. Die Straßen laufen meist zueinander rechtwinklig, so daß jede große Stadt wie ein Riesenschachbrett erscheint.


Tante empfing mich trotz ihrer vorgerückten Jahre, und obwohl wir uns bis dahin im Leben erst einmal gesehen hatten, überaus herzlich und hatte allerlei amerikanische und mir noch nicht geläufige Genüsse zur Erquickung bereitgestellt: Grape fruit, ice-cream-soda, Bananen in Sahne und Zucker aufgeschnitten u. dgl. In der „Halle“ des Hauses unten empfing uns der Hausmann, ein Neger, und fuhr uns im Aufzug ins „flat“ (Wohnung) nach oben. Zeitweilig hielt sich Tante auch ein Negerdienstmädchen, aber .. sie hat es bald aus den erwähnten Gründen wieder abgeschafft. Die Jalousien über den großen Schiebfenstern, die man von unten nach oben öffnet, waren überall sorglich heruntergelassen, denn Neuyork litt trotz der Septembermitte noch unter einer sehr großen lästigen feuchtschwülen Hitze. Die Männer gingen daher ohne Weste und Jacke, meist bloß im Faltenhemd mit Gürtel. Tantes Wohnung glich wie die meisten der amerikanischen Damen einem kleinen Museum oder einer großen niedlichen Puppenstube, als sei sie stets nur zum Ansehen gewesen. Altbremische Sauberkeit und amerikanische Freude an schönen Sachen hatten hier einen Bund geschlossen.
Welch eine Erquickung war es, sich nun des Abends wieder in ein richtiges Bett legen zu dürfen und nicht nur in ein Oberbett der Kabine. Es erscholl kein in Angst versetzendes Nebelhorn mehr, noch stieg die Kabine in den Wänden ächzend langsam auf und nieder oder rollte von einer Seite auf die andere. Und auch am Tisch saß man wieder ganz fest und sicher ... Und nun ging’s ans Erzählen ...
[S. 50]
Lange litt es mich nicht im Hause. Anderen Tag schon begann ich meine Wanderungen durch New York, nur mit Reiseführer, Karte und meinen bescheidenen englischen Kenntnissen ausgerüstet. Ich fuhr zuerst mit der Straßenbahn und der Hochbahn, die vor dem Subway den Vorzug der mannigfaltigen Aussicht hatten, wenn sie auch dem Subway sehr an Schnelligkeit nachstehen, zurück ins Stadtinnere, also „downtown!“, wie der Neuyorker sagt. An der City Hall, dem alten Rathaus Neuyorks, stieg ich zuerst aus. Äußerst bescheiden und klein unter den Riesen steht das Rathaus dieser Riesenstadt mit seinem feinen, weißen Marmor am City Hall Park, einer anmutigen grünen Oase mitten in dem tollen Geschäftstrubel, ein geschichtliches Denkmal dafür, wie es in Neuyork noch im Beginn des 19. Jahrhunderts aussah, als der heute verschwindend kleine zierliche Rathausturm alle anderen Häuser noch stolz überragte und keine Dollarburg ihm das Sonnenlicht verdunkelte. Als Napoleon I. nach Rußland zog, wurde City Hall eingeweiht. Im Empfangssaal des Governors steht noch das Pult, auf welchem Washington einst seine erste Botschaft an den damals in Neuyork tagenden Kongreß geschrieben hat, und auch der Stuhl, der George Washington bei seiner Inauguration zum ersten Präsidenten als Sitz gedient hat ..! Heute wirkt das alles wie ein schlichtvornehmer Gruß aus längst vergangenen Zeiten.
Von der City Hall wanderte ich den Broadway, die einzigartige asphaltierte Wolkenkratzerschlucht, zu Fuß weiter hinunter bis zur Südspitze der Insel Manhattan, also an den südlichsten weitvorgeschobensten Punkt der Stadt, bis zur sog. „Battery“. Mich zog es zum geliebten Meer hin. Ich mußte einmal wieder Seeluft in die Nase ziehen. Dabei kam ich an der alten und ehrwürdigen Trinity Church vorüber, die auf ihrem alten Kirchhof mitten zwischen den höchsten Wolkenkratzern steht und zwischen ihnen trotz ihres über 80 Meter hohen Turmes heute völlig verschwindet! Ein höchst instruktives Bild der Stadtentwicklung. Trinity church stammt mit ihrer Parochie noch aus der holländischen Zeit der Stadt vor über zweihundert Jahren.[S. 51] Die erste Kirche der zweitältesten und reichsten Gemeinde der Stadt wurde hier schon 1697 errichtet! Sie ist also „old, old, very old“! Einst gehörte ihr fast das gesamte Areal des umliegenden Hauptgeschäftsviertels! Welche unausdenkbaren Werte! Auf dem Kirchhof — merkwürdigerweise genau gegenüber dem Eingang zu Wallstreet, als wollte er symbolisch andeuten, daß auch alle Goldjagd zuletzt der Tod endet! — sind noch Grabdenkmäler zu sehen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen! Das will in Amerika sehr viel besagen, denn dort ist schon sehr „alt“, was aus der Zeit Washingtons vor hundert Jahren stammt. Die Union hat ja kaum 1½ Jahrhundert Geschichte hinter sich, und jedes Jahrzehnt drüben bedeutet bald soviel wie ein Jahrhundert in Europa, was die Schnelligkeit der durchlaufenen Entwicklungsstufen angeht.
An der Battery — der Name stammt noch von den ersten holländischen Befestigungswerken aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts — und ihren „Batterien“ steht man sowohl auf einem historisch als auch geographisch einzigartigen Grunde. Einst war hier an dieser Stelle in der Zeit der englischen Herrschaft vor den Freiheitskämpfen der Mittelpunkt des Neuyorker geschäftlichen Lebens! Heute liegt der weite Platz fast völlig still. Wie haben sich die Zeiten gewandelt! Anfang des 17. Jahrhunderts fuhr hier ein Henry Hudson, der Entdecker des Neuyorker Hafens, im Auftrag der holländischen Ostindienkompagnie auf seinem kleinen Boot dem „Halve Maan“ (Halbmond) unter holländischer Flagge den Hudson hinauf, um die sog. „nordwestliche Durchfahrt“ zu finden. Aber unverrichteter Sache mußte er umkehren. Drei Jahre später wurden hier auf dem Südende von Manhattan die ersten holländischen Blockhütten errichtet und Handel mit den damals noch umwohnenden Mohawkindianern begonnen. Die ganze Manhattaninsel, die heute Neuyork mit 2½ Millionen Einwohnern trägt, wurde zu jener Zeit den Indianern für Glasperlen und Knöpfe, im Werte von etwa 60 Gulden (!!) abgekauft und danach noch gratis ein furchtbares Gemetzel unter ihnen veranstaltet! Die neue Siedlung erhielt alsdann zuerst den Namen „Neu-Amsterdam“. Noch am[S. 52] Ende des 30jährigen Krieges wohnten hier nicht mehr als 100 Weiße! Erst 1667 wurde die Halbinsel von den Holländern an England abgetreten und erhielt jetzt den Namen Neuyork. Am 9. Juli 1776 wurde wiederum die Herrschaft Englands abgeschüttelt und als Zeichen dafür die Reiterstatue Königs Georgs VII. von England von den „Söhnen der Freiheit“ in Neuyork niedergerissen. Am 25. November 1783 mußten die Engländer endgültig Neuyork verlassen. Der erste amerikanische Kongreß trat in der Stadt zusammen und wählte General Washington zu seinem Präsidenten. An der Battery steht noch heute ein hoher Flaggenmast an der Stelle, da die Engländer vor ihrem Abzug zum letztenmal ihre Flagge hißten. Den Fahnenmast schmierten sie dabei so ein, daß es den „Söhnen der Freiheit“ nicht leicht werden sollte, sie herunterzuholen, was auch nur mit sehr großer Mühe gelang. Und so wird heute noch immer zur Erinnerung daran am 25. November hier feierlich das Sternenbanner gehißt. So hat auch die Neue Welt ihre Geschichte! Nur wissen wir meist sehr wenig von ihr.
Noch großartiger als die eigentümlichen geschichtlichen Erinnerungen an dieser Stelle ist von hier der Blick über die gesamte upper bay. Hoch reckt draußen die Freiheitsstatue im Hafen ihre Fackel empor, einer Welt entgegen. Ferry-boats eilen heulend draußen hin und her und speien alle Augenblicke Hunderte von Menschen samt Wagen und Autos auf einmal an Land oder verschlucken sie wie nichts in ihren doppelstockwerkigen, gewaltigen Leib. Hinter der Freiheitsstatue, die übrigens etwas an die Figur der Germania auf dem Niederwald oder die Bavaria in München erinnert, dehnen sich in der Ferne die grünen villenübersäten Hügelreihen von Staten Island, und weiter hinaus bis an den Horizont glitzert der offene weite Atlantische Ozean ...
Ich begab mich nach diesem wohltuenden und wunderbar erhebenden Blick auf das Wasser und die upper bay weiter in das Gewühl der Stadt zurück. Geschäftshaus an Geschäftshaus, Bank an Bank, Wolkenkratzer an Wolkenkratzer! Rasselnd sausten die Hochbahnen ihre hochgelegenen Schienenwege entlang. Lustig flatterten aus ihren Fenstern die gelesenen Zeitungen der Fahrgäste auf die Straße hernieder,[S. 53] die viele einfach aus dem Straßenbahnfenster werfen! Die amerikanischen Straßen sind überhaupt im allgemeinen schmutziger und ungepflegter als bei uns. Papierabfälle liegen überall umher. Aber schon durcheilten neue Zeitungsboys, die neuesten Ereignisse laut ausschreiend, mit neuen „papers“, die die Hauptereignisse mit wahren Riesenlettern an der Stirn tragen — u. U. als wichtigstes auch den Sieg einer berühmten Fußballmannschaft samt ihren Bildnissen! — durch die Straßen. Man abonniert die Zeitungen nicht, sondern kauft sie einzeln auf der Straße. Die Zeitung selbst erscheint dem ruhigen Europäer wie ein wildes und fast kindliches Durcheinander und buntes Allerlei einzelner außen- und innenpolitischer, sportlicher und privater Einzelnotizen in der marktschreieristischen Aufmachung und mit Augenblicksbildern übersät. Das Format ist riesengroß, großmäulig wie alles drüben, voller Interviews der Tagesgrößen auf allen Gebieten in direkter und persönlicher Rede und Gegenwart, alles auf den Augenblick und zu augenblicklichem starken Eindruck berechnet, denn binnen fünf Minuten wirbelt sie erledigt schon wieder aufs Straßenpflaster. Auch die Zeitung spiegelt die allgemeine Hast, Aufgeregtheit und Reklamesucht des amerikanischen Lebens. Reklame und wieder Reklame, wohin man sieht: Auf allen Dächern blitzt es abends in unerhörter Lichtfülle und Buntheit auf und erlischt, in allen Bahnwagen und an allen Haltestellen schreit dich dasselbe Ding, Fleischextrakt oder Mundwasser oder Keks tausendfach an, so daß zuweilen kaum der Stationsname für den Fremden noch zu entdecken ist. An jedem freien Flecke einer großen Hauswand steht es wieder in Riesenlettern, was du kaufen, essen, sehen, wie du kochen, schlafen, reisen sollst.
Lichtreklame[6].
Auf den Straßen überfällt einen die Menge der Obstverkäufer, der Jungen, die dir, ob man will oder nicht, die Schuhe putzen und dir[S. 55] dazu einfach den Fuß festhalten! Jedermann läßt sich die Schuhe stets auf der Straße oder in einem Laden putzen, wie man bei uns etwa täglich rasieren geht. Billig ißt man in den „lunchrooms“ (Frühstücksräumen) und „dairies“ (Milchwirtschaften), in den Restaurants zum Selbstbedienen mit und ohne Musik u. dgl. In „Wallstreet“[7] war um zwölf Uhr vor der Baumwollbörse eine riesige Menschenmenge angestaut. In den offenen Fenstern der großen Firmen saßen die Handelsvertreter und tauschten heftig gestikulierend die neuen Kurse aus. Börse wird hier zum Teil noch offen auf der Straße gemacht!
Als ich mich etwas mehr auf die Ostseite der Stadt begab, kam ich in die ärmeren Viertel, wo mehr Italiener als in Mailand, mehr ostgalizische Juden als in Lemberg und sogar haufenweise Chinesen wohnen. Da hausen zuweilen zwei kinderreiche Familien in einem einzigen Zimmer! Auf den eisernen Balkons hängt die Wäsche, liegen die roten, unüberzogenen Betten aus. Hier wohnen die Armen, die in der schwülen Sommerhitze es vorziehen, lieber am Strand oder in Parks zu nächtigen als in jenen menschenüberfüllten Straßen, von denen die eine genau aussieht wie die andere. Dazwischen finden sich auch noch unbebaute Plätze, wo gehämmert und geklopft wird, wo auf mächtigen Gerüsten sich gewaltige Krane drehen. Aber wie Felsen in der Brandung stehen mitten im größten Gewühl und Verkehr die stattlichen „police-men“ meist irischer Herkunft, mit einem tropenartigen Helm, den starken, weißbehandschuhten Händen und dem praktischen Gummiknüppel. Sonst Häuser an Häuser, Blocks an Blocks, Straße an Straße, ein höllisches Straßen- und Menschenschachbrett ... Mir brummte der Schädel und brannten die Füße, als ich nach dem ersten erlebnisreichen Tage heimkam, und noch abends, als ich Schlaf suchte, flimmerten mir Menschen und Häuser vor der erregten Phantasie .....
Am zweiten Tag regnete es und zwang mich wohltätig, daheimzubleiben. Am dritten begann ich meine Stadtwanderungen aufs[S. 56] neue. Der Subway brachte mich zunächst zum Washingtonsquare (Washingtonplatz). Der in römischem Stil erbaute Washingtonbogen auf dem Platz trägt die Inschrift: „Let us raise a standard to which the wise and honest man can repair. The event is in the hand of God“. Praktisch und fromm zugleich! Die englisch-amerikanische Frömmigkeit versteckt sich nicht und ist immer aufs praktische Handeln gerichtet, daher weniger spekulativ wie die deutsche. Ein rechtes Leben steht dem Amerikaner über dem frömmsten Glauben. An dem Bogen konstatierte ich auch, wie doch die klassischen Bauformen bis nach Amerika gedrungen sind! Gerade die Zeit der Gründung und des ersten Ausbaus der amerikanischen Union war die Hochblüte klassizistischer Baukunst. Oder zog es auch die junge Republik bewußt zu den Formen des Vorbildes aller Republiken, dem alten Rom? So ist auch General Grants imposantes Totenmal im „Riverside-Park“ am Hudson eine getreue Nachbildung der römischen Kaisergräber, erinnert an die Engelsburg und die Rotunde der Caecilia Metella in Rom an der Appischen Straße ...
Dann fuhr ich — einer Sehnsucht seit Tagen — zum Metropolitan Tower hinauf, um einen vollen Überblick über die Stadt in Ruhe von oben zu genießen. Es war ein blendend schöner Nachmittag, als ich da oben als im Augenblick einziger Besuch eine unvergeßliche Stunde erlebte. Wohl in zwei Minuten war ich bis zum Aussichtsbalkon im 45. Stockwerk(!) emporgefahren und trat nun, etwa 200 Meter hoch über dem Straßenniveau, hinaus auf den Balkon dicht unter den Uhrglocken und der vergoldeten Kuppel. Man stand damit so hoch, daß man sich dem Verkehr der Riesenstadt vollständig entrückt fühlte, als ginge einen das da unten gar nichts mehr an. Auch recht hohe Häuser wie das bekannte spitzwinklige, einem „Bügeleisen“ gleichsehende „flat-iron-building“ erschienen von hier oben nur klein.
Ein ungeheures Häusermeer, bald hoch, bald niedriger, ohne Stil und Plan, erstreckte sich gen Nord und Süd. Im Süden stieg die Hauptmasse der Wolkenkratzer drohend und rauchend auf, mit dem Singergebäude ungefähr in seiner Mitte wie einem Festungsturm.[S. 57] Dahinter glitzerte die upper bay mit der Freiheitsstatue. Drüben im Osten reckten sich die gewaltigen Brücken über den Meeresarm des „East River“ nach der dunstigen Millionenstadt Brooklyn hinüber. Das offene Meer sah man dort nicht deutlich, aber hell beleuchtet lag Long Island mit seinen einladenden Siedlungen da. Im Norden verschwamm das Stadtbild am Ende des Zentralparks in der Gegend der St. Johns Kathedrale. Im Westen säumte der breite Hudson, von vielen kleinen Dampfern belebt, das grandiose Stadtbild. Aus seinen vielen Piers an seinen Ufern schauten die Schornsteine der Ozeandampfer aller Herren Länder hervor. Ganz drüben lag in Rauch und Dunst gehüllt Hoboken, weiter nördlich grün und felsig die sog. „Palisaden“ am Hudsonfluß.
Aus der Vogelschau dehnte sich die Sechsmillionenstadt so tief zu meinen Füßen, als wenn Ameisen in ihr umherliefen. Kaum drang ein deutlicher Laut herauf, sondern nur ein allgemeines Summen, Surren, Klingeln, Hämmern, Pochen und Tuten. Welch ein Millionengetriebe da unten! Was haben doch Menschen in hundert Jahren da unten alles gebaut! Wie alle diese Menschenhirne da unten täglich sinnen, planen, hoffen, sorgen, grübeln, arbeiten. Für was? Um das bißchen täglich Brot auf Erden! Nirgends regiert so das Geld und die Arbeitshetze die Welt wie da unten! Ein paar hundert Menschen werden da unten täglich geboren oder sterben. Wer weiß es oder kümmert sich viel darum? In gut einem halben Jahrhundert ist von all den Millionen Menschenameisen da unten, die jetzt um Verdienst täglich rennen, kaum einer noch da! Aber das gefräßige Ungeheuer selbst, die Millionenstadt, wird weiter rauchen und fauchen und schaffen, sich recken und dehnen ruhelos Tag und Nacht!
Welch eine Unsumme menschlicher Arbeitskraft, menschlichen Arbeitswillens und -fleißes ist da unten aufgehäuft, aber auch ebenso sehr Schmutz, Not, Krankheit, Schande und zerbrochenes Glück ...! Wer das mit einem Male alles sehen könnte! Ob er es ertrüge? Und doch hat alles seinen Gang, seinen Weg und seine Ordnung. Jeder weiß, wohin er gehört und wo sein Platz ist, was er will und was er zu erreichen[S. 58] gedenkt! Man möchte sich hier oben angesichts dieses Menschenmillionenhaufens die Posaune eines Erzengels wünschen, um einmal in das Geldbabel die Botschaft vom Wert der geistigen Menschenseele hineinzurufen. Wie viele würden sie hören und verstehen? ... Können Menschen in solcher Atmosphäre wie da unten je eine andere Lebensanschauung gewinnen als die, daß Geld und Verdienen einziges Ziel und Bestimmung unseres Lebens ist?
Ich habe auf manchem hohen Turm in Deutschland gestanden und bin auf manchen hohen Berg gestiegen, aber selten hat mich die Frage nach dem Sinne des großstädtischen Menschenlebens der Gegenwart so gepackt wie in der einsamen Stunde an jenem sonnigen Septembernachmittag allein zweihundert Meter über Neuyork, der Metropole des gesamten amerikanischen Kontinentes.
Dann trieb es mich aus dieser grotesken Einsamkeit mitten unter und über Millionen Menschen über der Stadt in eine ganz andere idyllische Einsamkeit mitten in ihr. Im Zentrum Neuyorks liegt, ähnlich wie in der Sechsmillionenstadt London der Hydepark, der lang hingestreckte „Zentralpark“, eine prachtvolle, stundenweit ausgedehnte riesige grüne Oase, ein Eldorado von alten Bäumen, feinen Spazierwegen, wohlgepflegten Rasenflächen, gleichsam mitten aus dem tosenden Verkehr herausgeschnitten, von entzückenden und erquickenden kleinen Teichen und ihren leise hingleitenden Booten unterbrochen. Wir kennen solche ausgesucht schönen Parke auch im Berliner Tiergarten, dem Dresdner Großen Garten und etwa auch dem Bremer Bürgerpark, aber mitten in Neuyork empfindet man den Zentralpark doppelt und dreifach wie ein Paradies, weil man plötzlich aus dem Weltverkehr ruhig auf einer stillen Bank sitzend die Eindrücke sammeln und seine Nerven erholen kann. Hätten mich nicht die einfachen Inschriften auf englisch, deutsch, italienisch und hebräisch (!)[8] daran erinnert, ich hätte unter den alten Eichen vergessen können, in Neuyork zu sein.
[S. 59]
Auch die geistigen Schätze der Weltstadt ließ ich mir nicht entgehen. Hat zwar die Union bis heute noch keine eigentlich bodenständige geistige Kultur hervorgebracht, sondern noch immer im wesentlichen von den geistigen Brocken gelebt, die von Europas überreichem Tisch fielen, besonders in Malerei und Musik, so ist doch das Amerikanisch-Geschichtliche und -Geographische trefflich zusammengefaßt im „Museum of natural history“, und Teile der Schätze Europas, bald als Original, bald als Nachbildungen, finden sich neben einzelnem amerikanischen Gut im „Museum of art“. In dem Mittelraum des letzteren standen die Hauptwerke aus Italien und Nürnberg in Nachbildungen eigenartig durcheinander: Notre Dame, Parthenon, das Sebaldusgrab, der Gattamelata, alles einträchtig nebeneinander. Im Obergeschoß fesselten mich neuere amerikanische Gemälde. Heiße Sehnsucht erweckte in mir, wie ich mich noch deutlich entsinne, ein großes Gemälde aus dem Felsengebirge mit Schneegipfeln bis in die Wolken und im Tal Indianerzelte! Wer dahin könnte! Und ich sollte noch hingelangen! Imponierend fand ich auch das Kolossalgemälde von Washingtons entscheidendem Übergang über den Delaware, dessen Darstellung ein wenig an den Blüchers bei Kaub erinnert. Ebenso fesselte mich wegen seines historischen Inhalts das Bild: Kolumbus’ Landung; Schwert und Kreuz zum Himmel erhoben setzen Kolumbus und seine Mannschaft ihren Fuß auf das Land des Urwaldes und der Indianer. Aber auch gute echte Niederländer waren da, und wie manche Schätze sind erst seit der Inflationszeit hinübergewandert! Dazu war die ganze griechische Kunst im Abguß vorhanden, allerlei feine Vasen und Steine, Musikinstrumente, Gold- und Silberarbeiten u. dgl.
In dem fast noch interessanteren, weit originelleren „Museum of natural history“ war die gesamte amerikanische Baum- und Tierwelt zu schauen samt der Eskimo- und Indianerkultur. Und das alles ausgezeichnet praktisch und höchst geschmackvoll und anziehend zusammengestellt und angeordnet und durch ausführliche Karten und Beschreibungen erklärt. Da sah man gewaltige Mammutgerippe,[S. 60] Wale, Eisbären und ausgestopfte Elche, springende Delphine in den Wellen, Eskimos und Indianer am Herde im Zelte, bei ihrer Arbeit, samt ihren Waffen und Booten. Frappiert hat mich dabei manche Indianermaske mit ihrer scharfen Nase und dem charaktervoll geschnittenen Kinn, die mich stark an den echt amerikanischen, früher beschriebenen Typ im Straßenbild erinnerten.
Welche Geschichte hat sich doch auf diesem Kontinent abgespielt! Von den Sauriern und den 30 Meter im Umfange messenden Urwaldriesen, durch die bequem ein Wagen hindurchfahren könnte und die sechs Männer nicht zu umspannen vermögen, bis zu Henry Fords Autos und den Subways in Neuyork! Welches Völkergemisch ist hier zusammengekommen und geht in der Riesenretorte des amerikanischen Bürgertums fast restlos auf: Holländer, Engländer, Deutsche, Franzosen, Iren, Schweden, Italiener, Polen, Juden, Armenier und nicht zuletzt die Neger. Seit zwei Jahrhunderten hat sich die abendländische Kultur hier Eingang verschafft, hat alles Quantitative maßlos gesteigert, und von der Art der Pioniere hat das Angesicht Amerikas das Kühne, Vorwärtsdrängende, Schaffensfrohe übernommen. Freilich, der rote Mann ist dabei fast ganz der Raublust und Profitgier, dem Betrug und dem Mordgeist der Waldläufer und Goldsucher zum Opfer gefallen, und was von ihm übrigblieb, ist der geistigen Überlegenheit der abendländischen Einwanderer vollständig erlegen, aber aus der Retorte der Völker, Rassen und Religionen ist hier — mit Ausnahme der Neger — doch ein neuer, eigenartig geschlossener Menschentypus emporgestiegen, der „Amerikaner“ .....
Nach dem Besuche der Museen bin ich in den nächsten Tagen einmal aus der Stadt hinausgefahren, um Neuyork auch an seinen äußeren Punkten kennenzulernen. So ging und fuhr ich zunächst über die mehr als kilometerlange riesige Brooklynbrücke, die ein deutscher Ingenieur (John A. Roebling) erdacht hat[9] und die so hoch (etwa 40 Meter) den Meeresarm des East River überspannt, daß die höchsten[S. 61] Masten darunter hinwegfahren können. Dann ging es durch das etwas düstere, dunstige Brooklyn, das für sich allein über eine Million Menschen beherbergt. Einzigartig ist von der Brücke der Blick rückwärts auf das dampfende Wolkenkratzerviertel. Sonst ist Brooklyn und das anschließende Williamsburg mit seinem wimmelnden Menschen- und Geschäftsverkehr das getreue Abbild der größeren Mutter. Weiter hinaus geht es auch in stille Wohn- und Villenviertel über, bis man endlich auf langen Alleen zuletzt den tollen Vergnügungspark „Coney Island“ am Strande des Atlantischen Ozeans erreicht.
Man denke sich alle Jahrmärkte, Juxplätze, Vogelwiesen, Oktoberfeste usw. bei uns auf einem Haufen samt all ihren Achterbahnen, Kinos, Singspielhallen, Berg- und Rutschbahnen, Geheimkabinetten, Schaukeln und Karussells, kleinen Theatern, Musikkapellen, Drehorgeln und Varietés samt all der dazugehörigen, aber noch verzehnfachten ohrenbetäubenden Musik in allen Tonarten und das noch einmal vielfach vergrößert durcheinander, dazwischen aber auch noch allen Auswurf, Mob, Hefe, Faulenzer und Tage- und andere Diebe Neuyorks in einem Haufen zusammen — dann hat man „Coney Island“, das Paradies unzähliger vergnügungslüsterner Neuyorker! Coney Island ekelte mich bald an; ich vermochte kaum noch eine halbe Stunde dort zu verweilen, dann zog es mich wieder an das geliebte rauschende Meer. Ein frischer Wind fegte über leicht schäumende Wellen, die weißkämmig zum Strande heranrollten. Einige Badeschönen, die hier in echt amerikanischer Prüderie in vollständigem Badekostüm, d. h. mit mehreren (!) Baderöcken, -blusen, -strümpfen, -schuhen und Badesonnenschirmen sich ergingen, störten freilich das Bild. Dort feiert der Abschaum des Unrats, hier der Gegenpol der prüden Unnatur seine Triumphe! Da lobe ich mir doch lieber unsere nordgermanischen Vettern und ihre unbekümmerte und unberührte und ungeschminkte volle Natürlichkeit.
Auch dem Süden der Stadt stattete ich einen Ausflug ab. Für 5 Cent fährt man von der Battery mit dem Ferry in einer halben[S. 62] Stunde nach dem grünen „Staten Island“ hinüber und ist auch hier Neuyork auf eine Weile völlig entrückt. Dicht an der Freiheitsstatue fährt man vorbei, die immer aufs neue stolz und imponierend ihre Fackel hochschwingt. Mit Recht hat sie unser wackerer Z III bei seiner ruhmvollen Erstlingsfahrt gebührend gegrüßt und umflogen. Sie verkörpert weithin sichtbar alle amerikanischen Ideale und Aspirationen. Mit dem Sockel ist das Denkmal etwa 100 Meter hoch! Im Innern der bronzenen Figur führt eine Treppe bis in den Kopf wie bei der Bavaria in München. Aus ihren Augen kann man heraussehen. Bei Nacht ist die Fackel, die die Freiheitsfigur in der Hand hält, weithin strahlend elektrisch erleuchtet. Die Figur selbst hat einst dem sie schenkenden Frankreich eine Million Franks gekostet. Links liegen blieb Ellis Island, die Wehmutsinsel der Auswanderer. Rechts passierten wir eine Reihe englischer Schulschiffe, die gerade in der upper bay festgemacht hatten. Wie Möwen saßen die Seekadetten in ihren weißen Anzügen aufgereiht in den Raen der Masten und sahen nach Neuyork hinüber. Diesen Weg fuhr einst auch unser wackeres Handelsunterseeboot „Deutschland“ mit Kapitän König herein, dem die Engländer bei seiner kühnen Wiederausfahrt vergeblich auflauerten. Auf Staten Island angekommen stieg ich zur Anhöhe hinauf und genoß von dort oben wieder einen einzigartig bezaubernden Blick über Bucht, Hafen und Stadt ...
Dann flog ich ein andermal über den Hudson westwärts aus. Ich hatte ja beim Abschied vom Dampfer dem munteren Badenser Fräulein, das zu seinem Onkel fahren und ihm die Wirtschaft führen wollte, versprochen, es einmal in Hoboken zu besuchen. Das Versprechen mußte ich dem lieben Geschöpfchen doch auch einlösen, das gewiß schon auf meine Ankunft sehnlichst wartete. Ich meldete mich wohlweislich nicht an. Vermutlich war dann der Onkel nicht zu Hause! Denn der interessierte mich weniger. So riskierte ich einen unerwarteten Besuch. Aber Strafe folgt der Missetat oft auf dem Fuße! Ich verfehlte zwar „sie“ nicht, aber gründlich zunächst die Palisade Avenue in Hoboken, wo sie wohnte. Als ich nämlich glücklich über dem Hudson[S. 63] drüben war, fuhr ich mit der „car“[10] fröhlich nördlich fast eine Stunde gen Englewood ins frische grüne Land hinaus statt südwärts nach Hoboken, bis ich auf einmal Verdacht schöpfte und mich erkundigte. Da mußte ich zu meinem Schrecken hören, daß ich von meinem Ziel etwa zwölf Meilen entfernt war, aber derselben Avenue in Englewood recht nahe. So mußte ich den ganzen langen Weg wieder rückwärts nach Hoboken reisen, und kostbare Stunden des Nachmittags waren verstrichen. Aber es schadete nichts; ich hatte eine schöne Fahrt gemacht, an reizenden Landsitzen und leuchtenden Sommervillen hatte ich ein Stück „country“ gesehen. Wenn „sie“ nur da war! Und sie war es!
Ich traf sie sehr hausfraulich in der Küche. Allein! Ihr Onkel hatte ihr zwar streng verboten, einen Fremden hereinzulassen. War ich ein Fremder? Sie bereitete dem gestrengen Herrn Onkel das Dinner, wenn er von der City mit dem „ferry“ heimkäme. Das mußte allerdings bald sein. Aber er kam glücklicherweise noch nicht so bald. Arglos und fröhlich, wie es ihre Art war, zeigte sie mir unterdessen die ganze Villa des Onkels von außen und von innen, von oben und von unten, während ich stets ein bißchen ängstlich lauschte, ob man schon die Tritte des Herrn Onkels höre. Als wir nach der Hausbesichtigung wieder in der Küche angelangt waren — schon damit auch der Braten ja nicht anbrenne — und noch eine gute Weile geplaudert hatten, hielt ich es für diesmal geraten, mich zu entfernen. Wer konnte wissen, wann der Herr Onkel erschien und was er sagen würde, und würde nicht auch meine Tante zürnen, wenn ich zu spät zum Essen zu ihr kam? Und mit ihr durfte ich es doch, solange ich in Neuyork weilte, keinesfalls verderben. Als ich schied, brachte sie mich bis ans Gartenpförtchen. Wollte sie sehen, ob der Onkel schon kam? Oder ... Das gute Geschöpf hatte von Neuyork noch gar nichts zu sehen bekommen, und wie hatte sie aufhorchend meinen Schilderungen und Erlebnissen gelauscht! Aber der Onkel hatte gesagt, Neuyork wäre[S. 64] nichts für junge Mädchen! Sie sah mir lange nach. Ich glaube gar, ein kleines Tränchen hing in ihrem Auge ... Sie sollte sich ja in Amerika gut verheiraten, hatte ihre Mutter gesagt. Gewiß hat sie einen viel besseren als mich bekommen! —
Auch den Norden der Stadt durchwanderte ich in der Richtung nach Bronx, an den Harlem River und auf seine Höhen. Der Harlem River verbindet den East River mit dem Hudson, so daß strenggenommen der Hauptteil Neuyorks auf einer langgestreckten Insel liegt. Ganz im Norden fand ich noch Reste ursprünglichen Waldgebietes mit einer geradezu subtropisch üppigen Vegetation. Man darf ja nicht übersehen, daß Neuyork auf der geographischen Breite von Neapel (!) liegt, wenn auch sein Klima im ganzen kühler ist als das Süditaliens. Am Fort George, das ich nach mehrstündiger Fußwanderung erreichte, war ich erstaunt über die sonnigen dichtbewachsenen grünen Hügelreihen, die trotz des zu Ende gehenden September noch viel üppigeres und frischeres Laub zeigten als bei uns in der gleichen Jahreszeit. Von den „Washington Heights“ hatte man einen geradezu herrlichen Blick auf die „Palisaden“, d. h. die felsigen Ufer des waldumsäumten breiten Hudsonflusses, der an manchen Stellen mit unserem Rhein an Schönheit wohl wetteifern kann. Freilich fehlen ihm die malerischen Burgruinen und des Rheins ganze romantisch-geschichtliche Vergangenheit.

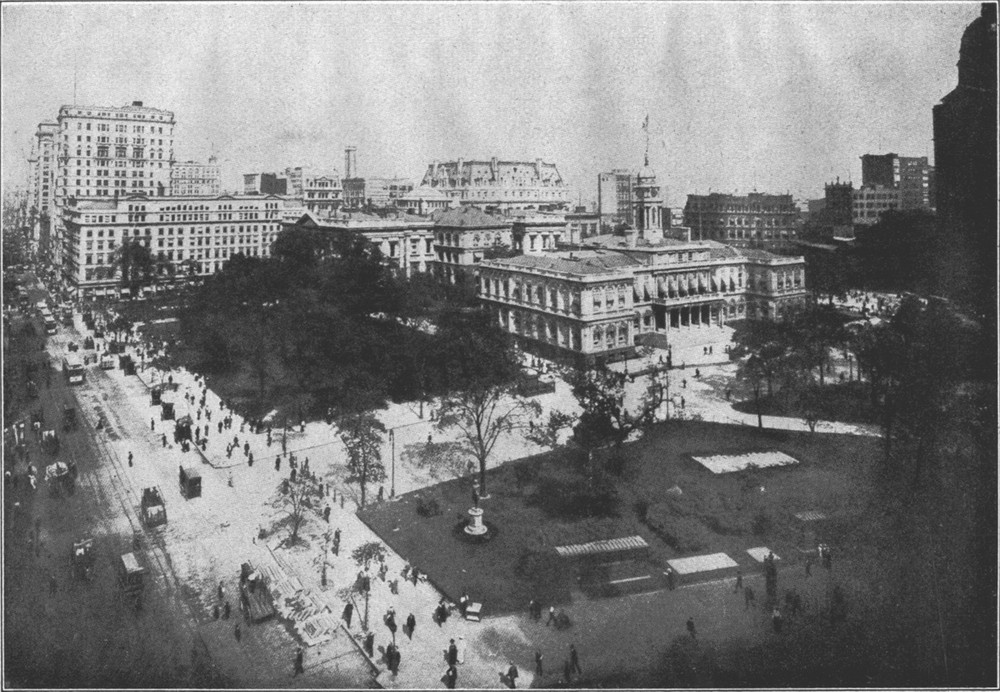
Neben der Natur zog mich auch immer der Stadt volles Leben an, so auch die Theater! Ich sah den „Parsifal“ im Metropolitan opera house deutsch. Ich saß in Kinos und kleinen Theatern der Italiener und Juden. Höchst volkstümlich und derb! Wieviel wäre zu erzählen vom Sport, von städtischer Verwaltung und Verfassung, vom Militär, zu dessen Eintritt auf vielen verlockenden Plakaten ständig geworben wird, von der Polizei, von der berühmten Neuyorker Feuerwehr, von den Schulen, den glänzend ausgestatteten, öffentlichen Bibliotheken und den 1100 (!) Kirchen der verschiedensten Denominationen in der Riesenstadt, den Hospitälern und Friedhöfen. Aber ich bin kein wandelnder Reiseführer. So habe ich auch keineswegs alle die einzelnen großen Banken und Börsen, alle die staatlichen Ämter, die großen[S. 65] Plätze und Denkmäler aufgesucht, noch will ich sie alle beschreiben. Ich habe nicht die Absicht, mit meinem persönlichen Reisetagebuch Bädeker, Führer und Karten überflüssig zu machen. Einiges davon hole ich bei anderer Gelegenheit nach.
Aber ehe ich von Neuyork weiterreiste, erlebte ich noch den Anfang einer phänomenalen Jahrhundertfeier in Erinnerung an Hudsons und Fultons erste Fahrten. Alle Bekannten und Verwandten in Neuyork hatten mich schon immer beschworen, die müsse ich unbedingt noch mitmachen, sie sei das „Ereignis“ dieses Jahres. Also war ich aufs äußerste gespannt und lief sogar Gefahr, das andere „phänomenale Ereignis“ in Boston zu versäumen, das ich auch unbedingt mitmachen mußte, nämlich die feierliche Einführung des auf Lebenszeit neugewählten Universitätspräsidenten von Harvard, eine Feier, der man in manchen Kreisen mehr Bedeutung beimaß als dem Einsatz des Unionspräsidenten in Washington! So war ich auch darauf aufs äußerste gespannt, denn mein akademisches Fühlen war trotz meiner fortgeschrittenen Semester noch sehr lebendig.
Am letzten Sonnabend des September begannen die Jahrhundertfestlichkeiten und dauerten vierzehn Tage bis in den Oktober. Alles zur Erinnerung der beiden großen Seehelden, des Henrik Hudson, der vor 300 Jahren den Hudson auf seinem „Half-moon“[11] entdeckte, und des Robert Fulton, der ihn mit dem ersten Dampfschiff „Clermont“ befuhr. Vorgesehen waren Gottesdienste — die in Amerika bei öffentlichen Feiern nie fehlen! —, Flottenparaden aller Länder, Riesenfeuerwerk, fünf Denkmalsenthüllungen, Opernvorstellungen, Parkeröffnungen, große Sportveranstaltungen, glänzende Bankette, Truppenparaden, Kinderfeste, wetturnerische Vorführungen, „Karnival“ genannt (!), Massenausflüge den Hudson hinauf u. dgl. Also ein Heidenrummel!
Tatsächlich strömte schon am ersten Festsonntag eine wahrhaft ungeheure, nach Hunderttausenden zählende Menschenmenge auf dem[S. 66] Riverside-Drive am Hudsonufer zusammen. Herrlicher blendender Sonnenschein lag auf Stadt und Strom. Tausende von Ansichtskarten-, Album-, Bild- und Fähnchenhändlern bearbeiteten das Publikum ständig mit allen Mitteln ihrer Rhetorik. Nur zwei Worte schwirrten noch in tausendfacher Variation an allen Orten, in allen Tonlagen und Stimmungen, anpreisend, schreiend, rufend, schnarrend ans Ohr bei drei- bis vierstündigem Stehen auf einem Fleck, zwischen Menschenmauern eingekeilt: „Hudson-Fulton, Hudson-Fulton, Hudson-Fulton“!
Alle Nationen der Welt hatten Kriegsschiffe zur Feier abgeordnet. Auf dem Hudson lagen sie in langer Reihe friedlich nebeneinander, die braunschwarzen Dreadnoughts und Kreuzer Englands, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Japans usw. Wie Lämmer bei Löwen und Tigern. Was sind doch alle internationalen Höflichkeitsbesuche und Vereinigungen anders als Schein und Heuchelei? Zwischen den großen schossen kleine Boote hin und her, die Ferries heulten und tuteten unablässig. Von halb elf Uhr ab — um elf Uhr sollten die Feierlichkeiten beginnen — hatte ich wartend und völlig eingekeilt mit hungrigem Magen bis halb vier Uhr nachmittags auf demselben Fleck gestanden, ohne mich auch nur einen Fußbreit vor-, rück- oder seitwärts bewegen zu können. Endlich um drei Uhr nachmittags begann der Auftakt der Flottenparade. Ich dachte, nun würde sich wohl die ganze stolze internationale Kriegsflotte rauchend und fauchend in Bewegung setzen und allerlei erstaunliche Manöverbewegungen auf dem Hudson ausführen, aber sie blieben alle unbeweglich und wie angenagelt auf ihrem Flecke liegen und fingen nur alle miteinander an, greulich zu schießen und zu donnern, daß man jedesmal nur so zusammenfuhr, wenn ein Feuerstrom, den man zuerst sah, aus ihren Mündungen gerade auf uns herüber zuschoß ... Dann hallte der Donner lange nach. Schließlich erschien aus Rauch und ohrenbetäubendem Gedröhn eine nicht sehr imponierende Festflottille von kleineren und einigen größeren Booten, die die neuerbauten Nachahmungstypen des alten Hudsonseglers „Halfmoon“ mit seinen hohen Schnäbeln und das noch kleinere Fultondampfschiff „Clermont“ mit seinen hohen Schaufelrädern und seiner wie ein[S. 67] Gänsehals hohen und unförmigen Esse feierlich geleiteten. Die Hunderttausende am Ufer brachen in einen nicht endenwollenden Jubel aus, als die rührend kleinen und reichlich unbeholfenen Schiffchen an den dröhnenden und feuerspeienden Riesen der fremden Kriegsschiffe vorüberglitten ... In der Tat, in einem Jahrhundert welche Entwicklung seit Fulton bis zu den modernen Ozeandampfern von 55 000 Tonnen und gar bis zum Z. R. III und seinem Siegesflug! Und seit Hudson, der mit den Indianern über den Kauf Manhattans verhandelte, welche Geschichte in diesem Lande! Als die Schiffchen vorübergeglitten waren, verlief sich die nach Hunderttausenden zählende Menge, denn wohl nicht nur mein Magen und meine Füße revoltierten energisch. Man war richtig steckesteif geworden. Gehen war ein Genuß.
Abends wurde dann noch ein riesiges Feuerwerk abgebrannt. Von den Palisaden herüber warfen mächtige Scheinwerfer ihre riesigen Lichtstrahlen über die Stadt. Und nach einem Kanonenschuß erglühten die Konturen sämtlicher Kriegsschiffe auf dem Hudson bis an die Masten und Schornsteine mit Tausenden von elektrischen Birnen — wirklich ein märchenhafter Anblick. Aber das Abendrot des nächsten Sonnenunterganges dünkte mich doch noch großartiger ... Das war mein Abschied von der Riesenweltstadt .....
[3] Transportgesellschaft.
[4] Aus: Die Neue Welt, eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik, herausgegeben von Claire Goll. S. Fischer Verlag, Berlin. 1921. S. 75.
[5] Untergrundbahn.
[6] Aus: Neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. Herausgegeben von Claire Goll. S. Fischer Verlag, Berlin 1921, S. 30.
[7] Sie hat wohl ihren Namen daher, daß einst nur bis dahin von der Battery sich die Stadt erstreckte, ¹⁄₁₀₀ ihrer heutigen Länge!
[8] Neuyork zählt ja auch mehrere Hunderttausende Juden!
[9] Erbaut 1870-83.
[10] Straßenbahn.
[11] Halbmond.
Am nächsten Morgen schon führte mich vom „Grand-Zentral-Depot“ der Expreß nach Nordosten. Aber vorher gab es erst noch einen kleinen Anstand, denn das Reisen, erst recht in fremden Ländern, hat nun einmal seine Tücken. Obwohl 14 Tage seit meiner Landung in Hoboken vergangen waren, hatte die Transfer-Company, der ich vertrauensvoll meinen Gepäckschein übergeben hatte, mir noch immer nicht meinen großen grünen Koffer, der doch mit soviel gelehrten Büchern vollgeladen war und in den Gepäckhallen der Hapag in Hamburg mich so kameradschaftlich getröstet hatte, von Hoboken herübergebracht. So blieb mir nichts anderes übrig, als das schwer fortbewegliche und vollgefüllte und immer mit Zerfall und schnellem Abgang drohende Ungetüm[S. 68] selbst zu holen. Vielleicht wartete es auf diesen Freundschaftsdienst. Was das nach Gewicht und bei entsprechender Sommerhitze aber für mich bedeutete, mag sich der Leser selbst etwas ausmalen. Aber „selbst ist der Mann!“ ist ja gerade echt amerikanischer Grundsatz. Danach handelte ich entschlossen ...
Um acht Uhr früh ging mein Zug. In äußerst praktischer Weise bevorzugen nämlich die amerikanischen Bahnen fast stets glatte, runde Abgangszeiten, also 8, 8³⁰, 9, 9¹⁵ Uhr usw. Krumme und ungerade Minutenzahlen trifft man selten. Auf der Bahn machte ich wieder allerlei neue Beobachtungen. Die Bahnhöfe sind praktisch, aber nicht immer groß. Eigentliche große Warteräume mit Restaurationsbetrieb existieren fast gar nicht, sondern nur offene Wartehallen mit einem besonders abgeschlossenen „ladies-“ und „smoking-room“, der recht primitiv sein kann. Die Bahnsteige sind schmal, die Fahrkarten oft winzig, meist ohne Angabe des Fahrpreises! Der Einfachheit halber steckt man die Karte in das Hutband an den Hut, von wo sie der den Zug kontrollierende Schaffner abnimmt und während der Fahrt mehrfach kupiert. Bahnsteigsperre gibt es nicht. Der Bahnkilometer ist drüben wie vieles teurer als bei uns, er kostet etwa 7½ Pfennig! Fast nach jedem größeren Haltepunkte geht der Schaffner aufs neue durch die D-Wagen und knipst sämtliche Fahrkarten, so daß sie zuletzt mehr Löcher als Papier haben!
Demokratisch wie die Straßenbahn ist auch die Eisenbahn; sie kennt nur eine (gepolsterte) Klasse in D-Zugform, aber ohne Abteileinteilung. Der Ausstattung nach ist sie etwa wie bei uns II. Klasse, aber oft ebenso schmutzig wie es die Bahn noch bis vor kurzem in Italien war. Papier, Obstschalen, Zeitungen wird alles einfach wie aus der Hochbahn an den Boden geworfen! Die Bahnen sind sämtlich Privatbesitz und machen sich gegenseitig tüchtig Konkurrenz. Oft fahren zwei Linien, die von verschiedenen Gesellschaften gebaut sind und betrieben werden, dicht nebeneinander vom selben Ort zum selben Ziel! Sie suchen sich gegenseitig durch größere oder mindere Schnelligkeit und Zugsicherheit (aber ohne kostspielige Bahnwärter[S. 69] und Schranken!), Ausstattung der Wagen u. ä. den Rang abzulaufen. Der sich entwickelnde Ruß und die umherfliegende Asche der Lokomotiven ist höchst unangenehm. Die Wagenfenster sind daher kaum zu öffnen. An Wegkreuzungen ertönen Signale der Maschine. Die Landstraße hat nur ein Warnungsschild: „Look out for the engine!“[12] Jeder hat also auf sich selbst aufzupassen, daß er nicht überfahren wird; niemand wird sein Leben garantiert. Die Schnelligkeit ist im allgemeinen gut, die Wagen sind sehr fest aus Eisen gebaut und auf Zusammenstöße eingerichtet, aber der Unglücksfälle sind es wegen mangelnder Aufsicht und beschränktem Personal auch dreimal soviele als bei uns! Was macht das? Leben gilt nichts. Ohne Umstand fährt der Zug ein und aus nach dem Rufe: „All aboard!“ Jeder hat selbst dafür zu sorgen, daß er richtig in den Zug hineinkommt und das Abfahren nicht verpaßt, sintemal das Trittbrett sehr hoch ist. Schilder ihrer Bestimmung tragen die Wagen nicht. Glücklicherweise saß ich nicht in einem Wagen, der unterwegs abgehängt wurde ...!
Also fuhr ich zum ersten Male in einem amerikanischen Eisenbahnzug.
Lange noch ging es durch die Häuserblocks Neuyorks. Noch einmal hielten wir an der 125. Straße, dann erschienen rechts die Wälder des Bronxparkes über dem Harlem River. Reizende Blicke öffneten sich rechts nach dem Long-Island-Sund mit seinen blauen Linien des Ozeans am Horizont. Das Land war rings übersät von zierlichen, luftigen Holzvillen der amerikanischen Bauart, dazwischen gab es aber auch wüste, unangebaute Strecken, kleine schlechte Fahrwege, viel Unordnung. Das Land erscheint, wie Lamprecht bemerkt hat, immer noch reichlich unfertig. Alles erweckt den Eindruck schneller und planloser Bebauung ohne Überblick und Zusammenhang. Hier baute sich eben jeder an, wo es ihm gerade beliebte, und rodete soviel als er vermochte. Das andere blieb, wie es war. Wie würde es erst im Westen aussehen, wenn schon der kultivierte Osten so ungeordnet und wild aussah?
[S. 70]
Am Long-Island-Sund liegen große Industrieorte, wie Bridgeport und Newhaven. Im letzteren ist der Sitz der altberühmten „Yale-Universität“, der alten gefeierten Konkurrentin Harvards. Golden strahlte aus der Stadt die Kuppel des Stadtkapitols, da alle an Größe und Stil gern mit dem großen „Kapitol“ in Washington eifern möchten.
Von Newhaven ging es nordwärts nach dem rauchigen Hartford. Obwohl wir hier durch dichtbesiedelte Gegenden fuhren, reicht die Bevölkerungsdichte auch nicht entfernt an die unserer europäischen Industriebezirke an der Ruhr, in Belgien, um Chemnitz oder Manchester heran. Nach den beiden letzten Städten nennt sich die Eisenbahnlinie, mit der ich fuhr: „New York, New Haven and Hartford Railroad.“
Hinter Hartford lenkten wir östlich in die prächtige hügelige und romantische Landschaft Connecticuts: Wälder, Berge, Sümpfe, kleine Teiche, pfadloses Gestrüpp, wohin man sah. Hier wäre ich gern einmal ausgestiegen und planlos gewandert. Aber der Zug fuhr unentwegt weiter und hatte für solche unnützen Landbummler keine Haltestelle. Das Wandern durch die Natur und das Steigen auf die Berge ist überhaupt in Amerika noch wenig üblich. Dazu sind die Entfernungen auch meist zu groß, der Wege zu wenig, die Sonntage zu heilig und ein Rucksack drüben — zu lächerlich! Die Farmen Connecticuts, an denen wir vorbeisausten, waren eingebettet in den prächtigsten Herbstschmuck. Hin und wieder sah ich äußerst anheimelnde Landhäuser und gemütvoll weidende Rinderherden. Sonst nur weglose und ungepflegte Wälder. Üppig und ungehemmt schießt und sprießt es überall aus dem noch nie gepflügten oder gerodeten Boden. Wie kahl und arm sind dagegen oft unsere allzu wohlgeordneten Waldungen.
Einige Male hielten wir auf kleineren Stationen (Willimantic, Pomfret, Putnam) in fast unbewohnter Gegend. Seit Hartford hatte sich überdies unser Zug recht geleert. So saß man gemütlich auf den Polstern, und es ermüdete mich nicht im geringsten, stundenlang unverwandt das Land des neuen Erdteiles in mich aufzunehmen. Und[S. 71] hätte man Langweile gehabt, so hätte sie einem der boy vertrieben, der ständig in jedem Zug alle möglichen und die unmöglichsten Dinge anzubieten pflegt: Glacéhandschuhe, Bilder, Karten, Schokolade, Reiseführer, Zeitungen, Bücher u. dgl.
Gegen zwei Uhr nachmittags nach fast sechsstündiger Schnellzugsfahrt (man vergleiche aber die kurze Entfernung auf einer Karte der ganzen Union!) näherten wir uns Boston, dem altenglischen Kulturzentrum, der Stadt, in der die geistig feinsten und aristokratischsten Leute Amerikas wohnen, wie man allgemein in Amerika zugesteht. Boston ist der Sitz der feinen Bildung und Sitte. Sogar die Aussprache ist dort nicht ganz so dumpf wie sonst, sondern sucht sich der helltönenderen der Engländer anzupassen.
Seit Blackstone rasten wir ungehemmt durch die Ebene. Dann ging es durch die Vorstädte Bostons. „Black Bay Station“ — und nach wenigen Minuten waren wir in der breiten rußigen „South Union Station“. Trotz ihrer 16 Einfahrtsgleise hatte sie nichts Imponierendes.
Es regnete! — — —
Boston erscheint trotz seiner über eine halbe Million zählenden Einwohner klein, wenn man aus Neuyork kommt. Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der Unabhängigkeitskämpfe, war Boston die volkreichste und auch die politisch führende Stadt der Union. Schon 1630 hatten sich hier die ersten englischen Kolonisten im benachbarten kleinen Salem angesiedelt, während Neuyork noch „Neu-Amsterdam“ hieß und kaum 100 Holländer beherbergte (s. S. 51)! 1770 begannen hier die Freiheitskämpfe mit dem sog. „Bostoner Blutbad“, in dem einige Bostoner von britischen Soldaten, die sie herausgefordert hatten, getötet wurden. Das war bei dem noch heute stehenden „Old State House“ mit dem noch heute dort befindlichen britischen Löwen und Einhorn auf dem Dach. 1773 warfen Bostoner, als Indianer verkleidet, eine englische Teeladung, die trotz der „Nichteinfuhrakte“ importiert werden sollte, kurzerhand ins Meer, nachdem man sich in der Old South Church, die ebenfalls noch steht, versammelt hatte! Die Stelle dieser berühmten „Tea-party“ ist am Kai bezeichnet. Britische Truppen[S. 72] besetzten nun nach dieser Auflehnung die Stadt, aber General Washington überschritt bald den Charles River, der an Boston breit wie ein Meeresarm vorbeifließt, und befreite die Stadt 1776 aus den englischen Händen. Diese ganze Gründungsgeschichte der Union hat sich hier in Boston abgespielt! So ist es der historischste Boden des ganzen Landes und so erinnert es mit seinen alten efeuumsponnenen Kirchen in der City und der ehrwürdigen „Faneuil Hall“ und seinen krummen, engen Straßen in der inneren Stadt noch am ehesten an Europa.
Boston ist aber auch das amerikanische „Athen“. Nicht weit von Boston, in Concord und Cambridge, lebten und wirkten ein Hawthorne, Emerson, Longfellow, Lowell und Agassiz. Auch ein Benjamin Franklin, der Erfinder des Blitzableiters, ist in Boston geboren und begraben. Und dicht vor Bostons Toren, in Cambridge, liegt noch heute die älteste und tüchtigste Universität Amerikas, das Harvard College. Bostons Mittelpunkt ist der „Common“, ein zentral gelegener, sympathisch wirkender, nicht allzu großer Stadtpark, der stattlich zum Hügel des State House (Kapitol) mit seiner weithin leuchtenden vergoldeten Kuppel emporsteigt. Das State House (Regierungsgebäude) enthält prächtige Innenräume, vornehme Hallen, die in großen Wandgemälden die geschichtlich wichtigen Augenblicke aus dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts festhalten.
Der unstreitig prächtigste Platz der Stadt aber ist der dem Charles River nahegelegene sog. „Copley Square“, den nicht weniger als vier ansehnliche und bedeutsame Gebäude zieren: zwei der schönsten und stilvollsten Kirchen des Landes, die romanische „Trinity Church“ der englischen Hochkirche und die in stilvoller italienischer Frührenaissance erbaute „New Old South Church“ der Kongregationalisten. Weiter säumt den Platz das Museum of fine arts, in der Hauptsache eine Gemäldegalerie. In ihr fand eine eigenartige Ausstellung statt, die dartun sollte, was für Kultur- und Sozialprojekte in 5 Jahren in der Welt und in Amerika im besonderen verwirklicht sein würden! Nur vergaß die damalige rührige und prophetische Ausstellungsleitung zu weissagen, daß die Welt vor allem das Kulturprojekt des Krieges[S. 73] aller gegen alle verwirklichte und gerade das kulturfortschrittliche Amerika zuletzt in diesem kulturfördernden Reigen sogar den Ausschlag geben würde! Endlich steht dort am Copley Square, wie sie sich rühmt, die größte Volksbibliothek der Welt, „the public library“, in weißem Marmor mit unübertrefflich prächtigen Lesesälen — auch einer besonders für Kinder! — und überraschenden Einrichtungen für schnellste Herbeischaffung jedes gewünschten Buches binnen wenigen Minuten! Ich habe dort allerdings den Eindruck gewonnen, daß der einfache Amerikaner bildungs- und lesehungriger ist als der gleichgestellte Deutsche. So ist auch die Zahl der trefflichen „magazines“, d. h. der guten illustrierten Wochen- und Monatszeitschriften, die vielmehr als die auf den Augenblick berechneten Tageszeitungen den Leser wissenschaftlich über alle wichtigen Dinge verständlich auf dem laufenden halten, unübersehbar groß und reich.
Um die Innenstadt Bostons mit ihren belebten und — verglichen mit Neuyork — zum Teil engen Geschäftsstraßen legen sich die feinen Wohnviertel, so die „Commonwealth Avenue“ und „Boylston Street“ und weiter hinaus umfangreiche Vorstädte, die sich zuletzt in reizende Landhauskolonien auflösen. Weite Parkgebiete sind überall dazwischen von der Bebauung freigelassen. In weitem Bogen umsäumen liebliche und aussichtsreiche Hügelreihen die Stadt in der Ferne wie die „Blue hills“, die „Arlington Heights“ u. a.
Am Bostoner Hafen ist’s freilich wie überall in Amerika düster und schmutzig. Reizvolle Städtefronten am Wasser anzulegen, versteht der Amerikaner offenbar noch nicht. Dazu ist der Sinn all die Jahrzehnte hindurch viel zu sehr aufs rein Praktische und Kommerzielle gerichtet gewesen. Wenn das Land auch, wie ich es einmal in einem Vortrag des greisen Harvardpräsidenten Dr. Eliot treffend ausführen hörte, über „politische Sicherheit, materiellen Reichtum und moralischen Fortschritt“ verfügt, so aber nicht über den Sinn für Beschaulichkeit und ästhetische Lebensgestaltung. Hier war noch nicht Kulturgeschichte, hier will sie erst werden. Hier war bis jetzt, die Neuenglandstaaten ausgenommen, im allgemeinen nur Geschichte des Handels und des politischen[S. 74] Aufschwungs. Freilich fiel das Riesenland der einst jungen und kleinen Union, die zuerst über nicht viel mehr als die schmalen Randstaaten des Ostens am Atlantischen Ozean verfügte, ziemlich mühelos in den Schoß, und unerschöpflich sind heute das Land, seine Bodenschätze, seine Hilfsquellen und Entwicklungsmöglichkeiten. —
Da ich mich lange in Boston und dem nahen Cambridge aufgehalten habe, hatte ich Muße genug, mich, soweit möglich, auch um das geistige Leben und die geistigen Fragen zu kümmern. So ging ich nach und nach fast auch zu allen wichtigeren kirchlichen Denominationen und religiösen Gemeinschaften, denn sie spielen in Amerika eine sehr ausschlaggebende Rolle. Es sind ihrer wohl an 200, deren jede frei ihrer Überzeugung lebt und ihr Bestes zu geben sucht. Vollkommene religiöse Toleranz hat zuerst Amerika in der Welt praktisch durchgeführt! Alle Religionsverfolgten Europas, von den englischen Puritanern angefangen, die 1620 mit der „Mayflower“ hinüberkamen, fanden hier eine gastliche Freistatt. Von Anfang an war hier Staat und Kirche getrennt. Die Kirchen verwalteten als freie religiöse Vereine und Genossenschaften sich stets vollkommen selbständig und hatten auch für ihre Existenz und ihre Bedürfnisse allein aufzukommen. So lernte der Amerikaner von Anfang an andere Überzeugungen achten und für die eigenen opfern.
Ein Sonntag in Amerika verläuft anders als bei uns. Am Sonntagmorgen liegt über der großen, werktags so rastlosen Stadt mit ihren Hochbahnen, Straßen- und Untergrundbahnen eine ungewohnte Stille. Nur das nie ruhende Meer wirft seinen weißen Schaum wie immer an die Uferdämme. Die wohlverankerten Boote schaukeln ein wenig hin und her, aber die Kais sind menschenleer. Die Straßenbahnen fahren selten. Nur die Schuhputzer haben wie immer zu tun. Hoch auf den Stiefelthronen sitzt heute auch der einfachste Kunde, und der Italiener oder Grieche fährt mit wohlgeübten Handgriffen mit mehreren Bürsten zugleich über die Schuhe, bis sie blank sind, daß man sich fast darin sehen kann. Alle großen Geschäfte, die menschenwimmelnden Warenhäuser, die Banken, alle Theater und die meisten[S. 75] Restaurants, in denen in der Woche Hunderte ihren Lunch einnehmen, sind geschlossen. Die großen Geschäftsstraßen, in denen gestern Abend noch Tausende im Schimmer der aufblitzenden und wieder erlöschenden Reklameschilder hin und her eilten, sind wie ausgestorben. Es ist der „Sabbat des Herrn“, der Tag absoluter Ruhe, an dem sogar auf manchen Eisenbahnstrecken kein Zug fährt und manche Bahnhöfe einfach verschlossen sind!
Der Vormittag schreitet voran. Etwa um halb elf Uhr ertönen die ersten Glockenschläge, leise, fein und melodisch in rhythmischen Pausen. Kein weithin schallendes, ehern schwingendes Geläute ist es wie bei uns. Die meisten Gottesdienste in den Kirchen beginnen erst um elf Uhr. Da und dort sieht man Menschen den Kirchen zustreben, die meist weit kleiner als bei uns sind, versteckt und efeuumsponnen mit zierlichem Turm sich wenig oder gar nicht über die hohen, Geschäfts-, Wohn- und Logierhäuser hervorheben, ja manchmal wie Old Trinity in Neuyork ganz zwischen ihnen verschwinden. Wir studieren den sehr reichhaltigen und überaus mannigfaltigen Kirchenzettel der großen Zeitungen, reichhaltig durch die Unmenge der Denominationen, mannigfaltig auch durch die seltsamen Anzeigen der Predigtthemen und der im Gottesdienst stattfindenden Musikdarbietungen! Beides soll im besonderen Maße Hörer und Besucher anlocken und etwa andere „Konkurrenz“-Kirchen ausstechen. Liest man die lange Reihe durch: „Baptisten, Kongregationalisten, Christian Science, Episkopalisten, Quäker, bischöfliche Methodisten, Swedenborgianer, Spiritualisten, Presbyterianer, Unitarier, New thought, Theosophen, ‚church of higher life‘, Universalisten, Lutheraner, Heilsarmee,“ so hat man die Wahl. Sie alle sind geschichtlich begründet, manche, wie Christian Science, New thought u. a., sind erst jüngeren und jüngsten Datums. Bald waren es Unterschiede der Verfassung (Bischöfliche oder Episkopalisten, Presbyterianer oder mit Ältestenverfassung, Kongregationalisten oder solche, die auf Souveränität und Selbständigkeit der Einzelgemeinde pochen), bald waren es solche des Glaubens: Der Baptismus verwirft die Kindertaufe, der Methodismus fordert persönliche Bekehrung, die[S. 76] Quäker verwerfen ein berufsmäßiges Predigtamt. Die Lutheraner sind meist Deutsche, Schweden, Dänen oder Finnen. Die episcopal church ist der Rest der einst hier herrschenden englischen Staatskirche, noch heute die Kirche der vornehmen und vornehm sein wollenden Leute. Die „Unitarier“ sind im Anfang des 19. Jahrhunderts als Protest gegen die Dreieinigkeitslehre des Christentums entstanden. Die „Christian Science“ ist auch in Deutschland als Sekte der „Gesundbeter“ bekannt geworden. Die Swedenborgianer sind Anhänger des schwedischen mystisch-religiösen Philosophen Emmanuel Swedenborg. Führend im religiösen Volksleben scheinen im allgemeinen die Methodisten und Baptisten zu sein, in Neu-England mehr die Kongregationalisten, dazu kommt die englische Hochkirche unter den Reichen und unter den Deutschamerikanern die Lutheraner. Aber auch die meisten von ihnen teilen sich wieder in die verschiedensten Teilkirchen; auch die Baptisten und Methodisten sind mehrfach gespalten. Doch geht im ganzen durch das amerikanische Kirchenwesen heute durchaus ein Zug zur Einigung, vor allem auf sozialem und sittlichem Gebiete. So haben die Kirchen erst jüngst den Feldzug gegen den Alkohol gewonnen, wie sie einst ihr gewichtiges Wort gegen die Sklaven erhoben haben. Den praktisch-ethischen Fragen des Volkslebens mißt man drüben ein ganz anderes Gewicht in der Kirche bei als bei uns, während in Deutschland in der Vergangenheit sich alles in Glaubenskämpfen zerfleischte. Neben all diesen protestantischen Denominationen steht und wächst dank der jüngsten romanischen und östlichen Einwanderung immer machtvoller auch die römisch-katholische Kirche. Ein Kardinal ist ein Amerikaner. Die katholische Kirche übertrifft die größten protestantischen Kirchen noch an Bekennerzahl. Und sie ist, wie überall, ganz einheitlich.
Welchen Gottesdienst man aber auch besucht, die äußere Art desselben ist fast überall, abgesehen von den liturgisch reicheren Episkopalen und Lutheranern, sehr ähnlich oder gleich, selbst Swedenborgianer, Christian Science und Spiritualisten haben im allgemeinen denselben gottesdienstlichen Rahmen mit Lied, Gebet, Ansprache usw.[S. 77] übernommen. Außen an der Kirche gibt meist schon ein großes Plakat deutlich Auskunft über Name und Art der Gemeinde, über ihre Veranstaltungen, über Wohnung und Sprechstunden des Predigers u. dgl. In der Vorhalle findet man oft eine kleine Auslage von Büchern und Schriften, von denen die meisten unentgeltlich zur Verfügung stehen. Beim Eingang empfängt uns einer der Ältesten oder ein sog. „usher“, ein jüngerer Herr mit weißer Nelke im Knopfloch, der uns zu einem freien Sitzplatz geleitet. Die Kirchenbänke sind mit Polstern belegt, aus bequemen und wohlgeformten Holzwerk — nicht wie unsere jahrhundertalten steifen, harten Dorfkirchenbänke, von denen man oft mit Rückgrat- und Kreuzschmerzen aufsteht. In der Bank findet man Gesangbuch, Gebetbuch, ein Neues Testament, Schriften, ja wohl gar Fächer für die Damen bereitliegen! Also man liebt auch in der Kirche den Komfort und die Bequemlichkeit. Der Geistliche pflegt in einfachem schwarzen Rock ohne Talar an ein Sprechpult zu treten. Eigentliche Kanzeln haben nur die Katholiken, die Hochkirche und die Lutheraner. Auch ein Altar ist nur dort vorhanden. An dem Pulte wird gelesen, gebetet, gepredigt. Meist leitet guter Chorgesang den Gottesdienst ein. Dann spricht der Geistliche ein freies, längeres Gebet. An das Gebet schließt sich gewöhnlich eine Psalmenlesung, bei der Prediger und Gemeinde abwechselnd laut vorlesen. Ja, es kommt auch vor, daß ein Ältester oder sonst ein Laie die Schriftlesung hält. Danach erst setzt der Gemeindegesang ein, zu dem sich die Singenden von den Sitzen erheben! Frisch und rhythmisch, selten getragen, klingen die Choräle. Das ganze Lied wird abgesungen, nicht nur etwa drei langatmige und langsam gespielte Strophen. Die Liedstrophen sind selbst kurz und knapp und entstammen neueren religiösen Dichtern. Dem Liede folgt eine Solomusik und — nicht zu vergessen — das Kirchenopfer, das auf offenen Tellern eingesammelt und zur Danksagung nach vorn an den Altartisch getragen wird. Ich sah auf den Opfertellern meist nur Silberstücke oder Dollarscheine! Von den Kollekten und Mitgliedsbeiträgen lebt ja die Gemeinde. Man weiß also rechnerisch, was man zu geben hat. Das Auftreten der Solosängerinnen[S. 78] auf offener Predigttribüne im Angesicht der Gemeinde wirkt allerdings theatralisch und reichlich reklamehaft. Die kirchliche Predigt behandelt zeitgemäße Themata. Man liest sie in der Zeitung oft absichtlich eigenartig formuliert angezeigt: „Gott am Totenbett eines Sperlings.“ „Nach dem Tode — was dann?“ „Allein mit der Erinnerung.“ „Wie ein Mensch denkt.“ „Das Leben mit Flügeln.“ „Die Augen des Arztes.“ „Die Bergvision.“ „Christus und der Arbeiter.“ „Darwin und die Religion.“ „Das Göttliche der Selbstüberwindung“ usw. Die Prediger bevorzugen eine lebendige Sprechweise, anschauliche, aus dem Leben geschöpfte Darstellung voller Beispiele und praktischer Anwendung. Der amerikanische Prediger will in der Predigt packen, fesseln, werben und zur Tat veranlassen, weniger belehren, denn der Amerikaner bleibt Realist auch im Gottesdienst und läßt nie das wirkliche Leben aus dem Auge. So nehmen auch die Predigten Stellung zu allen Tagesfragen, den sozialen, politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ja sportlichen Ereignissen. Kein Thema ist verpönt. Gewandte Prediger genießen auch ein großes Ansehen. Teile ihrer Predigten drucken die Tageszeitungen ab und bringen — echt amerikanisch — ihr Bild dazu! Wenn auch nicht alle Amerikaner zu einer Kirche gehören, so doch alle, die irgendwie etwas gelten wollen und etwas sind. Es scheint mir drüben weniger Indifferenz und Abkehr von der Religion zu sein als in Europa trotz der starken wirtschaftlichen Interessen. Öffentliche Gebäude tragen sehr oft Bibelworte an der Stirnseite; keine öffentliche Feier beginnt ohne Gebet! Von der kirchlichen Regsamkeit mögen folgende Zahlen ein Bild geben: In Neuyork z. B. sind die Baptisten allein mit 51, die Lutheraner mit 45, die Methodisten mit 63, die Presbyterianer mit 57, die Hochkirche mit 93 (!), die katholische mit über 100, die jüdische Religion mit 26 Synagogen vertreten, die kleineren Denominationen ungerechnet. Man zählt in der Union etwa 200 000 Kirchgemeinden mit etwa 150 000 Kirchen und etwa 50 Millionen Sitzen. Es könnte also jeder Amerikaner einmal jeden Sonntag — entweder morgens oder abends — einen Sitz in einer Kirche finden! Deutsche Großstadtgemeinden[S. 79] haben oft 20-30 mal soviel Mitglieder als sie Kirchenplätze haben! Und doch sind die amerikanischen Kirchen eher besser besucht im Durchschnitt als die deutschen. Etwa 160 000 Geistliche — zehnmal mehr als das zwei Drittel so große Deutschland — unterhalten die amerikanischen Gemeinden nebst 200 eigenen theologischen Seminaren. Da die Kirchen keine Verbindung mit dem Staate haben, so gibt es in den Schulen keinen Religionsunterricht. Nach welcher Glaubensart sollte er auch erteilt werden? Nur Andachten mit Gebet und Bibellektion ohne Erklärung durch den Schulleiter sind daselbst gestattet. Den Ersatz des Religionsunterrichts bilden die überaus rührigen amerikanischen Sonntagsschulen, die über elf Millionen Kinder durch über eine Million freiwillige Hilfslehrkräfte unterrichten! Ist der Gottesdienst aus, so sieht man am Ausgang, in der Vorhalle, in den Gemeinderäumen die Gemeindeglieder noch länger verweilen, sich begrüßen und wie eine große Familie zusammenstehen und ihre Gedanken austauschen. An dem allgemeinen „shake-hands“ beteiligt sich auch der Geistliche. Wie oft ist nach einem Gottesdienst, den ich besuchte, der Prediger auch auf mich zugeeilt, weil er in mir den Neuling erkannte und für seine Gemeinde zu gewinnen hoffte! Das kirchliche Gemeindeleben ist allerorts mit seiner Geselligkeit und seinen Vortragsabenden, Vereinen und Veranstaltungen sehr rege und vielseitig entwickelt. Es kommt vor, daß Gemeinden eigene Turnhallen und Speiseräume, Lesezimmer, ja Schwimmbäder für ihre Jugend besitzen!
Der Sonntagnachmittag verläuft ebenso still auch an den schönsten Sommernachmittagen wie der Vormittag. Der ganze deutsche Vergnügungsrummel samt Ausflugsverkehr, Tanzboden und Im-Gasthaus-sitzen ist drüben unbekannt. Auch Fußball, Tennis, base-ball, die sonst so leidenschaftlich gespielt werden, ruhen am Sonntag. Die Theater spielen nicht; es herrscht „Sonntagsheiligung“ wie bei uns kaum an Karfreitag oder Totensonntag. Fußwanderungen unternimmt man auch nicht, höchstens ein auto-car-ride. Man besucht sich, schaukelt im Schaukelstuhl, liest die umfängliche Sonntagszeitung oder in den magazines und geht womöglich des Abends nach dem supper[S. 80] um sieben, halb acht oder acht Uhr noch einmal zum Gottesdienst oder zu einem kirchlichen Vortrag.
Des Nachmittags findet man aber auch die Redner, religiöse und politische, in den großen öffentlichen Parks am Werke. So erinnere ich mich eines Novembernachmittags in Boston. Der Common lag kalt und herbstlich mit seinen entlaubten Bäumen da. Das stolze Freiheitsmonument schaute über den grünen Rasen. Es bildeten sich einige Menschengruppen in dem Parke. Auf einer Bank stand ein Sozialist; dreißig, vierzig Arbeiter um ihn herum. Mit volkstümlich packenden Worten suchte er seine Hörer für die bald fälligen Staatswahlen in Massachusetts zu gewinnen. „Higher conditions, better wages!“[13] war seine Parole. Hier und da warf ihm einer der Umstehenden eine Frage dazwischen. Der Redner wußte immer witzig und treffend zu antworten. Ich ging zur nächsten Gruppe. Sie war kleiner. Ein Heilsarmeesoldat stand dort in der Mitte, vor Kälte waren ihm Hände und Nase rot. Er sang aus einem zerflederten Liederbuche den Umstehenden vor, einige Gleichgesinnte begleiteten ihn, und zwar eine alte verschrumpelte Negerfrau, drei bleiche Männer in armseliger Kleidung, ein hungriger, an einer sweetpotato (Süßkartoffel) kauender Junge und eine schwarzgekleidete feinere Dame, während ringsumher andere lachten, rauchten und schwatzten. Die frommen Sänger taten mir leid. Nun trat ein weißhaariger Herr auf und erzählte von seiner „Bekehrung“ und seinem erfahrenen seelischen Glück. Man lauschte. Die Heilsarmeeleute bekräftigten seine Worte ständig mit „Amen“ und „Hallelujah“! Nach einem weiteren dünngesungenen Liede trat ein dritter, bleicher, untersetzter Mann auf und hielt die zweite geistliche Ansprache. Das Publikum, das sich angesammelt hatte, wandte sich zum Teil schon wieder zum Gehen. Aber der kleine Bleiche schrie unentwegt aus Leibeskräften: „Das Geld macht nicht selig; die Rockefeller und Vanderbilt fahren alle zur Hölle, wenn sie sich nicht bekehren.“ Seine Augen funkelten dabei, aber man nahm ihn nicht ernst. Als er geendet hatte, knieten die Heilsarmeeleute[S. 81] — ein peinlicher Anblick — vor den Umstehenden nieder und beteten laut für das Seelenheil aller Anwesenden, der Soldat mit dem zerflederten Liederbuch, das alte verschrumpelte Negerweib, der hungrige kauende Junge, die feine schwarze Dame, der weißhaarige geistliche Redner und die drei bleichen arbeitslosen Männer. Unwillig wandten sich die letzten weg; einige junge Burschen aber warfen sogar von hinten ihre ausgerauchten Zigarettenstummel auf die Betenden! Nur zwei Damen traten heran und drückten den vom Gebet Aufstehenden dankbar und anerkennend die Hand und beteiligten sich an dem Schlußgesang. Ich ging fort. So geht es der Religion auf der Straße. Mehr Achtung und Anerkennung verdient schon das soziale Wirken der Heilsarmee.


Es war schwer, am Sonntag um Mittag eine „dairy“ oder einen geöffneten „lunchroom“ zur Erquickung zu entdecken. In den Familien saß man jetzt am offenen Kaminfeuer beim traulichen Mittagstisch. Und als ich gar am Nachmittag den Versuch machte, in Ermangelung von Fußwegen auf der Landstraße einen Nachmittagsspaziergang aufs Land hinaus zu unternehmen, überschütteten mich die Autos dermaßen mit Straßenstaub, daß ich grau und weiß wie ein Müllerbursche mit meinen guten dunklen Sonntagskleidern wieder heimkam! Einmal, sagte ich mir, und nie wieder! Für was mich wohl die Insassen der Autos gehalten haben mögen? Gewiß für einen „armen dummen Deutschen“!
Boston mit seinen mancherlei geistigen und philosophisch-religiösen Bewegungen ist auch der Ursprung für die in der Welt so viel von sich reden machende Christian Science (christliche Wissenschaft), die am schnellsten von allen Sekten gewachsen ist. So war ich denn gespannt, auch sie in ihrer Heimat und am Orte ihrer Entstehung kennenzulernen. An einem der nächsten Sonntage besuchte ich ihren „Tempel“. Er ist unstreitig eine der schönsten und großartigsten Kirchengebäude in Amerika. Im Unterschied von den meisten anderen Kirchen ist es eine mächtige, imponierende, etwas an den Berliner Dom erinnernde Kuppelkirche im Barockstil, die an 3000-4000 Menschen faßt. Weißer[S. 82] Marmor verleiht dem Innern großartige Feierlichkeit. Dreifache balkonartige Galerien, wie wir sie in unseren Opern gewöhnt sind, laufen an drei Seiten der Rundung um. Die vierte Seite wird von einer gewaltigen Orgel eingenommen, deren Marmorseiten in mächtigen Lettern an der einen die Bibelstelle von dem Geist als dem Tröster und an der anderen ein entsprechendes Wort der Gründerin der Sekte tragen. Christus und die Gründerin der Sekte, Mrs. Mary Baker-Eddy, stehen in gleichem kanonischen Ansehen, so wie aus der Bibel und dem von ihr herausgegebenen „Textbuch“ stets unmittelbar neben- und nacheinander im Gottesdienst vorgelesen wird.
Bereits einige Zeit vor Beginn füllte sich die mächtige Halle. Im ganzen vorherrschend „die oberen Zehntausend“. Zylinderhut und rauschende Seidentoiletten herrschten durchaus vor. Draußen fuhr ununterbrochen ein Auto nach dem anderen und eine Equipage nach der anderen vor, wie vor kaum einer anderen Kirche der Vornehmen. Als schüchterner Fußgänger ging ich zwischen den Parfümduftenden und Glacébehandschuhten auch hinein. In geräumigen Wandelhallen war Gelegenheit, unentgeltlich wie im Konzertsaal oder im Theater die Garderobe abzulegen. Innen führten feingekleidete Herren mit der wie überall obligaten weißen Nelke im Knopfloch die Besucher zu den mit bequemen Polstern belegten Sitzreihen. (Merkwürdig, daß man ausgerechnet in den freien Kirchen des freien Amerika nirgends sich seinen Sitzplatz selbst wählen darf!) Ich kam so links von einem der Mittelgänge halbwegs nach vorn zu sitzen, von wo ich alles sehr gut übersehen und hören konnte. Während die Orgel machtvoll einsetzte, schritten der erste und zweite Vorleser, ein Herr und eine Dame (!) die goldgeschnittenen Bücher (Bibel und „Textbuch“) feierlich unter dem Arm, zu ihren Predigersesseln im Angesicht der Gemeinde auf einer sehr geräumigen erhöhten Marmorbühne unter der Orgel. Auch eine Sängerin in großer Toilette mit prachtvollem Blumenbukett in der Hand nahm dort Platz. Die Feier begann dann mit gemeinsamem Gesang aus dem eigenen Liederbuch der Christian Science, zu dem auch Mrs. Eddy selbst eine Anzahl Gesänge beigesteuert hat. Dem[S. 83] gemeinsamen Gesange folgte, wie überall, gemeinsames Gebet, dem sich das gemeinsam gesprochene Vaterunser in szientistischer Umbildung anschloß. Dieselbe lautet in deutscher Übersetzung folgendermaßen:
Ich setze dies Gebet hierher, weil aus ihm recht deutlich die Grundanschauungen der Christian Science erkennbar sind. Der Schwerpunkt liegt in dem Schluß: Weil Gottes geistiges und vollkommenes Wesen alles in allem ist, die alleserfüllende Weltsubstanz, so ist Sünde, Krankheit und Tod nur Schein. Wer mit Gottes Liebe verbunden ist, wird von allen Übeln wirklich befreit. So legen die Szientisten auch in der Betrachtung des Lebens Christi weit größeren Nachdruck auf seine Heilungen als auf seine Verkündigung, z. B. Worte wie Matth. 10, 8: „Machet die Kranken gesund, reiniget die Aussätzigen, wecket die Toten auf, treibet die Teufel aus“ sind für sie geradezu ausschlaggebend. Aber merkwürdig halten sie es nicht mit der unmittelbaren Fortsetzung: „Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebet es auch. Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Erz in euren Gürteln haben.“ Wie man hört, lassen sich die Heiler ihre Kunst gut bezahlen, auch das „Textbuch“ ist recht teuer! Von der Allmacht des geistigen Prinzips in der Welt und im Menschen wird alles Heil, vor allem auch die körperliche Heilung von allen Leiden ohne Anwendung medizinischer[S. 84] Mittel erwartet. Darin ähnelt die Christian Science den in jüngster Zeit in Amerika zahlreich erwachsenen Bewegungen der sog. „mind-cure“ (Gemütskur), deren auch in Deutschland bekanntester Prophet Ralph Waldo Trine ist. Nach der wechselweisen Vorlesung aus Bibel und „Textbuch“ erhob sich die Sängerin in großer Toilette und sang mit mächtiger Stimme, von den Tausenden bestaunt, in den weiten Dom hinein. Darauf kam, wie überall, die „Predigt“, die aber nicht aus der freien Rede eines religiösen Redners über ein selbstgewähltes Thema, sondern wiederum nur aus einer etwa halbstündigen, auf den Fremden und Nichtgläubigen eintönig wirkenden Vorlesung aus Bibel und „Textbuch“, Vorlesungen, die für alle szientistischen Gemeinden der Welt autoritativ ausgewählt sind, bestand. Sie sollen der Höhepunkt der Versenkung in das alles Übel heilende geistige Weltprinzip sein. Die Lektionen sind nach Themen geordnet und werden quartalweise im voraus publiziert, z. B. 1. „Nichtwirklichkeit“. 2. „Sind Sünde, Krankheit, Tod wirklich?“ 3. „Die Lehre von der Versöhnung“. 4. „Ewige Verdammnis?“ 5. „Adam und der gefallene Mensch“. 6. „Die Prüfung nach dem Tode“. 7. „Sterbliche und Unsterbliche“. 8. „Seele und Leib“. 9. „Gott, die einzige Ursache und der alleinige Schöpfer“. 10. „Ist das All atomistisch entstanden?“ usw. Alle diese Themen spiegeln eine durchaus optimistische und idealistisch-religiöse Weltanschauung. Nach dieser „Predigt“ wurde auch hier die Kollekte gesammelt. Schweigend wurden die offenen Teller durch die Reihen gereicht, und ganze Bündel von Dollarscheinen sah ich darauf niedergelegt! Dann strebten die Tellerträger mit ihnen zur Marmorbühne, wo sie als „Opfer“ niedergesetzt wurden. Nach den Schlußworten geriet die ganze große vornehme Menge wieder in Bewegung, die Galerien leerten sich, die Treppen und Wandelhallen füllten sich; aus den Sonntagsschulsälen strömten die jungen Leute. Draußen tuteten die Automobile, und feine Equipagen fuhren mit Pferdegetrappel wieder die Asphaltstraßen davon. Und das Sonntag für Sonntag mit erstaunlicher Anziehungskraft!
Neben dieser Sonntagsfeier im Christian-Science-Tempel finden[S. 85] jeden Mittwoch Abend sog. „test-meetings“ (Zeugnisversammlungen) statt, in denen anstatt der Vorlesungen Gelegenheit zu offener Aussprache über erfahrene Heilungen gegeben wird. Schon in Neuyork hatte ich eine solche Zeugnisversammlung besucht. Es war ein strahlend erleuchteter prunkvoller Kirchensaal, der viele Hunderte faßte und bis auf den letzten Platz gefüllt war, wiederum im besten Teil der Stadt gelegen und von vornehmsten Kreisen besucht. Gesang, Gebet und Vorlesung eröffneten auch hier den Abend. Dann folgten die „tests“, auf die ich besonders gespannt war. Zuerst erstaunte mich der Freimut der Damen, mit dem sie hier zumeist — wie überhaupt auch sonst im amerikanischen Leben — das große Wort führten, ohne Zögern aufstanden und einige Minuten fließend und überzeugend vor Hunderten von ihren Erfahrungen sprachen, etwa zehn bis zwanzig Personen. Solche „Zeugnisse“ von erlebten Heilungen ohne Anwendung medizinischer Mittel, nur durch Glaube und Gebet, wie sie hier gegeben wurden, können in jeder Nummer des Christian-Science-Journals nachgelesen werden. Viel eindrucksvoller ist natürlich ihre persönliche Wiedergabe in öffentlicher Versammlung. Der Nachdruck lag, wie ich feststellen konnte, bei den meisten auf geheilten Gemütsstörungen und nervösen Leiden, über die schon unser alter weiser Kant geschrieben hat: „Von der Macht des Gemüts, seiner krankhaften Gefühle Meister zu werden“[14]. Aber immer wird auch von der Besserung und Heilung akuter und organischer Leiden erzählt! Für reine Illusionen tritt gewiß niemand öffentlich auf, mag auch noch soviel Suggestion und Selbsttäuschung manchmal dabei die Hand im Spiele haben. In diesen persönlichen Zeugnissen liegt jedenfalls eine ungewöhnliche Werbekraft. Freilich sind auch Fälle erwiesen — mir ist selbst ein solcher persönlich bekannt —, wo das überspannte Verschmähen der berufsärztlichen Kunst den Tod herbeigeführt oder mindestens beschleunigt hat. Da der Mensch von genug Krankheiten und Übeln geplagt ist, die Gesundheit jedem über alles geht und schon[S. 86] mancher auch umsonst viel Geld zum Doktor und in die Apotheke getragen hat, so wirkt begreiflicherweise diese Verheißung von geistiger Heilung wie ein unübertroffenes Evangelium. Zweifellos sind auch Erfolge da. Besonders bemerkenswert war mir, in wie vielen „tests“ betont wurde, daß die Sprecher erst durch die Christian Science auch ein neues inneres Glück, echte Lebensfreude, ja Kraft, Daseinslust und eine neue inhaltvolle Lebensansicht gewonnen hätten. Das sind gewiß noch die echtesten Zeugnisse früher religiös unbefriedigter oder unangeregter Menschen. Viele suchten hier Heilung des Körpers und fanden Frieden der Seele. Mit solchen Zeugnissen und Erfolgen glaubt die Christian Science ihre spezielle Lehre gleichsam experimentell bewiesen zu haben. Darum ist nach ihrer Ansicht allein ihre religiöse Lehre „Wissenschaft“ (science). Krankheit, Sünde und Tod sind Irrtum und Schein. Aber hat sie schon je vom Tode geheilt? Ist nicht auch die hochbetagte Gründerin Mrs. Eddy schließlich gestorben? Merkwürdigerweise hat die Sekte den Tod der Stifterin leicht überstanden. So zählt sie heute etwa 1200 Gemeinden in Nordamerika, England und Deutschland. Das „Textbuch“ hat seit seinem Erscheinen im Jahre 1875 an die 200 000 Auflagen (!) erlebt. Die Gemeinden sind straff organisiert und zentralisiert. Bis zu ihrem Tode hatte die gewandte und energische Mrs. Eddy alle Zügel allein in der Hand. Sie ist die Verfasserin des nicht allzu geistvollen „Textbuches“; ein amerikanischer Geistlicher namens Quimby hat es entscheidend redigiert. Es ist etwa so umfangreich wie ein Neues Testament. Seine Ausführungen wiederholen sich endlos. Die Kapitelüberschriften (es ist nur in englischer Ausgabe vorhanden!) lauten in Übersetzung: 1. Wissenschaft, Theologie und Medizin; 2. Physiologie; 3. Fußstapfen der Wahrheit; 4. Schöpfung; 5. Wissenschaft des Seins; 6. Christian Science und der Spiritualismus; 7. Ehe; 8. Tierischer Magnetismus; 9. Beantwortung einiger Einwürfe; 10. Gebet; 11. Versöhnung und Abendmahl; 12. Christian-Science-Praxis; 13. Das Lehren der Christian Science; 14. Zusammenfassung. Anhangsweise folgt noch ein „Schlüssel zur hl. Schrift“, d. h. bezeichnenderweise[S. 87] nur zu dem mystisch-mythologisch erklärten ersten und letzten Buch der Bibel!
So ist der Amerikaner zwar äußerlich kirchlich in eine Unzahl von Kirchengemeinschaften und Sekten geschieden, aber praktisch in den Lebenszielen unendlich viel einheitlicher. Mögen sie Baptisten, Methodisten, Hochkirchliche, Heilsarmee, Quäker oder Presbyterianer heißen, sie wollen alle dasselbe sittlich-geistige Ideal in das amerikanische Volk pflanzen. Sie predigen weder Dogmen noch ethische Prinzipien, sondern gründeten lieber Liga auf Liga zur Bekämpfung sozialen Elends oder der Trunksucht, zur Förderung der Sonntagsheiligung, der Ausbildung der Masse, der Ausbreitung der Sonntagsschulen, der Einbürgerung der Fremdlinge aus dem fernsten Osten ins amerikanische Volk, der Ausbreitung der Mission nach Afrika, China und Japan u. ä. Und zwar genügen dem Amerikaner dabei nicht Vereine mit wohlausgedachten Statuten und einem Häuflein Mitglieder, sondern jedesmal muß es ein „movement“ werden, eine Bewegung, die riesenschnell wächst, gleich den Wolkenkratzern ihr Haupt gigantisch in die Höhe reckt und binnen kurzem Millionen Dollars an freiwilligen Spenden flüssig macht. Die Tätigkeit der Gemeinden und Geistlichen ist daher vielfach maßlos. Jeder Tag ist erfüllt mit Geselligkeiten, Vereinigungen, Zusammenkünften und Klubs aller möglichen Altersgruppen. Man ist immer tätig und immer beschäftigt, um des Sonntags auch desto strenger zu feiern und zu ruhen. Über die Möglichkeit der Durchführung solcher Bestrebungen wird auch nicht lange gegrübelt, sondern frisch probiert. Glückt es, so ist die Sache „gut“ und in ihrer Wahrheit „erwiesen“. Das und nichts anderes ist zugleich der Kern der modernen, so echt amerikanischen Philosophie des „Pragmatismus“. Freilich ist die Kehrseite dieser Art eine Verschwendung von Kräften. Jeder kann eine Kirche bauen und eine Gemeinde gründen und einen Pastor berufen. Es kann vorkommen, daß ein Städtchen von 1700 Einwohnern sage und schreibe neun(!) verschiedene Gemeinden beherbergt und ernährt, daß an allen vier Straßenecken je eine Kirche einer anderen Denomination steht, so daß[S. 88] schon 50-100 Familien eine „Gemeinde“ bilden und zu ihrer Erhaltung unendliche Opfer bringen müssen, aber auch bringen. Dafür sind sie aber auch Sonntags womöglich zweimal in „ihrer“ Kirche. Die Konkurrenz blüht, stachelt, treibt vorwärts und zerreibt zugleich. Der Staat ist nicht berechtigt, irgend jemand nach seinem religiösen Bekenntnis zu fragen. Die öffentliche Statistik ist auf die Angaben der Kirchen selber angewiesen, obwohl auch kein Kongreß oder Senat ohne Gebet eröffnet wird. Ein Spötter könnte kein wichtiges öffentliches Amt bekleiden, so wenig wie in England.
So rastlos der Amerikaner arbeitet und Geschäfte treibt, so ernst nimmt er es mit seiner Religion. Die Opferwilligkeit ist erstaunlich groß, die Unzahl der Kirchen, Gemeinden und Pastoren kostet viel Geld, wenn die Kirchen auch meist kleiner und schlichter gebaut sind als die unseren, und der Missionseifer auch unter den Gebildeten ist gleich groß wie auch in England. Nichts wäre unrechter, als einfach von amerikanisch-religiöser „Heuchelei“ zu sprechen, jedenfalls ganz unrecht von bewußter Heuchelei. Die Moral des Geschäfts und der Frömmigkeit gehen in der anglo-amerikanischen Welt nebeneinander her und ineinander über. Der Anglo-Amerikaner empfindet nicht die Schwierigkeiten, die für uns hier verborgen liegen. Er theoretisiert nicht, wie wir es tun. Er ist praktischer Geschäftsmann und ebenso praktisch tätig in seiner Religion.
Hier können wir uns gegenseitig um unserer verschiedenen Wesensart willen schwer verstehen. Ebenso wie uns die allzu rastlose Betriebsamkeit und Überemsigkeit auf kirchlichem Gebiete schließlich auf die Nerven fällt und uns zur Stille und Keuschheit wahrer Frömmigkeit schlecht zu passen scheint, ist das Drängen auf praktisches kirchlich-religiöses Handeln doch auch vorbildlich; und doch mögen wir es nicht etwa für den Preis tiefgründigen deutschen Weltanschauungsdenkens erkaufen. Daß die Kirche auf sozialem Gebiet oft viel lauter als bisher bei uns in der Öffentlichkeit ihre Stimme hätte erheben sollen, könnten wir von drüben lernen.
So ist es nicht ganz leicht, ein Wort über das innerste Wesen[S. 89] amerikanischer und deutscher Frömmigkeit zu sagen. Der Amerikaner ist froher, heller, tatenreicher. Ist er weniger ernst? Der Erweckungsversammlungen und Gebetsallianzen sind viele, Missionsstudium und Bibelkurse blühen. Und doch will es manchmal scheinen, als reiche amerikanisch-englische Frömmigkeit nicht an den tiefer gehaltenen Ernst derjenigen eines Martin Luther heran. Das Wesen der Frömmigkeit ist schwer zu erlauschen. Die amerikanischen kirchlichen Lieder sind frisch und heiter auch in der Melodie. Aber die ernstesten Gedanken werden dadurch leicht auch zu Spiel und religiöser Unterhaltung. Wie ich es einmal fand, daß man die Choräle mit Händeklatschen begleitete! Das Gemisch von religiöser Erbauung und Geselligkeit im Kirchenleben hat seine Gefahren. Religion gedeiht doch besser in alten Domen und ehrwürdigen gotischen Kirchen als bei Limonade, Schwimmbassins, Turnhallen, Empfangsräumen, Salons u. dgl. Die stets freien Gebete wirken leicht unkeusch; der Bekehrungseifer stößt ab, die Predigten sind oft zu sehr effekthaschend, wenn jedes größere Sportfest u. a. auch sofort seine Resonanz in der Predigt findet. — — —
Ende November stand mir in Boston ein weiteres wichtiges geistiges Erlebnis bevor. Der bekannte und große Negerführer Booker T. Washington, der noch lebte, sollte in Boston sprechen. Den mußte ich natürlich sehen und hören. Mit den gedrückten und ausgestoßenen Negern hatte ich gleich bei meiner Ankunft in Hoboken Sympathie empfunden. Diese geheime Freundschaft wollte ich ihnen auch bewahren.
Um acht Uhr abends sollte die Versammlung — bezeichnend! — in New Old South Church beginnen. Als ich um sieben Uhr auf dem Copley Square ankam, war die weite Kirche schon gefüllt. Ganz hinten erwischte ich gerade noch ein Stehplätzchen. Als die Versammlung begann, geleiteten der Rektor der Kirche D. Gordon und Präsident Lowell von der Harvard-Universität den großen Negerführer auf das Podium. Präsident Lowell — eine hohe Auszeichnung für den Negerredner — führte Mr. B. T. Washington, einen breitschulterigen, etwas ergrauten gelblichdunkeln älteren Neger mit einem breiten untersetzten[S. 90] Kopf, der üblichen unschönen Nase und den wulstigen Lippen, mit den Worten ein: „Der große Erzieher, Rasseführer und Bürger!“ Echt amerikanisch! Einst war der bedeutende Mann im Winkel geboren als Sohn eines unbekannten weißen Mannes und einer verführten Negersklavin, Sklave unter Sklaven, nun war er Führer einer ganzen Rasse, Volksbildner, Redner und Schriftsteller, um den das ganze amerikanische Volk sich drängte, wenn er sprach. Ich konnte gerade zwischen zwei riesigen Damenhüten, deren Träger sich mit mir Schulter an Schulter hineingeschoben hatten, noch auf Booker T. Washington hindurchsehen, wenn ich mich auf die Zehen stellte. Rings um mich Kopf an Kopf, meist Weiße, aber auch Schwarze, die nicht in allen Kirchen bei den Weißen gelitten sind. Hinter mir stand noch weiter Mann an Mann bis auf die Straße hinaus.
Atemlose Stille herrschte, als B. T. Washington mit etwas heiserer, aber starker Stimme begann, mit seinem trockenen Humor ein Redner von Gottes Gnaden. Eine volle Stunde verbreitete er sich über die Erfolge des von ihm geleiteten Negerbildungsinstitutes in Tuskegee, seiner eigensten Schöpfung, die 1500 Studenten unter 167 „Instruktoren“ (Lehrern) zählt. Während er, der Neger, zu dem weißen gebildeten Publikum der besterzogenen Stadt der Union redete, sprach seine ganze Lebensgeschichte unbewußt mit, und die Zukunft einer ganzen Rasse schien wie eine Siegeswolke um ihn zu lagern.
Der Sklave.
Aus „Neue Welt“. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. Herausgegeben von Claire Goll. S. Fischer Verlag, Berlin 1921, S. 50.
Einige Tage zuvor hatte ich B. T. Washingtons „Autobiographie“ und sein Buch über die „Zukunft des amerikanischen Negers“ gelesen und war voll Bewunderung und Enthusiasmus. Jetzt, da ich ihn selbst sah, tauchten alle die anschaulichen Bilder wieder empor, die er gezeichnet hat. Welches Elend hatte ihn doch noch in seiner Jugend in der Sklavenhütte umgeben, welche harte Arbeit nach der Sklavenfreiheitsproklamation in der Salzmine und der Kohlenzeche. Und wie hatte er sich ergreifend danach gesehnt, eine Schule besuchen zu dürfen! Welch ein Reichtum dünkte ihm die erste Mütze, die ihm seine Mutter aus einigen Fetzen zusammennähte, oder das erste Büchergestell, das er sich aus einer Kiste zimmerte! Und als er als kleiner Junge ein neues Hemd bekam, trug es sein älterer Bruder für ihn erst eine Zeitlang, denn es war aus so grobem Stoff, daß es seine zarte Haut wund gerieben hätte. Und als er sich dann nach Jahren mit 50 Cents in der Tasche aufmachte, nach Hampton zu gehen und die von General Armstrong geleitete Negerschule zu besuchen, und auf der Straße schlafen mußte, weil das Hotel ihn als Schwarzen nicht aufnahm, Schiffe ausladen half, um sich ein Frühstück zu verdienen, und sein Schulgeld im Institut damit verdiente, daß er Kohlen trug und die Zimmer fegte, in den Ferien seinen Mantel verkaufte, um sich das Reisegeld nach Hause zu verschaffen und seine Mutter wiederzusehen, da begann langsam die Zeit seines Emporsteigens zu dämmern. General Armstrong schätzte ihn bald sehr hoch und empfahl ihn nach seinen Prüfungen als Lehrer an eine Negerschule und dann später das Negerinstitut in Tuskegee selbst einzurichten, eine Art technische Hochschule für Farbige.
Inzwischen hatte Booker T. Washington seine Ideen zu entfalten[S. 92] begonnen. Nur ein Wunsch beseelte ihn, seiner Rasse aufzuhelfen. Die Tage der Sklaverei wären vergangen, die Freiheit sei da. Die Freiheit aber stelle ungeahnte Aufgaben. Viele Neger betrachteten die Freiheit nur als Erlaubnis zu tun, was sie wollten. Andere suchten es sofort den Weißen in Wissenschaft und Technik gleichzutun, was meist mißlänge. Die meisten seien nach dem Norden ausgewandert und suchten sich eine einträgliche Stellung als Kellner, Portier, Chauffeur, Straßenkehrer oder niederer Arbeiter und Handwerker zu verschaffen. Was sollte geschehen? Booker T. Washington faßte den klugen und volksphilosophisch richtigen Gedanken: Unsere Rasse ist jung und unentwickelt, mittellos und wenig geachtet trotz ihrer Freiheit. Sie muß sich ihre Achtung erst verdienen, sie muß sich ihre materielle Unabhängigkeit dadurch erkämpfen, daß sie sich Eigentum und Handfertigkeit erwirbt, die den Weißen in ihre relative Abhängigkeit bringt, m. a. W. sie muß anfangen, den Weißen im Handwerk und in den technischen Berufen zu überflügeln. Der Neger solle den Weißen nicht nur in der Krawatte und dem Schnitt des Anzuges, den gelben Schuhen und dem steifen Kragen nachahmen, sondern in seiner Tüchtigkeit. Washingtons Absehen ging deshalb allein darauf, den Neger technisch zu trainieren und ihn in den Stand zu setzen, sich vor allem eine ökonomisch und politisch geachtete Stellung zu erwerben. Nie ist Washington — ein besonders schöner Zug — ein Wort der Anklage gegen den Weißen entflohen, der lange genug den Schwarzen als Sklaven auf seinen Pflanzungen in den elendesten, aller Kultur und Bildung baren Verhältnissen gelassen hat. Er wollte allein seine Rasse aufrufen, ihre Zukunft in ihre Hand zu nehmen, um sich Achtung und Geltung selbst in der Welt zu erobern.
Augenblicklich liegen die Verhältnisse in dieser Hinsicht drüben noch recht kompliziert; anders im Süden als im Norden. Der Norden, der Neger nur in der Minderzahl enthält, hat die Sklavenbefreiung veranlaßt, er liebt die Freiheit der Rasse, aber trotzdem gelingt es dem einzelnen Neger selten, eine sozial wirklich geachtete Stellung einzunehmen. Der Süden, der an Negerübervölkerung leidet, hat eine[S. 93] völlig soziale Trennung der Weißen und Schwarzen durchgeführt bzw. seit der Negeremanzipation beibehalten. Der Neger hat dort seine besonderen Straßenbahnwagen und besondere Eisenbahnabteils. Kein „weißes“ Hotel nimmt einen Farbigen auf, sogar die Parks sind unter die Rassen geteilt! Die untergeordneten beruflichen Stellungen, die der Neger durchweg innehat, fördern das Gefühl und die Stimmung der Weißen, eine Herrenrasse zu sein, und der Neger muß sich auf Grund seiner ökonomischen und geistigen Abhängigkeit durchaus als Mensch zweiter Klasse fühlen. Um sein Stimmrecht wird er im Süden meist betrogen; politischer Einfluß ist für ihn ausgeschlossen. So sieht die Zukunft trübe aus für beide Teile. Der Neger bleibt im amerikanischen Volke ein Fremdkörper. Niemand sieht eine klare, glatte Lösung. Rückkehr der Neger nach Afrika ist unmöglich; Absorption in die weiße Rasse ist absolut nicht erwünscht und immer ein Unglück. So leben die 14 Millionen Neger wie ein unverdaulicher Fremdstoff unter den achtzig Millionen Weißen in den Vereinigten Staaten.
Die Schuld der Sklaverei rächt sich heute. Keine geschichtliche Tat geschieht ohne Sold. Und doch: Sollte die weiße Rasse nicht berufen sein, Lehrmeister ihrer schwarzen Schwester, die sie solange mißhandelt hat, zu sein? Keine günstigere Bedingung für die Neger, als in ein vollkommen kultiviertes Land gesetzt zu sein, wo der tägliche Anblick der Technik und aller entwickelten Lebensverhältnisse, einschließlich der sittlichen und sozialen, ihr ständig das höhere Kulturziel vor Augen hält, das sie erreichen soll. Sollte es wirklich eine Menschenrasse auf Erden geben, die grundsätzlich für alle Zeit auf einem niedrigen Niveau zu leben verdammt wäre? Und wenn man noch so oft darauf hinzuweisen pflegt, daß die schwarze Rasse bis jetzt noch nicht einen bedeutenden Menschen, noch nicht einen Shakespeare oder Goethe hervorgebracht hat, so ist das dieselbe Art der Argumentation, als wenn etwa Tacitus die Germanen ein Volk zweiten Grades hätte schelten wollen, weil sie damals noch keinen Phidias oder Sophokles zu seiner Zeit hervorgebracht hätten! Die Negerrasse hat noch keine „Geschichte“[S. 94] gehabt. Sie fängt eben an, die ersten Schritte in der Kultur zu tun, warten wir, und wenn es auch Jahrhunderte oder Jahrtausende dauern sollte! Der eine Booker T. Washington ist ein Gegenzeuge, und seine Tuskegeezöglinge und die auf den fünf anderen höheren Negerschulen samt den wenigen Negerstudenten sind schon ein Gegenbeweis. Gleich Josephs Brüdern verkauften die Weißen den Neger in die Sklaverei. Aber eben sein Gefängnis ist vielleicht dazu bestimmt, der Ausgangspunkt einer neuen glänzenderen Zukunft für ihn zu werden. Mir aber war es eine stille Freude, einen solchen Mann gesehen und gehört zu haben, der große Linien der Geschichte prophetisch schaut, mit kühnem Optimismus in die Zukunft seiner Rasse blickt und sein Leben dafür eingesetzt hat, daran mitzuhelfen, sie zu ermöglichen.
Als Probe von B. T. Washingtons praktischen Gedanken und seiner einfachen und anschaulichen Ausdrucksweise setze ich ein Stück aus seinem trefflichen Buche: „Charakterbildung, Sonntagsansprachen an die Zöglinge der Normal- und Gewerbeschule von Tuskegee, Berlin 1910“ hierher, und zwar das Kapitel: „Die Methode im häuslichen Leben“ (S. 65-69):
Der Wert der Methoden im häuslichen Leben.
„Die meisten von euch werden früher oder später von Tuskegee ausgehen, um ihren Einfluß auf das häusliche Leben unseres Volkes geltend zu machen. Dieser Einfluß wird sich erstrecken auf euer eigenes Heim, auf das Hauswesen eurer Mütter und Väter oder auf dasjenige eurer Verwandten. Wo ihr auch hingeht, in jedem Hause werdet ihr einen guten oder einen schlechten Einfluß ausüben. Wie man es anfängt, um die größte Summe von Glück in diese Heimstätten hineinzutragen, das ist eine Frage, die einen jeden unter euch angeht. Ich sage euch das, damit ihr euch klar macht, daß jeder einzelne von euch berufen ist, auf andere einzuwirken. Versäumt ihr es, diesen Einfluß zum besten anderer auszuüben, so habt ihr den Zweck verfehlt, den diese Anstalt verfolgt.
Vor allen Dingen müßt ihr euren Einfluß auf den Gebieten geltend machen, welche den besten Erfolg versprechen; unter diesen ist es wichtig, unserem Volk ein möglichst hohes Ideal des häuslichen Lebens vor Augen zu stellen. Sehr oft mache ich die Beobachtung — und zwar um so mehr, je länger ich unter unserem Volk umherreise — daß viele Personen sich vorstellen, sie könnten kein behagliches[S. 95] Heim haben, ohne sehr reich zu sein. Nun sind einige der fröhlichsten und behaglichsten Häuser, die ich kenne, solche von Leuten, die durchaus nicht wohlhabend sind, ja, die man geradezu arm nennen könnte. Aber es waltet darin ein Geist der Ordnung und Behaglichkeit, der macht, daß man sich darin so wohl fühlt, als ob man sich in dem Hause sehr reicher Leute befände.
Ich will mich deutlicher erklären. In erster Linie muß in allen Dingen, die das Hauswesen angehen, Pünktlichkeit herrschen. Beispielsweise bei den Mahlzeiten. Es ist unmöglich einen Hausstand ordentlich zu führen, wenn nicht eine bestimmte Zeit für jede Mahlzeit angesetzt ist und auch streng eingehalten wird. Es gibt Häuser, in denen einmal um sechs, einmal um acht, einmal vielleicht gar um neun Uhr gefrühstückt wird; das Mittagsbrot findet bald um zwölf, bald um eins oder zwei statt und das Abendbrot um fünf, sechs oder sieben; selbst dann fehlt oft die Hälfte der Familie, wenn das Essen angerichtet ist. Auf diese Weise vergeudet man Zeit und Kraft und macht sich überflüssige Mühe. Dagegen spart man Zeit und sehr viel Arbeit, wenn man ein für allemal eine bestimmte Stunde für die Mahlzeiten festsetzt und alle Familienmitglieder dazu angehalten werden, um diese Zeit zu erscheinen. Durch dieses Mittel wird der Familie viel Verdruß erspart und man gewinnt kostbare Zeit, um zu lesen oder sonst etwas Nützliches vorzunehmen.
Was nun ferner die Methode anbelangt; gleichviel wie ärmlich ein Hausstand ist, gleichviel wie wenig Geld im Hause ist, es ist immer möglich, die häuslichen Verrichtungen methodisch zu ordnen. Wie viele Hausfrauen gibt es wohl, die in dunkelster Nacht in ihre Wohnung kommen und ohne Mühe ein Streichholz finden können? Daran erkennt man die gute Hausfrau. Kann sie es nicht, so geht Zeit verloren. Man spart Zeit und auch Mühe, wenn man die Streichhölzer an einem bestimmten Ort aufbewahrt und alle Familienmitglieder daran gewöhnt, sie stets wieder dort hinzulegen. Oft findet man die Streichhölzer auf dem Tisch oder auf einem Wandbrett in der Ecke. In vielen Häusern gehen täglich fünf bis zehn Minuten verloren, nur weil die Hausfrau diesen einen kleinen Punkt vernachlässigt.
Das gleiche gilt vom Wischtuch. Das Wischtuch soll einen bestimmten Platz haben und täglich wieder dorthin gelegt werden. Wer keinen bestimmten Platz hat, um seine Sachen aufzubewahren, der muß alle fünf bis zehn Minuten, sobald er einen Gegenstand braucht, bald in, bald außer dem Hause auf die Suche gehen. Beständig muß er fragen: ‚Hans‘, oder ‚Liese, wo ist dies oder jenes? Wo hast du es zuletzt gehabt?‘ usw.
Ebenso verhält es sich mit dem Besen. Vor allen Dingen darf in einem methodisch geordneten Hause der Besen nicht verkehrt aufgestellt werden. Hoffentlich wißt ihr alle, welches das richtige Ende eines Besens ist. In einem solchen Hause[S. 96] steht der Besen niemals verkehrt und immer an seinem Platz. Wenn ein Gegenstand verlegt ist und man danach suchen muß, so verbraucht man nicht bloß Zeit, sondern auch Kraft, die nützlicher angewendet werden könnte. Man muß einen bestimmten Platz haben für seinen Mantel, für seinen Hut, kurz, für jedes Ding im Hause.
Diejenigen Menschen, die für jedes Ding einen Platz haben, das sind die Menschen, denen es nie an Zeit gebricht, zu lesen oder auch sich zu erholen. Ihr wundert euch manchmal, daß die Leute in Neu-England so viel Zeit übrig haben, um Bücher und Zeitungen zu lesen und doch genug verdienen, um unserer Anstalt so viel Geld zuzuwenden, wie dies geschieht. Diese Leute haben hinreichend Muße, sich geistig zu bilden und mit allem, was in der Welt vorgeht, Fühlung zu behalten, weil in ihren Häusern alles so methodisch geordnet ist, daß sie die Zeit erübrigen, die wir damit verlieren, uns mit Dingen abzugeben, die wir eigentlich ganz genau wissen sollten.
Ich bin selten in eine von Schwarzen gehaltene Pension gekommen, wo die Lampe an ihrem Platze stand. Wenn man in ein solches Haus kommt, muß nur zu häufig erst nach der Lampe gesucht werden; ist sie schließlich gefunden, so ist sie leer; man hat vergessen, morgens Petroleum aufzufüllen; dann fehlt es an einem Docht oder es muß ein Zylinder geholt werden. Hat man endlich alles beisammen, so sind die Streichhölzer verlegt!
Ich möchte wissen, wieviel Mädchen hier anwesend sind, die es verstehen, ein Zimmer so herzurichten, daß ein Mensch darin übernachten kann — das heißt, es mit der richtigen Anzahl von Handtüchern, mit Seife und Streichhölzern zu versehen und alles, was ein Mensch zu seiner Bequemlichkeit braucht, zu beschaffen und an seinen richtigen Platz zu stellen. Einige unter euch möchte ich lieber nicht auf die Probe stellen. Diese Dinge müßt ihr lernen, ehe ihr die Anstalt verlaßt, damit ihr anderen und euch selbst zum Nutzen gereicht. Könnt ihr dies nicht, so bereitet ihr uns eine Enttäuschung.“
Weit interessanter und packender ist B. T. Washingtons Lebensbeschreibung, von ihm selbst verfaßt: „Vom Sklaven empor“ (Up from slavery), eine der erschütterndsten und lebenswahrsten Biographien, die existieren. — — —
Hatte ich in dem berühmten Neger einen lebendigen Roman vor mir gesehen, so bin ich ganz unvermutet und ungewollt in Boston eines Tages zur Abwechslung Mittelpunkt eines Romans geworden.

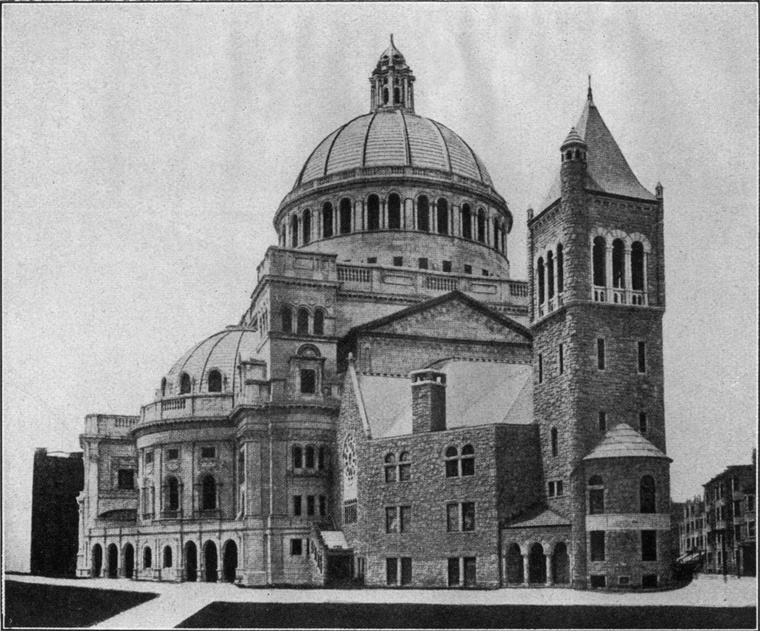
Ich wurde nämlich eines Tages wie ein Medium zum Wiedervereiniger zweier sich seit Jahrzehnten suchender Brüder nicht allzu lange[S. 97] vor ihrem Lebensabend! Ich erzähle dies persönliche Erlebnis an dieser Stelle, weil es anschaulich zeigen kann, was alles in Amerika möglich ist. Eines Tages besucht mich in Cambridge, der Vorstadt Bostons, einer meiner Vettern aus Neuyork. Sein Vater forsche schon jahrelang nach einem Halbbruder, der einst mit 14 Jahren aus Bremen fortgelaufen, vermutlich in die weite Welt gewandert sei und von dem man niemals wieder etwas gehört habe. Er vermute aber stark, daß derselbe, wenn er überhaupt noch lebe, sich wahrscheinlich in der Union aufhalte. Nun habe er aber schon so manches amerikanische Adreßbuch nach seinem Namen durchgesehen, aber nicht gefunden. Aber hier — so berichtete der Vetter aus Neuyork — in Boston habe er heute im Adreßbuch ihren nicht häufigen Familiennamen — den Namen eines Arztes in einer der feinsten Villenstraßen — entdeckt. Da der Name in der Union sehr selten sei, bestehe stark die Möglichkeit, daß er am Ende wirklich der gesuchte Onkel sei! Nun getraue er sich aber nicht recht, den völlig fremden Herrn allein aufzusuchen. Wenn zwei gingen, so sei das schon besser. Die ganze Sache kam mir recht mystisch, abenteuerlich und nach europäischen Begriffen zwecklos vor. Und nun sollte ich, der ich selbst erst Ankömmling war, einem reichen Bostoner Arzt ins Haus fallen und ihn kurzerhand fragen, ob er etwa mein Onkel sei und vor etwa einem halben Jahrhundert aus Bremen fortgelaufen sei?! Nach europäischen Begriffen stellte ich mir die Wirkung solchen Fragens vor: Er würde uns wohl sofort aus dem Hause weisen. Dafür war es ja gut, daß wir dann wenigstens zwei waren. Trotz aller Bedenken ließ ich mich bewegen mitzugehen, denn ein bißchen Abenteuer zu erleben lockte mich. War nicht meine ganze Amerikareise auch ein bißchen Abenteuer? Und wo es etwas ganz Neues zu erleben gab, da war ich gern dabei. Also gingen bzw. fuhren wir mit der Elektrischen nach Boston. Wer aber sollte reden? Das war noch nicht entschieden. Natürlich mein Vetter, denn er sprach als langjähriger Amerikaner fließend englisch. Ich war also Zeus, und er machte den Merkur. Höchst gespannt war ich, ob wir überhaupt vorgelassen wurden! Was sollten wir denn eigentlich an der Tür[S. 98] sagen, wenn geöffnet wurde, weshalb wir kämen? Nun, bei einem Arzt mußte man ja vorgelassen werden. Aber nun war es Sonntag nachmittag, da kamen doch wohl in der Regel keine Patienten. Immerhin konnten wir zuerst so tun, als ob wir es wären ...
Wir standen vor dem Haus, einer stattlichen zweistöckigen Villa im vornehmen Viertel Bostons, und zogen die Klingel. Richtig stand der Name da: Dr. med. N., gleich dem Namen meines Neuyorker Onkels. Der Name sah sehr heimatlich und familiär aus. Was für ein Geheimnis mochte sich hinter ihm verbergen? Aber vor dem Familiennamen stand noch ein Zwischenname, den es so leicht wohl in der ganzen Union nicht wieder gab. Er hatte französischen Klang. Diesen Namen gab es gewiß in unserer ganzen Verwandtschaft nirgends. So sank uns wieder der Mut und die Hoffnung, eine freudige Entdeckung zu machen. Indessen hatte auf unser Klingelzeichen ein Neger geöffnet. Wir stockten. Was sollten wir sagen? Wir standen da wie zwei dumme Jungen, die einen dummen Streich vorhatten. Wir sagten gar nichts. Und das war noch das Beste. So führte uns der Neger die Treppe in der Vorhalle hinauf und einfach gleich in das Wartezimmer und bat uns, Platz zu nehmen. Was wir taten. Das Wartezimmer bewährte seinen Namen auch an uns. Es duftete nach Medizin, und wir warteten geduldig etwa zwanzig Minuten und hatten alle Bilder an den Wänden schon mehrmals besichtigt und reichlich in ausliegenden Magazines geblättert. Man hörte, wie mit Teegeschirr geklappert wurde. Dann ging die Tür auf; es kam der Doktor und Hausherr, ein kleiner, untersetzter, schwarzer Herr mit goldenem Kneifer, der uns gewohnheitsmäßig, ohne uns genau anzusehen, in sein etwas dunkles Studierzimmer nötigte. Wir folgten und sahen uns beide an, und große Enttäuschung und innere Heiterkeit malte sich auf unseren Gesichtern, als wollten wir uns gegenseitig zu verstehen geben: Das soll unser Onkel sein? Ausgeschlossen! Erstens keine Spur von Ähnlichkeit. Und zweitens war der Mann vor uns wohl ein Mann Ende der Fünfzig, mein Onkel in Neuyork aber bereits hoch in den Sechzig.
[S. 99]
„What can I do for you?“ fragte der Hausherr uns höflich forschend, wer wohl der Patient wäre, als wir immer noch nichts sagten und doch beide offenbar recht gesund aussahen. Ja, was machten und sagten wir nun? Mein Vetter faßte sich ein Herz und bat zunächst um Entschuldigung, er sein kein Patient, er komme in einer persönlichen Angelegenheit. Der kleine Doktor machte ein Gesicht, als wollte er sagen: „Ich verstehe schon. Ihr wollt mich anpumpen, aber ich gebe nichts!“ Aber mein Vetter fuhr, ohne sich beirren zu lassen, fort: „Er selbst heiße auch wie der Herr Doktor, und ob der Herr Doktor vielleicht einen Bruder gleichen Namens habe?“ „Nein!“ kam es sofort prompt und bestimmt und recht erstaunt ob der persönlichen Anfrage zurück. Da erhoben wir uns auch sofort und verabschiedeten uns höflichst unter wiederholten Entschuldigungen, nicht ohne daß ich auch meinen Namen noch und Wohnsitz nannte, mein Vetter desgleichen. „Ach, ich dachte zuerst,“ sagte der Doktor, „die Herren wären vielleicht Matrosen in Zivil, von denen ich manchmal Sonntag nachmittags aufgesucht werde!“ Er verbeugte sich und schloß hinter uns die Tür. Der Neger geleitete uns dienstfertig hinaus. „Wir — Matrosen?“ Es war ja zum Lachen.
Es war also nichts! Wir waren wieder draußen. Ich fuhr zuerst gegen meinen Vetter los: „Auch keine Spur von Ähnlichkeit!“ Und mein Vetter: „Und er hat ja gar keinen Bruder!“ Also war die Sache klar. Mein Vetter überlegte, ob er noch heute wieder abreisen sollte, um seinem Vater in Neuyork das erneute Mißgeschick mitzuteilen, um eine Enttäuschung reicher. Armer Onkel! Aber wir beschlossen, den Abend doch noch gemeinsam zu verbringen, und erst anderntags um Mittag wollte mein Vetter nach Neuyork zurückfahren.
Als ich an diesem Abend schließlich in mein Logis zurückkomme, heißt es, ein Fräulein aus Boston sei dagewesen von einem Herrn Dr. med. N. und habe nach mir gefragt, sei aber, da ich nicht da war, unverrichteter Sache wieder gegangen! Nach einer halben Stunde klingelt auch schon das Telephon: Herr K. N. aus Boston! Er läßt die beiden Herren bitten, wenn möglich, morgen Vormittag doch noch einmal bei ihm vorzusprechen! — Donnerwetter![S. 100] Also doch etwa ein Onkel? Aber es war ja unmöglich! Er hatte ja keinen Bruder! Und es war doch auch keine Spur von Ähnlichkeit zu sehen .... Oder wollte er uns nur noch einmal sprechen, da unsre Unterhaltung etwas reichlich kurz und schnell gewesen war?
Ich konnte kaum den nächsten Vormittag erwarten. Dann fuhren wir wieder hin, klingelten und wurden diesmal gleich in den Familiensalon geführt. Das war sonderbar! Herr Dr. N. erschien, trat sofort auf mich zu und sagte wörtlich: Mein lieber Herr B., Ihr Vater hieß mit Vornamen soundso, ist im Jahre 18.. geboren, lebte in Bremen und hatte zwei Schwestern, die hießen B. und A... Ich war sprachlos vor Staunen, als hätte mich ein Donnerschlag gerührt. „Woher wissen Sie das?“ rief ich, „sind Sie ein Wahrsager und Hellseher oder haben Sie telepathische Fähigkeiten?“ „Nichts von alledem,“ gab der Doktor zurück, „aber als Sie gestern aus meinem Hause gingen, sah ich Ihnen hinter den Gardinen nach. Sie drehten sich noch einmal um. Ich sah jetzt erst deutlich Ihr Gesicht. Ihr Gesicht, Ihr Gang, Ihre Art zusammen mit Ihrem Namen stellten mir auf einmal wie eine Vision deutlich Ihren Vater vor bald fünfzig Jahren in Bremen wieder vor Augen, der damals wohl etwa in Ihrem Alter war und Ihnen auf ein Haar glich, und damit tauchten auf einmal Welten der Erinnerung in mir auf, die längst in mir versunken waren. Ich werde Ihnen das alles noch erklären. Erst lassen Sie mich aber meine Frau hereinrufen.“ Er ging ins Nebenzimmer. Wir wußten uns vor Staunen gar nicht zu fassen. Also, er war unser Onkel!! Dann trat Frau Dr. N. herein, der wir uns vorstellten und die mit einem etwas auffallenden Akzent englisch sprach — deutsch war es jedenfalls nicht — und ihre „lieben Neffen“ herzlich begrüßte. Dann fuhr Doktor N., sich an meinen Vetter wendend, fort: „Ihr Vater — mein Bruder — heißt wohl mit Vornamen B .... Ich bin in der Tat der verschollen gewesene Bruder, ich bin wirklich Ihr Onkel, den Sie noch nie gesehen haben und von dessen Dasein Sie nichts wissen konnten, und Sie sind meine Neffen. Seien Sie uns herzlich willkommen!“
[S. 101]
Wir wußten beide noch immer nicht, ob wir träumten, im Kino saßen, einen unglaublichen Roman hörten, in der Hypnose, Trance oder sonst was lebten, oder ob es alles Wirklichkeit war. Aber er wußte ja die Namen genau und die Daten. Es konnte gar kein Zweifel an der Echtheit des Onkels sein. Glücklicher Onkel in Neuyork! Wenn er das erfuhr! Aber wie war das alles nur möglich? Nun erzählte der neue Onkel weiter. Wir hatten uns alle indessen am offenen Feuerplatz des Kamins in bequemen Sesseln gemütlich niedergelassen und lauschten der unerhörten Mär: „Ich bin in der Not vor beinahe fünfzig Jahren,“ begann der Doktor, „aus Bremen fort aufs Schiff gegangen. Wir waren sehr viele Kinder. Vater hatte nicht für uns alle Platz. Und eine Schuldummheit kostete mir den weiteren Aufstieg. Ich schämte mich; Vater verstand mich auch nicht recht, da kam die Weltsehnsucht und Abenteurerlust über mich, wie es schon manchen Bremer und Hamburger Jungen gepackt hat. So ging auch ich fort in die Welt mit dem Entschluß, nicht eher etwas von mir hören zu lassen, bis ich etwas geworden wäre. Die Welt ist weit. Ich landete nach manchen Irrfahrten in Le Havre in Frankreich. Von dort kam ich nach Paris und trat als Schreiber bei einem Rechtsanwalt in die Lehre. Dem guckte ich allerlei Juristerei ab, lernte des Abends fleißig aus Büchern und faßte den Plan, wenn möglich, noch Jura zu studieren. Aber woher dazu das Geld nehmen? Da war der Suezkanal neu eröffnet. Das ist meine Chance, dachte ich, und ging nach Ägypten! Aber dort packte mich bald das gelbe Fieber, wochenlang lag ich bewußtlos zwischen Leben und Tod. Als ich wieder genas, kannte ich selbst mich kaum wieder. Alle Erinnerung war in mir wie ausgelöscht. Ich kehrte nach Frankreich zurück, trat wiederum bei einem Notar ein und wurde nach einigen wohlgelungenen Arbeiten sein Bureauchef, ja Assozié. An der Sorbonne legte ich juristische Prüfungen ab, heiratete meines Chefs einzige Tochter, meine liebe Frau — ich sah zu meiner neuen Tante, die lächelte, hinüber, also eine Französin! — und übernahm nach seinem Tod seine Praxis. Aber nach dem 70er Krieg war es für einen Deutschgeborenen schwer in Frankreich[S. 102] voran zu kommen. Ich siedelte deshalb nach Amerika über. Von dem Erlös der verkauften Praxis studierte ich hier in Boston an der Medical School Medizin und ließ mich schon vor über zwanzig Jahren in Boston als Arzt nieder. Unser Haus haben wir seit fünfzehn Jahren. Gestern, als ich Ihr Gesicht sah und in Ihnen — er meinte mich — wieder Ihren Vater wie einst vor mir sah, tauchte nach langer Zeit meine ganze Jugend wieder empor.“ Er schwieg. Auch niemand von uns wagte zu sprechen. Wunderbare Lebensläufe und Menschenschicksale! Tote schienen lebendig zu werden ...!
Nun wurden die Kinder hereingerufen, darunter ein artiges Fräulein trat ein — sie war es, die mich gestern in Cambridge zu treffen suchte — aber keiner von uns wußte zuerst, ob wir uns nun wirklich gleich als Vetter und Base betrachten sollten. Und bald flogen Telegramme nach Neuyork und nach Deutschland, und in wenigen Tagen lagen sich totgeglaubte und verschollene Brüder wieder in den Armen! Und ich mußte der Mittelsmann sein, von dem aus der Funke des Erkennens und Wiederfindens übergesprungen war! Mit diesem einen Ereignis hatte sich eigentlich schon meine ganze Amerikareise gerechtfertigt und gelohnt. Wie rund ist die Welt und wie klein!
[12] Gib acht auf die Maschine!
[13] Bessere Lage, größerer Lohn!
[14] Man vgl. auch Feuchtersleben, Diätetik der Seele.
Eine meiner Hauptabsichten meiner Reise war, nicht einen verschollenen Onkel wieder zu entdecken, sondern u. a. auch das amerikanische Universitätsleben näher kennenzulernen und den damals noch lebenden Professor William James zu einer deutschen Doktordissertation zu „verarbeiten“.
So war ich also bald nach meiner Ankunft in Boston mit der „Cambridge-car“ die prächtige Harvardbrücke über den breiten Charles River hinüber nach der beinahe 100 000 Einwohner zählenden Universitätsvorstadt Cambridge gefahren, die in ihrem Mittelpunkt das in der ganzen Union hoch angesehene, schon aus dem 17. Jahrhundert, der Puritanerzeit, stammende Harvard College mit seinen Hochschulen birgt.
[S. 103]
Cambridge[15] selbst machte zuerst keinen allzu erhebenden Eindruck. Erstlich regnete es fürchterlich bei meiner Ankunft, und überall starrte mir Schmutz entgegen. Aber auch an trockenen Tagen pflegten wahre Wolken von Staub die Hauptverkehrsstraßen entlang zu fegen. Auch schien die Stadt mir unansehnlich und recht unregelmäßig gebaut. Boston selbst wirkte dreimal vornehmer. Aber je weiter man nach Cambridge hinein kam, desto anziehender wurde es. Und als ich durch die „Quincy Street“ in den prachtvollen Ulmenpark des Universitätshofs eintrat, fand ich es geradezu reizend und anheimelnd. Eine angenehme Stille lag über den vielen und zum Teil recht zerstreut liegenden Universitätsgebäuden mit ihren Vorlesungshäusern, Instituten, Seminaren, Speisehallen, Wohngebäuden der Studenten, die alle in den sog. „dormitories“, einer Art freien Studentenpensionaten (aber ohne Verpflegung) zusammenwohnen und auch in großen z. T. vornehm ausgestatteten Speisehallen zusammenessen, ausgebreitet. In einer sehr stillen Allee in einer der kleineren, älteren, aber äußerst traulichen, efeuumsponnenen halls, in der schon Emerson gelehrt hat, fand ich meinen Wohnsitz. Der Hausmann (janitor) empfing mich auch als „German“ sehr freundlich und geleitete mich zu meinem „furnished room“ (möbl. Zimmer). Auch ein älterer hilfsbereiter Student, der mir später ein lieber Freund wurde, Mr. Arthur E. W., instruierte mich über alles zunächst für mich Notwendige. Gottlob aber, daß ich Englisch verstand und sprach!
In meinem „furnished room“ fand ich alles zum Leben Notwendige beisammen, einen großen behaglichen Kamin, den ich aber selbst zu heizen hatte! In Amerika gilt ja überall: „Selbst ist der Mann! Da tritt kein andrer für ihn ein, auf sich selber steht er da ganz allein!“ Ich habe das Heizen des offenen Kamins auch redlich oft drei- bis viermal versucht, die aufgeschichteten Holz- und Kohlenstöße kunstgerecht zu entfachen und dann hübsch in Brand zu halten, aber der ungewohnte amerikanische Kamin hatte seine Tücken und wollte sich[S. 104] wahrscheinlich auch von so einem „damned German“ nicht ohne weiteres anheizen lassen. Aber auch in der deutschen Universitätsstadt Tübingen ging es zu meiner Zeit einem sehr gescheiten Stiftler ebenso, so daß er schließlich dem dortigen Hausmann verzweifelt sein Leid klagte. Der kam und sagte lakonisch: „Wenn i das Fujer’ wär’, i ging au aus!“ So kam auch hier schließlich ein rettender Engel und half dem unpraktischen Deutschen aus der kalten Hölle. Aber noch öfters saß ich ungeheizt, natürlich gerade dann, wenn etwa einer der Herren Professoren mir seinen liebenswürdigen Gegenbesuch machte, so daß mir noch heute der alte weißhaarige, in Samaria eifrig ausgrabende Professor Lyon leid tut, der so fröstelnd in meinem hohen strohgepolsterten Lehnstuhl saß und sicher mit wissenschaftlicher Schärfe im Stillen die Ursache der Kälte in der sonst warmen Hall zu ergründen suchte. Bei mir lagen eben die mächtigen Holzklötze, die sonst in den offenen Kaminen schwelen, meist nur angekohlt und fröhlich rauchend, aber ohne zu wärmen hinter ihrem Gitter, obwohl ich nachher so ziemlich die höchste Rechnung für Heizmaterial am Ende des Semesters zu begleichen hatte!! Wenn nicht in dem Januarblizzard, der einen meterhohen Schneefall brachte und -20° R ein anderer weit herumgekommener amerikanischer Freund, Mr. Moore, der besonders für Konstantinopel, die Türken und die Griechen schwärmte, sich meiner erbarmt oder mein japanischer Freund Mr. Ashida, heute in Kyoto Dekan der Doshisha-Hochschule, mich in sein wohlgewärmtes trauliches japanisches Zimmer mit hinübergenommen hätte, wäre ich wohl eines Tages eines seligen Kältetodes gestorben ...
Weiter enthielt mein „furnished room“ einen sehr schönen Schreibtisch mit jenem obenerwähnten strohgepolsterten Lehnstuhl, einem Schaukelstuhl, zugleich Ehrensitz für hohen Besuch, zwei Bücherregale, ein paar einfache Stühle und einen kleinen Alkoven, in dem das Bett stand, und von dem aus ich den schönsten Blick in die malerischen und träumerischen Universitätsanlagen hatte. Hier sah ich das letzte goldene Herbstlaub des „indian summer“ zu Boden wirbeln, hier sah ich den feuchten Novembernebel um die Bäume rieseln, hier sah ich den[S. 105] Schnee in wilden Massen niederwirbeln und auf leisen Sohlen den amerikanischen Frühling sich nahen ...
Mein großer grüner Koffer war zuerst noch nicht da. So legte ich mich die ersten Nächte im Mantel zu Bett. Meine Photographien von den Lieben und Freunden daheim stellte ich auf das Kamingesims mit der merkwürdigen Empfindung, an 4000 Meilen von ihnen entfernt zu sein. Einige deutsche Kunstwartbilder hing ich mir als Schmuck an die Wand. Drüben und neben mir zogen in ähnlicher Weise meine studentischen Nachbarn ein. Es entwickelte sich bald zwischen uns ein recht freundschaftlicher Verkehr. So war ich wieder einmal Student. An Semestern war ich wahrscheinlich der älteste im Hause, wenn auch nicht an Jahren. Denn die amerikanischen Studenten haben oft schon merkwürdige Lebensläufe hinter sich, ehe sie zu studieren anfangen.
Nach meiner Ankunft in Cambridge machte ich sogleich meinen schuldigen Antrittsbesuch beim Herrn Dekan der Fakultät („School“), einem äußerst liebenswürdigen älteren Herrn mit weißem englischen Schnurrbärtchen, der mein zum Teil noch sehr fehlerhaftes Englisch „marvellous“ nannte und bedankte mich für die gütige Einladung nach Harvard. Überall fand ich eine sehr große Liebenswürdigkeit, Höflichkeit, Gastfreundschaft und ein unbeschränktes Entgegenkommen, obwohl ich selbst mit Kritik und recht freimütiger Beurteilung amerikanischer Verhältnisse gar nicht zurückhielt, aber überall stieß ich auch auf einen höchst ausgeprägten Nationalstolz. Davon könnten wir mehr haben! Man war stets in allen Dingen moralisch, technisch, politisch, wirtschaftlich wie selbstverständlich überzeugt, das Beste und Größte „in der Welt“ zu besitzen. An Quantität aller Verhältnisse überragt ja auch in der Tat die Union alle Länder der Welt. Vor Deutschlands Wissenschaft neigte sich drüben alles in Ehrfurcht!
Am anderen Tag begab ich mich zu den Mahlzeiten zum ersten Male nach einer der gemeinsamen Universitätsspeisehallen. Studenten als Kellner weiß gekleidet — in Amerika gar nichts Ungewöhnliches! —[S. 106] bedienten selbst, nahmen die „down-stairs-orders“[16] entgegen, die man auf kleine Kärtchen schrieb, und brachten binnen wenigen Minuten von unten herauf alles Gewünschte. Längst vor dem Krieg war in Amerika der „Werkstudent“ schon fast die Regel. Auch für den wohlhabenden Studenten galt es schon immer drüben als unvornehm, sein Studiengeld vom Vater zu fordern statt selbst zu beschaffen! So arbeitete in der Universitätsdruckerei nachts als Setzer ein Millionärssohn! Die meisten „arbeiteten“ in den langen akademischen Sommerferien, die drüben etwa ein volles Vierteljahr umspannen, als Kellner in den großen Sommerhotels auf dem Lande, oder als Sprachlehrer, Bankangestellter, Straßenbahner, Organist, Hotelportier u. dgl. Ich kannte einen Studenten, der tagsüber Vorlesungen hörte und nachts als Nachtpförtner in seinem Bostoner Hotel seine griechische Grammatik lernte! So wurde auch ich öfters gefragt, ob ich nicht einen „job“ (Arbeitsstelle) anzunehmen wünsche. Ich habe mir dann auch neben meiner Universitätsarbeit mit deutschen Stunden u. a. noch etwas Taschengeld verdient, bis einer der „freshmen“ (unterster Jahrgang im „College“), den ich unterrichtete, mir eines Tages erklärte, „mein Deutsch sei nicht richtig; was ich ihn gelehrt, habe ihm der amerikanische Professor als Fehler angestrichen“!! Da habe ich diesem „Frechmän“ beinahe eine ... — erklärt, daß er nicht wiederzukommen brauche! Und verzichtete auf solchen „job“!
Am gemütlichsten und besten aß man in der prächtigen, gotischen „Memorial Hall“, die mit ihrem hohen Glockenturm wie eine große Kirche alle anderen Universitätsgebäude überragte. Dafür hielt ich sie zuerst auch, bis ich über ihre wahre Bedeutung aufgeklärt wurde. Man saß hier an kleinen Klubtischen zu vieren oder sechsen — gegen tausend Studenten aßen hier täglich! — und konnte nach Herzenslust für einen festen Wochenpreis von nur 5 Dollar bestellen und essen, besonders wenn man sich mit dem Neger gut stellte (das war hier unser alter guter Jackson), was und wieviel man begehrte. Und ich[S. 107] stellte mich daher immer besonders gut mit ihm! Da reichte mir seine braungelbe Hand unermüdlich hin, wonach das Herz verlangte. Was für fröhliche Stunden haben wir in Memorial Hall verlebt! Mittags um zwölf Uhr zum „lunch“ und abends fünf oder halb sechs zum „dinner“, der Hauptmahlzeit. Da fand sich an unserem Tisch ein deutscher Student der Philologie aus Heidelberg ein, von dem man rühmte, daß seine englische Aussprache besser sei als die der Eingeborenen! Mit dem Grad eines A. M. (Master of arts) kehrte er in die Heimat zurück. Weiter verkehrte bei uns ein Privatdozent der Chemie aus Prag, der heute ordentlicher Professor in München ist, dazu drei bis vier junge smarte Amerikaner, ein Pflanzerssohn aus dem Südstaat Carolina, dessen Devise war: „Wenn dir einer dumm kommt, box ihn nieder!“; ferner der gereifte Bruder eines angesehenen Baptistenpredigers in Boston und endlich ein dritter Schmächtiger auch aus dem Süden, der ungeheuer viel Pfeffer auf seine Speisen warf und dazu unbändig rauchte und dessen Losung war: „Was sich dir in den Weg stellt, schieß nieder!“ Typisch für die aus den Pflanzer- und Südstaaten! Alle meine Bekehrungsversuche, seine Sitten und Anschauungen zu mildern, scheiterten. Unsere Sprache untereinander war nur englisch. Und das war gut. Nur der Prager Chemiker — ein echter Deutschösterreicher — konnte es nicht lassen, wenn er den Heidelberger und mich einmal allein am Tisch traf, doch mit seinem urgemütlichen wienerischen Dialekt herauszurücken, was dort drüben doppelt heimatlich klang ... Auch fand er, die amerikanischen Girls, auf die er manchmal ein Auge warf, „fräßen einem richtig aus den Händen“ ...
Ich gewöhnte mich schnell an die amerikanisch-akademische Tageseinteilung. Früh acht Uhr besuchte ich gern der Sitte gemäß die „morning prayers“ in Appleton Chapel, der traulichen Universitätskapelle. Hier gab es — echt amerikanisch — „five-minutes-addresses“! (Ob wir Deutsche das auch fertig brächten?) Dann sang ein kleiner melodischer Studentenchor. Von da ging man zum Frühstück, das in Amerika mit Früchten beginnt und mit Koteletts endigt. Von neun bis zwölf[S. 108] hörte man Vorlesungen. Punkt zwölf erschien man wolfshungrig zum „lunch“, daran schloß sich ein kleiner Spaziergang am Ufer des Charles River oder ein Tennisspiel. Von zwei bis fünf Uhr war man wieder entweder im Colleg oder Seminar, übte oder las in der Bibliothek, falls man nicht einen Klubvortrag besuchte. Ehe man zum dinner ging, ging es in die akademische Turnhalle[17], um rasch einige „physical exercises“ in der ganz vorzüglich mit den raffiniertesten Geräten ausgestatteten Universitätsturnhalle vorzunehmen. Danach nahm man allgemein ein sehr ungeniertes Bad, das dem lateinischen Namen der Turnhalle voll entsprach. Nach solchen wohlberechneten Vorbereitungen schmeckte das dinner in Memorial Hall einzigartig prächtig. Um sieben Uhr rief die Hausglocke der hall zum „evening-prayer“ und danach war noch etwa drei bis vier Stunden stille Arbeitszeit, um Bücher zu lesen, Referate anzufertigen u. dgl. Ich bekam vor der Quantität geistiger Arbeit der amerikanischen Studenten allen Respekt!
Gleich zu Anfang des Semesters fanden die großen offiziellen Feierlichkeiten der Einführung des neuen Universitätspräsidenten statt. Die „Registration“ (bei uns „Immatrikulation“) war hingegen sehr einfach und unformell. Man wurde schnell mit seinen Personalien in ein Buch geschrieben. Das war alles. Aber die Inauguration des Präsidenten war höchst feierlich und großartig. Vierzig Jahre lang hatte der ehrwürdige, wohl über achtzigjährige Dr. Eliot das Universitätszepter geführt. (Die Universitätsrektoren amtieren drüben auf Lebenszeit!) Nun galt es seinen Nachfolger auf Lebenszeit einzuführen, Dr. Lowell. Über 200 Professoren aus dem ganzen Land waren dazu zusammengeströmt, Harvard zu Ehren. Vor der Haupthalle der Universität, einem schlichten hellen Gebäude im Universitätspark, war ein Podium aufgeschlagen, auf dem alle die Ehrengäste und der eigene Lehrkörper in ihren feierlichen Doktortalaren unter freiem Himmel Platz nahmen. Über der ganzen Feier lag blendender Sonnenschein, und zu vielen Hunderten füllte die[S. 109] akademische Jugend vom jüngsten „freshman“ bis zu den gereiften „graduates“ den weiten Park. Unter den Gästen wurde besonders der neuangekommene deutsche Austauschprofessor, ein berühmter Berliner Historiker, geradezu überschwänglich begrüßt als „not surpassed by living men“[18]. Der neue Präsident hielt eine lange Ansprache über Aufgaben und Ziele der amerikanischen Universitätsbildung und trat ein für freiere Wahl der Vorlesungen und bessere Vorbildung der Studenten nach — deutschem Muster!
Denn der amerikanische Lehrbetrieb ist in vielen Stücken ein sehr anderer als bei uns. Im selben Alter, in dem wir in Deutschland in die Schule eintreten, tritt zwar auch der Amerikaner in die Schule ein, und zwar jeder, so will es die jegliche Klassenunterschiede verabscheuende Demokratie, die auch in der Eisenbahn nur eine Klasse erlaubt, in die Volksschule (public oder grammar school), die gewöhnlich sechs Jahrgänge umfaßt. Freilich erlaubt es das amerikanische System den Begabteren und Fleißigen, Klassen zu überspringen und so in wenigen Jahren das Ziel zu erreichen, das zur nächsthöheren Schulgattung, der Oberschule (high school), die etwa unserer Realschule oder den mittleren Klassen des Gymnasiums entspricht, hinführt. Erst im Alter von dreizehn, vierzehn Jahren beginnt der Amerikaner Sprachen zu lernen. Bereits die High school-Kurse sind „wahlfrei“, und so steht die Wahl zwischen Deutsch, Französisch, Latein oder Griechisch oder mehreren von diesen zusammen offen. Nach vierjährigem High school-Besuch wird der Amerikaner reif, die Aufnahmeprüfung zum „college“ zu bestehen. Das college bildet den Grundstock der Universität und kann eigentlich mit keiner deutschen Einrichtung verglichen werden. Das „college“, englischen Ursprungs, dient keineswegs dazu, auf die sogenannten „akademischen“ Berufe, wie wir sagen, vorzubereiten, sondern den Amerikaner zum „Gebildeten“ und „gentleman“ in wissenschaftlicher und persönlicher Hinsicht heranzubilden. Die Lehrgegenstände des college sind völlig wahlfrei[S. 110] und entsprechen ihrem Gehalt nach ungefähr dem, was wir in den Oberklassen des Gymnasiums und in den ersten Semestern auf der Universität lernen. Nur darf nie vergessen werden, daß nirgends in Amerika genau der gleiche Maßstab, dieselben Anforderungen und die gleiche Güte vorherrscht. Die Teile des Riesenlandes sind so ungeheuer voneinander verschieden, vor allem der Westen und Süden vom Osten, den alten Neuenglandstaaten mit dem geistigen Zentrum Boston und der Harvard-Universität, daß die qualitative Gleichheit der Schulen und colleges ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Ein kleines college des Westens lehrt vielleicht nicht mehr, als was bei uns ein Tertianer oder Untersekundaner lernt, während der college-Student in Harvard Zutritt zu Kursen hat, die keiner deutschen Universität Schande machten. Der college-Student, der im gleichen Alter das college bezieht, wie wir etwa die Universität, obwohl er noch nicht dieselbe wissenschaftliche Höhe erreicht hat, kann, weil er völlig freie Hand in der Wahl seiner Vorlesungen hat, schon auf dem college spezialisieren, wenn er später in eine Fachschule (Graduate school), die am ehesten unseren Fakultäten entspricht, einzutreten gedenkt. Die meisten aber halten sich nur im college auf, um eine „liberal education“ zu gewinnen, um ihre Allgemeinbildung zu vollenden, d. h. sie haben kein spezielles wissenschaftliches Interesse, hören Literatur, Geschichte, Philosophie und suchen nach vierjährigem Lehrgang den Grad eines B. A. (Bachelor of arts) zu erhalten, der für eine bestimmte Anzahl (17 oder 18 dreistündiger) tüchtig durchgearbeiteter Vorlesungen verliehen wird. Diejenigen, die den A. B. haben, sind die „Gebildeten“, in welchem Beruf, Geschäft, Technik oder wo sonst sie sich auch später befinden mögen. Diejenigen, die Rechte, Philologie, Theologie und Medizin, Mathematik und Naturwissenschaft eingehend studieren wollen, um Richter, Prediger, Professor u. dgl. zu werden, treten in die „graduate school“ ein, die allein denen, die den degree des B. A. besitzen, offen steht. In der graduate school (Law School, Medical and Divinity School und Faculty of Arts and Sciences), die unseren mittleren und letzten Semestern entspricht,[S. 111] wird etwa drei bis vier Jahre gearbeitet und der Doktorgrad erreicht. Aber das Studentenbild in der graduate school ist von dem unseren auch wieder recht verschieden. Der college-Student ist zwar in dem Alter unserer Studenten, es fehlt ihm aber manchmal an dem eigentlichen „wissenschaftlichen“ Interesse, dafür ist sein ganzes Gehaben vielleicht ein ganz Teil jugendlicher als das unserer Studenten. Der graduate-Student aber in der graduate school übertrifft meistens unser Studentenalter beträchtlich; denn durchaus nicht alle treten sofort nach Vollendung ihres college-Studiums in eine Fakultät ein, sondern viele arbeiten zuerst eine Zeitlang in einem praktischen Berufe und verdienen sich das teure Studiengeld erst selber. So kann das für uns merkwürdige Verhältnis eintreten, daß z. B. einer bereits eine eigene Pfarrstelle auf dem Lande inne hat, die ihm mit der sonntäglichen Predigt den Unterhalt für sein theologisches Studium gibt, das er jetzt erst eigentlich beginnt (!!). Andere sind in einem Geschäft gewesen oder haben an einer Schule bereits einige Zeit gelehrt; andere sind während ihres Studiums noch in allerlei Nebenberufen tätig. Ein „Instruktor“ in Nationalökonomie spielte gar in einem Professorenhause den Hausmeister, versorgte morgens um sechs Uhr im Winter die Dampfheizung des Hauses mit Kohlen; wieder ein anderer war Organist in einer Kirche!
Es existierte nie Klassengeist; der Student bildete nie eine soziale Sonderschicht. „Arbeit“ war drüben immer ein allgemeiner sittlich-demokratischer Begriff, der für den Studenten sich keineswegs auf wissenschaftliche allein beschränkte. Andererseits ist auch die wissenschaftliche Arbeit nicht höher eingeschätzt als andere. Jede Arbeit ist „work“, gleichgültig, was für eine; ausgenommen vielleicht Stiefelputzen, das für den Amerikaner einen antidemokratischen Geruch mit sich führt. Nur der, der arbeitet, ist geachtet. Die Achtung bezieht sich aber fast allein auf die Quantität der geleisteten Arbeit und die mit ihr verbundenen Einnahme, nicht so sehr auf ihre qualitative Eigenart! Die Art des Studiums ist daher von der unseren recht verschieden. Während wir kein höheres Ideal als das der „akademischen Freiheit“[S. 112] kennen, d. h. der völligen Selbstbestimmung in wissenschaftlicher und persönlicher Hinsicht, ist dieser Begriff der amerikanischen Universität, mit Ausnahme der Wahlfreiheit der einzelnen Fächer, völlig fremd. Das college und die graduate school ist eine höhere und höchste Art „Schule“, nichts anderes. So hat der einzelne Student seinen vorgeschriebenen (!) Platz im Kolleg, er hat seine genau bis auf Stunde und Seite „vorgeschriebene“ Lektüre zu jeder Vorlesung aufzuarbeiten; er hat oft wöchentliche, monatliche oder mindestens halbjährliche Prüfungen zu bestehen, wöchentliche oder monatliche schriftliche Referate und Aufsätze oder größere Arbeiten einzuliefern, die vom Professor korrigiert und zensiert werden! Fernbleiben vom Kolleg ist völlig unbekannt, Bummeln ausgeschlossen. Der Student sucht nicht seinen eigenen Weg in der Wahl seiner Lektüre, in seiner Privatarbeit und in seinen Spezialstudien, die ihn vielleicht dieses Semester dahin und das nächste dorthin führen, sondern mit der Wahl eines Kollegs ist sein Weg Schritt für Schritt genau vorgezeichnet. Eine solche Fülle der Lektüre und Aufsätze überschüttet ihn, daß kaum ein Quentchen Zeit für eigene Wege übrig bleibt. So rechnet man konsequent sehr genau mit der Seitenzahl (!) der Lektüre, die in diesem und jenem Kolleg vorgeschrieben ist; die Aufsätze werden nach der Vielstelligkeit der Zahl ihrer Worte von den Studenten taxiert und mit Mindestforderungen der Zahl der Seiten und Worte abgegrenzt(!); das Interesse richtet sich auf die Anzahl der dreistündigen Vorlesungen, die einer bewältigt, die Zensuren, die er für seine „papers“ davonträgt, und den „degree“ (akademischen Grad), den er zu bestimmter Zeit mit der Aufarbeitung einer Anzahl von Vorlesungen erlangen kann, und last not least — das Einkommen der Stelle, die er mit einem Harvard-degree zu erlangen hofft! Ich will nicht zu schwarz malen. Aber dasselbe quantitative Urteil, das hier von jedem neuen Gebäude oder kostbaren Gemälde vor allen Dingen den Preis zu nennen weiß, das jede neue gute Institution mit dem Titel „the best and highest in the world“ belegt, breitet seine unheilvollen Schwingen auch über die Wissenschaft. Es war für mich[S. 113] ein sehr eigentümlicher Eindruck, als ich zum erstenmal in den Lesesaal der Universitätsbibliothek trat und die langen Reihen Bücher sah, — genau bezeichnet für jeden Kurs, keins weniger und mehr als vorgeschrieben (!) — und eine Fülle lesender Studenten — aber nur in „vorgeschriebener“ Lektüre von Seite soundsoviel bis Seite soundsoviel, kein Wort mehr oder weniger — da ist der Geist freier, ungebundener, eigener kritischer Wissenschaft erstickt im Staub pedantischen Schulgeistes, der rechnet, statt wägt, ißt, aber nicht selbst verdaut, „lernt“, aber nicht „studiert“, eine Menge Bücher kennt und doch kein Forschungsfeld überschaut, der nichts ahnt von der unendlichen Weite und Tiefe wirklich eigener selbständiger, kritischer, wissenschaftlicher Arbeit; der nie recht wissenschaftlich arbeiten lernt trotz mehrjährigen täglichen zehn- oder zwölfstündigen Fleißes! Der ganze amerikanische Universitätsgeist leidet an seiner Schulmäßigkeit: Auch die Dozenten müssen fast soviel Stunden in der Woche wie unsere Schullehrer geben. Der Universitätsprofessor ist mehr Lehrer als Gelehrter. Auch seine Bezahlung steht nicht im Verhältnis zu dem Reichtum des Dollarlandes, und sein Ansehen ist nicht mit dem eines deutschen akademischen Professors zu vergleichen. Alles dies soll keineswegs in Abrede stellen, daß auch Amerika sehr tüchtige Gelehrte und kritisch begabte Studenten hervorbringt, aber mehr trotz als infolge seines Systems. Und doch ist es auffällig, in welcher Überfülle die Übersetzungen deutscher wissenschaftlicher Bücher in Gebrauch sind, und geradezu rührend ist es zu beobachten und zu hören, mit welch aufrichtiger und uneingeschränkter Bewunderung der gebildete Amerikaner immer wieder zu dem Land der Dichter und Denker hinaufschaut.
So hatte also auch ich meine liebe Not, genügend freie Zeit für meine eigenen Studien zu behalten, Land und Leute kennenzulernen u. dgl., wenn auch ich mit einem „degree“ geschmückt Harvard wieder verlassen wollte. Und ohne degree gilt man ja drüben in akademischen Kreisen gar nichts. Und ohne degree zu scheiden, hätte mich in amerikanischen Augen als Faulpelz gekennzeichnet ...
[S. 114]
Die Inaugurationsfeier schloß mit dem üblichen Gebet, Musikchören und dem Jubel der „college-men“. Anderntags war noch einmal große Vorstellung aller fremden Gäste in der Repräsentationshalle der Universität, in „Sanders Theatre“, das seinen Namen von seiner theaterähnlichen Rundung hat. Der neue Universitätspräsident, vom Stab seiner Dekane begleitet, begrüßte feierlich jeden fremden Gast, indem er ihn mit allen seinen Titeln und Verdiensten ausführlich der Studentenschaft vorstellte. Jedesmal antwortete wüstes Beifallsgeschrei. Es waren auch zwei weibliche Professoren und die Spitzen von Heer und Marine unter ihnen, die von den Studenten besonders brüllend bejubelt wurden. Alle anderen wurden laut und immer lauter beklatscht beinahe zwei Stunden lang. Langsam defilierten sie auf dem Podium vorüber, zum Teil ehrwürdige Gestalten und noch junge Doktoren aus der Nähe und der Ferne, ja sogar auch aus Kalifornien und Texas, die geistige Elite der Union.
Abends brachten die „fresh-men“ dem neuen Präsidenten einen Fackelzug im „Stadium“ dar. Das Stadium ist ein ungeheurer, etwa 40 000 Personen fassender, elliptischer offen amphitheatralischer römischer Zirkusbau, der den großen Universitätsfußballspielen dient. Heute lag er im Dunkeln. Nach dem Einlaß kletterte alles affenähnlich über die weiten und hohen Betonsitzreihen, die stumm dalagen und sich hell vom klaren Nachthimmel abhoben, bis das schier unermeßliche Rund doch nur zum kleinsten Teil mit Menschen gefüllt war. Dann nahten in langem feierlichen Zug die fresh-men mit ihren Fackeln, d. h. sie trugen auf Stangen kleine Töpfe mit brennendem Öl, an 1200 Mann zu je zweien nebeneinander, ein wirkungsvoller Zug. Im Stadium führten sie allerlei Reigen und Freiübungen aus, die sich mit den Lichtern im Dunkeln außerordentlich eindrucksvoll ausnahmen. Den Schluß machte ein Buntfeuerwerk, das zu allerletzt die Namen des Präsidenten und des college zeigte. Der also gefeierte Präsident hielt eine kurze Dankesansprache, die in dem großen Rund ausgezeichnet zu verstehen war. Mit einem an Indianergeheul erinnernden vieltausendstimmigen „Ra-Ra-Ra-Ra ...“,[S. 115] dem traditionellen studentischen Ruf, endete die Feier. Die Zeitungen waren noch Tage und Spalten lang voll davon ...
„Vivat academia, vivant professores“ heißt es in dem alten deutschen Studentenlied. So kommen nun nach der academia die Professoren daran, mit denen ich drüben zusammen sein konnte. Ihr allzeit so sehr gefälliges Entgegenkommen habe ich schon gerühmt und verdient auch hier eigenen Dank. „What can I do for you?“ war die ständige Redensart der höflichen Menschen drüben. Der erste, der mich freundlich empfing, war der auch in Deutschland als erster Austauschprofessor und durch seine Schriften bekanntgewordene Sozialethiker Francis G. Peabody, ein Typus des hochgebildeten und vornehmen Neuengländers. Er hatte ein prachtvolles und nach jeder Seite hin ausgezeichnetes sozialethisches Seminar eingerichtet, wie drüben überhaupt alle Seminare, Bibliotheken, Laboratorien an Reichtum der Mittel dank der großen Stiftungen der Millionäre die unseren oft weit überragen. So findet man drüben in den Bibliotheken nicht bloß die gesamte amerikanische und englische Fachliteratur, sondern auch die deutsche, französische und italienische, so daß ich meinen schweren grünen Koffer mit den vielen Büchern hätte ruhig zu Hause lassen können und mir manche Kosten und Ärger ersparen. Freilich Peabodys Vorlesung enttäuschte mich. Gewiß ließ der Vorlesungsraum nichts zu wünschen übrig. Auf was für vorsintflutlichen Bänken hatte man einst im Tübinger Stift gesessen. Hier feine bequeme Subsellien, aufklappbare Halbtische, so daß man bequem die Beine beim Schreiben noch übereinanderschlagen konnte, wie es der Amerikaner liebt. Nur Gelegenheit, Hüte usw. aufzuhängen, sah ich nicht. Die Studenten steckten ihre Mützen in die Tasche oder brachten gar keine mit. Freilich die Beine auf den Tisch legte im Kollegraum niemand, wie ich das in den Klubzimmern täglich und reichlich zu sehen Gelegenheit hatte. Als der Professor eintrat, erhob sich niemand; niemand trampelte oder gab sonst ein Zeichen studentischer Begrüßung, vielmehr wurde lustig weitergeschwatzt und gelacht! Die erste Stunde bestand fast nur in Ankündigungen des Semesterpensums, Aufgabe der „vorgeschriebenen“[S. 116] Lektüre, Verteilung von gedruckten Dispositionen, zwar alles klar und praktisch — aber eben auch reichlich schulmäßig. Ich empfand gar nicht, auf einer Universität zu sein.
Mit dem deutschen Austauschprofessor trafen wir im „cosmopolitan club“ zusammen, einer interessanten Vereinigung von etwa hundert Studenten aus aller Herren Länder, Griechen, Siamesen, Chinesen, Japanern, Brasilianern usf., denn Harvard hat Weltruf. Der Professor nahm aber merkwürdigerweise von uns Deutschen recht wenig Notiz! Er sprach fließend englisch, wenn auch mit deutschem Akzent, an jenem Nachmittag ein für amerikanische Ohren wenig glückliches Thema, nämlich über „deutsche — Trinksitten“! Damals schon war Amerika zu zwei Dritteln „trockengelegt“. Heute ist es es ganz. Cambridge war schon immer eine völlig „abstinente“ Universitätsstadt. Der Erfolg der Ansprache war, daß ulkige Studenten dem berühmten Gelehrten beim Abschied zwei leere — Bierflaschen in seine Rocktaschen praktizierten!! Bei Professor William James, dem berühmten Psychologen, einem Sohn eines swedenborgischen Predigers in Neuyork und dem Bruder des bekannten Novellisten Henry James, durfte ich öfters weilen. Bald konnte ich formlos mit ihm über seine neue pragmatistische Philosophie plaudern, über die damals eifrigst diskutiert wurde, bald durfte ich an seinem Tisch den „Thanksgiving-turkey“, d. h. den traditionellen Truthahn an dem nationalen Danksagungstag am 27. November mitverzehren. Er war der Meinung, daß Wahrheit nur in der Praxis des Lebens selbst erlebt, aber nicht im voraus von uns theoretisch festgestellt werden kann. Das, was sich bewährt, das, was „stimmt“, was uns weiterführt, was Erfolg verheißt, ist wahr. M. a. W. die Wahrheit „bewahrheitet“, realisiert sich selbst. James war immer ein Mensch von seltener Liebenswürdigkeit und Herzensgüte, vornehmer Schlichtheit und einem feinen Humor. Nichts war ihm mehr verhaßt als Fertig- und Abgeschlossensein. Er selbst blieb immer ein Lernender. Auch war er für alles interessiert, denn alles war ihm ein Stück Wirklichkeit in diesem großen wunderbaren Universum, zu dem wir selbst, wie er[S. 117] von seinem voluntaristischen und aktivistischen Standpunkt aus meinte, vielleicht den allerwichtigsten Beitrag liefern. Dies Universum ist, meinte er, nicht fertig, sondern es wird noch ständig; es wird vornehmlich zu dem, wozu wir es machen. Und gute geheimnisvolle Mächte stehen uns dabei hilfreich zur Seite. So interessierte er sich auch besonders zeitlebens für den Spiritismus und Okkultismus als psychologisch-metaphysisches Problem und schloß doch zuletzt ehrlich und behutsam mit einem non liquet. Er soll vor seinem Tode seiner Familie versprochen haben, sich, wenn möglich, mit ihr aus der jenseitigen Welt zu verständigen, um ihr von ihr einen Wirklichkeitsbeweis zu geben. Und seine Familie behauptete wohl auch nach seinem Tode, von ihm Botschaften empfangen zu haben (!). Für James war nichts zu bizarr und zu ungewöhnlich, daß er als Psycholog es nicht untersucht hätte. So war er der Psycholog, der auch allem Wunderlichen und Pathologischen nachspürte. Die Haupttypen der religiösen Menschen führte er auf ihre verschiedene Nervenanlage zurück. Nach ihm gibt es zartbesaitete (religiöse) und grobkörnige (unreligiöse) Menschen. Die religiöse Seelenanlage im Menschen entbindet s. E. die wertvollsten sittlichen Mächte im Menschen. Aber wir müssen im Leben abwechseln zwischen der Haltung des sich selbst verleugnenden Frommen, wie es Buddhismus und Christentum fordern, und dem Nietzschetypus des sich selbst behauptenden und sich durchsetzenden Menschen. Diese Jamessche Philosophie ist durch und durch amerikanisch, praktisch, wirklichkeitsnah, systemlos, dem Willen und Handeln entsprechend, tatenfroh und lehnt doch keine übersinnliche Wahrheit, wenn sie sich bewährt, ab. Welches Glück, den bedeutenden Mann noch kennenlernen zu dürfen!
Auch mit dem Universitätspräsidenten selbst traf ich bei einer „reception“, einem Empfangsabend, bei unserem Dekan zusammen. Diese Empfänge hatten freilich etwas sehr Förmliches und Steifes. Zuerst stand man wortlos herum, unterhielt sich krampfhaft mit allen möglichen fremden und unbekannten Gästen, eine Tasse Tee in der einen und einem Gebäck in der anderen Hand (aber Vorsicht war[S. 118] nötig, die Tasse nicht auf die feinen Teppiche oder das Parkett zu verschütten!), bis man vom Mittelpunkt des Abends, dem Präsidenten, auch einmal ins Gespräch gezogen wurde, der uns allen ein paar Minuten die Hand schüttelte. Äußerst geschickt lenkte der Präsident bei mir, dem Deutschen, das Gespräch sofort über auf 1870, die deutschen Gegensätze von 1866 und auf das bismarckische Deutschland — aber stets mit vornehmer Achtung, ja Bewunderung. Lebhaft und sprühend waren dabei im Gespräch seine sonst etwas in der Ferne scheinbar ausdruckslosen Augen. Welche Aufgabe aber für diesen Mann, täglich zu repräsentieren, Ansprache über Ansprache zu halten, auch für den Fremdesten sofort ein Thema zu finden ... An Gewandtheit stand ihm nicht nach Prof. E. C. Moore, der selbst lange in Deutschland studiert hatte und auf dessen Studiertisch ich eine Menge deutscher wissenschaftlicher Zeitschriften sah. Ich war zum Abendessen geladen. Bei uns ist man bei Einladungen größere Portionen gewöhnt als in Amerika. Und das Getränk war — echt amerikanisch — ein Glas frisches Wasser mit einem Stückchen Eis zur Kühlung! Glücklicherweise hatte auch Freund R. mich noch rechtzeitig ermahnt, „full dress“ anzulegen.
Sehr oft waren wir Deutsche auch bei dem deutschen, aber amerikanisierten Professor der Psychologie Münsterberg eingeladen. Mit seinen trefflichen Büchern über „Amerika und die Amerikaner“ hat er den ersten völlig sachgemäßen Vermittlerdienst zwischen Deutschland und Amerika geleistet. Auch dort war „reception“, bei der allerlei bedeutende Leute auftauchten: Eduard Meyer, Präsident Eliots ehrwürdige greise Gestalt ... währenddem reichten Diener in großer Livree Eiskream und Limonade herum. Eine der Töchter des Hausherrn wurde von meinem Heidelberger Freund stark umworben ... Ein andermal war es bloß „offener Nachmittag“ bei Frau Professor M., die sachgemäß hinter einem riesigen Teekessel thronte, aber immer gastlich und fürsorglich. Bei Professor F. stellte sich heraus, daß seine Frau eine nahe Verwandte einer mir sehr bekannten Frankfurter Familie de Neufville war. Wie die Welt rund und klein ist ...!
[S. 119]
Nach den Professoren ein Wort über die Studenten und ihr geselliges Leben: Sehr viel Anregung bot mir der schon erwähnte „cosmopolitan Club“. Ich verkenne nicht den Wert und das Erbgut der Nation und habe mich erst recht drüben mit Stolz als Deutscher gefühlt und Deutschlands Wert trotz allem in der Welt erfahren, aber doch habe ich immer auch einen starken Zug in die Welt verspürt, mich auch als „Mensch“ denn nur als Angehöriger einer festumgrenzten Volksindividualität zu fühlen und mich mit Angehörigen auch einer recht fernen Rasse in allem Menschlichen einig empfunden, ob es der Negerstudent Mac Sterling war, der mich auch in sein Logis lud, oder Freund Ashida, mein japanischer Studiengenosse, oder etliche Griechen, Armenier oder Siamesen und was sonst alles in Harvard auftauchte. Mehr Berührung mit einzelnen Angehörigen fremder Völker und die Lust zu neuen furchtbaren Kriegen wird in der Menschheit sich mindern! Im cosmopolitan Club sprachen die interessantesten Redner: Erst der deutsche Historiker, dann war Präsident Eliot angezeigt, danach ein belgischer Konsul über den Kongostaat und seine „rechtmäßige“ Erwerbung, danach ein Spanier von Geburt, Professor Santyana über die zwei Hauptweltströmungen, die klerikal-monarchisch-konservative und sozialistisch-freimaurerisch-revolutionäre. Darauf „talkte“ ein juristischer Harvardprofessor, der damals so etwas wie Justizminister des Königs von Siam war, über seinen gütigen Herrscher, dessen Bild im Klubraum hing, schließlich der bekannte Franzose Professor Boutroux, Präsident des „institute de France“ über den Philosophen Pascal, und zuletzt fand eine Vorlesung eines japanischen Universitätspräsidenten der kaiserlichen Universität in Kyoto statt. Er erschien mit all seinen japanischen Orden. Also wahrhaftig eine respektable Galerie seltener Köpfe! Andere Redner sprachen über die herrliche Hawai-Inselgruppe mit Lichtbildern, ein zweiter über Wanderungen und Bärjagden in Alaska, so daß mein wanderlustiges Herz im Anblick dieser herrlichen, einsamen, fast noch nie betretenen Gegenden fast zersprang. Daß auch ich bald noch recht weit fortreisen mußte, das stand mir seit jenem[S. 120] Abend ganz fest! Gletscher, Schneewanderung, Zeltleben mit Eskimos und Indianern, Fahrten in der einsamen Bai, Bärschießen und -abhäuten, Kahnbau und Pelzfabrizieren — da wäre ich gern einmal dabei gewesen! Freund Moore stellte mir an jenem Abend noch allerlei Griechen vor, und sie nahmen mich mit in ein echt griechisches Restaurant in Boston, ein sogenanntes „Xenodocheion“. Ein andermal war sogenannter „ladies tea“, den Mrs. M. in hohem lila wallenden Federhut präsidierte, danach ein sogenannter „Nationalitätenabend“. Bei dem ersteren wurden uns allerlei graziöse Bostoner Schönheiten vorgestellt, darunter eine Ms. St., Freund R.s ganzer Schwarm, gekleidet, gepflegt und in Haltung wie eine tadellose Schaufensterpuppe in wundervollem Kostüm, dessen Farbe ich über ihren kirschroten Lippen, ihren wohlgepflegten blendendweißen Zähnen und ihren schmalen feinen Händen, die gewiß noch nie Kochtopf oder Scheuerlappen angefaßt hatten, nicht behalten habe. Aber ob ich sie hätte haben mögen? Die Amerikaner lieben es zwar, an Frau und Gattin nur eine Schönheit, ein Spielzeug, eine heitere und lebensgewandte plaudernde Gesellschafterin zu haben, — man sehe sich die entspr. Typen in den magazines an! — die keine Kinder bekommt und ihre Hausfrauenpflichten anderen überläßt, galante „receptions“ hält, das Auto lenkt, öffentlich redet und angestaunt wird. Da war mir aber doch die kleine schlichte Hobokenerin aus Baden bei ihrem Onkel am Küchenherd tausendmal lieber ... An dem anderen, dem „Nationalitätenabend“, war der Klubraum mit den Flaggen aller Völker sinnvoll und malerisch drapiert. Brüderlich hing die unsere neben der Trikolore, dem Union Jack und dem Sternenbanner. Jede Nationalität hatte nun einen Toast in ihrer Landessprache auszubringen und eine nationale Eigenheit ernst oder humorvoll den Anwesenden vorzuführen. Germany wurde zuerst aufgerufen! Es sprach für Deutschland ein ehemaliger deutscher Korpsstudent mit tüchtigen Schmissen auf der Backe — so recht etwas für amerikanische Herzen! — und sang die „Wacht am Rhein“, die viele Amerikaner begeistert mitsangen! Dann kamen[S. 121] Frankreich, Spanien, Brasilien, Griechenland, Indien, China, Japan und Rußland an die Reihe. Welch ein interessantes Ragout gab es da zu hören und zu sehen: Japanische Tänze, chinesische Lieder in einer für unser Ohr merkwürdig unmusikalischen Art, russische Bauerngesänge, ein Hindu-farewell-Lied und ein japanisches Gaukelspiel. Ein spanischer Student führte zuletzt naturgetreu eine Prügelstrafe aus einer spanischen Dorfschule vor zum großen Gelächter der Amerikaner, die körperliche Strafen im Schulleben nicht kennen!
Auch ein „deutscher Abend“ des „Deutschen Vereins“ fand statt. In dem geräumigen Festsaal der Harvard-Union war eine große Hufeisentafel aufgestellt — in Amerika kennt man sonst nur Klubtische oder Einzelsitze — um eine deutsch-studentische „Kneiptafel“ vorzuführen. Rings an den Wänden lagen in großen Glasschränken die siegreichen Fußbälle aufbewahrt, mit Datum versehen, mit denen die Universitätsmannschaften in großen Wettkämpfen im Stadium gesiegt hatten. Wie Totenschädel lagen sie da in Reih und Glied und schauten verwundert auf das, was im Saale nun anhub. Nun wurde — in dem „trockenen“ Cambridge — ein Faß deutsches Bier aufgelegt und angesteckt, Neger servierten dabei, und die deutsche „Kneipe“ begann! Auf diese Weise wurde wieder einmal in den amerikanischen Studenten die Überzeugung befestigt, daß Deutscher und Biertrinker ungefähr dasselbe ist. Wie oft bin ich selbst drüben gefragt worden, ob ich denn nicht „mein Bier“ vermißte, während mir die in Memorialhall zu Lunch und Dinner allgemein viel getrunkene Milch viel besser bekam und mundete.
Aber auch mancher einzelne Student ist mir in der liebenswürdigsten Weise nahegetreten. Wie oft hat mich mein Freund Arthur E. W. zum schönen „fresh-pond“ begleitet, einem äußerst idyllisch gelegenen Teich mit reizendem Ausblick auf die Landstädtchen Arlington und Waverly. Wie manchmal saßen wir dort unter den dunkelen Bäumen, während ein leichter Wind die Wellen des kleinen Sees kräuselte, freundschaftlich auf einer Bank zusammen. Er lehrte[S. 122] mich Miltons „paradise lost“[19] verstehen, ich dolmetschte ihm Goethes Faust, so gut es ging. Wie schwer war es, dieses urdeutsche Ideenwerk englisch verständlich zu machen! Wie mütterlich nahm sich meiner das Studentenehepaar M. an. Er und sie studierten, und zwar beide auf den philosophischen Doktor hin. Aber sie war noch klüger als er! Er kam schon aus praktischer Arbeit und wollte sich nur auf der Universität noch weiterbilden. Echt amerikanisch, da man eine Weile arbeitet und verdient und dann wieder studiert. Ebenso echt amerikanisch, daß die Frau mit dem Mann studierte! Daneben aber versorgte Frau M. noch ausgezeichnet ihre kleine Küche in dem kleinen sauberen Logis, das sie bewohnten, und wußte dann und wann noch mit einem freundlichen Mahl mir aufzuwarten. Manchmal dachte ich es mir freilich ein bißchen peinlich für den Mann, wenn die Frau bessere Abschlußzensuren heimbringt als er selbst! Aber der Amerikaner ist an die Superiorität der Frau gewöhnt. Wie gastfreundlich wurde ich in jenem kleinen und reizend gelegenen Landstädtchen Littleton in Massachusetts aufgenommen, da mich einer der Mitbewohner unserer Hall, Mr. Joseph H., einführte auf den Landsitz seiner Mutter und seiner Brüder! Wie vornehm und weitläufig war dort alles! Park, Tennisplätze, Veranden — und dazu die köstliche Landluft! Welch eine Stille hier nach dem immer noch recht belebten Boston und Cambridge. Freund H. war damals gerade der Vater, Inhaber einer größeren Gestühlfabrik, gestorben. Sofort brach der Sohn pietätvoll sein Studium ab und erfüllte den letzten Wunsch des Heimgegangenen, das väterliche Geschäft zu übernehmen. Bei dem ebenfalls verheirateten Mr. C. und seiner liebenswürdigen Gattin sah ich mich zum ersten Male genötigt, mit einem sechsjährigen Kinde englisch zu reden, das sich nicht denken konnte, daß es Leute gebe, die nicht von Geburt an englisch redeten! Ob ich immer die Worte für das wußte, wofür es sich gerade interessierte, das kümmerte es nicht. Es fühlte sich auf meinem Schoße trotzdem[S. 123] wohl. Ein sonst delikates Huhn reichte hier nach amerikanischer Einteilung für — sieben Personen! Zur Erledigung dieser Portionen war ich, da es eine Abendmahlzeit war, ahnungslos im Frack erschienen. Aber wieder einmal falsch, denn es sollte ein ganz informelles studentisches Essen sein; und ich hatte die Gastgeberin ehren wollen, und saß nun als einziger den ganzen Abend in steifster Toilette! Was mag die Hausfrau — übrigens auch Studentin — für einen Schrecken bekommen haben, als sie mich in meinem dinner-dress erblickte!
Ja überhaupt dieser „full dress“ — bis man das richtig heraus hatte, wo er angebracht war und wo nicht! Ich hatte schon einmal vor, eine Humoreske zu verfassen, betitelt „Die Geschichte meines Fracks“. Lieber Leser, höre, ich habe es fast immer falsch gemacht! Nur vor den allergrößten Dummheiten in puncto „Frack“ haben mich wohlmeinende Freunde glücklich bewahrt. Bei Professor L. war ich z. B. Sonntags mittags eingeladen gewesen — und kam natürlich abends sechs Uhr, weil ich annahm, jedes dinner sei abends sechs Uhr; aber Sonntags ißt man es gerade mittags! Dazu erschien ich natürlich abends im Frack, während man Sonntags gerade im Gehrock kommt, da man annimmt, daß man am Vormittag den Gottesdienst besucht hat. Schwarzer Rock ist aber der Kirchenrock, dazu gehört graugestreifte Hose und hoher Hut mit etwa braunen Glacés. So hatte ich es einmal bei Professor James Sonntags mittags gefunden und gedacht: Sieh, wie unformell benimmt sich der wahrhaft große Mann! Da sieht man es, dachte ich, wie sich der Philosoph über Sitte und Mode hinwegsetzt; und dabei hatte er sie gerade peinlichst eingehalten! Und ich war es, der es wieder falsch gemacht! Also merke, lieber Leser: Wochentags vor 6 Uhr macht man Besuche im „Prince-Albert“, nach sechs Uhr nur in „full dress“ oder, wenn inoffiziell, im „smoking“. Sonntags aber ist es ganz anders. Da ist das dinner um 2 Uhr und der Anzug Gehrock. Bei dem Dekan machte ich am ersten Tage gar Besuch im Kollegröcklein, wie mir mein Freund W. geraten — und sicher war das als offizieller Antrittsbesuch auch[S. 124] wieder falsch gewesen. Auch fiel mir auf, daß ich bei den amerikanischen Damen wenig Eroberungen zu machen schien — nur die Ende 60er stehende Gattin des trefflichen Predigers Rev. G. bemühte sich sehr um mich! Mein in solchen Dingen äußerst bewanderter Freund R., der Philologe und Anwärter des A. M., hat es mir erklärt: Herren mit Schnurr- oder gar einem Vollbart seien bei Amerikanerinnen von vornherein unmöglich! Zu spät sah ich tiefbetrübt ein, was ich mir hatte entgehen lassen! Gar manches Brieflein von ehemaligen amerikanischen Studienfreunden erreichte mich später noch, doch nie ein rosa Billetchen von zarter Hand! Nur die Sekretärin der Fakultät, der ich durch meinen erworbenen Universitätsgrad angehörte, sendet mir unentwegt alle Prospekte und Einladungen zu Harvard-Banketts und Vorträgen — meist, wenn sie schon vorüber sind. Aber so will es ihre amtliche Pflicht!
Unter den vielen Einladenden war eines Tages auch der brave Hausmann unserer Hall, Mr. M. Ich stieg an dem betreffenden Abend freundlich zu ihm in seine Souterrainwohnung hinab. Denn ich war immer sozial gesinnt. Amerikanische Arbeiter verdienen im allgemeinen mehr und leben besser als die deutschen. Schon vor dem Krieg unterschied sich der Arbeiter drüben in Kleidung und äußerem Gebaren fast in nichts von dem bessergestellten Bürger. Und siehe, bei Mr. M. war es auch recht gemütlich. Hübsche Möbel, dazu ein Schrank voller Bücher! Das gehörte notwendig zum Inventar eines Universitätshausmanns. Seine Frau war übrigens eine geborene Schwedin aus Stockholm! Auch bei ihm gab es Früchte, Cakes und Tee und ice-cream wie bei einer offiziellen „Rezeption“, wenn auch ohne Diener und weiße Handschuhe. — — —
In wie schöner Erinnerung stehen mir die Ausflüge mit den amerikanischen Freunden an so manchem sonnigverträumten Tag des „indian summer“. Es war immer aufs neue reizend, an den ländlichen Seen zu sitzen. Die Möwen wiegten sich auf dem blauen See. Im Sonnendunst grüßten die Arlington Heights herüber ...
[S. 125]
Wie oft pilgerte ich auch allein die Massachussets-Avenue nach Arlington hinaus. Nach über einstündiger Wanderung auf der Landstraße stieg ich links die Höhen hinauf. Pfad- und weglos — Amerika kennt kaum Fußwege — strich ich über die mit hübschen Landhäusern übersäten Hügel. Von oben ergoß sich ein herrlicher Blick über die parkartigen und waldigen Höhen und Talgründe mit ihren vielen kleinen blauen Teichen. In der Ferne lag das rauchende Boston mit seiner weithin leuchtenden vergoldeten Kapitolskuppel. Oder ich stieg rechts empor und war bald — nur eine Stunde weg von der Millionenstadt! — zwischen Steinen, Dornen, zerfallenen Bäumen und verlassenen Feldern in einem wahren Urwalde, wo vor Gestrüpp und Buschwerk fast gar nicht weiterzukommen war, und hatte Mühe, wieder einen Weg durch das prächtige Herbstlaub an den Farmhäusern einfacher Leute vorüber, wo Kühe weideten und Kinder spielten, nach der Landstraße zu finden ...
Fast noch prächtiger aber war es weiter nördlich in den sog. Middlesex fells, einem herrlichen Naturpark mit wundervollem Aussichtsturm[S. 126] jenseits Medford und des Mystic River. Ich hatte wohl noch nie in meinem Leben solch prächtige Herbstfärbungen gesehen. Dazu das tiefe, glühende Rot des Laubes im Unterholz! Welcher Blick bot sich von oben bis nach dem Dichtersitz Concord, nach Cambridge und zum Meer! Und allerwärts eine Fülle der malerischen Landhäuser. Auch Amerikaner haben Natursinn! Nur ist nicht jedem vergönnt, hier draußen zu wohnen. Im ganzen scheint mir drüben der Wohlstand und der Wohnungskomfort höher zu sein als bei uns. Auch der kleine Mann hat hier sein eigen Häuschen und Garten und vor allem seinen „bathroom“[20], denn Waschtische sind in den Schlafräumen unbekannt. Die bathrooms haben nur den Nachteil, daß ein Familienmitglied beim Ankleiden auf das andere oft recht lange warten muß. Bei Damen kann das eine Stunde währen, bis der bathroom wieder frei wird! Und da er zugleich auch noch anderen Zwecken dient, ist die Polonäse vor dem bathroom oft recht ergötzlich bzw. hochpeinlich ...!
Je mehr ich Bostons und Cambridges Umgebung kennenlernte, um so mehr erschien sie mir wie eine ungeheure, wenn auch regellose Villenkolonie. Welch ein Kulturfortschritt! Heil den Glücklichen, die da draußen wohnen dürfen! Wie voll sind aber auch die Abendzüge dort hinaus! Wie stehen, hängen, hocken sie in fröhlicher Seelengeduld, sich stets ins Unvermeidliche schickend, auf Plattformen und Trittbrettern, Zustände, bei denen es dem biederen Deutschen graute oder er nur zu schimpfen wüßte. Auf den vollbesetzten Straßenbahnen sah ich die Fahrgäste manchmal nur noch mit zwei Fingern an einer Längsstange angeklammert, in vollbesetzten Lokalzügen womöglich vorn auf der Lokomotive hängen oder stehen!
Auch längs der Ozeanküste und der weiträumigen Bostonbai dehnten wir unsere Exkursionen aus. So ging es einmal mit der Beachbahn nach dem alten Salem und nach dem romantischen Marblehead hinaus. Salem ist eine der ältesten Ansiedlungen noch aus der Zeit der Puritaner (1630), heute eine kleine stille Stadt mit einigen wenigen ganz[S. 127] alten Häusern an der Massachussets-Bai. Aber nach Lamprechts begeisterter Schilderung erwartete ich viel mehr dort. Marblehead ist Seebad der Bostoner. Es war schön, wieder einmal voll dem rauschenden Ozean ins Angesicht sehen zu können. Dumpf dröhnend spritzte der Gischt am steinigen Strand auf. Auf der einsamen Felseninsel Nahant kletterten wir in den öden, zerrissenen Felsen umher, bis uns der Schaum der in der Flut heranstürzenden Wogen zurücktrieb. Tausende von angeschwemmten Muscheln lagen umher, deren ich mir eine Sammlung mit nach Hause nahm. Lange noch zierten die schönsten Stücke mein Kamingesims. Und welche Abendstimmung erlebte ich hier draußen! Purpurrot tauchte die Sonne die fernen Fabrikschornsteine Bostons wie in Feuerglut, die weißen Villen am Strand erglühten wie Bergspitzen in den Alpen, das Meerwasser ward erst bronzen, dann silbern, bis am Strande die Lichterreihen der Straßen kleiner Städte und Vororte aufblitzten ...
Auch den historischen „Bunker Hill“ habe ich erstiegen in der Vorstadt Charleston, die an sich düster und rauchig ist. Auf Bunker Hill hielt zum erstenmal in den Unabhängigkeitskämpfen die junge amerikanische Miliz den englischen Truppen tapfer stand (am 17. Juni 1775). Im Anfang des 19. Jahrhunderts wurde zur Erinnerung daran ein 62 m hoher sehr aussichtsreicher Obelisk errichtet, der weithin mit seiner weißen Steinspitzsäule die Vorstädte Bostons überragt ...
Ebenso flogen wir gern nach Osten und Süden aus: Die interessanteste, etwas weiter abgelegene Stadt war unstreitig „Concord“, das amerikanische Weimar, der Wohnsitz Emersons, Hawthorns, Thoreaus u. a. Poeten und Dichterphilosophen. Ringsum schönes, stilles hügeliges Farmland mit Wäldern und Viehherden. Concord ist wirklich ein Idyll, dazu vom Hauch großer geistesgeschichtlicher Vergangenheit umweht. Die Geister der Großen gehen hier noch um wie bei uns in Weimar. Wie schlicht und anheimelnd, wie das Goethehäuschen an der Ilm, sind ihre Landsitze! Dazwischen überall Denksteine in Erinnerung an die Unabhängigkeitskämpfe, die um Concord und Lexington begannen. In Concord steht auch das bekannte ansprechende[S. 128] Denkmal des „minute-man“, der „jede Minute“ bereit den ersten Schuß im Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer abfeuerte, „den man in der ganzen Welt hörte“.
In Waltham fuhren wir auf den kleinen Seen des Charles River mit echten canoes umher. Ganz entzückend ziehen sich die Seen unter tiefbelaubten Bäumen hin. Wie leicht und sanft glitt das spitze, schwanke Boot übers Wasser! Zwei amerikanische Freunde ruderten, während ich bequem in den Kissen des Damensitzes liegen durfte und das Steuern besorgen sollte. Ein junger Nationalökonom führte mich eines Nachmittags in das idyllische Waverly, ein äußerst malerisches Ineinander von Hügeln, Parks, Villen und Teichen. Er war sehr beschlagen in Deutschlands politischer Geschichte, so daß ich ihm nicht immer auf alle seine Fragen eine präzise Auskunft geben konnte ...
Dieselben ausgedehnten Parkanlagen fand ich am Südrande Bostons in „Jamaica plain“, und von den Blue Hills, die wir mit eineinhalbstündiger Fahrt auf der Elektrischen erreichten, bot sich von Süden eine ähnlich herrliche Aussicht wie von den Middlesex-fells im Norden. Der Aussichtsturm ließ uns über die Wälder der Blue Hills, den Ozean und die ferne Stadt samt einem gut Teil des Staates Massachusetts schauen! Mächtig kam es mir oben zum Bewußtsein: Es ist ein Stück schönsten amerikanischen Landes, das du hier oben überschauen darfst. Könnte ich jetzt noch einmal dort stehen! So haben wir studiert und innen und außen uns umgeschaut ...
[15] Nicht zu verwechseln mit dem englischen Cambridge!
[16] Im Keller befand sich die Küche!
[17] „Gymnasium“.
[18] Unerreicht von den Lebenden!
[19] „Das verlorene Paradies“.
[20] Badezimmer mit Wasserklosett und warmem Wasserzufluß.
Jedes Volk hat seine Heiligtümer. Auch das amerikanische. Zu seinen Heiligtümern zählt die Bundesverfassung, sein Freiheits- und Selbständigkeitsgefühl, sein Weltbewußtsein, gleich England eine Art auserwähltes Volk zu sein, und endlich der — Fußball. An den großen Fußballspielen nehmen viele Zehntausende teil. Extrazüge fahren aus allen Richtungen. Die Zeitungen geben wie bei den Wahlen sofort an der Stirnleiste das Ergebnis bekannt. Und so erwartete ich mit großer Spannung das große Wettspiel zwischen den beiden alten Universitäten[S. 129] Harvard und Yale. Es gibt Jahre, wo in der Union an die dreißig junge Leute in den heißen Fußballkämpfen ihr Leben einbüßen!
Noch summt mir das wilde, tosende Rufen der Harvard- und Yale-„undergraduates“ in den Ohren, noch flimmern mir die vierzigtausend wogenden Köpfe in dem gewaltigen Rund des Harvard-Stadiums vor den Augen ... wie ein brausendes, tobendes Meer.
Es war ein Tag, so heiß wie eine Schlacht und mit einer Spannung erwartet und verfolgt wie eine Schlacht. Weit vom Norden und Süden und vom mittleren Westen waren sie zusammengeströmt mit Automobil und im Sonderzug, die vierzigtausend, das Harvard-Yale-game zu sehen, das die Fußballsaison abschließende Spiel zwischen den beiden größten, ältesten und bedeutendsten Universitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Jedes college, ja jede high school hat ihr Footballteam und ihr „Stadium“. Im Herbst jedes Jahres messen sie einander. Schon hatte dieses Jahr Yale über Wesleyan, Syracuse, Springfield, Holy Croß, West Point, Colgate, Amherst und Princeton gesiegt und Harvard über Bates, Williams, Maine, West Point, Cornel und Dartmouth; und nun sah alle Welt, die neunzig Millionen der Vereinigten Staaten, auf das letzte große Spiel zwischen den ehrwürdigen Meisteruniversitäten Yale und Harvard. Welche ungeheure Bedeutung dieses Spiel einnimmt, das zeigt wohl am besten der Umstand, daß für zwei Tickets in letzter Stunde 60, 80, 100, ja 200 Dollars an Spekulanten gezahlt worden sind, während Zehntausende keins mehr bekommen konnten; daß ferner während des Spiels Tausende die Redaktionen der großen Zeitungen in Boston umlagerten und die Anschläge der Drahtnachrichten und so aus der Ferne das heiße Spiel Zug um Zug verfolgten; daß in den Theatern des Landes in den Zwischenakten die Punkte der streitenden Parteien als Transparente erscheinen und natürlich Extrablätter von allen Zeitungen verausgabt werden. Der Sport ist in den Vereinigten Staaten eine öffentliche, nationale Angelegenheit. Ein Blick in die Zeitungen genügt, um das in aller Deutlichkeit zu erkennen. Jede Zeitungsnummer bringt täglich spalten- und seitenlange Einzelberichte über die großen Teams des Landes, über die Spieler[S. 130] im einzelnen, über ihre Herkunft, ihren Lebenslauf, ihr Alter, ihre Geschicklichkeit, ihre Größe, ja ihr Gewicht, ihre besten Kicks, Abbildungen der einzelnen Züge und wichtigsten Momente des Spiels usw. Diese Sportsnachrichten nehmen oft mehr Raum ein als die politischen Artikel; an Umfang können sich höchstens mit ihnen noch die Ehescheidungsberichte, Automobilunfälle und Theatergrößen messen ...!
Nun war also der große Tag herangekommen. Man mochte ein eisigkaltes Wetter erwarten. Tags zuvor blies es bitterkalt vom Norden her. Aber merkwürdig, der 20. November war fast lau und mild, und doch mußte sich jeder wohl vorsehen, in dieser Jahreszeit zwei oder drei Stunden im Freien auf kalten Steinen zu sitzen. Bereits zwischen 12 und 1 Uhr mittags nach dem Lunch wälzten sich Hunderte vom „Harvard Square“ in Cambridge die Bolystonstreet hinunter hinaus aufs „Soldiers field“ zum „Stadium“. Jeder bekannte sich durch ein entsprechendes Abzeichen als Harvard- oder Yaleman: hochrote und tiefblaue Kravatten, Armbinden, Fähnchen, Federn bis zu den blauen und roten Hüten und Jacketts der Damen. Hie rot und Harvard — hie blau und Yale! Heiser priesen die Verkäufer ihre Harvard-Yale-Ansichtskarten und die Bilder der Spieler an. Von der entgegengesetzten Seite rollten unaufhörlich die Automobile heran, eins hinter dem andern, tutend, heulend, surrend, schnaubend, rasselnd. Die Straßenbahnen fuhren Wagen hinter Wagen, bis auf die Trittbretter besetzt, auf denen noch fast ebenso viele Plätze fanden wie im Wagen; hier hing einer nur noch mit einem Fuß auf dem Trittbrett, dort klammerte sich ein anderer nur noch mit den Fingern an eine Längsstange; die Mäntel flogen im Wind, die Hüte drohten fortgerissen zu werden.
Am Stadium, dem gewaltigen, imposanten, elliptischen, halboffenen Amphitheater aus weißgrauem Beton, das nahezu vierzigtausend Personen faßt, stauen sich die Massen und schwellen an zu einem wirren Menschengewoge; aber niemand drängt und drückt oder schilt und schimpft, jeder wartet und ist geduldig, selbstlos und demokratisch. Bald war die eine breite Straße, die von Cambridge über eine alte, schlechte Holzbrücke über den Charles River zum Soldiers field[S. 131] führt, nur noch ein Menschenknäuel mit viel tausend Köpfen. Ringsumher auf den Zufahrtsstraßen und am Charles River entlang sammelten sich die Automobile zu ganzen Wagenparks. Wohl noch keine Automobilausstellung der Welt hat deren eine solche Menge und Verschiedenheit der Marken zusammengebracht. Wer nicht zu Automobil kommt, kommt mit einem der vielen Eisenbahnsonderzüge, die aus allen Richtungen an diesem Tage Boston zustreben.
Das weite Rund des Stadiums mit seinen vieltausend Steinsitzen, seinen gewaltigen Substruktionen und seinen schönen Kolonnaden über den höchsten Sitzreihen lag still und gemessen da und wartete der Menge, die sich von allen Seiten über seine Treppen und Steingänge ergoß und es trotz ihrer ungeheuren Zahl nur langsam zu füllen vermochte. Ich hatte einen Sitz hoch oben über den Kolonnaden bekommen, wo sich nicht nur ein ausgezeichneter Überblick hinunter in die gewaltige halboffene Ellipse auf das Spielfeld bot, sondern auch hinaus ins offene Land. Ich fühlte mich fast nach Rom in das gleich gewaltige Kolosseum versetzt. Gleich dem Tiber wand sich hier der breite Charles River an Cambridge hin; mäßige Hügel säumten gleich Rom auch hier rings den Horizont; in der Ferne schimmerte die goldene Kuppel des Kapitols von Boston auf dem Beacon hill, der schöne Frührenaissanceturm der New old South Church grüßte aus dem feinen blauen Herbstdunst herüber, der über der großen Stadt lagerte. Wie hier das Menschengewimmel, so mochte es einst vor zwei Jahrtausenden zu Zeiten des Titus und Domitian im römischen Amphitheater ausgesehen haben, wenn die vierzigtausend das Spiel erwarteten. Nur statt der glattrasierten Römer hier glattrasierte Amerikaner, statt der Toga und Tunika Automobilpelz und Wintermantel, schwarze steife Hüte und graue Reisemützen, statt der Löwen und Gladiatoren harmlose Fußbälle und junge Studenten ...
Wie Ameisen krabbelten die Menschen auf den Steinsitzen hin und her und suchten ihre Plätze. Schwärzer und schwärzer wurden die runden Steinreihen. Bald bewegten sich da unten vierzigtausend Köpfe hin und her, vierzigtausend schwarze Männerhüte und graue[S. 132] Reisemützen und rote und blaue Damenhüte; dazwischen flatterten lustig die hochroten Harvard- und die tiefblauen Yalefähnchen mit dem stolzen H. und Y. Harvard war recht siegesgewiß. Sein Captain Fish, einer der trefflichsten Fußballspieler, hatte zwar im letzten Spiel gegen Dartmouth eine Verletzung davongetragen, aber er war wieder munter und war fest entschlossen mitzuspielen und hatte, wie die Zeitungen berichteten, geäußert, nur der Tod allein könne ihn von diesem Spiel abhalten. Captain Coy von Yale aber war ein ebensowenig zu verachtender Gegner, ein weitgefürchteter „Kicker“. Freilich hatte Harvard in den letzten zwei Jahrzehnten nur viermal Yale besiegt, aber der Sieg des letzten Jahres über Yale und Captain Fish machte Harvard im voraus siegesgewiß.
So ward es zwei Uhr. Auf ein Zeichen sprang eine Schar junger Menschen mit weiten flatternden roten Tüchern, fast wie Stierkämpfer gekleidet, in das Stadium, von tosendem Beifall begrüßt, Captain Fish und die Harvardspieler. Bald darauf stürmte ein zweiter Haufe in wehenden blauen Tüchern herein — die Yalespieler. Die Tücher wurden abgeworfen, ein schwarzes Überwams ausgezogen — dann standen die roten und blauen Kämpen einander gegenüber. Jeder angetan wie ein Fechter, wohlgepolstert an Schultern und Knien und teilweise mit Kopfhauben gegen Fußtritte und Schädelbrüche geschützt, in weiten zerschlissenen dunkelgelben Hosen und rotem oder blauem Wams. Schon erhoben die Harvard- und Yale-„undergraduates“, die auf je einem Haufen auf beiden Seiten dicht zusammensaßen, ihr Schlachtgeschrei, und aus vielhundert Kehlen, den Schalltrichter vor dem Munde, schallte es: „Har—vard, Har—vard, Har—vard, ra—ra—ra—ra—ra—ra, ra ra ra ra ...“ Und von drüben antwortete es ebenso siegesgewiß und drohend: „Yale—Yale—Yale, ra—ra—ra—ra—ra—ra, ra ra ra ...“ Jede Partei suchte die andere mit Schreien und Lärmen zu überbieten. Das Schreien ging fort und wuchs, von Vormännern ganz methodisch und systematisch unter Kommando und gewaltigen Armbewegungen dirigiert: „eins—zwei—drei: ra—ra—ra—ra—ra—ra, ra ra ra ...“
[S. 133]
Indessen ertönte ein Pfeifchen. Die Spieler traten an die Mittellinie des Feldes, das in viele weiße Karrees geteilt war, ähnlich einem großen Tennisplan, gebückt mit den Händen am Boden, den Kopf tief gesenkt, zum Fang und Sprung bereit. Harvard begann. Hoch und weit wirbelte der Ball, von einem Harvardman gewaltig emporgekickt durch die Luft ... ein Yaleman fängt ihn auf, die Harvardleute fallen über ihn her ... der Yaleman stürzt rücklings auf den Hinterkopf zu Boden, ... ein wilder Knäuel um ihn, zweiundzwanzig Menschen wälzen sich übereinander und raufen sich um den Ball, ... indessen sehe ich andere mit Wasser und Tüchern herbeispringen. Ein Yaleman ist schwer verletzt, halb bewußtlos liegt er am Boden; einen Augenblick stoppt das Spiel. Der Verletzte wird zur Seite getragen, ein anderer tritt für ihn ein — und das Spiel geht weiter. Jedes Jahr sind es ja mehrere, die nicht nur Arm oder Bein, sondern das Leben auf dem Fußballspielplatz lassen.
Hin und her wirbelt der Ball, bald ist Harvard einige Yards voraus, bald Yale; hier und da stürzen die Spieler übereinander, wälzen sich als Knäuel am Boden ... dazwischen Rufen und Jauchzen und Klatschen und Winken der Zuschauer, immer lauter und frohlockender, bald Harvard, bald Yale. Wie ein Meer toben die Vierzigtausend da unten. Bald wirbeln die blauen Yalefähnchen durch die Luft, bald die roten Harvardflaggen, bald erheben sich hier auf der Seite Tausende in der Erregung von den Sitzen und beugen sich vor, um besser zu sehen, bald dort: Fortwährende Rufe und Schreie. Dazwischen das laute Zählen der Spielführer, die Pfeifchen der Spielmeister und das wilde „ra—ra—ra—ra“ der Harvard- und Yaleundergraduates, wohl kommandiert und dirigiert. So wogt das Spiel bei zwei Stunden hin und her.
Währenddessen eilen die Photographen mit ihren Apparaten und Stativen unablässig von einem Ende des Spielfeldes zum andern, um ja keinen Zug zu verpassen, die Reporter registrieren genau jede Wendung, und Punkt für Punkt wird augenblicklich in alle Windrichtungen telegraphiert. Als es Yale zweimal gelingt, den Ball über[S. 134] die letzte Harvardlinie hinauszuschleudern, und so der Sieg für Yale immer mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt, da kann ein ganzer Haufen Yalestudenten nicht mehr an sich halten; im Enthusiasmus springen sie von den Sitzen und aus den Reihen aufs Spielfeld hinaus, werfen Hüte, Mützen und Mäntel in die Luft, umarmen sich und tanzen vor Freude, und einige Schutzleute haben Mühe, sie zurückzudrängen, damit die Bahn für das Spiel frei bleibt. Indessen notiert das Bulletinboard am inneren Ende des Stadiums für die Zuschauer Zug um Zug, Punkt für Punkt und Linie um Linie. Draußen am Charles River stehen viele Hunderte, die kein Ticket haben erlangen können, die aber wenigstens mit dem Glas die Zahlen am Bulletinboard von ferne zu erhaschen suchen. Mehr und mehr neigt sich das Glück Yale zu. Die Yalegirls werden immer enthusiastischer, immer schneller wirbeln die blauen Fähnchen in den Händen der Girls durch die Luft. Das fortwährende kommandierte heisere „ra—ra—ra—ra“ der Harvardmen hilft ihren Kampfgenossen nicht auf.
Ja, in der Tat, das Unerwartete geschieht. Yale gewinnt! Es ist vier Uhr. „Yale 8 Punkte, Harvard 0.“ Wilder Siegestaumel ergreift die Yalestudenten. Sie stürzen wieder von den Sitzreihen ins Feld herunter, gruppieren sich geschwind hinter ihrer blauen Musikkapelle, — und nun geht es in wilden Sprüngen und wildem Tanzen unter Siegessang und Freudengeschrei im Feld des Stadiums hin und her. Mächtig schallen die Yalelieder durch das Rund. Hüte und Mützen fliegen vor Vergnügen aufs neue hoch in die Luft und werden beim Umzug über die Balken der siegreichen Goals geschleudert. Kläglich und wütend schreien die Harvardmen ihr „ra—ra—ra—rarara“ dazwischen. Yale hat gesiegt. Die heiße Schlacht ist aus ...
Die Massen der Tausende auf dem Steinrund sind wieder in Bewegung. Der gewaltige Automobilpark löst sich auf. Die Straßen beginnen sich wieder zu füllen; die Straßenbahnen fahren wieder davon, eine hinter der anderen mit den vielen auf den Trittbrettern hängenden Menschen. Nur der Charles River fließt ruhig und gemessen im weiten Bogen nach dem dunstigen Boston hinunter und[S. 135] wundert sich über die Tausende, die seine alte Holzbrücke passieren, voll Jubel, Enthusiasmus und — Enttäuschung. Über den Hügeln von Newton und Brookline taucht die Sonne purpurrot unter, und ihr glutroter Schein spiegelt sich in den Fenstern Cambridges. Ruhig und verlassen liegen unter den blätterlosen alten Ulmen die Dormitories und die Collegehalls der Harvarduniversität. Memorialhall reckt seinen charakteristischen Vierungsturm empor und öffnet sein Tor den vielen fremden Yalemenschen, die sich jetzt in seiner weiten gastlichen Halle, wo die großen Ahnen Harvards ehrwürdig von den Wänden schauen, zum Dinner niederlassen. Über dem sich leerenden, weiß im Abendlicht schimmernden Stadium aber schwebt wie ein Aeroplan gemächlich und still eine riesige Flagge: — „Ponds Extrakt“! Es gibt in Amerika keinen schönen und berühmten oder poetischen Ort, den die Reklame nicht meinte noch verschönern zu müssen. Wie eine Siegesfahne winkt sie hinüber zur goldenen Kuppel des Kapitols in Boston im Abenddunst ...
Kaum haben wir unseren Fuß aus dem Stadium gesetzt, da laufen uns schon die Zeitungsboys entgegen mit den Extrablättern, die in riesigen Lettern verkünden: „Yale Wins. Final score: Yale 8, Harvard 0“, während der Draht längst den Sieg Yales in alle Lande trägt. Der siegreiche Fußball aber wandert in den „trophee-room“ der Yaleuniversität, wo ihn die kommenden Geschlechter mit Ehrfurcht und Staunen hinter Schrein und Glas beschauen, wie wir wohl vor den Schädeln der Großen und Heiligen in der Geschichte mit Ehrfurcht stehen ... Der Ruhm der Yalespieler aber ist gesichert für alle Zeiten, weit mehr denn eines berühmten Yaleprofessors, der dicke Bände geschrieben und die amerikanische Wissenschaft ein gut Stück weitergebracht hat ...
Griechenland hatte seine Amphitheater und Tragödien, Rom seine Kollosseen und Gladiatoren, das Mittelalter seine Turniere und Ritterspiele, Spanien seine Stiergefechte, die moderne Gesellschaft in Deutschland hat ihre Pferderennen und ihre Mensuren, Amerika hat sein Fußballspiel ... Kraft und Jugendheldenmut sucht sein Feld; glücklich[S. 136] die Nation, die sich am Heroischen begeistert wie ein Mann. Aber ist nicht ein Unterschied, wo wir das Heroische suchen ...? — — —
Nach diesem Kennenlernen der akademischen Fußballjugend trieb es mich ein andermal die in der englisch-amerikanischen Welt großartig in der sog. Young men’s christian association weltumspannend organisierte Jugend kennenzulernen. Ich begnügte mich, einer Einladung des Zweigvereins, des sog. Y. M. C. A. in Cambridge, zu folgen.
Es war ein geräumiges Vereinshaus, natürlich ein eigenes, an der Hauptgeschäftsstraße, der Massachusetts Avenue in Cambridge, in das ich eintrat. Als ich die schöne Freitreppe hinanstieg, gelangte ich auf dem ersten Stock zu dem Bureau, wo der Sekretär den Fremden freundlich empfängt, dann in einen weiten offenen Empfangsraum mit feinen Teppichen, elektrischem Licht wohl ausgestattet, und zu den anschließenden gemütlichen Lesesälen, wo etwa 30 Zeitungen, die besten Tageszeitungen, Wochenschriften aller Art, religiösen, belehrenden und künstlerischen Inhalts, auflagen. Auch ein Billard und andere Geselligkeitsspiele fehlten nicht und werden allabendlich eifrig benutzt. Die Treppen führten mich weiter empor zu den mannigfachsten Klubräumen in den verschiedensten Größen für kleinere und größere Zusammenkünfte der Jugendlichen. Der Verein in der Großstadt umfaßt meist mehrere hundert Mitglieder, die an Einzelbestrebungen und Alter so verschieden und zahlreich wie möglich sind, so daß sie geteilt sich in kleinen Zirkeln zusammenfinden. Und hier herrscht nun die bunteste Mannigfaltigkeit, zunächst was das Alter betrifft: Ich sah kleine Knirpse, die wohl kaum zehn Jahre alt sein mochten, die noch die Volksschule besuchen, aber eifrig schon „im Verein“ verkehrten. Das amerikanische Leben drängt im ganzen ja weit mehr und weit früher auf die Öffentlichkeit hin als das unsere. So ist auch das Clubleben weit mehr ausgebildet. In jeder Schule von den Kleinsten angefangen bestehen oft schon Schülerklubs, die sich selbst regieren, ihre Präsidenten und Beamten wählen und so im kleinen die große Demokratie des ganzen Volkes abbilden und auf das politische Leben, an dem jeder Bürger Anteil nehmen soll, vorbereiten. Neben diesen[S. 137] Kleinen gab es genug derer in den Zwanzigern und Dreißigern. Neben den Volksschülern die Männer, Arbeiter und Angestellten aller Berufszweige! Dazwischen Realschüler von fünfzehn und sechzehn, Lehrlinge, junge Kaufleute und Handwerker von noch nicht zwanzig. Jedes Alter und jeder Berufszweig bildete einen eigenen Kreis und eine eigene „Klasse“.
Ebenso bunt wie das Alter waren die Bestrebungen, die sich da zusammenfinden. Der Y. M. C. A. in Cambridge bietet neben den Bibelstunden, die alle als Grundlage vereinen, Unterricht in Sprachen, Mathematik, Zeichnen, Singen, Buchhaltung, Schreibmaschinenschreiben, Stenographie — und vor allem Turnen und Sport. Dazu kennzeichnen noch zwei Dinge jedes amerikanische Klubleben: Gymnastik und politische Debatten. Jedermann vom Schuljungen bis zum Studenten und verheirateten Mann übt täglich seine Spiele, es sei Fußball, Base-ball, Basket-ball, Tennis oder Laufen, Springen und Geräteturnen ... So muß jedes Vereinshaus des Y. M. C. A. vor allem eine eigene vollständig mit allen modernsten Geräten und Spielen wohlausgerüstete Turnhalle besitzen. An ihrer Größe und Ausstattung kann man das Florieren des Vereins kontrollieren. Aber nicht nur das, ein amerikanisches Vereinshaus, das auf der Höhe sein will, muß möglichst auch ein eigenes Schwimmbassin haben oder allerwenigstens, wenn es nicht als veraltet und rückständig gelten will, einen eigenen großen Baderaum mit vielen Brausen und Duschen. Was gibt es auch schöneres als Spiel und Sport, erst zu turnen und zu springen und zu schwingen und zu schwitzen und dann zu baden und zu duschen, zu spritzen und im Wasser zu planschen! Das hatte ich selbst in der akademischen Turnhalle öfters ausprobiert. Der Verein muß sogar Gelegenheit geben, sich von einem zuständigen Arzt auf körperliche Gesundheit und Tauglichkeit untersuchen zu lassen! Und wie oft kontrolliert der junge Amerikaner mit Stolz zunehmendes Maß, Gewicht und Stärke ... So ist denn auch der professionelle, wohlgelernte, mit gutem Gehalt angestellte Turnmeister eine der wichtigsten Personen unter allen Vereinsbeamten. Und mit welcher[S. 138] prächtigen Grazie und Gewandtheit weiß er alle Übungen vorzumachen!
Dazu tritt das andere, was jedem Amerikaner über alles geht, Reden (addresses) hören und debattieren. Man kann jeden Abend zwei, drei und mehr Redner hören. Man ist einfach für alles interessiert, für den Nordpol, den Mars, für Luftschiffe, für babylonische Ausgrabungen, neueste elektrische Erfindungen ... jeder Redner und jeder „speech“ ist willkommen. Es muß möglichst jeden Abend oder jede Woche einmal etwas Großes im Verein „los“ sein. Und wie offen erfolgt die Aussprache! Da werden Fragen gestellt, der Redner unterbrochen; keiner fürchtet sich, den Mund aufzutun. In Amerika findet man immer und überall fragende, lernbegierige, empfängliche und für geistige Darbietungen dankbare Menschen. Selten wird kritisiert, immer bewundert und gelobt!
In den obersten Stockwerken des Vereinshauses — ich kletterte mit meinem Führer bis aufs Dach hinauf, wo man den Turm der City Hall gerade vor sich hatte und durch die Nacht bis zu dem lichtschimmernden Boston hinüberblicken konnte — fand ich auch Zimmer zum Logieren für durchreisende Mitglieder von Zweigvereinen, für den Sekretär und die ständig fungierenden bezahlten Beamten des Vereins.
An jenem Abend, an dem ich im Verein weilte, hatte ich Gelegenheit, einem Schauturnen beiwohnen zu können, das drüben den seltsamen Namen „Karnival“ trägt. Ich wurde erst durch die Baderäume geführt, wo sich Kleine und Große in hellen Haufen tummelten und ihre Turnkleidung anlegten. Dann bekam ich das „Gymnasium“ (die Turnhalle) zu sehen, mit der kaum die besten unserer Turnhallen es hätten aufnehmen können. Eine große Zuschauerschaft war schon versammelt, Eltern, Väter und Mütter, Brüder und Schwestern. Alles wartete gespannt auf das Öffnen der Flügeltüren und das Einmarschieren der Turner. Und dann kamen sie, nacheinander, die Riegen der kleinen Knirpse, die so wohl über den Bock zu springen und allerlei lustige Purzelbäume zu schlagen wußten, dann die älteren Schüler mit ihren exakten Stab- und Hantelübungen, und endlich die[S. 139] in den Zwanzigern, meist sehnige, straffe, frische junge Menschen mit ihren geschwellten Armmuskeln und strammen Waden. Neu waren für mich eine ganze Reihe wohl ausgeführter Reigentänze, die mit ihren wilden und doch taktmäßigen Sprüngen mich an Indianer- und Negertänze erinnerten. Eine Riege erschien als „Farmer und Trapper“ verkleidet, eine andere mit brennenden Holzkeulen, die im Dunkeln geschwungen einen faszinierenden Eindruck hinterließen. Mancher der Turner hatte ein großes „C“[21] auf dem Rücken als Ehrenzeichen, daß er eine Reihe vorgeschriebener ausgesucht schwerer Übungen vollendet ausführen kann. Auch einige farbige junge Männer waren als Turner darunter, was mich besonders freute.
In den Vereinigten Staaten bestehen etwa 2000 solcher Y. M. C. A.-Vereine, die 681 eigene Häuser haben mit einer Gesamtmitgliederzahl von über 450 000 Personen und einem Gesamtvermögen von ungefähr 50 Millionen Dollars! Und wieviel wird für sie gegeben! Der Bostoner Verein, dessen Haus kürzlich in der Nacht in Flammen aufging, sammelte binnen 14 Tagen 500 000 Dollars für ein neues größeres! Der Cambridger Verein plant, seine Mitgliederzahl von 200 auf 2000 zu erhöhen und man wird das in einer „Kampagne“ auch fertigbringen. Die Stadt wird gleichsam für wenige Wochen bestürmt und erobert: Energie, Zielbewußtsein, Begeisterung, „Rekord“ — die leben nirgends mehr denn in Amerika. Die Tätigkeit der Y. M. C. A.-Vereine ist im ganzen Land von jedermann anerkannt, vom Präsidenten, der sie öffentlich gelobt hat, angefangen. Sie schaffen anerkanntermaßen Charaktere, treffliche gebildete Bürger, gesunde frische Menschen, allem Gemeinen, Trägen und Genußsüchtigen abhold. — — —
Mittlerweile war langsam Weihnachten herangekommen. Wie würde es mir im fremden Erdteil am Heiligen Abend ergehen und zumute sein? Hatte ich bis jetzt unter den vielen neuen Eindrücken, deren Kette für mich gar nicht abriß, nie an Heimweh auch nur gedacht,[S. 140] sondern lebte fortgesetzt in einer Art Erobererstimmung, ein ganzes Land in seiner eigenen neuen Art, seiner Sitten, Anschauungen und Gebräuchen mir geistig zu eigen zu machen, so würden mich vielleicht die stillen Weihnachtstage doch auf einmal „kleinkriegen“! Das fürchtete ich ...
Man feiert Weihnachten drüben doch recht anders als bei uns. Die zentrale Stellung, die das Weihnachtsfest im deutschen Volks- und Gemütsleben hat, hat es drüben lange nicht, ja wohl in keinem Volk sonst. Schon das Sinnbild des deutschen Weihnachten fehlt, der Christbaum, wenn auch nicht überall ...
Weihnachten voraus geht in Amerika der nationale „Thanksgiving day“ am 27. November. Zwei nationale Feiertage hat die Union, an denen sich das ganze Volk ohne Unterschied zusammenfindet, das ist der „Fourth of July“ (4. Juli), der Verfassungstag, der mit allem Pomp und Aufsehen und höchstem Stolz vom ganzen Volk von der Küste des Atlantik bis zum Stillen Ozean und von den großen Seen bis zum Golf von Mexiko begangen wird; man halte dagegen den Streit und die Zerrissenheit unseres Volkes in Sachen eines Verfassungstags! Und daneben religiöser betont als der 4. Juli der „Danksagungstag“, wenn die ersten Schneestürme die nördlicheren Staaten durchfegen und man sich um den traditionellen Truthahn sammelt, wie wir um die Martins- oder Weihnachtsgans. An diesem Tage gedenkt das amerikanische Volk in allen Kirchen aller Denominationen mit Dank des Reichtums, der Sicherheit, des Fortschritts, des Glücks und Ansehens, das es in der Welt genießt und auch des Sieges, den es im Weltkrieg „der Gnade des Höchsten“ zu verdanken hatte. Und es läßt sich gern die Verpflichtung vorhalten, nun auch seinerseits sein Wort und seinen Willen kräftiger als bisher zur Beglückung und Befriedung der Völker trotz der Monroedoktrin in die Wagschale der Welt zu werfen, Kriege in der Welt zu verhüten (!), daß jedem, auch dem kleinsten Volk in der Welt — darum auch Tschechen, Polen, Südslawen und Serben, Juden — ihr Selbstbestimmungsrecht werde, besonders allen Unterdrückten wie einst dem[S. 141] amerikanischen Volk selbst, als es „der Herr aus seinem Diensthause führte“. Zu diesem feierlichen Thanksgivings day hatte ich nicht weniger als fünf Einladungen erhalten zu drei Professoren, zu dem befreundeten liebenswürdigen Studentenehepaar und zu den Eltern meines Freundes Arthur E. W. Leider konnte ich nur einen Truthahn verspeisen, da der Thanksgiving leider nicht fünf Tage hintereinander gefeiert wird. Ich nahm des letzteren freundliche Einladung an, da sie zuerst gekommen war, und mußte die anderen nicht leichten Herzens ausschlagen. W.s Eltern wohnten in der freundlichen und schöngebauten Vorstadt Bostons Dorchester. Ich hatte dort Gelegenheit, auch einmal in amerikanisches Familienleben des kaufmännischen Mittelstandes hineinzuschauen. Der Familienvater war zwar ertaubt, aber um so intensiver belesen in aller schönen Weltliteratur. Und kein Laut der Klage kam wegen seines Leidens über seine Lippen ...!
So kam Weihnachten näher.
Dienstag vor Heiligabend las der Rhetor der Universität in „Appleton Chapel“ aus den „Christmas Carols“ von Dickens. Dazwischen wurden englische Weihnachtslieder mit frischer Melodie gesungen, darunter auch das Lied von der „heiligen Nacht“ in Übersetzung. Wie seltsam das in Amerika berührte! Denn kein Lied ist deutscher als dieses. Ebenso seltsam klang mir immer die Übersetzung unseres Lutherliedes: „Ein feste Burg ...“ als englischer Choral in den Ohren:
[S. 142]
Dann schlossen die Vorlesungen auf zehn Tage. Zehn goldene Tage war ich einmal die vorgeschriebene Zwangslektüre los und konnte im Lande der „Freiheit“ einmal wieder meiner geistigen Selbstbestimmung leben! Freitag war heiliger Abend. Aber ich sah in Cambridge keinen Christbaum, noch weniger einen Weihnachtsjahrmarkt. In Neuengland herrschen noch ganz die alten englischen Weihnachtssitten. An den Fenstern der Läden und Häuser hingen einige grüne Kränze — das war alles. Nicht einmal rechte Weihnachtsgottesdienste, wie wir sie gewöhnt sind, gab es, nichts von Metten und Vespern. Das Fest wird auch bloß mit einem Feiertag begangen!
So hatte ich mir selbst am heiligen Abend — den sie übrigens drüben auch gar nicht feiern! — einen kleinen Weihnachtstisch zurechtgebaut und schenkte mir selbst ein paar blitzende amerikanische Schlittschuhe, zündete mir einige Kerzen auf dem Kamin an, steckte hinter meine Bilder ein paar Tannenreiser, schichtete ein paar rotwangige Äpfel auf und feierte so still für mich heiligen Abend in der neuen Welt. Als ich die Kerzen angezündet und ihr Schein auf die paar mageren Zweiglein fiel, fiel, glaube ich, auch ein kleines, warmes Tränlein mit darauf. Jetzt wäre ich doch fürs Leben gern die zehn Ferientage einmal schnell zu Hause gewesen und hätte soviel zu erzählen gehabt — aber das Weltmeer mit seinen 4000 Meilen lag dazwischen! Ich fing nun manchmal schon heimlich die Wochen an zu zählen, wann es wieder heimgehen würde. Bei Wachsduft und Kerzenschein kamen auf einmal alle die Weihnachtsfeste der Kindheit leise zu mir in mein amerikanisches Studierzimmer hereingeschritten, frohe und ernste, und stellten sich wie unsichtbare Engel an den Wänden meines „furnished room“ auf und hatten wohl alle auch ein kleines, warmes Tränlein an den Wimpern ... Damit mir es nun aber in meinem Zimmer nicht gar zu einsam werde, holte ich mir einige Kameraden aus unserer Hall herein, von denen die meisten aus dem eigenen Lande auch nicht heimfahren konnten, weil viele weither aus dem Süden oder dem „mittleren Westen“ waren. So kam zu meiner „Weihnachtsfeier“ mein lieber japanischer Freund[S. 143] Ashida, Mr. Moore und der Heidelberger Philologe. Wir lasen deutsche und englische Weihnachtsgedichte zusammen und sangen dann alle miteinander auf deutsch „Stille Nacht, heilige Nacht“, bis die Kerzen langsam herabbrannten. Der Japaner, der Amerikaner und wir zwei Deutschen!
Als sie wieder gegangen waren, packte ich die heimatlichen Weihnachtspakete aus, die vor einigen Tagen angelangt waren; das wollte ich gern ganz allein tun. Da kamen noch allerlei — aber jetzt echte deutsche — Tannenzweiglein und duftende rotwangige deutsche Äpfel, Weihnachtskerzen, warme Sachen und vor allem Weihnachtsbrieflein zum Vorschein. Und wie war das alles mit soviel Liebe und weiser Berechnung zeitig aus der Heimat abgegangen ...! Und wie wirkte das alles hier so traulich und wehmütig zugleich! — —
Der Abend schloß für mich nicht so ganz still und die Nacht nicht so ganz heilig insofern, als sich — wohl nach einer zugezogenen Erkältung — in der Nacht Fieber einstellte und ich das Bett hüten und nicht mehr zu Präsident Lowell gehen konnte, der alle Harvardstudenten, die nicht heimfahren konnten, zu einem offenen Weihnachtsabend zu sich eingeladen hatte. Das war schön von ihm! Ich lag derweilen allein fiebrig in der Weihnachtsnacht ... In derselben Nacht gab es auch noch einen riesigen Wasserröhrenbruch in der Stadt, so daß das Wasser in hellen Strömen durch alle Straßen schoß. Da man ein böses Einfrieren befürchten mußte, griffen noch in derselben Nacht die Studenten mit zu, als sie gerade vom Präsidenten kamen, um noch größeres Unglück zu verhüten.
Andern Tags hatte mich Freund W. wieder zu seinen Eltern zusammen mit seinem Stubengenossen R. nach Dorchester zum „Christmas-Dinner“ eingeladen. Wir hatten daselbst wieder „a very good time“ (viel Spaß), wie man drüben sagt, und sangen allerlei wehmütige Negergesänge, die ich einige Tage zuvor in einer baptistischen Negerkirche gehört und gelernt hatte. Dort war, als ich eintrat, alles ganz „schwarz“ gewesen, nur die weißen Zähne und Augen ließen erkennen, daß Menschen anwesend waren!! Süßlich-sentimental erklangen[S. 144] die Lieder, aber der Prediger fuchtelte dafür um so gewaltiger mit seinen Armen auf dem Pult. Ein laut schreiendes Kind und ein bellender Hund begleiteten in dieser Negerkirche die Predigt auf ihre Weise! Und überall duftete es eigentümlich ...
Gegen Abend machte mein Freund mit uns noch einen Weihnachtsbesuch in einem sehr reichen Hause im Franklinpark, wo eine sehr wohlhabende Dame, die einst mit ihm — glückliches Land der Koedukation! — in die „high School“ in Dorchester gegangen war, auf ihrem ländlichen Schlosse wohnte. Wir schritten die tiefverschneiten Parkwege entlang und traten ein. Ein riesiger prächtiger Christbaum stand hier auf spiegelblankem Parkett in der Empfangshalle. Er reichte vom Fußboden bis an die Decke und war über und über mit Hunderten von Kerzen besteckt. So sah ich doch noch einen Christbaum! Feine Herren und Damen verteilten unter ihm an eine Anzahl von all der strahlenden Pracht wie geblendet dastehende arme Kinder der Vorstadtviertel Weihnachtsgaben. Die Dame des Hauses selbst sang am glänzend polierten Flügel allerlei süßtönende Lieder ... Aber trotz allem, dies Weihnachten gefiel mir auch nicht recht. Es war mir zu fein.
Dieselbe Nacht noch vom ersten zum zweiten Feiertag wütete in ganz Neuengland ein furchtbarer Schneesturm, wie man ihn lange nicht erlebt hatte. Die schwersten Äste der alten Harvardulmen lagen am Morgen zerschmettert am Boden. Die Vorstadt Chelsea stand infolge der Sturmflut unter Wasser; viele Schiffe waren gestrandet, Neger wurden erfroren in den Straßen aufgefunden, denen es immer noch schwer fällt, den nördlichen Winter durchzumachen; Seeleute wurden zahlreich vermißt. Auch das kein schönes „Weihnachten“! Und am Morgen lagen, als man erwachte, Schneemassen in den Straßen Cambridges, daß niemand von den Studenten, die früh zu ihrem „job“ als Organist oder Prediger aufs Land hinauswollten, auch nur vor die Tür kam!

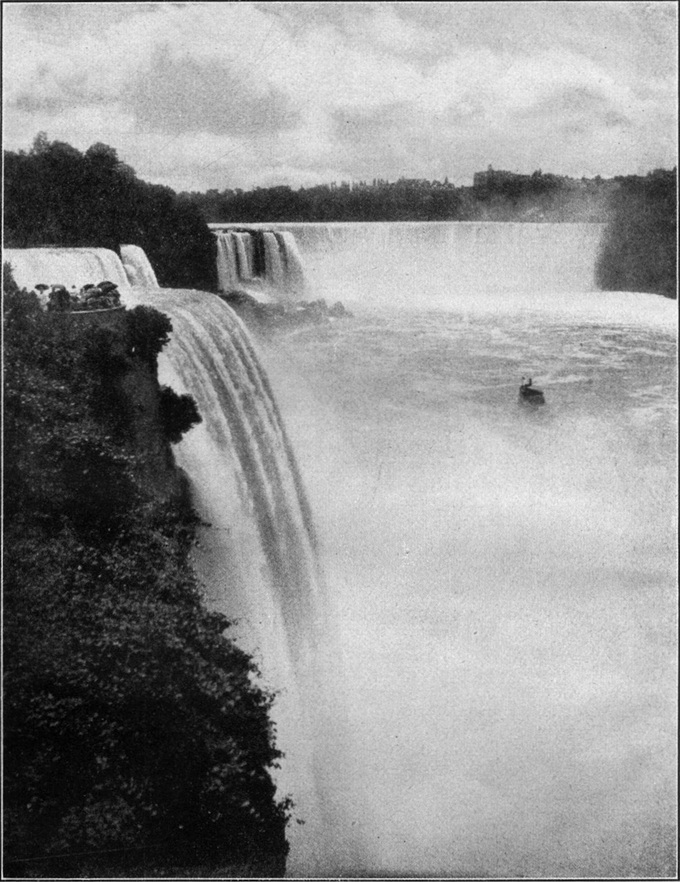
Als guter deutscher Tourist zog ich trotzalledem nachmittags dicke feste Stiefel an, hing einen tüchtigen deutschen Lodenmantel um und[S. 145] stapfte nach Mount Auburn hinaus, besah mir die einzigartig schöne Winterlandschaft und arbeitete mich bei blendendem Sonnenschein vier Stunden durch den hohen weichen Schnee von Concord nach Belmont durch und fühlte mich bei dieser Wanderung wie in den Schwarzwald oder auf den hohen Westerwald versetzt. Ja, ich hatte Lust, in diesen Tagen nach Kanada zu reisen, wo der Winter meist noch dreimal so dick ist als in Neuengland, aber ich ließ glücklicherweise den Plan einstweilen wieder fallen, denn wer weiß, wo ich in Schnee und Eis stecken geblieben wäre ...
Am letzten Abend des Jahres hatte ich noch Gelegenheit, noch einen Weihnachtsunterhaltungsabend in einem „settlement-house“ in Boston mitzumachen. In den sogenannten „Settlements“ werden Knaben und Mädchen der ärmsten Viertel von sozialgesinnten Studenten zu Klubs, Spiel, Sport und Vorträgen gesammelt, um geistiges Leben in ihnen zu wecken, Sinn für Anstand, Sitte und charaktervolles Leben in ihnen zu pflegen, ja ihnen nach Möglichkeit alles das zu ersetzen, was sie in ihren elenden und traurigen Verhältnissen daheim entbehren müssen. Also eine Arbeit ähnlich der in den Hamburger Volksheimen, die sich die settlement-Bewegung in England und Amerika in der Tat zum Vorbild genommen haben. Die settlement-Arbeiter oder „Siedler“ wohnen meist — ein großes Opfer ihres Lebens! — selbst im Klubhaus mitten in der übelsten Umgebung (dem sogenannten „slum“), um daselbst als Salz und Licht ihrer Umgebung zu wirken. Reiche Freunde unterstützen die Arbeit und erstatten den Unterhalt der Siedlung. Nach einer feudalen Schlittenfahrt im „Franklinpark“ dinierten wir mit den feinen Damen der Bostoner Gesellschaft, soweit sie zum Vorstand des Settlements gehörten, und dann ging es — ein mir nicht gerade angenehmer Kontrast! — zu den Vorführungen des armen Jugendklubs. Die Knaben und Mädchen boten allerlei hübsche theatralische Aufführungen in niedlichen, selbstgefertigten Kostümen; zum anderen Teil unterhielt die Kinder ein professioneller Komiker, der sprechend allerlei Tiere und Maschinengeräusche nachzuahmen wußte und zuletzt noch[S. 146] als Bauchredner auftrat. Nicht endenwollender Beifall der Kinder lohnte ihn. Zum Schluß gab es das in Amerika immer unvermeidliche „ice-cream“ mit Cakes! Ein derber Junge konnte es sich aber nicht versagen — der Komiker hatte es ihm wohl angetan! — einem anderen eine Portion des schönen „ice-cream“ in den Nacken zu gießen. Mein Freund setzte ihn dafür flugs und energisch an die Luft. Meist waren es Kinder armer eingewanderter Italiener, Iren, Juden und Slawen.
So ging das alte Jahr für mich drüben zu Ende. Am Silvesterabend zündete ich noch einmal meine Kerzen auf dem Kaminsims an und machte schon Pläne zu meiner baldigen großen Fahrt durch die Union, die mich bis zum Stillen Ozean führen sollte ...
[21] = Cambridge!
Aber wie zum Stillen Ozean gelangen? Ein reicher Allerweltsreiseonkel war ich ja nicht. Mein mir verliehenes amerikanisches Stipendium reichte kaum für das Studienjahr. Und einen wirklich einträglichen „job“ hatte ich nicht, seit jener „Freshman“ behauptete, mein Deutsch striche sein Professor als Fehler an! Da kam eine ernst-frohe Nachricht für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es bewahrheitete sich wieder einmal: Was dem einen sein Tod ist, ist dem andern sein Brot. Hatte ich hier in Amerika einem Onkel das Leben wiedergegeben, so starb derweilen mir eine liebe, gute, ferne Tante im Schwabenland, die mich einst als Tübinger Studenten freundlich beherbergt und an mir beifällig zu rühmen wußte, daß ich trotz all meiner ernsthaften Neigungen mit Recht „auch e bissele weltlich“ geblieben sei. Sie hatte mir nun — dafür sei ihr im Grab noch gedankt! — eine kleine Erbschaft hinterlassen, die zu einer Fahrt, wenn man es wohl einteilte, an den Stillen Ozean hin und her reichen mochte! So stand ich vor dem Entweder-Oder: Entweder das Geld zu den Wechslern zu tragen und dann mein Pfund einst mit Zinsen wieder heimzunehmen, oder es auf sehr ehrenwerte und anständige Weise hier im Lande Amerika durchzubringen, d. h. die[S. 147] Erbschaft in Geist und unwiedereinbringliche Erlebnisse zu verwandeln. Ich wählte das letztere und habe es noch nie bereut. Wer weiß, ob sie nicht sonst die Inflation verschlungen hätte. So beschloß ich, die Erbschaft zu „verreisen“. Ohne dich, liebe gute Tante, hätte ich wohl nie den Stillen Ozean und das Felsengebirge gesehen!
Nun fing ich alle Tage zu rechnen an, — aber es wollte nicht recht reichen! Denn die Fahrkarte allein nach San Franzisko und zurück kostete wohl bald dreimal so viel wie die von Hamburg zur See nach Neuyork! Denn von Boston nach San Franzisko und zurück ist ungefähr so weit wie von Berlin in gerader Linie bis nach Kapstadt oder beinahe bis nach Wladiwostock!! Ja, ich überlegte schon, ob es am Ende nicht gar gescheiter sei, von San Franzisko gleich über den Stillen Ozean, durch Japan und auf der sibirischen Bahn heimzufahren. Aber diese Route wäre noch um zwei Drittel Weg weiter gewesen. Freilich hätte ich dann einen „trip round the world“ vollendet und auch von dem Felsengebirge, dem Niagara und dem Grand Canyon erzählen können.
Mit diesen rechnerischen Gedanken gehe ich eines Tages durch die „Washingtonstreet“ in Boston und sehe in einem Reisebureau günstige Fahrgelegenheiten für Auswanderer nach Kalifornien in Gestalt von ermäßigten Rundreisescheinen „Chikago-Los Angeles-Frisko-Chikago“ aushängen — zum halben Preis! Das war etwas für mich! Ich war ja nun zwar kein Auswanderer, aber vielleicht konnte auch ich ein solches Billett kriegen. Dazu kam noch die 20stündige Reise Boston-Chikago und wieder zurück. Aber die konnte allein auch kein Vermögen kosten. So war es. Ich behielt dabei immer noch die Hälfte meines Erbes für den Tagesunterhalt. Lebte ich recht sparsam, so mochte es wohl bis nach San Franzisko reichen. Wieviel konnte ich sehen, wenn ich so die ganze Union in ihrer vollen Breite zweimal durchfuhr! Leuchtend stieg die große Reise vor meiner Phantasie auf! Fuhr ich öfters des Nachts, so blieben die Tage um so freier zu Besichtigungen. Vor meinem geistigen Auge tauchten schon die Niagarafälle, Chikago, die Indianerprärien, der Mississippi, das Felsengebirge,[S. 148] die Wüsten Arizonas und Nevadas, der Grand Cañon des Koloradoflusses, von dem ich schon geradezu faszinierende Bilder gesehen hatte, das paradiesische Kalifornien, der Pazifik, das vom Erdbeben zerstörte San Franzisko selbst, die Mormonenstadt, der Große Salzsee und wer weiß was alles auf! Ohne Zögern schritt ich tapfer in das Reisebureau hinein und erstand das preiswerte „Auswandererbillett“, einen richtigen übermeterlangen Fahrschein mit allen möglichen und unmöglichen Bahnstationen darauf und der Berechtigung auf etwa 12 000 km Eisenbahnfahrt! Mein Herz hüpfte und zersprang fast vor Freuden: Einen ganzen Erdteil sollte ich zweimal durchfahren! Wie viele in der Welt kamen mir gleich? In Harvard staunten sie über meinen kühnen Entschluß. Denn es gab nicht viele Amerikaner in Neuengland, die schon einmal bis nach Kalifornien gekommen waren! Denn wer von uns Deutschen war am Kaukasus oder am oberen Nil?
Mittlerweile war es langsam Frühling geworden. Vom Eise und Schnee befreit waren Ströme und Bäche, als ich zur „Northstation“ in Boston hinausfuhr in Richtung „Buffalo“! Der weitgereiste Freund Moore hatte mir noch viele gute Ratschläge gegeben, Adressen und Reiserouten empfohlen, mein japanischer Freund Mr. Ashida hatte noch einmal in Boston mit mir zu Abend gegessen und gab mir das Geleit bis an den Zug, dann war ich allein, ganz allein und fuhr dem „wilden Westen“ zu! Beide Freunde konnten sich wohl am ehesten in meine Seelenverfassung hineinversetzen, der eine durch seine weiten Fahrten als Dolmetscher und Führer mit Cook bis nach Italien, Griechenland und Konstantinopel, der andere kannte selbst den weiten Weg von Japan über den Stillen Ozean, das Felsengebirge und die Mississippiebene nach Boston herüber ...
Als wir fuhren, schaute ich mich zunächst in dem fürstlich ausgestatteten Pullmannwagen um. Die Decke war wie in einem Salon. Plüsch auf den Sitzen, auf die man zum Ausruhen die Beine legte (soweit hatte ich mich auch schon amerikanisiert!). Hinter jedem Sitz brannte zum bequemen Lesen eine besondere Glühbirne. Der Zug[S. 149] war gar nicht besetzt. Wenige gelangweilte Zeitungsleser saßen auf einigen anderen Plätzen in den Ecken und ließen bald ihre „papers“ zu Boden gleiten, um selig zu entschlummern, Kaufleute, Geschäftsreisende, die gewiß wie oft schon diese Strecke gefahren waren. Was ahnten die, was in meiner Brust alles vorging und wie mir das Herz klopfte: „Nun hast du die große Fahrt an den Stillen Ozean angetreten ...!“ An der Tür stand, jedes Winks gewärtig, der Negerschaffner zur Bedienung. Ab und zu kam der „trainboy“ und bot seine Postkarten, ein Dollaralbum für einen halben Dollar an, Handschuhe, Süßigkeiten, Zeitschriften wie immer. Langweilig konnte es mir auch ohne ihn nicht werden. Mir war alles interessant, was ich sah; ich schaute gespannt hinaus, solange noch etwas von der Landschaft zu erkennen war ...
Langsam senkte sich die Abenddämmerung nieder. Es war ein Nachtzug. Wir fuhren durch historische Gefilde. Im Rauch der Großstadt und ihrem unübersehbaren Häusermeer versank der schöne Frühlingstag. Wir überquerten den Charles River und rasten zwischen dem langen straßenreichen Sommerville, mit seinen unzähligen freundlichblickenden weißgestrichenen Holzhäusern und ihren offenen Vorhallen und Veranden dahin. Über die Dächer grüßte Fort Prospect Hill mit seinen steinernen Zinnen und seinem wehenden Sternenbanner, ein stolzes Wahrzeichen aus dem Unabhängigkeitskrieg. Der hohe weiße Obelisk auf Bunker Hill, wo einst General Warren und Oberst Prescott vor anderthalbhundert Jahren sich so lange siegreich gegen die Engländer behauptet hatten, blieb zurück. Wir jagten an Arlington, den Arlington Heights und der Gegend von Concord in seiner poetischen Einsamkeit vorüber. Sie waren mir von meinen Fußreisen wohl bekannt. Im Rauch der Fabriken, Schiffe und Bahnen der Boston-Bucht war inzwischen die Sonne hinabgesunken ...
Wir waren über Bostons nächste Umgebung hinaus. Hügel, Wälder und Felder mit Obstbäumen, an denen sich schon das erste Grün hervorwagte, wechselten miteinander. Aber so rechten Mut, hervorzukommen,[S. 150] hatte das Grün an den Bäumen noch nicht. Denn wie oft bricht im April noch Sturm und Schnee aus Kanada über Knospen und Blüten herein, die ebenso schnell ein plötzlicher Sommer ablöst. Wie das Klima drüben die größten Gegensätze aufweist, so sind auch die Menschen voller Kontraste. Das hartwechselnde Klima hat sie rauh, aber auch energisch gemacht. Auch hier machte das Land, wie einst zwischen Neuyork und Boston, vielfach den Eindruck des Unfertigen. Wohlangebaute und wohlausgenutzte Felder in unserem Sinn sah man selten. Wälder wechselten mit öder Steppe. Hier und da tauchten Farmen auf, manchmal auch verlassene, wo die Ausbeute sich nicht mehr lohnte. Aber man muß gerecht bleiben: Was in Europa in einem Jahrtausend erreicht worden ist, dazu war ja hier nur ein Jahrhundert Zeit zu Besiedlung und Urbarmachung eines Kontinents! So sehen wir Europäer, die wir nur an kleine, wohlgeordnete Landschaften gewöhnt sind, wo jeder Fußbreit jemandem gehört und seit Urväterzeiten umgepflügt worden ist, leicht Unordnung, Schmutz, wüstliegendes Land, Steine, verkohlte Baumstämme, unrationell abgeholzte Wälder, an deren Wiederaufforstung man kaum denkt, und übersehen die vollbrachte Leistung. Hier lag eine Mühle und da eine Faktorei, dort eine einzelne Farm und drüben ein abgelegenes Landstädtchen. Der Zug hielt selten, kaum alle dreiviertel Stunden oder alle Stunden einmal, manchmal noch viel länger auch gar nicht ...
Wir fuhren mit etwa 50 Meilen Geschwindigkeit. Die Wagen sind so fest und gutfedernd gebaut, daß man selbst bei langen Fahrten kaum etwas vom Fahren merkt. Nur ein leichtes Rollen und ein leises Ächzen der Wände verrät es. Das ist alles. Die Stationen enthalten zum Teil allerlei Merkwürdiges. Namen: Amsterdam, Utica, Rome, Syrakuse, Genf, Batavia! Alle diese Orte liegen im Staate „Neuyork“! An wundervollen Gebirgsgegenden fuhren wir vorüber, Caatskill-Mountains und Berkshire hills. Ach wer da überall wandern, die Aussichten sehen oder dort ein Zelt für ein paar Wochen aufschlagen könnte! Aber dazu reichte meine Zeit lange nicht. Da wären noch Pumas, schwarze Bären, Wildkatzen, Rotwild, Füchse, Dachse,[S. 151] Adler, Wildenten, Reiher und Haselhühner zu erlegen! Es ist die Gegend, wo einst die Mohawkindianer und Irokesen dem vordringenden Trapper, der mühsam seinen schweren Karren mit seinen Tieren durch die Täler trieb, hemmte, überfiel und erschlug, was ihm der Weiße reichlich vergalt. Aber heute ist weder von Mohawks noch Irokesen etwas zu sehen ... Nur einförmige Rauchwolken lagen über dem Schienenstrang ...
Etwa um zehn Uhr fing der Schlafwagenschaffner, der Neger, in sehr großer Gemächlichkeit und Seelenruhe an, unseren D-Wagen (die keine Abteile haben, um etwaigen Überfällen leichter begegnen zu können!) in einen Schlafwagen zu verwandeln. In äußerst praktischer Weise werden dazu von oben und unten Betten heruntergeklappt und hervorgezogen, und es wird Raum zum Schlaf für 32 Passagiere! Große grüne Vorhänge werden vor die Betten gehängt, hinter denen man sich — Männlein und Weiblein — ungeniert entkleidet. Ich klomm wie in der Schiffskabine mittels einer kleinen Leiter wieder in eins der oberen Betten empor. Denn man hat da viel mehr Raum zum Auskleiden, was einem oben sogar im Aufrechtsitzen gelingt. Unten dagegen geht es ohne Kopfanstoßen, vergebliches Hüpfen, Lupfen, Ziehen und Zerren nicht ab. Auch glaubte ich mich oben gegen etwaiges Bestohlenwerden im Schlafe sicherer. Die Wertsachen, Uhr und Scheckbuch, barg ich unter meinem Kopfkissen oder am Fenster ... und legte mich dann ruhig aufs Ohr schlafen.
Bald verrieten rings überall regelmäßige Atemzüge, daß die meisten schon entschlummert waren. Die Glühlampen waren bis auf wenige ausgelöscht ... Einsam rollte unser Zug aufwärts durch die Nacht. Nur hier und dort blinkte ein Lichtlein ... mit Dampf und Gekeuch ging es das Mohawktal hinauf. Mit ziemlicher Gewalt trommelte dabei die aus der schwer arbeitenden Lokomotive geschleuderte körnige Asche auf das Wagendach und ließ noch nicht so bald ruhigen Schlaf aufkommen ... Ich hörte, wie wir in der Hauptstadt des Staates Neuyork, in Albany, hielten am oberen einzig schönen Hudson. Auch hier mußte ich es mir versagen, auszusteigen. Immerfort ging es in[S. 152] die Nacht hinaus! Wie verschieden die Menschen doch zu Zeiten gereist sind! Zu Fuß, zu Pferd, auf dem Esel, in der Sänfte, in der alten rumpelnden Postkutsche, auf dem Segel- und Dampfschiff, und nun im Schlafwagen oder im eigenen Ford-Auto. Es war schön, so ruhend und schlafend durch eine fremde Welt gerollt zu werden! Es war ein eigenartiges Bewußtsein für mich: Da draußen kennt dich kein Mensch, und du da drinnen kennst auch keinen! Wie anders reist der Spekulant, der Geschäftsmann, der Landaufkäufer, der Farmer, der Hochstapler, der Tourist, der Novellist, der Student! Wie schön, mit frohem Gewissen und geschwellter Brust und klopfendem Herzen zu reisen, immer neuer Eindrücke gewärtig ... Um Mitternacht fielen mir endlich doch die Augen zu ...
Als ich wieder erwachte, war es schon heller schöner Morgen. Ich hatte ganz gut eine Reihe von Stunden geschlafen. Nebel wallten im Mohawktal. Wir fuhren jetzt abwärts. Ringsum frühlinghaftes Land und Sonnenschein. Aber im Schlafwagen hatte sich eine recht stickige Luft gesammelt. Einige erhoben sich schon und wandelten mit struppigem Haar oder — je nachdem — in langen Zöpfen halb angekleidet zu den Waschräumen am Ende des Wagens, wo einer nach dem anderen recht ungeniert im fahrenden Zug Toilette machte, ähnlich den Polonäsen vor den bath-rooms. Dörfer flogen währenddem draußen vorüber, aber meist wahllos, ordnungslos gebaut. Man sah Holzhäuser, nirgends Backsteinbauten. Auch die Schienen liefen über feste Holzbohlen. Was mußten hier die Wälder einmal alles hergegeben haben! Dürftige Holzgatter hielten das Vieh zusammen. Kleine Tümpel, Wäldchen; kleine äußerst einfache Holzkirchen mit goldenem Kreuz oder Knauf. Häßliche Reklameschilder an den Scheunen ...!
Wir näherten uns Buffalo am Lake Erie, einem jener großen Seen oder besser Binnenmeere, die unserer Ostsee gleichen. 440 Meilen, also etwa die Entfernung Frankfurt-Hamburg, hatte ich schon in der Nacht durchfahren. Gegen acht Uhr früh dampften wir langsam über eine Brücke, deren Einsturz bald erwartet wurde! Die Bahn ist versichert[S. 153] — das genügte der Bahngesellschaft! Früher hat man Brücken über Schluchten zuweilen einfach auf gekappte Bäume gebaut, solange sie hielten ...
Ich war in der „Büffelstadt“, in der 1901 Präsident McKinley ermordet wurde. Viele Deutsche wohnen in ihr. Nicht ganz ausgeruht, aber froh der allmählich unerträglichen Luft des Schlafwagens entronnen zu sein, verließ ich den Pullmann und reckte die steifen Glieder ...
Buffalo machte auf den ersten Anblick einen etwas düsteren Eindruck. Ich entdeckte nichts Besonderes in ihm. Wer aus dem lärmenden Neuyork und dem gebildeten Boston mit seinem „fascinating“ Harvard College, wie mir eine alte weißhaarige Dame, die Mutter eines Privatdozenten in Harvard, begeistert rühmte, kommt, dem haben mittlere Großstädte, wie Buffalo, die reine Geschäftsstädte sind, nicht viel zu sagen.
Kühn kann man behaupten, man mag einen unversehens in eine Geschäftsstraße in Neuyork, Chikago, San Franzisko, Buffalo oder St. Louis stellen — und er wird kaum zu sagen wissen, wo er sich befindet. Eine ungeheure Gleichförmigkeit liegt über allen amerikanischen Großstädten. Völlig gerade und geradlinig einander schneidende, oft für den Fußgänger schier endlose Straßen, gleich abgezirkelte Häuserblocks mit ihren Warenhäusern und Wolkenkratzern, deren wenigstens ein paar sich in jeder großen Stadt finden, machen jedes Stadtbild zum Schema. Man findet keine individuellen Straßennamen, das macht die Charakterlosigkeit des Städteeindrucks vollkommen. In der Mitte der Stadt liegt stets irgendwo die „City Hall“, das Rathaus, oder auf einer Anhöhe das Staatskapitol mit einer meist stattlichen Kuppel; dazu irgendwo ein größerer Park; in der Stadt selbst sind außer wenigen „Squares“ meist keine größeren öffentlichen Plätze vorhanden, die die Architektur der öffentlichen Gebäude zu voller Wirkung kommen ließen. Die Theater sehen von außen auch oft wenig imponierend aus und sind wie die meisten Kirchen in die Häuserfronten hineingebaut, damit das Riesenschachbrett[S. 154] der Häuserblocks ja nicht irgendeine malerische Unterbrechung erfährt. Fast in allen Hauptstraßen fahren wie bei uns elektrische Straßenbahnen, deren Wagen aber meist länger und schwerer sind als bei uns; irgendwo rasselt auch eine Hochbahn ohrenbetäubend auf ihren Eisengerüsten daher und nimmt das letzte Licht, das die Wolkenkratzer noch in den Straßen gelassen haben, hinweg, oder in unterirdischen Tunneln braust ein subway, der hier und da wie ein geheimnisvoller Maulwurf seine Hügel in den Straßen in Gestalt kleiner gläserner Eintrittshallen zu den unterirdischen Stationen aufgeworfen hat. Zeitungsjungen laufen die Straßen entlang und schreien ihre papers aus, die in riesigen roten Lettern irgendeinen Streik, ein Schiffsunglück oder einen Mordprozeß ankündigen, meist mit viel Übertreibung. Sind irgendwo ein paar Arbeiter ausständig, so heißt es in der Zeitung „big strike and riot“. Ehescheidungsprozesse, Sensationen, Brände, Gesellschaften der Society-Leute, Gerichtsverhandlungen und Sportnachrichten nehmen fast allen Raum ein. Das Politische kommt oft recht zu kurz oder ist in kleine persönliche Geschichtchen zerstückelt. Automobile tuten an allen Ecken, Schutzleute mit Pfeifchen dirigieren den Verkehr an den Straßenkreuzungen. Das ist so der äußere Eindruck der amerikanischen Großstadt, auch Buffalos.
Darüber hinaus weiß ich von Buffalo nicht viel Individuelles zu erzählen. Alles Historische fehlt ja in Amerika, zumal wenn man den Osten verläßt. Dann steht man überall auf allerjüngstem Boden. Man kann in Amerika nirgends nach alten Schlössern und malerischen Stadtumwallungen, nach zackigen Türmen oder gotischen Kathedralen, nach historischen Gebäuden und alten Rathäusern, selbst nicht überall nach Kunstgalerien und weltberühmten Museen forschen. Alles das fehlt! All der historische und geistig kulturelle Zauber, wie ihn eine tausendjährige Geschichte über die Städte Europas gebreitet hat, fehlt: Hier ist weder ein Florenz noch Rom, weder Straßburg noch Nürnberg, weder Paris noch London. Eins ist hier allbeherrschend, das ist der „Busineß-Geist“. Hier ist Pionierland und immer noch quantitative[S. 155] Anfangskultur. Die amerikanischen Großstädte, vielleicht eine einzige, Washington ausgenommen, sind Geschäftsstädte.
So war in Buffalo selbst nicht viel, was mich anzog. Ungeheuer schnell ist es in wenigen Jahrzehnten emporgewachsen. Vor dreißig Jahren sind noch viele Deutsche hier eingewandert. McKinley wurde, wie gesagt, hier ermordet, und ein Indianerhäuptling hat hier ein Denkmal in einem Friedhof der Stadt. Das ist seine Geschichte. Ich nahm deshalb am Bahnhof sofort die Straßenbahn, um hinaus zu den Niagarafällen zu fahren. Einkehr hielt ich nahe den Fällen in einem schlichten deutschen Pastorat, wo deutsche Familiengemütlichkeit mich wundersam in der amerikanischen Umgebung umfing. All das Unruhige der reklameschreierischen Großstadt, alle die Läden und Banken, Trust-Compagnies und Warenhäuser samt den Alleen der Vorstädte und ihren oft hübschen Wohnsitzen blieben hinter mir, und ich suchte meine Zuflucht für einige Stunden wieder einmal auf einem Fleckchen Deutschland, wo ein deutscher Professorensohn und eine deutsche Professorentochter als deutscher Pfarrer und Pfarrfrau neben ihrer netten, aber doch bescheidenen Holzkirche hausten ...
Die beiden Pfarrersleute sind auf eine merkwürdige Weise dahingekommen. Er hatte nie in Deutschland richtig sein Abitur gemacht, sondern war nach seiner Ausbildung auf einem Seminar (um zuerst Missionar zu werden) „hinüber“ gegangen samt seiner Braut, der einzigen Tochter eines bekannten Nationalökonomen in einer Universitätsstadt Mitteldeutschlands, so wie er auch der Sohn eines bekannten Universitätstheologen derselben Stadt war. Sie hatten von Jugend auf in derselben Straße miteinander gespielt und sich früh kennen und lieben gelernt. Die Eltern wollten die Verbindung beider erst nicht recht zugeben. Auch daß der Heidenmissionar zum smarten Amerikaner wurde, paßte ihnen gar nicht. Aber allemal ist der Wille der Kinder ja stärker als der der Eltern. So fuhren sie ohne große Mittel und ohne zu wissen, wohin und wo bleiben, übers große Wasser und fanden wie alle drüben ihren Platz. Erst wurde er Pastor einer deutschen Gemeinde in Illinois, dann in Iowa mit nur etwa 250 Dollar[S. 156] Jahresgehalt. Und nun hier am Niagarafall. Eine solche kleinere Gemeinde setzt echt amerikanisch voraus, daß ihr trotz seiner kleinen Gemeinde viel beschäftigter Pastor noch allerlei Nebenerwerb betreibt, mit dem er das Fehlende seines Gehalts selbst dazu verdient, wobei kein Arbeitszweig schändet.
Traulich war es wieder einmal an einem deutschen Familientisch zu sitzen und wieder einmal deutsch zu reden. Freilich die in Amerika geborenen Kinder des Pastors empfanden ganz amerikanisch und sprachen untereinander nur englisch; nur den Eltern antworteten sie noch aus schuldiger Rücksicht deutsch. Aber auch der Hausfrau entschlüpften dann und wann in ihrer deutschen Unterhaltung die englischen Fachausdrücke: „Bitte, kommen Sie in den parlor!“ (Empfangszimmer). — „Hier hat uns der Maler die Stube gepaintet“ (paint malen). — „Wünschen Sie noch etwas jam?“ (Gelee). — „Nicht wahr, in Buffalo ist auf den Straßen immer ein mächtiges crowd?“ (Gedränge). In diesem Stil ging es fort. Aber wie erfreut waren sie doch, daß ich, obwohl so ganz unangemeldet, zu ihnen kam! Ich kannte des Hausherrn Schriften und konnte ihm erzählen, daß ich noch bei seinem Vater an der Universität Vorlesungen gehört hatte! Dann tauschten wir gemeinsame Erinnerungen an Saalefahrten, deutsche Studentenverbindungen, und über Deutschland im allgemeinen aus. Er wußte nicht genug die Treue und Anhänglichkeit seiner Gemeindeglieder, die alle aus einfachem Stande waren, deutsche Holzarbeiter, Zimmerleute, Straßenbahner usw., zu rühmen, etwa 150 Familien, die die ganze Kirche samt Pastor unterhielten. So hatte ich auch in dem Schaffner der Straßenbahn, die mich hinausführte, einen alten Württemberger entdeckt. Aber keiner von ihnen allen wollte wieder in die alte Heimat zurückkehren!
Als ich mit dem deutschen Pastor in seiner kleinen hölzernen Kirche stand, wie rührend überkam mich da die Schlichtheit, die mich umfing! Die einfachen Bänke und die Kanzel und der Sonntagsschulsaal und die bescheidenen Gemeinderäume ...! Sogar eine große Küche war hinten angebaut, wo allmonatlich eines Abends für[S. 157] Arme eine eigene „patentierte“ dicke Suppe gekocht wurde, die außen an der Kirche durch ein aushängendes Schild der Gemeinde und den Umwohnenden angezeigt wurde. Sie war außerordentlich beliebt und wurde gern gegessen und gekauft. Aus diesem Suppenabend sprang dann meist noch ein beträchtlicher Gewinn für die Gemeindekasse heraus! Die Gemeinden drüben fühlen sich viel mehr als Familie als bei uns. Man kennt einander genau. Man pflegt aber auch öfter die Kirche zu wechseln. Die Kirche ist oft der einzige Zusammenschluß, den man hat; sie vertritt die Gesellschaft. Nun ist aber die Erhaltung speziell der deutschen Kirchen ein großes Problem. Die zweite und dritte Generation ist ja fast immer schon völlig amerikanisiert und versteht oft kaum noch Deutsch. Die „deutschen“ Kirchen können auf die Dauer daher nur als Missions- und Übergangskirchen für die Einwandernden angesehen werden. Denn alle Nationalitäten amerikanisieren sich hier über kurz oder lang völlig. Der deutsche Charakter, Gemüt und Tüchtigkeit mag sich auch unter der englischen Zunge erhalten oder ein Ferment in dem sich bildenden amerikanischen Nationaltypus sein. Aber ausgeprägtes Deutschtum als solches und als Bestandteil für sich hat auf die Dauer im amerikanischen Volkskörper wenig Zukunft. Nicht anders ergeht es dem Irischen, Italienischen oder Griechischen drüben.
Am Nachmittag machte mein Gastgeber sich mit mir auf den Weg, mir eines der imposantesten Naturschauspiele der Erde zu zeigen, die es gibt, den Niagarafall. Der Niagara selbst ist ein breiter, nur einige Meilen langer Flußkanal, der den Eriesee mit dem Ontariosee verbindet. Auf halbem Wege stürzt dabei der imposante Fluß über eine fast anderthalb Kilometer breite und 50-60 Meter hohe Felsenwand hinab in zwei durch eine breite Insel geschiedenen nebeneinanderliegenden Fällen. Seit meiner Jugend klang mir das alte indianische Wort „Niagara“ wie ein Zauber im Ohr. „Niagara“, Donner der Gewässer, ist nicht das einzige indianische Wort, das sich erhalten hat.
Wie würde der Niagara wohl aussehen? Ich erinnere mich wohl, Bilder von ihm in früheren Jahren gesehen zu haben, aber sie waren mir doch nicht mehr ganz deutlich in Erinnerung. Nun sollte ich ihn[S. 158] selbst in Wirklichkeit sehen. Sagenumwoben sind seine „donnernden Gewässer“; jährlich verschlingen sie zwei Opfer nach der indianischen Sage, und jährlich muß nach altem Glauben ein reines Mädchen im gebrechlichen Kanoe den Fall hinuntergesandt werden, aus dem sie nimmer lebend entrinnt, um die Geister des Stromes günstig zu stimmen! Jährlich — aber das ist die rauhe Wirklichkeit — verschlingt der Niagara mehrere Menschen, die in ihm verzweifelt den Tod suchen und von seiner schauerlichen Macht magisch sich angezogen fühlen. Die Geliebte eines modernen deutschen Dichters und Dramatikers stand am Rand des Falls und war so in seine brausende Gewalt versunken, daß man sie mit Gewalt davor bewahren mußte, sich nicht auf der Stelle in ihm den Tod zu geben. Andere fühlten sich zu den tollsten Wagnissen gereizt; auf Drahtseilen haben Seiltänzer die Fälle überschritten, in einem Faß hat sich einer die Stromschnellen hinabtreiben lassen und ist mit dem Leben davongekommen, und hat fortan seinen Lebensunterhalt damit verdient, daß er sich mit seinem Faß für Geld sehen ließ!
Wir hatten uns erst durch die Stadt „Niagara Falls“, die sich dicht an den Fällen angebaut hat, samt all ihren Hotels, Basaren, Ständen, Droschken, Autos, Führern und Händlern durchzuwinden, — ach, daß in aller Welt Händler und Marktleute die gewaltigen Naturschönheiten gerade als ihren besonderen Raub betrachten und, während man sich von dem „Donner der Gewässer“ betäuben lassen möchte, einem unaufhörlich mit Donnerstimme ihre oft unschönen Ansichtskarten anpreisen und einem als Führer fast den Weg versperren! — bis wir auf einmal wunderbar frische Luft atmeten, ein feiner Wasserstaub herübersprühte, ein ungeheures Donnern, das mit jedem Schritt zunahm, sich hörbar machte, — wir waren in den Anlagen dicht an den Fällen! Noch ein paar Schritte, und links bot sich der erste Blick auf den amerikanischen kleineren Fall. Von oben gesehen übt er nicht seine volle Wirkung. Geht man aber tief bis auf das Niveau seines unteren Endes hinunter, so spürt man erst die erdrückende Gewalt der herniederdonnernden Wassermassen.
[S. 159]
Nun bot sich uns bei unserem Besuch noch ein besonders eigenartiges Schauspiel. Es war Anfang April. Die Sonne schien freundlich warm. Rings sproßte es in tiefem, frischem Grün an Baum und Strauch: Weite Wiesenflächen zwischen Baumgruppen in entzückendem Grün — aber im Niagarastrom war noch Eis und Schnee. Wie ein mächtiger Gletscher türmten sich die Schnee- und Eisschollen vom noch weithin zugefrorenen Flußbett den donnernden, schäumenden Wassern entgegen. Man konnte sich auf dem Eis am Ufer ein Stück weit auf den Fluß hinauswagen und trotz der warmen Frühlingssonne eine Schnee- und Gletscherpartie unternehmen, Schneehügel emporklimmen und sich von den Wolken voll Wasserstaub überschütten lassen und von unten hinaufsehen zu den unablässig herniederstürzenden und wieder aufschäumenden Wogen. Es gibt viele großartige Wasserfälle in der Welt, in der Schweiz und in Italien; aber der Niagara übertrifft sie doch alle weit mit der ungeheuren Masse seines Wassers. Den überwältigendsten Eindruck macht der kanadische Fall, der noch dreimal so breit als der amerikanische und von ihm durch die breite Felseninsel völlig geschieden ist.
Aus der Gletscherregion stiegen wir wieder empor in die Frühlingssonnenwärme und zu den frischen grünen Wiesen hinan — ein Kontrast, wie man ihn nur an einzelnen Punkten in den Alpen erleben kann, wo ziemlich plötzlich der letzte Schnee den grünen Matten Platz macht. Wir nahmen unseren Weg nun hinüber auf die breite, waldige, jetzt wohlgepflegte Insel „Goat Island“, die die beiden Fälle voneinander scheidet. Auf sanften Wegen kann man hier sich jetzt zu Fuß und Wagen ergehen. Aber wie muß es einst hier gewesen sein! Als noch keine Eisenbahnbrücke den Strom überspannte, noch keine Geschäftsstadt sich am Fall angebaut hatte, noch keine Fabriken ihre rauchigen Schornsteine über die Felsen reckten, gierig, die unausschöpfbaren Urkräfte zu nutzen, als dichter, schier undurchdringlicher Urwald die Ufer und diese Insel säumte, die wohl vermutlich nie ein menschlicher Fuß betrat, als nur hin und wieder ein Indianer scheu das Dickicht durchbrach und mit Entsetzen diese donnernden Gewässer erschaute[S. 160] und zitternd die Kunde ins Dorf und zu dem Stamm brachte und man dann in Haufen aufbrach, die Wunder der Götter und Geister zu schauen und den Donner ihrer Stimme zu vernehmen, und der Häuptling, am Fluß angekommen, in vollem Schmuck die Zweige auseinanderbog und der Majestät der Natur ins Auge schaute ...
Das obere Ende dieser „Ziegeninsel“, der vier kleine Felsinselchen vorgelagert sind mit den poetischen Namen „Three Sisters and little Brother“, eröffnet einen ganz unerwarteten Blick auf den riesig breiten Niagarafluß oberhalb der Fälle, wo er mehrere Kilometer breit mit seinen schäumenden, rauschenden Stromschnellen und seinen darüber kreisenden Möwen fast den Eindruck eines wogenden Meeres macht. Rollend und brausend rauscht der gewaltige Strom, mit Eisschollen bedeckt, die in den Fällen an den Felsen zerschellen, daher, ein tobendes Gewässer. Nur noch wenige hundert Meter — und die Wasser neigen sich über die Felskanten hinab im tosenden Fall ...


Den Niagarafluß, oder besser gesagt die Niagaraschlucht, unterhalb der Fälle entlang hat man auf beiden Seiten eine elektrische Ringbahn gebaut, die auf gefährlichem Pfad, dicht zwischen dem tosenden Fluß und den steil abstürzenden Felsrändern hinführt und den besten Blick auf die Stromschnellen unterhalb der Fälle gewährt. Der oben mehrere Kilometer breite Strom wird unterhalb der Fälle in eine enge, noch nicht hundert Meter breite Felsschlucht zusammengezwängt, in der er eine furchtbare Tiefe annimmt und in der sich die Wasser mit unablässigem Schäumen und vielen mächtigen wilden Strudeln fast konvex zusammentürmen und -zwängen, bis sie in einen fast kreisrunden Teich gelangen, den sogenannten „Whirlpool“, wo sie ans Land spülen, was sie in ihrer tollen Fahrt über die Fälle mit heruntergerissen haben, es seien Baumstämme oder Menschenkörper. Auf leichtbeschwingter Brücke — es führen deren einige in mehr oder weniger vollendeter Eisenkonstruktion über die Felsschlucht — setzt die Gürtelbahn über den Strom und führt durch schöne Haine von hohen Lebensbäumen, aus denen sich ein entzückender Rückblick auf den sich wieder in sanfterem Hügelland verbreiternden Fluß und die in duftigem[S. 161] Dunst leise sich andeutenden Uferlinien des Ontariosees ergibt, hinauf zu der stolzen Denksäule des im amerikanischen Krieg 1812 gefallenen englischen Generals Brockes. Auf der wohlangelegten, von der amerikanischen wohl abstechenden kanadischen Seite geht es dann durch gut gepflegte Parkanlagen, die noch manchen reizvollen Blick hinunter auf die Stromstrudel und hinüber auf die amerikanischen Felsen mit ihren wie Hephästus’ Werkstätten rauchenden und feuerspeienden Eisenwerken bietet, zurück zum kanadischen Fall. Je näher ich ihm wieder kam, bis ich seine ganze ungeheure, an einen Kilometer fast fassende Breitseite, die mit immer neu aufsteigenden, fast undurchdringlichen Wasserstaubwolken geheimnisvoll verhüllt ist, vor mir hatte — da war ich von der Macht der brausenden, mit ihrem verhaltenen gebrochenen, wie von Bergsprengungen herrührenden Donner doch überwältigt. Was ich beim amerikanischen Fall noch vermißte, das fand ich hier alles. Diese ungeheuren Gewalten, die sich hier entfalten, lassen sich nicht beschreiben. Unausstehlich war nur das Gehämmer der Bohrarbeiter in der Nähe an den Felsen herum, ihre schrillen Pfiffe, das Surren der Maschinenräder, fortgesetztes Hämmern und Klopfen. Aber was bedeutet all dies menschliche Kratzen und Pochen an dem Urgestein gegenüber der Macht, die da drüben seit Jahrtausenden täglich sich frei auswirkt?
Man kann auch in die Felshöhlen unter dem amerikanischen Fall mit Führer auf schwankenden Treppen und Stegen gelangen, wobei die Teilnehmer ganz in Gummi gehüllt sich — soweit schwindelfrei — an den Händen fassen. Aber erstens war zu meiner Zeit noch alles vereist, und zweitens hätte ich mir doch überlegt, ob ich meine Nerven riskieren soll. —
So fuhren wir wieder heim ins Pastorat. Auf der Elektrischen traf ich am Bahnhof einen Westpreußen aus Elbing. Er fragte mich, wie mir die Fälle gefallen hätten? Aber diese Frage war immer noch verständiger als die andere, ob man in Deutschland auch schon Dampfheizung oder elektrisches Licht und Straßenbahnen und Automobile habe, ob auch hohe Häuser und große Läden da seien, und wie schnell[S. 162] die Bahnen führen, ob sie so gut und bequem seien wie in Amerika, und ob man im Winter auch wirklich warme Zimmer habe! Die ausgewanderten Deutschen kennen oft nur noch ihr Deutschland von vor fünfzig Jahren, da man bald noch mit der Post fuhr und Petroleumlampen brannte, und nun meinen sie, das gelobte Land Amerika allein besitze Technik und Kultur in der Welt!
Die nächste Nacht schlief ich wieder einmal in einem weißüberzogenen Bett bei den gastfreien gütigen Landsleuten. Mit dem Frühesten ging es wieder nach Buffalo hinein, wo gegen acht Uhr der Zug nach Chikago abging, der über Detroit dort abends um elf Uhr (!) eintreffen sollte! Diesmal bestieg ich nicht den Pullmann, wo man Bad, Schreibtisch, Telephon, Barbiersalon usw. benutzen kann, sondern einen Auswandererzug der billigeren Wabashlinie, deren große D-Wagen mit auszieh- und drehbaren plüschbezogenen Lehnstühlen auch noch bequem genug ausgestattet waren. Auch in ihm konnte man nach Belieben sitzen, liegen, essen und schlummern. Die Fahrt war dementsprechend billiger, zwar auch dafür ein klein wenig langsamer. Aber ich hatte ja Zeit. Also in fünfzehn Stunden von Buffalo nach Chikago! Die Mitreisenden waren aus einfacheren aber mir interessanten Ständen: Einige handfeste Schweden mit Familien saßen im Wagen. Den großen starken Menschen hing zwar — wenig amerikanisch! — hinten das Blusenhemd aus dem Hosengürtel. Das kümmerte mich aber wenig. Neben mir aßen sie faustdicke Brotscheiben mit fingerdickem Käse darauf. Das kümmerte mich schon ein wenig mehr! Obwohl Amerika vom schönsten Obst förmlich birst, kosteten doch zwei Äpfel im Zuge beim trainboy 10 Cent (50 Pf.)! An jeder Wegkreuzung prustete die Lokomotive keuchhustenartig ihr Warnungssignal in die Ferne. Auch dieser Zug hielt selten, die Stationsbahnhöfe — natürlich Detroit ausgenommen — waren merkwürdig primitiv.
Die donnernden Gewässer des Niagara lagen hinter mir. Langsam rollten wir über die lange Brücke, die den Strom überspannt, ins englische Kanada hinein. Von einer Zollrevision merkte man fast nichts. Dann gings durch unendliche Ebenen, die sich nun ohne Unterbrechung[S. 163] Tausende von Meilen weit bis an die Rocky Mountains erstrecken. Diese unendlichen Ebenen des Mississippistromgebietes sind die Quellen von Amerikas Reichtum. An den Seen gibt es Kohle, Eisen, Kupfer und Blei, in den „Weizenstaaten“ vermag soviel Korn zu wachsen, um die ganze Menschheit zu ernähren. Farmland an Farmland. Hier besitzt man nicht zwei, drei Äcker, sondern 500 bis 1000 „acres“, deren jeder einen halben Hektar ausmacht. Wie muß sich hier der deutsche Bauer fühlen, der aus den engen Grenzen seiner alten Heimat kommt! Eins ist es hier vor allem, das jeden Fremdling in Erstaunen setzt, die Ungeheuerlichkeit des Landes; wohl an zwanzig Deutschland gehen ja auf den Flächenraum der Vereinigten Staaten, die eher mit einem Kontinent denn mit einem einzigen Land verglichen werden müssen. Der Staat Texas allein übertrifft unser Deutsches Reich an Größe, und viele der großen westlichen Staaten kommen ihm an Größe fast gleich. Reist man bei uns Stunden, um das halbe Land zu durchqueren, so hier Tage. Und doch zählt die Union erst hundert Millionen Einwohner. Welche Zukunft und welches Bevölkerungswachstum mag ihr noch bevorstehen! So wächst hier der Unternehmungsgeist und die Energie ins Fabelhafte. Ungeahnte Möglichkeiten und Chancen tun sich überall auf. Alles das ist faszinierend für den Auswanderer, der sich hier ein neues Leben und sein Glück sucht. Die alten Brücken zur Heimat werden zunächst abgebrochen. Der Anfang ist zwar schwer, bis man sich in die neuen Verhältnisse und die neue fremde Sprache eingelebt hat, aber dann, nach fünf, zehn Jahren beginnt man Boden unter den Füßen zu fühlen. Stolz sucht man jetzt von dem Erfolg in die Heimat zu berichten, die alten Fäden wieder anzuknüpfen. Bald geht man ein-, zweimal selbst wieder übers Meer, die alten Verwandten wieder zu sehen, und ihre eisernen Öfen, die harten Holzbänke in der langsamen Eisenbahn und das Fehlen des Badezimmers mit warmem und kaltem Wasser zu verspotten und sich zu freuen, wenn man wieder in den blauen Hafen Neuyorks einfährt, die Wolkenkratzer ihre Konturen am Himmel abzeichnen, die Freiheitsstatue ihre Fackel[S. 164] über die Bai reckt und man den Fuß wieder in das gelobte Land des Dollars setzen kann.
Das amerikanische Leben ist ja auch ungeheuer beweglich. Der Vater war vielleicht noch deutsch und ein rechter Bauer, der Sohn geht schon aufs Kollege, ist Amerikaner und siedelt sich in der Großstadt an oder geht weiter westwärts. Typisch ist dieser Zug für Amerika „westwärts“ zu gehen. Von Anbeginn ging man „westwärts“, erst den Hudson hinauf, dann über die Berge an die Seen, dann bis Chikago, dann schritt man über den Mississippi, und dann wagte man sich in die Rockies, und schließlich faßte man Fuß in Kalifornien. Scherzweise hat man gesagt, der Amerikaner will in keinen Himmel kommen, wo man nicht weiter „westwärts“ gehen kann. Das 18. Jahrhundert lebte im wesentlichen noch im Osten in den dreizehn alten Staaten, das neunzehnte faßte Fuß in den ungeheuren Mississippiebenen, das zwanzigste wird den Westen kultivieren. In Ägypten schauen vergangene Jahrtausende von den Pyramiden auf ein starres Land herab, in Amerika schauen kommende Jahrtausende von den Wolkenkratzern auf ein ungeheuer bewegliches und vielgestaltiges Leben. Hier ist alles anders als in den alten Ländern. Hier genoß kein König und Kaiser Ehrerbietung, hier war keine Kirche, die vom Staat ihre Steuern eintreiben läßt, hier waren keine Stände mit besonderen Vorrechten, keine Orden, die den Beamten schmücken. Frei war das Volk, frei der Mann in seiner Selbstachtung und der Achtung anderer, völlig auf sich selbst und seine Arbeit angewiesen und darauf, wieviel er selbst aus sich machen kann ohne Pension und Altersversorgung. Daher auch die Jagd nach dem Geld. Selbst die Politik und die öffentlichen Ämter sind oft ein Spielball in der Hand derer, die möglichst viel für die eigene Tasche herauszuschlagen suchen. Ungeheurer Reichtum überall. Schnellste Lebenskarrieren, vom Straßenjungen, der Zeitungen verkauft, auf zum Inhaber der größten Zeitung in einer Großstadt, vom Farmerkind zum Professor in Harvard. War nicht Roosevelts Karriere eine der typischsten? Kaum vom Kollege graduiert, ist er schon Magistrat in Neuyork; wenige Jahre[S. 165] später ohne jede militärische Laufbahn Reiteroberst und Sekretär der Marine und bald darauf Präsident des Landes! Man wechselt und wandert, wie es die Gelegenheit gibt, heute Student, morgen Professor, heute clerk und morgen trustee, bald im Osten, bald im Westen. So hat sich in den Vereinigten Staaten kein Provinzialismus und wenig Gauindividualität entwickeln können, und Dialektunterschiede existieren fast nicht oder sind wenigstens mit den ausgeprägten in den europäischen Ländern gar nicht zu vergleichen. Die ganze Union spricht eine Sprache.
Indessen fuhren wir durch die sich überall ungeheuer gleichenden Ebenen Stunden für Stunden. Eine Abwechslung bot nur der kleinere Lake St. Clair mit seinen gelbbraunen, sich ins Uferlose erstreckenden Wasserflächen, über denen schwere Regenwolken hingen. Ein paar Fischerhütten am Strand, eine kleine Steinkirche zeigte sich; unter grünen Pappeln ein steinernes Häuschen. Am Strand ein altes Kanoe und ein paar Männer, die ihre Netze ausgeworfen hatten. Auf dem Flurland dicht neben der Bahn ein Farmer mit seinem Pflug. Die Pferde bäumten sich wild auf, als der Zug vorbeibrauste. Indessen turnte der schwarze Kellner aus dem Speisewagen den Mittelgang der Wagen entlang und rief monoton sein first call for „luncheon“ aus. So kamen wir um Mittag nach Detroit. Die amerikanischen Zolloffiziere gingen durch den Zug. Auf einem Trajekt setzten wir über den Endzipfel des Sees. Dann ging es wieder weiter durch endlose Strecken Michigans und Indianas gen Chikago, wieder auf amerikanischem Boden.
Hie und da lag eine einsame Station, alle halbe oder ganze Stunden. Überall war fruchtbares Ackerland, das wohlgepflegter aussah, als um Buffalo. Es wohnen hier viele Deutsche. Hie und da an der schlechten Landstraße, die neben der Bahn herlief, ein Blechpostkasten einer entfernten Farm, der als Briefablage und -aufgabe zugleich dient. Kleine Haine, übel zugerichtet. Hier existiert ja keine Forstpolizei, und erst neuerdings gibt es Staatsschutz für den Wald.
So wurde es Mittag und Nachmittag und Abend, und noch immer[S. 166] dieselbe Landschaft. Fast alles noch braun und dürr, weil es noch früh in der Jahreszeit war. Hie und da ein blühendes Bäumchen auf der Flur wie ein Kuß Gottes auf die Frühlingserde. So wurde es Abend und Nacht. Am Himmel standen hell und klar die Sterne, dieselben Sterne, die jetzt auch über Deutschland standen. Im Wagen schliefen schon die meisten; die bequemen Chairs gestatten es, sich weit zurückzulehnen. Und als wir uns endlich nach fünfzehnstündiger Fahrt Chikago näherten, war es fast Mitternacht geworden. Viele hellerleuchtete Vororte flogen an uns vorüber. Elektrische Lampen erhellten die Bahnhöfe, Straßen und Fabrikviertel — und ein brennendes Haus, in das die Feuerspritzen ihre Wasserstrahlen sandten, leuchtete wie eine Riesenfackel schaurig durch die Nacht. So tüchtig und ausgezeichnet die amerikanischen Feuerwehren sind, so oft brennt es hier; manchmal sind schon halbe Städte einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen, so Chikago 1872.
Und nun kam ich wirklich in die Stadt, deren Namen eine so eigenartige Nuance des typischsten unbegrenztmöglichen Amerikanertums für unser Ohr bekommen hat. Chikago zählte 1831 noch hundert Einwohner! Einst war es ein Fort gegen die Indianer, und heute ist es mit bald vier Millionen die viertgrößte Stadt der Welt, an Flächenraum viermal größer als Berlin, mit einer Wasserfront von 35 Kilometern Länge am See Michigan, der uferlos wie das Meer aussieht. 40 Sprachen werden in Chikago gesprochen. Etwa 600 000 Deutsche leben in der Stadt, und vielleicht nur ein Zehntel ist in Chikago selbst geboren.
Ich war in Chikago! Wachte oder träumte ich? Auf dem Schiff hatten sie manchmal begeistert ein Lied Chikagos zu Ehren im Chor gesungen, das ich aber damals nicht recht behalten habe. Zum Schluß jeder Strophe kam immer wieder als Refrain von wildem Beifallsgetrampel und -händeklatschen begleitet: „O Chikago, o Chikago ...!“ Und dann ging es so weiter, daß ihm in der Welt nichts gleich sei! Ich war in Chikago, der Stadt mit den meisten einlaufenden Eisenbahnzügen, wo zirka 500 Personen im Jahr durch Autos ihr Leben[S. 167] verlieren, wo 40 000 Schutzleute den Verkehr dirigieren, wo in einem einzigen der großen Warenhäuser ¼ Million Kunden ein- und ausgehen, wo neben 10 000 Angestellten allein über 500 Feuerwehrleute ständig Wachtdienst tun, wo täglich Hunderttausende Stück Vieh ihr Leben lassen und zu Konservenfleisch und Wurst verarbeitet werden, wo man einen ganzen Fluß, den Chikago-River, gezwungen hat, in seinem Lauf wieder umzukehren und seine verdorbenen Wasser statt in den See zu ergießen, dem Mississippi zuzuführen und so Typhus und Cholera fast verbannt hat! Nun kam ich wirklich in diese merkwürdige Stadt ...
Einer meiner beiden Chikagovettern empfing mich liebenswürdig in der „Illinois Central Station“ mit ihrem verwirrenden ohrenbetäubenden Getriebe. Ach, wie reckte ich die Glieder nach der fünfzehnstündigen ununterbrochenen Bahnfahrt, die mich trotz des bequemen „reclining chair“ recht steif gemacht hatte. Immerhin war es eine gute Vorübung für die noch dreimal längeren Bahnfahrten, die mir hinter Chikago bevorstanden!
Jetzt war ich in Chikago bereits 1000 km vom Atlantischen Ozean entfernt, aber immer noch 3000 km vom Stillen! Wie angenehm empfand man das freundliche Empfangenwerden durch liebe Verwandte zumal in so später Nachtstunde in der riesigen Weltstadt, freilich durch Verwandte, die ich noch nie im Leben gesehen hatte, die ich nur vom Hörensagen kannte. Sie alle hatten ihren typisch-amerikanischen Entwicklungsgang durchgemacht, aber sich alle auch zu angesehenen Stellungen selbst emporgearbeitet. War es in Neuyork die Musik, in Boston die Medizin, so waren es in Chikago Juwelen und das unvermeidliche Auto, das ihnen Wohlstand und Brot gegeben.
So fuhr ich denn mit meinem neugefundenen Vetter zunächst mit der Hochbahn aus der City und ihrem Trubel, ihrer blendenden Lichtreklame, durch dunkle, schmutzige Viertel, an zahlreichen Wolkenkratzern vorüber — die freilich noch nicht die wahnsinnige Höhe der Neuyorker erreichten — schöne Alleen hinaus in den freundlichen Villenvorort Oakpark, wo mein Vetter mit seiner Familie ein gutausgestattetes[S. 168] Landhaus bewohnte mit dem typisch-amerikanischen Meublement, das stets das gleiche ist, ob man in Neuyork einkehrt oder in San Franzisko, in Chikago oder St. Louis. Amerika bleibt eben überall das gleiche Amerika. Die alles nivellierende Fabrikware hat hier ihren völligen Sieg erfochten.
Bald hatte ich die Ehre und Freude, auch wieder eine neue Cousine kennenzulernen, eine geborene Amerikanerin, die kaum ein Wort Deutsch verstand ...
Andern Tages ging es gleich wieder an meine „Arbeit“ des Besichtigens, in möglichst kurzer Frist viele wichtige Eindrücke in mich aufzunehmen. Also fuhr ich andern Tags sogleich nach dem Frühstück, mit Reiseführer und Karte in der Hand, mit der „elevated“ hinein in Chikagos Großstadtgewühl! Und es übertrifft an manchen Stellen noch dasjenige Neuyorks! Über, unter, neben dem Kopf rollt, rast, saust, klingelt, tutet, pfeift es überall. Alles ein ununterbrochenes Gelaufe und Gerenne! Es dampfen die Wolkenkratzer. Die Warenhäuser speien ständig Hunderte und Tausende von Menschen aus, um andere ebensoviele wieder einzusaugen. Die Amerikaner kommen aus dem Felsengebirge, ja aus Seattle in Alaska und aus San Franzisko, um in Chikago bei „Siegel u. Cooper“ oder „Marshall Field u. Co.“ einzukaufen! Dies „shopping“ ist ein Hauptvergnügen amerikanischer Damen.
Welchen Eindruck machte Chikago auf mich, das Neuyork des mittleren Westens? Eine ungeheure, etwas düstere Großstadt mit Hochbahngerassel und Automobilgetute, Wolkenkratzern, die die Geschäftsstraßen zu Schluchten verengen, mit Bank an Bank, Geschäft an Geschäft, lunchroom an lunchroom, „moving pictures“ an „moving pictures“. Das ist die City. Auch hier wie überall. Bei Tage ein ungeheuer lebendiges Treiben von den höchsten Stockwerken der „office-buildings“, zu denen sieben bis zehn Aufzüge gleichzeitig auf- und niederfahren, bis herunter auf die Straße und ihr Gewimmel. Nachts und Sonntags ist die City eine ausgestorbene Stadt, in der kein Kirchturm offen emporragt, und nur Nachtwächter und Schließer[S. 169] ihr Logis haben. Die Geschäftsleute wohnen draußen in den Vorstädten, die man mit einstündiger Fahrt mit der Hochbahn erreicht, draußen bei den großen Parks, die sich um die Stadt ziehen. Zwischen der City aber und den Parkvorstädten liegen die unabsehbaren Viertel der kleinen Leute, voll Italiener und Neger, dazwischen noch vielfach unbebaute Strecken, auf denen Knaben ihren Baseball spielen. Hier weiß niemand vom anderen. Hier sind Städte in einer Stadt, und Stunden dauert es, um vom Norden nach dem Süden oder zum Westen zu kommen.
Ich stand auf dem Turm des „Auditoriums“, eines großen Theaters, und sah über die rauchenden Wolkenkratzer und in die offices hinein mit ihren Bureaus, wo Tausende von jungen Mädchen ihren Beruf darin gefunden haben, von morgens bis abends auf der Schreibmaschine zu klappern und sich dabei ungeheuer frei und selbständig vorkommen. Ich sah über die Riesenwarenhäuser von „Siegel u. Cooper“ und „Marshall Field u. Co.“, wo einfach alles in der Welt zu haben ist, Warenhäuser, die ganze Straßenblocks einnehmen. Mit Staunen schreitet man durch die Säulenhallen, sieht die Aufzüge in allen Ecken mit Menschen auf- und niedersausen und schaut die Schätze aller Erdteile vor sich ausgebreitet. Die Boys an den Eingangstüren führen umfangreiche Kataloge bei sich, um den Käufer sofort zu der richtigen Abteilung leiten zu können. Weiter blickte ich über den weiten Michigansee, der die lange Front der Stadt bespült und im Sturm seine gelbbraunen Wogen gischtschäumend ans Ufer peitscht, Handelsschiffe als Wrack ans Land wirft, ein Binnenmeer Nordamerikas; weiter über die wunderschöne Hauptpost, die leider zwischen die Blocks so eingekeilt ist, daß sie unmöglich ihre architektonische Schönheit entfalten kann, und über die ganz flache, niedrige, im Renaissancestil gebaute Kunstgalerie, die wie ein kleines Kind unter Riesen steht ...
Um Mittag warf ich einen Blick hinein in die „First Nationalbank“ mit ihren prachtvollen Marmorvestibülen und in die Börse, wo ein wilder Tumult herrschte. In drei Haufen standen die Makler zusammen und schrien gegeneinander. Nur mit Fingerzeichen verständigten[S. 170] sie sich. Von den Bureaus flogen die Telegramme hin und her, an den Bulletinboards notierten die Schreiber mit Kreide die Kurse, die ihnen klappernde Telegraphen zuraunten, alles in allem ein wildes Geschrei, dessen Sinn ich kaum verstand.
An einem der Nachmittage in Chikago ging ich ins „Kolosseum“, einen der amerikanischen Riesenzirkusse, der wohl 10 000 Menschen zu fassen vermag, gleich jenem von Barnum und Bailey, der zuweilen mit seinem Riesenzelt in Deutschland von Stadt zu Stadt zog. Übrigens entdeckte ich ihn als guten Bekannten wenigstens an den Reklameanschlägen auch dort. Es war, soviel ich mich erinnere, ein Montag nachmittag um zwei Uhr. Und doch war der Zirkus gut gefüllt. Ich mußte mich fragen, wo alle diese hier sonst so arbeitseifrigen Menschen die Zeit hernehmen, an einem lichten Montagnachmittag drei Stunden im Zirkus zu sitzen! Aber der Amerikaner wie sein antiker demokratischer römischer Vetter liebt die Spiele über alles. Ich habe selbst in Italien nicht soviel Kinematographentheater gesehen, die alle besetzt sind, wie hier. Die Vorstellungen im Zirkus gingen auf fünf Podien zugleich vor sich! Der Amerikaner mißt auch das Vergnügen nach der Quantität. Auf dem einen Podium wurde Schule geritten, auf einem anderen tanzten Bären, Affen und Hunde, auf einem dritten turnten Akrobaten, auf einem vierten wurden Gewichte bis 300 und 500 Pfund gehoben, auf einem fünften produzierten sich Seiltänzer und Springer, dazu einer, der alle Glieder seines Leibes in die schauderhaftesten Verrenkungen bringen konnte; rings herum noch ein Heer von Clowns, die ihre Witze rissen und in ihren abgeschmackten Kostümen sich balgten. Eine der Glanznummern war ein Pferd, das an einem Luftballon in die Höhe fuhr, und zuletzt ein tolles römisches Wagenrennen um die Arena. Alt und jung, Männer und Frauen, Schwarze und Weiße füllten als Zuschauer die weiten Galerien!
Im Auto fuhr mich mein Vetter nach der Universität hinaus, die Rockefeller, der Petroleumkönig, nachdem sie eine Zeitlang eingegangen war, mit vielen Millionen wieder neu ausgestattet hatte, so daß sie heute überaus schöne, dem englischen Universitätsstil nachgebildete,[S. 171] sehr weitläufige und zahlreiche Gebäude zu den ihren zählt. Sie hat eine gute Lage weit draußen im Jacksonpark am See, am Südende der Stadt. Ehrwürdig schauen ihre Kapellen im englischen gotischen Stil, ihre Bibliothek, ihre „Dormitories“ und Kolleggebäude über die weiten grünen Parkrasenflächen, wo Studenten in leuchtenden weißen Sportshemden und -hosen Tennis und Golf spielen. Die täglichen körperlichen Übungen, die Lust zu Sport und Spiel können wir Deutschen gar nicht genug von Engländern und Amerikanern lernen. Die Tüchtigkeit unserer höheren Schüler und die deutsche Wissenschaft in allen Ehren, aber im ganzen sind wir Deutschen doch lange Stubenhocker und Stammtischphilister geblieben. Nur eins haben wir, das Wandern. Im übrigen hatten wir in unseren Schulen viel zu wenig Turnstunden die Woche und nur einen Nachmittag für „Turnspiele“. Der amerikanische Student spielt täglich schon in der Volksschule, als Boy in der high school, täglich im Kollege, als graduate und noch als erwachsener Mann. Das Jahr ist geradezu in verschiedene Spieljahreszeiten eingeteilt: Im Frühjahr spielt man Baseball, im Herbst Fußball, sonst Tennis und Golf, solange es das Wetter nur irgend erlaubt.
Draußen am Jacksonpark, wo der frische Seewind durch die Anlagen streicht, war einst auch der Platz für die berühmte Weltausstellung 1893 zum vierhundertjährigen Gedenken an die Entdeckung Amerikas, zu der an zwanzig Millionen Menschen zusammenströmten. Was war doch gegen diese Menschenmassen die Völkerwanderung, von der wir in der Geschichte so viel Wesens machen? Noch sind einige Reste von der „world fare“ übriggeblieben. Die Nachbildungen der drei Schiffe des Kolumbus liegen noch in einer kleinen Bucht, hochbugige kurze Galeeren, mit denen sich heute keiner mehr auch nur für eine Woche über den Ozean wagen würde — und Kolumbus fuhr vier Monate! Ferner stand noch das Kunstmuseum und das türmereiche „Deutsche Haus“, das erst kürzlich einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen ist, und endlich wie auf einem felsigen Kap ein weißgestrichenes Franziskanerkloster. Aber wie wenig passen doch diese mittelalterlichen Häuser in diese Umgebung!
[S. 172]
Einer meiner Besuche galt auch dem „Hull House“, einem der ältesten und bedeutendsten „settlements“ in Amerika. Das Hull House, von einem Mr. Ch. J. Hull 1889 in Immigrantenvierteln Chikagos gegründet, umfaßt heute dreizehn Gebäude, Turnhalle, Schulräume, Läden, Klubzimmer, ein Restaurant, Musikräume, Tanz- und Theatersaal, Handwerksstätten, Lesesäle usw. Etwa 9000 junge Menschen verkehren wöchentlich in diesen Räumen, suchen hier ihre gesellige, körperliche und geistige Erholung! 50 sich selbst unterhaltende freiwillige Leiter wohnen im Hause und bilden untereinander einen korporativen Klub. Daneben sind über 200 andere freiwillige „Settlement-Worker“ als Klubleiter tätig. Die Knabenklubs treiben alle Art Handwerk bis hinauf zu künstlerischer Malerei — ich sah Bilder, die keiner Ausstellung Schande machten — und lernen eifrig Sprachen; die meisten sind junge Italiener, Griechen und Russen. Auch Musik ist wohlgelitten und natürlich vor allem der Sport. Die Bäder sind offen für das Publikum und ebenso das Restaurant. Bäder wurden im letzten Jahre 30 000 genommen, und das Restaurant besuchen täglich 500 Personen. Das sind auch fast die einzigen Einnahmen des Hauses. Im Sommer wird auf dem Land ein „camp“, ein Lager, bezogen, das den Klubmitgliedern für eine Woche frei zur Verfügung steht. Welcher kulturelle Segen muß von einem einzigen dieser Settlements auf ein ganzes Stadtviertel ausgehen! Hier herrscht Ordnung, Sauberkeit, Geselligkeit, Kameradschaft, Freundschaft, Zucht, Sitte, Kunst und die Anfänge wissenschaftlicher Bildung und technischen Könnens. Mein letzter Blick galt der Kleinkinderschule und der Krippe, die mit dem Hull House verbunden ist. Ich vergesse nie all die Kleinen an ihren winzigen Tischchen und mit ihren kleinen Tassen und Löffeln, die Babies in ihren Bettchen und endlich die schwindsüchtigen Kinder auf dem Dach, wo sie in freien Hallen unterrichtet werden. Auf dem Dach in einer Großstadt! Besser wenigstens als in den finsteren Löchern ihrer Wohnungen. Aber warum nicht hinaus aufs Land, wo kein Schornstein und kein Wolkenkratzer droht und die Luft beengt? Welches Elend! Zugleich welche Hilfe! Wenn man diese warme Sonne[S. 173] der Liebe überall scheinen fühlt, dann vermag man fast das Elend, das diesen Armen aus den Augen schaut, zu vergessen ...
Das war Chikago. Universität und Settlement, Zirkus und Wolkenkratzer, am See und in den Schluchten der Geschäftsstraßen, in den Parks und Fremdenvierteln, im lunchroom, wo man sich selbst bedient, und in der office 20 Stock hoch, wo der Ausläuferboy im zerschlissenen Anzug mit seinen acht Dollars die Woche, auf Aufträge wartend, gelangweilt die Zeitung liest — aber wer weiß, was er noch für eine Zukunft hat! Wie hieß es doch in jenem amerikanischen Stück „Die City“? Nicht die City vernichtet den Mann, sondern sie erfordert einen, der ihr gewachsen ist. Nicht die City macht den Mann, sondern der Mann die City. Ja die City! Ihre Geschichte läßt sich nie ausschreiben.
Durch meinen Vetter wurde ich auch in Kreise eingeführt, die sich für alle möglichen philosophischen und metaphysischen Dinge interessierten. Mein Vetter selbst schrieb, obwohl vollkommen Laie, Artikel über ethische Probleme trotz Kontor- und Geschäftsaufgaben. Immerhin eine Leistung! Er stellte mich einem Herrn vor, der mir — echt amerikanisch — bekannte, nacheinander Methodist, Materialist, Buddhist, Naturphilosoph und Spiritualist (Spiritist) geworden zu sein. Echt amerikanisch! So wurde ich darauf aufmerksam, wie stark z. B. neben dem Anwachsen der Christian Science auch die Beschäftigung mit dem Spiritismus in Amerika ist. Ich hatte Gelegenheit — auch schon in Neuyork — an „spiritualistischen“ Vortragsveranstaltungen, Sitzungen u. dgl. teilzunehmen. Aber rechten Geschmack konnte ich den Dingen nicht abgewinnen, vor allem konnte ich mich nicht von der Wahrheit und Wirklichkeit der behaupteten Erscheinungen überzeugen. So geschäftstüchtig und wirklichkeitsnah der Amerikaner ist, so unkritisch und leichtgläubig scheint er mir in übersinnlichen Fragen. Hier fehlt jede kritische deutsche Gründlichkeit. Der Amerikaner hält von vornherein viel mehr für möglich und wahrscheinlich als wir, die wir von unseren großen kritischen Philosophen geschult sind. Jedenfalls ist er dafür, daß alles einmal probiert und versucht werde. Probieren[S. 174] geht vor allem in Amerika über Studieren: Die Wahrheit wird sich schon selbst bewähren! denkt man drüben. Erweist sie sich nicht selbst in der neuen Richtung, so wird die Sache auch von selbst wieder eingehen und verschwinden. So argumentiert amerikanisches Denken. Während wir meist von der Theorie zur Praxis schreiten, macht man es drüben umgekehrt.
Ich war also recht gespannt auf das, was ich zu sehen bekäme. In jeder der amerikanischen Großstädte gibt es sogar mehrere Gemeinden von „Spiritualisten“, deren „Gottesdienste“ äußerlich ähnlich denen der Kirchen verlaufen.
Ich will ganz einfach erzählen, was ich in spiritualistischen Versammlungen gehört und gesehen habe. Vier Arten von spiritistischen Versammlungen habe ich besucht, „Gottesdienste“, sog. „test-meetings“, eine Sitzung mit voller „Materialisation“ der Geister und endlich eine Wochenversammlung, wo Gelegenheit zu Frage und Antwort über den Spiritualismus gegeben war.
Die „Gottesdienste“ finden Sonntags zu den üblichen Stunden statt. Einmal des Morgens war es in einem Konzertsaale. Rednerpult, Lehnstühle für Älteste, Gesang, Gebet (zu Gott als „Prinzip“!) Schriftvorlesungen, offene Tellerkollekte, Predigt und Segen war wie in jedem amerikanischen Gottesdienst. Die Gesänge waren frisch und lyrisch, die Melodien voll Innigkeit. Ich setze den Schlußvers des Liedes, das ich in Neuyork mitgesungen habe, hierher:
Aus dieser einzigen Strophe geht der religiöse Grundcharakter zweifellos hervor, das starke und einzige Betonen des Glaubens an ein Weiterleben der Toten. Für diesen Glauben sucht man Beweise;[S. 175] mit Augen will man die Geister der Gestorbenen sehen und mit Ohren Botschaften von ihnen vernehmen. So heißt es in einem Flugblatt, das mir schon in Newyork gegeben wurde, ausdrücklich „nicht zu zerstören, sondern den Glauben, wie er in den hauptsächlichen Lehren aller Religionen enthalten ist, zu bestärken und zu begründen, ist der Spiritualismus bestrebt“. Und er allein rühmt sich, die Lehren „aller großen Lehrer von Konfuzius bis Mohammed und von Moses bis Jesus durch psychische Phänomene demonstrieren zu können und uns so einen klareren Einblick in Ethik und Philosophie zu eröffnen“. Aber die Predigtrede im sogenannten „Trance“zustand enttäuschte mich sehr. Das Lesepult ward zur Seite gerückt. Der Redner saß für einige Minuten in seinem Stuhl, bedeckte sein Gesicht mit der Hand und schien in „Trance“ zu verfallen. Er zuckte einige Male heftig, dann erhob er sich mit unsicheren Schritten, um mit geschlossenen Augen eine mehr als halbstündige äußerlich formgewandte Rede zu halten. Neben einigen guten Gedanken, allerlei krauses, ungeschichtliches Zeug über Christi Reisen, die er in seiner Jugend im Alter zwischen 12 und 30 Jahren nach Babylon, Indien und Ägypten unternommen habe, wo er zu den Füßen der alten Weisheitslehrer gesessen und von ihren Lippen seine Lehre empfangen habe! Ich bin nicht psychologisch bewandert genug, die Frage zu entscheiden, ob jemand im Trance-zustand eine solche halbstündige Predigt, formgewandt und logisch konsequent, zu halten vermag, und ob es überhaupt möglich ist, gleichsam auf Kommando und auf eigene Initiative hin, selbst in Trance zu fallen und aus ihr wieder zu erwachen. Ist aber die Trance simuliert, liegt also bewußte Täuschung vor, so erregt der ganze „Gottesdienst“ trotz ansprechender Gebete und Lieder Abscheu. Jedenfalls aber soll die Trance die Predigt als „inspiriert“ legitimieren und den Eindruck erwecken, Geister sprechen durch den Prediger; der Redner selbst ist bewußtloses und willenloses Werkzeug der „Inspiration“! In der Tat kündigt die spiritualistische Gemeinde für jeden Sonntag zwei andere „Geister“ an, die durch den Prediger sprechen sollen, so einmal — niemand[S. 176] anders als William Shakespeare (!) und Darwin. Damit auch die Komik nicht fehlt, sollte am Morgen desselben Tages der Geist eines der Bauleute am salomonischen Tempel sprechen!!
Der spiritualistische „Gottesdienst“ war recht spärlich besucht, aber es sollte Gottesdienst sein, nichts von Klopfgeistern und Tischrücken. Der Spiritualismus ist eben drüben mehr als das, was man gewöhnlich von ihm weiß, eine organisierte und anerkannte religiöse Sekte. Auch die „Sonntagsschule“ fehlt dabei nicht. Als Lesegegenstand wurde bekanntgegeben: Eine Geschichte unseres Planeten und des Mars seit ihrem 68 000- bzw. 25 000jährigen Bestehen!! Weiter wurde in diesem Zusammenhang erzählt, daß ein berühmter Astronom im Westen der Vereinigten Staaten dieses Buch über den Mars zu seinen Berechnungen benutze (!). Ich mußte auch über die umfangreiche spiritualistische Bibliothek staunen, die ich im Bibliothekzimmer zu sehen bekam; sie gab mir einen Eindruck davon, wie viele Menschen hier ihre geistigen Kräfte an den Spiritismus und seine Lehren gewandt haben müssen.


Ein andermal ging ich zu einem sogenannten „test-meeting“, d. h. zu einer Versammlung, in der Geister durch ein Medium Botschaften an ihre lebenden Verwandten ausrichten und so die übersinnliche Welt und ihr Wirken durch weissagende Zeugnisse, die das Medium kraft der Inspiration einzelnen ausstellt, beweisen. Diese Versammlung hat in einem prunkvoll ausgestatteten Saal einer Loge stattgefunden. Es mögen wohl 100 Personen anwesend gewesen sein, darunter besonders viele weißhaarige Damen. Es war Sonntag nachmittag. Wieder ein „gottesdienstlicher“ Rahmen. An Stelle der Predigt kamen die „Geisterbotschaften“. Das Medium, eine Dame in den mittleren Jahren, von imponierender Erscheinung, saß für einige Minuten, ganz wie jener Prediger, von dem ich oben berichtete, die Augen mit der Hand geschützt, in ihrem hohen Stuhl und schien in „Trance“ zu fallen. Ringsum feierliches Schweigen und gespannte Erwartung: Was werden die Geister zu sagen haben? Wem wird sie eine Botschaft ausrichten? Dann erhebt sich die Dame — ich[S. 177] vermochte, obwohl ich in der ersten Reihe saß, durchaus keine psychische Veränderung an ihr wahrzunehmen — mit offenen Augen und sicherem Schritt. Sie tritt zu einem Tischchen, wo vor Beginn des Gottesdienstes die „Gläubigen“ allerlei Andenken an ihre Verstorbenen, Ringe, Armbänder, Bilder, sogar eine Bibel, verhüllt niedergelegt haben. Sie greift eines der Objekte heraus; und nun beginnt der „Geist“ des Verstorbenen, der sie leitet und auf den sich das Objekt bezieht, ihr eine Botschaft an den Lebenden aufzutragen und durch sie als Medium dem Lebenden sich durch Mitteilung seines vergangenen und zukünftigen Lebens als wirklich zu erweisen, d. h. das Medium begann in ganz allgemeinen Ausdrücken zu weissagen, auf wen sich das Objekt bezieht, etwa so: „Ich sehe eine Gestalt neben mir in weißem Haar, eine Frau, alt, sorgenvoll und doch mit treuem Auge ...“ Dann bricht sie ab, hält den Ring empor, den sie ergriffen, und fragt: „Wem gehört dies?“ Ein älterer Mann in Trauerkleidung steht auf. Sie fährt fort: „Ich sehe Ihre Frau neben mir, und sie sagt mir, sie begleite Sie auf allen Ihren Wegen und sie schütze Sie vor Unglück und freue sich, Sie bald im Himmel wiederzusehen. Doch zuvor müssen Sie durch Leid und schwere Sorgen hindurch ... usw.“ In ähnlichen ganz allgemeinen Phrasen bewegen sich die „tests“. Manchmal scheint es nicht recht zu stimmen, was die Prophetin von der verstorbenen Person weissagt. Der Gläubige denkt hin und her und kombiniert und überlegt und entdeckt hier und da einen Sinn und ein Zusammentreffen und tröstet sich und die übrigen damit, daß die Geister nicht alles enthüllen und Prophetien immer dunkel zu sein pflegen. Aber einige Male scheint die Kunst der Prophetin auffallend das Richtige getroffen zu haben, die betreffende Person erhebt sich und bekennt: „Es stimmt ganz genau“, und ein allgemeiner Beifallssturm lohnt die Prophetin, die enthusiastisch ausruft: „Friends, the world moves on ...!“ So ging es fort für eine ganze Stunde; wohl 20 Personen bekamen ihre „tests“.
Über was soll man sich mehr wundern, über die Gläubigkeit dieser „Gläubigen“ oder die psychologische Kunst des „Mediums“? Wenn[S. 178] doch die „Geister“ einmal wirklich neue Offenbarungen senden wollten und nicht nur Gemeinplätze und zweideutige Phrasen! Aber hat denn nicht manchmal das „test“ genau gestimmt? Ja, es scheint so. Aber es ist erstens nicht zu vergessen, daß das Medium meist seine Leute kennt, dieselben kommen ja fast sonntäglich; viele begrüßte sie mit Namen und Handschlag nach der Versammlung. Vieler Lebensgeschichte mag sie in einigen Umrissen kennen oder erschließen aus ihrer Person, ihrem Alter und ihrer Kleidung (es fiel mir auf, daß sie sich fast ausschließlich an Personen in Trauerkleidung wandte!), aus ihrer Haltung und ihrem Gesichtsausdruck. Je nachdem, was sich während ihres Weissagens auf den Gesichtern der Angeredeten ausprägt, ob Zustimmung, Befremden, Freude, Schmerz, Erstaunen, fährt sie in ihrem Spruch fort, ändert ihre Worte oder hält ein. Viele der Angeredeten, die „glauben“, sind zudem natürlicherweise im Augenblick der „tests“ erregt, verwirrt, sie kombinieren und phantasieren, sehen mehr Zusammenhänge, als da sind, und hören mehr und deuten mehr aus den Worten des Mediums heraus kraft ihrer eigenen wirklichen Kenntnis ihres Lebens und ihrer Verstorbenen, als was das Medium in seiner allgemeinen Zweideutigkeit hat wirklich verlauten lassen. Interessant wäre es auch zu wissen, wieweit dieses Medium sich eines Betruges und seiner psychologisch kombinierenden Kunst selbst bewußt ist oder wieweit es an seine Geistesinspiration selbst glaubt(?).
Die dritte Art Versammlung, die ich besuchte, sollte eine Sitzung mit voller Materialisation von Geistern sein! Sie fand abends acht Uhr statt. Wieder mögen es etwa 100 Personen gewesen sein. Fremde wurden nur auf den hinteren Reihen zugelassen! Fürchtete man vielleicht eine plötzliche Störung und Entlarvung durch Unberufene? Der Leiter der Versammlung erklärte die Maßnahme damit, daß alle rohe Selbstsucht von ungläubigen Personen, die in der ersten Reihe sitzen, dem Eintritt der Materialisation hinderlich sei(!). Damit auch hier die Komik nicht fehlte, bat er am Schluß seiner einleitenden Worte den Diener, ein Fenster zu öffnen, da[S. 179] frische Luft den Geistern sehr zur Verkörperlichung helfe!! Der Raum wurde alsbald verdunkelt — merkwürdig, daß Geister immer nur im Dunkeln erscheinen! Das Medium, eine Frau in mittleren Jahren, setzte sich hinter einen roten Vorhang ... (warum immer noch hinter einen Vorhang?). Ein Klopfen ließ sich hören, der Vorhang öffnete sich ein wenig und eine weiße Gestalt huschte vorbei. So mehrere Male. Dann begann die weiße Gestalt — die merkwürdigerweise weder Größe noch Gestalt, noch Gewand, noch Stimme, noch ihren Platz wechselte! — Namen zu nennen, undeutlich flüsternd, so daß man bald diesen, bald jenen herauslesen konnte. Der Leiter gab dann den Namen laut bekannt und fragte, ob jemand den Geist erkenne. War jemand desselben Namens im Saal, so fragte derselbe etwa den Geist: „Bist du’s, Mutter?“ Der Geist antwortete dann: „Ja, meine Tochter.“ Freudig rief die Gläubige dann: „Ich freue mich, dich zu sehen, komm bald wieder!“ Und der Geist verschwand. Das war die ganze „geistreiche“ Unterhaltung der Geister aus der anderen Welt, die sich aber nie auf eine lange Unterhaltung einließen. Wohl nicht weniger als 50 solcher Geister erschienen binnen einer Stunde an diesem Abend, hier und da auch ein Mann mit schwarzem Bart und schwarzem Rock ... aber dann dauerte es gewöhnlich etwas länger, bis er kam. (Nahm der Geist sich erst Zeit, das weiße Gewand mit dem schwarzen zu vertauschen?)
Dies war die eindrucksloseste, albernste Versammlung und der offensichtlichste und plumpste Betrug, den ich je erlebt habe. Man muß sich nur über die Leichtgläubigkeit der Menschen wundern, die in dunklem Raume eine Frau in weißem Laken für einen Geist halten. Den Alten verzeihen wir es, wenn sie körperliche Geister sahen, aber in unserer kritischen und naturwissenschaftlichen Zeit scheint es unverständlich. Ich will nicht vergessen zu sagen, daß eine Dame vor der Materialisation ein stimmungsvolles Lied sang und während der „Geistererscheinungen“ eine simple Spieldose ihre Weisen klimperte, vielleicht um „Sphärenmusik“ zu imitieren! Einige in der Versammlung konnten sich des Lachens nicht enthalten, wurden aber[S. 180] von einer „gläubigen“ Dame, die sich umdrehte, in barschen Worten zurechtgewiesen. Lachte man mehr, lief man Gefahr, ganz hinausgewiesen zu werden.
Endlich die vierte Art spiritistischer Versammlung, der ich beiwohnte, war eine Wochenversammlung, wo man Fragen stellen konnte und Antwort über spiritistische Lehren erhielt. Hier kam das allerkonfuseste Zeug zutage, z. B. Frage: „Was ist Gott?“ Antwort: „Natur“. — „Wer war Jesus?“ Antwort: „Geboren in einer Vegetarierfamilie, deshalb mit so starkem und wundertätigem Körper und Geist begabt!“ — Die Geister leben in verschiedenen Vibrationssphären und scheinen eine Art ethischer Läuterung durchzumachen. Für täglichen Spaziergang und körperliche Bewegung als gesundheitsfördernd wurde stark eingetreten! Ein Bild eines Geistes in Gips wurde vorgezeigt, das vor vielen 1000 Jahren bei einer Materialisation abgenommen sein soll! David und Saul wurden als spiritistische Rivalen(!) geschildert. Die Propheten der Bibel waren natürlich samt und sonders Spiritisten. Auch die „Hexe von Endor“ (1. Sam. 28) durfte natürlich nicht unerwähnt bleiben. Kurz, ein wahrer Hexentanz von geschichtlicher Unkenntnis und phantastischer Metaphysik, vermischt mit ethisch-asketischen Tendenzen, ja schließlich ein bißchen Vegetarianismus. Ein trüber Strom, der sich unbekannt und unbeachtet in obskurer Literatur von den Zeiten der hellenistischen Religionsmischung an durch das hexengläubige Mittelalter und die krausen Spekulationen phantastischer Philosophen herabergießt bis auf unsere Tage, neu aufgefrischt und aufgetischt mit Geistererscheinungen und spiritistischen Sitzungen.
Das waren meine Abschiedseindrücke von Chikago. Wirr und kraus wie die Stadt im ganzen, schien mir auch ihre geistige Verfassung zu sein. Was mag sich an Geldjagd, Lebensnot, Glaube, Schande und Aberglaube alles in ihr bergen! Und das alles emporgeschossen in noch nicht 100 Jahren! 1831 ja noch ein Indianerdorf am „Zwiebelfluß“, 1925 die viertgrößte Stadt der Welt! Und es wird nicht ruhen, bis es noch eines Tages Neuyork überflügelt hat!
[S. 181]
Chikago.
Aus: Neue Welt, eine Anthologie amerikanischer moderner Lyrik, S. Fischer Verlag, Berlin.
[S. 182]
Ich hatte genug von dem mystischen Spuk der Spiritisten und ebenso von dem Geschäftstrubel Chikagos; ich freute mich daher ordentlich auf die Einsamkeit im — Eisenbahnwagen, dem ich mich nun wieder für etwa 40 Eisenbahnstunden anvertrauen wollte und ebenso auf die Einsamkeit der ungeheuren Mississippiebenen.
Dankbar verabschiedete ich mich von meinen freundlichen Gastgebern, die mir soviel gezeigt und soviel zugänglich gemacht hatten. Aber immer hätte ich um keinen Preis in Chikago wohnen und weilen mögen ebensowenig wie in Neuyork. Ich könnte weder der täglichen Ermordung der Zehntausende von Hammeln und Ochsen zusehen, wie das lebende Vieh, das frühmorgens eingeliefert, am Abend als fertige Wurst die „Union stock Yards“ verläßt, noch möchte ich täglich bei Marshall Field u. Co. aus- und eingehen oder als Türboy Hunderttausenden täglich die Tür öffnen. Eher noch würde ich auf den weiten Wassern des Lake Michigan herumfahren oder in den grünen Parks baseball spielen wollen. Aber so gnädig erweist sich ja das Leben den wenigsten unter den Menschen.
So verzichtete ich auch nicht allzuschweren Herzens auf den Besuch der deutschesten Stadt Amerikas, Milwaukee, in der allein auch sozialistische Stimmen sich maßgebend geltend zu machen pflegen! Wie anders in Deutschland, dem Mutterland des Marxismus! Der Amerikaner ist viel zu sehr Individualist, als daß er in Massen je dem marxistischen Sozialismus anheimfallen könnte. Er hat zu sehr auf Schritt und Tritt in seinem Lande erprobt, was persönliche ungehemmte Energie und Eigenart des einzelnen vermag, ja daß die Union der Entschlußkraft und Unabhängigkeit des wagenden Individuums alles verdankt, als daß er überzeugter Marxist werden könnte. Die Deutschen kommen im Urteil des Stockamerikaners nicht immer gut weg. Wie die Stimmung über sie ist, zeigt folgendes moderne Gedicht:
[S. 183]
„Deutsche Nachkommen.“
Aus: Die neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. Herausgegeben von Claire Goll. S. Fischer Verlag, Berlin 1921, S. 66.
[S. 185]
Ebensowenig weinte ich den großen Pullmann-Werkstätten nahe Chikago in Pullmann eine Träne nach, daß ich sie nicht in Augenschein nahm. Nur fort aus dem Menschenameisenhaufen Chikago! Das war jetzt mein sehnlichster Wunsch.
Bald nach der Abfahrt, als die letzten Fabriken wichen, taten sich ungeheure Ebenen im Staate Illinois auf mit herrlichen Fluren, von denen viele deutschen Farmern gehören. Ein wenig hügelig war das Gelände, aber nicht lange. Die ersten Frühlingsknospen waren an den Bäumen. Das Land sah etwa so aus, daß es auch in der Provinz Sachsen in Mitteldeutschland hätte liegen können. Wir näherten uns dem Illinoisriver, demselben, in dessen Oberlauf man den Chikagofluß zurückzufließen zwang, damit er nicht länger mit seinen schädlichen Abwässern den trinkwasserspendenden Lake Michigan verunreinige. Langsam zog eben auf ihm eine Barke dahin, die ein großes Segel aufgespannt hatte. Die einzige Unterbrechung des Flußbildes. Hier und dort dehnte sich Sumpfland. Ab und zu sah man eine alleingelegene Farm, Rinder- und Pferdeherden. Alles ein ganz anderes Bild als die geschlossenen deutschen Dörfer mit ihrer engen, wohlabgezirkelten Gemarkung!
In unserem Zug — ich fuhr wieder in der „chaircar“, nicht im Pullmann — saßen allerlei Leute meist einfacheren Standes mit ihren Kindern. Sie hatten ihre Decken, ihre eigenen Eßkörbe mitgebracht, aus denen sie die üppigsten Mahlzeiten hervorzogen — auch der Wein und das Tischtuch fehlte nicht. Für drei Tage und Nächte Fahrt nach Kalifornien hatten sie sich häuslich eingerichtet, so wie man es sich auf Deck und in der Kabine des Schiffes gemütlich macht. Sie spielten, lachten, lasen, rauchten, aßen, schliefen, wie es paßte. Die Kinder benutzten bald den langen Mittelgang als ihre Rennbahn und die langen Liege- und Drehstühle als Verstecke, spielten Hasch und Sichkriegen. Der Boden des Wagens verwandelte sich daher allmählich in ein Stilleben von Obstschalen, Orangen- und Brotresten, Papier aller Sorten, leeren Schachteln usw. Eine ästhetisch veranlagte Dame vor mir hatte sich an den Plüsch des Sitzes ihr[S. 186] gegenüber eine dunkelrote Rose gesteckt, um ihre Umgebung zu verschönern. Aber in der allmählich sich verschlechternden Luft — die Fenster sind wegen des stets sehr reichlichen Ascheflugs aus der Lokomotive nicht zu öffnen — welkte sie, und ein rotes Blatt nach dem andern fiel langsam mit einem leisen „Hsch“ zu Boden. Neben mir saß ein junger Eisenbahner von vielleicht 22 Jahren, der in Kalifornien Stellung suchte und in mir das gleiche vermutete. Er empfahl mir, in den Y. M. C. A.[22] einzutreten. Das sei überall in der Welt eine gute Sache. Ihr könne man angehören. Er pries mir alle die äußeren und inneren Vorzüge derselben, aber das hinderte ihn doch nicht, nachher in einer Ecke des Wagens lustig mit zwei kecken Chikagogirls ein wenig zu flirten. Im Wagen wurden wie immer Karten, Schokolade, Handschuhe und Obst angeboten. Nur daß sich das Obst, je weiter wir uns von Chikago entfernten und je seltener wir hielten, ständig verteuerte.
So etwa je nach ein bis zwei Stunden gab es eine Haltestelle. Dazwischen war nichts. Die Bahnhöfe verdienen kaum diesen Namen! Und ein Namensschild derselben war selten deutlich zu entdecken. Die Siedlungen lagen alle immens weit auseinander. Jeder ist hier König in seinem eigenen Reich und auf seiner schier unbegrenzten Scholle. Wie anders in den Riesenstädten, wo sich die Menschheit zu Millionen zusammenballt! Wer nicht einmal durch diese endlosen Ebenen gefahren ist, kennt Amerika nicht! Neuyork und Chikago allein sind noch nicht die Union! Aber nirgends war auch etwa eine alte Dorfkirche, wie in Franken oder Schwaben, zu entdecken. Die Besiedlung ist hier ja erst vor 50 bis 70 Jahren vor sich gegangen. Es ist hier immer noch Anbau- und Gründungszeit, wie es etwa bei uns unter Karl dem Großen war. Bei einer Gruppe von etwa 20 Wohnhäusern steht schon eine kleine hölzerne, höchst primitive Farmerkirche. Sie fehlt nirgends, oft sind es gar zwei oder drei verschiedener Denominationen! Alles ist in diesem Lande ungeheuer,[S. 187] die Ebene, die Ströme, die Seen, die Städte, die Bodenschätze, die Fruchtbarkeit, der Reichtum. Während bei uns ein Bauer bei allem Fleiß im allgemeinen aus dem Boden — die künstliche Düngung nicht gerechnet — nicht viel mehr ziehen kann als sein Vater und Großvater vor 40 und 60 Jahren zog, erntet ein Ansiedler, der mit nichts nach Amerika kommt, oft schon nach sechs, sieben Jahren so viel, daß er sich ein eigenes wohlmöbliertes Landhaus bauen und ein Automobil kaufen kann! Wie müssen die Ebenen hier erst bei voller Ernte strahlen, wenn Korn und Mais übermannshoch steht und die großen Mäh-, Dresch- und Säemaschinen auf den Feldern fauchen! — —
Je südwestlicher wir kamen, desto wärmer wurde es! Man sah schon Landleute auf den Feldern mit vereinzelten Strohhüten gehen. Sonst ist erst der 15. Mai drüben der offizielle Termin, den Strohhut auf- und nicht mehr abzusetzen bis in den indian summer hinein! Um Mittag hatten wir den Mississippi erreicht. Glitzernd wälzte er seine blauen, bis 1 km breiten Fluten träge und gemächlich — wie etwa die Elbe unterhalb Hamburgs — durch die ungeheuren Ebenen des mittleren Westens. Seine Länge ist dreimal die unseres Rheins. Ich war am Mississippi! War es möglich? Wovon man als Kind nur in Indianergeschichten geträumt und gelesen hatte! Es war mir in den Augenblicken, da unser Zug bei Fort Madison gravitätisch über die lange eingleisige Mississippibrücke rollte, unbeschreiblich seltsam zumute, daß ich es mir immer wieder sagen mußte: Jetzt fährst du über den Mississippi! Zwei kleine, alte, vorsintflutliche Dampfer kreuzten den von bewaldeten Inseln eingenommenen mächtigen Strom. Fort Madison lag gänzlich einsam, nur von wenigen Häusern umgeben. Welchen Feind will es hier abwehren? Stritt es einst gegen die Franzosen oder Engländer oder Mexikaner oder die Indianer? Von rechts her winkten grüne Wälder. Alles glänzte in blendendem Frühlingssonnenschein. Zur Feier der Überfahrt über den Mississippi verzehrte ich die letzte Apfelsine, die mir die liebe Cousine in Chikago mit eingepackt hatte. Dann fuhren wir wieder und fuhren und fuhren ... Von den 38 Stunden bis Neumexiko waren erst die[S. 188] wenigsten herum. Wie hatte doch bei Florenz einmal mir gegenüber eine deutsche Dame, als sie in vier Stunden von Bologna kam, schon ungeduldig ihren Mann gefragt: „Ach, Artur, wann sind wir denn endlich da?“ Hier lernte man in Geduld sitzen und fahren.
Jenseits des Mississippi, im Staate Missouri, den wir jetzt durcheilten, liegt das alte Prärieland, da man einst mit dem Lasso die Büffel jagte und Indianer durchs übermannshohe Gras ritten. Das Flußtal begleiteten sanfte Hügelreihen, eine angenehme Unterbrechung der endlosen Ebenen, sanfte Bachtäler, Wiesenhänge, auf denen zahlreiche Kühe weideten. Wie bald werden sie nach Chikago in die Union stock yards wandern? Gefallene Bäume liegen da, um die sich niemand kümmerte. Aber nirgends waren hier umfangreichere Wälder. Einst war es romantischer, mit der Büchse durch die Wildnis zu reiten, als mit der Bahn hindurchzufahren, aber wieviel ungezählten Millionen wächst hier jetzt das Brot, während früher die Indianer wohl nur einige Hunderttausend gezählt haben. Die sanftgewellten Hügelreihen am glitzernden Mississippi hatten mit ihren Büschen, Bächen und Pferdeherden ihren eigenen Reiz. O wie hätte ich all den Schreibmaschinenfräuleins und den blassen Angestellten in dem wimmelnden und dampfenden Chikago, wo man in den Wolkenkratzerschluchten kaum den Himmel und vor all der Lichtreklame kaum noch die Sterne sieht, einmal hier auf einige Wochen herauszukommen, um sich ohne Zeitungsgeschrei und Dollarjagd in Licht, Luft und Sonne gesund zu baden, gegönnt! So wie die Pferde und Rinder heute hier weideten, weideten sie auch einst vor Jahrtausenden am Nil, am Euphrat oder am Eurotas. Aber kein Expreß dampfte an ihnen vorüber, daß sie erschreckt zur Seite sprangen, kein Auto tutete in ihre Wildnis, kein Wolkenkratzer reckte sich gen Himmel! Wie die Kulturen im Kern einander gleich bleiben und doch verschiedenes Antlitz tragen! So wie die Menschen am Ganges braun, am Nil schwarz, am Jangtsekiang gelb, am Rhein weiß und am Mississippi rot sind und doch die gleichen Bedürfnisse und Gedanken haben. Wie ist hier Macht vor Recht gegangen und hat dem roten[S. 189] Mann, der selbst vielleicht einst vor Jahrtausenden als ein Bruder des Gelben aus Nordasien hier hereingekommen ist, Land und Grund genommen, ihn mit Pistole und Branntwein ausgerottet und sich an seine Stelle gesetzt! Und lag nicht doch in der vorwärtsdrängenden Kulturmacht des Weißen ein höheres Recht, so daß Macht auch ein Recht in sich birgt? Ich muß im Grunde allen fremden Völkern und Rassen wohlgesinnt sein — dazu erziehen uns Weltreisen —, aber ich muß doch auch in der Geschichte der Kriege und Kolonisationen Sinn finden. Heute haben hier die Indianer in den meisten der Staaten des mittleren und fernen Westens nur noch ihre „Reservationen“, am größten in Oklahoma. Es gibt eine Reihe Amerikaner, die mit Stolz Indianerblut in sich tragen, während Negerblut völlig verachtet ist! Es gibt genug Indianer, die als Amerikaner gekleidet fast unerkennbar in amerikanischen Diensten stehen. So lernte ich einen indianischen Studenten und Lokomotivführer kennen! Aber es gibt vielleicht auch noch eine Viertelmillion Vollblutindianer, die abgelegen in ihren Dörfern (pueblos) leben und sich von Töpferei oder Teppichweberei kümmerlich nähren und in ihrer Liebe zu den wilden Bergen und einsamen Felsschluchten nicht lassen können ...
Am Flußufer standen einige Fischer mit ihren Angeln und schauten stundenlang in das Blau des Himmels und in die Weite. Vor seinem Haus in der offenen Halle saß ein behäbiger Farmer in weißem Bart und schaute unserem Zug nach, dem einzigen Ereignis, das am Tag sein Einerlei unterbricht. Auf einem grünen Anger spielten barfüßige Knaben — die man in Amerika selten sieht — ihren baseball. Bei einem kleinen Ort stand eine Holzkirche armselig wie eine Scheune. Nur die Fenster mit ihren gotischen Holzladenfenstern und einem eisernen Kreuz am First ließen sie als solche erkennen. Am Abend sah man die Landleute in Ermangelung von Wegen und Straßen einfach auf den Bahnschienen ihren Wohnungen zustreben! Das ist der ebenste und kürzeste Weg drüben. Die Lokomotive pfeift, und man tritt einen Augenblick zur Seite! Wer dabei überfahren wird, hat es sich selbst zuzuschreiben. Polizeistrafen gibt es dafür nicht!
[S. 190]
Purpurrot begann die Sonne im Westen zu sinken. Immer weiter westwärts ging unsere Fahrt ... Zwei barmherzige Schwestern fuhren allein in einem äußerst primitiven Reisewägelchen draußen durch den Abend. Der Wagen suchte sich selbst die beste Fahrgelegenheit durch den Sand und das Gras. In einigen erleuchteten Zelten saßen Bahnarbeiter um ihr Abendbrot ... Mit Dunkelheit kamen wir nach Kansas City im Staate Kansas und überschritten hier den mit seiner gewaltigen Breite fast an den Mississippi erinnernden Missouri, der von hier nach St. Louis zum Einfluß in seinen größeren, aber bis dahin kürzeren Bruder strömt. Kansas hat etwa 200 000 Einwohner und ist die größte Stadt des gleichnamigen Staates. Sie liegt am Einfluß des Kansasflusses in den Missouri. Sie ist wie alle amerikanischen Städte rasch gewachsen. 1860 hatte sie noch nicht 5000 Einwohner! Jetzt hat sie ihr stattliches „Kapitol“, ihre prächtigen Parks usw., wie es einer ordentlichen großen Stadt zukommt. Einer der Einwohner unserer Hall in Cambridge war aus Kansas, Freund R., er hatte also 38 Bahnstunden in seine Universitätsstadt zu fahren! Wer macht ihm das in Deutschland nach?
Mit einem Trinkgeld brachte ich unseren besonders trägen und lässigen Neger auf die Beine, daß er mir im Schlafwagen noch ein Bett verschaffte. Denn die ganze Nacht mit den Kleidern in der Ecke sitzen, wenn auch der „reclining chair“ erlaubte, ihn lang wie einen Liegestuhl auszuziehen, erschien mir doch nicht gerade das Ideal zu sein, zumal mir noch ein ganzer Tag Eisenbahnfahrt bis nach Neumexiko hinein bevorstand. Der Neger, wohlbeleibt und mit breiter Nase, hatte mir grinsend und schmunzelnd zugesagt, eine „upper berth“, wie das meine Gewohnheit war, zu verschaffen. So geschah es auch. Ich stieg in dem mit seinen grünen Vorhängen wohlverhängten, besagten Schlafwagen als einer der letzten auf der kleinen Leiter in mein hochgelegenes Reich und kleidete mich oben aus, barg alles wohl in einer Ecke und sah noch nach, ob auch Uhr, Scheckbuch und Börse wohl in ihren Taschen waren. Dann legte ich mich ruhig aufs Ohr. Die meisten anderen im Wagen schliefen schon den[S. 191] süßen Schlaf des Gerechten und fuhren mit mir im Staate Kansas in die Nacht hinein ... „Rumrumrum ... rumrumrum“ rüttelte der Zug dahin. Bald war man nach dem vielen Sehen und der schon etwa 15stündigen Fahrt wohl in den Schlaf gewiegt. Kein Laut noch Kindergeschrei störte hier die Stille. Die Auswandererfamilien mit ihren Kindern waren der größeren Billigkeit halber in der „tourist-car“ zurückgeblieben und hatten zwischen den ausgezogenen Stühlen ihre Kissen und Decken ausgebreitet. Es war dort das reinste „Nachtlager von Granada“. Ich hoffte wohlgestärkt am Morgen in einem neuen Staate, Kolorado, von denen jeder allein etwa ein Drittel so groß ist wie das Deutsche Reich, wieder aufzuwachen ...
Plötzlich, als ich wohl ein bis zwei Stunden geschlafen hatte, hält mir mitten in der Nacht jemand eine Blendlaterne vors Gesicht, rüttelt mich am Arm und zieht mir auch schon die Bettdecke weg — eine recht eigenartige Situation. War es ein Überfall? War der Zug von Räubern angefallen? Nein. Der Neger bedeutete mir, ich müsse schleunigst aus dem Bett heraus ... es sei noch ein Fahrgast eingestiegen, der auf das Bett Anspruch habe! Wachte oder träumte ich? Es war leider kein Zweifel an der betrübenden Wirklichkeit: Der Schlafwagenneger stand grinsend mit seinem breiten, braunen Gesicht vor mir und packte schon, ohne meine Antwort abzuwarten, meine Kleider über den Arm und schleppte sie davon in die Ecke des Wagens und warf sie dort auf ein anderes oberes Bett, das anscheinend noch frei war. Warum er mir das nicht von Anfang an gegeben hatte? Ich ergriff die letzten Utensilien hinter ihm drein, kaum daß ich Zeit hatte, wenigstens die Unaussprechlichen noch anzuziehen. Aber es schlief ja alles im Wagen und sah meinen höchst eigenartigen Umzug nicht. Nur der Neger und der neu eingestiegene Fahrgast, der schon auf mein wohlgewärmtes Bett wartete! (Übrigens pflegen echte Amerikaner nachts einen Schlafanzug anzuziehen, so daß für sie ein solch plötzlicher Umzug nicht allzu genierend ausfällt. Bei mir als echtem Deutschen war das anders.) Ich war so schlaftrunken — der[S. 192] erste Schlaf ist ja wohl immer der beste — daß ich kaum nachzusehen und nachzuzählen vermochte, ob der Neger auch alles richtig herüberbugsiert hatte. Kurz, ich schlief bald wieder ein. Und der Zug hielt ja wohl auch in der Nacht nicht mehr ... „Rumrumrum ... rumrumrum“ hörte ich es wieder wie im Traum ...
Morgens wachte ich auf bei blendendem Sonnenschein. Ungeheure gelbe kahle Ebenen dehnten sich zu beiden Seiten! Der Schlafwagen ward lebendig; Männlein und Weiblein strebten nach den Waschtoiletten ... Man kleidete sich an. Ich zählte: Alle meine Kleidungsstücke waren vorhanden. Die Uhr knöpfte ich in die Weste — da fühle ich zufällig in die innere Rocktasche: wo war mein Scheckbuch? Nun war das Scheckbuch weg! Das ganze Erbe der lieben Tante aus Schwaben! Und im Portemonnaie waren nur einige Halbdollarstücke und einige Cents. Das reichte vielleicht noch einen Tag! Und dann saß ich in Neumexiko, im Herzen des nordamerikanischen Kontinents — 40 Bahnstunden von den nächsten Menschen, die mich kannten. Aber auch wenn ich sie telegraphisch um Geld zur Rückkehr anging — sollte nun die ganze Fahrt zu Wasser werden? Wie furchtbar! Mir saß der Schreck in allen Gliedern. Wie doch der Mensch ahnungslos aus allen Himmeln stürzen kann!
Was tun? Sollte ich mich einem der mir völlig unbekannten Reisenden anvertrauen? Keiner würde mir Geld geben! „Selbst“ ist in Amerika der Mann! „Steig aus und nimm irgendeine Arbeit an!“ hätte man mir vielleicht auf amerikanisch geantwortet. Aber ich mußte ja doch auch nach Harvard zurück! Hier konnte ich keinesfalls bleiben. Und wenn nun gar jemand mein Scheckbuch gefunden und auf meinen Namen, der mit Unterschrift vorne drin stand, mein ganzes Geld abhob! Wie gewonnen, so zerronnen! Liegt auf geerbtem Geld kein Segen? „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Darüber hatten wir einmal einen Aufsatz machen müssen. Galt das jetzt mir? So schossen mir die Gedanken hin und her durch den Kopf. Ach, wenn ich doch sonst was verloren hätte, nur nicht die Reisekasse selbst! Ich verwünschte schon den Niagara und den Mississippi,[S. 193] daß sie mich überhaupt zu dieser Reise verleitet hatten! Hätte ich doch nie in der Washingtonstreet in Boston das Auswandererbillett gesehen! Was nutzte mir all das jetzt? Und dabei fuhren wir immer weiter, immer weiter fort, für mich ins Verderben ... immer tiefer in die Wildnis eines Erdteils ohne Geld! Wenn der Zug doch bloß einmal zu ruhigem Überlegen gehalten hätte! „Rumrumrum ... rumrumrum“, so schien mich der Zug selbst mit seinem endlosen und monotonen Rhythmus zu verhöhnen.
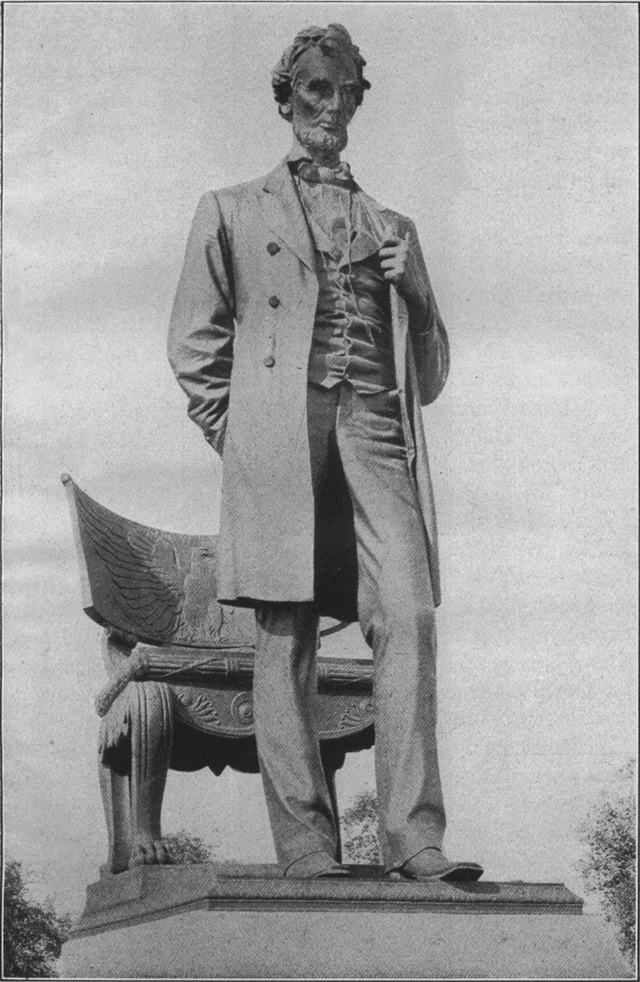

Ich erkundigte mich, nichts verratend, nach der nächsten Station. „Um halb acht Uhr sei Frühstück in Syrakuse, an der Grenze von Kolorado“, hieß es. Also da hielt der Zug 25 Minuten, und im Wartesaal war Gelegenheit, für 75 Cents warm und reichlich zu frühstücken: Hammelkotelette, Huhn und andere schöne Sachen. Was scherte mich jetzt das Frühstück? Ich mußte mein Scheckbuch haben. Wenn nur der Zug endlich einmal halten wollte und ich Schritte tun konnte! Fuhr er bis ans Ende der Welt? Aber wenn ich ausstieg, sollte ich vielleicht dann da bleiben, in einem weltverlorenen Städtchen nur noch 200 km vom Felsengebirge entfernt? Nein, mir kam ein besserer Gedanke: Bleiben kostete Geld, was ich ja nicht hatte, Fahren kostete mich im Augenblick kein Geld, denn mein Rundreisebillett, was bis Chikago zurücklautete — freilich über Kalifornien! — war ja bezahlt und steckte in meiner Tasche. Also weiterfahren und sehen, was dann kommt! Mein Plan war gefaßt: In Syrakuse nur aussteigen, um in der Frühstückspause „Schritte zu tun“! Ich wußte glücklicherweise die Nummern meiner Schecks genau; die hatte ich mir vorsichtig mit Bleistift notiert. Und das Notizbuch hatte ich noch! Also auf dem Bahnhof sofort an die Bankzentrale depeschiert und die betreffenden Nummern sperren lassen! So war vielleicht doch noch mein Erbe gerettet.
Als der Zug endlich hielt, handelte ich kurz entschlossen. Denn gestohlen war das Scheckbuch auf jeden Fall! Ich depeschierte. Dann trat ich nach Aufgabe meines Banktelegramms nach Boston an den diensttuenden police-man auf dem Bahnsteig und forderte ihn energisch[S. 194] auf, sämtliche Reisenden sofort zu durchsuchen oder etwa den Schlafwagenschaffner einfach zu verhaften, bis heraus sei, wer mein Scheckbuch gestohlen habe. Der police-man, ein Hüne von Gestalt und wohl Ire von Geburt, sah mich sehr groß an und an mir herunter — und rührte sich nicht von der Stelle! Erwartete er erst einmal ein großes Trinkgeld? Das hatte ich ja nicht. Oder bedurfte er dazu höheren Befehls? Wie sollte ich den in der Eile erwirken? Ich mußte doch weiterfahren. Enttäuscht und niedergeschlagen wandte ich mich in den Wartesaal, gab mein Scheckbuch verloren und setzte mich verzweifelt an die „Frühstücks“tafel — es waren noch 15 Minuten Zeit. Hunger hatte ich, mechanisch schlang ich Hammelkotelette und etwas vom Huhn hinunter. Aber was half’s? Meine Barschaft schmolz nur um so mehr. Sie würde wohl kaum noch diesen Tag überleben. Was dann? So wollte ich wenigstens noch einmal gut und vorsorgend gegessen haben. Sollte ich mich dann in Los Angeles als Kuli verdingen? Wenn wir nur erst dort wären! Bis dahin waren aber noch 48 Stunden mit der Bahn zu fahren! Reichte die letzte Mahlzeit bis dorthin?
Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte — ich hatte mich nicht entschließen können, in dem weltverlorenen Syrakuse zu bleiben; und das war gut! — stieg ich wieder ein, wie üblich, von dem kleinen bereitgestellten Schemel hinauf auf das sehr hohe Trittbrett und meldete jetzt dem Schlafwagenneger meinen Verlust. Grinsend hörte er mich an. Ich bedeutete ihm, ich sei der Fahrgast, den er heute Nacht aus dem Schlaf geweckt und in das andere Bett gewiesen. Er nickte. Durch seine Schuld sei also das Scheckbuch verlorengegangen. Er schüttelte. „No, Sir“ war seine Antwort, und er verschwand. Er suchte offenbar den Schlafwagen ab, klappte die Betten zusammen — und fand natürlich nichts! Mir war längst alles gänzlich vergällt. Sah ich sonst mit begeistertem Interesse stets in die Landschaft hinaus, so interessierte mich jetzt nichts mehr. Stumm sah ich vor mich hin und brütete. Die letzte Hoffnung war dahin. Im Schlafwagen nahmen auf den Sesseln die Reisenden wieder Platz. Ich teilte jetzt[S. 195] auch anderen meinen Verlust mit und wurde allgemein bemitleidet. Ich erwartete bloß noch, daß sie für mich eine freiwillige mildtätige Sammlung veranstalteten, daß ich bis Los Angeles zu leben hätte. Aber selbst das geschah nicht. Sah ich dazu zu wohlgekleidet aus? Ging sie der „German“ nichts an? Dachten sie: „Mag er sich’s doch wieder verdienen, jung genug ist er“? Ich weiß es nicht. Und wenn wir jetzt über die romantischen Pässe des Felsengebirges gefahren wären, ich hätte keine Notiz von ihnen genommen ...
So mochten wohl wieder dreiviertel Stunden vergangen sein, da kommt der Neger grinsend wieder herein, tritt auf mich zu und hält in der Hand triumphierend — mein Scheckbuch!! Beinahe hätte ich es ihm aus der Hand gerissen. Ich wußte nicht, sollte ich ihm um den Hals fallen oder gar als vermeintlichem heuchlerischen Dieb eins auswischen. Ich unterließ aber lieber beides. An Kraft war er mir sicher überlegen. Er hielt das Buch wohlweislich sehr fest. „Ob das meins wäre?“ — Nun natürlich, wie konnte er nur fragen; ich nannte ihm genau die Nummern aus dem Notizbuch. Da hielt er es mir näher, immer breiter grinsend hin, aber gab es noch nicht frei! Ich griff instinktiv in die Tasche und schüttete ihm meine noch übrige Barschaft in die braune Hand. Da auf einmal wurde sein breiter Mund schmäler und — er gab es mir! Wie ein Paradiesesstrom floß es durch meine Seele! „Well, Sir!“ — „Ja, well, Sir, aber wo war es denn?“ Er behauptete: Eben hätten es ihm zwei spielende Knaben aus dem Schlafwagen gebracht, die zum Versteckspielen unter die Sitze gekrochen wären! Das war möglich; dann war es also schon des Abends bei dem nächtlichen Umzug aus der Tasche gefallen oder genommen und unter die Sitze gestoßen worden....! Well, Sir, alles möglich! Oder ob der gute Neger nicht alles so beabsichtigt hatte? Ob er so ein gutes Trinkgeld verdienen wollte? Oder ob er gar erst bare Dollarnoten darin vermutet hatte? Mir war’s gleich. Wie interessant war sofort draußen wieder die Landschaft! An der nächsten Station war ich der erste, der aus dem Zug sprang und wieder an die Bank in Boston telegraphierte:[S. 196] „Scheckbuch gefunden, Sperre aufheben!“ Sie war wohl noch nicht ergangen ...
Unsere Fahrt ging durch Land wie durch die Wüste Gobi. Zum zweiten Male mußte die Uhr eine Stunde, jetzt auf „Mountain-Time“ (Gebirgszeit) zurückgestellt werden, wie in Detroit auf „Zentralzeit“. Der geographische Mittelpunkt der Union war überschritten. Die Vereinigten Staaten haben nämlich wegen ihrer Ausdehnung eine vierfache Zeit: In Neuyork ist Atlantic time, in Chikago Central time, im Gebirge Mountain time und in Kalifornien „Pacific time“, denn dort geht die Sonne vier Stunden später auf und unter als an der Küste des Atlantik. Auf dem Meer hatten wir täglich die Uhr nur um 20 Minuten zurückstellen müssen und auf der Rückfahrt später wieder vor! Da der Bahnzug etwa dreimal so schnell fährt als das Schiff, so macht es zu Lande beinahe jeden Tag eine Stunde aus, wenn man ständig westwärts fährt. — — —
Im Wagen herrschte jetzt wüstes Kindergeschrei, die Babys brüllten, die Boys haschten einander. Alles das störte mich in meiner Paradiesesfreude nicht. Der Boden des Wagens glich jetzt schon nicht mehr einer menschlichen Wohnung, denn jeden Tag mehrten sich der Abfall und die Speisereste beträchtlich. Mir gegenüber sog ein Kindchen an der Mutterbrust ... es ahnte nicht, wo es ist und wem es entgegenfuhr. Welch Pionier wird einmal aus ihm werden? Bei mir saß ein früherer Seemann, der schon Australien, die Türkei und England befahren hatte. Neben ihm und seinen Schilderungen kam ich mir sehr klein vor ... Staub und Rauch nahmen auch ständig zu, dazu die Wärme, denn wir fuhren jetzt bereits unter dem 37. Breitengrad, auf dem in Europa — oder vielmehr Afrika! — die Nordküste von Tunis und Algier liegt.
Vor dem heranbrausenden Zug rasten etliche Pferdeherden in die Steppe hinein. Alles war draußen gelb und baumlos. Man sah Zelte wie ein Zigeunerlager aufgestellt. Neben der Bahn strich ein schlechter Fahrweg mit dünnen und krummen Telephonstangen hin. So fest, gerade und glatt wie bei uns sind sie drüben nur in kultivierten[S. 197] Gegenden. Hier und da lag ein einsames Lehmblockhaus. Wir traten allmählich in ursprünglich spanisches Kulturland und indianisches Siedlungsgebiet ein. Man sah einige strohgedeckte Holzhütten. Die Leute ritten auf Maultieren durchs Land wie die alten Trapper. Auf den weiten kahlen Steppendünen in der Ferne einige dunkle Punkte, die man durchs Glas als weidendes Vieh erkennt. Wenn nicht die Bahn die Blutader für diese Einsamkeiten wäre, wären sie alle, Mensch und Vieh, hier von aller Welt abgeschlossen. Die großen Pazifiklinien haben erst den Westen Amerikas erschlossen. Hier war zuerst die Bahn, dann kamen die Menschen der Bahn nachgezogen. Bei uns in Europa waren erst jahrhundertelang die Menschen und ihre Städte da, dann erst verband sie die Bahn miteinander ...
Wo kriegen die Leute hier nur ihr Wasser her? fragte ich mich. Die Wasserläufe schienen alle ausgetrocknet zu sein. Gelbe Wüste reiht sich an die salzhaltige Steppe. Regen fällt hier ganz selten, höre ich. Wie heiß mag es erst im Sommer sein? Wie grün und fruchtbar war es dagegen im Mississippital! Die unentgeltlichen Wasserfässer am Ende des Eisenbahnwagens finden immer stärkeren Zuspruch. Eine dünne spinnewebfeine Eisenbahnbrücke führt uns über einen sandigen Fluß. In Chikago Tausende von Kunstbauten; hier erweckt ein einziger von ihnen großes Interesse in all seiner Dürftigkeit. Unter einem dürren Baum liegen drei Rinder im Schatten. Im Fluß stehen andere, wie die Kühe im Nil zu Pharaos Zeiten. Was könnte hier alles noch werden und wachsen, wenn das Land einmal systematisch berieselt und besiedelt sein wird!
Nach Stunden wieder einmal eine weltverlorene Station. Drüben erheben sich jetzt mäßig hohe felsige Hügelreihen. Verblichene Baumstämme liegen umher und ein paar faulende Knochen. Ich schaue gespannt nach dem Felsengebirge aus, aber sehe es immer noch nicht. Die Stationsnamen werden immer spanischer. An der Bahnstrecke arbeiten Neger in hohen spitzen Strohhüten wie bei uns die Pferde im heißen Sommer. Zwischen den Schienen liegen Haufen Sand wie verwehte Dünen ...
[S. 198]
In La Junta, einem wichtigen Bahnkreuzungspunkt, ist lunch. Alles stürzt hungrig hinaus. Da mein Bargeld am Ende ist und ich hier keinen Scheck eingewechselt bekomme, nehme ich ein billiges Mittagessen in einem Arbeiter-saloon dicht beim Bahnhof. Warum soll ich nicht einmal da essen, wo Arbeiter, Neger, Spanier oder Mexikaner essen? Das Besteck und Tischtuch ist freilich nicht allzu appetitlich ... aber es schmeckt auch ... Freilich sehen sie mich alle recht erstaunt an ...
Nach 25 Minuten dampfen wir weiter in nun fast genau südlicher Richtung durch den Südostzipfel des Staates Kolorado. Hügeliges Tafelland beginnt. So denke ich mir etwa Südafrika. Wilde Wasserfurchen zeichnen sich im Sand ab. Ein wenig Föhrengestrüpp ist das einzige, was hier wächst. Hier muß es, wenn es regnet, sehr heftig regnen. Man sieht es an den verhärteten Furchen. Die Bahn steigt ständig. Wir sind schon 1000 m hoch! In der Richtung aufs Gebirge ist es leider wolkig und umzogen, sonst sähe man jetzt das Felsengebirge. Man erblickt die Kette der Rockies bei klarer Sicht über 250 Meilen weit! Meine Erregung steigert sich. Wann werde ich die Berge zuerst wahrnehmen? Ich bin gespannt wie einst, als wir als Studenten das erste Mal in die Alpen fuhren ...
Mit einem Male sind wir auf eine weite hohe Ebene hinaufgeklommen, an deren hinterem Rande jetzt stattliche hohe blaue Bergketten sichtbar werden; hinter ihnen noch höhere, die aber nicht deutlich zu sehen sind. Ein paar Pferdeherden im Vordergrund bilden die einzige Staffage zu diesem grandiosen Bild. Sonst rings kein Baum und Strauch. Das müssen die Ketten des Felsengebirges sein. Sie sind es! Ziemlich links erhebt sich die Koloradokette mit etwas Schnee auf den Berghäuptern, tiefblau, bis über 4000 m hoch. Man sieht jetzt die Bahnlinie eine weite Strecke vorwärts an den langen Zeilen der Telephonstangen, die wie eine Streichholzpallisade in der Erde stecken. Stracks fahren wir auf die Berge zu. Es wird immer öder. Rechts drüben erhebt sich gigantisch der berühmte Pikes Peak bei Denver, einer der höchsten und am weitesten in die Mississippiebene vorgeschobenen Gipfel (4300 m).
[S. 199]
Wie leicht rollt der Zug über die Riesenebene! Wieder mächtige wilde Wasserrinnen! Wie mag hier der Regen hausen! Aber mitten in der einsamen Wüste auch ein — Reklameschild an der Bahn: „Star-Tobacco!“ Die ersten Indianerpueblos[23] tauchen auf mit ihren fast fensterlosen niedrigen Lehmhütten. Braune und schwarzhaarige Kinder spielen davor. Ein Güterzug kommt uns auf der eingleisigen Strecke entgegen. Die Züge verständigen sich schon aus der Ferne durch gegenseitiges lautes Pfeifen darüber, wo man sich ausweicht. Jener hält lange an der Ausweichstelle und wartet auf uns, bis wir vorüber sind. Aber wie machen sie es im Nebel und bei Nacht? Der Güterzug rollt die Schätze Kaliforniens nach Chikago. Die „Straße“ neben der Bahnlinie ist jetzt nur noch eine einzige feine Räderfurche im Sand. Ruhig, stolz und tiefblau schauen die Berge zu uns herüber. Wir halten an Station Trinidad, 1800 m über dem Meere, einem altmexikanischen Städtchen unter einer hohen Bergspitze, fast schon an der Grenze von Neumexiko. Die kleinen Orte sind hier meist nicht viel mehr als ein Haufen Lehmhütten wie im primitivsten Italien oder im Orient. Die mexikanischen Häuser sind sehr niedrig, die Straßen breit. Alles hat einen vollkommen südlichen Charakter. Die Männer (Mexikaner) tragen einen breitrandigen Schlapphut, den Italienern ähnlich, und haben feurige schwarze Augen.
Die Bahn steigt weiter steil an wie über den Apennin. Alles ringsumher bleibt kahl und steinig. Kein grünes Hälmchen ist zu sehen. Alle Frühlingspracht Missouris ist verschwunden. Wir fahren durch ein schmales höchst malerisches Felsental, dann durch einen Tunnel auf einer Paßhöhe von fast 2400 m! (Die Gotthardbahn erreicht bei Göschenen nur 1100 m!) Jenseits des Tunnels senkt sich die Trasse wieder beträchtlich. In Station Ratton stehen Sattelpferde an der Bahn, ankommende Reisende abzuholen. Wir sind mitten im Gebirge. Ringsum ist der Blick durch hohe malerische Bergketten eingeschränkt. Aber alles ist noch viel weitläufiger und riesiger als in den Alpen.[S. 200] Inzwischen umziehen sich die Berge, Wolken hüllen uns ein. Regenschauer prasseln nieder. Aber draußen herrscht wunderbar frische, würzige Bergluft, drinnen im Wagen aber ist die Luft zum Umkommen ...
Wir fahren wieder aufs neue über mächtige Hochebenen in beinahe 2000 m Höhe, die von hohen bewaldeten Bergketten eingesäumt sind. Noch einmal taucht die Abendsonne nach dem Regen über dem Schnee der Berge empor, dann versinkt sie. Das Felsengebirge ist, wie ich jetzt schon bemerkte, kein geschlossenes Gebirge wie die Alpen, sondern eine Sammlung von hohen Randgebirgen, die in sich ungeheuerliche Hochebenen einschließen. Das Gestein leuchtet bald rötlich, bald grünlich. Wem gehört all dies Land? Auf drei Bahnstunden keine menschliche Wohnung! Neumexiko hat bei einer Größe von 317 000 qkm eine Bevölkerung von nur 200 000 Einwohnern, also eine Dichte von 0,6 auf 1 qkm. Auf eine Entfernung Frankfurt a. M.-Karlsruhe oder Dresden-Leipzig keine nennenswerte Siedlung!
Während die Abenddämmerung einbricht, tauchen neue schneebedeckte Bergketten unter den Wolken auf. Geheimnisvoll! Sind alle diese Berge schon bestiegen? Wie lange Jahrtausende hausten hier die Indianer allein? Beinahe um zehn Uhr Sonnabend abends bei stockdunkler Nacht bin ich in Lamy Junction. Ich verlasse mit noch zwei Personen den Zug, um nach Santa Fé, Neumexikos Hauptstadt, umzusteigen. Seit Freitag früh hatte mich der Zug beherbergt. Er war einem wie zu einer Heimat geworden. Ohne Unfall hatte er mich von den großen Seen des Nordens quer durch die ganze Mississippiebene bis ins Herz des Felsengebirges gefahren. Man empfand so etwas wie Dankbarkeit ihm gegenüber, als man ihn verließ und er in die stockdunkle Nacht wieder auf- und davondampfte.
Nun saß ich nachts zehn Uhr mit zwei anderen wildfremden Menschen, einem Mann und einer Frau, auf dem kleinen Bahnhof dieses winzigen und herzlich unbedeutenden Nestes, Lamy genannt, noch 1200 km vom Stillen Ozean, beinahe 3000 km von Neuyork, über 6000 km von der Heimat oder vier Monate Fußwanderung[S. 201] entfernt! Es dauerte eine volle Stunde, bis der kleine Zug nach Santa Fé weiterging, der uns drei Menschen beförderte. Rings war rabenschwarze Nacht. Kein Lichtsignal, kein Anzeichen von menschlichen Wohnungen! Nach 18 Meilen Bahnfahrt waren wir etwa um Mitternacht in Santa Fé, der etwa 5000 Einwohner zählenden kleinen altmexikanischen Hauptstadt des jüngsten Staates der Union, Neumexiko, beinahe unter dem 35. Breitengrad, also in Höhe Maltas, Kretas und Zyperns gelegen. Aber von all seiner Schönheit und Altertümlichkeit war in der stockfinstern Nacht vorerst gar nichts zu sehen. Der Bahnhof lag ein wenig draußen. Ich sah mich um. Kein Mensch war weit und breit. Ich ging wie die anderen beiden eine völlig dunkle Straße stadtwärts, beziehungsweise in der Richtung, wo man sie etwa vermuten konnte. Am kleinen Bahnhof wurden die Lichter ausgelöscht. Nun war aber auch alles stockfinster. Meine Reisegenossen gingen einige Schritte vor mir. Sie kannten anscheinend ihr Ziel.
Da kam uns ein einfacher Mann entgegen, soweit man erkennen konnte. Er wechselte mit den beiden vor mir ein paar Worte. Die Frau ging weiter. Der Mitreisende aber blieb stehen, mit einer einfachen Ledertasche in der Hand. Jetzt kam der Fremde auch auf mich zu. Was wollte er? War es Freund oder Feind? „Ob ich schon Nachtquartier hätte? Ich könnte bei ihm billig schlafen.“ Da der andere schon zugesagt hatte, willigte auch ich ein. Mitgegangen, mitgehangen! Ich wundere mich noch heute, wie ich damals um Mitternacht in Santa Fé in völliger Finsternis einem mir völlig unbekannten Mexikaner mit einem anderen, der mir ebenso unbekannt war, in sein Haus folgen konnte. Wenn man mich hier etwa in der Nacht aufgehoben hätte, so hätte wohl kaum jemand je erfahren, wo und wie ich eigentlich von der Welt verschwunden wäre. Aber an diesem Buche sieht der Leser, daß ich am Leben blieb. Ich wollte auch zunächst die Schlafgelegenheit erst einmal „besichtigen“. „Es sollte nah sein,“ sagte der Fremde, „aber in die Stadt noch weit.“ So wollte ich einmal das Abenteuer probieren. Hatte ich in einem sehr feinen Haus in Neuyork[S. 202] unter bed-bugs[24] leiden müssen, so brauchte ich mich gewiß hier im Felsengebirge nicht über sie zu beklagen; aber vielleicht ging es sogar ohne sie ab.
Wir kamen nach ein paar Minuten an einem kleinen Haus an. Alle Läden an ihm waren geschlossen. Insofern machte es einen mystischen Eindruck. Der Mexikaner öffnete und führte uns eine Treppe hinauf. Eine alte Frau steckte in Nachtkleidung den Kopf aus einer halbgeöffneten Tür. Er murmelte zu ihr ein paar mir unverständliche Worte auf spanisch; darauf verschwand sie und erschien nachher notdürftig angekleidet mit einer kleinen Wasserkanne und einem Ding, das wohl ein Handtuch vorstellen sollte. Mein Begleiter bekam rechts ein Gemach, ich links. Das meine war noch etwas vornehmer und größer, enthielt außer dem Bett sogar eine Kommode und einen kleinen Waschtisch. Ich akzeptierte, der andere auch. Was sollte ich jetzt in Santa Fé nach Mitternacht nach 39stündiger Bahnfahrt noch lange nach einem Zimmer herumlaufen? Eine Räuberhöhle oder Verbrecherfalle schien es ja nun auch nicht gerade zu sein. Schließlich sind auch die Mexikaner Menschen wie wir, dachte ich, und der andere war ja auch noch zur etwaigen Hilfeleistung und Verteidigung da. Beim Schein einer Kerze, die ich dankend angenommen hatte, schaute ich zuerst, als ich allein gelassen war, in meiner Kammer unters Bett, ob keiner etwa drunter läge, der nachher, wenn ich schlief, hervorkäme und mich vielleicht beraubte. Schließlich verrammelte ich noch zur Sicherheit die Türen mit der Kommode und dem Waschtisch. Sollte also ein nächtlicher Angriff von dorther geplant sein, so würden mich mindestens die umstürzenden Möbel noch rechtzeitig aus dem Schlaf wecken. Das Fenster schloß ich, erstens von wegen des Einsteigens — was sich ja sogar einmal ein Bonsels geleistet hat! — zweitens von wegen der auf 2100 m Höhe trotz des 35. Breitengrades empfindlichen Nachtkühle. Dann untersuchte ich das Bett auf kleine Schlafgenossen hin, fand aber nichts Bedenkliches und legte mich zuletzt sorglos hinein ... um[S. 203] nach prachtvollem Schlaf — die 39 Bahnstunden saßen mir doch recht in den Gliedern — am anderen Morgen, einem Sonntag, um sieben Uhr bei strahlendem Sonnenschein wohlgestärkt zu erwachen ...
Ich sah mich in dem hellen Zimmer um. Es war alles bescheiden und einfach, aber ganz ordentlich. Das Fenster war noch geschlossen, es war also niemand des Nachts eingestiegen. Die Kommode stand noch geduldig hinter der Tür, also auch von dort hatte sich kein Feind genaht. Scheckbuch und Uhr waren auch noch vorhanden! Was wollte ich mehr? Ich sah aus dem Fenster und ließ die herrliche Morgenluft hereinströmen und sagte zu mir selbst: Nun bist du wirklich in Neumexiko, und die Berge dort drüben sind ein Stück Felsengebirge. Alles war wie ein Traum! — — —
Ich kleidete mich rasch an, um die Stadt zu besehen und möglichst auch noch heute in die Berge zu kommen. Denn durchs Felsengebirge zweimal quer hindurchzufahren und auf keinen Berg zu kommen, dünkte mir ein Ding der Unmöglichkeit. Ich pilgerte bald in das Städtchen und fand es nicht so weit vom Bahnhof, als ich vermutet hatte. Bald stand ich auf seinem Marktplatz. Während man sonst in amerikanischen Städten durch „Wolkenkratzerkañons“ zum Zentrum kommt, war man hier wie in einer völlig anderen Welt. Eine belaubte und schattige, rechteckige nicht allzugroße stille „plaza“ wie in einem süditalienischen oder spanischen Landstädtchen öffnete sich als der Mittelpunkt des „Verkehrs“. Ihn bestritten einige in der Sonne sitzende kleine schwarzhaarige Mexikaner in ihren breiten Schlapphüten und hier und da ein echtsüdlicher zweirädriger Eselskarren. Die eine Längsseite der plaza säumte der alte dreihundertjährige „governors palace“, ein einstöckiges flachgedecktes, etwas verfallen aussehendes langgestrecktes Gebäude, das heute ein Museum birgt. Fast vornehm wie eine versunkene Pracht wirkten seine Säulenkolonnaden. Einst war es die „Residenz“ spanischer, mexikanischer und auch noch amerikanischer Gouverneure. General Lewis Wallace, der 1879-82 Gouverneur von Neumexiko war, schrieb hier seinen vielgelesenen Roman „Ben Hur“! Wahrhaftig, hier herum hatte er auch das[S. 204] passendste Milieu dazu, denn Neumexiko steht an Vegetation, Bergwelt, Bauweise und Klima in nichts dem heiligen Lande nach. Still und ehrwürdig klangen die Glockenschläge der nahen zweitürmigen, aber im ganzen einfachen romanischen „Kathedrale“ des heiligen Franziskus, die zur Morgenmesse riefen und auf die Mexikaner und katholische Indianer aus den umliegenden Siedlungen zustrebten. Es war Sonntag. Auf altspanischem Boden herrscht noch heute der Katholizismus. Santa Fé ist für amerikanische Zeitverhältnisse uralt. Schon 1542 fanden hier die Spanier ein großes Indianerpueblo vor, als selbst Neuengland noch kein Weißer betreten. Und noch heute wohnen zahlreiche Indianer auch in der Stadt. Die Sträßchen um die plaza lagen still und verlassen. Die schlichtesten Lehmbauten, die Läden vor der schon am frühen Morgen recht warm scheinenden Sonne herabgelassen, waren hier aneinandergereiht. Man hätte auch in Assisi oder sonst wo in Mittelitalien in einem verlorenen Bergstädtchen sein können!
Welch wohltuende Ruhe in diesem alten Städtchen! Hier einmal dem Weltverkehr mit seinem Expreß, seinen Autos, Wolkenkratzern und Millionenstädten vollständig entronnen zu sein, war ein Labsal! Hier hätte ich am liebsten gleich vier Wochen zugebracht! Aber mich zog es noch weiter in die Bergwelt, die ringsumher ihr Haupt hob ... Freilich bis auf die Schneegipfel würde ich wohl nicht kommen, das war mir klar. Aber vielleicht auf die in mittlerer Höhe vor ihnen? Santa Fé selbst liegt schon 2147 m hoch. Die Gipfel, die seine mächtige Hochebene säumen, mögen wohl 4000 m hoch sein, und das „Mittelgebirge“ vor ihnen vielleicht gegen 3000 m. Das war also mein Ziel.
Ich nahm gleich den nächsten Berg aufs Korn. Hinter der Stadt stiegen einige wegähnliche Gebilde durch die Felder und Weinberge bergan. Da mußte es emporgehen. Es war mir gleich wohin. Die Richtung nach Santa Fé zurück würde ich schon immer wieder finden. Im letzten Laden der Stadt verproviantierte ich mich ein wenig mit Brot, Konserven und eingemachten Früchten. Das sollte oben mein Mittagessen sein. Dann stieg ich wacker bergan ... Die Sonne schien[S. 205] heiß, obwohl es noch zeitig am Morgen war. Immer noch kamen mir einzelne Mexikaner, den ausgezogenen Rock den Italienern gleich frei über eine Schulter gehängt, aus den umliegenden Orten, und auch vereinzelte Indianer in bunten Decken, einen holzbeladenen Esel vor sich hertreibend, den Hohlweg herab. Jedem von ihnen schaute ich nach und bestaunte sie: Leibhaftige Mexikaner und Indianer! So klein, braun und schwarz wie etwa bei uns die Zigeuner, mit denen sie als ursprüngliche Mongolen (?) vielleicht auch rassemäßig zusammen gehören.
Von einer roten Farbe sah ich allerdings keine Spur. Vielleicht waren die roten Indianer weiter im Norden und Osten. In schwarzen langen Strähnen hing ihnen das Haar in den Nacken; es kamen nur Männer. Frauen und Kinder blieben wohl daheim in ihren „pueblos“, den fast fensterlosen und nur mit Leitern zu ersteigenden flachen Lehmhäusern. Bald aber kam niemand mehr. Was sie wohl von mir dachten? Hier und da sah einer dem Fremden nach. Ob schon je einer hier heraufstieg? Wenn nun ein paar vielleicht von ihnen heimlich umkehrten und mir etwa auflauerten? Mein kleines Taschenmesser wäre meine einzige Waffe gewesen, aber auf wie lange? Mit Revolver und Büchse war ich noch nie in die Wildnis gezogen ... In solche Rolle hätte ich mich auch nicht so leicht finden können.
So stieg ich wohlgemut auf Schusters Rappen höher und höher. Den Hohlweg hatte ich verlassen, der schien mir zu weit ab und zu wenig in die Höhe zu führen. Rechts hinauf war noch eine Zeitlang so etwas wie ein Jäger- oder Wildpfad, der zwischen dem fast mannshohen stachlichten Gesträuch hinaufführte. Dann hörte auch der auf. Einige Fliegen folgten mir summend, sonst war es völlig still. Die Sonne meinte es sehr gut. Kein schattenspendender Baum war ringsum. Ein Wiesel huschte vor mir über den Weg und verschwand scheu. Im Gebüsch raschelte es manchmal wenig anheimelnd. Waren es Schlangen? Gar giftige? Ich mochte nicht erst untersuchen, sondern setzte meinen Anstieg, der immer steiler wurde, unentwegt fort. Hier lag ein gebleichter Ziegenschädel. Der Balg des Tieres war verschwunden.[S. 206] Und dort ein zerzauster Vogel. Hatten hier Kämpfe stattgefunden? Waren hier Raubtiere (Pumas?) in weidende Herden auf den Bergen eingebrochen? Gab es hier sonst noch Gefahren? Ich wußte es nicht und stieg bergan.
Kein Mensch war weit und breit. Santa Fé lag schon eine sehr gute Strecke unter mir. Seine wohlgeformte Kapitolskuppel leuchtete in der Sonne, sonst schrumpfte alles andere des Städtchens auf einen ziemlich engen Raum zusammen. Ein Ruf wäre nicht mehr hinabgedrungen. Gab es auch hier oben Indianer? Friedliche oder räuberische? Karl Mays Indianergeschichten, einst in der Jugend verschlungen, tauchten in meiner Erinnerung wieder auf. Ich sah rauchende warme Skalpe am Gürtel hängen. Passierte das heute noch? Ich hatte noch nichts dergleichen in den Zeitungen gelesen. Zugüberfälle und Lynchjustiz an Negern, die weiße Mädchen überfielen, pflegten vorzukommen, aber auch Pistolenschießereien und Eifersuchtsszenen in den Südstaaten, wo das alte heiße und stolze Kreolenblut noch in den Adern rollt. Sollte ich lieber umkehren, um nicht etwas zu riskieren? Aber wozu? Vielleicht war ich hier oben sicherer als mitten in Chikago oder Neuyork. Sollte ich mich nachher vor mir selber schämen? Ich stieg weiter empor ...
Nach einer Weile hielt ich eine kleine Rast und schnitt eine Büchse mit in der Hitze besonders lieblich schmeckenden Aprikosen auf und aß von meinem Brote. Dann stieg ich höher. Nur Stechpalmen und Kakteen begleiteten mich noch. Vom Weg war schon lange keine Spur mehr. Nicht einmal Tritte waren zu sehen. Jeder Schritt mußte jetzt erobert werden. Dicht und dichter wurde das stachelichte Gebüsch. Aber die Schneegipfel ringsum hoben sich auch immer höher und unersteiglicher. Ich nahm mir einen Bergabsatz als Ziel, der mir noch erreichbar schien. Die Sonne stieg auf Mittaghöhe und leuchtete unbarmherzig vom wolkenlosen strahlend blauen Himmel. Endlich unter viel Schweißtropfen nach viel Klettern und Kriechen war das Ziel erreicht. Meine Hände waren blutig gerissen. Noch immer sah man Santa Fé, aber wie in einer tiefen Ebene gelegen. Wie hoch mochte[S. 207] ich jetzt sein? Die Aussicht war überaus großartig. Wie stumme Helden umlagerte mich die Kette der Schneegipfel. Wie weltverloren zitterte dünn und fern der Pfiff einer Lokomotive herauf. Durch die weite Hochebene wand sich eine winzig kleine schwarze rauchende Schlange — der Sonntagszug. Als ich die Reste meines Proviants verzehrt hatte, schlief ich, ohne es zu merken und zu wollen, hier oben müde von dem dornigen, steilen und heißen Anstieg ein. Auch lag mir wohl noch die 39stündige Bahnfahrt von Chikago her in den Gliedern ...
Als ich wieder gestärkt von der herrlichen Bergluft erwachte, schaute ich mich verwundert um. Wo war ich? Ich merkte, daß ich geschlafen haben mußte. Ach, da unten lag ja Santa Fé. Ich war in Neumexiko, und diese Berge sind ja ein Stück Felsengebirge! Das ganz unbeschreiblich Eigentümliche meiner weltverlassenen Situation wurde mir wieder klar. Schlangen waren nicht gekommen, auch keine räuberischen Indianer hatten mich angefallen. Keine Moskitos hatten mich gestochen ... Ich zog die Uhr. Mittag war vorüber! Es war Zeit, schleunigst umzukehren, wieder unter Menschen zu gehen, wenn ich noch mehr sehen wollte. Wie gerne wäre ich weiter hinaus in die Bergwelt gestiegen, bis hin zu den Indianerpueblos und -reservationen, aber ohne jede Begleitung und besondere Ausrüstung war es doch wohl zu gewagt. Dazu gehörte vor allem Reittier und Führer ...
Der Abstieg ging natürlich viel rascher vonstatten als der Anstieg. In über einer guten Stunde war ich wieder in der Nähe der Stadt auf Wegen. Ich hatte einen kleinen Bachkañon mit Maultierspuren gefunden, wirkliche echte „Indianerpfade“, denen ich folgte. Denn alle Begriffe von Wegweiser, Farbzeichen, gebauten Wegen und etwa gar Ruhebänken wären im Felsengebirge eine bare Lächerlichkeit ...!
Als ich wieder auf die „plaza“ kam, saß da jetzt die ganze Stadt unter den belaubten Bäumen versammelt. Wie bunt waren die Kleider der Mexikanerinnen! Bei den Weisen einer konzertierenden Kapelle saß man, plauderte, rauchte und sah in die Sonne ... ein genügsames Völkchen!
[S. 208]
Trotz ungewöhnlicher Wärme — es war noch Anfang April — ging ich am Nachmittag noch in anderer Richtung hinaus vor die Stadt, eine Indianerschule zu besuchen, die der Staat zur Ausbildung und Erziehung tüchtiger indianischer Bürger eingerichtet hat. Die Schule war eine Art Internat und großes Pensionat, ein umfänglicher Gebäudekomplex mit Kapelle, Wirtschaftsgebäuden, Werkstätten, Wohn-, Lehr- und Schlafräumen und großen Spielplätzen. Als ich die Schule betrat, strömten die Indianerbuben, große und kleine, gerade aus der Kapelle aus der Sonntagsschule, alle in blauen Uniformen mit blanken Knöpfen, ihrer Schulkleidung. Dann stürmte alles hinaus aufs camp zum Spiel. Ich ließ mich zunächst beim Schulleiter, dem sogenannten „Superintendent“, melden und bat um die Erlaubnis der Besichtigung, was mir auch freundlichst gewährt wurde. Freilich auf eine lange Unterhaltung mit mir ließ sich der Herr „Superintendent“ jetzt an seinem freien Sonntagnachmittag nicht ein, denn er war gerade mit seinem Freund, dem Arzt der Stadt, übrigens einem Herrn deutscher Abstammung aus Michigan, beim Schachspiel. Das mochte er offenbar nicht unterbrechen. Er war zwar gemütlich und entgegenkommend, aber ein wenig unhöflich, indem er vom Schachtisch nicht einmal aufstand, um mir nur die Hand zu schütteln. Aber ich war es ja vielleicht auch, unangemeldet Sonntag nachmittag um halb vier Uhr ihm ins Haus zu fallen. Er fragte, ob ich nicht morgen wiederkommen könnte. Da wollte ich schon in die 1000 m tiefe Schlucht des Grand Cañon sehen ... Also das ging nicht.
Der Schulsuperintendent klingelte seinem Adjutanten, einem der Lehrer der Anstalt, einem Mr. G. Der erhielt den Auftrag, mich zu führen. Was er auch in der allerausführlichsten Weise tat. Mr. G. war selbst Indianer(!), freilich in europäischer Kleidung wie alle die Indianerjungen. Schade! Wieviel romantischer hätten sie in ihrer Nationaltracht ausgesehen! Aber das nennt sich ja „Kultur“, alles Bodenständige, Individuelle und Originelle möglichst auszurotten und alles grau in grau zu nivellieren. So werden auch bald die zivilisierten Indianerjünglinge ihr höchstes Ideal darin sehen,[S. 209] Strohhut, Kravatte, Blusenhemd, Gürtel und Hosenfalten genau nach Neuyorker Vorschrift zu tragen ... Mr. G. führte mich durch die weiten Schlafsäle, in denen die Betten ebenso sauber und ordentlich in Reih und Glied standen wie in einem deutschen Schulinternat, dann in die Baderäume mit ihren Duschen. Waschgeschirr im Schlafzimmer kennt ja der Amerikaner nicht. Hier muß es ein unterhaltendes Schauspiel sein, die 200 munteren braunen kleinen Kerle planschen und spritzen zu sehen. Dann gingen wir durch die Schulzimmer, wo sie an einzelnen Tischchen und auf Schemeln sitzen, in die Werkstätten, wo jeder irgendein Handwerk lernt, in die Anstaltsgärten mit ihren wohlgepflegten Feldern und Obstplantagen — welche Freude, diesen südlichen Reichtum zu sehen! — und endlich zuletzt in die katholische Kapelle, wo Franziskanerinnen die Sonntagsschule halten. Der „disciplinarian“ — das war Mr. G.s offizieller Titel — machte mich auch aufmerksam auf die Unterschiede an den Uniformen der Knaben, wer Kapitän, Adjutant, Leutnant u. dgl. sei. Die Anstalt ist also nach dem Prinzip des amerikanischen self governement der Schüler ein sich selbst regierender Schulstaat, der der Jugend viel Spaß bereitet und mit großem Ernst von ihr bis zum Schulgerichtshof gehandhabt wird. Zu allerletzt führte mich Mr. G. in seine eigene Wohnung und stellte mich seiner Frau vor — einer geborenen Mecklenburgerin! Diese Landsmännin war in Santa Fé, Neumexiko, schon 18 Jahre mit einem Indianer verheiratet! ...

Ich verabschiedete mich mit großem Dank von dem „disciplinarian“, ließ mich dem Herrn Superintendenten empfehlen und begab mich noch hinaus zu dem 20 Minuten abliegenden Spielplatz, wo die Indianerbuben jetzt ihren Sonntagnachmittagsbaseball spielten. Von fern sahen sie in ihren blanken Uniformen fast aus wie preußische Kadetten. Aber nun konnte ich sie auch recht in der Nähe betrachten. Von 10-16 Jahren waren alle Altersklassen vorhanden. Lauter braune stämmige Bürschchen und Burschen mit starken Backenknochen, langem schwarzglänzenden strähnigen Haar und einem leichten Anflug von Kupferröte auf den braunen Backen! Wie merkwürdig! Da[S. 210] lernen nun die Kinder von „Adlerfeder“ und „Falkenauge“ usw., einst der Schrecken der Weißen, Englisch, Geographie und Geschichte, um einmal als Normalamerikaner in Denver oder Chikago oder wo sonst eine kaufmännische oder staatliche Stelle zu bekleiden und im Amerikanismus aufzugehen. Der Stammverband löst sich, ihre Religionen sind gestorben, die Götzenbilder wandern in die Museen, und der Medizinmann findet keinen Glauben mehr. Der Sinn für Krieg und Jagd ist dahin; sie sollen „good citizens“ werden. Reklameindianer bieten in ihren bunten Trachten auf den Bahnhöfen der Santa Fé-Eisenbahn ihre Erzeugnisse, bunte Teppiche und Töpfe, feil oder führen Nationaltänze in den Bars der großen Hotels auf. So endet die alte Geschichte der Indianer in der Neuzeit! Freilich die alten runzligen Weiber in ihren Perlschnüren und die am Feuer kauernden Männer in ihren bunten Decken sind kein dauerndes Menschheitsideal. Aber wehmütig war mir es doch, diese Indianerjungen beim Baseball statt beim Pfeilschießen und Pferdereiten zu sehen ... Im Garten der Anstalt saßen einige ihrer Väter mit braunen runzligen Gesichtern, fransenbesetzten Lederhosen und einem turbanartigen Tuch um das glänzend schwarze, langgeschorene Haar. Ein bißchen heroischer hätte ich sie mir allerdings vorgestellt ...!
Am Abend zog nach dem heißen Aprilsonntag ein Gewitter auf. Stahlblau sammelten sich die Wolken an den Bergen. Über den Schneehäuptern zuckten gelbe Blitze. Sie spiegelten sich in den blendenden Fenstern des adligen Kapitols, dessen Kuppel aus seinen üppigen Gärten mich zum Abschied grüßte. Ich erreichte gerade noch vor dem Gewitterregen den Bahnhof und bestieg wieder den Zug nach Lamy, wo sich heute am Sonntag Abend am Bahnhof ganze Haufen von Indianern in voller Tracht tummelten. Es war immer derselbe Eindruck: Tiefbraune Gestalten, schwarze, langsträhnige Haare, bunte Umschlagetücher und befranste Hosen ... So erwarteten sie den Kaliforniaexpreß und boten während des Aufenthalts ihre ohne Tonscheibe geformten und mit der Hand schön bemalten Tonwaren an.
[S. 211]
Es war schon dunkel geworden, und ich war wieder im Schlafwagen. Leider durchfuhren wir gerade jetzt in dieser Nacht eine sehr interessante Gegend am breiten und reißenden Rio Grande entlang, der fast doppelt so lang als der Rhein schließlich sich in den Golf von Mexiko ergießt. Wir passierten Albuquerque, wo sich die Eisenbahn nach dem Zentrum Mexikos abzweigt, nach El Paso, Chihuahua und Mexiko ... freilich eine Reise von hier etwa noch zwei Tage weit. Dürr, eintönig und wenig bewässert ist rings das Land. Yuccapalmen, oft vielemannshohe Kakteen und Wermutsträucher sind die einzigen Steppenpflanzen, die hier fortkommen. An den Berghängen gedeihen Föhren und Zedern ...
Als ich am Morgen erwachte, dehnten sich rechts und links der Bahn wieder ungeheure Hochwüsten, kahle Felsen warfen scharfe Schatten; die Luft war ganz trocken und rein. Sonniges Himmelblau spannte sich über einem rötlich schimmernden Lehmboden. Hier und da sah man halbwilde Rinderherden, die von Cowboys zu Pferde umstellt und umkreist, eingefangen und zur Tränke oder zum Transport getrieben wurden. Herden oft von mehreren hundert bis tausend Stück, ein wimmelndes, buntbewegtes Schauspiel ...
In Winslow — wir sind noch immer 1470 m hoch — war „Frühstücksstation“. Ja, wie das wohltut, einmal wieder aus dem ewigfahrenden Eisenbahnwagen auf 25 Minuten aussteigen zu dürfen, wieder nach einer durchfahrenen Nacht als Mensch auf dem Erdboden sich in freier Luft und Sonne zu ergehen und die steifen Beine wieder bewegen zu können! Alles stürmte aus dem wieder zur Heimat gewordenen Wagen in den „Speisesaal“ der Station. Zum ersten Male bedienten hier chinesische Kellner, ein Zeichen, daß wir uns Kalifornien näherten, das sein Angesicht schon gen Asien wendet. Was man also in Amerika alles antrifft! Das Bild wurde immer bunter: Neger, Indianer, Chinesen, dazu die ganze Völkerkarte Europas ...
Wohlgestärkt fahren wir wieder ab. Mit zehn Pullmanns und zwei Maschinen fauchen wir über die Hochebene. Nach etwa zweistündiger Fahrt stoppt der Zug auf ein Flaggensignal mitten in der Wüste.[S. 212] Was ist los? Ein Unglück? Sind wir an einer Station? Bahnwärter oder Bahnbeamte u. dgl. sind nirgends sichtbar. Ein paar braune Gestalten kauern unter einem Schuppen. Ein einziger Passagier „steigt“ tatsächlich „aus“, d. h. er springt mit einem mächtigen Satz von dem sehr hohen Trittbrett auf das freie Feld der Wüste. Sein Gepäck wirft man ihm kurzerhand nach! Er dankt und winkt. Der Zug fährt weiter. Ob die braunen Gestalten ihn erwartet haben? So sehen also zum Teil „Stationen“ des Kaliforniaexpreß auf der Grenze von Neumexiko und Arizona aus! Hier kann man sich denken, wie leicht es unter Umständen sein muß, Schienen aufzureißen und Züge zum Halten zu bringen ...
Auf über 60 m hoher Brücke setzen wir über den berüchtigten „Diablo Cañon“. Hier haben sich einst blutige Kämpfe mit den Apachen-Indianern abgespielt. Am Horizont tauchen aufs neue hohe dunkelblaue Bergketten auf. Heiß steht die Halbmittagssonne über den sandigen Hügeln. Die kupfernen Drähte längs der Bahn blinken im hellen Sonnenlicht. In der Ferne erheben sich die kraterartigen Gipfel höher und höher; es sind die sogenannten „San Franzisko Mountains“, die aber von der gleichnamigen Stadt noch über 1000 km Luftlinie entfernt sind! Welch einen malerischen Kontrast bilden die gelbe unfruchtbare Wüste und das Tiefblau der Berge! Die Wasserscheide zum Stillen Ozean haben wir überschritten. Der Rio Grande war der letzte Fluß, der noch den Atlantischen Ozean im mexikanischen Golf erreicht. Inzwischen sind wir politisch auch schon in den Staat „Arizona“ eingetreten, der halb so groß wie das Deutsche Reich, doch nur wenig mehr als 100 000 Einwohner zählt. Denn gut ein Drittel von ihm ist Wüste und ein Drittel Hochgebirge. Gemütlich liege ich im reclining-chair und schaue mir unverwandt auch diese neue Welt rings um mich an. Es war schön, so gemächlich durch Wüste, Wildnis und Hochgebirge gefahren zu werden. Man kann auch einmal auf ein Halbstündchen die Augen schließen und ein Schläfchen halten — und versäumt dabei doch nichts Wichtiges. Denn die Szenerie ändert sich sehr langsam, manchmal auf einen halben Tag nicht. Jetzt sieht[S. 213] man draußen eine Zeitlang nur mächtige wilde Lebensbäume als das einzige, das die großartige Monotonie der Hochsteppe unterbricht. Das Leben im Zug ist inzwischen wieder wie das einer Familie geworden. Man kennt sich allmählich gut. Kinder tollen in den Gängen. Man tauscht Leid und Freud miteinander aus. Ab und zu tut man mehr aus Langeweile als aus Bedürfnis einen Gang zu dem Eiswasserfaß am Ende des Wagens. Schließlich wird man auch dazu zu träge. Der „trainboy“ bietet unaufhörlich Postkarten und Obst an. Es ist alles im Zuge vorhanden. Nur neueste Zeitungen fehlen; denn die aus Los Angeles oder Denver sind schon zu alt und ausgelesen. Aber etwa, während man durch Arizona fährt — vielleicht nie wieder im Leben! — irgendwelche Romane, es sei denn der berühmte Indianerroman „Ramona“, oder sonst wissenbereichernde magazines zu lesen, hielte ich in solcher Umgebung für ein Reiseverbrechen.
Auf einmal setzte wieder dichterer Baumbestand ein, je mehr wir uns den majestätischen San Franzisko-Mountains nähern. Aber wie hat man auch hier mit den Baumbeständen gewüstet! Man gab sich in Amerika ja nicht immer die Mühe, regelrecht zu fällen und zu roden. Man brannte die Wälder einfach nieder, um anbaufähiges Land zu gewinnen, ein Verfahren, das vielleicht bei uns in und nach der Zeit der Völkerwanderung geübt wurde. Ganze Reihen halbverkohlter, an- und ausgebrannter Baumstümpfe bleiben einfach stehen und liegen, so daß die Wälder schauerlichen Ruinenstätten gleichen. Teilweise aber sind die Baumruinen auch furchtbare Zeugen ungeheurer Waldbrände, deren es in der Union an 300 000 im Jahre geben soll. Zu ihrer Auffindung verwendet man neuerdings staatliche Forstbeamte mit Flugzeugen, die eine Beobachtung auf große Entfernungen gestatten. Nun möchte man dem völligen Untergang der riesigen Waldungen des riesigen Landes doch nach Kräften wehren ...
„Flagstaff“! Nach etwa 100 km Fahrt von Winslow halten wir wieder einmal. Es ist halb zwölf Uhr mittags. Die herrlichste kühle Bergluft strömt zu den geöffneten Fenstern herein. Wir sind jetzt dicht[S. 214] unter den imposanten, mit Neuschnee halb herunter bedeckten San Franzisko-Bergen. Die herrlichste Alpenlandschaft wie ein Berner Oberland breitet sich vor uns aus! Indianer hocken um ein Feuer gruppenweise in der Nähe der Station auf dem Waldboden. Einige weidende Pferde um sie herum. Auf dem Bahnsteig treffe ich auch einen deutschen Schlächter. Seine Eltern wohnen in Neuyork. Er ging „nach Westen“. Die erste Frage, die übrigens der Biedermann an mich, den Stammesgenossen, richtete, war: „Ob in Deutschland die Züge auch so schnell fahren und so fein sind?“ Ich habe gleich Ja gesagt. Da schaute er mich spöttisch und verächtlich an. Denn auch ihm ging schon nichts über Amerika. Es war gut, daß man wieder einsteigen mußte. An den hohen Bergketten selbst bauten sich reizende Holzhäuser im Stil der Schweizerhäuschen empor. Wie kühl, frisch, rein war hier alles! Von den Bergen, auf deren einem sich das Lowell-Observatorium befindet, wehte frische Schneeluft herab. Hier müßte man bleiben können! Eine idealere „Sommerfrische“ als hier, Tausende von Kilometern von aller Kultur entfernt, könnte ich mir kaum denken. Indianer als Bahnarbeiter schleppten mächtige Balken zum Verladen herbei. Der Holzhandel blüht ...
Nach weiteren 35 Meilen Fahrt sind wir am frühen Nachmittag in „Williams“, der Umsteigestation nach dem „Großen Cañon des Colorado River“, meinem nächsten Ziel, das an Großartigkeit noch die Niagarafälle übertreffen sollte. Williams ist ein kleiner Ort, dessen Bedeutung der Viehtransport und -handel ebenso ausmacht wie der Transport der Reisenden nach dem einzigartigen Naturschauspiel Amerikas ... Von Williams aber hatten wir nach der Grand-Cañon-Station noch einmal beinahe drei Stunden auf einer Nebenlinie zu fahren, obwohl es nur als ein „kleiner Abstecher“ von der Hauptlinie angesehen wird. Täglich geht ein Zug im Anschluß an den Kaliforniaexpreß hin und her. Die Kleinbahn fuhr langsamer als der Expreß über das weite Koloradohochplateau, aber auch sie war recht komfortabel eingerichtet. Drei Stunden lang durchfuhren wir dieselbe Gegend! Die San Franzisko-Berge, durch die man früher[S. 215] den Weg zum Grand Cañon nahm, blieben hinter uns. Kahle grasige Hochebene war jetzt das einzige. Echte Gebirgssteppe rechts und links, bevölkert hier und da nur von nach Tausenden zählenden Schafherden. Ein wenig war sie unserer wenn auch tiefgelegenen Lüneburger Heide vergleichbar, aber im ganzen viel öder, einsamer und unbewohnter.
Unterwegs an Station Willaha halten wir länger, damit die Reisenden in der Nähe sich die gerade statthabende Schafschur, die hier maschinell im Großbetrieb erfolgt, ansehen können. Etwa 5000 Schafe sind im Pferch. Eins nach dem anderen wird wenig sanft gepackt, zu Boden gedrückt, zwischen die Beine eines starken Mannes geklemmt und die Schermaschine rasch über seinen Pelz weggeführt. Abgezogen wie eine Rübe oder Kartoffel und oft aus vielen Schnittwunden blutend wird das Tier dann nach wenigen Sekunden entlassen, um anderen Platz zu machen. Aber mit der sprichwörtlichen Lammesgeduld, ohne auch nur einen Laut von sich zu geben, ließen die Tiere alles über sich ergehen ...
Ein andermal halten wir bei einem kleinen, auf einem Stab angebrachten Blechbriefkasten. „U. S. mail“ steht da. Sonst ist nichts weit und breit zu sehen. Alles schaut aus dem Fenster dem interessanten Schauspiel zu, das hier in der Wüste als wichtige Unterbrechung der Fahrt vor sich geht. Die kleine Postblechbüchse wird nämlich geöffnet und „geleert“! Und aus dem Zug werden einem herbeisprengenden Reiter zwei Postkarten und einige Zeitungen übergeben. Mit diesen sprengt er auf seinem dürren Gaul und in seinen schafpelzigen Hosen in die Steppe zurück und verschwindet im Busch. Post für die Cowboys! Ich denke an den Postverkehr der Millionenstädte. Welche ungeheuerlichen Gegensätze in demselben Lande!
Draußen liegen einige trockene, wurzellos vom Sturm geknickte Föhren. Sie faulen und verwittern. Vor Jahrtausenden sind sie versteinert und heute zum Teil noch in allen Farben schillernd nach Form und Gestalt erhalten. Ganze Wälder von Lebensbäumen treten auf. Die Vegetation belebt sich. Ach könnte man bei den Cowboys einmal im Zelt schlafen und mit ihnen reiten oder auf die San Franzisko-Berge[S. 216] steigen bis an den Schnee! Im Zug preist der Hotelportier der großen Cañonhotels immer aufdringlicher ihre unvergleichliche Unterkunft an, Wagenfahrten, Reittiere, Indianertänze, Zeltreisen und wer weiß nicht was ... Wir nähern uns also unserem Ziel.
Wir halten! „Grand Cañon-Station!“ Nur wenige Schritte, und wie beim Niagara wird eins der größten Naturwunder der Erde sich vor mir auftun ...! Zuvor aber bestelle ich mir im Hotel „Bright angel“ ein Zimmer und lege mein Gepäck ab. Dann will ich in aller Muße und Ruhe das grandiose Naturschauspiel von hier oben genießen. Der Hotelportier ist zur Abwechslung — ein Schweizer! Ein prächtiger, urwüchsiger, unverdorbener Bursche, der seinen volksechten Dialekt unter den englischen Brocken noch nicht verlernt hat. Der Wirt war leider ein etwas allzutypischer, sehr wohlbeleibter, damals oft dem Gläschen am Büfett zusprechender Deutscher, der hier schon recht treffliche Geschäfte gemacht hat. Freilich ist der „Bright angel“ nicht der einzige, aber älteste und verhältnismäßig preiswerteste Gasthof, was bei mir neben den Naturschönheiten immer etwas mit ins Gewicht fiel ...
Und dann trat ich an den Rand des Cañon! Er übertraf wirklich alle Erwartungen! Man stand einen Augenblick wie starr vor dieser märchenhaft-titanischen Naturszenerie, die sich da auftat. Ich war noch nie von einem Naturschauspiel so wahrhaft im buchstäblichen Sinne überwältigt wie hier. Selbst der Niagara — unvergleichlich in seiner Art — tauchte daneben auf eine Weile in den Schatten der Erinnerungen. Ich war in den Alpen gewesen, im Berner Oberland vor der Jungfrau, im Allgäu, in Tirol, im Stubaier, im Ortlergebiet. Aber hier übertrafen die Ausmaße und die grandiose Wucht des Ganzen alles bisher Geschaute. Das konnten gleichsam nur götterhafte Riesen der Vorzeit aufeinandergetürmt haben. So empfand man. Ich stand und schaute ... Wie klein war man dieser Urwelt gegenüber! ... Was ist der Mensch, diese Eintagsfliege auf seinem uralten und urmächtigen Planeten ...?
[S. 217]
Eine wahrhaft ungeheuerliche mit Felstürmen, Plattformen, Nebencañons in allen Farben vom Violett und vollem Rot bis zum satten Dunkelgrün, Gelb und Weiß des Jurakalks schimmernde, unfaßlich weite, nach unten in gewaltigen Terrassen sich stark verengende Riesenschlucht tat sich auf. Mehr einem steinernen Zaubergarten, in dem sich heimlich Riesen ergehen, oder verwunschenen Riesenschlössern vorweltlicher Titanen und Götter mit Zacken, Zinnen und Türmen vergleichbar denn einem Felsental eines einzigen Stromes, das er in Jahrhunderttausenden ausgewaschen und eingefurcht hat.
Oben steht man auf einem völlig flachen und platten, etwa 2000 m über Seehöhe befindlichen Steppenplateau, nur von winddurchwehten, niedrigen, knorrigen Föhren bewachsen, die sich da und dort zu Wäldern verdichten, und dann stürzt es dicht vor einem hinunter in wahrhaft gigantischen Stockwerken von jedesmal mehreren 100 m bis zur Fußsohle, die wieder in einer besonders scharf eingeschnittenen Felsenschlucht anderthalbtausend Meter unsichtbar unter dem Beschauer in der Tiefe des Cañons liegt. Gerade weil der Urheber des Cañons, der Koloradofluß, der in den kalifornischen Golf sich ergießt, völlig unsichtbar bleibt und doch wie Hephästus ständig in der Tiefe arbeitet, rauscht und braust, schafft und weiter sich einfrißt und an der Schlucht in alle Ewigkeit bohrt; wirkt das Ganze noch mystischer und unfaßlicher ... Mitten aber in den steinernen gigantischen Felsenöden erblickt man auf einmal bei schärferem Zusehen etwa 800 m tief unten eine kleine grüne Oase mit einem menschlichen Haus — eine zerbrechliche Menschenhütte in der Welt der Titanen! — das sogenannte „halfway-house“ (Halbweg-Haus) in der Hälfte des Abstiegs zum Koloradofluß. Man kann zu Fuß und auf Maultieren auf sehr steilem steinigen Zickzackpfad in die schaurige Tiefe hinabgelangen ...
Ich konnte mich von diesem riesenhaften Anblick nicht so bald trennen. Ich liebe es immer, auf hohen Bergen, an besonders großartigen Punkten der Natur auf Erden stundenlang allein zu weilen, um die großen, erhabenen Eindrücke und das feierliche Schweigen der immer grandiosen Natur in mich recht hineinzusaugen. Das ist mir dann Lohn[S. 218] genug für alle Anstrengungen, Mühen und Ausgaben der Fahrt. So lag ich schon als Vierzehn- und Fünfzehnjähriger stundenlang auf den Höhen des Schwarzwaldes, etwa dem Hochfirst über dem Titisee oder dem Feldberg über dem Feldsee oder auf dem Sulzer Belchen oder Donon in den Vogesen, als noch niemand daran dachte, sie könnten je wieder französisch werden, und sog die ungeheuren Ausblicke über die Rheinebene, die Gipfelwelt des Wasgaus, den Anblick der vielen kleinen Dörfer und Städte in mich hinein. Wie in einem Tempel geweiht trat man dann den Abstieg und Heimweg an. Es war die Seele gleichsam auf Jahre hinaus geweitet. Alles menschliche Gezänke und Gejage erschien da oben so erbärmlich! Man war eigentlich grundsätzlich von ihm erlöst. Streit um Mode und Meinung, um Richtung und Partei zerfloß vor solchen Erlebnissen wie eine Lächerlichkeit. Es war etwas vom Geiste des Universums in das Individuum geströmt und hatte es frei gemacht. Wie kindisch erschienen nach solchen Eindrücken auf hohen Bergen die Menschen in den großen Städten, die den Hals so lang recken und den Kopf so hoch tragen, da einer auf den anderen herabsieht, weil der eine einen anderen Rock trägt als der andere oder dieser einen geringeren Beruf hat als jener. O über die erbärmlichen und kleinlichen Menschen!
Stunden der inneren Erlösung werden am Rande des Cañon geschenkt — wenn nur nicht zwei Minuten hinter mir sich schon die „Kultur“ in Gestalt der Gasthöfe erhoben hätte samt den typischen Reisenden mit ihrem unnützen Geplauder und Gewäsche. Auf den Bänken am Rande des Cañon müßte etwa angeschrieben stehen: „Alles laute und oberflächliche Schwatzen und Lachen ist angesichts der großen Natur strengstens untersagt.“ Ich saß da, bis es dunkelte, und konnte mich nicht satt sehen. O das wunderbare Rot! Dieses strahlende Feuer des Gesteins um die Zeit des Sonnenuntergangs! Diese Riesenbauten, immer aufs neue großartig in ihrer schweigsamen Pracht! Letzte Sonnenstrahlen ließen jede Wand, jeden Sandfleck noch einmal rot, blau, violett, tiefgelb erstrahlen. Das Farbenspiel an den Wänden des Cañon war fast ebenso wundersam wie seine[S. 219] Größe. Dazu der Kontrast der obersten weißen Juraformation mit den roten und braunen Gesteinsbändern. Hier versagen alle Beschreibungen. Wie ein aufgeschlagenes lebendiges Museum hat hier die Erdoberfläche alle ihre geologischen Geheimnisse enthüllt und ihr Inneres offen und furchtlos aufgedeckt. Man sah wie die letzten Sonnenstrahlen langsam aufwärts glitten. Was für Gründe und Schlünde! Wände wie flüssiges Feuer! Jetzt wurde die rote Schlucht von der Abendsonne nicht mehr erreicht. Aber der gelblichweiße Kalk leuchtete noch lange! Langsam erstarben auch diese Lichter. Der Abend kam. Die kühnen Riesenschlösser verdunkelten ...
Aus dem nahen Föhrenwald ritt eine Gruppe Indianer heraus. Eine bessere Staffage konnte ich mir zuletzt gar nicht wünschen. Unter ihnen ein Bursche mit zwei feuerroten Pferden, als seien sie dem Cañon entstiegen. Jetzt halten sie am Rande der Riesenschlucht. Auch für sie scheint er, obwohl gewohnt, ein immer neues unfaßliches Schauspiel.
Grabgesang für den indianischen Häuptling
Schwarz-Amsel
(Aufrecht begraben auf einem lebenden Pferd am Felsenufer über dem
Missouri.)
Die braunen Burschen mit Federn und Bogen, gestickten Mokassins und prachtvollen warmen, weichen Decken — angenehm jetzt in der wehenden Abendkühle — verschwanden in einigen nahen Lehmbauten, wo sie — man sieht es durch die offene Tür — ein Feuer entzündeten. Malerisch säumten ihre bunten Kopfbinden das langsträhnige glänzend schwarze Haar ...
Geschminkte und gepuderte reisende Damen kamen jetzt daher und richteten ihre Lorgnette auf die Söhne der Natur. Da wünschte ich[S. 224] mir eine Geißel ...! Drinnen aber im Hopi-house, der Lehmhütte der angekommenen Hopi-Indianer, schaukelte friedlich ein Baby auf einem von der Decke an zwei Stricken hängenden Brett. Ein Älterer der Rothäute trat jetzt mit einer blitzenden Axt vor die Hütte, um Holz zu spalten und das Feuer zu entfachen. Diente nicht diese Axt wilderem Zweck? Am liebsten wäre ich zu der um das Feuer in der Hütte hockenden Gruppe gegangen und hätte mich unter sie gesetzt und mit aus ihrem Napf gegessen. Und Karl May war nie solcher Anblick vergönnt! — —
Nach dem Abendessen im „Bright angel“ trat ich noch einmal an den Rand des Cañon. Der Mond übergoß jetzt mit blendendweißem Licht die grellbleichen Kalkfelsen, die da in den schauerlichen Grund abstürzten. Welch eigentümliches Licht! Aber auch hier fehlte die Komik der Kultur nicht. Elektrische Bogenlampen erhellten frech und frank rings die Nacht um das Hotel! ... Fledermäuse umschwirrten sie. Glühlämpchen am Cañon! Welche Stillosigkeit! Auf den Bänken saßen einige Hotelburschen, deren Arbeit zu Ende war, und sangen süßmelancholische Negerlieder aus Kentucky und Tennessee! Vor dem Hopi-house aber tanzte — verhülle dein Haupt — für ihnen auf den Boden zugeworfene Kupfermünzen die Gruppe der Hopi-Indianer indianische Volkstänze. Sieben bis acht Männer, Frauen und Kinder waren es. Es war ein merkwürdiges rhythmisches Stampfen und heiseres Schreien, das durch eine Rassel in der Hand unschön unterstützt wurde. Die Frauen tanzten barfuß mit Blumensträußchen in den Händen, bald neben-, bald hintereinander zierlich und rhythmisch sich wiegend, die Männer in ihren Mokassins. Indianertänze im bleichen Mondschein vor der Indianerhütte am Rande des Cañons waren also der letzte Eindruck dieses Tages! Den nahm ich mit in meine Träume der Nacht ... —
Für den anderen Tag hatte ich mir vorgenommen, den Abstieg auf dem schwierigen und sehr mühevollen „bright-angel-trail“ in den Cañon zu wagen. Aber nicht mit Maultier und Esel, Führer und Pferden, Zelten und Proviant, mit geputzten Herren und gepuderten[S. 225] Damen, Dienern und Troß, sondern allein zu Fuß und mit ein paar Brotscheiben in der Tasche ... Allein, Auge in Auge, wollte ich der Nacktheit der Natur und den titanenhaften Schroffen des Kolorado gegenübertreten. Hoffentlich störte mich heute kein Menschenschwarm und -geschwirr, keine schwatzenden, beschleierten und lorgnettierenden Damen oder politisierenden Männer ...

Ich nahm also einstweilen Abschied von der bewohnten Oberfläche der Erde, um mich in die Eingeweide ihrer Unterwelt zu begeben. So kam es mir vor. Oben blieb die Menschheit zurück, und ich stieg der Tiefe zu, wie der Bergmann in den Schacht fährt und der Taucher in den Ozean sinkt. Fast so war es mir zumute. Hoffentlich gab mich der Cañon heil der oberen Erde wieder. Je weiter ich stieg — jeder Tritt war mit Vorsicht zu wählen, und jeder Schritt eine kleine Leistung — desto ungeheuerlicher wurden die Ausmaße der Abstürze. Und so tief man auch hinabstieg, immer neue Felsenabstürze gähnten unter mir, immer ferner rückte die Randhöhe des Plateaus oben, immer weiter wurde die Spanne von Rand zu Rand der Riesenschlucht. Welche Entfernungen, welche Tiefe, welche Steilheit des Felsenpfads! Welch schauerliche Felsöden! Man kam sich vor wie in einem Riesengefängnis, das kein Schließer zu verschließen braucht. Drüben aber die in der Morgensonne leuchtenden roten Zacken, Zinnen, Türme und Wände, die noch kein menschlicher Fuß betrat.
Etwa zwei bis drei Stunden bin ich mühsam allein hinabgestiegen. Kein Laut störte die Einsamkeit. Kein Vogel kreiste über den unfruchtbaren Felsmassen. Nur da und dort rollte ein Steinchen, das unter dem Tritt sich löste, springend, hüpfend mit ein wenig Geklirr in größere Tiefen. Es hallte der eigene Schritt wieder von den nächsten Felswänden. Ein paar niedrige Kakteen wuchsen zwischen den Steinen und ein paar blühende Anemonen ...
Ich landete auf einem Plateau, halbstündig im Geviert. Eine kleine grüne Steppeninsel inmitten der Felsmassen lag vor mir, von etwas quellendem Wasser berieselt. Das „half-way-house“, der Rastort der Touristenkarawanen, war erreicht. Ich kletterte noch vor bis[S. 226] an den Rand des eigentlichen engeren Flußcañons, wo es schwarz und steil in die Tiefe geht. Aber weiter wage ich mich nicht. Ich hätte gerne dort unten meine Hand in den Kolorado gesteckt ... Aber jeder Schritt tiefer kostete zwei mühsame Schritte nachher wieder herauf. Und hinauf war es weit länger und anstrengender als hinab. Würde auch das Wetter halten? Der Himmel hatte sich dunkel umzogen ...
Ich mochte eine halbe Stunde am Rand des letzten Absturzes gelegen haben, wie Jakob das Haupt auf einen harten Stein gebettet, und hatte in die Felseinsamkeit und den Himmel gestarrt. Vom Kambrium bis zum Tertiär lagen wohlabgezeichnet alle Schichten von unten nach oben übereinander, rote Granite, dunkelbraune Gneise, mattgrüner Schiefer, dunkelroter Kalkstein, rot und weißgebänderte Sandsteinformationen und zuoberst hellgrauer Kalk. Von Rand zu Rand spannt die Riesenschlucht oben etwa 15 km, bis 1½ km ist sie tief, und der Fuß auf der Sohle ist noch an 100 m breit. Bei Hochwasser kann der Kolorado bis um 70 m steigen! Wie mag der erste Weiße, der Goldsucher Garcia Lopez de Cardenas im Jahre 1542 gestaunt und gebebt haben, als er diese teuflische Schlucht, die bis 350 km (also etwa von Berlin bis über Prag hinaus) lang ist, zum ersten Male erblickte! Was besagen diesen Maßen gegenüber alle die Klamms Oberbayerns oder selbst die Elbrinne unserer sächsischen Schweiz? 1869 unternahm es zuerst der kühne Major J. W. Powell, den Koloradofluß durch den Cañon hindurch im ganzen 1600 km weit zu befahren! — — —
Ich hatte mich erhoben, um wieder anzusteigen. Und ich tat gut daran. Wolken und Nebel fuhren dichter über die Felszinnen. Ängstlich huschten die Eidechsen in ihre Steinritzen. Als ich eine kleine Stunde mühsam bergangeklommen war, brach um mich ein Schneesturm los! Im Nu tanzten wilde Flocken und hüllten mich ein. Kein Mensch war weit und breit. Orkanartig brauste es die Wände entlang. Verschwunden war mit einem Male der Zaubergarten samt allen seinen Farben. Im Schneesturm, in Nebel und Wind mutterseelenallein an eine Felswand gedrückt, wartete ich das Wetter ab. Der[S. 227] Steilpfad war zwar kaum zu verfehlen. Ein Verlorengehen war nicht gut möglich. Und ein Tornado oder eine Windhose, die mich am Ende nach dem anderen Rande des Cañons entführte, würde ja hoffentlich nicht gerade kommen.
Vorgestern noch in Santa Fé ein Sommergewitter und heute in derselben Höhe und Breite ein Schneesturm im April unter 36 Grad Breite! Welche Kontraste doch dieser Kontinent barg!
Vom anstrengenden, steinigen, steilen und eiligen Steigen klopfte mir das Herz bis zum Halse hinauf. Eine Zeitlang barg ich mich in der schützenden Nische an der Felswand. Die Hände waren mir eiskalt, aber am Rücken troff mir der Schweiß! Das Schneegestöber nahm zu. Ich war früh aufgebrochen. Die reitenden Karawanen hatten es vorgezogen, oben zu bleiben oder waren auf dem Viertel Weg wieder umgekehrt. Als ich endlich nach viel Mühe, durchnäßt und durchfroren wieder oben war, lag der Schnee auf den Hoteldächern und der Terrasse! ... Man glaubte sich in eine Winterlandschaft des Riesen- oder hohen Erzgebirgs versetzt und wärmte sich gern am behaglichen Kamin mit seinen mächtigen glimmenden Holzklötzen ...
Die Nacht erquickte die vom Ab- und Anstieg ausgereckten Glieder wunderbar. Es war die zweite Nacht am Rande des Cañons. Wie würde morgen das Wetter sein?
Am anderen Morgen war auch noch Nebel und Schnee. Die Tiefen des Cañons waren dicht verhüllt. So konnte ich also nicht einmal rechten Abschied von ihm nehmen. Wir fuhren erst wieder unsere drei Stunden bis an die Hauptlinie nach Williams: Pußta, Prärie, Heide — immer dieselbe Großartigkeit! In Williams ging es wieder — weniger angenehm nach der herrlichen Berg- und reinen Steppenluft — in die seit drei Tagen nicht gelüftete „chair-car“ des Chikago-Los Angeles Expreß, mit dem ich vor zwei Tagen hier angelangt war. Viele Auswanderer saßen wieder drin mit Kind und Kegel. Kalifornien ist seit dem Goldfieber von 1848 noch immer das Land der Sehnsucht aller[S. 228] Auswanderer. Unaufhörlich geleiten die Pazifikbahnen den fremden Menschenstrom in das gelobte Land am Stillen Ozean ... Die Bahn senkt sich. Der Nebel streicht über die Föhren wie über irgendeine deutsche Heide. Weite blaue Bergländer tun sich in der durchbrechenden Mittagssonne auf. Wir halten in Ash-Fork, einer Bahnkreuzung. Aber es ist nicht mehr als ein Dorf, dessen Straßen aus Holzplanken bestehen! Die Häuser sind buchstäblich auf den Sand gebaut. Aber bald wird auch hier eine „main-street“ (Hauptstraße), ein paar lunchrooms, eine general merchandise sein, und wohl auch ein oder zwei kleine Holzkirchen stehen. Links und rechts erheben sich mächtige Kraterhügel, wie unvermittelt auf das Plateau aufgesetzt. Schnaubend zieht die Bahn, nach der Durchschreitung des felsigen Johnsons Cañon, wieder in die Höhe. Neue Aussichten über weite, wellige Hochländer öffnen sich. In gewaltigen Kurven dampfen wir das Grasland hinan. Und weit und blau spannt sich der Himmel über dem ungeheuren Lande. Wem gehört hier dies alles? Niemand? Die Dämme sehen alle noch recht frisch und unbewachsen aus. Einige armselige „fences“ (Hürden) zeigen einige private Besitzer an.
In „Seligman“ wird die Uhr zum viertenmal seit Boston um eine volle Stunde nachgestellt: Nun ist „Pacific time“! (Die Union ist ja etwa 17mal so groß als das Deutsche Reich, also rund viermal so lang und so breit. Darum kommen wir in Deutschland mit ein und derselben Görlitzer Zeit aus, d. h. die Sonnenzeit in Köln und Königsberg differiert nur etwa um eine Stunde und die Görlitz-Berliner Zeit hält das Mittel inne.) Wir setzen auf wohlvollendeter Brücke über einen völlig wasserlosen Cañon. Dann dehnen sich wieder endlose gelbgraue menschenleere Steppen, blendend im Sonnenschein mit scharfabgezeichneten Schatten auf dem sandigen Boden säumender Bergreihen. Wie rein und klar ist hier die Luft und wie sonnig! Wenn ich jetzt alle die durchfahrenen Distanzen überdenke: Eine volle Nacht von Boston bis Buffalo! 15 Stunden von Buffalo nach Chikago. Und von Chikago bis zum Pazifik waren es vier Tage und drei Nächte! Bädeker hat recht mit seinem lakonischen Satz im Vorwort: „In[S. 229] Amerika lasse man alle engen Vorstellungen zurück.“ Wer Freude an einer wochenlangen, fortgesetzt wechselnden Bahnfahrt haben will, hat bloß zwei Möglichkeiten dazu, entweder mit der sibirischen oder einer amerikanischen Pazifikbahn zu fahren.
Was für Zukünfte schlummern noch in diesem ungeheuren Land der Rassen und Schätze an Eisen und Kohle, Weizen, Mais und Baumwolle, Vieh, Gold, Quecksilber und Petroleum! Davon ahnen die kleinen Italienerkinder noch nichts, die im Mittelgang unseres Wagens einander fröhlich haschen. Die Geschwindigkeit läßt etwas nach. Kleine Steppenkolonien tun sich auf, deren Häuser wie kleine Badehütten an einer Düne stehen. Ein paar völlig weltverlorene Stationen, wo nichts weiter als ein Stationsschild mit Aufschrift die Haltestelle bezeichnet und ein paar Schuppen für Hirten stehen. Die einzigen Tiere, die man zu Gesicht bekommt, sind hier merkwürdig kleine, dünnbeinige, aber wahrscheinlich sehr ausdauernde Steppenpferdchen ...
Weiße Wölkchen stehen sonnendurchschienen am blauen Himmel. Im Wagen spielen die Männer gelangweilt Karten, essen, schlafen, schmökern aus Zeitungen, trinken Eiswasser und träumen von der Zukunft. Wer rauchen will, muß für eine Zeit den am Ende des Zugs befindlichen allgemein zugänglichen, aber engen smoking-room aufsuchen. Recht nachahmenswert!
Ein Kolonistendörfchen mit etwa 15 Hütten zeigt sich unter ein paar grünen Bäumen. Ob nicht in zehn Jahren hier eine Stadt sein wird? Dann wird die Landschaft wieder steiniger, als es auch in der arabischen Wüste kaum sein könnte. Aber die Menschen erscheinen hier viel ruhiger und gelassener als im Osten. Es jagt sie keine „City“ mit ihren Untergrundbahnen und Autos. Die Natur ist auch zu groß hier für Hast und Hitze. Selbst die typischen kleinen Kirchen sieht man hier kaum noch. Sind die Menschen hier darum gottloser? Ich kann mir das in dieser Naturszenerie gar nicht vorstellen.
Gegen Abend — wir nähern uns jetzt der Grenze des Staates Kalifornien — werden die Randgebirge wieder höher. Stundenlang geht es durch dieselbe eintönige Wüste. Leben hier wilde Tiere? Und[S. 230] was für welche? Kein Wölkchen trübt mehr den purpurroten Abendhimmel. Unter einigen Kakteen, Yuccabäumen und Palmen hocken ein paar runzlige Indianerfrauen. Station Kingman. Das Gelände ist jetzt von ganz südlichem Charakter. Was wir daheim in Treibhäusern und Palmenhäusern bestaunen, wächst hier wild. 100 Meilen wieder seit Seligman! Dazwischen haben wir nicht einmal gehalten! Wozu auch? In den namenlosen Bergen und Felscañons? Rötlich schimmern die einsamen Bergketten im Abendlicht. Arizona trägt seinen Beinamen „das Land der schönen Sonnenuntergänge“ nicht umsonst. Sand um Sand, purpurschimmernde Kraterhügel wie von Riesenmaulwürfen aufgeworfen. Wie mit der Schere ausgeschnittene Bergketten, die sich scharf vom blanken Himmel abzeichnen.
Hier könnte man sich, da die Stationen 100 Meilen auseinanderliegen, bei Nacht einen Zugüberfall sehr gut vorstellen. Tatsächlich fand einer gerade in dieser Gegend zwei Tage später, als ich schon in San Franzisko war, in der üblichen Weise statt, über die sich niemand in Amerika mehr aufregt: Schienenaufreißen, falsche Signale, Aufspringen auf die Lokomotive, Überwältigen von Lokomotivführer und -heizer, Durchsuchen des Packwagens, Einschüchterung der schlafenden Reisenden mit vorgehaltenen Revolvern ... Dann geht es wieder weiter. Man rührt sich nicht, und ohne Blutvergießen geht es vorüber! Aber was machen sie hier in den Fällen von Maschinendefekt und ähnlichem? Das mag eine hübsche Zeit dauern, bis hierher eine Reservemaschine kommt!
In dem nahen Flußbett sieht man Wagenspuren. Wüsten um Wüsten. So hätte ich mir Arizona nicht vorgestellt, so einsam und verlassen. Wie völlig anders waren dagegen die Staaten am Atlantik! Und was soll hier wachsen? Endlose purpurn erglühende Bergzüge. Wie Goldkronen liegen die letzten Sonnenküsse auf den rückwärtsliegenden Felsbergen ...
Wir setzen über einen sehr breiten Strom. Es ist der Kolorado River, der den Cañon durchströmt; eine Ebene öffnet sich am Fluß. „Needles“ ist erreicht am Eingang zum Goldland Kalifornien, genannt nach den[S. 231] in der Ferne wie spitze „Nadeln“ aufsteigenden Porphyrketten. Die Bahnlinie hat sich wieder mächtig gesenkt. Die Hochebenen sind verlassen. In eiliger Fahrt war es in mannigfachen Windungen hinab dem Koloradofluß zugegangen, der hier kaum noch 200-300 m über Seehöhe aus den Bergschluchten tritt! Hier ist alles subtropisch, ja fast tropisch. Kaum aber daß ein bißchen Naß das Land besprengt, da sprießt es auch schon in ungeahnter Üppigkeit. Man sieht die Männer hier auch abends im Frühling nur in Hemdsärmeln.
Es ist Zeit, das Abendessen einzunehmen. Wie ausgehungert eilt alles zu den Fleischtöpfen ... Geradezu mystisch schön sind die Tinten an dem unbeschreiblich kristallklaren Abendhimmel ... Dann geht es nach 25 Minuten Aufenthalt wieder in die Nacht hinein. Die Mondsichel tritt klar und scharf heraus. Wir fahren durch die Mojawewüste. Ich wache in der Nacht einmal auf, als wir in Dudlow halten. Funkelnd steht der Orion am Himmel. Laut zirpen Tausende von Grillen durch die milde südliche Nacht. Von den San Bernhardinobergen sehe ich freilich nichts, auch nichts von den erloschenen Vulkanen und ausgetrockneten Salzseen der Mojawewüste ...
Aber wie verwandelt ist das Bild am Morgen! So wie wenn man durch den Gotthard fährt und auf der anderen Seite des Tunnels, nachdem die Wasserscheide der Alpen durchschritten ist, eine andere Welt findet. So wachen wir in der Frühe, als wir von den San Bernardinobergen (3500 m!) in die Ebene in sausender Fahrt herunterfahren, bei feuchten Morgennebeln auf, die schon vom Stillen Ozean herandringen; das Berg-, Steppen- und Wüstenklima Arizonas ist völlig verschwunden. Es herrscht nebliges Seeklima. Um sechs Uhr rüttelt mich der Neger an der Schulter: Noch 40 Minuten bis Los Angeles! Aufstehen!
Nun, da war es ja Zeit, sich zu erheben und wie immer auf dem Oberbett sitzend anzukleiden und sich fertigzumachen. Für die meisten Mitreisenden bedeutete die Ankunft in Los Angeles viel mehr als für mich! Die meisten kamen jetzt an ihr Lebensziel, in ihre neue Heimat, sowie wir etwa damals in Neuyork nach über 3000 Meilen Seefahrt[S. 232] landeten, so „landeten“ sie jetzt nach einer Bahnfahrt von 4000 km von Neuyork oder 3000 km von Chikago — also fast ebenso großen Entfernungen wie von Europa! — an der Küste des Stillen Ozeans. Als ich zum Wagenfenster hinausschaute, bot sich ein völlig veränderter, fast märchenhafter Anblick dar. Tagelang waren wir durch grasige Steppen und einsame Hochebenen, über sandige Wüsten und durch felsige Cañons gefahren, und jetzt fuhren wir auf einmal durch die ausgedehntesten prächtigsten Weingärten, vorüber an ganzen Alleen von Pfeffer- und Orangenbäumen, vorbei an den herrlichsten mit hohen Palmen bepflanzten Straßen und den saubersten, malerischsten, von den üppigsten Pflanzungen grünumrankten und unter Blütenpracht förmlich begrabenen Landhäusern und Landstädtchen. Zitronen und Eukalyptus, Orangen, Palmen und Wein, Akazien und Agaven, welche ein märchenhaftes Paradies, noch viel üppiger und blühender als das fruchtbare Oberitalien! Und Los Angeles’ Umgebung ist vielleicht wieder die Krone des ganzen herrlichen Landes. Aber, lieber Leser, sage das nicht laut in San Franzisko! Du könntest auf offener Straße dafür niedergeschlagen werden. Und jedermann würde es recht finden! Denn es gibt auf Gottes Erdenrund kaum zwei aufeinander eifersüchtigeren Städte als San Franzisko und Los Angeles, die beiden ehrgeizigen Königinnen Kaliforniens ... Wir halten. Ich steige aus. Am Ziel! Eine Welt von Bildern und Eindrücken, was mit zum Großartigsten der Welt gehört, war an mir vorübergezogen.
Los Angeles hat einen schönen und stolzen Namen. Als spanische Gründung 1781 wurde es „La Puebla de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles“ („Stadt unserer Herrin der Königin der Engel“) genannt. Erst seit 1846 ist es bei nur 1600 Einwohnern (!) amerikanisch geworden. Noch 1880 hatte es noch immer kaum 50 000 Einwohner, heute bald eine halbe Million. Als ich aus dem Bahnhof trat, sah ich zunächst noch nichts von seiner paradiesischen Herrlichkeit, noch von seinen 130 Kirchen, eher konnte ich an seine 2000 Fabriken glauben. Schmutzig und düster erschien die nächste Umgebung. Der erste Kampf ging wieder einmal darum, mit heiler Haut aus dem[S. 233] Geschrei der Kofferträger, Transferagenten, Hotelportiers, Autos und Kutscher herauszukommen. Lastwagen wirbelten auf den zum Bahnhof führenden Straßen genug Staub auf ... Ich sah japanische, chinesische Anschriften, den Fremden einladende Herbergen der Heilsarmee ... dann schlug ich mich durch bis zur Innen- und Geschäftsstadt. Banken, Läden, Warenhäuser wie überall. Es hielt mich diesmal auch nicht lange in der Stadt. Geschichtliches bietet sie gar nichts. Ich strebte so schnell wie möglich nach dem Stillen Ozean, von dem „die Stadt der Engel“ noch immer 35 km entfernt liegt!
Möglichst rasch und entschlossen ging ich zu dem Bahnhof der ausgezeichneten elektrischen Lokalschnellbahnen, die nach jeder Richtung von Los Angeles in die Umgebung streben. Ich bestieg sofort einen Zug, der geradewegs nach San Pedro am Pazifik fuhr.
Mit Schnellzugsgeschwindigkeit waren wir in 40 Minuten dort ... Noch war es wolkig, und Morgennebel lag über den Feldern. Erst ging es eine Weile durch weniger reizvolle Vorstädte, Chinesenviertel und Arbeiterquartiere und an allerlei Schuppen und Lagerhäusern vorbei. Dann kam ein Geländestreifen mit reizenden Landhäuschen, tief in das üppigste südliche blühende Grün eingebettet: Palmen, Gummibäume, Eukalyptus, Orangen, Rosen, Geranien, Yuccas und Granatbäume in paradiesischem Wechsel. Danach wieder lange unangebaute grasige Steppen. Die Gegend glich in manchem der zwischen Rom und Ostia in Italien. Zuletzt erhoben sich rechter Hand die San Pedroberge. Und vor uns dehnte sich gewaltig — der Stille Ozean! Wir hielten in der kleinen Hafenstadt San Pedro an der San Pedrobai.
Grau und etwas wolkig mit mäßigem Wellenschlag lag der Stille Ozean da. Er schien seinem Namen Ehre machen zu wollen! Nun war mir an seiner Küste das Angesicht Asiens, Japans und Chinas zugewendet! Im Hafen lag ein großer Dampfer, der „President“, der gerade nach San Franzisko in See stechen wollte. Ein Stück weiter links schaukelte sich ein kleineres Dampfboot von nur 600 Tonnen, nicht viel größer als unsere Rheinschiffe, zur Abfahrt bereit nach der[S. 234] sonnigen Insel Santa Catalina im Stillen Ozean. Sie ist 25 Meilen von der Küste entfernt, also etwa zwei Drittel soweit wie Helgoland von Cuxhaven. War ich einmal am Stillen Ozean, so wollte ich auch auf den Stillen Ozean! Also schnell ein Billett gelöst und auf der Ozeannußschale, dem „Cobrillo“, eingeschifft!
Nach kaum 20 Minuten stach er mit Menschen wohlgefüllt in See! Er fährt täglich einmal am Vormittag hinüber und am Nachmittag wieder zurück. Ich hatte es gut getroffen. Bald nach der Abfahrt hellte sich der Himmel langsam auf. Nach einer Stunde Fahrt verschwand die kalifornische Küste hinter uns. Man sah nur noch das Wasserrund des Ozeans. Nicht lange danach tauchten vor uns matte Linien ziemlich stattlicher Berge auf, die ersten Wahrzeichen des einsamen Eilandes draußen ...
Die Meerfärbung war noch eintönig grau. Mehrmals hielt ich die Dunst- und Nebelgrenze auf dem Wasser schon für die Küstenlinie, aber so schnell waren wir nicht dort! Die Dünung der See war mäßig, aber für das kleine Boot schon beträchtlich. Wir waren kaum zum Wellenbrecher hinaus, da erbleichten auch schon die meisten Gesichter der mitfahrenden Damen. Der kleine Kasten stieg tüchtig auf und nieder oder rollte rhythmisch von einer Seite auf die andere. Einige Frauen sanken blaß ihren Männern in die Arme, andere stürzten gleich mit dem Deckstuhl um ... Möwen folgten uns noch lange ...
Je näher wir dem Eiland kamen, desto deutlicher wurden seine Umrisse. Jetzt erkannte man auch schon Felsabhänge und kahle und grasige bis zu 600 m aus dem Meer ansteigende Bergabhänge auf ihm. Wie ein Blinklicht glänzte das helle Dach eines Sommertheaters uns entgegen. Solange wir auf See waren, war es fast kühl. Als wir nach zweieinhalbstündiger Fahrt in die Bucht von Avalon einfuhren, brach die Sonne leuchtend hervor, und eine wohlige Wärme empfing uns auf der basaltischen Insel ...
Recht spaßig war die Landung. Während wir in die Bucht hineindampften, empfing uns eine ganze Menge kleiner Ruderboote, aus[S. 235] denen uns die Bootsführer schon auf ziemlich beträchtliche Entfernung ihre Hotels, Pensionen, Bars, lunchrooms, Wagen, Boote usw. durch das Sprachrohr anpriesen, mit echt südländischer Lebhaftigkeit einer den anderen überschreiend. In gleicher Weise wurden wir einst auf der ähnlich gelegenen und ähnlich anmutenden Insel Capri empfangen. Die meiste Reklame machte ein Boot mit einem „gläsernen Boden“, unter dem ständig ein nackter, brauner Schwimmer einherschwamm, um des Bootes und des Wassers Durchsichtigkeit zu zeigen! Auch ein Sport! Wieder andere tauchten unaufhörlich nach ins Wasser geworfenen Fünfcentstücken, deren sie in wenigen Minuten mehrere schwimmend und tauchend heraufholten und triumphierend und wie Seehunde triefend auf die nasse Ruderbank ihres Bootes zum Beweis und als Lohn niederlegten. Als wir endlich auch noch die prüfenden hämischen Blicke der Badegäste am Landungssteg passiert hatten, hielten wieder die porters, Agenten und Hotelburschen uns mit Geschrei und Anpreisungen auf; eine resolute Wirtsfrau aber übertönte sie alle, indem sie mit einer mächtigen Klingel in der Hand laut schellend vor ihrem lunchroom auf- und ablief, bis sie ihn voll Ankömmlinge hatte. Und Appetit hatte die Seefahrt ja gemacht ...
Dann erging man sich in den wundervollen sattgrünen und sonnigen Anlagen am Strande des Seebades, wo sich Hotel an Hotel und Villa an Villa reihte. Weit ins Innere begab ich mich nicht. Ich fand es am schönsten, mich an einer etwas abgelegenen und einsamen Stelle am Strande zu lagern und als freies Kind der Natur dem Spiel der ankommenden sich brechenden Wellen zuzuschauen und dem heiseren Bellen der plumpen Seelöwen zu lauschen, die nicht weit vom Strand auf wasserumspülten Klippen ihr lustiges Spiel trieben, bald mit ihrem glatten, geschmeidigen Körper ins Wasser gleitend, bald triefend wieder aufs Trockene emportauchend.
Wie warm schien die Sonne auf Sand und Steine! Einige Möwen kreisten zu meinen Häupten. Ein ganz milder Wind wehte von der See herein: Leicht und klar umplätscherte mich das Wasser des Ozeans.[S. 236] Die Wiese herab blühten unzählige weiß und lila leuchtende Blümlein. Es waren einzige Stunden der Erholung und des Unberührtseins von Welt und Menschen. Nach einer Stunde kam den Weg an den Felsen entlang als einziger Mensch eine alte weißhaarige Dame geschritten, die ihren üblichen Nachmittagsspaziergang machte. Eine schwarze Dienerin trug und hielt ihr den Sonnenschirm über den Kopf. Wie sie mich plötzlich von ferne am Wasser im warmen Sand ruhend erblickte, kehrt sie erschreckt um. Die Taucher und der Glasbodenschwimmer lagen derweilen auch in ihren Bademänteln, auf neue „Arbeit“ wartend, am Strand unter den Hotels. Der „Cobrillo“ rauchte friedlich aus seinem Kamin in der Bucht. Die Seelöwen bellten immer noch, und die resolute Wirtin hatte ihr lautes Schellen eingestellt. Welche paradiesische Ruhe hier! Welche nervenstärkende Stille und wohlige Wärme an diesem glücklichen Strande! Und wie lockend mußte es sein, diese paradiesische Insel wie ein Robinson nach allen Richtungen zu durchstreifen ...
Um dreieinhalb Uhr rief der Cobrillo mit seiner Sirene wieder seine Fahrgäste zusammen, auf daß man noch zum dinner abends nach Los Angeles kommt. Vier Stunden Aufenthalt waren mir wie ein Tag auf diesem paradiesischen Eiland vorgekommen. Die See war jetzt ganz ruhig geworden. Die ersten Fahrgäste überschritten schon wieder den schwankenden Landungssteg und suchten sich gewitzigt von der ersten Fahrt die Mittelplätze beim Schornstein aus. Die Taucher gingen wieder an ihre „Arbeit“. Der nackte, braune Glasbodenschwimmer ruderte sein Boot hinaus. Da mußte auch ich meinen Strandwinkel verlassen und warf mich wieder in die Tracht des wohlbekleideten Kulturmenschen. Ach, daß das Schönste immer am schnellsten vorübergeht! Und es bleibt allein die Erinnerung ...
Bei völlig ruhiger See und vollem Sonnenschein stachen wir wieder auf dem kleinen Dampfer in See, dem Kontinent entgegen. Die Berge hoben sich in unserem Rücken wieder höher und höher. Eine alte spanische Missionskirche über dem Hotel Metropole und Grand View winkte uns den Abschied zu. Die Möwen flogen auch wieder[S. 237] mit uns heimwärts. Und die Hochzeitspärchen an Bord hatten bei der Rückfahrt keine ungewollten Umarmungen mehr zu befürchten ...
Um sechs Uhr liefen wir wieder in San Pedro ein. In der Abenddämmerung rasten wir die 23 Meilen nach Los Angeles mit der elektrischen Schnellbahn in 40 Minuten zurück. Und als ich wieder nach diesem eindrucksvollen Ausflug die „Main Street“ durchschritt, brannten bereits die vornehm wirkenden Glaskandelaber in den Hauptstraßen von Los Angeles und machten sie zu wahren Wandelgängen unter freiem südlichem Himmel. Alles Volk, besonders die flirtende Jugend, zog die Hauptstraße unter den brennenden Kandelabern auf und ab, eine allgemeine südliche Mode wie in den Hauptstädten Italiens und Spaniens, wo man sich erst abends recht aus den Häusern wagt. Mein Abendessen nahm ich bescheiden in einem sogenannten „help-yourself“-Restaurant. Da tritt man zu den langen Büfettreihen selbst mit einem Tablett in der Hand, nimmt sich Teller, Messer, Löffel, Gabel und stellt sich selbst aufs Tablett an Speisen, die ständig am Büfett bereitstehen, was man begehrt. Bei dem letzten Büfettfräulein erhält man dann einen Zettel, auf dem sie alles blitzschnell addierend, angibt, was das selbstgewählte Menu kostet. Der Preis wird beim Ausgang an einer Kasse entrichtet. Äußerst praktisch wie alles in Amerika und zugleich auch recht appetitanreizend! Außerdem spart man die Ausgabe für Getränke und Bedienung, die ja bei uns oft noch ein Drittel Aufschlag bedeuten. Man ist auch schneller fertig, macht anderen Platz, wischt den Mund, stellt das abgegessene Geschirr zur Seite, bezahlt und geht, denn „time is money“. Ja hier gab es sogar noch Abendmusik gratis dazu!
Dann ging ich auch einmal in ein „show“, ein einfaches Theater, um den Abend nützlich zu verbringen. Es hatte drei Ränge, die an fast gefängniskahlen Wänden umliefen. Der Vorhang war, ehe er aufging — echt amerikanisch! — mit Reklamen bedeckt! Das Theater saß ziemlich voll junger Leute, Weiße und auch Chinesen! Der Eintrittspreis war nicht gering. Das Spiel dauerte zweieinhalb Stunden. Aber es wurde dabei geraucht; andere aßen Orangen und Bananen.[S. 238] Die Schalen warf man einfach unter die Sitze! Erst kamen allerlei recht üppige Balletts, die anscheinend besonders den anwesenden Halbwüchsigen gefielen, dann trat eine tauchende Dame in schwarzem Trikot auf, zuletzt kam ein amerikanisches Drama: „Die City“, in dem die Gefahren und die schließliche Verzweiflung eines von der City Zermalmten geschildert wurden. Die Taucherin sprang und hüpfte und schwamm wie ein Aal; behend und schlank war sie wie ein Reh. In dem Drama wurde eine wohlhabende Bankierfamilie einer Landstadt geschildert: Sohn und Tochter streben nach Neuyork. Der konservative Vater warnt vergeblich. Ein natürlicher Sohn desselben fordert Geld von ihm und droht ihm im Weigerungsfall mit Erschießen. Das erregt den Alten so, daß er darüber stirbt, nicht ohne seinem rechten Sohn den Grund offenbart zu haben. Zehn Jahre später steht dieser vor seiner Wahl zum Gouverneur in Neuyork. Seinen Halbbruder hat er zu seinem Sekretär gemacht. Seine Schwester will sich von ihrem trunksüchtigen Mann scheiden lassen, weil sie ihren Halbbruder liebt, ohne um sein Geheimnis zu wissen. Ihr echter Bruder offenbart ihr, daß ihre mit ihm bereits heimlich geschlossene Ehe nichtig ist. Daraufhin erschießt verzweifelt der Halbbruder die Gattin, die seine Schwester ist. Er wird verhaftet und dem Gericht übergeben. Die Sünde der Väter rächt sich an den Kindern! Der Held des Stückes schließt: „Nicht die City verdirbt den Menschen, sondern der Mensch die City. Die City offenbart nur, wer sich in ihr zu behaupten vermag und wer nicht.“ Man ging ergriffen. Draußen umwogte einen die wirkliche „City“ mit ihrer Dollarjagd und ihren Versuchungen. Welch erschütternde Bekenntnisse hatten mir Freunde anvertraut! Es menschelt überall sehr und immer in gleicher Weise in der Welt, aber im ganzen scheint man in Amerika schamhafter und „moralischer“ zu sein, wenn auch oft prüder. Die Witzblätter dürfen nicht so offen geil wie zuweilen bei uns sein. Die Prohibition hat sicher auch hier ihre unschätzbaren Verdienste ...
Am anderen Tag hoffte ich, Kalifornien, das allein so groß ist wie[S. 239] unser jetziges Deutsches Reich, zu durchqueren. Die Luftlinie von Los Angeles bis Frisko mißt etwa 600 km! Die Gesamtlänge des amerikanischen Kaliforniens beträgt aber etwa 1500 km oder die Entfernung von Memel bis Basel! Freilich beträgt die Breite durchschnittlich nur 300-400 km. Danach kann man sich ungefähr von seiner Größe eine Vorstellung machen. Die Einwohnerzahl beträgt freilich noch nicht zwei Millionen, von denen die reichliche Hälfte in den beiden wetteifernden Großstädten wohnt! Man fährt von Los Angeles 15-16 Stunden mit dem Expreß nach San Franzisko. Ich teilte mir deshalb diese Strecke lieber, um unterwegs noch allerlei mitzunehmen.
Volles sonniges, warmes Wetter begünstigte die Fahrt. Man bedauerte es fast, wieder in den Pullmann steigen zu müssen. Draußen lagen die pinienbewachsenen Berge im hellsten Sonnenschein; ihnen zu Füßen reifende Getreidefelder im April! Viermal wird hier im Jahr Gras geschnitten und Heu gemacht!
Von der Fruchtbarkeit und Üppigkeit Kaliforniens machen wir uns in Deutschland ebensowenig eine zureichende Vorstellung wie von der Wüstenhaftigkeit des Felsengebirges und der Unendlichkeit der Mississippiebenen. Ich fuhr mit der „Line of the thousand wonders“ (Linie der 1000 Wunder) und war auf die „Wunder“ wirklich gespannt. Wie in Italien schimmerten von allen Höhen weißgestrichene Häuschen. Durch die Felder zogen Pflüge, von acht Maultieren gezogen. Rechts grüßten die Berge, links dehnten sich die strotzenden Felder, ganz leicht blau drüben lockte die Linie des Ozeans! Ganze Haine voller Oliven, als ob es graue Weiden wären, flogen vorüber.
Neben mir sitzt, wie ich bald herausbekomme, ein alter Schleswig-Holsteiner, der als Junge in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts schon herübergekommen war. Jetzt war er gut ein Fünfundsiebziger geworden! Er war nicht zurückgekehrt, weil er Preußen haßte und nicht beim Militär dienen wollte. Da ich ständig mit Notizbuch und Bleistift in der Hand zum Wagenfenster hinausstarrte, fragte er mich, ob ich Land kaufen wollte. Daß man bloß zum Vergnügen[S. 240] und zum Studium durch die ganze Union reisen könne, begriff er nicht, am allerwenigsten aber, daß ich wieder in die alte Heimat zurückwollte. Spöttisch fragte er mich — die typische Frage alter verbissener Deutschamerikaner — ob es jetzt in Deutschland auch Straßenbahnen, elektrisches Licht und Dampfheizung gebe, oder ob wir noch Petroleumlampen brennten und mit der Postkutsche führen? Er war nie wieder, verbittert wie er war, in die Heimat zurückgekehrt und konnte sich kaum vorstellen, daß auch bei uns jetzt modernes Leben herrschte. Vielleicht überzeugt ihn unser Zeppelin Z III, falls er ihn noch erlebte, wenn er als „Los Angeles“ die „Stadt der Engel“ besucht.
Bald trat die Bahnlinie ganz dicht und höchst malerisch an den Ozean heran. Die felsigen Berge ließen nun kaum noch Raum für ihre Trasse. 160 km lang fuhren wir an der kalifornischen „Riviera“ hin, die in der Tat der italienischen und französischen nichts nachgibt. Drüben über dem St. Barbara-Kanal sah man die felsige Insel Santa Cruz, die Hänge der Berge über und über mit Blumen übersät, als herrsche hier ewiger Frühling. Schäumend brachen sich die anrollenden Wogen des Ozeans an der Steilküste wie in Rapallo oder Nervi. Auf hoher See zog ein Dampfer mit langer Rauchfahne. War es der „President“ von gestern aus San Pedro? Wo sich das Land wieder ein wenig öffnete, zeigten sich goldgelbe Senffelder, in denen braune Spanier arbeiteten. Von ihnen stammt die Landbevölkerung vielfach besonders um die alten Sitze der spanisch-mexikanischen Missionen herum ab. Dann sah man wieder Gummibäume, Eichen, Oliven und weite Weidetriften. Und so oft die Bahn stieg, weiteste Aussicht über den blauen Ozean! Man wurde die Illusion nicht los, als ob man etwa zwischen Pisa und Genua fahre. Gelb und blau sind die Meeresabhänge in unbeschreiblich prächtigem Blumenflor. Es waren wirklich die „thousand wonders“ keine Phrase! Dann drängten uns mächtige Dünen vom Meer ab. Asphalt- und Petroleumquellen an und in demselben mit den die Landschaft entsprechend verunzierenden Essen und Fördertürmen tauchten auf ...

[S. 241]
Wir hielten in Santa Barbara, 100 Meilen von Los Angeles, dem amerikanischen „Mentone“, einem der Glanzpunkte der kalifornischen Riviera, zugleich einem der mildesten und geschütztesten Winterkurorte der Union, wo man keinen Winter kennt und auch keinen unerträglich heißen Sommer, eingebettet in Rosen und überragt von der alten historischen und höchst malerischen 1786 gegründeten Franziskanermission des berühmten Padre Junipero Serra. Die Bilder des Klostergartens mit seinem Kreuzgang, dem Refektorium, der weißgestrichenen Kirche und den braunen Kutten der Franziskaner zauberten ein volles Stück Mittelalter mitten in das modernste Land der Erde. Noch hatte kein Erdbeben es verwüstet.
Weiter geht es an der Riviera entlang in 100 Meilen nach San Luis Obispo in einem weiten Wiesental. Es wird allmählich warm. In einem von der Mittagssonne blendenden Steinbruch arbeiten halbnackte, braunschwarz gebrannte Arbeiter. Denken wir im Anblick der Kapitols, state-houses und skyscrapers immer daran, wer ihre weißen Blöcke gebrochen und ihre Quadern behauen hat? Wieviel Menschenschweiß klebt doch an jedem Stein der Großstadt! Die Bahn steigt in mächtigen Kehren vom Ozean ab über das Gebirge der Luciaberge 400 m hoch durch sieben mit Holzplanken gestützte und ausgebaute Tunnels hinüber in das Salinastal, wo in weiten wegelosen Eichenhainen halbwilde Rinderherden fröhlich ihr Leben genießen. Ab und zu tutet die Lokomotive mächtig in die Welt hinaus, um Gegenzüge zu warnen, oder klingelt, um Wanderer von dem Schienenweg zu scheuchen. Die weitesten Strecken liegen hier noch unangebaut! Der alte Schleswig-Holsteiner hatte nicht so unrecht. Hier könnte man gut nach Land ausschauen. Was könnte hier aus den Weidetriften noch für ein Etschtal werden!
Wie aus einem Kinderspielzeugkasten tauchten weißgestrichene Landhäuser zwischen dunklem Grün auf. Kleine, schwarze, scheinbar unansehnliche Schweine, halb verwildert, tummeln sich an einem kleinen Sumpf. In Salinas steige ich aus, um Monterey, die älteste Stadt Kaliforniens, einst vor San Franzisko und Los Angeles des Landes[S. 242] Hauptstadt, aufzusuchen. Heute ist Monterey ein ganz stilles Landstädtchen von kaum 2000 Einwohnern an der entzückenden, paradiesischen Montereybucht. Ein Wagen bringt uns auf herrlicher Straße zu einem der komfortabelsten und prächtigsten Hotels der Welt, Hotel del Monte. Seine Gärten und Parks sind weltberühmt, sie bergen in sich alle Pflanzenwunder Arizonas und Kaliforniens zugleich. Man wandelt unter Palmen und riesigen Kakteen, in Alleen von Rosen und Eukalyptus, unter immergrünen Steineichen, Pinien und Zypressen. Es dunkelte schon, als wir aus der Heide wieder ans Meer kamen. Geheimnisvoll tauchte wieder der Ozean, unser Begleiter, auf. Einsame Vögel kreisten am Abendhimmel. Schwarz zogen sich im Dunkel die Dünen am Strande hin. Letzte Lichter tanzten auf dem Wasser ...
Im kleinen Städtchen mit seinen alten, krummen und primitiven Straßen, deren Häuser meist nur ein- oder zweistöckig sind wie in Santa Fé, fühlt man sich bald nach Mexiko und bald nach China versetzt. Chinesischen Wäschern und Fischern begegnet man dort ebenso zahlreich wie den spitzhütigen Mexikanern. Und das Bild wird noch bunter durch die Uniformen der zahlreichen Soldaten des „presidio“. Abends promenierten sie alle durcheinander an den wenigen Läden, den einfachen dairies, drug-stores und bars entlang, die aber nicht viel mehr als erleuchtete hölzerne Buden waren. Besonders viele Aushängeschilder, mit denen zum Eintritt in das Heer aufgefordert wurde, sah man hier:
„U. S. Army. Young men wanted! Good pay! No expenses! Unusual opportunity for travel, education and advancement!“[25]
Nach einem Abendimbiß trete ich in ein Lokal der „Bethlehem-Mission“, in der gerade eine „Erweckungsversammlung“ stattfindet.[S. 243] Sie verläuft ganz heilsarmeemäßig. Zwar ist sie nur halbgefüllt mit einfachen Frauen und Männern; auch Soldaten sind da. Eine Predigerin, eine verhältnismäßig noch junge Dame, steht am Pult und redet unter Singen und Händeklatschen, wozu sie auch bei Haupt- und Kraftstellen die Anwesenden animiert, von der Notwendigkeit der sofortigen Bekehrung. Die Soldaten hörten ganz andächtig zu. Zur Bußbank kam freilich keiner. Da ich es nicht über mich brachte, meine religiösen Gefühle rhythmisch mit anderen zusammenzusprechen und unter Händeklatschen den Takt angebend zu begleiten, entfernte ich mich recht bald wieder. Die geistige Kultur, auch die religiöse, erschien mir zuweilen drüben noch recht primitiv! Vielleicht hätte die Predigerin auf Neger und Navajo-Indianer mehr Eindruck gemacht als auf mich. Freilich war ihr Eifer und sittlicher Ernst höchst anerkennenswert. Man stelle es sich etwa so vor: „God is love“ (klatsch, klatsch!) — „halleluja, halleluja, halleluja!“ (klatsch, klatsch!) usw. Das lag mir noch lange, aber nicht gerade angenehm im Ohr. Hier wirkt mehr das Exerzitium, die Routine und die Suggestion als freie Überzeugung. So preßt und knetet man Seelen, aber gewinnt sie nicht.
Ein herrlicher Morgen brach anderen Tags an, wie es der vorige war am Santa Barbara-Kanal und der kalifornischen Riviera. Strahlendes Blau spannte sich über dem blendend weißgelben Strand und den sanft anrollenden Wogen mit ihrem ewigen Anprallen und Zurückschlürfen. Die chinesischen Fischer wuschen schon ihre Netze, als ich mich auf die Wanderung begab, den herrlichen und berühmten seventeen-miles-drive[26] entlang zu gehen. Bei Pazifik Grove nahm mich ein kühler schattenspendender Fichtenwald auf, in Amerika eine Seltenheit. Mir gingen Schillers Zeilen im Kopfe um:
Immer üppiger wurde der Forst. Auch hier hätten Räuber kommen können und den deutschen Götterfreund erschlagen. Ob mich auch[S. 244] Kraniche oder die Möwen der Monterey-Bucht gerächt hätten? Ich bin die komfortable Straße nicht ganz entlang gewandert, denn 17 Meilen wäre eine Tagesleistung gewesen, und ich wollte den Nachmittag noch nach San Franzisko. So strebte ich aus dem Waldesdickicht nach einiger Zeit wieder heraus und quer hinüber nach dem Strand des Pazifik. Denn der Ozean hatte es mir nun einmal angetan, so oft ich seiner habhaft wurde, ob es auf Coney Island oder an der Battery in Neuyork, in Shirley Point bei Boston oder an der Wasserfront in Chikago, in San Pedro oder auf Santa Catalina war. Das Meer übt seine magische Gewalt über den Menschen. Fast noch mehr als das Hochgebirge hat es etwas Feierlich-Erhabenes und Grenzenloses. Damit wird es zum Auslöser der größten Sehnsucht in uns. Am Meer umspannen wir mit der Phantasie gleichsam das Ganze der Welt: Was liegt da drüben hinter der letzten Wasserlinie? Es zieht uns mit seinen ewig gleichen Wellen weiter und weiter in die Welt hinaus. So lockte es alle Seehelden, daß sie Leben und Wohlfahrt in die Schanze schlugen und sich auf gebrechlichem Fahrzeug der ungewissen Weite anvertrauten, um neues Land zu erobern. Aber das Meer übt auch eine wunderbar gemütheilende Wirkung. Nicht bloß seine reine salzige Luft, sondern ebenso seine Weite und Größe. Sie macht alles Kleine unseres Lebens klein und alles Große groß:
Diese Goetheworte durchlebte ich, als ich wieder am Strande lag, mich ganz der großen Natur hinzugeben. Ich wollte ja auch nicht einen Rekord des Rasens durch einen Kontinent aufstellen, sondern zugleich mitten in allem Schauen und Lernen mich noch ein wenig selbst finden. Freilich war weder Boston noch Buffalo, weder Chikago oder sonst eine große Stadt erholsam, aber um so mehr der Tag am Grand[S. 245] Cañon, die Stunden auf Santa Catalina und nun an der prachtvollen Bucht des für Amerika uralten Städtchens Monterey in Kalifornien. Schon 1602 waren hier die Spanier gelandet, als es noch kein Neuyork noch Boston gab, und nannten die Siedlung, die sie schufen, nach dem damaligen Vizekönig von Mexiko, dem Grafen von „Monte Rey“. Und so blieb „Monterey“ Hauptstadt des Landes bis zur amerikanischen Besitzergreifung 1846, zweieinhalb Jahrhunderte lang, denn lange gab es weder ein San Franzisko noch ein Los Angeles! Dann aber mit dem plötzlichen fabelhaft schnellen Aufschwung dieser beiden Handels- und Hafenstädte versank Monterey in seinen Dornröschenschlaf, aus dem es wohl nie wieder erwachen wird. Nur die „Kurgäste“ und Globetrotter, die die Bucht, das Hotel del Monte und Pazifik Grove besuchen wollen und den „seventeen-miles-drive“ unter viel Getute und Benzingestank entlang kutschieren, bringen etwas Leben und Geld in den stillen malerischen Erdenwinkel, der noch immer mit seinem alten Zollhaus, seinen alten Forts und seiner katholischen Missionskirche ungefähr ein Bild der Zustände vor zwei, ja fast drei Jahrhunderten zu bieten vermag.
Da wo ich mich in den feinen weißen Sand der Bucht, noch fast zwei Stunden vom Städtchen, einwühlte, war niemand als die goldene Sonne, die so warm und wohlig die in Tropfen blinkende Haut entlang rieselte und so sanft trocknete. Einige dicke Algen lagen angespült neben mir am Strand, so dick und hart wie Schiffstaue oder Gummischläuche; von den Seelöwenfelsen hörte man das heisere Bellen der spielenden glatten Tiere. Nautische Signalglocken erklangen melodisch unter Wasser, die bei Nebel den Schiffer vor den Klippen warnen sollen; Pinguine watschelten behäbig mit ihren leuchtenden weißen Westen auf den Felsenkanten und erhoben ein mörderisches Geschrei, als ich ihnen ähnlich froh und frei in die sacht anrollenden Wogen entgegenschritt. Gibt es einen herrlicheren Naturgenuß, als wenn die goldene Sonne uns auf Brust und Schulter küßt, wenn die reine Ozeanwoge spritzend uns umspült und wenn nur blauer Himmel Dach unserer Zelle ist? Warum wird uns solch Glück so selten zuteil?[S. 246] Warum hüllen wir törichten Kulturmenschen uns auch im heißesten Sommer in so viel unnütze Kulturhäute? Wer vermag schneller und voller zu heilen als Licht, Luft und Sonne?
Aber auch diese goldenen Stunden verrannen nur zu schnell. Ein paar Ruderboote nahten mit ächzenden Schlägen und scheuchten mich aus meinem sonnigen Bade. Auf der Düne lag das verlassene Wrack eines Segelbootes. Ein großer Dampfer zog am Horizont mit langer Rauchfahne vorüber. Kam er von Frisko und fuhr nach Los Angeles? Als ich mich angekleidet und wieder nach Monterey zurückkehrte, kam ich wieder an allerlei Fischerdörfern vorüber, wo die Chinamen ihren Fang sortierten, ihre Netze wuschen und mir recht erstaunt nachsahen. Auf einem Sandplatz übten die Soldaten ...
Damit mußte ich der schönen Bucht von Monterey Lebewohl sagen. Ein Eilpersonenzug führte mich am Nachmittag nach San Franzisko. Mein meterlanges Rundreisebillett war nun allmählich schon recht klein geworden.
Wieder ging es durch blühendes Obst- und Weingelände. Das scherte einige Gemütsmenschen im Wagen nicht, den Handkoffer auf den Knien als Tisch benutzend Skat zu spielen! Von der Kreuzung Pajaro ging es hinüber an den Santa Cruz-Bergen vorbei, die man auch in der Bucht von Monterey sich erheben sieht, in das Tal des Guadeloupe River. Wieder welch ein breites, schönes, wohlangebautes Tal! Etschtalerinnerungen! Die üblichen weißen Holzdörfchen mit ihren weiß angestrichenen Kirchlein erschienen.
Golden stand die Abendsonne im Westen. Der brakeman, d. h. der farbige Bremser oder Hilfsschaffner, schreit mechanisch die Stationen aus. Es steigen nur immer Leute zu, die „to the city“, nach „Frisko“ wollen. Es ist, obwohl April, so warm wie bei uns im Juli! Bei Santa Cruz, am anderen Ende der Montereybucht, steht noch ein Rest vollkommen vorgeschichtlicher Urwälder, ein Hain von 20 Riesenbäumen der sogenannten „big trees“, die zum Teil einen Umfang von 21 m und einen Durchmesser von 7 m erreichen! Kaum sechs Männer[S. 247] können sie umspannen! Ihre Höhe mißt 100 m und darüber! Ihr Alter wird zum Teil bis auf 3000 Jahre geschätzt! Manche sind so mächtig, daß Wagen bequem durch sie hindurchfahren oder 12 bis 14 Personen auf ihrem Stumpf Platz haben können!
Unser Zug eilte das Guadeloupetal hinab gen San José, an die Südspitze der 35 Meilen langen San Franzisko-Bai. Rechts hoch oben zeigte sich im Abendlicht scharf vom Himmel abhebend auf dem Mount Hamilton, der mit seinen 1354 m über der Bucht bald wie der Rigi über dem Vierwaldstätter See ragt, die berühmte Lick-Sternwarte wie ein weißer Punkt, eine der größten Sternwarten der Welt. Der Bürger James Lick hinterließ nämlich bei seinem Tode 1876 in San Franzisko ein Vermächtnis von 700 000 Dollars zur Begründung einer Sternwarte. So wurde sie eine der ersten und bestausgestatteten der Welt. Die Linse des großen Refraktors hat heute einen Durchmesser von 100 cm! James Lick selbst hat sich — höchst originell — im Fundament des Fernrohrs beisetzen lassen, so daß man also buchstäblich auf seinen Schultern stehend den Himmel beobachtet! Die Aussicht soll, wie sich denken läßt, überaus großartig sein, nicht weniger großartig als einer der unvergleichlichen Blicke durch das Rohr selbst.
Bald tauchte auch links eine Merkwürdigkeit auf. Wieder eine echt amerikanische hochherzige Stiftung! So wie Rockefeller die gesamte Universität Chikago, eine der besten und großartigsten der Union, gestiftet und Carnegie fast jeder amerikanischen Stadt eine Volksbibliothek geschenkt hat, so hat nicht weit von der Station „Palo alto“, wiederum nach einem mächtigen Rotholzbaum so benannt, das Ehepaar Leland Stanford aus San Franzisko zum Gedächtnis an ihren einzigen früh verunglückten Sohn eine Universität mit einem Grundkapital von nicht weniger als 30 Millionen Dollars gestiftet; sie heißt daher „Leland-Stanford-Junior-Universität“. Man kann vor diesen großzügigen amerikanischen Stiftungen nicht Achtung genug haben. 1891 wurde die Hochschule in prächtigster Umgebung und mit den prächtigsten und stilvollsten Gebäuden eröffnet. Man fühlt sich in ihren herrlichen Hallen und Gängen nach Athen zu Platos und Sokrates’[S. 248] Zeiten versetzt. Das Gelände selbst gehörte einst dem Stifter und war ein über 3000 ha großes Gestüt. Heute ergehen sich dort an 2000 Studenten, darunter Hunderte studierender Damen!
Während unserer Weiterfahrt nahmen die Reklamen und die Besiedlung ständig zu, ein Beweis, daß wir uns einer Großstadt näherten ... Um acht Uhr mit Einbruch der Dunkelheit waren wir nach 137 Meilen Fahrt in San Franzisko, der „Stadt des Erdbebens“! Das war fast das einzige Konkrete, was ich von Frisko bis dahin wußte, und daß es der amerikanische Überfahrtshafen nach Japan ist, auch daß es am sogenannten „Goldenen Tor“ liegt.
Ich trat aus dem Bahnhof. Das erste, was mir im Schein der Bogenlampen in der Stadt auffiel, war noch stark unebenes Pflaster und allerlei Unebenheiten in der Fahrbahn. Ja, manchmal waren ganze Buckel auf dem Bürgersteig, da und dort nur notdürftig mit Brettern und Steinen Löcher im Fahrdamm zugeflickt. Das waren die Spuren des Erdbebens! Zum ersten Male im Leben sah ich mit eigenen Augen seine Wirkungen und Verwüstungen. Aber sie waren doch noch viel größer als ich geahnt hatte ...
Nachdem unschöne Viertel mit allerlei bars und shows durchschritten waren, wo des Abends hier ein Heilsarmeesoldat und dort eine Negerfrau und hier sogar ein Chinese auf der Straße predigte — ausgerechnet in der einstigen Stadt der Goldsucher, Abenteurer, Verbrecher und der schlimmsten Korruption — bog ich in die glänzend erleuchtete und von Menschen nur so wimmelnde Market Street ein, wo sich alles erging wie in Los Angeles unter den erleuchteten Kandelabern der Mainstreet. Mächtige Geschäftshäuser, Banken und Hotels erhoben sich da. Nach der Stille der Monterybucht und dem Idyll auf Santa Catalina, den Santa Cruz-Bergen und dem Tal des Guadeloupe River umlärmte mich hier wieder die typische Großstadt, ja Weltstadt. Wenn auch San Franzisko Neuyork an Größe noch weit nachsteht — es hat nur ein Zehntel seiner Einwohner — so ist es doch mit seinem weltmännischen Gebaren das Neuyork des Westens. Schaut man von Neuyork nach Europa, so schaut man[S. 249] von hier nach China und Japan. Der Blick ist beide Male gleich groß und weit übers Weltmeer gerichtet. Freilich trennt von Yokohama beinahe die doppelte Zeit und Strecke als wie von Southampton ...
Aus dem Bezirk der blendenden Lichtreklame, der shows und moving pictures strebte ich quartiersuchend in stillere Straßen. Bald stand ich fast völlig im Dunkeln, wo es nur noch bergauf und bergab ging. Rollende Drahtseilbahnen strebten zu steilen Hügeln hinauf, auf denen San Franzisko gebaut ist. Mein getreuer Bädeker, der noch im Jahre des Erdbebens erschienen war, ließ mich jetzt ziemlich grausam im Stich! Teils waren die Straßen, die ich suchte, vom Erdboden verschwunden, teils waren sie neu- oder anders angelegt. An ganzen Vierteln kam ich vorbei, wo Block an Block noch eine Wüstenei war. Den vollen Umfang der fast unvorstellbaren Katastrophe aber übersah ich erst im Hellen am anderen Tage. Und doch hatte die Energie und die Tatkraft der Amerikaner schon so viel wieder aufgebaut. Aber stärker noch als das Erdbeben hatte wie immer das ausgebrochene Feuer gewütet, das nicht zu löschen war, weil mit den entzündeten Gasrohren auch die Wasserleitungsrohre zerborsten waren und kein Wasser zum Löschen hergaben. Die Einwohnerschaft war in die Parks geflüchtet und mußte Häuser und Besitz ihrem furchtbaren Schicksal überlassen ...
Als ich schließlich in einem sehr sauberen und ordentlichen Privatlogis im Bett lag, konnte ich noch lange keinen Schlaf finden. Immer war mir’s, als bewege sich der Fußboden und das Bett wanke, denn zu unheimlich war der erste Eindruck all der Bodenerhebungen und geflickten Straßenstellen und der zerstörten Stadtviertel im Dunkeln auf mich als Fremdling gewesen ...
Anderen Tages, als die Sonne schien, war es mir fast wie eine Beruhigung. Das Haus stand noch fest, auch die Stadt lag noch ruhig wie tags zuvor. Ich bestieg einen der echt amerikanischen „observation-cars“, der Stadtbesichtigungsautomobile, die ja auch zu uns herübergekommen sind, und ließ mich mit einer ganzen Schar auf den amphitheatralisch angeordneten Sitzen durch die Stadt fahren. Vorn[S. 250] stand der Ausrufer mit dem Schalltrichter, der uns genau erklärte, wo und wie das Feuer ausbrach, und zeigte, wie weit es um sich gegriffen hatte. Man sah noch immer deutlich die Feuerlinie und die Stellen, wo es zum Stillstand gekommen war. Gerade das Zentrum der Stadt war heimgesucht worden; die äußeren Wohnviertel blieben verschont. Aber keineswegs waren alle Wolkenkratzer zuerst eingestürzt. Im Gegenteil, manche hatten gerade dank ihrer festen Konstruktion aus Eisen und Beton standgehalten. Aber das Stadthaus, die prunkvolle kuppelgeschmückte city-hall war trotz ihrer sechs Millionen Dollar Baukosten in 20 Sekunden ein Opfer ihrer zum Teil betrügerischen Konstruktion geworden. Denn sie stammte noch aus der Zeit der Korruptionswirtschaft. Nach dem „Feuer“ — davon spricht man in der Stadt selbst viel mehr als von dem „Erdbeben“, wovon man Stöße wohl öfter verspürt, ohne sie sonderlich zu achten — baute man das Geschäftszentrum zuerst in eingeschossigen Baracken und Holzgeschäftsbuden notdürftig wieder auf und es hieß: „business as usual“. Aber bald begann die Periode des völligen Wiederaufbaus ...
Geradezu ungeheuer war der Ausblick auf die Zerstörung im ganzen. So furchtbar hatte ich es mir nicht gedacht![27]
Allmählich fuhr uns das Besichtigungsauto aus der Stadt heraus — die wie immer die amerikanischen Großstädte außer Hotels und Geschäftshäusern sonst wenig Originelles und Bemerkenswertes bietet — zu dem berühmten Goldengatepark, der zwischen der Stadt und der Steilküste des offenen Ozeans liegt. Die Stadt selbst ist nicht unmittelbar am offenen Pazifik gebaut, sondern an der Bucht, die sich durch die etwa 1½ km breite Öffnung des „Goldenen Tors“ einzigartig 10 km breit und bis 85 km lang ins Land hinein erstreckt. Sie erinnert an Konstantinopel und den Bosporus. Im Norden wird sie malerisch von dem fast 900 m hohen Mount Tamalpais und im Osten von der Schneekette der Sierra Nevada (über 4000 m!) überragt.[S. 251] Von Süden schaut auf sie der Mount Hamilton mit der Lick-Sternwarte von fern hernieder. Ein herrliches Landschaftsbild, groß und glänzend in seinen Ausmaßen!
Hatte der Ausrufer uns bisher unter anderem „the largest apartement-store in the world“ gezeigt, so hieß es jetzt „the most beautiful park in the world, the prettiest and largest tennis-lawns in the world“. Am Golden Gate selbst wartete auf uns gar „the largest salt-water-bath-house in the world“. Je weiter man in Amerika nach Westen kommt, desto voller wird der Mund genommen und desto überzeugter ist man, das Größte und Beste von allem „in der Welt“ zu besitzen. Höchst spaßhaft war es für mich als Deutschen, als wir im Goldengatepark an einer Nachbildung von Rauchs Weimarer Goethe-Schiller-Denkmal vorbeifuhren und der Ausrufer durch den Trichter uns anbrüllte: „Mister Gois änd Mister Skill (so ausgesprochen!!), two German poets!“. Die anderen Amerikaner, Japaner, Engländer und was sonst da oben saß, nahm auch davon wohlgefällig Kenntnis wie von einem drug-store oder einem neuen Hotel.
An den Felsen des einstigen stolzen „Cliff-house“, eines höchst komfortablen und aussichtsreichen, aber kürzlich auch durch Feuer zerstörten Strandhotels rollte der offene pazifische Ozean an. Ein dumpfes Brausen, in das sich wieder das heisere Bellen großer Scharen mächtiger Seelöwen mischte, die drüben auf den „seal-rocks“ ihr Wesen hatten. Leider war es etwas unsichtiges Wetter; aber um so geheimnisvoller rollten aus dem Nebel die mächtigen Wogen heran. Am Strande lagen viele einfache Familien mit Kind und Kegel und genossen hier ein billiges Sonntagvormittagsvergnügen. Nur flogen zu hunderten und tausenden ihre Butterbrotpapiere höchst malerisch am Strande herum! Einige Sandplastiker formten berühmte Köpfe wie Washington, Lincoln, Grant, Garfield, auch so mancher eine von der See mit ihrem Kind ans Land gespülte ertrunkene Frau, ja den berühmten Löwen aus dem Gletschergarten von Luzern höchst treffsicher und eigenartig aus dem Sand ... Aber der immer stärker einsetzende kühle und feuchte Nebel lud heute nicht zu allzulangem[S. 252] Verweilen ein. Merkwürdig, über dem Park und der Stadt schien die Sonne, aber vom Ozean heran kroch der Nebel, über dem das Haupt des Mount Tamalpais wie eine sagenhafte Insel schwamm ...
Am Nachmittag setzte ich mit einer der großen und trefflichen Ferrys über die weite seeähnliche Fläche der blauen Bai hinüber nach Oakland, dem Brooklyn San Franziskos, der Stadt der schönen „Eichen“alleen, von denen die Stadt den Namen hat, um Berkeley, den Sitz der prachtvollen staatlichen Berkeley-Universität, zu besichtigen. Auf einem Gartenpavillon wehte eine deutsche Flagge — wie das anheimelte! — und auf der Straße hörte ich einen Mann ganz unverfälscht schwäbeln. Gern hätte ich auch den Mount Tamalpais bestiegen, aber in Berkeley hatte ich es übernommen, Verwandte meines guten Harvardfreundes W. zu besuchen. Ich hatte den Besuch auch nicht zu bereuen, denn die Tochter des Hauses, selbst Studentin, führte mich in der wundervoll in Parks und Gärten gelegenen Berkeley-Universität überall kundig umher. Durch die märchenhaftesten südlichen Haine von Sykomoren, Oliven, Palmen und Kakteen wandelten wir in sinnende wissenschaftliche Gespräche vertieft zu dem prächtigen, in griechischem Stil erbauten „Theater“, in dessen offenem Halbrund ein ausgezeichnetes auch überall sehr gut wahrnehmbares Sonntagskonzert gegeben wurde. Von den Parkhügeln aber ergoß sich ein bezaubernder Rückblick auf die weite blaue Bucht und die ferne Stadt ... Freund W.s Verwandte hätten mich gern gleich da behalten, und ich hätte gleich von Oakland die Weiterreise fortsetzen können, aber einmal hatte ich mein Gepäck nicht da, und dann gab es in Frisko noch manches andere zu sehen. Auch wollte ich die Gastfreundschaft völlig Unbekannter doch nicht zu sehr in Anspruch nehmen und fuhr noch vor Abend mit dem Fährboot wieder herüber. Schon die Fahrt lohnte sich! Mit voller Glut sank die Sonne über dem Goldenen Tor, es wahrhaft vergoldend, während sie früh über den hohen Schneehäuptern der Sierra Nevada heraufzusteigen pflegt. An den Molen und Bahnlinien blitzten die ersten Lichter auf ...
[S. 253]
Ich wollte von Frisko nicht abfahren, ohne daß ich auch seiner chinatown einen Besuch abgestattet hätte. Den Abend pilgerte ich daher ein wenig in das Chinesenviertel der Stadt, das von etwa 10 000 Gelben bewohnt wird. (Mit dem Einwanderungsverbot hat ihre Zahl stark abgenommen. Sie war früher viel höher.) Man soll zwar abends nicht ohne Geheimpolizist sich dorthin begeben! Aber so wie ich mich in Santa Fé arglos ohne Weg und Steg auf einen Berg der Rockies begab, so bummelte ich auch hier des Abends gemächlich tutti solo in die chinatown hinein. Was für ein enges und wimmelndes Leben herrschte da mit eigenen chinesischen Läden, Restaurants, Teestuben und kleinen primitiven Theatern! Die meisten der Gelben saßen allerdings mit ihren weiten schwarzen Blusen und Hosen, ihren Schlitzaugen, dem glattrasierten Schädel feiernd und pfeiferauchend auf Stühlchen in Pantoffeln vor ihren Häusern. Man sah in die offenen Läden, in die sonderbaren Apotheken und Werkstätten hinein. Frauen und Mädchen bügelten Wäsche; Schreiber schrieben Briefe ... alle aber blickten mir verwundert nach. In einem kleinen Basar kaufte ich mir ein paar chinesische Deckchen zum Andenken. Aber nirgends hatte ich den Eindruck, daß man hier einen eindringenden Europäer etwa umbringen wollte. Auch die Chinesen schienen mir im Grunde ein gutmütiges Völkchen zu sein wie die Neger und Indianer. Ja, sind nicht alle Menschen im Grunde gutmütig, wenn man sie nicht gerade reizt oder aufhetzt? In der chinatown traf ich aber auch Araber im weißen Turban und braune Hindus, auch massenhaft Japaner. In Frisko landen Schiffe aus aller Herren Länder; es ist wirklich eine Weltstadt. Der seltsamste Anblick aber war wohl ein Chinese — in Heilsarmeeuniform! Man sieht, wie weltumspannend diese seltsame, aber so rührige und soziale „army of salvation“ ist!
Anderen Tages früh stieg ich in der Stadt zum sogenannten „Telegraphenhügel“ hinauf, eine der höchsten und aussichtsreichsten Anhöhen Friskos. Von oben lag die erhaltene und zerstörte Stadt wie ein Riesenschachbrett vor mir, auf dem ein unartiges Riesenbaby sich ein[S. 254] Vergnügen daraus gemacht zu haben schien, Häuser umzustürzen. Von der Stadt schweifte der Blick zur immer aufs neue schönen blauen Bucht und zu dem Durchlaß des „Goldenen Tors“ mit dem Tamalpais im Hintergrund. Ich hätte ihn gar zu gern doch noch bestiegen — aber woher zu allem die Zeit nehmen? So bin ich auch nicht mehr in den „versteinerten Forst“ bei Calistoga gekommen. Aber ist es nicht auch ratsam, sich auch noch etwas für den — zweiten Besuch aufzusparen? Sonst fehlte ja jeglicher Anreiz und jede logische Begründung für ihn?!
Dicht beim Telegraphenhügel war eine Negerkleinkinderschule, wo die putzigen kleinen Negermädchen und -knaben mit ihren breiten Stumpfnasen und schwarzkrausigen Wollköpfen wie andere Kinder sangen, spielten und lernten ... Nicht sehr weit davon stieß ich auf eine kleine protestantisch-italienische Kirche. Auf was man in amerikanischen Städten nicht alles stößt! Auch die alte spanische Missionskirche „San Francisco de Dolores“, 1776 erbaut, steht noch, die den Anfang des mexikanischen San Franzisko bildete, das noch 1850 nur 500 Einwohner hatte! 1847 wurde es von einem amerikanischen Kriegsschiff für die Union in Besitz genommen. So wurde der ferne Westen eher amerikanisch als die Territorien im Felsengebirge.
Die den steilen Hügel hinabführende Kabelbahn brachte mich wieder hinab zum Hafen. Ein wimmelnder Obstmarkt hatte sich aufgetan! Was für Unmassen Orangen, Bananen, Spargeln wurden hier zu Bahn und Schiff verfrachtet! Dazu die Ausfuhr des feurigen kalifornischen Weins, den auch zuerst spanische Missionare aus Europa einführten. In der neueren Zeit pflanzten Deutsche dazu rheinischen Weißwein. Aus französischen Reben zog man bald auch den vorzüglichsten Bordeaux, Medoc, Portwein und Sherry. Die letzteren freilich südlicher um St. Barbara und Los Angeles.
Frisko ist eine eigene Stadt! Viel Kirchtürme sieht man nicht, aber hier konnte einer, wie mir erzählt wurde, vom „newsboy“, einem armen auf der Straße Zeitungen verkaufenden Jungen bis zum Inhaber einer der größten Blätter sich emporschwingen. Freilich diese Hoch-Zeit der Gründungen ist längst vorüber; das Goldfieber ist[S. 255] längst erloschen. Und der Friscoman steht an Überlegsamkeit heute in nichts dem Neuyorker nach, ja er fühlt sich als sein westliches Gegenstück. Und Los Angeles ist geschlagen! Aber sage es ja nicht in seinen Straßen!
Nachmittags unternahm ich noch einmal eine aussichtsreiche Überfahrt mit dem Fährboot an den Fuß des Tamalpais am Rande des „Goldenen Tors“ nach dem ganz italienisch anmutenden Sausalito. Weißschimmernd leuchteten Oakland und Berkeley mit der Kalifornia-Universität herüber. Rings umher steile Felsenufer. In südlicher Vegetation versteckt baut sich das Villenstädtchen das felsige Ufer hinauf wie nur die alten Städtchen an den oberitalienischen Seen.
Das Wetter war stets bei allem angenehm sommerlich warm, aber nie heiß, obwohl San Franzisko auf der geographischen Breite Palermos liegt! Doch nirgends fand ich trotz all der Naturschönheiten einen rechten Ruheplatz. Der Amerikaner braucht kein Ausruhen. Es fehlen die Bänke oft sogar in den Parks und an Aussichtspunkten. Man kennt kein stillsinnendes Naturgenießen. Auf den Bahnhöfen umbranden einen die Agenten, Schuhputzer und Kofferträger. Die bars und lunchrooms sind nicht immer offen, Gartenwirtschaften gibt es in der ganzen Union nicht. Als Fremder ist man daher drüben richtig auf die Straße gesetzt. Ganz anders der Chinese — den ich auch diesen Abend zum Abschied noch einmal aufsuchte; denn wann würde ich wohl einmal nach China kommen, zumal seit mein einziger treuer Studienfreund Dr. Moses Chiu, den ich noch von Halle her kannte, zu früh in seiner Heimat in Amoy hatte sterben müssen.
Wie seelengemütlich saßen die gelben Zopfträger jetzt wieder vor und in ihren Häusern! Warum? Weil sie mit wenigem zufrieden und weil sie Kinder einer jahrtausendalten Kultur und Schulung sind. Ihr gerades Gegenteil ist der Yankee. Nie zufrieden mit dem Erreichten, ein steter rastloser Vorwärtser und ein Sohn der reinen Gegenwart. Wie behäbig, wie beleibt, wie runzelig neben ihm mancher Chinese, aber auch wie gutmütig aus den Augen schauend, so ungefähr wie eine blinzelnde Katze im Sonnenschein ... —
[S. 256]
Nun hieß es allmählich das noch immer halbmeterlange Zettelbillett zur Rückfahrt stempeln lassen und Abschied nehmen vom Stillen Ozean. Es war mir ein bißchen weh ums Herz. Aber selbst ein Alexander der Große mußte aus Indien umkehren! Mit ihm konnte ich mich trösten, daß es jetzt für mich nicht gleich noch eine Erdhälfte zu durchqueren gab! Ich hätte ja fürs Leben gern jetzt einen der unter Dampf liegenden Japansteamer bestiegen und wäre über Yokohama, Hongkong, Kalkutta oder Wladiwostok, Moskau heimgereist, aber was hätten sie in Harvard gesagt, so ohne Abschied auf und davon zu gehen! Und auch auf der Rückfahrt durch die Union würde es ja noch manches zu sehen geben: Die Salzseestadt, die Wüsten Nevadas, den Pikes Peak bei Denver, Pittsburg, Washington, Baltimore, Philadelphia ...
So setzte ich zum dritten Male abends neun Uhr über die weite Bai. Die Lichter der Stadt funkelten im Wasser. In Oakland stieg ich zehn Uhr abends in den bereitstehenden Chikagoexpreß. Der Schlafwagen war international überfüllt: Auch Japaner, auch Damen ... Aber ich hatte mein Oberbett fest und zeitig bestellt und ließ es mir auch nicht wieder rauben, obwohl nicht alle unterkamen. Wir setzten uns in Bewegung. Bald lag man wieder oben und rollte durch die Nacht. — — —
Um Mitternacht passierten wir Sacramento, die eigentliche Regierungshauptstadt des ganzen Staates Kalifornien mit einem gebieterisch ausschauenden Staatskapitol inmitten herrlichster Anlagen, nach fast 90 Meilen Fahrt und dem Überqueren ausgedehnter Sumpfgegenden und erneutem Übersetzen über einen Buchtarm. Die Bahnlinie überschreitet darauf den Sacramentofluß und sein breites Tal und keucht dann in mächtigen Windungen stundenlang zu den Pässen der Sierra Nevada hinauf. Es wurde nun eine richtige Alpenfahrt wie über den St. Gotthard, nur doppelt so hoch! Schade, daß das nächtliche Dunkel uns die zauberischsten Rückblicke auf die San Franziskobucht verwehrte ...


[25] Amerikanische Armee. Junge Leute gesucht. Gute Bezahlung! Keine Ausgaben! Ungewöhnliche günstige Gelegenheit für Reisen, Ausbildung und Beförderung!
[26] 17 Meilen-Fahrweg.
[27] Der Leser kann sich die Zerstörung gar nicht groß genug vorstellen, sie ist nur mit der Niederlegung und Beschießung ganzer Städte im Weltkrieg annähernd zu vergleichen.
[S. 257]
Am Abend waren wir von der subtropischen Küste des Stillen Ozeans weggefahren, am Morgen wachten wir nach völliger Verwandlung in Höhe von 2000 m in prächtigster Alpenschneelandschaft der Sierra Nevada wieder auf. Die Sierra Nevada ist ein etwa über 700 km langer bis über 4000 m ansteigender schneebedeckter Alpengebirgszug des Felsengebirges, der Kalifornien von der Union so stark trennt, daß diesseits und jenseits des Gebirges völlig anderes Klima herrscht. Die kühlen und feuchten Seewinde dringen nicht bis in die unfruchtbaren heißen Wüsten Nevadas, und das milde gleiche Klima Kaliforniens kennt nicht den stürmischen Wechsel auf den Hochflächen des Felsengebirges und in der nördlichen Mississippiebene.
Erstaunt sah man aus dem Fenster. Auch zwischen den Schienen lag wirklich Schnee! Und noch tags zuvor hatte ich mich wohlig in dem durchsonnten Sand des Ozeans gebräunt. Die Paßhöhe war eben überschritten. In vielen Windungen an steilen Felshängen entlang in schwindelnder Höhe über tiefeingeschnittenen Tälern mit herrlichem dunklen Fichtenbestand, aus dem blinkende Bergseen wie in der Schweiz und dem Schwarzwald heraufschauten, eilte unser Zug, der den stolzen Namen: „China and Japan fast-mail“ trug, auf der ältesten seit 1869 eröffneten Pazifiklinie in eiligem Tempo wieder abwärts.
Viele hundert Meter lange künstliche Holztunnels sicherten die Bahn gegen Schneeverwehungen. Aber aus den Aussichtslöchern boten sich köstliche Blicke in die Bergwelt ...
Im Wagen machte gerade alles Morgentoilette. Und einige der alten Damen packten schon aus ihren Reisekörben ein leckeres Frühstück aus, das in mir so etwas wie Appetit weckte. Auf sauberem Tafeltuch stellten sie Tassen zurecht; dann folgte ein Gang dem andern: Belegte Brötchen, Käse, Obst, kaltes Geflügel, Sardinen, kalter Braten und zuletzt Rotwein! Wer hätte da nicht mittun wollen? Sie hatten sich[S. 258] gut vorgesehen, weil sie wußten, was ihnen bis Chikago bevorstand! Ich aber hatte übersehen, daß zwar unser „China and Japan fast mail“ „the best dining-car-service of the world“ besaß, aber dafür auch keine Frühstücks- und Lunchstationen innehielt wie der Santa Fé- und Los Angeles-Expreß. Und da nun der „beste Speisewagendienst der Welt“ auch offenbar die „besten Preise der Welt“ hatte — z. B. ein Beefsteak einen Dollar! — so war ich diesmal ziemlich aufs Hungern angewiesen, denn meine Reisekasse schmolz und mein Speisevorrat bestand aus — drei Apfelsinen, von denen ich alle drei Stunden eine zu verzehren beschloß, dann würde es gerade noch bis zur Mormonenstadt reichen, wo man wieder zivilen Boden und menschliche Preise unter die Füße bekam. Nachts brauchte man ja glücklicherweise keine Nahrung. So mußte ich mich also diesen Tag mit dem Anschauen der interessanten Gegenden „sättigen“ und mein Getränk dem unentgeltlichen Eiswasserfaß am Wagenende entnehmen. Das tat ich ebenso oft wie jene Kinder, die ein paar Sitze weiter plötzlich in unverfälschtem Dialekt ihren Vater laut fragten: „Du, Pape, ist do’ Wasser in de’ Pump?“, was der Vater mit einem beifälligen lauten Gähnen quittierte. Man war also nie allein, immer wieder unter „Landsleuten“, auch wo man es gar nicht vermutete. Auf der Straßenbahn in Buffalo ebenso wie auf dem Bahnsteig in Flagstaff am Fuße der schneebedeckten himmelaufragenden San Franziskoberge, in Oakland so gut wie in dem Expreß auf 2000 m Höhe in der Sierra Nevada. Also war man nicht nur unter Japanern, die jetzt mir gegenüber in einem blaueingebundenen Buch mit wunderlichen Schriftzeichen lasen — war das eine buddhistische oder taoistische Morgenandacht? — und nicht nur unter Chinesen, die sichtlich als nicht ganz vollwertig von den übrigen Mitreisenden gemieden wurden (Neger wagten sich schon gar nicht in den Wagen) und den breitgesichtigen, stets wohlrasierten Amerikanern. Leid tat mir eine Lady, die in der Nacht, wie ich vor Syrakuse mein Scheckbuch, so jetzt ihr meterlanges Zettelbillett bis Neuyork eingebüßt hatte! Ich kann auch nicht sagen, ob sie es wiedergefunden hat oder noch an ihr Ziel[S. 259] gekommen ist. Helfen konnte ich ihr auch nicht — als allein mit innigem Mitgefühl.
Im Waschraum schwamm es indes förmlich bei so ausgiebiger Benutzung und so völliger Besetzung des Wagens! Es war auch nicht ohne Interesse, daselbst die verschiedenen Rassen und Nationalitäten bei der Eigenart ihrer Morgentoilette und halb im Naturzustande zu beobachten ...! Aber ich hätte einen Dollar geopfert, wenn ich dafür den nachtdurchschlafenen Wagen, der sich nun wieder in einen fahrenden „Salon“ verwandelte, gründlich hätte durchlüften können, eher als für ein Dollarbeefsteak im Speisewagen ...
Es war wieder ein ganz wundervoller Morgen geworden. Warm und freundlich grüßend schien die helle Sonne vom blauen Himmel auf den frischen weißen Schnee herab. Rauschend brausten in der Tiefe der Täler die Gebirgsbäche und schäumten donnernd über die Felsbänke. Die Szenerie glich durchaus der von Göschenen vor dem Gotthardtunnel. Dann und wann schauten Hochgipfel aus den Seitentälern. In unzählig vielen Windungen ging es rollend und bremsend im ganzen etwa 800 m Gefälle abwärts, also ungefähr so viel wie vom Gotthardtunnel hinab zum Vierwaldstätter See, durch zahllose Tunnels mit ihren langen Holzdächern bis zur „Hauptstadt“ des Staates Nevada, Reno, mit seinen 5000 Einwohnern!
Reno liegt ganz an der Grenze des Wüstenstaates Nevada, der bei 300 000 qkm (Größe Preußens!) nur 50 000 Einwohner zählt, also erst auf 6 qkm einen Menschen! Reno hat zwei Merkwürdigkeiten. Erstens ist es Sitz einer „Staatsuniversität“, die aber so geringwertig ist, daß man nach ihrer Absolvierung kaum fähig wird, in Harvard ins Kollege aufgenommen zu werden, d. h. von vorne zu studieren! Die zweite noch größere Merkwürdigkeit ist, daß man in Reno in zwei Minuten geschieden werden kann, so daß von 20 Ehepaaren im Staat Nevada etwa 13 (!) wieder auseinanderlaufen. Günstiger liegt das Verhältnis sonst in der ganzen Union, wo erst (!) auf 10 Ehen eine Scheidung kommt. Das liegt an der gesetzlichen Leichtigkeit der Scheidungen. Schon beiderseitige gänzliche Abneigung genügt zur[S. 260] Trennung. Meist dringen mehr die amerikanischen Frauen auf Scheidung als die Männer. Und doch haben die Frauen es drüben viel leichter im häuslichen Leben als bei uns. Keiner Frau mutet man in Amerika schwere körperliche Arbeit zu. Kein weißes Dienstmädchen braucht drüben Kohlen zu tragen, Teppiche zu klopfen, Stiefel zu putzen u. dgl., erst recht nicht die Hausfrau. Selbst den Kinderwagen schiebt stets der Mann, ebenso trägt und hebt der Mann stets das Kind. Der Mann ist der Frau Knecht. Und sie ist drüben mehr sein Gespiele, seine schöngekleidete und wohlgepuderte Puppe als seine harte Mitarbeiterin. Sie gebietet, und der Mann führt vielfach nur ihren Willen aus. Sie redet, predigt, organisiert, lenkt auch das Automobil! Fast der gesamte Unterricht der Jugend liegt in Händen von Frauen! Im öffentlichen Vereinsleben geistiger und wohltätiger Art spielt sie die durchaus tonangebende Rolle. Die Prohibition war auch wesentlich ein Sieg der Frauen. Sehr groß ist daher auch die öffentliche Rücksichtnahme auf die Frau überall. Ihr wird es nie drüben begegnen, daß sie z. B. je in einem Straßenbahnwagen stehen muß. Auch der älteste Herr macht ohne weiteres der jüngsten Dame Platz! Anders und eigenartig sind auch die Grußverhältnisse. Männer untereinander nehmen nie Hut oder Mütze ab, auch nicht Schüler vor dem Lehrer, denn auch er ist nur ein älterer „boy“. Aber im Gruß zwischen Herr und Dame grüßt der Herr nicht zuerst die Dame, sondern hat zu warten, ob sie ihm mit ihrem Gruß ihre Gunst bezeigt! Eine Dame zuerst zu grüßen würde als so unschicklich gelten, als wenn man bei uns eine fremde Dame ohne weiteres anspräche. Stets geht auch der Herr auf der Außenseite des Fußsteigs, so der Dame die geschütztere Innenseite überlassend. Ja manche reden schon von einem fast femininen Einschlag in der amerikanischen Kultur, deren äußeres Kennzeichen auch das sehr große Wertlegen der Herren auf „style“ (Mode) und ihre Vorliebe für — Süßigkeiten ist. In diesem Licht sind die vielen Ehescheidungen begreiflich. Sie sind nicht Zeichen sittlichen Verfalls, sondern nur der Ausdruck der hohen Ansprüche der Frauen an Leben und Wertschätzung und eines hochgespannten[S. 261] Idealismus, der sofort Verbindungen löst, die dem Ideal nicht mehr entsprechen. Bedenklicher ist schon der Rückgang der Geburten in stockamerikanischen Ehen, so daß sich fortgesetzt das Ursprungsverhältnis der Bevölkerung zugunsten der erst kürzlich eingewanderten ungebildeten Schichten aus Osteuropa verschiebt ...
Wir fuhren indessen in der warmen hügeligen Nevadawüste, die an Einsamkeit, Verlassenheit und Grenzenlosigkeit mit Arizona wetteifern kann. Stationsnamen, wenn der Zug einmal hielt, fand ich selten angeschrieben. Ohne den Ruf: „All aboard!“ setzte sich der Zug langsam wieder in Bewegung. Man mußte dabei zusehen, daß man noch rechtzeitig auf das Trittbrett kam. Auf einer der verlassenen Stationen erstand ich mir eine Tafel Schokolade, die ich mir in die Tasche steckte. Als ich sie aber nach qualvoller längerer Zeit der Selbstverleugnung wieder hervorzog, war sie unter Nevadas Wüstensonne in braunes Wohlgefallen zerflossen und hatte das Rockfutter hübsch braun gefärbt und durchsalbt ... Es war um Mittag heiß geworden. Der Gang zum Eiswasserfaß wurde zur Polonäse!
Immer eintöniger wurde die Landschaft. An einem einfachen Fluß stehen ein paar Kinder und schauen stumm dem Zug nach. Wo ein bißchen Gras sprießt, weiden ein paar Pferde. Sonst sieht man nur Sand und wieder Sand, und zwar so grell und weißleuchtend, daß er im Wagen einen richtigen Widerschein an die Decke wirft und in der Ferne sich spiegelnd gar wie lockende Seen erscheint. Am Horizont prangen in der Ferne blaue Randgebirge. Näherbei sieht man nur Föhrengestrüpp und Wermutgesträuch ...
Im Zug schliefen sie jetzt wie die Fliegen an warmer Wand ihren Nachmittagsschlaf. Ich bin der einzige, der noch krampfhaft und interessiert hinaus ins Land schaut. Auch der Japaner hat längst sein blaugebundenes Buch mit den seltsamen Runen zugeklappt. Die weißhaarigen Damen haben längst den Rest ihrer opulenten Mahlzeiten in ihre Körbe versteckt und die Rotweinflaschen wieder zugekorkt. Auch die Chinesen lehnen gedrückt und müde in einer Ecke. Die Lady, die ihr Billett verloren, hat resigniert die Augenlider heruntergelassen[S. 262] wie müde Fensterläden, hinter denen Lebensverdrossenheit wohnt. Die deutschen Buben, die nach dem „Wasser in de’ Pump’“ frugen, spielen auch schon lange nicht mehr. Alles schläft. Es ist ja auch nichts zu versäumen. Es steigt niemand weder aus noch ein. Der Zug schlingert so durch die Sandwüste wie ein Schiff bei Windstille über das Meer. Man weiß es eben wieder nicht mehr anders, als daß man fährt und fährt und immer wieder fährt. Jeder hat sich in seiner Weise in sein Eisenbahnschicksal ergeben ...
Es ist Goldgräberland, das wir jetzt durchfahren. Verlassene Minen und Bergwerke wechseln mit neuaufblühenden. Manchmal ist eine Siedlung schon auf den Sand hingestellt, aber es sind noch keine Menschen da, drin zu wohnen! Alles sieht aus, wie aus einer Holzbaukastenschachtel putzig, schematisch aufgebaut bis auf die kleine weiße Holzkirche, die nicht fehlen darf. Im ganzen wohnt hier ein robustes und skrupelloses Geschlecht, die Nachkommen echter Abenteurer, wilder Spekulanten, denen Spiel um Geld Sport war und noch ist und der Revolver oft gar leicht und lose im Gürtel sitzt ...
Wer hier zu Fuß gehen wollte! Er könnte wie durch die Sahara waten und verdursten. Den einzigen Schatten wirft weite Strecken nur der Zug. Rötlich schimmern die Felsengipfel. Dann wieder einmal ein paar armselige Hütten mit Menschen darin. Station Paran. Auf dem „Bahnsteig“ am Zug spielen hemdärmlig einige Burschen Fußball! Er ist der einzige planierte Platz. Der Bahn entlang reitet durch den Sand ein Herr und eine Dame im Tropenhelm! Die Sonne steht hoch, die Berge werden immer höher und steiler. Immer neue Berge und Wüsten tauchen im Vorblick auf. Kein Europäer hat ja eine Ahnung, wieviel Tagefahrten breit „das Felsengebirge“ ist, welche riesigen Hochebenen zwischen den drei Hauptgebirgszügen desselben liegen, deren Streifen scheinbar schmalfurchig von Norden nach Süden ziehen! Wieviel Schweiß muß es hier einst gekostet haben, diese Bahn durch die Einöden zu bauen!
So kommt wieder der Abend heran. Wir fahren unentwegt. Wir haben längst schon wieder „Mountain-time“ und die Uhr eine Stunde[S. 263] vorgerückt. Der erste Abend bricht an, da uns die Sonne nicht mehr im Rücken, sondern wieder im Angesicht aufgeht — eine Weissagung auf Heimkehr! Die sandige Wüste färbt sich abendlich graugrün. Die Chinesen sind in ihrer Ecke erwacht und kauderwelschen laut miteinander in der stolzen Sicherheit, daß sie niemand versteht. Mein Japaner liest seinem Kind aus dem blauen Buch vor. Die ältlichen Damen breiten zum Abendessen wieder ihre saubere Serviette aus und entkorken wieder die Rotweinflaschen. Unentwegte Raucher suchen für eine Weile das kleine Rauchabteil auf. Wem es nicht aufs Geld ankommt, der folgt jetzt dem „last call for dinner“[28] des Kellners in den Speisewagen. Die Kinder balgen sich wieder im Mittelgang. Mit dem Abend erwacht alles Leben ...
Wir halten an einer Bahnkreuzung. Eine Reihe immer dünner werdender Telegraphenstangen weist durch die Wüste gegen die Berge ins Wegelose ... Der Lehmboden rings ist trocken und rissig. Jeder Zentimeter Regen und Schnee bedeutet hier Brot. Allmählich bricht Dunkelheit an. Wir fahren immer noch in einer Höhe von 1000 bis 1500 m. In der Dämmerung sehe ich noch durstiges Rindvieh in einem trockenen „creek“ stehen. Niedrige Büsche werfen lange dunkle Schatten. Einige weiße Zelte leuchten im grellen Mondschein. Sind es Bahnarbeiter, Hirten, Goldgräber?
Dann klettere ich — zum wievielten Male? — wieder einmal in meine „upper berth“. Der Salonwagen hat sich wieder in einen Schlafsaal schnarchender Nasen verwandelt.
Am zweiten Morgen wieder eine völlige Verwandlung! Als ich erwacht bin und aus dem Fenster sehe, ist es lichter Morgen. Vom blauen Himmel scheint helle Morgensonne, die noch nicht lange aufgegangen sein kann, und — ist es Traum, Vision oder Wirklichkeit? — wir fahren, obwohl noch immer im Eisenbahnzug, mitten durch einen herrlich weiten glänzendblau schimmernden See, der sich bis an die[S. 264] schneebedeckten Berge der Wasatch Mountains verliert. Rechts und links spülen die Wasser an den mäßig über dem Wasserspiegel erhöhten Bahndamm. Er scheint künstlich aufgeworfen, auf Pfählen und Holzbrücken errichtet. Stundenlang rollen wir so im glitzernden Morgensonnenschein mitten über den großen Salzsee! Vor einigen Jahren hat nämlich die Southern Pacific-Eisenbahn, um die Route nach Kalifornien um 70 km abzukürzen, den Schienenweg auf 37 km langer Holzbrücke mitten durch den an seinen tiefsten Stellen nur 11 m tiefen, aber 6000 qkm großen[29], etwa 100 km langen und 60 km breiten Salzsee (Great Salt Lake) gelegt. Sein Wasserspiegel liegt immer noch 1280 m über dem Meere! Wir befinden uns also wiederum auf einer der riesigen Hochebenen zwischen den Hauptgebirgszügen des Felsengebirges, dem Zentrum des Mormonenstaates „Utah“, eines Staates, der selbst halb so groß wie Kalifornien ist. Als wir den See überquert haben, eilt der Zug durch die lachendsten und wohlangebautesten Fluren und Felder, die den denkbar stärksten Gegensatz zu den unfruchtbaren Wüsten Nevadas bilden.
Ein wahres Kulturparadies breitete sich auf einmal um uns aus, das einem wie einst das „gelobte Land“ den Israeliten erschien, als sie aus der Sinaiwüste heranzogen. Der Schöpfer dieses Paradieses, das vor dreiviertel Jahrhunderten genau so trostlose Wüste wie der größte Teil Nevadas war, ist die eigenartige Sekte der „Mormonen“ oder, wie sie sich selbst nennen, der „Heiligen Jesu Christi der letzten Tage“. Wir hielten zuerst in der ein wenig vom See landeinwärts gelegenen mittelgroßen Mormonenstadt Ogden. Hinter uns lag der schimmernde Salzsee, vor uns wie ein Schweizer Bild die schneebedeckten Wasatch Mountains. In Ogden verließ ich die Hauptroute nach Chikago, um nach der Hauptstadt der Mormonen, der Großen Salzseestadt umzusteigen. Auf sie war ich allerdings schon lange sehr gespannt. Da ich eine Stunde Aufenthalt in Ogden hatte, ging ich etwas in das Städtchen hinein. Nichts Sonderliches war außer[S. 265] einer Mormonenkirche zu bemerken. Überall ruhige Sauberkeit und breite Straßen.
Nach einer weiteren Stunde südlicher Fahrt war Salt Lake City erreicht. Auch zwischen Ogden und Salt Lake City liegen prächtige Feldfluren zwischen wohlgepflegten Pappelreihen, unter denen wohlgebaute gerade Landstraßen hinführen. Allen Reisenden, die einstiegen, und denen, die man draußen erblickte, schaute ich immer mit der stillen Frage ins Gesicht: „Bist du ein Mormone oder nicht? Sehen so die Mormonen aus?“ Ich meinte immer, man müßte es ihnen von außen schon an einer Art sonderbaren Wesens ansehen. Aber das war keineswegs der Fall.
So war es morgens acht Uhr geworden. Klopfenden Herzens steige ich in Salt Lake City aus. Mir war es, als käme ich jetzt in die Stadt des Dalai Lama. Die Lage ist ja derselben nicht so ganz unähnlich. Ich empfand so, wie wir uns in Rom aufmachten, um über den Tiber in das Trastevere zu gehen und in das heilige Viertel des Vatikans und der Peterskirche einzudringen. Mußte nicht dort, so dachte ich, jeder Stein im Pflaster von besonderer Heiligkeit reden und die Luft rings gleichsam geschwängert sein von Andacht? Mit ähnlichen Spannungsgefühlen trat ich aus dem Bahnhof in Salt Lake City auf die sehr breite Hauptstraße und hatte sofort nach wenigen Minuten nach Durchschreitung einiger Bahnhofsquartiere den Eindruck, zum ersten Male in einer peinlich sauberen und trotz ihrer 100 000 Einwohner stillen und ruhigen amerikanischen Stadt zu sein, dazu in malerischster Umgebung. Von gesteigerter Heiligkeit war noch nichts zu bemerken! Die Menschen kauften und verkauften, gingen, fuhren, redeten genau wie in anderen Städten der Weltkinder. Heilig schienen mir die schneebedeckten Berge, die hier wie in Innsbruck die Schneehäupter zur Maria-Theresienstraße hereinschauen. So endet auch in dieser Stadt der Blick meist an den schneebedeckten Wasatch, die südlich bis zum Grand Cañon reichen! Schon in Ogden hatte mir ein eifriger Postkartenverkäufer auf der Straße seine Karten von den Wasatch Mountains mit den Worten angepriesen: „The finest mountain-view in the world!“ Selbstverständlich!
[S. 266]
Ich schritt indessen in das Stadtinnere bis zu dem gebietenden Denkmal Brigham Youngs, des kraftvollen Nachfolgers des „Propheten“ Joseph Smith, des Gründers des Mormonismus. Dann stehe ich in dem heiligen Bezirk der Mormonen, dem „Tempelblock“ selbst, der von einer langen quadratischen Mauer umgeben ist. Aus ihrem Innern erhebt sich mächtig der vieltürmige Tempel und das riesenschildkrötenartig gewölbte Dach des sogenannten „tabernacle“. So stehe ich jetzt an der Stelle, die den Mormonen so heilig und zentral ist wie Rom den Katholiken, wie die Kaaba den Mohammedanern, der Tempelplatz in Jerusalem den Juden und Olympia den Griechen. Aus dem nahegelegenen Mormonenkollege aber strömen gerade die Schüler aus der Morgenandacht.
Echt amerikanisch begibt man sich zur Besichtigung des Tempelbezirks zunächst in das „information-bureau“, wo die Einlaßkarten und Führer zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten zu haben sind. Geld und Geschäft hat bis jetzt keine heilige Stätte der Welt verschont, auch die der Mormonen nicht. Christus schwingt noch immer seine Geißel umsonst.
Unter einem Stimmengeschwirr von Menschen werden wir dann in das „Tabernakel“ geleitet. Wir treten durch die niedrigen Backsteinpfeiler ein; treppauf geht es auf die Galerie in das Innere. Es öffnet sich ein kahler Riesenraum, den eine einzige Deckenwölbung überspannt und der an 10 000 Sitzplätze faßt! Den einzigen Schmuck des Raumes bildet eine mächtige Orgel, an der ein großer Stern mit der Umschrift „Utah 1896“ angebracht ist. Denn in diesem Jahr wurde das bis dahin mehr oder weniger unabhängige Mormonenterritorium als Staat in die Union aufgenommen. Von der Orgel reichen etwa 500 Personen fassende Sitzreihen die Orgelbühne herab, die nur Sitze für Priester und mormonische geistliche Würdenträger enthalten. Denn unter den Mormonen hat fast jeder zehnte Mann irgendeine priesterliche Würde. Das Tabernakel dient zu Gottesdiensten und auch für große Konzert- und Vortragsveranstaltungen. Die Akustik ist trotz des riesigen Raums dank seiner ovalen Anlage und seiner ungestützten[S. 267] hölzernen Wölbung vorzüglich. Man hört auch nur leise gesprochene Worte bis in entfernte Ecken! Das Tabernakel wurde bereits in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts erbaut, ein Zeugnis des Selbstbewußtseins der Mormonen, deren Stadt damals kaum soviel Einwohner zählte als der Raum Sitze! Am Tempel selbst aber baute man von 1873 an Jahrzehnte hindurch.
Wir treten wieder unter den 44 Backsteinpfeilern, den kurzen Füßen der hölzernen Riesenschildkröte, hervor und begeben uns zum „Tempel“, den wir aber von innen nicht besichtigen dürfen! Kein profaner Blick von „Heiden“ (d. h. Nichtmormonen) darf ihn beschauen, ja selbst nicht einmal jeder Mormone kommt in sein Inneres! Als mächtiger sechstürmiger Bau, dessen höchsten Mittelturm eine große Bronzestatue des Engels „Moroni“ krönt, erhebt er sich — freilich ohne erkennbaren Stil — aus dem Grün des schön angelegten Tempelblocks und überragt weithin die Stadt. Er ist keine eigentlich allgemein gottesdienstliche Stätte, sondern dazu bestimmt, der Tempel „des neuen Zion“ zu sein, wo Christus, wenn er in Bälde zum Weltgericht wiederkommt, seinen Thron aufschlagen und das Gericht über die sündige Welt abhalten wird. Etwa vierzig Jahre wurde am „Tempel“ gebaut; vier Millionen Dollar hat er gekostet! Er soll innen aufs prächtigste mit kostbarstem Marmor und edlen Steinen geschmückt sein, erzählte man mir. Je schwieriger es ist, ihn zu betreten, desto geheimnisvoller erscheint das gewöhnlichen Sterblichen verschlossene Bauwerk. Nur Mormonen höheren Grades kommen in ihn anläßlich mormonischer „Versiegelungen“ für die Ewigkeit und „Taufen für Verstorbene“ hinein. Ich hatte vor, — auch amerikanisch! — geradewegs dem Präsidenten der Mormonenkirche, also gewissermaßen dem Papst von Salt Lake City einen Besuch zu machen und ihn angesichts meiner weiten Reise um einen Blick in das Tempelinnere zu bitten, aber wahrscheinlich hätte auch das mir nichts geholfen. Aber vielleicht hätte er mich an seine Tafel geladen? Schade, daß ich es nicht versuchte! Da hätte ich alles leicht aus erster und bester Quelle erfahren, was ich zu wissen wünschte.
[S. 268]
Unsere gesprächige Führerin, die uns auch noch eine kleinere Mormonenkirche, die sogenannte „assembly hall“ aufschloß, die immerhin auch 3000 Personen faßte, und zuletzt uns noch einmal zu einem imponierenden Orgelkonzert ins „Tabernakel“ einließ, hatte natürlich auf recht viele Fragen der Besucher zu antworten. Alles bestürmte sie förmlich um Auskunft über das Wesen und die Lehren des Mormonismus. Ihre Auskünfte waren natürlich nur sehr bruchstückartig und unzusammenhängend, ebenso wie die an sie gestellten Fragen. Aber sie blieb unermüdlich und unerschütterlich: „Der Mormonismus ist wahr! Er ist nicht von Menschen gemacht. Er stammt aus direkter göttlicher Offenbarung. Die christlichen Kirchen sind vom wahren Christentum abgefallen. Die ganze Geschichte der christlichen Kirche ist nichts als ein großer Abfall. J. Smith bekam von Gott durch seinen Engel Autorität, die wahre Religion der Bibel wiederherzustellen und das echte aaronitische Priestertum zu erneuern. Auch die ‚Ordnungen‘ der Ämter hat die Kirche unrechterweise geändert. Die Taufe darf z. B. nicht an kleine Kinder nach mormonischer Meinung erteilt werden! Die Mormonenkirche tauft erst achtjährige Kinder. Es gibt auch eine Taufe für ungetauft Verstorbene. Die Handlung der Buße hat sie erneuert. Die Trauung ist gültig auch für das ewige Leben. Eine Mehrehe — der große Streitpunkt — habe auch Jesus nicht ausdrücklich verboten, im Alten Testament wurde sie sogar von den Erzvätern geübt! Seit 1896 ist freilich die Mehrehe durch Aufnahme in die amerikanische Union öffentlich verboten; geübt wurde sie bis dahin auch nur von zwei bis fünf Prozent der Mormonen. Und Salomo hatte doch auch sogar — darauf wies die Sprecherin nachdrücklich hin — 1000 Weiber! Jeder Mormone hat an seine Kirche den ‚Zehnten‘ abzuliefern. Gott offenbart sich fort und fort durch Propheten, so war auch Joseph Smith beauftragt, neue Offenbarungen zu geben.“ Das ist einiges von den bruchstückartigen Darlegungen der Führerin auf die an sie gestellten Fragen.
Mir genügte das freilich nicht. Im information-bureau kaufte ich mir daher zunächst eine Mormonenbibel „the book of Mormon“, in[S. 269] dem ich auf meiner Weiterfahrt sehr eifrig las, ein kleines schwarzeingebundenes Buch ungefähr im halben Umfang unserer Bibel. Außerdem eine Darlegung der mormonischen Lehre von einem mormonischen Theologen. Und endlich schenkte mir in demselben Bureau ein alter Mecklenburger, als er mein intensives Interesse wahrnahm und mich als Deutschen erkannte, noch eine Schrift „the great apostasy“, in der die Geschichte der Kirche als „der große Abfall“ von dem wahren Evangelium dargestellt wird. Der Mecklenburger schüttelte mir bewegt die Hand, ich möchte auch noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, und schloß mit dem Bekenntnis: „My heart feels satisfied“. Neuerdings hat Professor Eduard Meyer anläßlich seines Aufenthalts in der Union eingehende Studien über den Mormonismus angestellt und veröffentlicht. Danach ergibt sich geschichtlich das Folgende, das sowohl für die Geschichte und Zustände der Union als auch die religiöse Mentalität drüben im Ganzen äußerst charakteristisch ist:
Der Gründer der Mormonensekte, Joseph Smith, ist am 23. Dezember 1805 als vierter von neun Geschwistern in dem Dorf Sharan im Staate Vermont geboren. Sein Vater war — echt amerikanisch — bald Handelsmann, bald auch Schullehrer. Ruhelos zog er von Ort zu Ort und ist nie zu beständigen Verhältnissen gelangt. 1815 siedelte er nach Palmyra im Staate Neuyork über, darauf nach Manchester, N. Y. Die Mutter des Propheten, Lucy Smith, war ebenfalls die Tochter eines Abenteurers namens Salomon Mack, der erst bei einem Bauern arbeitete, dann Soldat und Marketender in den Indianerkämpfen und Religionskriegen des ausgehenden 18. Jahrhunderts war, später als Matrose diente und zuletzt um 1810 als fast Achtzigjähriger in höchst fehlerhafter und unorthographischer Sprache eine Erzählung seines Lebens mit mancherlei Träumen und Visionen herausgab! Dieses Erbteil ging auf die Mutter des Propheten über, die zeitlebens an Visionen litt und ihren Sohn überlebte († 1856). Auch sie gab von ihren inneren Erlebnissen in einer Selbstbiographie Kunde. Religiöse Fragen haben das Elternpaar stets beschäftigt;[S. 270] auch Vater Smith erlebte allein sieben Visionen. Der Eltern äußere Lebensumstände können gar nicht armselig genug gedacht werden, und doch waren in ihrer Hütte wie in den meisten amerikanischen vor über 100 Jahren die Axt und die Bibel die am meisten gebrauchten Gegenstände. Von diesen Eltern, von beiden Seiten her also aufs stärkste visionär erblich belastet, stammte der „Prophet“. Schulbildung hat er bei dem ständigen Umherziehen seines Vaters nur vorübergehend genossen; Lesen und Schreiben konnte er Zeit seines Lebens nur dürftig; an Träume und Visionen glaubte er seit frühester Jugend. Und schon früh bedrückte sein religiöses Gemüt die Frage, welche von den vielen Sekten wohl die rechte sei oder ob sie nicht alle von der Wahrheit abgefallen seien und die rechte Religion erst wieder entdeckt werden müßte ...
An einem schönen Frühjahrsmorgen 1820 — so heißt es in seiner Lebensbeschreibung — sei er fünfzehnjährig in den Wald gegangen und habe Gott um Erleuchtung über die Wahrheit angefleht. Da habe ihn zuerst dichte Finsternis umgeben und seine Zunge sei wie gefesselt gewesen, aber dann habe sich eine Lichtsäule auf ihn herabgesenkt, in der zwei verklärte Gestalten sichtbar wurden. Die eine sagte ihm, alle Sekten seien im Irrtum, keiner solte er sich anschließen, vielmehr sei er berufen, die rechte Kirche erst zu gründen. Erwacht fand er sich allein auf dem Boden liegend, die Augen gen Himmel gerichtet ...
Mit 18 Jahren (1823) folgte eine neue wichtige Vision, in der ihm lichtumflossen der Engel „Moroni“, der heute als Bronzefigur den Tempel krönt, erschien und anwies, nach dem Hügel Cumorah bei Manchester, N. Y., zu gehen. Dort werde er beim Graben zwei goldene Platten finden, die mit geheimnisvoller Schrift bedeckt seien. Dreimal erschien ihm der Engel Moroni bei der Nacht, und noch ein viertes Mal am Tage bei der Feldarbeit, wo er neben seinem Vater ohnmächtig wurde. Noch an demselben Tage habe Smith den Hügel aufgesucht, die Platten gefunden, aber der Engel habe ihm verboten, jetzt schon die Platten zu heben!
[S. 271]
In den folgenden Jahren verdingte sich Smith zur Feldarbeit wie sein Vater, wird aber als schmutzig, scheu und träge, ja dem Trunk ergeben geschildert. Er benutzt seine visionären Kräfte, um nach Schätzen zu graben, verlorene oder gestohlene Sachen wieder herbeizuschaffen. Dabei diente ihm ein durchsichtiger Kristall („peek-stone“), den er in seinen vor die Augen gehaltenen Hut legte, worauf er die gesuchten Dinge in dem Kristall sah[30]. Mit 21 Jahren verheiratete sich Smith und erhielt nun von dem Engel die Erlaubnis, den Schatz zu heben.
Im nächsten Jahr, Februar 1828, beginnt J. Smith mit einigen Freunden, Farmern wie er, Martin Harris, dem Schullehrer Oliver Cowdery und David Whitmer, selber hinter einem Vorhang sitzend (!), das Mormonenbuch, die goldenen Tafeln mit Hilfe seines „Gucksteins“ übersetzend, zu diktieren. 1829 war das Buch fertig und wurde 1830 veröffentlicht. M. Harris, obgleich gewarnt, hatte das Geld zum Druck dazu hergegeben.
Was ist’s nun mit diesen geheimnisvollen Tafeln? Niemand hat sie je mit irdischen Augen gesehen. J. Smith behauptet, daß sie in einer Kiste in seinem Hause gelegen haben. Der Engel aber hatte dem Propheten verboten, sie jemand zu zeigen! Nachdem die „Übersetzung“ fertig war, wurden die Tafeln dem Engel Moroni „zurückgegeben“! Aber die Freunde bestanden darauf, sie zu sehen. So hat J. Smith eines Tages in einer Vision ihren Anblick vermittelt. Das bezeugen sie schriftlich auf der ersten Seite des Mormonenbuches. Aus all dem folgt, daß die Offenbarungstafeln wohl nie existiert haben, daß aber der „Prophet“ visionär sie gesehen und an ihr Vorhandensein geglaubt hat.
Und was ist der Inhalt dieser „Mormonenbibel“? Ich habe mich nach der Abfahrt von der Salzseestadt viele Stunden im Eisenbahnwagen redlich bemüht, ihren Inhalt in mich aufzunehmen, aber über[S. 272] 30, 40 Seiten habe ich es nicht hinaus gebracht, so langweilig, inhaltslos und grotesk und geschichtlich unmöglich ist der Inhalt. Das Mormonenbuch ist wie die Bibel in Bücher, Kapitel und Verse eingeteilt. Sein Stil erinnert stark an das Alte Testament. Im ganzen will es ein Bericht über die Schicksale der bei der Eroberung Samarias 722 v. Chr. verschollenen zehn Nordstämme des Volkes Israel sein, die nach den mannigfachsten Irrfahrten und Kriegszügen nach Nordamerika gekommen seien und deren Nachkommen niemand anders als — die Indianer geworden wären! Man denke sich, die Indianer Nachkommen der alten Juden!! Das bestätigt gewiß auch die gegenseitige Rasseähnlichkeit!? Auch Christus ist, wie Smith glaubte, nach Ostern auf dem amerikanischen Kontinent erschienen und hatte ihm die Offenbarung der wahren Religion gegeben. Nur sind seine rechtgläubigen Anhänger in Amerika aufgerieben worden, und seine Offenbarung wäre verschollen, wenn nicht der letzte Prophet „Mormon“ und sein Sohn, der Engel Moroni sie auf jene Tafeln aufgezeichnet und vergraben hätten, bis sie J. Smith wieder fände. Diese Bibel des Propheten Mormon, von J. Smith erneuert, sei die Bibel für Amerika, ja für die Welt. Eine ganz abstruse und unmögliche Sache!
Woher aber stammt dieser Inhalt des Mormonenbuches? Das schlechte und fehlerhafte Englisch und die absurden geschichtlichen Ideen lassen niemand anders als J. Smith selbst als Verfasser erwarten. Das Buch ist der Spiegel seines ererbten visionären Fabuliertalents und seiner vollständigen Unkenntnis der wirklichen Geschichte des amerikanischen Kontinents und der Welt. Aber wie ist es möglich, wird man fragen, daß ein solches Buch überhaupt Glauben fand? Nun im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts unter den ungebildeten und schwärmerischen Abenteurern ist es für Amerika nicht unbegreiflich, zugleich in einer Zeit der stürmischsten und die Menschen wie eine Psychose ergreifenden Erweckungsversammlungen (camp-meetings, revivals); ebensowenig angesichts der ungeschichtlichen naiven Gläubigkeit des Amerikaners allem gegenüber, was sich als alt und uralt ausgibt, weil man ja selbst in einem fast vollkommen[S. 273] geschichtslosen neuen Lande lebt. Es ist also nicht nötig, zu der Vermutung zu greifen, die man lange geteilt hat, Smiths Buch sei ein Abklatsch eines Romans eines puritanischen Predigers Spaulding, dessen Manuskript wiederum ein Buchdrucker Rigdon dem Propheten in die Hände gespielt habe. Das seit 1885 bekannte Manuskript Spauldings zeigt nur äußere Ähnlichkeiten in Stil und Herkunft, aber gar nicht im religiösen Inhalt.


Wie ist es danach zu einer eigenen Mormonenkirche gekommen? Unmittelbar nach Fertigstellung des Mormonenbuches begann eine Propaganda für den neuen Glauben im Staate Neuyork. J. Smith war überzeugt, daß seine Anhängerschaft zur Weltherrschaft berufen sei! Ein solch phantastischer Traum ist auf dem amerikanischen Kontinent und auf dem Gesinnungsboden eines „auserwählten Volkes“ durchaus begreiflich. J. Smith verkündete bald die Nähe des „1000jährigen Reiches“ und setzte seine Mission im Staate Ohio fort. Immer neue Orakel verkündete er. Seinen Anhängern wurden auch wunderbare Heilungen nachgesagt. Von Ohio ging ein Teil der Gläubigen bis nach Kansas und Missouri. Aber 1832 begannen auch schon die ersten Verfolgungen der „Heiligen“ durch „die Heiden“. Smith und sein Freund Rigdon wurden in einer Nacht aus dem Bett gerissen, auf die Straße geschleift — einer der nicht wenigen Fälle von amerikanischer Lynchjustiz — mit Teer beschmiert und zum Spott mit Federn ausstaffiert! Den Mormonen in Missouri warf man die Fenster ein, zündete ihr Heu an und schoß in ihre Häuser! Die Staatsregierung unternahm zunächst nichts. Aber je mehr die Mormonen verfolgt wurden, desto mehr breiteten sie sich aus. Auch J. Smith machten die Verfolgungen in seiner Überzeugung nicht irre. Im Gegenteil. 1834 forderte der „Prophet“ seine Anhänger zum Abzug auf, er selbst organisierte sie militärisch als ihr „General“! Die Mormonen verschanzten sich gegen anrückende Regierungstruppen in einem festen Lager in Missouri, wurden jedoch umzingelt und mußten sich der amerikanischen Miliz ergeben. Smith wanderte ins Gefängnis. Das Todesurteil wurde über ihn 1838 verkündet, aber nicht vollstreckt![S. 274] Smith entfloh, seine Anhänger sammelten sich in Nauvoo in Illinois, das damals noch ganz unkultiviert war. Nauvoo sollte nun der Sitz des neuen Zion und des Tempels werden. Aber auch hier war ihres Bleibens nicht lange. Zu großem Anstoß führte die jetzt schon eifrig geübte Polygamie! Seit 1843 rechtfertigte sie der Prophet und übte sie selbst. Die „mit Heiligen versiegelten“ Frauen würden bestimmt des ewigen Lebens teilhaftig! So sollen sich nach Smiths Tod 27 Frauen gerühmt haben, dem Propheten „angesiegelt“ gewesen zu sein! 1844 wurde J. Smith von seinen Anhängern sogar ernsthaft als Kandidat für die Präsidentschaft der Union aufgestellt!! Smith stand auf der Höhe seiner Erfolge. Eine Druckerei, die ihn schmähende Artikel und Zeitungen erscheinen ließ, ließ er zerstören und erklärte der Union den Krieg, die ihn zur Verantwortung ziehen wollte! Dann aber nahm er eingeschüchtert die Kriegserklärung wieder zurück und entfloh ins Felsengebirge. Seine Anhänger verlangten aber von ihm, daß er sich freiwillig den amerikanischen Gerichten stelle! Er tat es und ahnte sein Endschicksal voraus. Er wurde des Hochverrats für schuldig erklärt und eingekerkert. Obwohl das Gefängnis von amerikanischer Miliz bewacht wurde, drangen am 27. 6. 44. nachmittags fünf Uhr 200 abenteuerliche Gesellen mit geschwärzten Gesichtern ein und erschossen den Propheten in seiner Zelle, in der er sich vergebens zur Wehr setzte. Er wurde in Nauvoo begraben und war so, 39 Jahre alt, für seine Überzeugung den Märtyrertod gestorben.
Aber damit ging der Mormonismus nicht unter. Im Gegenteil, er blühte erst recht auf. In Brigham Young, dessen Denkmal mit Recht im Mittelpunkt der Salzseestadt steht, erhielt das Mormonentum einen äußerst tatkräftigen und zielbewußten und vor allem organisatorisch hervorragend begabten Führer, der die Mormonen aus Nauvoo hinweg unter viel Mühsalen und Beschwerden bis in die damals noch völlig unbewohnten Einöden am Großen Salzsee führte. Hier entstand bald mit Hilfe künstlicher Bewässerung ein Kranz blühender und fleißiger Dörfer. Merkwürdigerweise trennte sich Smiths Frau und Mutter mit den Kindern von des „Propheten“ Gemeinde und[S. 275] gründeten eine reformierte Mormonenkirche! Einer der Brüder Smiths wurde sogar aus der Kirche der „Heiligen“ ausgestoßen! Young, vier Jahre älter als der Prophet, leitete die Mormonenkirche bis 1877. Von Hause aus war er Tischler und Glaser. Unter ihm erst wurde das anstößige Dogma von der Polygamie öffentlich verkündet (1852).
Man begnügte sich bald nicht mehr nur mit den Siedlungen am Salzsee, deren Fruchtbarkeit von allen Seiten Landsucher anlockte, sondern schickte auch Sendboten nach Europa! Young verschönte und vergrößerte auch die Hauptstadt, er baute das „Tabernakel“ und legte den Grundstein zum „Tempel“. Mit den umwohnenden Indianern, in denen man ja die Nachkommen des auserwählten Volkes Israel sah, verbündete sich Young und hielt mit ihnen zusammen lange Zeit die amerikanischen Regierungstruppen in Schach. Utah war selbständiges Territorium. Young übte die Rechte eines Gouverneurs aus. Er war zugleich Präsident des Staates und der Kirche. Die Gerichte urteilten nach seinen Weisungen und zuweilen mußten Verbrechen durch freiwilligen Tod gesühnt werden! Von den nach Kalifornien strömenden Goldsuchern erhob man hohe Durchgangszölle. Die Landsuchenden hielt man in Abhängigkeit, indem die Kirche selbst das Land verpachtete. Aber die Einöde um den Salzsee verwandelte sich bald in ein Kulturparadies, das ich selbst mit Augen sah. So wurde Salt Lake City eine der saubersten und schönsten Städte der Union. Die Industrie blieb hier noch lange ganz fern.
Young hielt auch auf straffe sittliche Zucht. Die Stadt wurde in Bezirke eingeteilt, denen Bischöfe und Priester vorstanden. Sie hatten das Leben sämtlicher Familien streng zu kontrollieren. Völlerei, Diebstahl, Betrug, Meineid, Fluchen und Würfelspiel — sonst vielgeübt — waren hier Seltenheiten. Als 1867 die Bahn nach dem Stillen Ozean gebaut wurde, hörte Utah auf, von der Welt abgeschnitten zu sein. Der Durchgangsverkehr stieg gewaltig. 1890 erteilte der amerikanische Staat Amnestie an alle Polygamisten. 1896 wurde Utah als Staat der Union eingegliedert. Der Traum eines mormonischen Weltstaates[S. 276] mit Salt Lake City als Mittelpunkt war damit ausgeträumt. Übrig blieb nun der religiöse Mormonismus als Sekte wie der religiöse Katholizismus nach Aufhebung des selbständigen römischen Kirchenstaats. Heute mögen die Anhänger des Mormonismus in aller Welt eine halbe Million betragen. In Salt Lake City selbst haben sie dank der Einwanderung nicht mehr die Majorität. Eine ganze Reihe Kirchen anderer Sekten wie der Presbyterianer, der Methodisten usw. erheben sich auch jetzt daselbst. Aber etwa 2000 mormonische Missionare durchziehen die Welt und werben für J. Smiths Lehre und Sendung. In Deutschland und der Schweiz soll es etwa 5000 Mormonen geben, deren heißeste Sehnsucht es ist, einmal nach Salt Lake City zu kommen und im Schatten des Tempels zu sterben ...
Ich hatte die Stadt durchschritten und stand am sogenannten „Eagle-Gate“ (Adler-Tor), das sich aus vier eisernen Bogen bestehend, vom Unionsadler gekrönt, angeblich über „die längste Straße der Welt“ spannt dicht beim Grab des mächtigen Brigham Young. Salt Lake City ist so modern geworden, daß sich auch schon ein paar stattliche Wolkenkratzer erheben, wenn auch nicht von der Höhe derjenigen Neuyorks. Die Innenstadt ist umkreist von einem Kranz höchst gefälliger und geschmackvoller Landhäuser. Alle Straßen, deren ein großer Teil mit hohen Pappeln bepflanzt ist, machen einen äußerst sauberen und gepflegten Eindruck. Um die Stadt leuchten Schneeberge. In der Tat, eine prächtige Lage für das mormonische Zion! In einigen kleineren Straßen entdeckte ich auch noch recht alte Häuser, darunter ein aus rohen Balken gezimmertes Blockhaus, das erste in Salt Lake! — —
Wolken hatten sich zusammengezogen. Es fing an zu regnen. Ich flüchtete in die neue stattliche, gotische katholische Marienkathedrale und empfand wieder einmal, daß es doch etwas Schönes um die offenen katholischen Kirchen ist; sie bieten den Fremden und Reisenden stets einen unentgeltlichen Ruhesitz, wo man dem Lärm des Straßenverkehrs und der Nervenanspannung der Besichtigungen auf eine Weile ungehindert entfliehen kann. Ich suche sie daher in fremden Städten[S. 277] immer gern auf und saß auch jetzt eine Weile in Salt Lake so gut in der katholischen Kirche wie in München in der Theatiner Hofkirche, in Venedig in S. Marco oder in Rom in Maria Maggiore. Es ist auch gewiß etwas Großes um das Weltumspannende der katholischen Kirche, die dieselbe in Köln oder in Sevilla, in Dresden oder in St. Marys Kathedrale in Salt Lake ist. Der Katholik kann sich darum überall in der Welt in seiner Kirche sofort daheim fühlen und zurechtfinden ...
Wieder verließ ich wie im Staat Neumexiko in Santa Fé und San Franzisko im Schlafwagen auch das Zion der Mormonen des Abends. Fort ging’s in das Zauberbergland Kolorados. Bei der Abfahrt leuchtete mir noch ein strahlendes Alpenglühen auf den Wasatchbergen den Abschiedsgruß ... Ein letzter wundervoller Eindruck!
Ich hatte wieder eine weite Fahrt vor mir, wieder eine ganze Nacht und einen ganzen Tag durch einen großen Teil des Staates Utah über die Kette des Wasatchgebirges hinein in das größte Gebirgs- und Alpenland Amerikas Kolorado bis nach „Kolorado-Springs“ an den Fuß des 4300 m hohen Pikes Peak, den Eckpfeiler des Felsengebirges am Rande der unendlichen Mississippiebene. War ich wieder soweit, dann hatte ich die ganze mächtige Breite des Felsengebirges wieder hinter mir.
Ich las auf meinem Bett sitzend noch eine Weile in der Mormonenbibel, dann entschlummerte ich in meiner „upper berth“, die ich mir wieder rechtzeitig gesichert hatte. Ich war jetzt schon so sehr an das Schlafwagenfahren gewöhnt, daß ich so ruhig und gut wie im schönsten Hotelbett schlief. Dazu hielt der Zug in dieser Nacht wohl gar nicht, und ich wurde so wieder 700 Meilen, also etwa eine Strecke von Königsberg-Basel mühelos weitergerollt. Am „Jordan“ entlang ging es vom Salzsee zum viel kleineren Utahsee und dann keuchend hinauf über die Paßhöhe des Wasatchgebirges (2300 m) und wieder hinab durch das sogenannte „Castle Gate“, an dessen Eingang drohend zwei riesige 150 m hohe aufragende Sandsteinfelsen stehen und kaum[S. 278] den eingleisigen Schienenweg hindurchlassen, zum Green River, einem Quellfluß des Koloradostromes. Von all dem sah ich freilich wenig, sondern verschlief es; aber am nächsten Tage sah ich dergleichen genug, was den stolzen Namen der Bahnlinie als der „most scenic line of the world“ rechtfertigte, denn sie geht mitten durch das wildzerklüftete Alpen- und Goldland Kolorado, die „Schweiz“ der Vereinigten Staaten, hindurch.
Ich erwachte am Morgen, als wir schon die Koloradowüste hinter uns und den Green River überschritten hatten und im felsigen Cañon des Grand River, des anderen Quellflusses des Kolorado, fuhren. Aus dem lieblichen Kulturparadies am Salzsee war ich in die wilden Bergschluchten Kolorados, wie aus dem Italien und Spanien Kaliforniens in die Schneewelt der Sierra Nevada und aus dieser wieder in die sengende Wüste Nevadas versetzt. Was für Verwandlungen! So war ich wieder am Koloradofluß, in dessen wilden Großcañon ich vor etwa einer Woche von 2000 m Höhe geschaut hatte — freilich mehrere hundert Meilen von hier südlich — und den wir bei Needles an der Grenze Kaliforniens bei herrlichstem Sonnenuntergang breit wie einen Meeresarm gekreuzt hatten. Jetzt dampften wir seinen Oberlauf aufwärts. Wir hielten in Grand-Junction, wo eine Nebenlinie nördlich durch das Bergland auch nach Kolorado Springs führt. Ich blieb auf der kürzeren Hauptlinie, die ein Umsteigen ersparte. Aber jedem Leser rate ich, im entsprechenden Fall doch lieber die noch viel interessantere Nebenlinie zu benutzen.
Die Farmen in den Hochtälern wie auf Alpenweiden und -matten erwachten! Hunde spielten vor den schweizähnlichen Blockhäusern. Hühner gackerten heimatlich. Hemdärmelig standen in hohen Stiefeln und wollenen Jacken stämmige Menschen vor ihren Blockhäusern, die mich sehr an die am Fuß der San Franziskoberge in Flagstaff erinnerten, und schauten dem Tagesereignis, dem Zug, nach ...
Es ist herrlicher Morgensonnenschein. Aus einem Cañon geht es ohne Unterlaß in den anderen. Meist läßt der Felsabsturz gerade nur noch den Platz für die Bahnlinie frei. Ein Zugzusammenstoß muß[S. 279] hier leicht möglich, aber nicht gerade ungefährlich sein! Bergwerkstollen sieht man bis hoch an die Felswände hinauf. Im Wagen sitzen allerlei — amerikanisch! — bibellesende Menschen, darunter auch wieder ein Heilsarmeesoldat. Mit einer ihre Morgenandacht im Wagen haltenden jungen Dame komme ich ins Gespräch. Sie stammt von deutschen Eltern und bekennt sich als eifrige Sonntagsschullehrerin. Sonntags besucht sie zwei- bis dreimal ihre Kirche. Sie liest fast nur in der Bibel, sagt sie. Andere Bücher bedeuten nichts! Meine Morgenandacht bestand im Augenblick im Hinausschauen in die großartige Natur- und Gebirgswelt. Redete nicht auch hier Gott zu mir? Ich brauchte jetzt kein Buch über Gott. Meine Bibel waren im Augenblick die grandiosen Felsabstürze und Schneehäupter und rauschenden Ströme, an denen ich mich nie müde sehen konnte. Und etwa zur Mormonenbibel zu greifen, hatte ich jetzt, obwohl wir kaum aus Utah heraus waren, immer weniger Neigung. Was ging mich jetzt die abstruse und unmögliche Geschichte der Juden auf dem amerikanischen Kontinent vor ein paar tausend Jahren an? Sollten wirklich Juden durch diese Kañons gezogen sein oder auf diesen Almen ihr Vieh geweidet oder an diesen rauschenden Strömen gekämpft und sich ausgerottet haben? Ich bin kein Judenfresser — aber das auch nur einmal auszudenken, wäre mehr als grotesk. Ärgerlich packte ich diese Art „Bibel“ zu unterst in meinen Handkoffer ... Die junge Dame war auf Deutschland nicht gut zu sprechen, obwohl sie es selbst nie gesehen hatte ...! „Aber es muß doch dort nicht schön sein“, so philosophierte sie zu mir flötend und selbstbewußt, sonst wären doch meine Eltern nicht hierher in die „States“ ausgewandert! Ihr Vater kam aus Elbing in Westpreußen, wo er ein kleines Bauerngütchen besessen hatte, und hier war er allerdings bald Großfarmer geworden. Ich sagte ihr — und es sollte keine bloße Höflichkeit sein — daß ich hier am liebsten jetzt ausstiege und durch die Wälder ginge und über die Felsen dem Schnee entgegenstiege! Da sah sie mich ganz entgeistert an und bekam fast einen kleinen Ohnmachtsanfall: „Aber hier gibt es ja nirgends Wege! In diesem Lande geht man nicht spazieren!“[S. 280] Mehr als mitleidig sah sie mich dabei an, und ich entgegnete ihr ebenso mitleidig in Gedanken: „Armes Land, das zum Wandern zu ungeheuer ist, das man nur im Expreß oder mit dem Auto durchrasen kann. Und selbst das nicht, denn auch dazu fehlen noch die Straßen durch die Rockies. Ihr Amerikaner, dachte ich, müßt doch eine ganz andere Seele haben als wir Deutschen. Bei euch ist alles aufs Riesige, Große, Ungemessene gestellt. Ihr kennt nicht die Kleinszenerie eines deutschen Mühlentälchens oder den lauschigen Sitz an der Quelle und den wohldurchwegten Buchenwald.“ —
Wir waren inzwischen immer höher gekommen und fuhren wieder einmal auf 2000 m Höhe. Die kleinen Bahnhöfe, die wir zuweilen passierten, an denen manchmal ein einziges Fräulein den ganzen Bahndienst versieht oder ein Bursche mit einer Flagge winkt — NB die ganze bahnamtliche Verständigung! — erinnerten mich lebhaft an Hochtäler in Tirol und ihre grasigen einsamen Weiden. Kühe weideten hier oben wie in den Alpen. Und ringsum grenzten Schneeberge den Horizont.
Ja, jetzt schneite es gar. Wie lustig! Wie warm aber mochte es gleichzeitig auf dem Asphalt des Broadway in Neuyork sein! Nur die Gletscher fehlten hier zur Vervollständigung des alpinen Bildes. Von der Bahn aus wenigstens sah ich keinen. So tief wie in unseren Alpen reicht hier der Schnee nicht in die Täler. Sonst war alles wie in unseren Alpen. Auch wenn ich mir die Menschen hier oben betrachtete, so schienen mir die Bewegungen der Koloradoleute, an Sturm und Schnee gewöhnt, viel stämmiger, gemessener und gewichtiger als der typischen überbeweglichen Yankees. Die Koloradoleute kommen einem recht unamerikanisch vor, so wie etwa bei uns der Schwarzwälder oder Partenkirchener mit dem Berliner auf dem Asphalt der Friedrichstraße auch wenig gemein hat.
Bald sind wir in vollendeter Schneelandschaft. Es schneit hier stark. Bahnrauch, Nebel und Schnee hüllen das Hochtal ein. Noch immer laufen die Gebirgsbäche zum Stillen Ozean. Wir sind in die romantische Schlucht des „eagle-cañon“ eingefahren. Die Schlucht ist nur[S. 281] noch wildrauschender Fluß und mehrere hundert Meter hoch aufsteigende Felswände. Die Bahn keucht in Windungen immer höher empor. Endlich in Höhe von 3184 m (!) — also z. B. noch 400 m über dem Stilfser Joch in Tirol, einem der höchsten Alpenstraßenpässe — erreicht die Bahn den „Tennesseepaß“, d. h. die Wasserscheide zwischen Stillem und Atlantischem Ozean! Der Zug hält, gleichsam stolz auf seine Leistung. Es ist auch eine. Die Lokomotive faßt Wasser und Kohlen und erholt sich von ihrem Rekord, einen D-Zug mit sechs Wagen auf solche Höhe hinaufgebracht zu haben. Für einen Augenblick springen wir Globetrotters von den hohen Trittbrettern aus unseren Pullmann-Wagen, die uns seit Salt Lake City schon wieder etwa 16 Stunden beherbergen. O diese wunderbare köstliche frische Hochgebirgsluft! Wir sind 200 m über der Höhe der Zugspitze!! So ist es auch draußen recht empfindlich kalt. Das Thermometer zeigt 0 Grad! Rings hüllt uns eine neblige Schneelandschaft völlig ein. Schneehäupter schauen über alle Seitentäler herüber, darunter die stolzen Gipfel der „Sangre de Christo“-Berge[31]. Ach könnte ich ein wenig hierbleiben und die Koloradoalpen ersteigen! Aber die unerbittliche Zeit, Fahrplan, Geld und Arbeitsfrohn treiben mich mit ihrer Geißel und dem Ruf unserer Fronvögte: „All aboard!“ in die dumpfen Wagen mit ihrer verbrauchten Stickluft aus Nacht- und Tagkampieren, Speiseresten, Abfällen, weggeworfenen Zigaretten, Zeitungen u. dgl. zurück.
In Station „Buena Vista“ ist da oben wirklich eine Prachtaussicht. Wir fahren eine Zeitlang auf einem Hochplateau in 3000 m Höhe. Um uns erheben sich die sogenannte „Collegiate Peaks“, die nach den großen Universitäten genannt sind: „Mount Yale, Mount Princeton und Mount Harvard“, jeder ein Montblank für sich, an 4300-4400 m hoch! Nicht weit von hier ist ein Tunnel, durch den die dortige Bahnlinie sogar in 3500 m (!) Höhe die Wasserscheide der Ozeane überschreitet. Draußen steht — wie ich beim Hinaussehen feststelle — wieder einmal[S. 282] bei ein paar Hütten eine kleine Holzbaukastenkirche. Einige weidende Esel zeigen sich uns als die einzigen Lebewesen hier oben, wie auch diese geduldigen Tiere allein bei uns nach den Alpenhütten emportraben. Fast heimatliche Gefühle stellen sich bei mir ein, je öfter ich daran denke, daß es wieder dem Atlantischen, „unserem“ Ozean zugeht! Werde ich noch einmal im Leben am Rande des Pazifik liegen, mich in seinem Sande in der Bucht von Montery wohlig wärmen oder nach der paradiesischen Insel Santa Catalina hinüberfahren oder die Seelöwen gegenüber dem Goldenen Tor der San Franzisko-Bucht brüllen hören? Das alles kam mir jetzt auf diesen hochalpinen Ebenen wie ein sonniges, aber verklungenes Märchen vor samt den Zinnen des Mormonentempels und den weiten glitzernden Fluten des Salzsees ...
Allmählich ging es von der alpinen Hochebene wieder herab in einen neuen schaurigen Cañon. Die Bahntrasse hatte sich beträchtlich gesenkt. Es war wohl der vierte große Cañon dieses Tages, der des „Arkansas-River“, der viele hundert Meilen lang bereits dem „Vater der Ströme“, dem Mississippi, zuströmt. Sein Wasser rauscht frisch und kalt, wie es aus den Bergen kommt. Mächtige Felsblöcke sperren seinen Weg. Immer enger wird der Bahnweg. Wie ein ständig sich krümmender Wurm windet sich der Zug durch die riesige Schlucht. Wirklich, diesmal war der Mund nicht zu voll genommen: Es war „the most scenic line of the world“, die ich fuhr. Der Arkansascañon übertraf alle Tiroler, Schweizer und oberbayrischen Klamms zusammen, die ich gesehen hatte. Welche Wildromantik ständig da draußen! Mich beseligte ein eigenartiges stilles Glücksgefühl, das alles einmal sehen zu dürfen. So hätte ich bis ans Ende der Welt fahren können! Nur zu schnell glitt alles vorüber ...
„Morningpapers“[32] wurden ausgeboten. Was scherten mich jetzt in dieser Alpenszenerie die Politik der Welt und die Börsenkurse, Theatergrößen und Sporthelden! Wie lächerlich klein, unwichtig und aufgebauscht[S. 283] erscheint all das Menschengetriebe der Kulturgroßstädte hier oben! Andere im Wagen studieren immer von neuem die Fahrpläne, die sie doch bald auswendig können müssen, um die Zeit totzuschlagen, die mir viel zu schnell vergeht. Auch Kartenspiel ist nicht jedermanns Sache und dünkte hier mich Sünde. Ich studiere derweilen immer aufs neue die majestätische Natur draußen und suche die großen Eindrücke recht fest und tief in mich einzusaugen ...
An den kleinen Stationen, wo es etwa alle ein bis zwei Stunden einmal hält, steigt niemand ein und aus. Aber zuletzt, ehe wir aus dem Felsengebirge austreten, kommt noch das Großartigste von allem, die sogenannte „Royal-Gorge“[33]. 800 m hohe Wände steigen hier fast senkrecht aus der Schlucht empor. Die Schlucht wird jetzt so schmal, daß die Spur für die Bahn zum Teil erst künstlich geschaffen werden mußte. Auf hängender Brücke (!), deren obere Eisenbänder in die Felswände eingelassen sind, überschreitet die Bahn die allerengste Stelle. 13 km lang ist dieser ganze unbeschreiblich romantische Engpaß. Unter uns oder dicht neben uns tost der Arkansas-River. Hier wächst kein Gräslein mehr in dieser Teufelsschlucht, kein Sonnenschein dringt in die Tiefe ... Der Zug hält einen Augenblick zur Bewunderung der grandiosen Gebirgsszenerie. Dann auf einmal tritt nach nicht allzulanger Weiterfahrt die Bahnlinie urplötzlich ins offene Gefilde hinaus. Wie aus einem Höllental geht es ins Himmelreich, wie aus der Teufelsschlucht des Gotthardpasses in das grüne „Andermatt“. Die Berge treten zurück. Die Baumblüte ist im Gange. Noch erscheinen keine zusammenhängenden Siedlungen, sondern erst nur Einzelfarmen. Berittene Hirten treiben mächtige Kuhherden in die Hürden, denn der Tag neigt sich wieder einmal zum Abend. Wir halten in Cañon-City, dann in Pueblo, das nicht mehr weit von La Junta ist, der Gegend, wo ich mein Scheckbuch verlor und wiederfand. Ich bin also eine riesige Schleife gefahren. Ich steige aus in dem amerikanischen Davos, in „Kolorado-Springs“ am Fuß des 4300 m hohen Pikes Peak. Der[S. 284] vielbesuchte Badeort liegt selbst 1800 m hoch, also auf Rigihöhe. Dicht vor sich hat man die Kette des Felsengebirges, das ich einst so sehnsüchtig erschaut und nun zweimal so ausgiebig seiner ganzen ungeheuren Breite nach durchfahren hatte; zur Rechten beginnen die ebenso ungeheuerlichen Mississippiebenen ...
Als ich aus dem Bahnhof trat, fiel schon die Nacht ein. In meinem Logis, das ich bald gewählt, freute es mich doch, nach der 24stündigen Fahrt seit Salt Lake wieder einmal ungerollt und ungewiegt schlafen zu dürfen. Wie in Kalifornien in Los Angeles, Monterey und San Franzisko wollte ich mich auch hier in dem vielgerühmten Klima ein bißchen erholen und es mir auf ein bis zwei Tage gemütlich machen, denn noch immer lagen ungeheure Entfernungen vor mir. Erst ein Drittel der Breite der Union war wieder von Westen nach Osten durchmessen ...
Von Kolorado-Springs, dem Davos oder Luzern Amerikas, kann man viele herrliche Touren machen, aber dazu braucht man Führer, Esel, weitere Bahnfahrten, so in die „Cheyenne Berge“, die Alpenfahrt nach der Goldgräberstadt „Cripple Creek“, vor allem aber zu dem nach dem Indianergott Manitou, dem „großen Geist“ genannten Gebirgsort am Fuß des Pikes Peak, zu dem „garden of the Gods“, dem Göttergarten mit seinen grotesken Felsbildungen, und vor allem auf den die ganze Gegend beherrschenden „Pikes Peak“ selbst.
Es war fast immer blendender Sonnenschein, wenn ich aufstand. In Kolorado-Springs regnet es von September bis April überhaupt nicht; selten fällt Schnee! Es ist noch trockener und sonniger als Davos und wird daher viel von Brustkranken, Tuberkulösen und Neurasthenikern in der Union aufgesucht. Von den endlosen Prärien der Mississippiebene weht der reine warme Wind herein. Die hohen Berge der Rockies schützen es gegen Stürme und Kälte. Es war also allein schon ein erhebendes Bewußtsein, an einem so gesunden und paradiesisch-klimatischen Ort zu weilen. Man lebte den ganzen Tag in dem Gefühl, wie von rosigen Engelslüften umgeben zu sein, und war von der fast fixen Idee besessen, daß man nur immer recht tief Atem zu holen brauche und die Lungen davon recht gefüllt mitzunehmen,[S. 285] um gesund zu sein. In der Tat, als ich wieder nach Chikago zu meinen Verwandten kam, waren sie erstaunt, mich trotz der inzwischen geleisteten Bahnfahrt von 5000 Meilen so frisch und rotbackig zu finden. Das hatte ohne Zweifel die Luft von Kolorado-Springs zusammen mit dem sonnigen Sand am Pazifik zuwege gebracht.
So fuhr ich nach dem Frühstück sofort mit der Eisenbahn die nicht allzugroße Strecke über „Kolorado-City“ ins Gebirge hinein nach „Manitou“. Kolorado-Springs war schon still. Denn die großen Hotels waren noch geschlossen. Die Saison war noch nicht angegangen. Aber Manitou war geradezu noch wie ausgestorben. Vielleicht hätte ich hier jetzt noch nicht einmal ein Zimmer bekommen. Denn alle Pensionen und Gasthöfe schienen noch geschlossen zu sein. In Kolorado-Springs dominierte schon einzigartig schön das Montblanchaupt des Pikes Peak, aber in Manitou wirkte es geradezu erdrückend. Man war ihm hier jetzt näher wie in Lautersbrunn oder Wengen in der Schweiz der „Jungfrau“. Manitou liegt verstreut mit Villen und Pensionen in einem alpinen Kessel, etwa 2000 m hoch. Von hier aus wird die Besteigung des Pikes Peak meist unternommen. Und die hatte ich mir nun einmal schon lange in den Kopf gesetzt. Sie stand als unerschütterlicher Punkt auf meinem Reiseprogramm.
Es geht auf den Pikes Peak eine Zahnradbahn hinauf, die drei Stunden braucht. Aber die hätte ich verschmäht, auch wenn sie gegangen wäre. Gewiß war sie auch für meinen Geldbeutel zu teuer. Ebenso wie ich es für eine Entheiligung unserer Alpen halte, daß sich jetzt jede feiste Madame oder jeder Schieber auf die Jungfrau oder bald auf die Zugspitze hinauffahren lassen kann. Auch auf den Rigi und den Pilatus sind wir seinerzeit ganz zu Fuß hinauf- und wieder hinuntergestiegen. Das war redliche Touristenarbeit. Die Zahnradbahn war aber noch nicht wieder eröffnet! Außer der Zahnradbahn geht eine 27 km lange Fahrstraße auf den Gipfel! Die kann man hinauffahren. Aber sie war für mich zu weit. Ich wäre auch nie in der Kutsche hinaufgefahren. Zu Fuß wäre ich hinauf-, aber an einem Tage nicht wieder heruntergekommen! Endlich geht ein Fuß- und Reitweg durch den Englemans[S. 286] Cañon hinauf, zu dem man sechs Stunden braucht! Mit dem Fußweg wollte ich es tapfer versuchen. Ausgerüstet war ich zwar gar nicht dafür. Ich hatte weder Bergschuhe noch Alpenstock, auch keine langreichende Wegzehrung! Was hatte ich auf dem Frühlingspflaster in Boston und Chikago auch an Alpentouren im Felsengebirge in Schnee und Eis gedacht! Schon am Niagara war ich höchst überrascht, ihn Anfang April noch völlig vereist anzutreffen ...!
Ich wanderte also zunächst, als ich aus der Bahn stieg, durch den prächtigen Luftkurort Manitou, kam am Bahnhof der Zahnradbahn vorüber und stapfte tapfer, klirrend meinen Stock aufstützend, den Fahrweg zum Englemans Cañon hinauf. Es wurde immer stiller und einsamer um mich. Nur die Sonne schien und war meine treue Begleiterin. Der Fahrweg hörte bald ganz auf und wandte sich rechts ab. Der Fußweg hörte bald auch auf — nämlich im tiefen Schnee! Nun blieb nur noch die Trasse der Zahnradbahn als Pfad zu erkennen. Der folgte ich. Einige weidende Esel waren die letzten Lebewesen gewesen, die ich sah. Im Sommer trugen sie wohl unermüdlich die Touristen auf den Alpengipfel des Pikes Peak. Nun kam lange gar nichts mehr. Ich setzte immer Fuß vor Fuß, eine tüchtige tiefe Spur hinter mir lassend. Nach einiger Weile hüpfte mal ein graues Eichhörnchen über den Weg, das noch lange nicht daran dachte, sein Sommerkleid anzulegen. Hier und da löste sich im wärmenden Sonnenschein eine Schneelast von den dichtstehenden Tannen und huschte mit gespenstischem Laut zur Erde nieder. Eine reine Luft war rings zum Jauchzen. Ein Himmelblau spannte sich über mir, wie ich es so tief und klar kaum je gesehen hatte. Ich dehnte und weitete meine Brust und füllte die Lungen, als ob es bis ans Lebensende reichen müßte ... So war eine Stunde nach der anderen vergangen. Aber der Pikes Peak erschien mir immer höher und — ferner! Rings um mich war alles Schnee. Auch die Trasse der Zahnradbahn war jetzt so dicht mit Schnee zugedeckt, daß sie kaum noch zu erkennen war. Jeder Schritt wurde zu einer mächtigen Anstrengung. Lautlos still war alles ringsum. Leise Zweifel begannen in meiner[S. 287] Brust aufzustehen, ob ich wohl heute noch hinaufkäme. Oben sollte ein Gasthaus sein, aber es war gewiß jetzt noch geschlossen! Ein Herr und eine Dame waren mir entgegen abwärts geschritten, wohlausgerüstet wie Alpensteiger. In der Freude, in dieser Hochgebirgseinsamkeit einmal plötzlich Menschen zu sehen, griff ich auf gut deutsch an den Hut und sagte fröhlich, ganz vergessend, wo ich war: „Guten Morgen“! Die Lady sah mich groß an, offenbar sehr erstaunt und beleidigt zugleich, daß ich es wagte, als Mann eine Dame zu grüßen und anzusprechen, und grüßte nicht wieder! Ich hatte im Augenblick auch ganz vergessen, daß ich ja auf amerikanischem Boden eine Dame nicht zuerst grüßen darf! Und selbst auf dem Weg zum Pikes Peak muß man die Form wahren! Der Herr, offenbar, wie ich beim Näherkommen sah, ein Führer, murmelte lächelnd ein paar Worte. Ich rief ihm noch nach, wieweit es noch auf den Pikes Peak sei, da antwortete er: „Bis zum half-way-house noch eine gute halbe Stunde.“ So stapfe ich weiter, in der Hoffnung, beim „half-way-house“ wohl eine trockene und warme Stube zu finden. Dann überließen sie mich meinem Schicksal. Als ich endlich, vom ewigen Schneestapfen und Bis-ans-Knie-Einsinken recht müde geworden, das „half-way-house“ erreiche, ist es — verschlossen! Ich rüttele an allen Türen, es hilft nichts. Die Fensterläden sind zugeschlagen. Kein Lebewesen, weder Mensch noch Tier, regt sich in ihm. Mir wie zum Spott steht bloß groß da angeschrieben: „Half-way-house“ — und droben erhob der Pikes Peak sein Haupt, jedesmal höher, ferner und anscheinend unerreichbarer denn je zuvor!
Ich verzehrte meinen Mundvorrat an Gebäck und Orangen im Stehen. Meine Füße steckten naß in leichten Strümpfen und durchlässigen Schuhen wie in ständigem Schneewasserbad. Ich überlege. Zum Umkehren kann ich mich noch nicht entschließen; aber ob ich heute noch auf den Pikes Peak komme und auch wieder mit heiler Haut bei diesen unerwarteten Schneeverhältnissen herunter, ist mir nun höchst zweifelhaft geworden. Und wenn oben gar auch verschlossen ist wie hier das half-way-house, sollte ich dann die Nacht[S. 288] oben im Schnee zubringen? Das waren keine angenehmen Aussichten! Wie es nur wohl die nicht wiedergrüßende Lady gemacht hatte? Hatte sie vielleicht einen Schlüssel zu dem Unterkunftshaus mitgehabt? Meine Wirtin in Kolorado-Springs hatte es mir nicht sagen können, ob „oben“ offen sei und ob man jetzt schon hinauf könne. Ich müsse es versuchen. Ich las in meinem getreuen Bädeker nach, da fand ich den mir jetzt leider nur allzu wahr erscheinenden Satz: „Die Besteigung des Pikes Peak ist des Schnees wegen nicht vor Juni, nur im Sommer anzuraten!“ Er hatte recht, der treffliche Bädeker, wie immer. Aber da ich im tiefen Schnee so manchen Berg auch im deutschen Winter erstiegen hatte, dachte ich, ich könnte auch den Pikes Peak in Amerika im April zwingen ... Der Mensch denkt! ...
Ich stapfte weiter. Meine Stiefel waren außen Schnee und innen Wasser. Ich gab das Rennen noch nicht auf. Oder sollte ich etwa doch besiegt einen Kompromiß schließen? Kompromisse sind stets vom Übel. Aber manchmal geht es doch nicht anders. Rechts oben über einem steilen Hang schaute ein Aussichtstempel herab: „Grand-view-rock“ nannte er sich. Ein Wegweiser, aber jetzt ganz ohne Weg, wies hinauf. Sollte ich mich mit diesem kleinen Pikes Peak begnügen? Schmählich! Aber der Mensch versuche die Götter nicht! Sollte etwa nachher in den amerikanischen Zeitungen stehen: „Am Pikes Peak wurde ein deutscher Tourist erfroren und entkräftet aufgefunden. Aus seinen Papieren ergab sich, daß er usw. ...“ Nein, diese Sensation gönnte ich den so sehr sensationslüsternen „papers“ neben alle den anderen auf dem Asphalt Chikagos und Neuyorks denn doch nicht! Dazu war der sacro egoismo in mir zu lebendig. Also wandte ich mich rechts hinauf und stieg zunächst weg- und steglos durch den Wald und über vereiste Felsen zum „grand-view-rock“ hinauf, bis mir das Herz bei dem fast senkrechten Steigen bis zum Halse hinauf klopfte ...

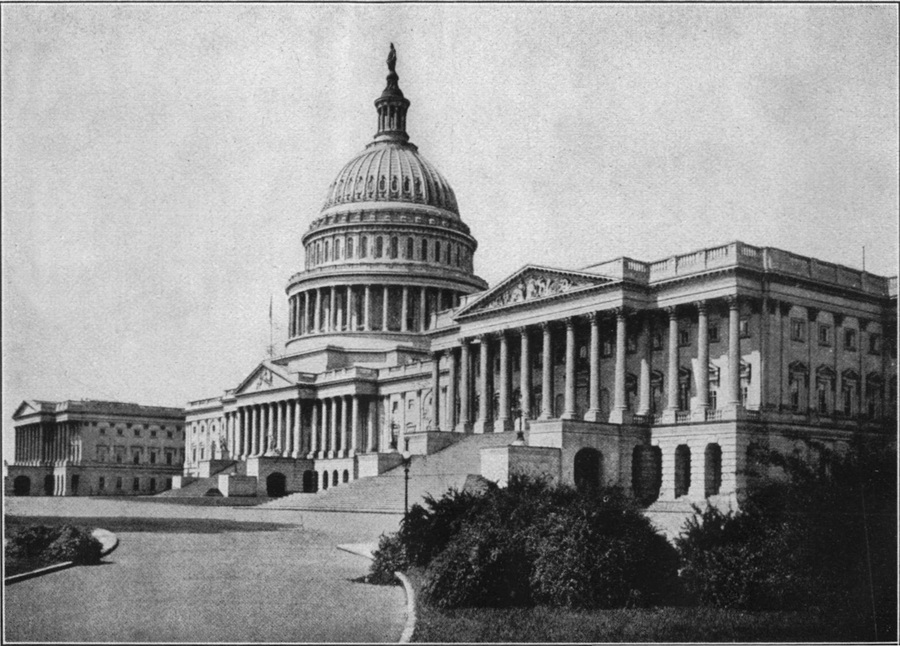
Ich hatte ihn erreicht. Auf hohem Felsen thronte ein Holztempelchen. Ich trat ein. Die Aussicht von oben war in der Tat glänzend[S. 289] und „groß“. Unten zu meinen Füßen lag Manitou wie aus einer Spielzeugschachtel aufgebaut, weiter hinaus Kolorado-Springs, und dann ergoß sich die endlose Ebene wie ein Meer bis an den weitesten Horizont; ringsum aber die immer gewaltiger ansteigenden Berge. Über allem das noch immer unbezwingliche Schneehaupt des Pikes Peak! Ich stand wohl jetzt etwa noch knapp 1000 m unter seinem Gipfel. Es war Mittag. Der Hunger meldete sich. Und der Weg abwärts und zurück war auch noch ein gutes Stück Arbeit. So entschloß ich mich schließlich doch schweren Herzens, die weitere Besteigung des Berges nicht zu versuchen. Aber es hat mich einen Kampf gekostet ...!
An den Felsen des grand-view-rock waren sehr merkwürdige Inschriften, die zur religiösen Bekehrung riefen, angeschrieben, z. B.:
„God will save us. The wicked go to the hell. Where will you spend
eternity? He that believes, shall be saved.
He, that does not, shall be
damned.“[34]
Also Heilsarmeefrömmigkeit bis auf den Pikes Peak hinauf! Ob das hier gerade sehr geschmackvoll wirkte? Ob nicht die grandiose Bergwelt allein dem Menschen mehr wirkliche Gotteserkenntnis predigte als solche Inschrift? Das Holzgeländer des Tempelchens, das vor der Tiefe schützen sollte, war recht morsch. Im Winter mag hier manch schöner Sturm und Frost wüten! Nachdem die letzte Kost verzehrt und der letzte Blick hinauf auf das göttergleiche Haupt des Pikes Peak und hinab in die endlosen Prärien getan war, begann ich innerlich traurig den nicht mühelosen Abstieg nach Manitou ...
In Manitou wieder angekommen, mache ich, ehe ich nach Kolorado-Springs zurückkehre, noch einen weiten Umweg in die „gardens of the gods“, d. h. in jenes Gebiet der merkwürdigsten Sandsteinbildungen, noch vielmal absonderlicher als etwa die unserer sächsischen[S. 290] Schweiz, besonders eigenartig durch ihre rotglühende Färbung. So wandle ich am Nachmittag — die Schneeregion ist wieder verlassen — zwischen dem „Turm von Babel“, einem mächtigen mehrgipfligen spitzen Fels, den „drei Grazien“, drei steilspitzen Nadelfelsen, den „siamesischen Zwillingen“, zwei eigenartig fast in gleicher Höhe nebeneinander aufragenden und durch ein Felsstück verbundenen Gesteinstürmen, so daß sie wie zusammengewachsen erscheinen, am „Wackelstein“, einem mächtigen auf einer Ecke balanzierenden Felsblock, und dem „Gateway“, einem mächtigen Felsentor, vorbei zu den Höhlen der Felsenbewohner (cliff-dwellers) aus vorgeschichtlicher Zeit und den „Titanen“felsen, die fast den Eindruck assyrischer Götterfratzen machen. Und zwischen all diesen seltsam bizarren roten und weißen Sandsteinbildungen blickt immer wieder das majestätische Haupt des Pikes Peak aus der Ferne hindurch wie der schneeige Libanon durch die grandiosen Tempelruinen von Baalbek in Syrien ...
Gegen Abend bin ich wieder in Kolorado-Springs und kann mich auch hier nicht satt sehen an dem dominierenden Schneegipfel.
Nach einer nach diesen Anstrengungen wohldurchschlafenen Nacht entführte mich der Zug in die „Königin des Westens“ Denver. Mein lieber Freund Moore in Harvard, Dolmetsch und Cookführer in Konstantinopel und Griechenland, hatte es mir geradezu auf die Seele gebunden, daß ich seine Heimatstadt Denver besuchen müßte. Die Entfernung von Kolorado-Springs betrug 75 Meilen, also nur ein Katzensprung für amerikanische Begriffe. Während der ganzen Fahrt dorthin hatte man links eine Prachtaussicht auf die Kette des Felsengebirges. Und je weiter wir uns vom Pikes Peak entfernten, desto höher erschien er. Es war wieder ein feiner Frühlingsmorgen. Der Zug hatte mit Tuten öfters Vieh und Spaziergänger vom Bahndamm zu jagen, der auch hier als bequemster Verbindungsweg galt! Rechts dehnte sich der Blick in die endlose Prärie. Die Büffel in ihr sind freilich verschwunden. Die sieht man bloß noch im Golden-Gate-Park in San Franzisko oder in zoologischen Gärten. Auf 2000 m[S. 291] Höhe, auf der wir hinfuhren, waren die Bäume hier noch unbelaubt, während es in Kalifornien schon wie Sommer gewesen war!
Denver liegt wie München auf einer Hochfläche vor den Alpen. Rings ist wohlangebautes Farmland. Aber nirgends entdeckte man in ihm so etwas wie Volkstracht. In der Stadt selbst, die sauber, aber mir auch recht windig vorkam, empfangen mich wieder endlose Straßenzeilen. Nachdem ich einen Lunch eingenommen habe, gehe ich zu dem erhöht liegenden Staatskapitol der Stadt, um von oben recht die Aussicht über die Stadt und auf das Felsengebirge zu genießen. Aber es ist Sonnabendnachmittag, und ich werde nicht mehr zur Kuppel heraufgelassen, es sei schon „für Sonntag gekehrt“! Das tut man also auch in Amerika! So konnte ich die schöne Aussicht, die das Felsengebirge hier in einer Ausdehnung von 270 km zeigt, nicht bewundern und mußte mich mit Streifen durch die Stadt begnügen. So ging ich unter anderem in den Stadtpark und treffe auf ein Denkmal des Dichters Burns mitten zwischen Kanonen! Geschmackvoll! Die Zeitungsbureaus sehe ich umlagert von Massen, die auf die neuesten Nachrichten über den Ausgang der Sonnabendnachmittags-Fußball- und -Baseballkämpfe warten! So war auch Denver typisch amerikanisch. Das amerikanische „Gesicht“ ist überall gleich ...
Denver ist Hauptstadt des Staates Kolorado und dank der reichen Goldfunde und Minen äußerst schnell gewachsen. Erst 1858 wurde es von Goldgräbern gegründet, 1870 war es noch eine unbedeutende Stadt, heute zählt es schon 300 000 Einwohner!
Abends sitze ich schon wieder in meinem Schlafwagen, um in einer Nacht, einer Tagesfahrt und einer Nacht über Kansas City und den Mississippi wieder Chikago zu erreichen. Dann wird mein verbilligtes meterlanges Auswandererzettelbillett abgefahren und die große Schleifen-Westreise vorläufig vollendet sein. Stiller Mondschein liegt über den unendlichen Gefilden der Prärie. Ich war froh, in zwei Nächten sie zu durchfahren. Denn sie noch einmal ganz bei Tageslicht in ihrer grenzenlosen Einförmigkeit zu durchleben, wäre fast eine zu große Nervenbelastung gewesen. Die Seele war nun aus[S. 292] Neu-Mexiko, Arizona, Kalifornien, Nevada, Utah, Kolorado zu sehr mit immer wechselvollen und romantisch-anziehenden Bildern gesättigt, um jetzt noch für die monotone Öde der Mississippi-Ebene empfänglich zu sein und sie etwa 36 Bahnstunden lang hintereinander in sich aufzunehmen. Die Abspannung war aber auch sowieso noch groß genug. Ich fuhr also die Nacht zum Sonntag, den ganzen Sonntag und die Nacht zum Montag ohne Unterbrechung! Am Sonntag war der Zug sehr leer. Denn vielen Amerikanern ist es einfach Sünde, am Sonntag zu reisen. Die Zahl der Züge ist auch beschränkt.
An wie vielen kleinen Städten, einsamen Farmen, kleinen Kirchen fuhren wir in den 36 Stunden vorüber! Und dazwischen Land, Land und immer wieder unendliches Land. In Kansas und Illinois fing es auch erst ganz schüchtern an, Frühling zu werden. Es ist die Gegend der furchtbaren Frühlingsorkane, der gefürchteten Tornados, die sich bilden, wenn die südlich warmen und nördlich kalten Luftströme ungehindert aufeinanderstoßen. Die Natur war noch keinen Schritt weiter wie vor zweieinhalb Wochen.
Nachdem man viele Stunden lang nichts Besonderes gesehen hatte, zeigten sich einmal drei Jäger zu Pferde mit Flinten in der Steppe — welch ein Ereignis! Ein andermal standen ein paar Männer an einem kleinen Bahnhof und sahen dem Zug nach — ein Ereignis! Im Zuge selbst wurde es beim langen Fahren einer Dame übel. Bleich sank sie auf ihrem Stuhl zusammen — ein Ereignis! Ich wundere mich überhaupt, daß es bei dem endlos langen Bahnfahren nicht noch mehr Menschen übel und ohnmächtig wird. Aber sie haben offenbar hier von Jugend an andere Eisenbahnnerven als wir! Ich wunderte mich auch manchmal über mich selbst, daß ich die 12 000-km-Bahnfahrt so gut überstanden habe! Aber nun kommt angesichts der ohnmächtigen Lady ratlos der Neger-Wagenhilfsschaffner auf mich zu — was hat er nur mit mir vor? Erfolgt etwa ein neuer Angriff auf mein Scheckbuch? Er fragt mich, ob ich vielleicht ein „physician“[35][S. 293] sei, und ob ich der bleichen Dame beistehen könne. Beschämt muß ich meine vollständige medizinische Unkenntnis eingestehen. Wie kam er auf mich? Hat er mir mit hellseherischen Augen die Verwandtschaft mit meinem Onkel, dem Doktor in Boston, angesehen? Immerhin riet ich, die Dame sanft zu lagern, ihr ein Kopfkissen unterzuschieben und etwas Wasser zu holen und dann sie sich selbst zu überlassen, bis sie wieder zu sich käme. Das geschah auch bald, genau nach meinem medizinischen Rat! Und ich war zum Glück weiterer medizinischer Künste enthoben. Für was man mich drüben alles gehalten hat! Bald war ich Landaufkäufer, Reisender, Zeitungsschreiber, Stundengeber, Student, Arzt, nur nicht das, was ich wirklich war ...
Am Arkansasriver entlang ging es stracks gen Osten. Farmer stiegen ein, die nach Chikago wollten oder nach Neuyork zum Einkaufen! Welcher pommersche Bauer fährt bei uns nach Frankfurt am Main, Basel oder Mailand zum Einkaufen? Alle waren hier in der gleichen einförmigen städtischen amerikanischen Kleidung, auch die Farmer. Bauerntracht gibt es nicht. Man unterscheidet am Rock drüben niemand, keinen Kaufmann, Beamten, Farmer, Schreiber oder was sonst. Sie sind alle „citizens“, sitzen in derselben Eisenbahnklasse und treten gleich als „Bürger“ auf ...
In Kansas City hatte ich umzusteigen. Wie primitiv sind die Wartesäle selbst in einer so großen Stadt! Bloß Bänke in einer großen Vorhalle! Ich habe Zeit, gegenüber dem Bahnhof auf eine Felsenterrasse zu steigen. Rauchig und düster kommt mir an diesem Abend die Stadt vor.
Wieder geht es hinein in den „sleeper“ nach Chikago, und ich schlafe dem Lake Michigan entgegen. Nächtlich prasselt beim Fahren tüchtig die Asche aus der Lokomotive auf das Dach. Der Zug fährt schlecht, ruckt, zieht an, stöhnt, pfeift, steht und fährt wieder. Ist etwas nicht im Lote? Ich denke an die dreimal mehr Eisenbahnunfälle in Amerika als in Deutschland, und es ist mir etwas ungemütlich. Aber wohlbehalten rollen wir früh in Chikago ein. Gott sei dank, einmal wieder auf festem Erdboden! Mein Billett ist abgefahren! — —
[S. 294]
Diesmal langte ich in der Morgenfrühe in Chikago an, das war besser. Zwei Tage vorher hatte ein von Kanada einbrechender Schneesturm auch Chikagos Asphalt in Schnee gehüllt und weithin in Illinois, Wiskonsin, Michigan die Baumblüte „vernichtet“. So beuteten die Zeitungen schnell das unerwünschte Ereignis aus und kabelten, was für ein nationales Desastre führende Männer über Illinois prophezeiten! So daß man als naiver Mensch wirklich zuerst glaubte, die Union stehe am Vorabend des Hungertodes! Aber das diente wohl nur im voraus dazu, die amerikanische Menschheit auf höhere Obstpreise gefaßt zu machen, so daß der „Blizzard“ den Obstmagnaten nicht ganz ungelegen kam.
In Wolken, Regen, Schnee und Nebel wirkten die Wolkenkratzerschluchten diesmal noch düsterer und grandioser als sonst. In den unteren Stockwerken brannte den ganzen Tag Licht. Bei Marshall, Field & Co. sah ich das alte wahnsinnige Getriebe und Gewimmel im Ein- und Ausgehen. In den Straßen wie immer die policemen und Negerfuhrleute. Zum Brechen voll waren die moving pictures, Theater, Zirkusse. Man will Geld machen und sich vergnügen. Sonst will man in Chikago nichts ...
Luft bekam ich erst am stürmisch erregten Michigansee mit seiner weiten, meerähnlichen Wasserfläche. Von ihr aus kann man durch die anderen Seen und den Lorenzstrom zu Wasser bis nach London fahren! Die „stockyards“ widerten mich an. Die Clowns und Akrobaten bei Barnum und Bailey lockten mich nicht mehr. Das Geschrei an der Börse hielt mich keine Minute. Auch nicht das römische Wagenrennen der Cowboys noch die Todesspringer aus der Kuppel des Zirkus scheuchten mich aus dem Schaukelstuhl meiner Verwandten, aus dem ich der lieben Kusine meine gesamte Rundreise nach Kalifornien zu schildern suchte. Mein Vetter wollte es gar nicht glauben, daß man in verhältnismäßig so kurzer Zeit solche Entfernungen durchmessen und soviel sehen könne und dabei noch Nerven behalten und gesund bleiben, ja gesünder wiederkommen könne als man fortfuhr. Ich freute mich, als German selbst den Yankees zu imponieren! Und das ist nicht immer ganz leicht.
[S. 295]
So nach einem zweiten Aufenthalt in der drittgrößten Stadt der Welt dampfte ich eines Morgens wieder im Pullman davon, aber nicht geradeswegs über den Niagara nach Boston zurück, wie ich gekommen war — das wäre ja nichts Neues gewesen — sondern nach einem neuen leuchtenden Stern in meinem Reiseprogramm, nach Washington. Hatte ich soviel in der Union gesehen von Osten bis zum äußersten Westen, so wäre es schon ein Akt internationaler Unhöflichkeit gewesen, wenn ich nicht auch der Hauptstadt meinen respektvollen Besuch gemacht hätte. Freilich von Chikago nach Washington fahren, das bedeutete noch einmal tief nach Süden ausbiegen und dann wieder weit hinauf nach Norden. Also auf nach Washington!
[28] Letzter Ruf zum Abendessen.
[29] Also etwa zwölfmal so groß wie der Genfer See!
[30] Solche Dinge sind psychologisch möglich durch Zurücktreten des Wachbewußtseins und Hervortreten des Unterbewußtseins, das sich Dinge erinnert, die das Wachbewußtsein „vergessen“ hat.
[31] „Blut Christi“-Berge von ihrer rötlichen Sandsteinfarbe.
[32] Morgenzeitungen.
[33] Königliche Schlucht.
[34] Gott will uns retten. Die Bösen gehen zur Hölle. Wo willst du die Ewigkeit zubringen? Wer glaubt, wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.
[35] Ein Arzt.
Ich schickte mich an, noch zwei mächtige Katheten eines riesigen rechtwinkligen Dreiecks abzufahren statt der viel näheren direkten Hypotenuse. Das hatte aber auch den Vorteil für mich, daß ich auf diese Weise nicht nur nach Washington kam, sondern zugleich die große Hafenstadt Baltimore und die „Wiege der Freiheit“, die „Stadt der Bruderliebe“, die Millionenstadt Philadelphia berührte, ja zuletzt auch noch einmal durch Neuyork kam. War ich dann wieder in meiner „Heimat“ Boston, so hatte ich im ganzen eine riesige Acht gefahren, deren Schnittpunkt Chikago, deren bei weitem größerer unterer Teil gen Westen und der kleinere obere nach Osten lag. Immerhin waren es von Chikago nach Washington noch 650 km und von da nach Boston zurück weitere 400, also wiederum über 1000 km. Endlich aber kam ich unterwegs durch den großen Eisen- und Kohlenbezirk Pittsburgh, das amerikanische Essen, wo ich einen alten Großoheim eines meiner besten Jugend- und Schulfreunde besuchen und begrüßen sollte, der dort schon ein halbes Jahrhundert als Prediger einer kleinen Arbeitervorstadtgemeinde wirkte.
So wallte ich wieder durch den amerikanischen Kontinent lotrecht auf die Küste des „heimatlichen“ Atlantischen Ozeans zu. Erst ging[S. 296] es durch den Staat „Indiana“, dann nach „Ohio“ hinein, das ich nicht allzu weit vom Südende des Lake Erie in seiner ganzen Breite durchfuhr. Ohio war mir seit Kindheit an ein vertrautes Wort samt seiner Aussprache „Oheio“, denn in meiner Kindheit wohnte Onkel E. mit seiner Musikschule in der Hauptstadt dieses Staates, dem durch seine Schweinezucht berühmten Cincinnati. Die Stadt selbst ist nach dem agrarischen Römer Cincinnatus, der vom Pfluge weg zum Diktator berufen wurde, wie wir als Quintaner schon lateinisch zu übersetzen hatten, benannt. Und wenn in meiner Kindheit an den Onkel geschrieben wurde, so wußte ich schon als Kind, daß das stets hieß: „Cincinneti, Oheio“. Aber nie hätte ich es damals für glaublich gehalten, daß ich einmal selbst in dies mysteriöse „Oheio“ (das uns Kinder immer ein bißchen an „heio, popeio“ erinnerte) verschlagen würde. Cincinnati berührte ich allerdings in dieser Nacht direkt nicht. Es ist berüchtigt wegen seiner fürchterlichen häuserumstürzenden und dächerabdeckenden Tornados. So vermieden wir beides und durchfuhren schlafend und seelenruhig den ganzen Staat „Ohio“. Die strahlenden Bogenlampen über den vom Regen nassen glänzenden Schienen des Central Union Depots in Chikago waren einer der letzten Eindrücke meines Wachbewußtseins, ehe ich in das andere Land der Träume hinüberschlief ...
Am Morgen fuhren wir mitten durch grünes, ansprechendes Hügelland. Überall sahen frische grüne Halmspitzen hervor. Es wollte mit Macht auch hier Frühling werden. Wir hatten wieder „eastern time“ nach der „mountain time“ des Felsengebirges und der „central time“ von Chikago. Das Land war wieder bedeutend dichter besiedelt als in den Ebenen westlich Chikago. Den Ohiofluß aufwärts ging es gen Allegheny und Pittsburgh. Die einstigen Indianertäler sind heute voll Fabriken. Welche Wandlungen!
Dicker Rauch lagerte über der industriereichen Gegend. Man glaubte um Birmingham oder an der Ruhr zu sein. Aus dem Sonnenschein des grünen Landes umfing es uns bald mit dunkelgelber Finsternis der Wälder von Fabrikschloten. Einst war Pittsburgh, das[S. 297] heute die amerikanische Metropole für Eisen und Kohle ist, einst nichts als ein kleines Fort namens Duquesne gegen die Indianer am Zusammenfluß des Allegheny River und des Monongahela gelegen. Heute ist es eine halbe Millionenstadt zwischen beiden. Schon ist der Ohio hier am Oberfluß fast so breit wie unser Rhein. Sein ganzer Lauf bis zum Mississippi aber gibt dem Missouri an Länge nicht viel nach.
Wir fahren über den breiten Strom in die rauchende, stampfende, dampfende und dröhnende Stadt ein, wo auch schon genügend Wolkenkratzer ihren steilen Hals aus der City recken. Ja, das Flußtal des Ohio ist so sehr mit Rauch gefüllt, daß man kaum bis zur nächsten Brücke sehen kann! Ehe wir in den Bahnhof einlaufen, umkreist der Zug fast die ganze Stadt.
Ich kann nicht sagen, daß mich Pittsburgh anzog, ebenso wie ich bis jetzt den Rauch der Ruhr mied und den englischen Industriebezirk um Manchester und Birmingham so schnell wie möglich wieder floh. Denn ich halte es viel lieber mit grünen Wiesen, blauen Seen und schneegipfligen Bergen und bin der altmodischen Meinung, daß Fabrik und Industrie, Kohle und Eisen die Menschheit zwar reicher, aber nicht glücklicher gemacht haben. Freilich muß ich zugeben, daß ich ohne Dampf und Eisen nicht nach Frisco und nicht nach Pittsburgh gekommen wäre.
Die Stadt und ihre Schwesterstadt Allegheny, die wie Elberfeld und Barmen zusammenliegen, wird von steilen Hügeln umkränzt, so daß sie des Malerischen nicht ganz entbehrt. Neben Eisen und Kohle ist die Gegend ebenso reich an Petroleum und dem der Erde entströmenden geruchlosen Naturgas. Ich hatte keine Neigung, eins der riesigen Stahlwerke „Edgar Thomson“ oder die „Homestead Steel Works“, das älteste Werk Carnegies, oder die „Duquesne Steel Works“ zu besuchen, wenn es auch sicher höchst eindrucksvoll gewesen wäre. Den Lärm der Eisenhämmer und das Surren der Treibriemen kann ich, wenn ich will, auch bei uns genießen. Viel mehr zogen mich die Menschen an, ihre Meinungen und Schicksale. So[S. 298] pilgerte ich durch die Straßen nach Allegheny hinüber, zunächst einmal den achtzigjährigen Großoheim unangemeldet und überraschend aufzusuchen. Hoffentlich war er nicht etwa gerade kürzlich verstorben ...
Unterwegs traf ich auf allerlei Anschläge: „Vote for socialism!“ Der Aufschrei einer geknechteten und entwürdigten Menschheit! Wie viele Deutsche mögen unter den amerikanischen Arbeitern sein, die den amerikanischen Stahlmagnaten, Trusts und Milliardären fronen! In Pittsburgh soll es keine 24 Stunden ohne einen Streik abgehen! Wie viele deutsche Abkömmlinge haben hier Granaten im Weltkrieg gegen die deutschen Stammesbrüder gedreht! An einer anderen Ecke mitten zwischen den Wolkenkratzern ein Arbeitervermittlungsbureau mit der heimatlichen Anschrift: „Hier wird deutsch gesprochen.“ Wie mancher mag hier schon hoffnungsvoll eingetreten und furchtbar enttäuscht wieder gegangen sein!
Aus: Rauchnächte.
I.
II.
Aus: Die Neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. Herausgegeben von Claire Goll. S. Fischer Verlag. Berlin.
So komme ich hinüber in die ansteigenden Straßen Alleghenys. In einem graudüsteren Arbeitervorstadtviertel klingle ich neben einer kleinen, fast baufälligen Kapelle an einem niedrigen einstöckigen Haus mit blanken Türgriffen. Mir klopft ein wenig das Herz. Wer wird öffnen? Lebt der alte treue Mann noch? Ein breitschultriger, weißbärtiger, freundlich blickender alter Herr von etwas gebückter Haltung in schwarzem Rock öffnet. Ohne Zweifel der alte Prediger! Er fragt englisch nach meinem Begehr und öffnet sofort weit die Tür zum Eintreten. Was er wohl von mir denken mag? Ob ich als Bräutigam eine Trauung bestellen will? Aber dazu sehe ich wohl nicht festlich und strahlend genug aus. Ob ich gar ein Begräbnis vermelden will, aber dazu lachen meine Augen doch zu hell. Dann bin ich sicher ein bettelnder, hilfesuchender Einwanderer und „Landsmann“? Das ist nicht so ganz falsch! Und ich? Ich kauderwelsche gar nicht erst englisch, sondern sage frisch und fröhlich auf deutsch: „Guten Tag, lieber Herr v. d. L., ich soll Sie bestens von Ihrem Großneffen Alexander P. in Deutschland grüßen.“
[S. 300]
Der alte Mann fuhr unwillkürlich einen Schritt zurück und sah mich groß wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt an. „Habe ich recht gehört?“ redete er jetzt auch gut deutsch, „Alexander P.?“ — „Jawohl, wir haben neun Jahre zusammen auf der Schulbank gesessen, dann sind wir ein paar Jahre zusammen Studenten gewesen, und bei Ihrer Nichte, Frau Professor P., ging ich ein und aus.“ — „Es ist nicht möglich? Aber wenn Sie es sagen, muß ich es schon glauben. Aber wo kommen Sie denn her?“ Wir standen immer noch zwischen Tür und Angel. „Gerade aus San Franzisko oder aus dem Mormonentempel in Salt Lake oder vom Pikes Peak herunter, wie Sie wollen.“ Jetzt machte er ein noch erstaunteres Gesicht und zog fast die Hand schon wieder zurück, die mich schon ins Zimmer zu bitten schien: „Da bin ich alter Mann von 80 Jahren, obwohl ich dort drüben an dieser Kapelle schon 53 Jahre predige“ — sein Finger wies auf die stark berußte alte steinerne Kapelle — „noch nicht gewesen.“ Wir traten ins Haus, und ich mußte erzählen. Stundenlang saßen wir einander gegenüber, und ich erzählte von Deutschland, von seinen Verwandten und von meiner Reise durch die Union, von Neu-Mexiko und dem Grand Kañon und dem Stillen Ozean. Und dann fing er an, aus seinem Leben zu erzählen; fast ein Jahrhundert sprach aus seinen durchfurchten Zügen und mannigfachen Erlebnissen. Er war in Rom als Sohn eines bekannten deutschen Bildhauers v. d. L. geboren. Sein Vater starb früh. In meiner Heimatstadt besuchte er das alte städtische Gymnasium und konnte auch den Frankfurter Dialekt noch recht unverfälscht nachahmen. Ach, da mußte ich nun genau beschreiben, wie es jetzt auf dem Römerberg, am Dom und auf der „Zeil“ aussehe! Er kannte freilich nur die einstige freie Reichsstadt. Wie anders war seit Jahrzehnten alles geworden! Dann war er als junger Mensch nach Amerika gegangen in den Zeiten, wo Deutschland noch nichts bedeutete!
Drüben wurde er erst Farmer. Die Gelehrsamkeit hatte er an den Nagel gehängt. Vom Farmer avancierte er — echt amerikanisch — zum Apotheker! Ohne eigentliche Lehre und viel Ausbildung. Aber[S. 301] dann zog es ihn doch wieder zur wissenschaftlichen Bildung zurück. Er übernahm eine Schullehrerstelle! Und schließlich folgte er dem frommen Sinn seiner künstlerischen Familie, deren Urheimat das Baltenland war, besuchte ein amerikanisches Presbyterianerseminar und wurde an der Kapelle drüben Prediger, der er noch heute, nach 53 Jahren, vorstand! So lernte er nacheinander italienisch, deutsch, englisch und französisch reden und hatte in seinem Leben den Einwanderern auch schon in allen diesen vier Sprachen gepredigt. Als er anfing, brachte seine Gemeinde für ihn gerade 87 Dollars Jahresgehalt durch freiwillige Beiträge zusammen! In seiner ersten Kirchenkollekte fanden sich sieben Cent! Seine Gemeinde blieb immer eine der ärmsten von den armen. Aber er hielt ihr die Treue. Augenblicklich war sie wieder auf 70 Familien zusammengeschmolzen und unfähig, für den alten Herrn ein Ruhegeld aufzubringen. So sah er sich genötigt, bis zum letzten Atemzug zu arbeiten. Und war es zufrieden.
Wir plauderten lange. Ich fühlte mich bald bei dem lieben alten Herrn wie daheim. Er war seit Jahrzehnten Witwer. Aber da allmählich mein Magen etwas knurrte, so wollte ich mich auf eine Weile verabschieden, um irgendwo einen bescheidenen Lunch einzunehmen. Aber das litt der alte Herr nicht, sondern nötigte mich an seinen peinlich sauber gedeckten bescheidenen Tisch. Nach dem Essen mußte ich allerlei alte Familienbilder, Lebenserinnerungen, Bilder aus Rom, das ich aus eigener Anschauung kannte, ansehen. Und wie interessierte es ihn, zu hören, wie es heute beim Pantheon, auf dem Forum, auf dem Kapitol und in St. Peter aussehe! Mit einem gemütlichen Spaziergang über die Höhen der Stadt beschlossen wir den Tag. — —
Andern Tags fuhr ich nach Washington.
53 Jahre hätte ich nicht gerade in Pittsburgh oder Allegheny wohnen mögen, wo man die längste Zeit des Lebens in Rauch und Qualm verbringt; aber die Treue und Genügsamkeit des alten Predigers war doch ein Stück stillen Heldentums. Ich lechzte derweilen wieder nach freier Sonne und grünen Wiesen und Feldern. Sie sollten auch nicht lange auf sich warten lassen ...
[S. 302]
Lotrecht fuhren wir südöstlich auf das Alleghenygebirge zu, das als einziges den amerikanischen Osten unterbricht. An Ausdehnung und Höhe ist es mit dem Felsengebirge nicht entfernt zu vergleichen, sondern erinnert seiner ganzen Art nach vielmehr an unsere deutschen Mittelgebirge.
Stark stieg die Bahn an. Hell und freundlich schien wieder die Sonne. Wohlangebaute Fluren dehnten sich rechts und links. Man sah es den Feldern und Siedlungen an, daß sie weit älter sein mußten als die um Chikago oder gar westlich davon. Auch merkte man sichtlich die ständig wachsende Dichte der Besiedlung. Immer höher kamen wir in das Bergland hinein. Es schäumten die Bäche lustig und rasch vom Gebirge herab. Da und dort sah man wieder verwüstete und abgebrannte Wälder. Felstäler taten sich auf wie in der Schwäbischen Alb. Immer romantischer wurde die Landschaft und immer sonniger und grüner, je weiter wir südlich kamen und je näher dem Ozean. Als wir gar jenseits des Passes das Tal des Potomac River hinabfuhren, lachte uns geradezu ein jauchzender Frühling entgegen mit keimenden Saaten und herrlichstem Himmelblau. Anmutig leuchteten zartrosa die Apfelbäume in ihrer ersten schüchternen Blüte. Welche klimatischen Unterschiede auch hier wieder! Die großen Ebenen um Chikago sind schutzlos den kanadischen Froststürmen, die über die großen Seen hereinbrechen, preisgegeben. Aber das Land östlich und südlich der Alleghenies ist durch sie gegen die kalten Nordwinde wie durch eine Mauer geschützt, so daß man in Washington schon den Geschmack der warmen Süd- und Plantagenstaaten empfindet, den warmen Hauch Virginias, des „Landes der jungfräulichen Königin“ (Elisabeth) und Carolinas, des Staates Karls I. von England, der alten Hauptsklavenstaaten.
Bei „Harpers Ferry“ mündet fast wie in einer Neckarlandschaft der „Shenandoah“-Fluß[36] in den größeren Potomac. Links und rechts begleiteten uns die lieblichsten Hügelreihen. Es war ein lachendes[S. 303] Flußtal, das gerade für Bahn, Straße und schmale Siedlungen Raum läßt. In Harpers Ferry ist man an einer historischen Stelle. Nicht nur daß hier mancherlei Schlachten im Bürgerkrieg geschlagen wurden — denn in diesen Strichen lief die Grenze zwischen Nord- und Südstaaten, zwischen Sklavenbefreiungs- und Sklavenhalterstaaten — sondern Harpers Ferry ist die denkwürdige Stelle, wo schon 1859 John Brown mit wenigen entschlossenen Abolitionisten in das Städtchen eindrang, um die Sklaven zum Aufstand zu veranlassen. Aber die Neger folgten seinem Ruf noch nicht. John Brown wurde umzingelt, besiegt und schließlich von den Sklavenhaltern gehängt. Sein letzter Widerstand erfolgte in einem kleinen, scheunenartigen Haus, jetzt „John Browns Fort“ genannt, das heute noch steht. Die Bahn fährt dicht daran vorüber.
Als wir eine geraume Strecke weiter aus den Bergen in die Ebene hinausgefahren sind, ragt mit einem Male ein hoher Obelisk aus tiefem buschigen Grün, das Washington-Monument, empor. Bald darauf schwebt über der Landschaft eine hohe, stolze adlige Kuppel wie St. Peter über der Campagna bei Rom — das Kapitol der Bundeshauptstadt.
Ich bin wirklich in Washington! Traumhaft! Etwas wie Ehrfurcht überkommt mich. Vereint sich in Wallstreet und auf dem Broadway in Neuyork das Kapital der Union, so in Washington alle Regierungsmacht. Washington liegt gerade auf der Grenze des Nordens und Südens. So ist es von hier nicht weit nach den Schlachtfeldern von Gettysburg, Harrisburg und dem Hauptquartier der Südstaaten, Richmond. Man ist in Washington ungefähr in der Mitte zwischen Maine und Florida. Es ist auch bezeichnend, daß die Bundeshauptstadt ganz im Osten der Union liegt. Der Osten (außer Chikago und St. Louis) ist Amerika. Im Westen dominiert nur noch das einzige San Franzisko. Aber welche Entfernungen von der Bundeshauptstadt dorthin! Wir sind gewohnt, Hauptstädte in der Mitte des Landes zu suchen. Aber wir dürfen nicht vergessen, noch vor gut einem halben oder Dreivierteljahrhundert war Amerika bloß[S. 304] ein Streifen am Atlantik, dessen Mitte Washington bildete. So erklärt sich noch heute seine Lage.
Der Hauptbahnhof in seinem strahlenden Marmorweiß und seinen unzähligen, zum Teil unbenutzten Geleisen macht einen sehr vornehmen Eindruck. Der Bahnverkehr Washingtons ist freilich, verglichen mit dem Neuyorks und Chikagos, recht gering. Gleichwohl hatte Washington den echt amerikanischen Ehrgeiz, den „größten Bahnhof der Welt“ zu besitzen, selbst auf die Gefahr hin, daß es alle diese Geleise gar nicht ausnutzte!
Washington ist im ganzen eine stille, aber äußerst stattliche und höchst saubere Stadt. Nur zwei Städte machten auf mich diesen Eindruck, Washington und — Salt-Lake-City. Alles hell, gerade, luftig, grün, weitläufig. Eine wahre fürstliche Platzverschwendung herrscht in Washington überall.
Ich nahm meinen Weg sofort zum Kapitol, das aus dichtem dunklen Parkgrün hervorschaut. Ich war immer aufs neue überrascht von den weiten prächtigen Parkanlagen, von den großen, weiten Plätzen und überaus breiten Straßen, die ich hier sah. Ich hatte sofort den Eindruck, diese Stadt ist die schönste der Union, und sie kann sich wirklich mit den europäischen Hauptstädten messen. Welche königliche Platzverschwendung hat man sich hier erlaubt! Das ganze Gelände vom Kapitol zum Obelisk und von da zum „Weißen Haus“, eine gute halbe Stunde Weges, ist ein Park. Aristokratisch und edel steigt das Kapitol mit seinem weißen Sandstein und seinem Marmor, seinen vorspringenden Flügeln mit ihren klassischen Tempelstilfronten und seiner imponierenden, von der Freiheitsstatue gekrönten Kuppel auf einer kleinen Anhöhe auf, ein wahrhaft majestätischer Bau. Fast erscheint die Kuppel, weniger in Anbetracht der Länge als der verhältnismäßig geringen Höhe des Gebäudes, etwas groß und schwer. Besonders reizvoll sind die Blicke auf sie aus den verschiedenen Parkwegen und von dem unteren Ende der Pennsylvania-Avenue.


Am anderen Tag saß ich eine Weile auf der Galerie im Repräsentantenhaus und ebenso eine Weile im Senat und hörte den Debatten[S. 305] zu. Am meisten Eindruck aber machten mir die acht ehrwürdigen Richter des „Supreme Court“ in dem kleinen Saale des „obersten Gerichtshofes“, dessen Bedeutung etwa dieselbe wie die unseres Reichsgerichts in Leipzig ist, ja vielleicht eine größere, denn in Amerika wird das Recht nicht so sehr nach festgelegten Paragraphen angewandt, sondern nach dem Rechtssinn und Gewohnheitsrecht gefunden. Die Richter, außer denen des Supreme Court, sind nicht vom Staatsoberhaupt ernannt, sondern werden vom Volke erwählt.
Dann stand ich unter der Kuppel unter den großen historischen Gemälden, die von der Landung des Columbus, der Einschiffung der Pilgerväter, Washingtons Übernahme des Oberbefehls über die Revolutionsarmee, von der Entdeckung des Mississippi und der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung in Philadelphia 1776 Kunde geben. Eine imposante Halle! Oben in der Kuppel befindet sich eine mächtige Darstellung der Apotheose Washingtons, dessen Name mit diesem Land und seiner Verfassung und dieser Stadt unlöslich verknüpft ist. Kein Name ist berühmter geworden, selbst nicht der Lincolns, mit dessen Namen der Bürgerkrieg und die Sklavenbefreiung unauslöschlich verbunden sind. Als ich dann in den nächsten Saal zur Linken trat und den Marmorstatuen der großen Amerikaner gegenüberstand, deren zwei aus jedem Staat hier aufgestellt sind, drang die Geschichte, Größe und Macht dieses Landes, das einen ganzen Kontinent umfaßt, mächtig auf mich ein. Eine kurze, fast stille Geschichte, und doch bedeutungsvoller als irgendeine der europäischen Dynasten- und Raubkriege. Die Reibereien der europäischen Großmächte, Kolonialkriege, Kaiser- und Papsttum — alles das blieb hier unbekannt. Alles, was hier geschah, diente der Kolonisation, der wirtschaftlichen und der politischen Einigung. Aus Kolonien ist das Land zu einer selbständigen, an Volkszahl und Reichtum alle europäischen Mächte überbietenden Großmacht ersten Ranges emporgewachsen, die mehr „world-spirit“ in sich trägt als vielleicht sogar England, dessen Hauptabkömmling Amerika doch letztlich ist. Der anglikanische Typus ist in Amerika vorwiegend und hat dank der[S. 306] Sprache auch die absolut dominierende Herrschaft erlangt, während die Spanier, obwohl die ersten Ansiedler, die Franzosen am Mississippi in Neuorleans, Louisiana und in Kanada, die Holländer im alten Neuamsterdam, dem heutigen Neuyork, die Deutschen, zerstreut durch das ganze Land, und endlich die romanischen und slawischen Elemente der jüngsten Einwanderung im Anglikanismus Amerikas aufgegangen sind und in ihm wohl aufgehen werden.
Amerikas Geschichte beginnt eigentlich erst mit dem Unabhängigkeitskrieg am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Auffassung des Staats, der Kirchen im Verhältnis zu ihm, des Menschentums und der politischen Freiheit sind Aufklärungsgedanken. Hier hat Frankreich, das Frankreich der Revolution und der Republik, Pate gestanden (Lafayette!). Aus dieser Zeit stammt sowohl der klassizistische Stil der Staatsgebäude wie die Anlage der Stadt Washingtons. Ein französischer Architekt hat die Pläne seiner Parks entworfen. Frankreich schenkte die Freiheitsstatue für den Hafen von Neuyork, und immer ist die besondere Sympathie Frankreichs für die große Schwester in der neuen Welt wach geblieben. Wundern wir uns also nicht allzusehr, daß der inneren Stimmung nach und nicht nur aus Geschäftsgründen Amerika im Weltkrieg auf seiten Englands und Frankreichs trat. Aber kein anderer als Friedrich der Große ist die Ursache gewesen, daß Frankreich nach dem Siebenjährigen Kriege seine Besitzungen in Amerika an England abzutreten hatte! Der Siebenjährige Krieg war ebenso Kolonialweltkrieg zwischen England und Frankreich als Kontinentalkrieg zwischen Österreich und Preußen. Friedrich der Große war zum Teil Englands Soldat!
Seit dem Unabhängigkeitskrieg gab es nur noch ein Ereignis, das die Union tief erschütterte, den Bürgerkrieg und die Sklavenbefreiung. Durch Kauf wurde später Florida, Louisiana und Alaska erworben; von Mexiko wurden die südwestlichen Territorien Neumexiko, Arizona und Kalifornien an die Union abgetreten; so wuchs allmählich und doch rasch das Riesenland zusammen, bis es im letzten Jahrzehnt anfing, selbst Kolonialmacht und der Erbe Spaniens, das einst den Entdecker Kolumbus aussandte, zu werden.
[S. 307]
Diese Macht des Landes hat sich hier in der Hauptstadt ihre Symbole in prächtigen öffentlichen Gebäuden geschaffen. Gegenüber dem Kapitol liegt die Bibliothek des Kongresses, innen überreich mit Marmor ausgeschmückt, wie nur irgendein Palast in Italien, und mit einem über alles prächtigen Lesesaal, der sicher nicht viele Konkurrenten in der Welt hat. Nahe dem „Weißen Hause“ die stattlichen klassizistischen Gebäude des Bundesschatzamts und des Kriegsministeriums. Auf freiem offenen Plan davor ragt der stolze, schlanke, zu Ehren Washingtons erbaute 169 m hohe Obelisk auf, lange der höchste Steinbau der Welt, bis ihn die Wolkenkratzer überhöhten. Im Morgendunst von fern wie ein mächtiger weißer Spargel aus grünem Gebüsch, abends zart rosa leuchtend anzuschauen. Von seiner Spitze, zu der ein Aufzug — wie mühselig sind doch die vielhundertstufigen alten Steintreppen in unseren Domtürmen! — hinaufführt, eine überraschend großartige Rundsicht. Die ganze Stadt, die trotz ihrer verhältnismäßig geringen Einwohnerzahl doch einen immensen Flächenraum einnimmt, ist eingebettet in Parkgelände. In weitem Bogen bespült sie der Potomac, so breit wie die Elbe bei Hamburg, der sich bald unterhalb der Stadt zu einer langen, tief ins Land einschneidenden Bucht verbreitert. Und jenseits liegt der große, schattige Nationalfriedhof für die Gefallenen aus dem Bürgerkrieg. Ich bedauerte, daß nicht eine gerade stattliche Allee vom Kapitol zum Obelisk führte, mit ständigem Durchblick auf die Kapitolskuppel, und ebenso vom Obelisk zum Weißen Hause. Aber das Weiße Haus wäre in seiner Bescheidenheit gar nicht dazu angetan, den Endpunkt einer stolzen Allee zu bilden, denn hier wohnt ein „Bürger“, von keinem Posten bewacht, von keiner Schloßwache beschützt, ein „Bürger“ in einer besseren Bürgervilla, zu der jeder „Bürger“ Zutritt hat. Es war mir doch seltsam zumute, als ich am Gartengitter stand und in den Garten des Weißen Hauses hineinlugte mit seinem kleinen Springbrunnen in der Mitte, seinem eigenen Tennisplatz und seinen wohlgepflegten, mit gelbem Kies bestreuten Wegen. Um mich herum auf dem offenen grünen Plan am Obelisk spielten Schuljungen und junge Burschen ihren Baseball.[S. 308] Viele Leute, die aus dem Geschäft oder von der Arbeit kamen, Schwarze und Weiße, standen da herum und schrien mit, applaudierten und ermunterten die Spieler. Ich ging ins „Weiße Haus“ hinein, soweit es erlaubt war. Ich erwartete kein Schloß und sollte kein Schloß erwarten. Es will auch absichtlich mit keinem Schloß konkurrieren. In der Vorhalle des Weißen Hauses fand ich eine Galerie von Präsidentenfrauen bis auf Mrs. Roosevelt; auch durfte man in den sogenannten „Eastroom“ eintreten, einen bescheidenen Empfangssaal mit Parkett, goldenen Leuchtern auf den Marmorkaminen, ein paar Blattpflanzen an den Fenstern und drei Kristallkronleuchtern. Das war alles von äußerem Glanz.
Am Nachmittag benutzte ich das Dampfboot und fuhr den Potomac hinunter nach Washingtons Landgut „Mount Vernon“ in Virginia. So bekam ich auch etwas Geschmack vom Süden, in dem einst die großen Negerplantagen waren und die Sklaverei herrschte. Die Sklaverei ist aufgehoben. Aber noch hat der Neger kein volles Recht. Zu Zeiten kommen z. B. noch fürchterliche Lynchgerichte am Neger vor. Und ob man immer den Schuldigen trifft?
Johnson, Neger.
Aus: Die neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. S. Fischer, Berlin.
[S. 310]
In Mount Vernon verbrachte Washington den Rest seines Lebens, nachdem er zweimal Präsident gewesen und eine weitere Wiederwahl ablehnte, so daß es seitdem für die Präsidenten geradezu Pflicht geworden ist, höchstens acht Jahre die Präsidentschaft inne zu haben. Mount Vernon ist ein reizender lauschiger Landsitz auf einer sanften Anhöhe am Fluß, unter alten, dichtbelaubten Eichen, unter denen Washington und seine Frau auch begraben liegen. Ein paar Minuten standen wir entblößten Hauptes, eine Gruppe College-Studenten um mich herum, vor der schlichten Grotte samt einem Haufen älterer reisender Damen aus Philadelphia, die laut sich unterhaltend die liebliche Stille dieses geweihten Erdenwinkels unliebsam störten. Dann kam man oben zu der einfachen Meierei hinauf mit ihrem Herrenhaus, einem niedrigen zweistöckigen weißen Farmhaus mit offener, sehr simpler Vorhalle und einer Reihe von Ökonomiegebäuden im Hintergrund. Immer war da noch der alte Hausrat in den engen, niedrigen Stuben mit dem blankgescheuerten abgetretenen Holzboden und den großen blankgeputzten Türklinken, den alten runden goldumrahmten Bildern, den weißgetünchten Zimmerdecken, den großen offenen Kaminen und den einfachen Stühlen an dem runden Eichentisch, dem alten Klavierchord im Musikzimmer und den Gardinenbetten im Dachstock mit seinen kleinen „Sparerooms“, in deren einem Martha Washington gestorben ist, weil sie gern einen Blick auf ihres Mannes Grab haben wollte. Es war eine Luft, eine Umgebung und ein Hausrat etwa wie im Frankfurter Goethehaus. Frau Martha Washington schien mir sogar etwas Ähnlichkeit mit der alten Frau Rat Goethe zu haben. Man konnte auch Washingtons Todeszimmer sehen, wo er selbst 1799 starb. Die reisenden Damen aus Philadelphia schluchzten fast vor Vergnügen, daß sie das alles sehen durften, und brachen in jedem Zimmer in juchzende Seufzer aus: „Ach, hier hat er gesessen, ach und hier hat er gegessen und hier in diesem Bett ist sie gestorben — hier ist sein Degen, den er trug, und hier die Guitarre, die er spielte.“ In hellen Haufen drängten sie sich in dem kleinen Haus und auf den engen Stiegen und in den kleinen Zimmern, rannten über die Höfe[S. 311] und die grünen Grasplätze und erfüllten alles umher mit ihrem Geschwätz. Daß man nicht einmal hier ein stilles Stündchen verbringen konnte! Wie drang hier die alte Zeit auf mich ein, da vor hundert Jahren noch Philadelphia und Boston, die größten Städte der Unionstaaten, kaum ein paar Tausend Einwohner zählten! Wenn Washington heute die Millionen Menschen und die Wolkenkratzer und Chikago, das damals noch ein Sumpf war, und den fernen Westen sähe, an den vor hundert Jahren noch niemand dachte! — — —
Aber die Dampfsirene des Schiffes ertönte und mahnte zur Rückkehr. Und nun mußte man dieses stille alte Landgut mit seinen Erinnerungen wieder allein lassen und konnte nicht mehr unter den alten Bäumen sitzen und auf die breite Wasserfläche des Potomac hinunterschauen, wo von ferne die weiße Säule des Obelisk aufragt und die adlige Kuppel des Kapitols, die beide diesen Mann von Mount Vernon ehren. Inzwischen schnatterten die Damen aus Philadelphia wieder durcheinander, Deutsch-Amerikanerinnen anscheinend mit den Fehlern beider Nationen behaftet, ohne ihre guten Seiten zu besitzen, in einem fürchterlichen Sprachmischmasch: „Wollen Sie nicht hier sitzen, Miß Fuchs, ich habe für Sie einen Chair mitgebracht oder sit down right here ... schade, daß es regnen will, wo haben Sie denn Ihre umbrella gelassen? ... Wo ist Mrs. Arnold, perhaps she is looking for you ... Großartige Rosenstöcke, did you see them? Oh, ich bin so sorry, ich war nicht in der ‚kitchen‘, it makes me mad. Ich habe auch nicht gesehen, wo Mrs. Washington died ... Sehen Sie, hier habe ich einen spoon von dem Holz der Bäume, die er selbst gepflanzt hat, gekauft; sie sell es nirgends anders ... They have the copyright ... Und ich habe hier einen Teller gekauft für parties ... Und ich habe für meinen boy ein Bild, because er ist so interested in it ...“ In diesem Sprachstil ging es fort ...
Es ist schade, daß man ein Glück selten rein genießen darf. Während wir mit dem Dampfboot den Potomac wieder aufwärts fuhren und ich so gern den geschichtlichen Erinnerungen noch nachgehangen hätte, und der Abend langsam über Land und Wasser herabsank, wie damals[S. 312] als ich am letzten Abend auf deutschem Boden von Blankenese nach Hamburg zurückfuhr, schnatterten mir immerzu diese „philadelphischen“ Damen mit ihrem Deutsch-Amerikanisch dazwischen. Immerhin eine Vorbereitung auf Philadelphia, das ich morgen betreten wollte.
Noch einmal schritt ich den Abend durch die fürstlichen und adligen Straßen der Bundeshauptstadt. Eine gemessene Vornehmheit des höheren Beamtentums bewegte sich durch die Hauptstraßen, merklich anders als in Los Angeles und San Franzisko, aber auch anders als in Neuyork und Chikago, am ähnlichsten noch Boston.
[36] Indianisch.
Es gibt keine Stadt in der Union, die sich mit Washington an Stattlichkeit vergleichen könnte. Seine marmornen Institute und sein Kapitol sah ich noch lange vor Augen.
Es kam der vorletzte Tag meiner Rundfahrt, der mich wieder bis Neuyork zurückbringen sollte. In zwei schnellen Stunden — wie kurz waren hier im Osten die Entfernungen! — ging es durch das wohlangebaute Maryland nach dem großen von Schloten und Überseedampfern mächtig rauchenden Baltimore. Baltimore ist nächst Neuyork der größte Überseehafen der Union.


Die Millionenstädte des Ostens liegen alle an breiten, tiefeinschneidenden Buchten, in die große Ströme einmünden. Die nördlichste Boston an der kreisrunden Massachusettsbai, in die breit der Charles River strömt, England am nächsten gelegen, daher von den Puritanern auch zuerst erreicht. Es folgt Neuyork an der Mündung des breiten Hudson auf der einst unangreifbareren, langgestreckten Halbinsel Manhattan am inneren Rand der prachtvollen „upper bay“, die in den narrows einen engen, leicht verschließbaren Ausgang nach dem Ozean hat. Dann kommt die früher, ehe Neuyork so fabelhaft anwuchs, größte und bedeutendste Stadt der Union Philadelphia, heute noch immer ihre drittgrößte Stadt, an dem breiten Delawarefluß, der sich in die Delawarebucht ergießt. Philadelphia ist von dem sehr viel jüngeren Chikago, der Hauptstadt des mittleren Westens, schnell überholt worden.[S. 313] Einst war Philadelphia mit Boston die geistige Führerin der Union. Boston als Sitz der Puritaner, Philadelphia als Sitz der Quäker und vieler Deutschen in dem ersten Hauptabschnitt ihrer Einwanderung. Dem Quäkertum verdankt die Stadt auch ihren schönen Namen: „Stadt der Bruderliebe“. Es folgt an der Küstenlinie Baltimore, groß, rauchig und an Seeverkehr ein amerikanisches Liverpool oder Hamburg, an der breiten, fast an 300 km tief ins Land nordwärts einschneidenden Chesapeakbai, in die der breite Susquehanna River mündet. (Nebenbeigesagt sind in den Flußnamen besonders viele indianische Bezeichnungen erhalten: Susquehanna, Potomac, Monongahela, Shenandoah usw.) Die jüngste Gründung war Washington, eine reine Beamten- und Verwaltungsstadt am breiten Potomac, der auch in die Chesapeakbai fließt. Also fünf riesige Städte wie an eine Schnur aufgereiht in einem Gesamtabstand von Washington bis Neuyork von etwas über 350 km, für die Union eine kleine Entfernung.
Da ich im Grunde meiner Seele die Großstädte hasse — und ihrer soviele in der Union nur deshalb aufgesucht habe, weil in ihnen das eigentliche amerikanische Leben pulsiert — so versagte ich es mir entgegen meinem Reiseprogramm nach kaum anderthalb Stunden Fahrt von Washington aus, in Baltimore — es wäre mein zwölfter Großstadtbesuch gewesen — schon wieder auszusteigen. Ich war es nun vier Wochen gewohnt, mindestens einen vollen Tag und eine Nacht oder gleich zwei bis drei von ihnen hintereinander durchzufahren, daß es mich ordentlich verwunderte, daß ich „schon“ um Mittag vor der City Hall mitten in Philadelphia stand! Im Osten schrumpfen eben die Entfernungen schnell zusammen, wenn man aus dem Westen kommt und nehmen einigermaßen wieder europäische und menschliche Maße an. So ließ ich mir also am Blick von der Eisenbahn auf die rauchende Hafenstadt Baltimore genügen und dampfte weiter. Baltimore hat gleich Washington — darin kennzeichnet sich seine südlichere Lage — nicht bloß sehr viel Farbige — über ein Zehntel seiner Bevölkerung! — sondern auch besonders viele Katholiken, denn es geht ja auf die Gründung des katholischen Lords gleichen Namens zurück[S. 314] und war eine Zufluchtsstätte verfolgter englischer Katholiken. So ist hier auch der Sitz des amerikanischen Erzbischofs und Kardinals, einer Person, die sich eigentümlich mit ihrem mittelalterlichen Ursprung in dem übermodernen amerikanischen Leben ausnimmt. Aber gerade in den jüngsten Zeiten der Einwanderung aus Süd- und Osteuropa hat das katholische Element sehr zugenommen.
Die Stadt Baltimore wurde schon 1729 gegründet. Sie ist eine der Veteranen in der Union. Heute ist sie Hauptsitz der Austernkonserven-, der Stahl-, Segeltuch- und Backsteinindustrie, dazu Hauptausfuhrhafen für Getreide. Baltimores Washingtonmonument und seine City Hallkuppel grüßten mich. Die bekannte Universität Baltimores „John Hopkins“ hätte ich gern zum Vergleich mit Harvard aufgesucht, aber es fehlte die Zeit. Wie die großen Städte, so liegen auch die großen geistig führenden Universitäten fast alle wie auf eine Schnur gereiht an der Küste des Atlantischen Ozeans: Harvard bei Boston, Yale in Newhaven (s. S. 70), Kolumbia in Neuyork, Princeton bei Philadelphia, deren Rektor eine Zeitlang niemand anders als Woodrow Wilson war (!), und John Hopkins in Baltimore, Stiftung eines reichen gleichnamigen Handelsherrn.
Währenddem waren wir schon über den mächtig breiten Susquehanna River gesetzt, Philadelphia entgegen. Die rauchige riesige Hafenstadt mit ihrem Wald von Masten und Schloten der Ozeandampfer hatte wieder saftigen Wiesen mit weidenden Viehherden, Wäldern und kleinen idyllischen Bachtälern Platz gemacht. Überall sah man sehr wohlangebautes und wohlgepflegtes Farmland, dem man es ordentlich anmerkte, daß es schon Jahrhunderte alt war. Pennsylvanien ist noch heute einer der bestbesiedelten und bestangebauten Staaten. Fast an norddeutsches Tiefland erinnerten seine gefälligen roten Backsteinbauten mit ihren grünen Fensterläden, die noch in der „Stadt der Bruderliebe“ weit verbreitet und heimisch sind, so daß man in Philadelphia wie etwa heute noch bei uns in Bremen zumeist im eigenen kleinen Heim wohnt statt in riesigen Mietskasernen wie auf dem engbeschränkten Raum Neuyorks. Philadelphia hat sich damit[S. 315] mit Recht den ehrenden Namen einer „City of homesteads“ (Stadt der Heimstätten) erworben!
An Wilmington ging es vorüber, der größten Stadt in dem kleinen Staat Delaware, was allerdings nicht viel sagen will. In Delaware besteht übrigens aus früheren Zeiten allein noch die öffentliche Prügelstrafe! Sie könnte auch für manche Roheitsdelikte in der alten Welt noch bestehen! In dieser Gegend, die wir jetzt durchfuhren, landeten zur Zeit des 30jährigen Krieges schwedische Kolonisten und gründeten ihre erste europäische Niederlassung am Delawarefluß. Noch heute steht davon als Wahrzeichen eine kleine, Ende des 17. Jahrhunderts erbaute Schwedenkirche! Weiter ist es hier die Gegend, wo Washington den Delaware im Kampf gegen die Engländer überschritt. Hier war es auch, wo sich die geduldigen, friedliebenden Quäker unter William Penn schon 1682 festsetzten und vertragsmäßig — nicht wie sonst mit Gewalt und Krieg — den Indianern das Land mit Verträgen abkauften, die einzig hier in der Welt nicht gebrochen wurden, ohne beschworen zu sein! Bekanntlich verwerfen die Quäker noch heute den Eid.
Allmählich mehrte sich wieder der Rauch. Alle Anzeichen einer nahen großen Stadt meldeten sich. Über einem riesigen Häusermeer erschien bald der 155 m hohe Turm der City Hall von Philadelphia, lange auch eines der höchsten Bauwerke der Welt. Punkt zwölf stand ich am Ende der 19 Meilen langen „Broad Street“, die mit dem Broadway in Neuyork eifert, an seinem Fuße. Wieder umbrandete mich der typische amerikanische Großstadtverkehr! Es war wieder nicht viel Unterschied, ob man auf der State Street in Chikago oder dem Broadway in Neuyork oder der Broad Street in Philadelphia stand. Freilich am wildesten ist die Tonart des Verkehrs in Neuyork, am sanftesten für die Größe der Stadt noch in Philadelphia; Chikago hält etwa die Mitte. So steht es auch mit den Wolkenkratzern. Neuyork hat weitaus die meisten und höchsten, in Philadelphia sind es im ganzen nur wenige und mäßighohe, die Stadt hat ja nach allen Seiten Ausdehnungsmöglichkeiten genug und hat von ihnen Gebrauch gemacht.[S. 316] Der weißlockige perückentragende William Penn hat sie einst rechtwinklig angelegt wie alle amerikanischen Städte, indem er das riesige Straßenkreuz der Broad und Market Street anlegte, in dessen Mitte genau die City Hall mit ihrem riesigen Turm steht, so daß er gebietend gleichsam über die ganze Stadt sieht. Aber fast kaum glaublich ist, daß noch zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges die heutige Zweimillionenstadt nur etwa 12 000 Einwohner zählte, und geradezu rührend wirkt das alte kleine State House, dessen Backsteine man im Fairmountpark wieder aufgebaut hat, das älteste Backsteinhäuschen des ganzen Landes von wenig Quadratmetern Umfang!
Ich fuhr zum Turm der City Hall hinauf und hatte von oben wie vom Obelisk in Washington wieder eine märchenhafte Aussicht über die ganze Stadt und ihre Umgebung. Man stand hier oben dem Menschengewimmel und Geschäftsgetriebe fast so entrückt wie auf dem Metropolitan Tower in Neuyork. Weit sah man zum grünen und hügeligen Fairmountpark, dem Stolz Philadelphias, hinüber und auf der andern Seite zu dem meerarmartigen breiten Delaware. Mitten durch das Riesenschachbrett der Stadt windet sich außerdem noch der weit schmälere Schuylkill-River, der in den Delaware unterhalb der Stadt fließt.
Dann trieb es mich vor allem zu den historischen Stätten, die einem anwehen wie etwa die Faneuil Hall in Boston, z. B. zur „Independence Hall“. Am 5. September 1774 versammelte sich hier in Philadelphia als der damals durchaus geistigführenden Stadt der erste Kongreß, der hier am 4. Juli 1776 die berühmte Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von England erließ, noch heute die Magna Charta der Union. Und noch immer ist der „fourth of July“ der größte nationale Feiertag, an dem die Begeisterung für das Banner „der Sterne und Streifen“ auch in Philadelphia keine Grenzen kennt. Freilich fiel damals vorübergehend die Stadt noch einmal in die Hände der Engländer, aber als sie wieder erobert war, tagte hier der Kongreß bis 1797. Dazu war sie zugleich der Sitz des ersten Präsidenten. In der „Halle der Unabhängigkeit“ wird noch heute als[S. 317] Hauptheiligtum der bescheidene Sitzungssaal mit den alten Möbeln und dem Tisch gezeigt, auf dem die denkwürdige Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde. Jene Männer vor 150 Jahren konnten freilich nicht im entferntesten ahnen, welche beispiellose Entwicklung diesem Lande bevorstehen sollte. Auch die Glocke, die zuerst nach der Unabhängigkeitserklärung als Zeichen der errungenen Freiheit geläutet wurde, die sogenannte „Liberty bell“, ist noch vorhanden. Zwar hat sie Mitte des vorigen Jahrhunderts einen Sprung bekommen und wird seitdem nicht mehr benutzt. Aber ihr ehrwürdiges Dasein genügt. Im oberen Stock sind Erinnerungen an die Hauptgröße Philadelphias, den Gründer der Stadt, den Quäker William Penn, dazu ein Stück der Ulme, unter der er den denkwürdigen Vertrag mit den Indianern — ein Vorgang, der so oft gemalt wurde — abschloß. Endlich redet in Philadelphia zu dem Besucher noch eine dritte Berühmtheit, Benjamin Franklin, der den Blitzableiter hier erfand (1752). Stattlich sitzt er vor dem Hauptpostamt, während Penn seinen Ehrenplatz hoch auf dem Turm der City Hall gefunden hat.
Zum Fairmountpark kam ich leider nicht hinüber, auch nicht zur Kathedrale „Peter und Paul“ des römischen Kardinals, noch zu dem Waisenhaus „Girard College“, zu dem Geistlichen — wohl einzig in seiner Art in der Welt — der Zutritt ausdrücklich verboten ist! Einen Blick warf ich in die Universität, weil ich einen ihrer Lehrer, den bekannten babylonischen Ausgrabungsforscher Prof. Hilprecht schon in meiner Jugend in Deutschland einmal hatte sprechen hören. Dicht bei Philadelphia liegt auch die von Deutschen einst gegründete Vorstadt „Germantown“, wo sich schon 1683 niederrheinische aus der Heimat vertriebene Mennoniten niedergelassen hatten. Germantown war die allererste deutsche Siedlung in Amerika überhaupt! Von hier ging auch schon 1688 der erste Protest gegen die Sklaverei aus, freilich wirkungslos für noch fast zwei Jahrhunderte! So war das pennsylvanische Deutschtum das alteingesessenste! Mein Magen fing bei all dem „Besichtigen“ einmal wieder an zu knurren und erhob einen nicht ganz erfolglosen Protest gegen weitere Stadtdurchstreifungen.
[S. 318]
Ich fuhr gen Neuyork zurück. Erst ein Stück am Delaware hin. Bei Trenton setzten wir über den mächtigen Fluß. Die letzten Berge zur Linken entschwanden. In den Staat Neujersey gelangt, näherten wir uns bald der weiten blauen, fast heimisch wirkenden Newarkbai, deren Hauptstadt Newark, obwohl an 300 000-400 000 Einwohner zählend, doch ganz im Schatten Neuyorks steht und daher nichts bedeutet, ja wohl noch nicht einmal dem Namen nach in der Welt bekannt ist! Dann ging’s ein Stück an der blauen, herrlichen upper bay entlang, und die Wolkenkratzer tauchten auf! ... Wie sie jetzt auf mich wirkten, wie alte gute Bekannte! Mit durchaus heimatlichen Gefühlen langte ich wieder in Neuyork an. Mir war es, als wäre ich erst gestern von dort weggefahren, obwohl die mannigfachsten Erlebnisse von nicht weniger als von acht Monaten dazwischen lagen!
Da ich nun einmal wieder in Neuyork war, so faßte ich schnell den Entschluß, ehe ich wieder Onkel und Tante in der 137. Straße guten Tag sagte und mit dem subway hinausraste und ihnen vom Felsengebirge und dem Stillen Ozean erzählte, schnell noch einen Besuch in Westhoboken in der Palisade Avenue zu machen, die aufzufinden ich einst vor acht Monaten jene weite Irrfahrt ins grüne Land hinaus bis nach Englewood gemacht hatte! Pochenden Herzens sprang ich wie ein gewisser Goethe in Sesenheim durch die niedrige Gartenpforte nach der Haustür. Aber sie war und blieb diesmal festverschlossen! Ich hätte so gern meinen ersten Bericht von Indianern und Mormonen, dem Niagara und dem Grand Cañon der kleinen Badenserin vorgetragen und in der Küche wieder einmal bei ihr geplaudert, während sie dem Onkel das Essen rüstete. Aber es war und blieb das Gartenpförtlein verschlossen ... Wie schmerzlich! Gerade für diesen Abend hatte der ängstliche und vorsichtige Onkel sein Nichtchen einmal mit in die Oper nach Neuyork genommen, wie ich später erfuhr ... Wir sahen uns nur noch einmal im Leben, aber nicht in Hoboken ...
Bei Onkel und Tante tat ich in aller Unschuld so, als käme ich geradewegs vom Bahnhof der Pennsylvaniaeisenbahn! So oder ähnlich machen es ja wohl alle jugendlichen Neffen in ähnlichen Fällen. Es[S. 319] wurde Abend, der rasende und donnernde subway hatte mich wieder in die 137. Straße hinausgebracht. So war ich wieder „daheim“!
Ich brauchte diesen Abend in keine „upper berth“, in die ich so oft geklettert war, zu kriechen und mich halb liegend auszuziehen, noch wähnte ich in Traum und Schlaf mit dem Bett auf dem schwankenden Boden hin und her zu fahren wie auf dem erdbebendurchrüttelten Pflaster San Franziskos, noch hatte ich es nötig, mich im Dunkel der Mitternacht einem wildfremden Mann für ein Nachtlogis anzuvertrauen wie in Santa Fé und vorsorglich die Tür zu verbarrikadieren. Keine Fahrpläne und Hotelpreise ängstigten mich mehr, keine Reisepeitsche, alles Wichtigste auf die rascheste und billigste Weise mitzunehmen, wurde über meinem Haupt mehr geschwungen. Ich hatte mein Werk getan. Neuyork kannte ich gut; es brachte mich also auf keine Stunde früher aus dem Bett am anderen Morgen als notwendig. Am Abend aber gab es noch ein Erzählen ohne Ende ... Ich war doch weiter in den wenigen Wochen herumgekommen als alle meine amerikanischen Verwandten zusammen in den 40 Jahren ihres Dortseins!
Andern Tags war Sonntag. Ich fühlte so etwas wie ein Bedürfnis, eine deutsche Kirche — die es ja in dem stockenglischen Boston nicht gab — aufzusuchen und ein stilles „Nun danket alle Gott“ für mich allein zu singen. Denn es war wirklich ganz wider alle Wahrscheinlichkeitsrechnung gewesen, daß ich auf amerikanischen Bahnen gegen 12 000 km gefahren war, ohne einen einzigen Unfall zu erleben. Ich hatte viel gesehen, mehr wie in vielen Jahren meines Lebens. Ich war mehr Eisenbahn gefahren als vielleicht bisher und später in meinem ganzen Leben. Aber gleich dieselbe ganze Fahrt noch einmal zu machen, hätte ich doch nicht für 1000 Taler getan.
In der deutschen Kirche, die ich aufsuchte, amtierte — ein schönes Zusammentreffen — ein in Deutschland geborener Pastor, der auf derselben Universität wie ich studiert hatte, ja derselben Studentenverbindung angehörte wie ich einst. So wurde es ein besonders traulicher Abschied aus der Weltstadt Neuyork. Werde ich sie im Leben[S. 320] noch einmal wiedersehen, die Dollarburgen und die blaue upper bay, die Freiheitsstatue und die Brooklynbrücke? — —
Ich fuhr wieder nach Boston. Ich wollte nicht meine Gänge durch das Dollarbabel von vorne beginnen und der lieben alten Tante auch nicht noch einmal länger zur Last fallen. Wie bekannt kam mir jetzt die Strecke über Newhaven, am blauen Long-Island-Sund hin vor! Überall blühte es jetzt in Connecticut, dem „Kastanienstaat“. Wie oft hatte ich auf meiner weiten Reise schon den Frühling erlebt und war immer wieder in den Winter zurückgeschleudert worden! In Kalifornien war es schon fast Sommer; auf der Sierra Nevada, in Kolorado und Chikago schneite es! Hinter Pittsburgh jenseits der Alleghenies war der Frühling um Washington gerade mächtig im Kommen, und hier zwischen Neuyork und Boston setzte er gerade erst langsam ein, während in Arizona und Nevada die Sonne schon wie im heißesten Sommer gebrannt hatte und in Santa Fé sich gar schon heftige sommerliche Gewitter entluden. Es kam einem dieser ständige Wechsel wie ein einziger Traum vor ...
Am Abend in der Dämmerung lief unser sehr leerer Zug in Boston ein. Ich gottloser Mensch hatte es gewagt, am heiligen Sonntag auf der Eisenbahn heimzukehren! An einem Sonntag abend war ich vor Wochen klopfenden Herzens abgefahren, ungewiß einem Kontinent mit seinen unermeßlichen Entfernungen entgegen, ein über meterlanges Reisebillett in der Tasche. Wohlbehalten und mit wohlgefülltem Geist — freilich auch wohlgeleerter Tasche — kehrte ich „heim“, denn auch Boston und erst recht mein Harvard- = „furnished room“ kamen mir jetzt wie traute Heimat vor. Wie mußte ich meinem japanischen Freund Mr. Ashida danken, der mir, so oft ich vorher wieder schwankend werden wollte, stets zugeredet hatte, die Fahrt auf jeden Fall zu unternehmen. Wie ein Traum war mir jetzt das Ganze, als ich wieder unter Harvards Ulmen hinschritt, daß ich in den vorweltlichen Schlund des Grand Cañon geschaut, über den Salzsee gefahren, auf Santa Catalina im Stillen Ozean gelegen und versucht hatte, den Pikes Peak, den amerikanischen Montblanc, zu besteigen! Noch[S. 321] manchmal glaubte ich im Bett liegend zu fahren — und saß doch still hinter den Büchern. Noch manchmal glaubte ich den Bädeker für morgen genau studieren zu müssen — und hörte derweilen Professor Josiah Royces schwere philosophischen Gedanken des englisch-amerikanischen Hegelianismus ...
Meines Bleibens war aber in Harvard nun auch nicht mehr sehr lange. Seit ich den Paß in den Koloradobergen von der Wasserscheide herabgefahren war, wo der Arkansas die Richtung zum Atlantischen Ozean weist, hatte ganz leise der Zug zur Heimat zu arbeiten begonnen. Nur noch einen reichlichen Monat hielt ich es drüben aus, dann schloß ich, einen wohlerworbenen amerikanischen „degree“, den ich mir mit nicht leichten Prüfungen ehrlich verdient hatte, in der Tasche, die Koffer zur Heimfahrt. Ich wartete den Semesterschluß der Universität gar nicht erst voll ab, sondern beschloß meine Studien zum Erstaunen der Herren Professoren, die drüben solch akademische Freiheit gar nicht gewöhnt sind, schon vier Wochen vor der der übrigen Studenten. Ich hatte ja in Deutschland längst ausstudiert. Und alles Arbeiten auf amerikanischem Boden war für mich nur „überflüssig gutes Werk“.
So kamen die Abschiedsbesuche bei all den wohlwollenden Herren und sonstigen lieben Menschen, die sich meiner so freundschaftlich angenommen hatten. Ich bin ihnen allen noch heute sehr verbunden und verpflichtet. Dann fiel der Deckel auf den großen graugrünen Hochzeitskoffer meiner Eltern mit den Büchern und all den vielen Siebensachen, die sich nun noch reichlich vermehrt hatten, zur Fahrt durch Kanada heimwärts. Ob er wohlbehalten mit mir die Heimat erreichte? Ich hoffte es.
Kanada ist ein ganz riesiges Land, noch viel riesiger als die amerikanische Union! Es ist wenig kleiner als ganz Europa einschließlich Rußland! Ich hatte natürlich nicht vor, etwa auch noch[S. 322] dies Land seiner ganzen Breite nach zu durchfahren, seine unermeßlichen Prärien und unerschöpflichen Wälder zu erforschen, die die Bevölkerung trotz der ungeheuren Landfläche auf ein Zehntel der der Union beschränken. Dazu fehlte völlig die Zeit. Mir sollte es genügen, wenigstens einen Blick in das Land hineinzuwerfen und einen Abschiedshauch von ihm mitzunehmen.
Kaum eine namhafte Großstadt gibt es auf kanadischem Boden. Ein äußerst kalter und rauher Winter läßt das Land monatelang erstarren, obwohl seine Südgrenze etwa in der Höhe von Mailand läuft! Gar tief schneidet die Hudsonbai, die das ganze Jahr mit Treibeis (!) gefüllt ist, in das Land ein. Eisig sind die Stürme, die von Grönland und dem Eismeer herein und von hier bis in die obere Mississippiebene hinabbrausen. Es war mir möglich, den einzig wichtigen Osten zu durchfahren, wo vor England einst Frankreich Fuß faßte, das zu Zeiten von Neuorleans über Saint Louis bis Quebec gebot! Welch eine Koloniallinie! Im Siebenjährigen Krieg verlor ja Frankreich dank der Siege Friedrichs des Großen ganz Kanada, dessen Wert damals niemand ahnte, an England, und das Mississippital verkaufte Napoleon I. an die Union, auch seine Bedeutung nicht für möglich haltend, für ein Butterbrot! (15 Millionen Dollars). Von Ostkanada, Montreal und Quebec, wollte ich den mächtigen Lorenzstrom hinunter über den nördlichen Atlantischen Ozean nach Schottland hinüberfahren und noch England durchstreifen. Das waren wieder neue Erlebnisse! Der Plan, gar über Japan heimzukehren, war für mich leider unausführbar; so hielt ich mich dafür an den kanadischen Weg, sintemal die Route Kanada-Schottland die kürzeste Überfahrt auf offener See bietet!
So ging es durch Massachusetts, das liebliche Neuhampshire und Vermont gen Quebec. Ich sagte dem Charles River Lebewohl, der golden leuchtenden, so oft geschauten Kuppel des State House auf dem Boston Common, dem schönen Renaissanceturm der New old South, auch all den vertrauten Collegegebäuden von Harvard, in denen ich so oft ein- und ausgegangen war.
[S. 323]
Wir hielten in der rauchenden über 100 000 Einwohner zählenden Fabrikstadt Lowell. Ein Mönch in brauner Kutte stieg ein. Wie sich das in Amerika ausnimmt zwischen all den rasierten gentlemen! Er wollte offenbar nach dem katholischen Kanada reisen! Auch schon in Lowell gibt es genug französisch redende kanadische Arbeiter, die in den nördlichen Industrien der Union Verdienst suchen.
Dann kam rings schöne grüne Heide, je weiter wir nach Neuhampshire hineinfuhren. Flüsse, Seen und sanftgewellte Hügel bestimmten den Charakter der Landschaft. Alles alte Indianergründe! Davon zeugen noch heute die Namen der Flüsse, Seen und Berge, wie z. B. der Name des äußerst lieblichen, an den mittelenglischen Seendistrikt erinnernde Lake Winnipesaukee. Birkenbepflanzte Fahrwege säumen ihn, kleine Dampfer eilen über seine spiegelglatte Fläche. Waldige Mittelgebirge überhöhen ihn rings sanft ansteigend. Unverwandt schaute ich wieder hinaus in diese liebliche einsame Landschaft. Wieviel Raum und Platz ist hier noch für wanderlustige und siedlungsbereite Menschen! Der Zeitungsboy wanderte indessen wie immer durch den Bahnwagen und bot Ansichtskarten und Albums aus. Auch er hatte schon einen etwas fremdartigen Akzent ...
Die Stationsnamen hatten oft puritanisch-biblischen Klang: „Bethel, Kanaan, Lebanon“, wie man auch heute noch viel biblisch-alttestamentliche Vornamen unter den Amerikanern und Engländern findet: Abraham Lincoln, David Jefferson, Isaak Newton, Jonathan Eduards, Josiah Royce usw. — und waren doch alle beileibe keine Juden! Die Bahnhöfchen wurden immer unansehnlicher, je weiter wir nordwärts kamen.
Den See Winnipesaukee samt den malerischen White-Mountains ließen wir zur Rechten und fuhren nach dem Staat Vermont hinüber und dann den langen, vielverzweigten und vielbesuchten „Lake Champlain“ entlang. Er ist über 150 km lang, d. h. also mehr als doppelt so lang als unser Bodensee, wenn auch nicht von seiner Breite. Ein Kanal verbindet ihn mit dem Hudsonfluß. Immer aufs neue werden alle unsere deutschen Maßvorstellungen über den Haufen[S. 324] geworfen. Und dabei zählt dieser See samt dem Salt Lake in Utah durchaus zu den „kleinen“ Seen. Es war äußerst erfrischend und erquickend an ihm entlang zu fahren. Wir hatten eben einen 300 m hohen Paß mit der Bahn überschritten und senkten uns nun in seine liebliche Niederung. Auch an Joseph Smiths, des Mormonenpropheten Heimat, Dorf Sharon, eilten wir vorüber. Also in dieser träumerisch-idyllischen Landschaft hat der Prophet seine ersten seelischen Eindrücke empfangen! Sie ist freilich der denkbar größte Gegensatz zu den Einöden und Steppen um den Salzsee.
Je weiter wir an dem Lake Champlain nordwärts kamen, desto ebener und flacher wurde das Land wieder. Die freundlichen Berge Vermonts blieben zurück. Vor St. John erreichten wir die Grenze der Union und fuhren nun nach Kanada hinein. Es war für mich nicht das erstemal, daß ich englischen Boden berührte. Schon vom Niagara bis Detroit hatte ich das südlichste kanadische Gebiet durchfahren. Der Lake Champlain fließt ab im „Richelieu River“, der so breit ist wie ein Meeresarm. Schon der Name belehrte mich, daß sich hier eine alte geschichtliche Welt auftat, die noch heute neben 100 000 Indianern über eine Million französisch redende Kanadier bewohnen. Dünn ist das Land besiedelt. Ungeheure Ebenen bis an den Horizont taten sich auf, die an Weite und Unfaßlichkeit noch die Ebenen des Mississippi übertreffen! Auf weiten grünen Weiden tummelten sich Pferde und Rindvieh. Von Zollrevision merkte ich nichts. Freut sich etwa The Dominion of Canada über jeden Menschen und jedes Stück Ware, was in sein ungeheuer aufnahmefähiges Land hineinkommt? Oder spart man Beamte? Die Bauart der Häuser zeigte hier einen anderen Stil als in der Union. Es sind im östlichen Kanada meist Steinhäuser mit flachem oder französischem Doppeldach. Verschwunden sind die typischen amerikanischen hölzernen Farmhäuser. Auch die meisten Stationsnamen sind jetzt französisch, z. B. „Brosseau“!
Es dunkelte. Über den ungeheuren Grassteppen war westwärts die Sonne versunken. Von einer Reihe abendlich beleuchteter Hügel[S. 325] blitzten Lichter auf. Wir näherten uns den Ufern des St. Lorenzstromes, der kaum noch ein Strom zu nennen ist, der als der breite Abfluß des Ontariosees, einer der großen, ostseeähnlichen Seen, wie der Niagarafluß der Abfluß des Eriesees seeartig daherströmt. Er ist fast so lang wie die Wolga und schon 400 km vor der Mündung 20 km breit!
Einen ganzen Tag war ich wieder gefahren, als wir endlich zwischen neun und zehn Uhr abends in Montreal (frz.: „Königsberg“, aber hier meist englisch ausgesprochen: „montrioll“) eintrafen. Auf mächtiger Brücke setzen wir über den St. Lorenz, der hier so breit wie die Unterelbe ist. Montreal liegt auf einem unmittelbar am Fluß hoch ansteigenden Berg. Daher trägt es auch seinen Namen zu Recht. Es übertrifft an Alter, wenn auch keineswegs an Größe und Bedeutung, die meisten seiner viel jüngeren amerikanischen Schwesterstädte. 1608 wurden schon die ersten französischen Niederlassungen am St. Lorenzstrom gegründet! Heute zählt Montreal über 200 000 Einwohner. Es besitzt eine alte prächtige Kathedrale in französischer Gotik. Im Winter stauen sich die mächtigsten Eisschollen zu Bergen am Flußkai vor ihr. — Ich war der letzte, der aufs Schiff kam, das am Landungssteg schon ein geraumes Stück stadtabwärts abfahrtbereit lag. Ich nahm mir im Dunkeln eine Droschke. Wie hätte ich sonst im Dunkeln, eben erst in Kanada eingetroffen, nachts zehn Uhr durch die bergig gelegene Stadt das Schiff finden sollen? Mit der Straßenbahn, auf der viele Fahrgäste französisch wie in Straßburg sprachen, war ich nicht recht vorwärts gekommen. Ich mußte im Oberstübchen erst tüchtig umräumen und umschalten, bis ich nach dem vielen Englisch die richtigen französischen Worte fand! Gegen elf Uhr betrat ich das Deck, von den Passagieren neugierig angestaunt, und verstaute mich selbst auf dem „Royal-mail-twin-screw-steamer Jonian“, wie er offiziell hieß!
Der Dampfer selbst kam mir in seinen Ausmaßen recht klein vor, als ich ihn betrat, im Vergleich mit den Ozeanriesen, die man aus den Docks in Neuyork gewöhnt war. Aber solcher Riesen brauchte[S. 326] es ja auch zwischen Kanada und Schottland nicht. Er hatte immer noch 8000 Registertonnen und gehörte der englischen Allan-Linie. Angenehm war es, daß er nur II. Klasse führte, so daß einem auch als Menschen „zweiter Klasse“ und von minderem Geldbeutel doch einmal das ganze Schiff mit allen Decks und Salons bis hinauf aufs Oberdeck zur Verfügung stand; ferner war angenehm, daß im ganzen nur etwa 150 Passagiere mitfuhren. Es waren diesmal ein gut Teil Missionare darunter, die zu einer großen Missionskonferenz nach Schottland wollten. Die Besatzung aber betrug dennoch allein 180 Mann! Die wenigen Passagiere machten aber die ganze Fahrt recht familiär.
Müde von den langen Eisenbahnfahrten ging ich bald in meine Kabine, die ich für mich allein hatte. Zum Schlaf sollte es doch noch nicht sobald kommen, denn um Mitternacht begann ein wahrhaft höllisches Gepolter. Die großen Schiffskrane versenkten nämlich sämtliches große Gepäck und sonstige Ladung in die tiefen Laderäume im Bauch des Dampfers. Das gab ein Rasseln der Ketten, ein Drehen der Krane, ein Rufen, Pfeifen, Rollen, Schieben, Fallen ohne Aufhören. Erst etwa gegen drei Uhr nachts hörte es auf. Die Augen fielen mir zu ... Die Ankerketten wurden hochgezogen. Das war englische Rücksichtslosigkeit und Nüchternheit — wir fuhren! Ohne Sang und Klang ging es ab — auch englisch — ohne den ganzen schönen theatralischen Abschied wie in Kuxhaven. Kein Winken, auch kein Weinen! Der Engländer ist nicht so sentimental und melancholisch wie wir.
Als ich morgens erwachte, mir die Augen rieb und durch die Luke hinausschaute, schwammen wir mit unserer „Jonian“ auf einem breiten, schimmernden Strom, den liebliche grüne Ufer und sanft geschwellte Hügel begrenzten, sacht und ohne jede Erschütterung abwärts. So sollte es zweieinhalb Tage fortgehen, bis wir in den offenen Ozean hinauskamen. Ich hätte so bis ans Ende der Welt fahren mögen ... Gegen Vormittag zehn Uhr kamen wir an Quebec, der anderen alten französischen Gründung, vorbei. Quebec war mir zum ersten Male in der Kindheit in einem Gedicht Seumes begegnet,[S. 327] aber wie in völlig nebelhafter Ferne. Jetzt sah ich es wie Montreal auf noch steilerem Berg herrlich und gebietend über dem St. Lorenz thronen als natürliche starke Festung. Festungsmauern und drohende Kasematten säumten die Zitadelle, aber auch riesige Hotels mit gewiß prächtiger Aussicht haben sich den Berg hinangebaut. Quebec erinnerte mich stark an unseren Ehrenbreitstein am Rhein gegenüber Koblenz.
Hinter Quebec wurde der St. Lorenz noch zwei- bis dreimal so breit als bisher. Er weitete sich mehr und mehr und wurde fast wie zu einer tiefeingeschnittenen Bucht. Die in der klaren Luft wie gemalt ausschauenden Berge begleiteten ihn noch lange. Dann und wann passierten wir buschige Inseln mitten im Strom wie am Niederrhein. Nach Stunden begegnete uns auch das schönere und neuere Schwesterschiff, die „Virginian“, die von Schottland kommend und derselben Linie angehörend stattlich den St. Lorenz aufwärts dampfte. Lebhaftes Grüßen und Winken und Tücherschwenken hinüber und herüber — und dann war auch dies „Ereignis“ wieder vorüber! Nach einigen Stunden kam auch noch die „Lake Erie“ von der Dominian-Linie und ein Seedampfer, der der Canadian Pacific-Eisenbahn gehörte. Solche Schiffsbegegnungen sind immer „große“ Ereignisse an Bord und beliebte Ziele für Operngläser und Feldstecher.
Am Rand des Stromes tauchten hier und da kleine weißschimmernde Dörfer auf mit kleinen weißen Kirchtürmen, aber im ganzen doch selten. Sonst machte das weite Gras- und Hügelland links und rechts den Eindruck völliger Unbewohnheit, der uns in Europa — Rußland ausgenommen — so ganz fremd ist! Wir nahmen den Kurs nach der „Belle-Isle-Straße“, dem nördlichsten Ausgang aus dem St. Lorenzstrom, so daß wir das eisige Labrador links und „Neubraunschweig“ rechts ließen.
Als der erste Tag der Fahrt auf dem Lorenzstrom zu Ende ging, wich die Helligkeit abends nur sehr langsam. Es war ja Juni und ging dem hellsten Tag entgegen. Mit jedem Tag aber kamen wir in nördlichere Breiten. Ja es blieben zuletzt breite helle Streifen die[S. 328] ganze Nacht am dunklen Himmel stehen, die uns entweder als Reflexe des Eises im nördlichen Labrador oder als Nordlicht gedeutet wurden! So kriegte man fast ein bißchen Geschmack wie von „Grönland“ und „Nordpol“. Von der Südspitze Grönlands trennten uns nachher ja auch nur noch etwa 600 km, also etwa eine Entfernung wie von Edinburg zur Südküste Englands. Labrador allein ist so groß wie ganz Skandinavien und Spanien zusammen!
Aus einem buntfarbigen Abend tauchte ein strahlender Sonntagmorgen. Ruhig und gelassen glitt unser Schiff wie ein Riesenschwan den viele Kilometer breiten blauen Strom abwärts. Wir waren jetzt in den St. Lorenzgolf eingetreten, der sich in zwei Straßen nördlich und südlich der Neufundlandinseln zum Atlantischen Ozean öffnet. Wie mit dem Messer geschnitten zeichnete sich die Wasserfläche in der völlig staubfreien, herrlich-klaren frühlingshaften salzigen Seebucht vom Horizont ab. Von den aus dem warmen Golfstrom so oft aufsteigenden Nebeln war diesmal nichts zu merken. Rechts glitt eine längliche bergige Insel vorüber. Zum ersten Male begann sich jetzt unser Schiff dank der vom offenen Ozean nun seitlich hereindringenden Wellen ein wenig zu heben und zu senken. Der erste Gruß des offenen Atlantik!
Im Speisesaal fanden heute Sonntags auf dem englischen Dampfer nicht weniger als vier (!) Gottesdienste nacheinander statt, bei denen zumeist die mitreisenden Missionare predigten und aus ihrer Arbeit in Japan, auf den Philippinen und in Indien erzählten. Einer von ihnen, ein französischer Missionar, berichtete in mangelhaftem Englisch von seinen Erlebnissen bei der Fremdenlegion. Ehe sie redeten, wurden sie jedesmal mit Namen und Wirkungskreis vorgestellt! Auf einem mit dem englischen Union Jack umwundenen Pult lag eine große vergoldete Schiffsbibel. Das war die Kanzel. Die Mannschaft nahm, soweit frei, auch an dem „worshipping the Lord“ teil. Ich kann mich nicht entsinnen, daß wir auf dem Hapagdampfer bei der Hinfahrt Sonntags je irgendeine religiöse Veranstaltung gehabt hätten. Sonntags spielte hier auch die Schiffskapelle nicht einmal zu[S. 329] den Mahlzeiten! Kein Spiel, erst recht nicht Karten, wurde auf Deck veranstaltet oder geduldet, auch kein Tanz u. dgl. Rauch- und Biersalon blieben heute unbesucht! Das Klavier wurde nur zu Chorälen geöffnet ...
Eine breit aufgewühlte Wasserfurche ließ unser Schiff hinter sich. Schwärme von Möwen folgten ihm. Der Himmel behielt unverändert seine strahlende Bläue. Wir näherten uns der großen Insel „Anticosti-Island“. Ein Leuchtturm blinkte herüber. Bei Eisgang nehmen die Schiffe gewöhnlich von hier den weiteren südlichen Kurs um Neufundland herum, wir aber behielten den kürzeren nördlichen bei an der Küste von Labrador hin unter Grönland weg!
Montag morgen passierten wir die Nordküste der wegen ihres Nebels so berüchtigten Neufundlandinseln und fuhren in die Straße von Belle-Isle ein. Labrador schien ganz unbewohnt, trotz seiner ungeheuren Größe, bergig, öde. Es zählt wohl kaum 10 000 Einwohner[37]. Es kennt wie Kanada noch große Büffel- und Rinderherden, auch Bären! Als wir den Ausgang der „Belle-isle-Straße“ um Mittag ins offene Meer gewannen, kamen uns — zu unserer Freude — richtige Eisberge auf ihrer Wanderung von Grönland südwärts entgegengeschwommen. Wir machten freilich einen recht respektvollen Bogen um sie. Denn die „ice-bergs“ ragen oft nur wenige Meter über dem Wasserspiegel, aber um so länger sind sie unter ihm! Im ganzen waren es nur vier dieser Burschen, die wir sahen. Uns interessant, von den Seeleuten gefürchtet. Noch steht in furchtbarer Erinnerung der Zusammenstoß der Titanic mit einem dieser unheimlichen Gesellen 1912. Aber malerisch sehen sie aus, wenn sie so blendend weiß im tiefen Blau des Ozeans dahergeschwommen kommen, lautlos und doch so gebieterisch, ein Stück losgelöstes Nordpolland.
Als wir den offenen Ozean gewonnen hatten, zeigte er weiße Kämme bei schwacher Bewegung ... Das interessantere Stück der Fahrt war nun vorüber. Jetzt folgte wieder das erhabene Einerlei[S. 330] des offenen Ozeans ohne Küstenstrich und Abwechslung für die Augen. Freilich ein strahlender Tag löste den anderen ab. Leicht fuhr das Schiff seine Bahn. Das Meer war kaum bewegt. Es war ein wundervolles Dahingleiten in dieser Juniherrlichkeit der See. Ich saß entweder ganz am Bug vorn und schaute in die unendliche Weite, der wir entgegenfuhren, vorwärts das Land Europas „mit der Seele suchend“ oder ganz auf dem Achterdeck rückwärts gewandt allein mit meinen Gedanken über Amerika und sah der breiten quirlenden und schäumenden Furche nach, die unsere Schrauben hinter uns zurückließen. Es war zu prächtig, nichts zu tun als zu schauen und zu sinnen ... Andere, wie die Missionare, unterhielten sich ständig über Missionsfragen, lasen viel in ihren Büchern oder zankten sich auch über kirchliche Dinge. Merkten sie gar nichts von der Missionspredigt, die ihnen täglich der ewige Ozean Gottes hielt? Dafür nannte mich der französische Missionar, der bei der Fremdenlegion gedient hatte, „not sociable“[38]. Meinetwegen! Der beste Sozius in unserem Leben ist doch auch manchmal das eigene sinnende Ich, wenn es sich weitet zu einem Überich und seelische Tiefen aufzubrechen anfangen. Aber mit diesem Ich mögen so wenige allein sein! Sie müssen immer Menschen und „Unterhaltung“ um sich haben, die doch oft so seicht und fade ist ...
An einem der Wochentagabende war wieder nach den vier services des Sonntags — „prayer-meeting“. Es knieten nebeneinander im Salon die bärtigen Schotten und die glattrasierten Kanadier, und einer nach dem anderen begann ein langes freies und doch gepreßtes Gebet. Ich hielt es lieber mit dem: „Wenn du betest, so geh’ in dein Kämmerlein und schließ’ die Tür zu ...“
Am Freitag regnete es einen halben Tag lang, und wir fuhren in feuchtem Nebelgrau. Passierten wir den Golfstrom? Ich benutzte die Stunden, die man in den Salons zubringen mußte, meine Einführungsrede in mein Amt, das ich sofort nach meiner Ankunft in[S. 331] der Heimat antreten sollte, auf dem freien Ozean auszuarbeiten. Hier war Stille dafür. Salzluft des freien Himmels wehte mit hinein. Plötzlich tutete es zum Rettungsappell. Alles mußte in die Boote. Aber glücklicherweise war es nur Probealarm. Schreckhaft, aber interessant!
Sonnabend nachmittags näherten wir uns der schottischen Küste. Kein einziges Schiff war auf diesem nördlichen Kurs uns auf dem offenen Meer begegnet! Nur fünf Tage hatte die Fahrt auf offener See gedauert; zweieinhalb Tage fuhren wir auf dem St. Lorenz!
Vormittags elf Uhr tauchte zuerst frohbewillkommnet die bergige blaue Küste des grünen Irland auf, an dem wir nördlich vorbeifuhren. Wir hatten also das Ziel richtig gefunden. Möwen umflatterten uns begrüßend wieder zu Hunderten.
Ein letztes Konzert an Bord galt, wie üblich, der Mannschaftskasse. An seinem Ende wurde „God save the king“ gesungen! Jeder hatte dabei aufzustehen. Der Speisesalon war reich mit englischen Flaggen dekoriert. Gegen Abend tauchten auch schon die felsigen, unmittelbar aus dem Meer aufsteigenden malerischen Steilküsten Schottlands mit ihren Schlössern und alten Städten auf. Jetzt redete wieder die alte Welt mit tausendjähriger Geschichte zu uns ...
Den letzten Tag wurde unser Schiff noch ganz blank gestrichen. Temperaturmessen, Loten, Flaggenhochziehen war mir als Landratte immer wichtig ... Dann kam ein letzter himmlisch-klarer Abend bei der Durchfahrt durch die felsige Clydebucht, an deren innerem Ende Glasgow liegt. Ihr Eingang wirkt wie ein norwegischer Fjord. Um elf Uhr abends war es in diesen Juninächten Schottlands noch hell genug zum Lesen ...
Als ich Sonntag früh erwachte, lagen wir bereits fest im Dock in Glasgow mitten zwischen Schuppen und Lagerhäusern. Ebenso prosaisch und klanglos wie die Abfahrt in Montreal war die Landung in Glasgow. Ich war auf dem Boden Seiner britischen Majestät!
Kein Empfang, keine Musik!
Ich betrat wieder europäischen Boden ...
[37] Den Namen soll es von „terra laboratorum“, d. h. Land guter Sklavenarbeiter erhalten haben?!
[38] Nicht gesellig.

Druck der Roßberg’schen Buchdruckerei, Leipzig.