
Title: Auf Schneeschuhen durch Grönland. Zweiter Band
Author: Fridtjof Nansen
Translator: M. Mann
Release Date: August 6, 2023 [eBook #71355]
Language: German
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1897 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden, mit Ausnahme norwegischsprachiger Ortsbezeichnungen (‚Österdalen‘, ‚Österbygd‘), sowie dem Umlaut ‚Ü‘ in den Fußnoten, als deren Umschreibungen (Ae, Oe, Ue) dargestellt.
Die Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels verschoben.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden in der vorliegenden Beabeitung kursiv dargestellt. Komplette Abschnitte in Antiqua, wie etwa die Bildunterschriften der Karten, sind hiervon jedoch ausgenommen.
Das Original-Umschlagbild wurde vom Bearbeiter ergänzt und in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden.
Von
Dr. Fridtjof Nansen.
Autorisirte deutsche Uebersetzung von M. Mann.
Zweite Ausgabe.
Mit 159 Abbildungen und 4 Karten.
Zweiter Band.
Hamburg.
Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft
(vormals J. F. Richter).
1897.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei
Actien-Gesellschaft
(vormals J. F. Richter) in Hamburg.
[S. iii]
|
Seite
|
|||
|
Kap. XV.
|
Unser letzter Zeltplatz an der Ostküste. Erste Wanderung
auf dem Inlandseise
|
||
|
XVI.
|
Die Entwickelung unserer Kenntnisse von Grönlands
Inlandseis und die früheren Versuche, in dasselbe einzudringen
|
||
|
XVII.
|
Wir verlassen die Ostküste
|
||
|
XVIII.
|
Wir verändern unsere Route auf Godthaab. Einige
Mittheilungen über Klima und Schneeverhältnisse
|
||
|
XIX.
|
Die Wanderung über das Inlandseis. Ein Sturm
im Innern. Häusliches Leben
|
||
|
XX.
|
Segelfahrt über das Inlandseis. Land! Land! Der
erste Trunk Wasser
|
||
|
XXI.
|
Abwärts bis an den Ameralik-Fjord
|
||
|
XXII.
|
Die Seereise in dem „halben Boot“. Die Ankunft
in Godthaab
|
||
|
XXIII.
|
Die vier Zurückgelassenen im Austmannathal und
deren Erlebnisse
|
||
|
XXIV.
|
Reisebericht des Grönländers Silas
|
||
|
XXV.
|
Unser Aufenthalt in Godthaab
|
||
|
[S. iv]
XXVI.
|
|
||
|
|
A.
|
Einleitung. Die Verbreitung der Eskimos. Ihre
Wanderungen
|
|
|
|
B.
|
Das Aussehen. Die Kleidung. Der Kajakfang.
Die Häuser
|
|
|
|
C.
|
Das bürgerliche Leben in Grönland. Eigenthumsbegriffe.
Geselligkeit. Gastfreundschaft
|
|
|
|
D.
|
Mahlzeiten. Speisen. Genußmittel
|
|
|
|
E.
|
Die Stellung der Frauen. Die Ehe. Die Tugend.
Die Geburt. Die Kinder
|
|
|
|
F.
|
Charakter, Verbrechen, Trommeltanz und Gerichtsverfahren.
Freiheitsgefühl
|
|
|
|
G.
|
Ursprüngliche Religion. Aberglaube. Kunstsinn.
Dichtung. Musik
|
|
|
|
H.
|
Der Einfluß der Civilisation. Die Zukunft der
Grönländer
|
|
|
XXVII.
|
Ein Jagdausflug nach dem Ameralik-Fjord
|
||
|
XXVIII.
|
Die erste Uebungsstunde im Kajakrudern
|
||
|
XXIX.
|
Weihnachten in Godthaab
|
||
|
XXX.
|
Tagebuchaufzeichnungen aus Sardlok und Kangek
|
||
|
XXXI.
|
Abermals auf dem Wege nach dem Inlandseise.
Umiarsuit! Umiarsuit! (Ein Schiff! Ein Schiff!)
Die Heimreise
|
||
|
Anhang.
|
Das wissenschaftliche Ergebniß der Expedition
|
||
[S. 1]
 rüh am Abend, ungefähr um 8 Uhr, landeten wir endlich in dichtem
Nebel bei unserm letzten Zeltplatz an der Ostküste von Grönland. Im
selben Augenblick, als ich den Fuß ans Land setzte, stieg ein Schwarm
Schnepfen auf und ließ sich gleich wieder auf einem Stein ganz in
unserer Nähe nieder. Mit einem Schuß erlegte ich vier dieser leckeren
Vögel; das war ein guter Anfang.
rüh am Abend, ungefähr um 8 Uhr, landeten wir endlich in dichtem
Nebel bei unserm letzten Zeltplatz an der Ostküste von Grönland. Im
selben Augenblick, als ich den Fuß ans Land setzte, stieg ein Schwarm
Schnepfen auf und ließ sich gleich wieder auf einem Stein ganz in
unserer Nähe nieder. Mit einem Schuß erlegte ich vier dieser leckeren
Vögel; das war ein guter Anfang.
Balto war so muthig und obenauf, daß er, kaum an Land gekommen, die große Sünde beging, einen der Pfarrer in Finmarken in einer längeren Messe nachzuahmen, was ihm vorzüglich gelang; er würde es jedoch niemals gethan haben, wenn er seines Lebens nicht ganz sicher gewesen wäre. Heute leistete er sich auch sogar einen kleinen Fluch, was seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen war. Ja, er lieferte Ravna sein neues Testament in lappländischer Sprache zurück, das er von diesem geliehen und für ihn aufbewahrt hatte. Er meinte, jetzt habe er keine Verwendung mehr dafür. Als Sverdrup ihm sagte, er solle seiner Sache nur nicht gar zu sicher sein, es wäre noch mancher harte Strauß zu bestehen, ehe er die Westküste erreichte, wurde er doch ein wenig bedenklich und hielt mit dem Fluchen inne. Wir hatten nach und nach eine gute Uebung im[S. 2] schnellen Löschen unseres Bootes erlangt, niemals aber haben wir schneller gelöscht als an diesem Abend. Es lag ein fröhlicher Eifer in allem, was wir vornahmen, und derselbe wurde noch gesteigert durch mein Versprechen, Kaffee zu kochen.
In meinen Tagebuchaufzeichnungen von diesem Tage heißt es u. a. folgendermaßen: „Während die Boote geleert wurden, machte ich mich ans Kaffeekochen. (Es war die zweite warme Mahlzeit in den zwölf Tagen, die wir an der Ostküste zugebracht hatten.) Der Kaffee und das Abendessen wurden auf den Felsklippen unten bei den Böten in heiterster Stimmung eingenommen, — selbst die Lappen waren vergnügt. Wir hatten das Gefühl, einen Bestimmungsort erreicht und eine Schwierigkeit überwunden zu haben. Freilich stand uns der beschwerlichste Theil der Reise noch bevor, aber da war festerer Grund für unsere Schritte, sicheres Eis für unsere Berechnungen, — keine treibenden Eisschollen, keine Böte, die jeden Augenblick zerschellen konnten. Besonders für die Lappen war das Inlandseis mit seinen Schneefeldern heimischer als das wandelbare Treibeis. Die Landschaft, die uns umgab, würde nicht jedem Auge so schön erschienen sein wie dem unsrigen. Es waren graue Gneisfelsen, auf denen wir saßen, und zu beiden Seiten waren wir von Eisgletschern umgeben, die direkt ins Meer hinausgingen. Der Nebel hatte sich ein wenig verzogen, so daß auch der Berg (Kiatak) wenigstens theilweise sichtbar wurde. Auf dem Wasser schwammen hie und da einige Stücke Gletschereis. Es war eine Mischung von Grau und Weiß, hin und wieder von Blau unterbrochen, — graue Luft, bleigraues Meer mit weißen Eisschollen und graue Felsen mit weißem Schnee rings umher und dann ein klein wenig Blau in den Schluchten der Gletscher oder in dem Gletschereis draußen auf dem Wasser. Aber in unsern Herzen war kein Grau!“
[S. 3]
Mit eigenthümlich frohen Empfindungen legten wir uns an jenem Abend schlafen, nachdem wir ziemlich hoch am Berg hinauf einen passenden Zeltplatz gefunden hatten.
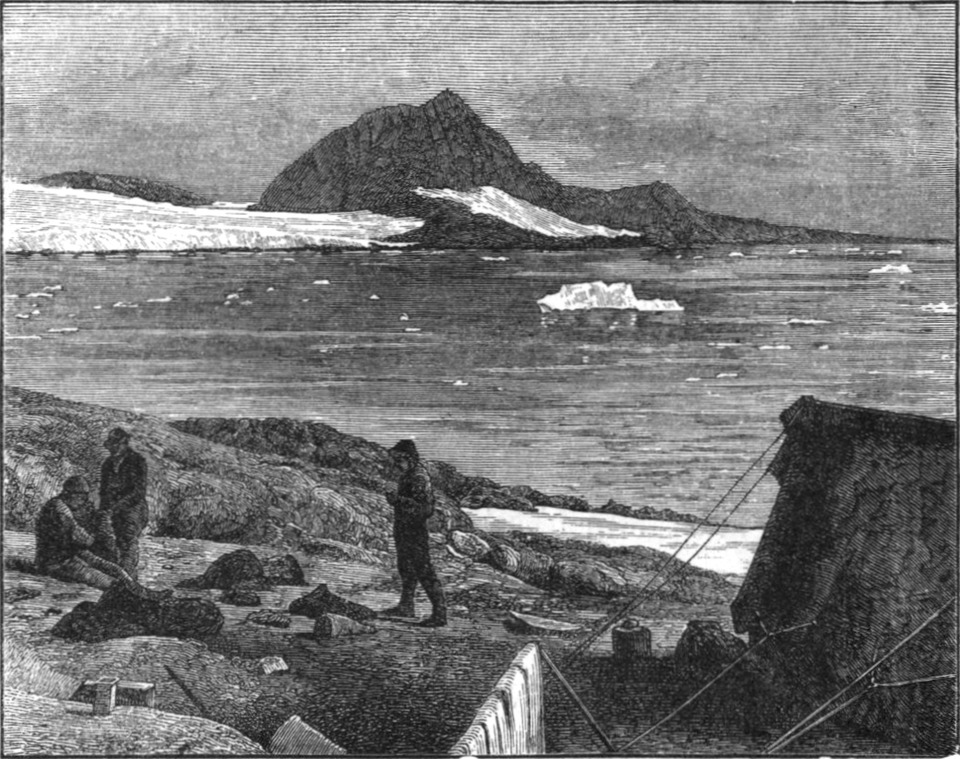
Der 11. August brach mit dem herrlichsten Wetter an. Von dem Platz vor dem Zelt sah man das blaue Meer sich im Sonnenschein bis an den Horizont erstrecken, nur hie und da schwammen weiße Eisberge auf der kaltblauen Tiefe, über welcher die vom schwachen Morgenwinde erregten Wogen in der Sonne spielten und glitzerten. Im Süden sahen wir die Kolberger-Heide mit ihren Schnee- und Eismassen und ihren unzähligen Nunataks aus dem Meere aufragen. Vor uns im Osten erhob der Kiatak seine gewaltige Kegelform von der blauen Tiefe bis zu dem wolkenfreien, klaren Augusthimmel. Von diesem Steinriesen aus und überall nach Norden hin breitete das Inlandseis seine weißen Massen gegen den Horizont. Zu[S. 4] unterst werden diese Massen immer blauer, zerrissener und zerklüfteter, bis sie in einer hohen, zersplitterten Eiswand unten an der See enden. Von diesen tiefblauen Eiswänden stammen die vielen Eisstücke, die rings umher auf dem Meere schwimmen, und die mit donnerähnlichem Getöse herabstürzen. Ganz oben aber wölbt sich das Eis gleich einer einzigen weißen Fläche, die nur hie und da von einzelnen tiefblauen Spalten durchfurcht wird; schließlich verliert man sie aus den Augen, weiß und fast warm hebt sie sich von der bläulichgrünen Farbe des Himmels ab.
Nicht viele Laute vernimmt man in dieser Natur. Nur die schrillen Schreie der Seeschwalbe dringen an dein Ohr, während du dort stehst, überwältigt von der großartigen, aber noch sterilen Schönheit dieser Natur. Von Zeit zu Zeit vernimmt man ein Getöse, das eine täuschende Aehnlichkeit mit Kanonenschüssen hat, — es ist das Krachen des Gletschereises, in dem sich ein neuer Riß bildet, oder das eine kleine Bewegung nach dem Meere zu macht. Vergißt man einen Augenblick, wo man ist, oder hört man dies Getöse des Morgens im Halbschlaf, so kann man sich gar leicht davon täuschen lassen.
Doch die Sonne ruft uns zur Arbeit, — da heißt es, das Frühstück in aller Eile einnehmen. Die meisten Mitglieder der Expedition werden sofort dabei angestellt, den Rost von den Schlittenschienen und später auch den von dem Stahlbeschlag der Schneeschuhe abzukratzen. In ihrem jetzigen Zustand, von Seewasser und Feuchtigkeit arg mitgenommen, würden wir nicht weit damit kommen. Dietrichson soll eine Karte über die Bucht, die Landzunge und die nächsten Theile des Inlandseises aufnehmen, während Sverdrup und ich unsere erste Wanderung über das Inlandseis vornehmen. Wir mußten ja untersuchen, ob hier vorwärts zu kommen war, sowie wo es am besten war anzufangen. Ich kann nicht leugnen, daß wir vor Ungeduld brannten,[S. 5] einen ersten Blick über diese terra incognita zu werfen, die wohl noch kein menschlicher Fuß betreten hatte. Es mußten jedoch verschiedene Vorbereitungen gemacht werden, ehe wir fortkommen konnten; heute, wo die Sonne schien, mußten wir allerlei astronomische Observationen anstellen, auch einige photographische Aufnahmen ließen sich vorzüglich bei diesem Wetter machen. Endlich, als die Sonne den Meridian passirt hatte und wir die Mittagshöhe gemessen hatten, waren wir fertig. Der Futtersack ist geschnürt, ein Alpenseil und Eisäxte haben wir auch, und so ziehen wir von dannen, den Felsabhang (ich habe ihn Nordenskjöld Nunatak genannt) hinan, der sich vom Zelte aus eine Strecke landeinwärts hinzieht gleich einer Insel im Inlandseise. Bald waren wir oben angelangt. Vor uns lag eine kleine Moräne, von der wir eine gute Aussicht über das Eis hatten. Wir sahen jetzt, daß es nicht so eben war, wie es von der See aus schien, zahlreiche Risse durchfurchten die weiße Oberfläche nach allen Richtungen hin. Vor allem war dies der Fall über den beiden Eisströmen oder Gletschern, die sich zu beiden Seiten vor uns ausbreiteten, der eine nach Norden, der andere nach Süden zu. Nachdem wir den nördlichen Gletscher untersucht und seine Oberfläche als ganz unpassirbar befunden hatten, sahen wir ein, daß wir nur zwischen den beiden Gletschern an dem Rücken entlang kommen konnten. Eine ganze Strecke gelangten wir auch über spaltenfreies Eis vorwärts. Im Anfang war das Eis hart und holperig, es hatte eine scharfe, rauhe Oberfläche, die unter den Füßen knirschte und unsere Stiefelsohlen ganz unbarmherzig mitnahm. Später kamen wir an etwas weicheren, aber nassen, körnigen Schnee, wo der Fuß ein wenig versank. Es währte jedoch nicht lange, bis wir auf Risse stießen; im Anfang waren es ganz kleine, unschuldige, die wir mit Leichtigkeit überschritten,[S. 6] bald aber wurden sie breiter und, wie es schien, bodenlos. Wir konnten nicht einmal darüber hinwegspringen, sondern mußten um die Risse herumgehen, und auf diese Weise gingen wir bald links, bald rechts.
Bekanntlich laufen die Risse gewöhnlich quer über die Richtung, in welcher die Eisströmung sich vorwärts schiebt. Sie entstehen dadurch, daß die Eismassen sich über Erhöhungen und Unebenheiten des untenliegenden Terrains wölben, wodurch natürlich die untersten Schichten des Gletschers zusammengepreßt werden, während der Schnee oder das Eis in den oberen Schichten von einander gerissen wird und bis ganz an den Grund berstet, hierdurch wird ein Riß gebildet, der sich an der Erhöhung entlang zieht, über die der Gletscher sich bewegt. Allmählich, je mehr die Bewegung vorwärts schreitet, bilden sich neue Risse, die alle ungefähr in derselben Richtung laufen.[1]
Eine ganze Weile ging alles gut, theils konnten wir uns am Rande der nördlich laufenden Risse halten — es war kein weiterer Umweg für uns —, theils waren sie nicht sonderlich lang. Sie wurden zum Theil schmäler, so daß wir darüber hinwegspringen oder sie umgehen konnten. Häufig gingen wir auch darüber hinweg über hohle Eisbrücken oder schmale Eisstreifen, die sich dadurch gebildet hatten, daß das Eis nicht ganz geborsten war, sondern daß ein Eisstreifen von einem Rande zum andern hängen blieb und eine schmale, schräge Brücke bildete, von der herab man zu beiden Seiten in die blaue, bodenlose Tiefe hinabschauen konnte. So lange die Schneeschicht auf dem Eise dünn war, gab es keine Gefahr, man konnte sehen, wo fester Grund[S. 7] für den Fuß war, und wo man sich in Acht nehmen oder sich beeilen mußte. Das Seil trugen wir um den Leib geknüpft, es mußte ganz stramm gehalten werden, damit wir uns gegenseitig beim Hindurchfallen oder Ausgleiten stützen und halten konnten.
Allmählich, als wir weiter kamen, nahmen jedoch die Schneemassen auf dem Eise zu, wir versanken in dem nassen, körnigen Schnee bis über die Knöchel, das Gehen wurde beschwerlich, und der Schnee lag verrätherisch bis über den Rand der Spalten, ja, er verdeckte sie zuweilen völlig, so daß sie wie eine ebene Fläche aussahen. Wir mußten vorsichtig tasten und überall mit unsern Stöcken in den Schnee stechen, sonst wären wir gar bald auf hohlen Grund gerathen, wo nur eine dünne Schneeschicht uns von der Tiefe trennte, in die der Stab bei dem geringsten Druck versank. Sobald wir dies fühlten, zogen wir uns schleunigst zurück oder machten auch einen verzweifelten Schritt vorwärts, soweit die kurzen oder langen Beine es gestatteten, um wenn möglich auf der andern Seite festen Grund und Boden zu erreichen, während der Kamerad sicheren Halt zu gewinnen sucht und das Seil sicher faßt, um einen genügenden Widerstand leisten zu können, falls die Schneekruste bersten sollte. Keiner von uns Beiden erlitt einen schlimmen Fall; ein paarmal sah es freilich böse aus, wir sanken bis unter die Arme durch den Schnee und fühlten die Beine in dem leeren Raum unter uns baumeln. Da dies auf die Dauer weniger angenehm war, suchten wir natürlich so bald wie möglich aus diesem Terrain zu gelangen, und nahmen unsern Kurs weiter südwärts, wo weniger Schnee lag und wo die Risse nicht so zahlreich waren. Da wir hier nicht so vorsichtig zu sein brauchten als bisher, kamen wir nun eine ganze Strecke lang schneller vorwärts. Allmählich hörten die Spalten fast ganz auf, dafür aber lag hier der[S. 8] nasse, körnige Schnee tiefer denn je zuvor, und es war unglaublich schwer, sich hindurch zu stampfen, denn wir versanken bei jedem Schritt bis weit über die Knöchel. Wir bereuten es jetzt bitter, daß wir keine Skier oder indianische Schneeschuhe mitgenommen hatten. Unsere norwegischen „Truger“ hatten wir freilich auf dem Rücken, doch konnten uns die nicht nützen, da sie zu klein waren, um uns bei der Beschaffenheit des Schnees oben zu halten.
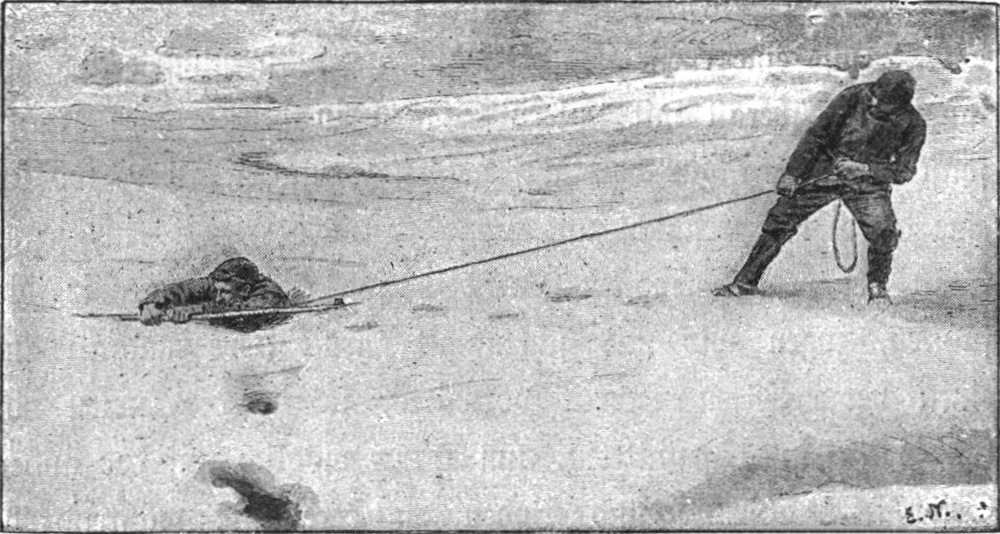
Die Steigung war ziemlich eben gewesen, seit wir in einer Höhe von ca. 125 m den festen Berg verließen. Vor uns im Nordwesten (rechtweisend) lag eine Höhe, von der wir die gewünschte Aussicht über das Eis haben zu müssen glaubten, falls wir nur dahin gelangen konnten. Wir schickten sehnsuchtsvolle Blicke hinauf, aber der Weg war lang und die Beschaffenheit des Weges, wie gesagt, niederträchtig. Indessen sind die Magen leer genug geworden, und die Sonne steht westlich genug, um uns an unsere materiellen Bedürfnisse zu mahnen. Wir legen die aus Weidenzweigen geflochtenen Truger auf den Schnee, stampfen ein Loch vor denselben und bilden uns so einen einigermaßen trocknen und warmen Sitz im Sonnenschein. Es war[S. 9] eine wahre Wonne, auf diese Weise ein wenig Ruhe genießen zu können, wir hieben kräftig auf unsern Pemikan und unsere Biskuits ein, warfen einen Blick auf die Landschaft um uns her und genossen den wolkenlosen Himmel und das strahlende Wetter. Nur blendet uns der Sonnenschein, der von der weißen Schneefläche zurückgestrahlt wird, sehr. Leider haben wir die Schneebrillen im Zelt vergessen und können daher nichts gegen diese Unannehmlichkeit thun.
Vor uns im Süden wölbt der breite Eisstrom seine zerrissene und durchfurchte Oberfläche bis zur See hinab, wir wissen, daß sich dort weiter nach unten zu einige Felskuppen befinden sollen, aber sie sind jetzt unserm Blick entzogen, und wir sehen nur das Meer, das dahinter liegt und seine blaue Fläche bis an den Himmelssaum erstreckt. Eigentliches Treibeis ist nicht zu erblicken, nur zerstreute Eisstücke, die hauptsächlich von den Gletschern herstammen. Welche Veränderung in den wenigen Wochen, die verstrichen sind, seit wir hier auf einer Eisscholle vorübertrieben. Damals lag das Treibeis von der Küste an 5 bis 6 Meilen ins Meer hinaus so dicht, daß nicht einmal unsere kleinen Böte hindurchkommen konnten, und jetzt hätte die größte Escadre überall ohne Schwierigkeit landen können, ja selbst ohne ein Eisstück zu berühren.
Aber der Mittag ist verstrichen, und wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Höhe noch vor Sonnenuntergang erreichen wollen; um die Zeit sieht man in größeren Entfernungen über die Schneeflächen am schärfsten.
Wir stampfen deswegen weiter mit erneuten Kräften, die nur Speise und Ruhe zu verleihen vermögen. Die Bodenbeschaffenheit wird immer ungünstiger. Eine etwas härtere Kruste, die oben auf lag und ein Ueberrest früherer Nachtfröste war, ermüdete uns sehr, indem wir unbarmherzig hindurchfielen,[S. 10] sobald wir den Fuß aufsetzten, und wenn wir ihn wieder erheben wollten, hing sie sich an den Knöcheln fest. Diese entsetzliche Beschaffenheit des Schnees kann den Stärksten erschöpfen, und wir empfanden das um so mehr, als unsere Beine völlig außer Training waren. Seit Monaten hatten sie nicht die geringste Bewegung gehabt, abgesehen von den vereinzelten Fällen, wo wir die Böte durch das Treibeis gezogen hatten. Unsere Muskeln über den Knien und in den Waden schmerzten gehörig.
Aber unbarmherzig ging es weiter. Wir mußten alle Kraft daran setzen, um so bald wie möglich auf die Höhe hinauf zu kommen, denn es sah so aus, als wenn wir Regen und bedeckte Luft bekommen könnten, wenn wir uns nicht sehr beeilten. Die Luft an dem höchsten Rücken entlang nahm bereits eine unheimlich graue, wollige Farbe an. Wir verdoppelten unsere Anstrengungen, und verlängerten unsere Schritte so viel wie möglich. Endlich, nachdem wir einmal über das andere geglaubt hatten, daß wir am Ziele seien, es aber immer wieder hinter einer Höhe hatten emporragen sehen, kamen wir auf den Gipfel der erstrebten Höhe, — aber ach! das Leben ist reich an Enttäuschungen! Wenn man einen Höhenrücken erreicht hat, liegt stets noch einer dahinter, der höher ist und die Aussicht versperrt, aber wir mußten auch dahin. Freilich konnten wir annehmen, daß wir während der zwei Meilen, die wir gegangen waren, das schlimmste Eis schon überwunden hatten, aber es konnte noch schlimm genug aussehen. Also vorwärts, so schnell die Beine uns tragen wollten, dem höchsten Punkt des Bergrückens zustrebend. Dort scheinen viele Risse zu sein, aber sie sind wohl nicht unüberwindlich. Während ein leichter Staubregen herabfiel, erklommen wir den ziemlich steilen Abhang, es geht schwerer denn je; wir sinken jetzt bis an die Schenkel in den[S. 11] Schnee, es hilft nichts, daß Regen und Wolken noch so sehr drohen, wir müssen hin und wieder anhalten und ein wenig uns verpusten, denn wir sind todtmüde. Diesmal sieht es jedoch wirklich aus, als wenn wir uns nicht getäuscht haben, — wenn nur der Regen nicht alles in einen grauen Schleier hüllt, werden wir von oben schon eine gute Aussicht haben. Eine Strecke lang können wir schon sehen, ja ich entdecke sogar einen einzelnen mir bis dahin unbekannten Nunatak. Immer begieriger schreiten wir von dannen.
Endlich standen wir auf dem Gipfel und wurden nun reich belohnt für alle Mühe und alle Widerwärtigkeiten. In ihrer ganzen weißen Majestät lag die Fläche vor uns da. Der Regen fiel freilich noch immer wie ein feiner Staub, aber es war uns doch möglich, alle wünschenswerthen Details zu erkennen, selbst die ziemlich entfernt gelegenen. Die ganze Fläche schien eben und ohne Risse zu sein ganz bis an den Horizont hinan. Darauf waren wir auch vorbereitet gewesen; was uns aber überraschte, waren die unzähligen kleinen und großen Nunataks, die über dem Schneemeer emporragten, selbst ganz weit ins Land hinein. Viele von ihnen waren ganz weiß und mit Schnee bedeckt, an einigen Stellen jedoch sahen dunkle, nackte Felsköpfe und Höhen aus dem Schnee hervor und bildeten einen scharfen Kontrast zu dieser blendend weißen Farbe, den Augen einen wohlthuenden Ruhepunkt bietend. Besonders zeichnete sich ein kleiner Nunatak ganz im Hintergrunde durch sein Aussehen und seine Lage aus. Wir nannten ihn die „Jungfrau“. Weshalb er diesen Namen erhielt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, vielleicht weil er so rein und jungfräulich aussah. Nur ganz oben am Kopf schimmerte ein klein wenig von dem dunklen Felsen hindurch, — gewissermaßen erinnerte seine Form auch an eine Jungfrau aus alten Tagen mit einem großen, weißen[S. 12] Krinolinenrock. Hinter diesem Nunatak ragten noch ein paar Gipfel empor, die ganz weiß waren und insofern noch mehr jungfräulich erschienen. Wir berechneten die Entfernung bis zu den hintersten Nunataks auf 5 bis 6 Meilen und konnten wohl kaum darauf rechnen, in den ersten Tagen bis dahin zu gelangen. Die Steigung war freilich eben und flach, so weit das Auge reichte, aber die Schneebeschaffenheit war, wie wir aus Erfahrung wußten, keineswegs gut, besonders die letzte Strecke war kaum passirbar gewesen. Wenn kein Nachtfrost eintrat, waren die Aussichten nicht gerade verlockend. Aber das Barometer zeigte uns, daß wir eine Höhe von über 900 m erreicht hatten, kamen wir noch ein paar tausend Fuß höher, so konnten wir doch, wenigstens während der Nächte, auf Frost rechnen. Arme naive Menschen, die in Grönlands Innern nach Frost seufzten!
Aber unser Ziel ist erreicht, — wir haben das Eis trotz Nunataks und trotzdem es sich so direkt vom Meere aus erhob, gleich von Anfang an passirbar gefunden, was wir kaum zu hoffen gewagt. Wir waren hungrig geworden, der Abend brach herein, es war nicht zu früh, uns abermals auf unsere Truger zu setzen und den Proviantsäcken ihr Recht widerfahren lassen.
Nachdem die Abendmahlzeit eingenommen war, galt es an den Rückweg zu denken. Wir sind wenigstens 2 Meilen vom Zelt entfernt. Es war wenig Grund vorhanden, denselben Weg einzuschlagen, den wir gekommen waren, — wir befanden uns ja auf einer Rekognoscirung und mußten deshalb untersuchen, ob ein Vordringen von einer anderen Seite nicht leichter für die Expedition sein werde. Wir hielten es für sehr leicht möglich, daß wir von dem Berge, der jetzt südlich vor uns lag, (auf Jensens Land) gut auf das Eis gelangen müßten. Man konnte hier hoch emporsteigen, hatte festen Grund und vermied[S. 13] dadurch einen Theil des schwierigsten Eises. Es war freilich ein wenig spät, um neue Wege auszuprobiren, aber das half nichts, Klarheit mußten wir haben, da mußte die Nacht mit zur Hülfe genommen werden.
Da der Schnee hier oben loser und höher denn je lag, schnallten wir unsere Truger unter die Füße und versuchten, ob das nicht helfen könne, und wirklich, es ging bedeutend leichter. Mit erneuten Kräften traten wir den Rückweg an, uns in südlicher Richtung auf den Berg zu haltend. Es dunkelte jedoch schnell, und wir waren noch nicht weit gekommen, als es unheimlich schwer wurde, die Risse im Eis in der Entfernung zu erkennen. Es waren deren allerdings noch nicht viele, aber wir mußten darauf vorbereitet sein, sie bald in Unmenge zu treffen. Da galt es denn, sich längs dem Gipfel des Höhenrückens zu halten, der die Senkungen trennt, die zu beiden Seiten liegen. Hier kann man darauf rechnen, einigermaßen sicher zu gehen. Eine ganze Strecke geht alles gut, der Weg wird auch besser, ja so gut, daß Sverdrup die Truger abschnallt. In nicht allzu weiter Entfernung sehen wir schon den Berg, wo wir Wasser zu finden hoffen und wo wir Rast machen wollen, um unsere müden Glieder auf dem kahlen Fels auszustrecken. Wir sehnten uns unsagbar danach, festen Boden unter den Füßen zu verspüren, und das konnte nicht so übermäßig lange mehr währen. Aber wie oft täuscht man sich nicht in seinen Berechnungen, wenn man es mit Eis zu thun hat, es mag nun Treibeis oder Inlandseis sein. Wir waren noch nicht weit gegangen, als wir anfingen zu ahnen, daß unser Ziel zu erreichen dennoch „übermäßig lange“ und mehr als das währen würde. Wir kamen nämlich an ein Terrain mit so langen und so schlimmen Spalten, wie wir sie noch nicht getroffen hatten. Im Anfang ging es noch einigermaßen, und auf unsern Trugern konnten wir mit größerer[S. 14] Sicherheit hinüberspringen als vorhin ohne dieselben, mit größerer Kühnheit konnte ich mich nun über die Schneebrücken wagen, da ich nicht so leicht durchfiel. Wo die Brücken zu unsicher waren, um betreten zu werden, wählten wir eine andere, vorsichtigere Art und Weise, indem wir uns auf den Bauch legten und auf allen Vieren hinüberkrochen. Dadurch erhielt der Körper eine weit größere Fläche, auf der er ruhen konnte, und die Gefahr durchzufallen wurde bedeutend verringert.
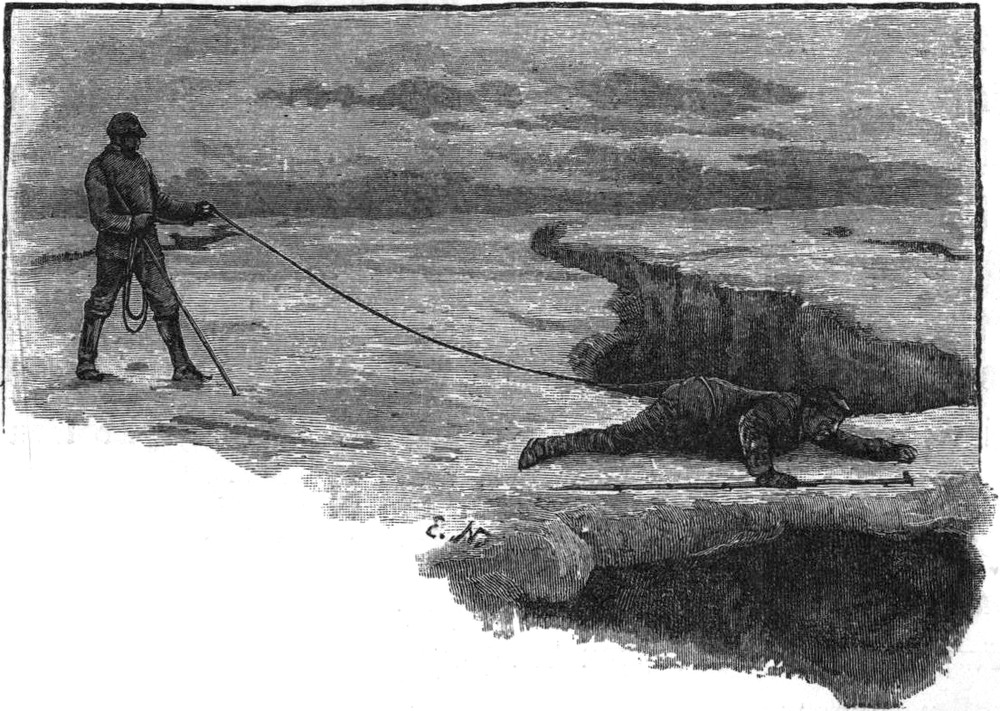
Bald wurden indessen die Risse so breit, daß wir die Unmöglichkeit, hinüberzukommen, einsahen, — wir mußten sie umgehen. Und das thaten wir denn auch im wahren Sinne des Wortes. Halbestundenlang gingen wir neben den Schluchten her, bald unterhalb, bald oberhalb derselben, aber sie wurden länger und länger. Schließlich kamen wir an eine Spalte, die breiter war als alle bisherigen; daß sie ebenfalls länger war, sollten wir auch gar bald erfahren. Wir wollten oberhalb des[S. 15] Risses entlang gehen, da wir der Meinung waren, daß er sich wahrscheinlich hier am ersten schließen würde, aber diesmal hatten wir uns gründlich geirrt. Wir gingen weiter und weiter und entfernten uns immer mehr von unserem Ziel, der Gipfel des Berges verschwand allmählich im Dunkel, aber die Spalte war und blieb gleich breit. Da waren keine Brücken, und in der Finsterniß konnten wir keine Veränderung gewahren. „Alles hat ein Ende,“ sagte der Knabe, als er Prügel bekam! Wir gingen weiter und kamen denn schließlich auch diesmal ans Ende. Wir gelobten uns, daß es das letzte Mal sein sollte, daß wir oberhalb der Risse herum gingen; der andere Weg brachte uns jedenfalls dem Berge näher, und dort mußte sicher Wasser für unsere brennenden Kehlen zu finden sein. Auf diese Weise kamen wir schneller vorwärts, und wir hatten nun wirklich die Freude, unser Ziel im Dunkeln wachsen zu sehen. Wir hatten nur noch wenige Schritte zurückzulegen, als wir vor uns einen dunklen Streifen oder eine dunkle Fläche auf dem Schnee entdeckten. Anfänglich glaubten wir, daß es eine neue Spalte sei, die uns von unserem Ziele trennte, wer aber beschreibt unsere Freude, als es sich herausstellte, daß es Wasser war, herrliches, fließendes Wasser! In größter Eile holten wir unsere hölzernen Becher heraus und tranken mit einer Wonne, wie nur der sie kennt, der einen ganzen Tag bis über die Waden in nassem Schnee herumgestampft hat, ohne einen Tropfen Feuchtigkeit zu genießen. Ich glaube kaum, daß es einen höheren Genuß im Leben giebt, als einen Trunk guten, frischen Wassers, wenn man dem Verschmachten nahe ist. Ist es Eiswasser wie hier, so trinkt man so lange, bis die eisige Kälte in den Zähnen und in der Stirn halt! sagt, dann macht man eine kleine Pause und trinkt von neuem. Still und andächtig saugt man das erquickliche Naß in sich hinein, damit die eisige Kälte nicht zu[S. 16] bald wiederkehren soll. Als wir so viel getrunken hatten, wie wir vorläufig vermochten, füllten wir unsere hölzernen Becher und unsere Feldflasche, legten die wenigen Schritte zurück, die uns noch bis zur Felswand übrig blieben, fanden einen guten Sitz auf einem vorspringenden Felsblock, und hieben aus allen Kräften in unser Pemikan, in unsere Biskuits und die Fleischpulverschokolade ein.
Aber da fing es an zu regnen, und das war weniger angenehm, auch nahm die Finsterniß in dem Maße zu, daß wir kaum mehr als zwei Schritte weit vor uns sehen konnten. Wir hatten noch ein gutes Stück bis zum Zelte zurückzulegen, also abermals vorwärts! Wir nahmen unsern Kurs in südlicher Richtung über das Eis und dem Felsen entlang. Die Oberfläche war hier einigermaßen eben, was an festem Lande entlang oft der Fall ist, weil das Eis dort still zu liegen pflegt und an den Boden und die Felsseite fest gefroren ist. Eine Weile ging es einigermaßen leicht, aber dann wurde der Abhang so steil und so glatt, daß wir uns nur mit genauer Noth festhalten konnten. Um die Situation recht angenehm zu machen, traten nun auch unter uns große Risse im Eise auf. In der Finsterniß konnten wir gerade noch die dunklen Abgründe erkennen, die bereit waren, uns, sobald wir einen Fehltritt thaten oder ausglitten, in ihren Schoß aufzunehmen. Die Felswand über uns war so steil, daß wir nicht daran denken konnten, dort vorwärts zu kommen, wir mußten bleiben, wo wir waren. Schließlich gelangten wir unversehrt an einen Ort, wo sich ein Bergabsatz in die Eismassen hinausschob. Zwischen der Bergwand und dem Eise befand sich eine mehr als 20 m breite, schwindelnd tiefe Schlucht, im Eise schimmerten verschiedene Risse durch das Dunkel; wie groß diese waren, konnten wir nicht entscheiden, das aber wußten wir, — unserem Vorwärtskommen setzten sie ein Ziel. Uns blieb[S. 17] nichts übrig, als über den Berg zu gehen und ein Thal, das ganz in der Nähe lag, zu passiren, um hinter den Bergabsatz zu gelangen und zu sehen, ob wir dort nicht vorwärts kommen könnten. Es war ein wahrer Genuß, wieder festen Grund unter den Füßen zu haben und tüchtig ausschreiten zu können. Trotz des Sturzregens, der uns bis auf die Haut durchnäßte, machten wir eine längere Rast auf den Steinen. Wir wollten bis zum Tagesanbruch warten und dann erst auf das Eis zurückkehren.
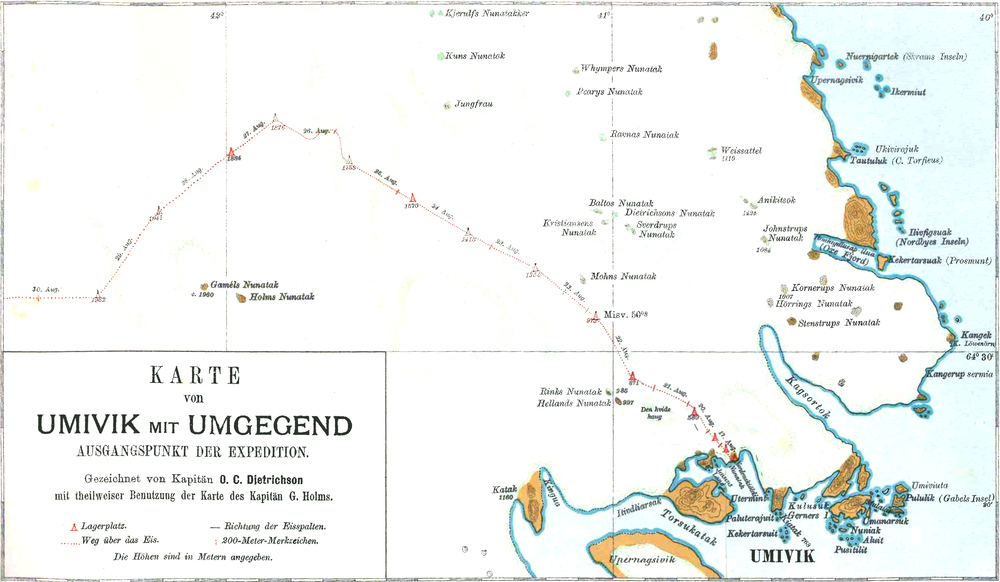
Endlich brach der Tag roth und glühend an, einen warmen Schimmer über Himmel und Landschaft verbreitend. Unter uns lag das Eis, das scheinbar leichter zu passiren war, als wir erwartet hatten. Wir untersuchten, wo wir am besten vorwärts kommen könnten, und dann machten wir uns wieder auf den Weg. Obwohl unsere Wanderung über den Gletscher nicht weit von der Stelle entfernt war, wo er in die See fällt, war das Eis hier nicht so zerklüftet und unwegsam wie weiter nach oben hinauf. Uneben und holperig war es, voller in die Höhe stehender Eiszacken und scharfer Kämme mit Schluchten dazwischen, die oft recht schwer zu passiren, aber nicht tief waren; so lange, bodenlose Spalten, wie wir sie dort oben angetroffen hatten, fanden wir hier jedoch nur ausnahmsweise und nur an einzelnen Stellen. Der Grund hierzu muß in dem Umstand zu suchen sein, daß sie sich mit Wasser füllen, das gefriert, und so nur Unebenheiten im Eise bilden.
Bald waren wir glücklich hinübergelangt, und nach einem zweistündigen Marsch konnten wir uns endlich um fünf Uhr des Morgens an dem Anblick unseres Zeltes erlaben. Hier lagen, wie wir es erwartet hatten, Alle im tiefsten Schlummer. Das erste, was wir thaten, war, daß wir uns etwas Essen hervorholten und uns an dem gütlich thaten, was das Haus zu bieten vermochte. Wir glaubten das nach unserem Spaziergang[S. 18] von 4 bis 5 Meilen redlich verdient zu haben. Dann krochen wir in unsere Säcke, streckten unsere Glieder aus und zogen bald in das schöne Land der Träume hinüber, höchlich befriedigt von dem Ausfall dieser unserer ersten Wanderung über das so viel besprochene und so gefürchtete grönländische Inlandseis, das so schwer zu besteigen und noch schwerer zu überschreiten sein sollte.
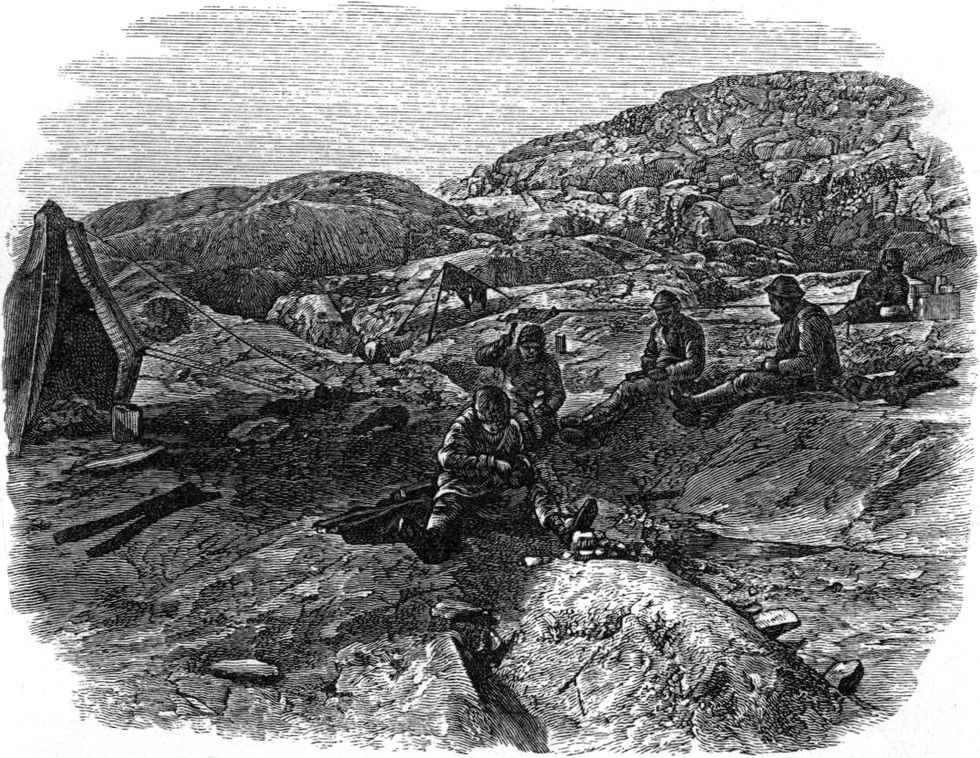
Ehe wir weiter zogen, hatten wir noch allerlei Vorbereitungen zu treffen, besonders bedurfte unser Schuhzeug der Ausbesserung und Versohlung, denn wir hatten bei unserer ersten Wanderung die Erfahrung gemacht, daß das Inlandseis starke Sohlen erforderte. Die Schlitten und Schneeschuhe mußten noch unter dem Stahl abgeschabt werden, um leicht zu gleiten, unsere Sachen mußten umgestaut und das, was wir zurücklassen wollten, hervorgesucht werden. Dies alles erforderte Zeit, und während der folgenden Tage konnte man die Mitglieder der Expedition[S. 19] auf dem Berge vor dem Zelte sitzen sehen, von verschiedenen friedlichen Beschäftigungen in Anspruch genommen, worunter das Schusterhandwerk den hervorragendsten Platz einnahm. Es war ein höchst eigenthümlicher Anblick, uns in diesen Umgebungen sitzen zu sehen, die Stiefel zwischen den Knien, Pechdraht und Pfriem mit einer Fertigkeit handhabend, als hätten wir uns unser Lebelang mit nichts anderem beschäftigt.
Aber wir wollen diese fleißigen Gestalten nicht bei ihrer wichtigen Arbeit stören, sondern lieber einen Blick auf die Versuche werfen, die früher gemacht sind, um in das mystische Innere Grönlands vorzudringen, und untersuchen, welche Bedeutung es haben kann, sich Klarheit zu verschaffen.
[1] Wenn nun die Eismassen, nachdem sie solche Erhöhungen passirt haben, an eine Thalsenkung oder einen Thalkessel gelangen, wo die Krümmung des Terrains also anstatt konvex zu sein, konkav wird, so schließen sich diese Risse wieder, füllen sich mit Schnee und Wasser, frieren zu und verschwinden allmählich ganz wieder.
[S. 20]
 icht so sehr durch seine wildzerklüfteten Küsten wie durch seine
mit Eis angefüllten Fjorde und sein mit Schnee und Eis bedecktes
Inland nimmt Grönland eine Sonderstellung zwischen den Ländern auf
der Oberfläche unserer Erdkugel ein. Dringt man in den von Menschen
bewohnten Theil, vom Außenlande nach innen zu, an den Fjorden
entlang, so stößt man bald ein paar Kilometer von der Küste entfernt
auf ein unabsehbares Schnee- und Eisfeld, unter welchem alles Land
verschwindet, und das den Gesichtskreis nach Osten zu, von Norden bis
nach Süden beherrscht. Dies ist das Inlandseis, der größte
Eisgletscher der nördlichen Halbkugel. Wie groß es ist, können wir noch
nicht mit Bestimmtheit sagen; daß die Ausdehnung aber mindestens eine
Million Quadratkilometer beträgt, wissen wir.
icht so sehr durch seine wildzerklüfteten Küsten wie durch seine
mit Eis angefüllten Fjorde und sein mit Schnee und Eis bedecktes
Inland nimmt Grönland eine Sonderstellung zwischen den Ländern auf
der Oberfläche unserer Erdkugel ein. Dringt man in den von Menschen
bewohnten Theil, vom Außenlande nach innen zu, an den Fjorden
entlang, so stößt man bald ein paar Kilometer von der Küste entfernt
auf ein unabsehbares Schnee- und Eisfeld, unter welchem alles Land
verschwindet, und das den Gesichtskreis nach Osten zu, von Norden bis
nach Süden beherrscht. Dies ist das Inlandseis, der größte
Eisgletscher der nördlichen Halbkugel. Wie groß es ist, können wir noch
nicht mit Bestimmtheit sagen; daß die Ausdehnung aber mindestens eine
Million Quadratkilometer beträgt, wissen wir.
Sowohl Eskimos wie Nordländer, Alle machten an dem äußeren Rand desselben Halt, und zu allen Zeiten hat über dem Inlande ein Schleier gelegen, den Niemand ganz zu lüften vermochte, und hinter dem die wildesten Phantasien ihr Spiel treiben konnten, denn gleich wie alles, das in Finsterniß gehüllt ist, hat auch Grönlands Inland eine eigenartige Anziehungskraft auf den Geist des Menschen ausgeübt.
[S. 21]
Die Eskimos sind, so viel wir wissen, die ersten Menschen, die nach Grönland gekommen sind, folglich sind sie auch die Ersten, welche eine Bekanntschaft mit dem grönländischen Inlandseis gemacht haben. Wie lange dies her sein mag, ahnen wir nicht, wir wissen es nicht einmal ungefähr, denn die Annahme, daß die Eskimos erst vor 1000 Jahren nach Grönland gekommen sein sollen, ist — wie in einem späteren Kapitel nachgewiesen werden wird — meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich.
Die Eskimos kamen aus Ländern, die an der westliche Seite der Baffinsbucht und der Davisstraße gelegen und die nicht mit Inlandseis bedeckt, sondern theilweise bis ins Innere bewohnt waren. In Grönland entdeckten sie gar bald, daß überall nach innen zu das Eis ihnen hemmend entgegentrat. Dies hat sie sicher von allen Versuchen, weiter in das Land einzudringen, abgehalten, es hinderte sie jedoch nicht, den Schauplatz für die vielen Erzählungen über das Zusammentreffen und den Verkehr mit Völkern, welche im Innern der früher von ihnen bewohnten Länder hausten, dorthin zu verlegen. Diese Völker sind wahrscheinlich zum größten Theil Indianer von den nördlichen Küsten des nordamerikanischen Festlandes gewesen, und in der Sagenwelt der grönländischen Eskimos haben sie dann das Innere Grönlands als Inlandsmenschen bevölkert, denen gewisse übernatürliche Kräfte zuertheilt waren. In gleicher Weise sind wahrscheinlich auch die Sagen von den Wanderungen quer über das Inlandseis entstanden, falls man denselben überhaupt einen historischen Ausgangspunkt geben will. Es sind dies Wanderungen, die in kleineren, westlich gelegenen, von den Eskimos bewohnten Ländern ausgeführt worden sind. Eine bestimmte Vorstellung von dem Innern scheinen die Eskimos sich nicht gebildet zu haben. In den Gegenden, in denen es[S. 22] Rennthiere giebt, kamen sie auf ihren Rennthierjagden häufig mit dem äußeren Rand des Inlandseises in Berührung und wagten sich wohl zuweilen auch eine Strecke über denselben hinaus bis zu den Nunataks, auf denen die Rennthiere ihre Zuflucht zu suchen pflegen. Sie erblickten hier überall nach innen zu, soweit das Auge reichte, Eis und Schnee; da ist es denn nicht unwahrscheinlich, daß sie sich das Ganze auf gleiche Weise bedeckt vorgestellt haben.
Die Norweger, die vor ungefähr 900 Jahren nach Grönland kamen und die die West- und die Südküste wahrscheinlich bis zum 15. Jahrhundert bewohnten, scheinen sich sehr bald eine verhältnißmäßig richtige Auffassung von dem Lande und dem Inlandseise gebildet zu haben, wie man aus der Erwähnung desselben im „Königsspiegel“ ersehen kann. Die Stelle lautet in der Uebersetzung folgendermaßen:
„Wenn du aber fragst, ob das Land frei von Eis ist oder nicht, oder ob es mit Eis bedeckt ist wie das Meer, so sollst du wissen, daß es einen kleinen Theil des Landes giebt, der frei von Eis ist, daß aber all das Uebrige mit Eis bedeckt ist, weswegen man auch nicht weiß, ob das Land groß ist oder klein, sintemalen alle Gebirgsstrecken und alle Thäler mit Eis bedeckt sind, so daß man nirgends eine Oeffnung findet, aber es ist doch anzunehmen, daß es Oeffnungen geben muß, entweder in den Thälern, die zwischen Bergen liegen, oder am Strande entlang, durch welche Oeffnungen die Thiere sich hindurchfinden können, denn die Thiere könnten nicht aus anderen Ländern dorthin laufen, ohne eine Oeffnung im Eise oder freies Land zu finden. Aber oft haben Leute es versucht, auf das Land zu gehen, auf die Berge, welche die höchsten sind, an verschiedene Stellen, um sich umzusehen und um zu erfahren, ob sie Land finden könnten, das frei von Eis und das[S. 23] bewohnbar sei, und haben sie es nirgends gefunden, ausgenommmen dort, wo jetzt Leute wohnen, und das ist sehr wenig vom Rande des Meeres entfernt.“
Diese Beschreibung giebt ein so richtiges Bild, daß wir bis in die allerneueste Zeit kaum ein besseres zu geben vermochten.
Aber die alten norwegischen Kolonien in Grönland verfielen (siehe Kapitel 10) und starben aus, der Seeweg dorthin gerieth in Vergessenheit, und damit verlor man auch die Kenntnisse, die bis dahin gesammelt waren. So läßt es sich denn erklären, daß wir im 17. Jahrhundert wieder auf die vollständigste Unwissenheit in Bezug auf das Land stoßen. Man legte Sunde, „Frobishersträdet“ und den „Beare-Sund“, quer durch dasselbe; ja auf einer Karte des Kartographen Meier aus der Mitte des Jahrhunderts wurde es sogar in eine Unmenge von Inseln zerstückelt, die dicht mit Wald bewachsen sein sollten, „wie in der Gegend von Bergen in Norwegen“.
Nachdem Hans Egede, wie bereits erwähnt, im Jahre 1721 nach Grönland kam und die neuere Kolonisation ihren Anfang nahm, erweiterte sich die Kenntniß der äußeren, nahe am Meer gelegenen Theile des Landes bald wieder, über das Innere scheinen jedoch, wenigstens in Europa, noch lange Zeit hindurch höchst merkwürdige Begriffe geherrscht zu haben.
Es währte indessen nicht lange, bis man sich mit dem Gedanken beschäftigte, die östlichen Kolonien (Oesterbygden), die man an der Ostküste vermuthete (siehe Kapitel 10) quer durch das Land zu erreichen. Schon im Jahre 1723 erhielt Egede von dem Direktor der in Bergen ansässigen Compagnie, die an der Spitze des grönländischen Unternehmens stand, ein Schreiben, in welchem es u. a. heißt:
„Falls es nicht bereits geschehen ist, erscheint es uns rathsam, daß 8 Mann kommandirt werden, die über das Land marschiren[S. 24] können, denn nach der Karte scheint es, daß die Breite nur 12–16 Meilen beträgt, dort, wo es am schmalsten ist, um wenn möglich auf die andere Seite zu gelangen, wo die alten Kolonien gewesen sind, und unterwegs nach Wäldern zu inquiriren. Geschiehet nun aber dies, so da wir gerne sehen würden, da müßte dieser Vorschlag zur ersten Sommerszeit ausgeführt werden, demnächst müßte die Mannschaft jeder mit seinem Ränzel mit Proviant sowie mit einem Gewehr ausgerüstet werden, desgleichen mit einem Kompaß, auf daß sie ihren Weg wieder nach Hause finden können, und drittens hat sich die auskommandirte Mannschaft der größten Vorsicht zu befleißigen, sowohl in Bezug auf die Ueberfälle der Wilden, falls sie solche unterwegs antreffen sollten, wie auch in Bezug auf das Observiren aller Dinge; ja, wo sie passiren, müssen sie an den höchsten Stellen Merkzeichen errichten, die ihnen jetzt und später als Wegweiser dienen können“.[2]
Dies ist ein ganz amüsantes Beispiel, wozu eine Kolonialpolitik führen kann, die von einem Geographen im Lehnstuhl betrieben wird!
Egede[3] besaß indessen Verstand genug, um zu erwidern, daß er in Bezug auf diese Untersuchung keine Möglichkeit sähe, „solche mit Erfolg auszuführen“. Auf die Karten sei kein Verlaß, „sintemalen ich,“ fährt er fort, „in der Circumferenz, in der ich bis dahin gereist habe, so viele Unrichtigkeiten darin finde“. Auch, meint er, würde „der beabsichtigte Marsch wegen[S. 25] der hohen Felsen und der anzutreffenden Schnee- und Eisberge und anderer unwegsamer Strecken ganz beschwerlich fallen“. —
Allmählich, als man mehr umherreiste und mehr von der Natur sah, gleichzeitig auch besser verstehen lernte, was die Eingeborenen zu berichten hatten, eigneten die Europäer, die in Grönland wohnten, sich bald eine richtige Auffassung von dem Innern des Landes an. Bereits wenige Jahre später (1727), ersieht man aus einem Brief aus Godthaab[4], daß man die Auffassung hatte, „daß sich von dem Rücken oder der Mitte des Landes aus nach Süden und Norden zu eine schreckliche Eisfläche oder ein mit Eis bedecktes Gebirge erstreckt“.
Als höchst eigenthümlich kann hervorgehoben werden, daß schon im darauffolgenden Jahr (1728) der Gedanke auftauchte, der erst im Jahre 1888 zur Wirklichkeit werden sollte, nämlich, „daß einige junge, kräftige Norweger, die gewöhnt waren, im Winter in den Bergen auf Schneeschuhen zu laufen, einen guten Theil des Landes nach allen Seiten rekognosciren sollten“.
Wenn man hieraus ersieht, welch’ eine verhältnißmäßig vernünftige Auffassung man stellenweise von dem Lande hatte, so muß es im höchsten Grade überraschend erscheinen, daß im Jahre 1728 an den ersten und einzigen Gouverneur von Grönland, Major Claus Enevold Paars, der Befehl erging, „daß er keinen Fleiß und keine Mühe sparen, sich auch weder durch Gefahren noch Beschwerden abschrecken lassen solle, auf alle erdenkliche Weise und auf irgend einem Wege in die erwähnte östliche Kolonie Oesterbygden zu gelangen, um zu erfahren, ob sich dort noch Nachkommen der alten Norweger befänden, welche Sprache selbige redeten, ob sie noch Christen seien, oder ob sie Heiden geworden, sowie welche Obrigkeit und Lebensweise unter[S. 26] ihnen herrsche. Ferner solle Paars „richtig vermerken,“ u. a. „wie das Land beschaffen sei, ob sich dort Wald, Wiesen, Steinkohlen, Mineralien oder dergl. befänden, ob es dort Pferde, Vieh oder andere, dem Menschen dienliche Kreaturen gäbe“.[5]
Zum Nutzen und Frommen dieser Expedition wurden von Dänemark ausgesandt: 11 Pferde, ein Kapitän, ein Lieutenant; als Gemeine sollte Paars die „Entrepidesten der Godthaaber Garnison“ auswählen.
Daß diese Expedition, welche die erste und in ihrer Anlage gleichzeitig die großartigste aller derjenigen ist, die ausgegangen sind, um das Innere Grönlands zu erforschen, in der Form, in der sie ursprünglich geplant wurde, zu keinem Resultat gelangen konnte, liegt auf der Hand. Die Pferde[6] starben theils unterwegs, theils in Godthaab, und man wird gar bald zu der Einsicht gelangt sein, daß es keine so ganz einfache Sache sei, quer durch das Land zu reiten.
Nichtsdestoweniger unternahm Paars im darauffolgenden Jahr eine Entdeckungsreise bis an das Inlandseis. „Am 25. April 1729 um 12 Uhr ging der Kommandeur mit Lieutenant Richart und Assistent Jens Hjort sowie 5 Gemeinen im Namen des Herrn zu See und hißte die Segel unter Sturm und Schneegestöber.“[7]
Sie segelten weit in den Ameralikfjord hinein, ungefähr 10 Meilen, „worauf ich,“ schreibt Paars,[8] „gegen Bezahlung[S. 27] zwei der dort ansässigen Landsleute mitnahm, um uns den Weg zu zeigen.“
Es ist ein ganz eigenthümliches Zusammentreffen, daß diese erste Expedition den Versuch machte, durch genau dieselbe Gegend auf das Inlandseis zu gelangen, wo die letzte Expedition herauskam. — Ueber diese Eiswanderung berichtet Paars in seinem Rapport an den König mit folgenden Worten:
„Nachdem wir zwei Tage marschirt hatten, gelangten wir am dritten gegen Mittag unter den Eisberg, als wir aber einige Stunden mit großer Lebensgefahr bergan vorgerückt waren, wurden wir im weiteren Vordringen durch die vorhandenen großen Klüfte gehemmt.“ (Hier folgt eine Beschreibung derselben.)
„— — Da wir sahen, daß jegliches Vorwärtsdringen unmöglich war, setzten wir uns auf das Eis nieder, feuerten nach dänischer Weise 9 Schüsse aus unseren Gewehren ab und tranken mit einem Glase Branntwein auf das Wohl unseres allergnädigsten Königs an einem Ort, an welchem dasselbe noch niemals getrunken wurde, welche Ehre auch dem Eisberg bis dahin niemals widerfahren ist; nachdem wir eine Stunde gesessen und uns ausgeruht hatten, kehrten wir wieder zurück.“
Als das „Remarquabelste, das zu sehen war“ führt Paars in erster Linie „große Steine“ an, „die oben auf dem Eise lagen“. Diese, meint er, müßten „absolut durch heftige Winde und Wetter hergeführt sein, wie sie dort in unglaublichem Maße herrschen, denn das Eisgebirge ist anzusehen, als wenn man in das wilde Meer hineinschaut, wo kein Land zu sehen ist, so ist auch hier nichts zu sehen als Himmel und das blanke Eis. Ferner war das Eis, auf dem wir gingen, scharfkantig wie der weiße Zucker-Kandis, so daß man, wenn man über das Eis vordringen will, eiserne Sohlen unter den Schuhen haben müßte, so schlimm war es, auf dem Eise zu gehen.“
[S. 28]
Dies ist das Wichtigste von dem, was Paars selber über seine Thaten und Beobachtungen auf dem Eisberge berichtet. Hieraus ist zu ersehen, daß die Resultate der Expedition in keinem passenden Verhältniß zu den großartigen Vorbereitungen stehen. Wunderbar mag es erscheinen, daß Paars, der nicht weit von dem Ort, an dem wir herunterkamen, auf dem Eise gewesen sein muß, keine Stelle fand, wo er, falls ihm sehr daran gelegen gewesen wäre, weiter hätte vordringen können.
Am 7. Mai langte man wieder in Godthaab an nach der „fatalen und sehr beschwerlichen Reise“.
Ganz ohne Bedeutung ist diese erste Expedition aber doch nicht gewesen, denn wenn sie auch nicht in irgend welchem erheblichen Maße die Anschauungen über das Innere des Landes in der Nähe der Kolonie hat verändern können, da man dort schon vorher durch die Grönländer ganz gute Berichte darüber erhalten hat, — so ist dies im Heimathslande doch sicher der Fall gewesen. Es währte bis zum Jahre 1878, ehe der dänische Staat abermals eine Expedition nach dem grönländischen Inlandseis entsandte.
Im 3. Kapitel (Seite 128) ist bereits erwähnt worden, was in dem 1746 erschienenen Buch „Nachrichten von Island, Grönland und der Straße Davis“[9] von einem Versuch erzählt wird, der darauf hinausging, in das Innere des Landes einzudringen, „und zwar vermittelst der langen Fußbretter, deren sich die Lappen und Andere auf ihren Winterzügen bedienen“. Dieser Bericht ist nicht allein wegen der Erwähnung der Schneeschuhe von Interesse, sondern auch deswegen, daß es das einzige Mal ist, daß[S. 29] des Verlustes von Menschenleben bei den Expeditionen auf das Inlandseis Erwähnung geschieht.
Die erste ein wenig längere Wanderung über ein Stück des Inlandseises, von der wir wissen, wurde im Jahre 1751 von dem Kaufmann Lars Dalager unternommen, der ein wenig nördlich von Frederikshaab, wo er ansässig war, zwei „Nunataks“ besuchte, die eine oder zwei Meilen vom Rande des Inlandseises auf der Südseite von Frederikshaabs Eisblink belegen waren. Diesen Ausflug hat er am Schlusse seines Buches beschrieben, dessen Titel lautet:
„Grönländische Relationen u. s. w., zusammengestellt in der Frederikshaab-Kolonie in Grönland Anno 1752.“
Ende August hatte Dalager die Reise landeinwärts südlich von Frederikshaabs Eisblink aus angetreten.
„Mein Zweck war es,“ sagt er, „mich nach Kräften zu divertiren und nebenbei ein wenig zu schießen“.
Aber er kam bald auf andere Gedanken:
„Bei dieser Gelegenheit resolvirte ich gar bald, eine Reise auch der östlichen Kolonie Oesterbygden über die Eisberge zu machen, von wegen der neuen Entdeckung, die ein Grönländer im verflossenen Juli-Monat gemacht hatte, welcher so hoch oben auf Jagd gewesen war, daß er deutlich die alten Kablunakischen[10] Berge auf der Ostseite sehen konnte.
Dies brachte mich derartig in Bewegung, daß ich wenigstens wie weiland Moses Lust hatte, das Land zu sehen. Ich nahm den vorhin erwähnten Mann, seine Tochter, sowie drei junge Grönländer mit. Wir traten dann unsere Reise an, nachdem wir vorher tief in einen Fjord am südlichen Ende des Eisgletschers hineingerathen waren.“
[S. 30]
Dalager hat sich scheinbar wie alle seine Zeitgenossen stark für die Auffindung der alten norwegischen Kolonie „Österbygden“ interessirt, die man noch nicht gefunden zu haben glaubte, und von der man allgemein annahm, daß sie an der Ostküste Grönlands gelegen haben müsse.
Man verließ den Fjord am 2. September 1751, am 3. September erreichte man den Rand des Inlandseises, „und am 4. gegen Morgen begaben wir uns,“ schreibt Dalager, „auf das Eis, um den ersten Berggipfel zu erreichen, bis zu welchem wir ungefähr eine Meile hatten. Der Weg dorthin war gerade so schlicht und eben wie auf den Straßen in Kopenhagen, der einzige Unterschied schien mir darin zu bestehen, daß es hier etwas glatter war. Dagegen hatte man aber nicht nöthig nach den Seiten auszuweichen und im Schmutz zu waten, aus Furcht, von den Pferden und Wagen des Postmeisters übergefahren zu werden.“
Am nächsten Morgen zog man weiter nach dem obersten Berge auf dem Eisfelde, dem Omertlok, der auch ungefähr eine Meile entfernt lag, zu dem der Weg aber sehr uneben war, voller Spalten und Risse, so daß die Wanderung 7 Stunden in Anspruch nahm.[11] Von dem Gipfel dieses Berges hatte man eine weite Aussicht über das Eis, und in der Ferne über dem Eisrand im Nordosten wurden einige Berggipfel sichtbar. Diese hielt Dalager für die Berge auf der Ostküste Grönlands; wie[S. 31] unten näher erklärt werden wird, stellte es sich aber später heraus, daß es Nunataks waren, die nur wenige Meilen von dem westlichen Rande des Inlandseises entfernt lagen (Jensens Nunataks.)
„Als wir auf dem Gipfel des Berges angelangt waren,“ sagt er, „verfielen wir in Verwunderung über den großartigen Prospekt nach allen Seiten hin, namentlich über das weitläufige Eisgebirge am Lande entlang und quer hinüber bis nach „Öster-Böyden“, dessen Berge ebenso wie diese mit Schnee bedeckt waren.“
Auf diesem Gipfel blieb man bis um 7 Uhr des Abends, dann schloß Dalager „mit einer Rede an die Grönländer, die von den ehemaligen Bewohnern von Öster-Böyden, von ihrem leiblichen wie geistigen Wohlergehen handelte“.
„Indessen ging die Sonne unter, weshalb wir uns eine Strecke bergab begaben und uns schlafen legten.“
Dalager wäre gern weiter landeinwärts gedrungen, sah sich aber aus mancherlei Ursachen genöthigt, auf die Heimreise bedacht zu sein; „einer der wichtigsten Gründe war, daß wir so gut wie barfuß gingen. Denn obwohl ein Jeder von uns für die Reise mit zwei Paar guten Stiefeln versehen war, so waren sie doch schon jetzt infolge der Schärfe des Eises und der Steine fast völlig verschlissen. Und da die eigens von uns mitgenommene Jungfer zum großen Unglück ihre Nähnadeln verloren hatte, konnten wir nichts flicken, weswegen wir sehr bestürzt waren,[S. 32] doch trösteten wir einander mit Gelächter, wenn wir die nackten Zehen aus den Stiefeln herauskriechen sahen.“
Am folgenden Tage (den 6.) traten sie deswegen den Heimweg an, und am 8. September gegen Abend erreichten sie den Zeltplatz unten am Fjord, „und — schließt Dalager — kann ich nicht unterlassen, hier zu melden, mit welch sonderlichem Appetit ich an dem Abend eine ganze Flasche portugiesischen Wein leerte, worauf ich bis um die Mittagsstunde des nächsten Tages schlief.“
Dalager giebt eine Beschreibung von dem, was er da drinnen erblickt. Hierin äußert er weit weniger Furcht, über das Inlandseis zu gehen, als viele seiner Nachfolger bis in die spätesten Zeiten davor zeigen. Er sagt u. a.:
„Um im übrigen meiner Ansicht über die große Eisfläche Ausdruck zu geben, die uns verhindert, mit Öster-Böyden in Kommunikation zu stehen, so glaube ich, daß es in Bezug auf die Wege praktikabel ist, sintemalen es mir erscheint, als seien die Eisberge lange nicht so gefährlich wie man sie verschrieen hat, und auch die Spalten nicht so tief, wie man behauptet“ u. s. w. Aus anderen Gründen hält er es indessen für eine Unmöglichkeit; so sagt er weiterhin: „Aber trotzdem bleibt es doch impraktikabel, auf einer solchen Reise zu reüssiren, aus den Gründen nämlich, daß man nicht so viel Mundportion mit sich schleppen kann, als wie man zu einer solchen Reise billig bedarf, demnächst die unerträgliche, harte Kälte; ich halte es für fast ganz unmöglich, daß irgend eine lebende Kreatur respiriren kann, wenn sie gezwungen ist, viele Nächte auf dem Eisfelde zu kampiren“ u. s. w.
Hier folgt eine ganz merkwürdige Beschreibung der Kälte, die so groß war, daß, obwohl sie alle gut gekleidet waren, und keiner von ihnen gerade ein Weichling war, „trotzdem die Glieder[S. 33] sich gleichsam zusammenzogen“, sobald sie sich eine Stunde auf dem Berge niederließen oder niederlegten. „Ich für mein Theil hatte als Unterbekleidung zwei gute Jacken und darüber einen Rennthierpelz. Des Nachts wickelte ich mich in einen schönen, doppelt gefütterten Mantel und steckte die Füße in einen Sack von Bärenfell. Aber doch war dies alles nicht im stande, mich warm zu halten.
Ich kann sagen, daß in den vielen harten Winternächten, die ich in Grönland auf dem Felde kampirt habe, mich niemals die Kälte so inkommodirt hat, wie in diesen ersten Septembernächten.“
Diese bis dahin wenig beachtete Beschreibung theilt uns deutlich genug die ersten uns bekannten Beobachtungen der starken Kälte mit, welche durch die Ausstrahlung verursacht wird, und die wir in demselben Monat auf dem Inlandseise antrafen.
Nach Dalager und bis weit in unser Jahrhundert hinein wissen wir nur von wenigen Europäern, die das Inlandeis besucht oder betreten haben.
Einer dieser Wenigen ist der im vorigen Jahrhundert lebende grönländische Naturforscher, der Priester Fabricius, von dessen Hand wir eine Abhandlung über die Eisverhältnisse in Grönland besitzen.[12] Diese ist nach verschiedenen Seiten hin merkwürdig für die damalige Zeit und giebt einen ganz guten Begriff von den Eisbildungen in Grönland. Es geht daraus hervor, daß Fabricius das Inlandseis besucht haben und auf demselben gewesen sein muß.
Der deutsche Mineralog Giesecke hatte während seiner 8jährigen Reise in Grönland (1806–13) mehrmals Veranlassung,[S. 34] den Rand des Inlandseises zu besuchen. Eine Auffassung von der wissenschaftlichen Bedeutung des Inlandseises hatte er indessen ebenso wenig wie andere Geologen seiner Zeit, und folglich trug er nichts von Bedeutung zur Förderung der Kenntniß desselben bei. Er machte dagegen seinen Eindrücken Luft in begeisterten Worten über die wilde Schönheit dieser Eisregion. Von einem Besuch des Eisgletschers bei Korok (oder wie er ihn nennt Kororsuak) in der Nähe von Julianehaab erzählt er, daß er, nachdem er ungefähr eine halbe Meile „auf dieser Polarbrücke“ zurückgelegt hatte, durch eine tiefe Spalte gehemmt wurde. „Ich legte mich auf den Magen und ließ einen 100 Fuß langen Faden, an dessen Ende ich einen Stein befestigt hatte, in die Eisschlucht hinabgleiten, ohne jedoch den Grund damit zu erreichen. Dann verließ ich diese gefährliche Promenade, von der ich mir keine Ausbeute für meine Zwecke versprechen konnte.“[13]
Nun verstreicht eine lange Zeit, in welcher das Innere Grönlands alles Interesse verloren zu haben scheint. Es war ja nun einmal festgestellt, daß man Oesterbygden auf alle Fälle nicht am leichtesten auf diesem Wege erreichen konnte, und daß von dem Inneren schwerlich Reichthümer zu erwarten waren. Die Vorstellungen, die man von dem Inlandseise hatte, scheinen indessen keineswegs klar gewesen zu sein, die sonderbarsten Phantasien wucherten üppig, und Einzelne glaubten, daß sich hinter der Eismauer fruchtbare Gefilde erstreckten, von denen die Rennthiere kämen und wohin sie sich zurückzögen.
In der Mitte dieses Jahrhunderts wurde dann durch die Arbeit eines Mannes eine neue Zeit für unsere Kenntniß des grönländischen Inlandseises eingeleitet. Dieser Mann war Dr. H. Rink.
[S. 35]
Durch eine Reihe gründlicher Arbeiten, welche die Früchte vieljähriger Reisen und Untersuchungen in Grönland waren, wo er sich längere Zeit theils als Naturforscher, theils als Kolonie-Direktor und theils als Inspektor aufhielt, leitete Dr. Rink die Aufmerksamkeit der Gelehrtenwelt auf Grönlands mächtiges Eisfeld und man machte die Entdeckung, daß es von ebenso hoher Bedeutung für die wissenschaftliche Welt war, wie man es früher für arm und interesselos gehalten hatte.

Rink wies nach, welche Mächtigkeit diese Eisdecke haben müsse, und welche enormen Eismassen jährlich von Grönland entsandt würden, da dies das einzige Land auf der nördlichen Halbkugel ist, auf dem größere Eisberge ihren Ursprung haben. Er hat später ausgerechnet, daß aus jedem der größeren Eisfjorde jährlich mehr als 1000 Millionen Kubikellen Eis ins Meer hinausgeführt werden.
[S. 36]
Es war gleichsam eine ganz neue Welt, die durch diese Abhandlungen über das Inlandseis und seine Wirkungen der Wissenschaft erschlossen wurde. Freilich hatten schon mehrere Naturforscher, darunter der bekannte Louis Agassiz, die Vermuthung aufgestellt, daß möglicherweise einstmals große Flächen Inlandseis existirt haben. Hier aber handelte es sich um ein noch jetzt vorhandenes Inlandseis, und es wurde den Geologen klar, daß große Theile von Europa und Amerika einstmals, sowie Grönland jetzt mit Eis bedeckt gewesen sein müssen, und daß hiervon die vielen Streifen und Furchen herrühren, die wir in den Felsen finden, die vielen Moränen und die vielen erratischen Blöcke, die über ganz Nord-Europa, oft an den überraschendsten Orten zerstreut liegen. Die Lehre von der großen Eiszeit entwickelte sich, und für die Geologie brach eine neue Zeit an.
Die Nothwendigkeit, ausgedehntere Beobachtungen an dem einzigen Ort zu machen, an welchem noch heute ähnliche Verhältnisse obwalten wie zu jener Eiszeit, stellte sich gar bald heraus, und es wurde eine ganze Reihe neuer Versuche gemacht, in das Inlandseis Grönlands vorzudringen.
Den Anfang dieser Reise machte die Foxexpedition, die im Jahre 1860[14] unter der Leitung von Sir Allan Young ausgesandt wurde, wenngleich sie nicht geologischer Natur war. Es war ursprünglich, wahrscheinlich angeregt durch Oberst Schaffner, die Rede davon, eine Schlittenexpedition unter der Führung von Dr. John Rae, der hierin nicht wenig Erfahrung hatte, an der Ostküste von Grönland an Land zu[S. 37] setzen, um über das Inlandseis nach der Westküste zu gelangen und dadurch zu untersuchen, ob es eine Möglichkeit sei, auf diesem Wege einen Telegraphenkabel hinüber zu legen. Als man sich Mitte September der südlichen Ostküste näherte, wo nach Sir Allan Young’s Ausspruch (siehe Bd. I S. 288) eine Landung möglich war, scheinen sich Bedenken eingestellt zu haben, — man umschiffte das Kap Farvel bis zur Westküste. Hier machte Dr. Rae in Begleitung von Oberst Schaffner in den letzten Tagen des Oktober und den ersten Tagen des November von der Kolonie Julianehaab aus einen Versuch, in das Inlandseis einzudringen. Nach der Schilderung, die Lieutenant Zeilau,[15] der selber an der Expedition theilnahm, davon giebt, scheint es, als wenn Dr. Rae und sein Gefolge nur so weit vordrangen, daß sie „einen Blick zum Inlandseis hinaufsenden konnten“. Aus Dr. Raes eigenem Bericht geht indessen hervor, daß er wirklich seinen Fuß auf das Inlandseis gesetzt haben muß, daß er aber gleich auf eine sehr tiefe und breite Kluft stieß, die seinem weiteren Vordringen ein unüberwindliches Hinderniß in den Weg stellte.[16] Eine merkwürdige Kluft!
Im selben Jahre (1860), ebenfalls im Oktober, machte der amerikanische Polarfahrer Dr. Hayes den Versuch, nördlich vom Porte Foulke auf dem 78° 18′ N. Br. in das Inlandseis einzudringen. Nach Dr. Hayes Angabe begann er die Wanderung am 22. Oktober und kehrte erst nach 6 Tagen zurück. Am ersten Tage erreichte man den Rand des Inlandseises, und am nächsten wurde die Wanderung über dasselbe angetreten. Man will an diesem Tage 5 englische Meilen auf dem Inlandseise[S. 38] zurückgelegt haben, am dritten Tage 30, am vierten Tage 25 englische Meilen, und dies alles theils auf dem allerunebensten Eise, theils auf sehr schwierigem Schnee, wo die Füße bei jedem Schritt die Kruste durchbrachen, welche den Schnee bedeckte. Auf welche Weise diese Entfernungen bestimmt wurden, davon verlautet nichts. Am fünften Tage will man durch einen sehr kalten und feuchten Wind zur Umkehr gezwungen worden sein, man will an dem Tage ca. 40 englische Meilen zurückgelegt haben. An dem dann folgenden Tage langte man bereits wieder im Winterhafen an. Hayes giebt eine haarsträubende Beschreibung von den Strapazen und von der Kälte, die, obwohl sie nicht so groß war wie auf unserer Expedition (das Thermometer fiel nur bis auf −34° Fahr.), ihnen doch beinahe das Leben raubte. Es muß höchst wunderlich erscheinen, daß diese tapferen Fußgänger sich sofort durch die Kälte bezwingen ließen.
Die Schilderung dieser Wanderung, die Dr. Hayes veranlaßt, in einem besonderen Kapitel die wichtigen wissenschaftlichen Resultate u. s. w. zu besprechen, muß einem aufmerksamen Leser schon beim ersten Blick verdächtig erscheinen. Für Denjenigen, der die Verhältnisse genauer kennt, wird es keines tieferen Nachdenkens bedürfen, um einzusehen, daß es eine völlige Unmöglichkeit ist, 25, 30, ja sogar 40 Meilen an einem Tage auf Schnee von der von Dr. Hayes beschriebenen Beschaffenheit, und mit dem erforderlichen Gepäck auf einem Schlitten, zurückzulegen. Es ist, wenn nicht geradezu eine Unmöglichkeit, doch ein Stück Arbeit, wie man es Dr. Hayes und seinen Begleitern kaum zutraut, und selbst wenn man nichts weiter über die Zuverlässigkeit des Verfassers wüßte, würde man solchen Angaben gegenüber seine Zweifel erheben. Ruft man sich indessen ins Gedächtniß zurück, was De Bessels in Bezug auf Dr. Hayes Breitenmessung nachgewiesen hat, — daß er eine[S. 39] verkehrte Observation angegeben haben muß, um glauben zu machen, daß er nördlicher war, als er in Wirklichkeit gewesen, — da muß der Zweifel zur Gewißheit werden.
Die hier angeführten Thatsachen müssen ohne weitere Kommentare genügend erscheinen, um Jedermann davon abzuhalten, wissenschaftliche Schlußfolgerungen aus diesem Bericht zu ziehen. Es ist um so mehr zu beklagen, als es die einzigen Aufzeichnungen sind, die wir über eine Eiswanderung in dem nördlichen Theile Grönlands besitzen.
Im Jahre 1867 machte der bekannte englische Bergbesteiger Edward Whymper einen Versuch, von einem kleinen Fjord (ungefähr auf dem 69° 25′ N. Br.) Ilordlek nördlich von Jakobshafen in das Inlandseis einzudringen. Whymper war der Ansicht, daß er möglicherweise eisfreies Land im Innern Grönlands vorfinden würde, und daß es nicht unmöglich sei, daß dies Land aus „losgelösten Landmassen oder Inselgruppen bestehe, wie man sie überall in den arktischen Gegenden antrifft. Die Entfernung der Ostküste des Landes bis zur Westküste war hinreichend groß, um das Vorhandensein unbekannter Fjorde und Einschnitte der See möglich erscheinen zu lassen“. Daß dort eisfreies Land sein müsse, glaubte er aus dem periodischen Auftreten und Verschwinden großer Rennthierheerden an der Westküste schließen zu können. Diese Thiere mußten aller Wahrscheinlichkeit nach „grasreiche Thäler und Zufluchtsstätten“ im Innern haben, wohin sie sich zeitweise zurückzogen.[17] Wie ersichtlich, hat dies Raisonnement viel Aehnlichkeit mit dem Ausspruch, den der[S. 40] Verfasser des „Königsspiegels“ bereits 400 Jahre früher gethan (siehe Bd. II. S. 22).
Whymper hatte es sich als Ziel gesetzt, bis zu diesen schneefreien Stellen vorzudringen, und seine im Jahre 1867 unternommene Reise scheint nur eine vorbereitende Tour für eine etwaige größere Expedition gewesen zu sein.
Nachdem er am 15. Juni bis Jakobshafen an der Diskobucht vorgedrungen war, unternahm Whymper drei Tage später mit einem aus Eskimos bestehenden Gefolge seinen ersten Ausflug an den Rand des Inlandseises, ein wenig landeinwärts von dem südlichen Arm des Ilordlek-Fjords, der 20 englische Meilen nördlich von der Kolonie gelegen war. Es war seine Absicht, zu untersuchen, inwiefern sich dieser Ort für den Beginn einer Eiswanderung eignete, und ob Hunde und Schlitten, die man dazu benutzen wollte, zweckmäßig seien. Das Aussehen des Inlandseises zeigte sich schon bei dem ersten Blick, den Whymper darauf warf, weit ebener und weniger abschreckend, als er es erwartet hatte, und man unternahm sogleich einen Ausflug in dasselbe.
Sie drangen ohne Schwierigkeit vor, und je weiter sie kamen, desto besser und härter wurde der Schnee. Nachdem sie ungefähr 6 englische Meilen zurückgelegt und eine Höhe von 1400 Fuß erreicht hatten, schien sich das Terrain, soweit ihr Blick reichte, nicht zu verändern, deshalb hielten sie es für zwecklos, weiter vorzudringen; sie hatten erreicht, was sie wünschten, sie hatten gesehen, daß sich die Schneefläche vorzüglich für eine Fahrt mit Hundeschlitten eignen würde, und die Eskimos, die sich in ihrem Gefolge befanden, versicherten Whymper, daß sie auf diesem Schnee bequem „35 bis 40 Meilen (engl.) pro Tag“ zurücklegen könnten.
So kehrten sie den mit den besten Hoffnungen auf einen[S. 41] günstigen Ausfall ihrer Reise zurück, „denn es schien ihnen nichts vorhanden zu sein, was einer Wanderung quer durch Grönland hemmend in den Weg treten konnte“.
Da das Inlandseis bei Ilordlek nicht ganz an den Fjord hinunterreicht, wollte Whymper versuchen, einen günstigen Ort zu finden, wo dies der Fall war und von wo aus sie dann gleich ihre Eiswanderung antreten konnten, ohne erst ihr Gepäck über Land zu schleppen.
Zu diesem Zweck unternahm er dann am 24.-27. Juni noch einen Ausflug an den Rand des Inlandseises, diesmal südlich von Jakobshafen nach dem bekannten „Jakobshavnsisfjord“. Hier war indessen das Eis so zerklüftet und uneben, daß von einem Vordringen mit Hundeschlitten keine Rede sein konnte, und man entschloß sich deswegen, den vorhin besuchten Ort zum Ausgangspunkt der Expedition zu nehmen.
Zu diesem Unternehmen bedurfte es indessen einer Reihe von Vorbereitungen, welche Whymper die verzweifeltsten Schwierigkeiten machen sollten. Gerade um diese Zeit raste eine tödtliche Seuche (Brustkrankheit, „brystsyge“) in den Kolonien an der Diskobucht, die Jung wie Alt dahinraffte. Von Jakobshafens 300 Einwohnern lagen 100 krank darnieder. Dies lähmte alle Unternehmungslust. Unglücklicherweise waren außerdem auch noch die meisten brauchbaren Schlittenhunde in der Umgegend ganz kürzlich einer Hundeseuche erlegen, weswegen es große Schwierigkeiten machte, die nöthige Anzahl von Hunden aufzutreiben.
Das Material für die hölzernen Hundeschlitten hatte Whymper aus Europa mitgebracht, aber die Wenigen, welche Schlitten verfertigen konnten, waren vollauf in Anspruch genommen durch das Zimmern von Särgen für alle Diejenigen, die an der vorhin erwähnten Seuche starben. So blieb denn[S. 42] nichts weiter übrig, als gewöhnliche grönländische Hundeschlitten zu benutzen, die aus schlechtem Material angefertigt und keineswegs für eine solche Expedition geeignet waren. Als Nahrungsmittel für die Theilnehmer der Expedition wie für die Hunde hatte man sich mit Hudsonbay-Pemikan versehen. Da es sich indessen herausstellte, daß die grönländischen Hunde diesen Stoff nicht fressen wollten, so mußte man gedörrtes Seehundsfleisch von allen Ecken und Kanten zusammensuchen. Dies war freilich leichter gesagt als gethan, denn da die Mehrzahl der guten Seehundsfänger krank darniederlag, herrschte in der ganzen Gegend fast eine Hungersnoth.
Endlich waren dann die meisten Schwierigkeiten so ziemlich überwunden, und am 20. Juli konnte die Inlandsexpedition, die außer Whymper aus drei Eskimos und zwei Europäern bestand, aufbrechen. Einer der Letzteren war der Engländer Robert Brown, der sich in England dem Unternehmen angeschlossen hatte.
Nachdem man einige Tage damit hingebracht hatte, die Bagage vom Ufer des Fjords an den Rand des Inlandseises zu schaffen, mußte man noch drei Tage warten, da man die Eiswanderung wegen eines anhaltenden Windes nicht antreten konnte.
Inzwischen bestieg Whymper einen nahegelegenen Hügel, um eine Aussicht über das Eis zu haben; wie unangenehm sah er sich aber berührt, als er die überraschende Entdeckung machte, daß das Eis sein Aussehen vollständig verändert hatte, seit er es vor einem Monat gesehen. Damals war alles mit dem „reinsten, fleckenlosesten Schnee“ bedeckt gewesen; jetzt aber war aller Schnee vollständig geschmolzen und hatte ein wahres Meer von Eis hinterlassen, daß von Millionen von Spalten und Rissen in allen erdenklichen Formen und Dimensionen durchkreuzt war. Alle kühnen Hoffnungen Whympers waren zu Wasser geworden.[S. 43] Als das Wetter am 26. Juli besser wurde, machten sie trotzdem einen Versuch, östlich über das Eis vorzudringen. Nach wenigen Stunden, und nachdem sie sich nur ein paar englische Meilen vom Rande des Eises entfernt hatten, mußten sie jedoch Halt machen, da eine Schiene an einem der größten Schlitten zerbrach. An einem der kleineren Schlitten war auch bereits eine der Schienen der Länge nach gespalten, und der Rest war durch die Stöße auf dem unebenen Eise sehr gebrechlich geworden.
Whymper sah jetzt die Unmöglichkeit ein, weiter vorzudringen, doch sandte er der Form halber drei seiner Begleiter[18] eine oder zwei englische Meilen weiter landeinwärts, um zu untersuchen, ob das Eis besser würde, obwohl er sehr gut wußte, daß es viele Meilen weit unverändert war. Als die Sendboten wiederkehrten und berichteten, daß das Eis eher schlechter als besser werde, trat man den Rückweg an.
Nach dieser Reise scheint Whympers Glaube an schnee- oder eisfreie Strecken im Innern Grönlands erschüttert zu sein. In seinem Buch: „Scrambles amongst the Alps“ 1871 schreibt er Seite 246: „Grönlands Inneres scheint vollständig mit Gletschereis bedeckt zu sein zwischen dem 68° 30–70° N. Breite.“ Weil er auf der letzten Expedition, soweit das Auge reichte, zerklüftetes Gletschereis erblickte, vermuthet er, daß sich das Eis oder das schneebedeckte Land in einer bedeutenden Ausdehnung erstrecken muß, „denn zur Bildung einer so ungeheueren Gletschermasse ist ein ganz kolossales Schneereservoir erforderlich.“ Er taxirte die Höhe des inneren sichtbaren Theils des Inlandseises[S. 44] auf „nicht weniger als auf 8000 Fuß“. Dies ist wahrscheinlich reichlich hoch gegriffen, wird aber die richtige Höhe nicht weit übertreffen.
Mit der Wanderung, welche der Freiherr A. E. Nordenskjöld gemeinsam mit dem jetzigen Professor Berggren von dem nördlichen Arm des Aulatsivikfjordes (südlich von Egedesminde auf dem 68° N. Br.) auf das Inlandseis unternahm, beginnt so zusagen eine neue Phase in der Geschichte der grönländischen Eiswanderungen.
Es ist dies das erste Mal, daß menschliche Wesen eine längere Strecke auf dem Inlandseise vordringen und mehrere Tage hintereinander auf demselben verbringen, wie es auch die erste Expedition ist, die eine Ausbeute von mehr wissenschaftlicher Natur hat.[19]
Am 19. Juli 1870 verließen die beiden Reisenden in Begleitung von zwei Grönländern den Eisrand in der Nähe des Fjordes. Sie hatten Proviant für 30 Tage mitgenommen. Ein Zelt hatten sie nicht, sie schliefen in zwei Schlafsäcken, die an beiden Enden offen waren, und in die sich zwei Personen mit den Füßen gegeneinander zur Noth hineinzwängen konnten. Dies Lager war indessen, wie Nordenskjöld berichtet, mit dem unebenen Eis als Unterlage sowohl unbequem als auch kalt. Die ganze Ausrüstung der Expedition wurde auf einen Schlitten gezogen.
Man war indessen nicht weit vorgedrungen, als es sich infolge des unebenen Eises herausstellte, daß es eine Unmöglichkeit war, sich mit einer so großen Ausrüstung abzumühen. Deswegen beschloß Nordenskjöld schon am zweiten Tage[S. 45] einen Theil des Proviants sowie den Schlitten zurückzulassen. Den Rest der Bagage nahm man auf die Schultern und setzte nun die Wanderung fort.
Am 21. Juli, als sie sich 36 Längsminuten östlich vom Fjord und 440 m über dem Meeresspiegel befanden, weigerten die Grönländer sich weiter zu gehen und kehrten auch wirklich am folgenden Morgen um. Die beiden energischen Europäer hatten jedoch noch nicht genug gesehen, sie setzten ihre Wanderung noch zwei Tage länger fort.
Am 22. Juli um 12 Uhr befanden sie sich auf dem 68° 22′ N. Br. und 56 Längsminuten östlich vom Zeltplatz am Fjord, in einer Höhe von fast 640 m über dem Meeresspiegel.
Am folgenden Tage (23. Juli) machten sie für die Nacht Halt auf dem 68° 22′ N. Br. und 76 Längsminuten östlich vom Fjord in einer Höhe von 600 m, also merkwürdigerweise niedriger als am vorhergehenden Tage.
Sie waren jetzt des Proviants wegen gezwungen, zurückzukehren, um aber eine Aussicht über das Inlandseis zu haben, drangen sie doch am folgenden Tage bis zu einer weiter landeinwärts gelegenen Höhe vor, alles Gepäck an dem Ort zurücklassend, wo sie übernachtet hatten. Von dem Gipfel dieser Höhe sahen sie, daß das Inlandseis, soweit das Auge reichte, sanft anstieg, ohne durch Felspartien unterbrochen zu werden, so daß der Horizont nach Osten, Norden und Süden von einem Eisrand begrenzt wurde, der fast so eben war wie das Meer. Der Wendepunkt lag in einer Höhe von 690 m über dem Meeresspiegel und ungefähr 83 Längsminuten oder 56 Kilometer östlich von dem nördlichen Arm des Aulatsivikfjordes. Die zurückgelegte Entfernung betrug folglich circa 11 Kilometer pro Tag.
[S. 46]
In der Nacht zwischen dem 25. und 26. Juli kamen sie wieder an den Fjord zurück, nachdem sie im ganzen 7 Tage auf dem Inlandseise zugebracht hatten.
Von dem Eis, über das die Expedition wanderte, giebt uns Nordenskjöld eine ausführliche Beschreibung, die durch unterwegs von Berggren aufgenommene Zeichnungen illustrirt wird. Es war in der Regel von tiefen und zum Theil breiten Spalten durchfurcht oder voller Unebenheiten bis zu einer Höhe von 12 m mit einer Abschrägung nach den Seiten zu von 25 bis 30°. Ein Hinderniß, das auch in nicht geringem Maße das Vordringen erschwerte, bildeten die vielen reißenden Bäche, die in tiefen Rinnen oben auf dem Eise flossen, und die oft nicht passirt werden konnten und deswegen umgangen werden mußten. Sie endeten gewöhnlich in großen Höhlen im Eise, sog. Gletscherbrunnen, in die sie sich als brausende Wasserfälle stürzten, um in der blauschwarzen Tiefe zu verschwinden. An einer Stelle stieß man auch auf einen Springbrunnen oder auf einen „intermittierten, mit Luft vermischten Wasserstrahl“, der in die Höhe sprang. Auch viele kleinere Seen befanden sich auf der Oberfläche; diese hatten keinen sichtbaren Abfluß trotz der zahllosen Bäche, die sich in sie ergossen. „Wenn man das Ohr gegen das Eis hielt, so vernahm man von allen Richtungen her ein eigenthümliches unterirdisches Brausen, das von den durch das Eis strömenden Bächen herrührte, und ein kanonenartiges Gedröhn zeugte von Zeit zu Zeit von der Bildung einer neuen Gletscherspalte.“
Das Wetter war während der ganzen Wanderung klar. Die Wärme stieg am Tage ein Stück über dem Eise „bis zu +7 bis 8° im Schatten und in der Sonne bis zu +25 bis 30° C. Nach Sonnenuntergang froren dagegen die Wasserlachen, und während der Nacht wurde es oft empfindlich kalt.“
[S. 47]
Dies sind scheinbar schon im kleinen Observationen der merkwürdigen Temperaturverhältnisse, die in Grönlands Innerem ausfindig zu machen, uns vergönnt war.
Das Merkwürdigste, was bei dieser Expedition vorgekommen ist, und was ein gewisses wissenschaftliches Aufsehen erregte, ist indessen die erste Beschreibung des sogenannten Eisstaubes oder Kryokonit. Darunter versteht man ein feines graues Pulver, das, soweit man vordrang, über das Eis ausgebreitet war. Durch das Einsaugen der Wärme von den Sonnenstrahlen war dasselbe in das Eis hinein geschmolzen und hatte lothrechte cylindrische Löcher von 1–2 Fuß Tiefe und von ein paar Linien bis zu ein paar Fuß Quermaß gebildet, die so dicht nebeneinander lagen, daß man vergebens einen Platz für den Fuß, geschweige den für den Schlafsack suchte. Auf dem Boden dieser stets mit Wasser angefüllten Löcher lag der Staub in einer Schicht von mehreren Millimetern.
Diesem Staube legt Nordenskjöld eine große Bedeutung bei; er nimmt nämlich an, daß er von kosmischem Ursprung ist, infolgedessen ist er mit der ganz neuen Theorie hervorgetreten, daß die Erde, wenigstens doch zum Theil, durch eine fast unmerkliche, stete Zufuhr von kosmischem Staub, der aus dem Universum herrührt, gebildet ist und noch immer wächst. Andere haben dagegen später nachgewiesen, daß dieser Staub in seiner Zusammensetzung auffallend dem Material der Küstenfelsen gleicht, weshalb sie meinen, daß der Staub von diesen Felsen aus auf das Eis geweht ist. Hierfür spricht der Umstand, daß die Staubmenge in demselben Grade abnimmt, in welchem man sich von den Küstenfelsen entfernt, und daß wir an der Ostküste von Grönland bei Umivik, wo das bloße Land am Eisrande fast verschwindend ist, fast keinen Staub auf dem Eise vorfanden.
Ein Jahr nach dieser bedeutungsvollen Eiswanderung (1871)[S. 48] wurde von dem Inspektor Nordwestgrönlands, Krarup Smith, eine Inlandsexpedition unter Führung des Assistenten Möldrup[20] ausgesandt. Den Erkundigungen zufolge, die Nordenskjöld später in Grönland eingezogen hat, scheint die Expedition unverrichteter Sache zurückgekehrt zu sein.[21]
In dem dann folgenden Jahr kam Whymper abermals nach Grönland zurück und bereiste den Distrikt nördlich von der Diskobucht und beim Umanak-Fjord. Diesmal machte er indessen keinen Versuch, wieder auf das Inlandseis einzudringen, er beschränkte sich darauf, hohe Felsgipfel am Rande des Inlandseises zu besteigen, um sich eine Aussicht über dasselbe zu verschaffen. Am 18. August bestieg er einen 6800 engl. Fuß hohen Berg Kelertinguit bei Umanak. Von dem Gipfel dieses Berges hatte er eine weite Fernsicht über das Inlandseis und fand seine frühere Ansicht bestätigt, daß ein ebener, zusammenhängender Rücken von schneebedecktem Eis „das Land so vollständig verdecke, daß keine Berghöhe sich auf der Oberfläche zeigte“. Mit einem Theodolit maß er den Winkel bis zu dem sichtbaren Rand des Inlandseises und schloß, daß derselbe „bedeutend über 10000 Fuß“ betragen muß. Whymper scheint nun zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, daß im Innern keine schneefreien Strecken zu finden seien, denn er sagt, „daß die an verschiedenen Stellen vorgenommenen Untersuchungen es zweifellos erscheinen lassen, daß Grönlands Inneres vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen vollständig in Schnee und Eis gehüllt ist“.[22]
[S. 49]
Die Aufmerksamkeit, welche Dr. Rinks Schriften über das grönländische Inlandseis zuerst erregten, hatte inzwischen gute Früchte getragen. Durch theils in Grönland, theils in den Alpen und in Skandinavien angestellte Untersuchungen hatte die Erforschung von Schnee und Eisgletschern, ihrer Wirksamkeit wie alles dessen, was damit in Verbindung stand, riesenhafte Fortschritte gemacht, und die Lehre von der Eiszeit hatte eine feste Form angenommen. Unter den Männern, die sich an dieser Arbeit betheiligten, können von skandinavischen Geologen erwähnt werden: die Norweger Kjerulf und Sexe, sowie der Schwede Torell, der im Jahre 1859 in Grönland war.
Als man indessen mit dieser Arbeit weiter fortschritt, wurde der Gedanke rege, daß das frühere Inlandseis nicht allein ganz Skandinavien und das nördliche Europa bedeckt, sondern auch im wesentlichen dazu beigetragen hat, den Ländern, die es bedeckte, ihr Aussehen und ihre Form zu geben, indem die Eis- oder Wandergletscher, die lose liegenden Kies und Steine mit sich führten und sich in die Unterlage, über die sie sich hinbewegten, eingruben, im wesentlichen dazu beigetragen haben, tiefe Thäler und Fjorde zu bilden, wie wir sie z. B. in Skandinavien und besonders im westlichen Norwegen finden. Diese Lehre fand einen eifrigen Anhänger in dem englischen Geologen Ramsay. Ein Umstand, der stark für diese Annahme zu sprechen schien, war die Thatsache, daß diese durch tiefe Thäler und Fjorde zerklüfteten Länder sich stets dort vorfinden, wo man Spuren der Eiszeit nachweisen kann, und zwar nur dort allein.
Von vielen Geologen wurde diese Lehre indessen stark angegriffen, und eine der Waffen, deren man sich bediente, war die Thatsache, daß alle Gletscher in Europa, die man kannte und untersucht hatte, eine sehr geringe Wanderschnelligkeit besaßen, höchstens 2 Fuß in 24 Stunden, und aus der Reibung, die sie[S. 50] hervorbringen konnten, ließ sich auch nicht annähernd die riesenhafte Arbeit erklären, die sie früher vollbracht haben sollten.
Da reiste im Jahre 1875 der norwegische Geologe Amund Helland, der sich sehr für die Studien über die Wirkungen der Eiszeit in Norwegen interessirte, und der viele merkwürdige Verhältnisse nachgewiesen hatte, die damit in Verbindung standen, nach Nord-Grönland, um dort die Geschwindigkeit der Bewegung der Gletscher und ihre Wirkungen zu studiren.
Die Reise, welche in den Monaten Juni, Juli und August (1875) unternommen wurde, umfaßte die Strecke von der Kolonie Egedesminde (68° 42′ N. Br.) bis zum Fjord Kangerdlugssuak (ungefähr 71° 15′ N. Br.) im Distrikt der Kolonie Umanak. Er besuchte fünf mit Eis angefüllte Fjorde und zahlreiche kleinere Gletscher, unter denen der Gletscher am innern Theil des Ilordlek-Fjordes, von wo aus er das Inlandseis bestieg, also an demselben Ort, an dem Whymper seinen ersten Versuch machte.
Die Ausbeute, welche diese Reise ergab, war besonders nach einer Richtung hin erstaunlich. Statt der bis dahin bekannten Bewegung von höchstens 2 Fuß in 24 Stunden entdeckte Helland u. a., daß der mächtige Gletscher im Eisfjord von Jakobshafen sich mit einer Geschwindigkeit von 64 Fuß (19,54 m) in 24 Stunden bewegte. Ein anderer Gletscher im Torsukatak-Fjord hatte allerdings eine bedeutend geringere Geschwindigkeit, aber auch er bewegte sich über 30 Fuß (10,16 m) in 24 Stunden. Dies waren ganz neue Faktoren, mit denen man rechnen mußte, wenn man der Wirksamkeit der Wandergletscher in Bezug auf die Bildung der Fjorde, Thäler und Seen eine Bedeutung beilegen wollte. Viele wollten deswegen dieser unerwarteten Entdeckung keinen Glauben schenken; durch spätere Untersuchung von dänischen Grönlandsfahrern sind sie dann freilich mehr als bestärkt.
[S. 51]
Im ganzen waren Hellands Beobachtungen in Grönland ganz danach angethan, die Theorien der Glacialisten zu stützen.
Wir kommen jedoch am Ende des Buches in einem eigenen Kapitel noch eingehender hierauf zurück, weshalb ich mich an dieser Stelle auf das bereits Mitgetheilte beschränken will.[23]
Im Jahre 1875 schrieb Dr. Rink[24] über die Möglichkeit, das Innere Grönlands zu bereisen. Er hielt es für sehr bedeutungsvoll, diese Untersuchungsreise, vom Westen ausgehend, bis an die Ostküste zu unternehmen. Er sagt darüber: „Ich glaube, daß sie sich am besten mit von Menschen gezogenen Schlitten bewerkstelligen ließe. Zwei kleine Schlitten müßten auf das sorgfältigste konstruirt und mit allen Bedürfnissen versehen werden. Außer dem wissenschaftlichen Leiter und einem Gehülfen müßten ungefähr vier Europäer an einer solchen Expedition theilnehmen.“ — Merkwürdigerweise ist mir diese Schrift erst nach meiner Rückkehr aus Grönland in die Hände gefallen, wie man aber ersehen wird, stimmt der darin ausgesprochene Gedanke in mehreren Punkten mit meinem Plan überein. Als Ausgangspunkt für eine solche Reise empfahl Dr. Rink die Gegend nördlich von Fredrikshaab, auf dem 62½° N. Br.
Im folgenden Jahre (1876) begannen auf dänische Staatskosten infolge eines Vorschlages des dänischen Geologen Prof.[S. 52] Johnstrup die „geologischen und geographischen Untersuchungen in Grönland“. Diese Untersuchungen sind seit der Zeit alljährlich fortgesetzt worden und haben eine große und sehr werthvolle Ausbeute ergeben, die im wesentlichen in dem schönen und bedeutungsvollen Werk „Mittheilungen über Grönland“ niedergelegt sind. Von diesem Werk sind bis dahin 12 Hefte erschienen und von der Kommission herausgegeben, die zur Leitung der Untersuchungen gewählt wurde, und die aus Prof. Johnstrup, Minister N. F. Ravn und Dr. H. Rink bestand.
Wie vorauszusehen war, bildete die Erforschung des Inlandseises eine der wichtigsten Aufgaben für diese Untersuchungen, und die Expedition, welche unter Leitung des Assistenten Steenstrup[25] im ersten Jahr (1876) ausgesendet wurde, stellte es sich u. a. zur Aufgabe, eine „vorläufige Rekognoscirung des Eisrandes“ im Julianshaaber Distrikt[26] vorzunehmen. Man beabsichtigte, einige Meilen weit hineinzugehen, bis an die drei auf früheren Karten angegebenen Nunataks, die sogen. „Jungfrauen“ oder „Niviarsiat“, um die Beschaffenheit des Eises zu untersuchen und festzustellen, ob es sich als Ausgangspunkt für ein Eindringen in das Inlandseis eigne. Dieser Plan gelang jedoch nicht, man stieß auf sehr unebenes Eis voll großer, tiefer Schluchten. Statt dessen unternahm man deswegen Messungen der Bewegungen des Eises in drei Eisgletschern, was bis dahin in Südgrönland noch nicht geschehen war. Die größte Geschwindigkeit betrug 3,75 Meter innerhalb 24 Stunden.[27]
Die nächste Expedition, an der Assistent Steenstrup[S. 53] und Premierlieutenant zur See J. A. D. Jensen theilnahmen, und die im Jahre 1877 nach dem nördlichsten Theil des Fredrikshaaber Distrikts ausgesandt wurde, erhielt ebenso wie die erste den Auftrag, außer einer gewöhnlichen Untersuchung der Küste „wenn möglich den Versuch zu machen, auf das Inlandseis hinaufzugelangen“, diesmal „in der Nähe von Frederikshaab oder an einem andern dazu geeigneten Punkt“. Also genau in der Gegend, welche zwei Jahr früher von Dr. Rink empfohlen war. Auch dieser Versuch mißlang indessen infolge unbeständigen Wetters.[28]
In dem dann folgenden Jahr 1878 wurde der Versuch indessen mit mehr Erfolg wiederholt. Es wurde eine Expedition unter Leitung von Lieutenant J. A. D. Jensen ausgesandt, die sich zu den interessantesten Reisen auf dem grönländischen Inlandseis gestalten sollte. Jensens Begleiter waren seine Landsleute Kandidat Karnerup und Architekt Groth, in Grönland nahm er außerdem den Grönländer Habakuk mit. Als Ausgangspunkt wurde abermals Fredrikshaab gewählt. Man unternahm zwei Wanderungen auf dem Eise.
Während der ersten (3. Juli), die nur einen Tag dauerte, wurde der Nunatak Nasausak (1478 m hoch), einer der sogenannten Dalager-Nunataks an der Südseite des Gletschers besucht. Diese Wanderung ist insofern interessant, als sie in derselben Gegend unternommen wurde, welche Dalager einst besucht hatte.
Da man diesen Ort indessen nicht für einen günstigen Ausgangspunkt für eine größere Eiswanderung hielt, so trat man dieselbe von einem nördlicher gelegenen Punkt, Namens Itiodlek, an.
[S. 54]
Die Expedition war sorgfältig und in mehreren Beziehungen zweckmäßig vorbereitet. Der Proviant war auf drei Wochen berechnet. Die Gesamtausrüstung wog 200 Kilogramm und wurde auf zwei kleinen Schlitten (jeder für einen Mann berechnet) gezogen, die etwas über 5 Kilogramm wogen, 5 Fuß lang und 2¼ Fuß breit waren. Da man „tiefer landeinwärts auf Schnee zu treffen glaubte“, wurden 4 Paar Schneeschuhe und 4 Paar kanadische Schneeschuhe mitgenommen.
Am 14. Juli begann die Wanderung. Außer den oben erwähnten drei Europäern und einem Grönländer gaben ihnen während der ersten Tage ein Grönländer und drei Grönländerinnen das Geleite, um ihnen beim Aufsteigen auf das Eis behülflich zu sein. Das Eis, das sie antrafen, war in hohem Grade uneben und schwer zu passiren. Kapitän Jensen hat selber in seinem Bericht (Mittheilungen über Grönland, Heft 1, Seite 54) eine lebhafte Schilderung der verschiedenartigen Beschwerden und Widerwärtigkeiten gegeben, welche ihr Vordringen verzögerte. Unter anderm litten sie Alle in hohem Grade an der Schneeerblindung. Infolgedessen gelangten sie nur in kurzen Tagesmärschen vorwärts, und erst am elften Tage (24. Juli) erreichten sie den größten des mehr als 9 Meilen entfernten Nunataks, die Dalager seiner Zeit gesehen und für die Felsen von Österbygden gehalten hatte, die sich aber als eine Reihe von Nunataks entwickelten — jetzt Jensens Nunataks benannt — und 4½ Meilen von dem nächsten Rande des Inlandseises entfernt liegen.
Auf dem Nunatak, den sie erreicht hatten, und dessen Fuß ungefähr 1264 Meter über dem Meeresspiegel lag, wurden sie sieben Tage lang vom Schneesturm aufgehalten.
Endlich, am 31. Juli, konnte die Rückreise beginnen, nachdem Kapitän Jensen am Morgen vom Gipfel des Nunataks[S. 55] aus, der 1556 Meter über dem Meeresspiegel lag, eine gute Aussicht über das Inlandseis gehabt hatte, das nach innen zu „höher und höher anstieg, bis es mit dem Himmel verschmolz, der bedeutend höher lag als der Standpunkt des Zuschauers“.
Am Abend des 5. August erreichte man nach einer Abwesenheit von mehr als 23 Tagen abermals den Zeltplatz bei Itiodlek, wo die Wanderer auf das wärmste von den Grönländern und Grönländerinnen im Empfang genommen wurden.
Diese Wanderung ist eine der interessantesten, die jemals auf dem grönländischen Inlandseise vorgenommen wurden, sie brachte eine reiche wissenschaftliche Ausbeute, brachte Aufklärungen über die Beschaffenheit des Eises und die Strömungsverhältnisse in einer Gegend, die von Nunataks wimmelt, über die geologischen Verhältnisse dieser Nunataks, über das organische Leben auf denselben etc., alles Dinge von großem Interesse. Ferner brachte man eine reiche Sammlung von Skizzen mit, die von Karnerup und Groth aufgenommen waren.
Die großen Hindernisse, mit denen diese Expedition zu kämpfen hatte, und die das weitere Vordringen unmöglich zu machen schienen, hielten die Kommission für die Leitung der grönländischen Untersuchungen davon ab, weitere Versuche zwecks Vordringens in das Innere zu veranstalten. Den Plan, die Ostküste zu erreichen, wozu diese Expedition ja nur eine vorläufige Rekognoscirungstour hatte bilden sollen, gab man völlig auf.
Von dänischer Seite ist infolgedessen denn auch seit dieser Zeit kein Versuch gemacht worden, in das Inlandseis einzudringen, dagegen sind im Laufe der Jahre zahlreiche interessante Untersuchungen am Rande des Eises und kleinere Wanderungen bis an die in der Nähe des Randes gelegenen Nunataks unternommen worden. Es würde indessen zu weit führen, wenn wir[S. 56] uns hier auf eine nähere Beschreibung einlassen wollten. Wir verweisen den Leser auf die Mittheilungen über Grönland, die alles Diesbezügliche enthalten. Unter Denen, die sich an jener Arbeit betheiligt haben, sind zu nennen: Assistent Steenstrup, Kapitän z. S. J. D. A. Jensen, Lieutenant Hammer und Lieutenant C. Ryder.
Die beiden Letzteren haben interessante Messungen über die Gletschergeschwindigkeit in Nord-Grönland vorgenommen. Besonders verdienen der Erwähnung Ryders Messungen des Uperniviks-Gletschers, der sich im August des Jahres 1886 mit einer Schnelligkeit bis zu 31 m in 24 Stunden bewegte.
Im Jahre 1880 unternahm der schwedische Geolog Holst eine Reise in Süd-Grönland, auf welcher er das Inlandseis besuchte und kleine Wanderungen auf dasselbe von verschiedenen Punkten aus unternahm. Der Zweck dieser Reise war im wesentlichen eine Untersuchung des von Nordenskjöld zuerst beschriebenen Eisstaubes (Kryokonit), der nach Holsts Analyse aus denselben Bestandtheilen besteht wie die Küstenfelsen, weshalb er ihn für Staub hält, den die Winde von der Küste aus mit sich geführt haben.
Eine der hervorragendsten Expeditionen auf dem grönländischen Inlandseis ist Nordenskjölds Expedition im Jahre 1883. Nicht zufrieden mit seiner ersten Eiswanderung i. J. 1870, wollte dieser unermüdliche Polarforscher noch weiter vordringen, um dem Innern Grönlands seine merkwürdigsten Geheimnisse zu entreißen. Er war nämlich gleich Whymper auf den Gedanken gekommen, daß sich inmitten dieser „Sahara des Nordens“ wie er das Innere Grönlands benennt, schneefreie Oasen vorfinden müßten, ja er war nahe daran, es für möglich zu halten, daß diese gleich den nördlichen Landstrecken Sibiriens bewaldet seien. Wenn auch keine der früheren Expeditionen nach Osten[S. 57] zu an eine Grenze der Eiswüste gelangt war, so sprachen doch allerlei Umstände dafür, „daß es in den meisten Fällen eine physische Unmöglichkeit ist, daß das Innere eines weitgestreckten Kontinents völlig eisbedeckt ist, bei den klimatischen Verhältnissen, die südlich von dem 80° N. Br.[29] auf unserer Erde herrschen“, ja, „was das Innere Grönlands betrifft, so ist es leicht nachzuweisen, daß die für eine Gletscherbildung nothwendigen Bedingungen dort nicht herrschen können, wenn sich nicht die Oberfläche des Landes langsam von der Ost- und Westküste nach innen zu hebt und dessen über dem Meere belegener Theil infolgedessen die Form eines runden Kloßes hat mit langsam nach dem Meere zu abfallenden Seiten“.
Die Betrachtung, welche Nordenskjöld zu diesem überraschenden Schluß führte, war die Annahme, daß zu einer Gletscherbildung stets ein gewisser Grad von Niederschlägen erforderlich ist; dies ist aber im Innern Grönlands nicht möglich, da die sämtliche von dem umgebenden Meer stammende Luft, welche die Niederschläge mit sich führen müßte, erst ihren Weg über die hohen Küstenfelsen nehmen muß. Während sie aber an den Felswänden emporstieg, hat sie sich, unter dem niedrigeren Luftdruck in der Höhe abgekühlt und erweitert und infolge dessen den größten Theil ihrer Feuchtigkeit abgegeben. Durch dies Abgeben der Feuchtigkeit würde indessen die gebundene warme Luft frei und die Temperatur der Luft erhöht. Indem sie nun auf der anderen Seite der Küstenfelsen niederfiel, würde sie indessen, je nachdem sie in einen höheren Luftdruck hinabgelangte, mehr und mehr erwärmt und zwar in gleichem Grade, wie sie während des Aufsteigens abkühlte. So müßte sie denn zu den Thälern des Innern in Gestalt von trockenen, warmen[S. 58] Winden gelangen, die dem bekannten „Föhn“ der Schweiz gleichen. Die feuchten Seewinde müßten deswegen in Grönland ihre Feuchtigkeit „gewöhnlich in Form von Schnee an den Felsen längst der Küste absetzen, wogegen aller Wind, der in das Innere des Landes gelangt, sei es von Osten, Westen, Süden oder Norden, trocken und verhältnißmäßig warm sein muß, falls nicht das Land einen organischen Bau von ganz anderer Beschaffenheit hat als alle andern Länder des Erdballes“.
Diese Schlußfolgerung würde bis zu einem gewissen Grade berechtigt sein, falls es ein Land gäbe, das vollständig von Küstenfelsen umgeben wäre und ein verhältnißmäßig niedriges Innere hätte, aber ein solches, größeres Land läßt sich kaum denken, am wenigsten kann man erwarten, daß Grönland diesen Bau haben sollte. Ich muß mich im Gegentheil vollständig Nordenskjölds Ansicht anschließen, wenn er sagt, daß Grönlands geologische Beschaffenheit auf einen orographischen Bau gleich dem Skandinaviens hindeutet, mit andern Worten, daß das Land aus Bergrücken und Berggipfeln besteht, die mit tiefen Thälern und Ebenen abwechseln; dann aber müssen auch in Grönlands Innerm in Bezug auf die Niederschläge günstige Bedingungen zur Bildung des Inlandseises vorhanden sein; denn wo mangelte es wohl in Skandinavien an Feuchtigkeit, falls man nur die erforderliche Temperatur hätte? Es scheint, als habe der große Polarreisende vergessen, daß es noch heutzutage im Innern von Skandinavien kleine Gletscher giebt, daß sich auch in den Alpen und an vielen andern Stellen, fern vom Meere, solche finden, und vor allen Dingen, daß sie einst eine unendliche Ausdehnung gehabt und unter anderem ganz Nordeuropa bedeckt haben. Hierauf wird er möglicherweise antworten, daß er gerade diese Behauptung bestreitet, die Eisdecke sei damals in dem Innern der Länder nicht zusammenhängend gewesen.[S. 59] Die Kosten der Expedition, der damals nicht allein die Aufgabe gestellt war, in das Innere Grönlands einzudringen, sondern die unter anderem versuchen sollte, die Ostküste zu erreichen (vergleiche Kap. X.), wurden ebenso wie Nordenskjölds erste Expedition nach Grönland i. J. 1870 von dem bekannten schwedischen Mäcen, dem Freiherrn Oskar Dickson bestritten, der zu diesem Zweck einen Dampfer, „Sofia“, zur Verfügung stellte.
Auf der Eiswanderung, die ihren Anfang am 4. Juli ungefähr an derselben Stelle nahm, wie die Wanderung i. J. 1870, wurde Nordenskjöld von 9 Mann begleitet, unter denen sich zwei mit Schneeschuhen versehene Lappen befanden, außerdem halfen ihm die meisten Offiziere der „Sofia“, sowie die Besatzung und zahlreiche Eskimos während der beiden ersten Tage bei dem Transport der Ausrüstung über das erste, unebene Eis. Unter den Begleitern befand sich auch der Direktor der kgl. grönländischen Handelsgesellschaft, Herr Hörring.
Im Laufe von 18 Tagen (bis zum 21. Juli) gelangte Nordenskjöld selber etwas über 117 km auf das Inlandseis hinauf und erreichte eine Höhe von 1510 m über dem Meeresspiegel. Hier wurde er aber von dem nassen Schnee, in den Schlitten und Menschen versanken, am Vordringen gehindert. Ehe man zurückkehrte, wurden indessen die beiden Lappen auf Schneeschuhen weiter ins Innere entsandt. Obwohl man nichts als Schnee und Eis gefunden hatte und obwohl man sich mitten auf einer unendlichen, meeresähnlichen Schneefläche befand, gab Nordenskjöld dennoch den Glauben an die Richtigkeit seiner Theorie nicht auf, sondern ertheilte den Lappen folgende schriftlichen Befehle:
„Falls man Land erreichen sollte, nehme man in aller Eile an Blumen und Gras mit, was zu finden ist, und zwar einen oder mehrere Stengel von jeder Blume und jedem Grashalm.
Auf dem Inlandseis am 21. Juli 1883.“
[S. 60]
Nach 57 Stunden (24. Juli) kehrten die Lappen zurück und berichteten, daß sie 230 km weiter landeinwärts gekommen seien und eine Höhe von 1947 m über dem Meeresspiegel erreicht hätten; so weit sie aber hätten sehen können, sei nichts anderes zu erblicken gewesen als ein einziges flaches, unendliches Schneefeld. Selbst wenn man von der Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, absieht, eine so lange Strecke in so kurzer Zeit auf einer Schneeschuhbahn zurückzulegen, wie man sie im Innern Grönlands findet, so muß man doch, wie wir später eingehender erklären werden, annehmen, daß die Lappen die von ihnen zurückgelegte Strecke zu hoch angeschlagen haben.
Am folgenden Tage (den 25. Juli) trat man die Rückkehr an, und am 31. August erreichte man, nachdem man 31 Tage auf dem Inlandseis zugebracht hatte, abermals den Zeltplatz bei „Sofiashavn“ in dem nördlichen Arm des Aulatsivikfjordes. Die Eskimos, die hier mit Proviant, Reservekleidern, einem Boot etc. warteten, waren sehr erfreut, als sie die Eiswanderer erblickten, die sie schon verloren geglaubt; sie hatten, wie sie behaupteten, mehrere Paar Kanicker (Stiefel) verschlissen bei dem Erklimmen der Berge, um nach ihnen auszusehen.
Das Eis, das man auf dieser bedeutungsvollen Reise traf, war nach verschiedener Richtung hin von Interesse. Es war freilich, besonders nach dem Rande zu, sehr uneben und theils arg zerklüftet, aber es war doch im ganzen ebener als das Eis, das man von früheren Wanderungen her kannte. Ferner stieß man ganz im Innern auf eine einzige ausgestreckte und völlig ebene Schneefläche, auf der kein Eis und keine Spalten zu entdecken waren, die aber, soweit das Auge reichte, mit Schnee bedeckt war. Diese Expedition war, ganz abgesehen von der Schneeschuhreise der Lappen, weiter vorgedrungen als alle ihre Vorgänger und hatte zum erstenmal diese Schneefläche erreicht,[S. 61] die, wie wir jetzt wissen, das ganze Innere Grönlands bedeckt. Es war auch, wie schon erwähnt ist, die Nachricht von der Entdeckung dieser Schneefläche, welche dem Verfasser den Anstoß zu dem Plan der Expedition gab, von der dies Buch handelt.
Es könnte scheinen, als wenn Nordenskjöld selber durch diese Expedition seine Theorie von einem eisfreien Innern sehr in Zweifel gezogen hätte. Dies meinte er auch während der ersten Zeit nach seiner Rückkehr, später begann er indessen abermals „zu zweifeln und es für mindestens möglich zu halten, daß man sich im Jahre 1883 nur auf einem breiten Eisgürtel befunden habe, der sich an dem 69° und 70° Nördl. Br. quer durch das Land erstreckt“,[30] während sich nördlich und südlich davon eisfreie Oasen befinden können.
Einen möglichen Beweis hierfür meint er in zwei Raben zu erblicken, welche die Lappen während ihres Schneeschuhlaufens sahen und die von Norden hergeflogen kamen und, nachdem sie die Schneeschuhspur erreicht hatten, dorthin zurückkehrten. Da sich diese Vögel um diese Zeit des Jahres selten weit von ihren Heckplätzen an der Küste entfernen, so meint er, dies spreche sehr für die Annahme, daß sie im Norden einen eisfreien Aufenthalt gehabt haben. Dieser Aufenthalt befinde sich möglicherweise an einem Sund, der sich Nordenskjölds Ansicht nach, wahrscheinlich vom Jakobshavner Eisfjord aus quer durch Grönland erstreckt und etwa bis an den Scoresby-Fjord an der Ostküste geht, und der „während der letzten Jahrhunderte durch Eismassen gesperrt wurde, die von den Gletschern an den Küsten des Sundes stammen“. Den Glauben an diesen Sund[31] hat Nordenskjöld[S. 62] von Hans Egede und Paul Egede überkommen, welche berichten, daß es bei den Eskimos eine Sage hierüber giebt.
Der Glaube an einen Sund, der Grönland durchschneidet, oder gar daran, daß das ganze Land aus einer Anzahl von Inseln besteht, die theils mit Eis überdeckt sind, hat seit der Zeit, als er zuerst im 16. Jahrhundert auftauchte, wieder und wieder Anhänger gefunden. Ursprünglich suchte man nach der sogenannten „Forbister-Straße“ oder dem „Beare-Sund“ im südlichen Grönland, und diese sind auf allen Karten jener Zeit angegeben. Die Veranlassung hierzu war, daß Forbister eine Reihe von Entdeckungen zwischen den Inseln in dem nordamerikanischen Archipelagus auf der linken Seite der Davis-Straße gemacht hatte, ohne zu wissen, wo er sich befand. Später glaubten Andere, er müsse in Grönland gewesen sein, weswegen sie die von ihm beschriebenen Sunde und Inseln dorthin verlegten. Daß Forbister nicht Grönland, sondern die Länder auf der andern Seite der Straße besucht hatte, wurde freilich bald aufgeklärt, was jedoch nicht verhinderte, daß sich der Glaube an die Südgrönland der Quere nach durchschneidende Forbister-Straße lange nach jener Zeit erhielt; wir finden ihn sogar in Granz’ „Geschichte von Grönland“ aus dem Jahre 1765, in welcher sowohl von einem Sund quer durch Südgrönland als auch von dem Sunde berichtet wird, der altgrönländischen Sagen zufolge Mittelgrönland durchschneiden soll. Hans Egede glaubte nicht, daß es einen Sund quer durch Südgrönland gäbe, da er selber einen solchen nicht hatte finden können, deswegen verzeichnete er auch keinen solchen auf seiner Karte in „der neuen Perlustration des alten Grönland etc.“, die im Jahre 1741 in Kopenhagen erschien. Dagegen glaubten sowohl er als auch sein Sohn Paul, wie wir bereits gesehen haben, an den Sund, der sich den Sagen[S. 63] der Grönländer zufolge vom Jakobshavner Eisfjord bis an die Ostküste erstreckt haben soll, und diesen verzeichnete er dann auf seiner Karte, ebenso wie er auf Paul Egedes Karte in den „Nachrichten über Grönland aus dem Jahre 1878“ zu finden ist. Ein Facsimile des Letzteren wird von Nordenskjöld in „die zweite Dicksonsche Expedition“ Seite 234 wiedergegeben.
Ich will mich hier nicht weiter darauf einlassen, zu erwägen, ob es möglich ist, daß ein so langer und schmaler Sund, dessen Seitenstück es wohl kaum giebt, überhaupt existiren kann; es will mir scheinen, als ob Grönlands ganze Form wie der geographische Bau dieses Landes dies äußerst unwahrscheinlich machen.
Die letzte Expedition auf dem Inlandseise Grönlands vor 1888 wurde im Jahre 1886 von Robert E. Peary, Civilingenieur in der Marine der Vereinigten Staaten, und dem Dänen Chr. Maigaard, Assistent in der königl. dänischen Handelsgesellschaft, unternommen.
Peary selber nennt die Expedition eine vorläufige Rekognoscirungstour.[32] Es war ursprünglich seine Absicht, sie mit Hunden und Schlitten zu unternehmen, aber im letzten Augenblick ließen ihn die dazu gemietheten Grönländer im Stich und zogen mit Hunden und Schlitten fort. So sahen sich denn Peary und Maigaard gezwungen, die Wanderung zu Fuß und allein zu unternehmen; freilich halfen ihnen ein Grönländer und eine Grönländerin während der ersten Tage, doch waren sie Beide nicht zu bewegen, sich weiter als eine kleine Strecke auf das Inlandseis hinauf zu wagen.
Zum Ausgangspunkt wählte man das Innere des Pakitsok-Fjordes[S. 64] (auch Ilardleck-Fjord genannt) auf dem 69½° Nördl. Br., also denselben Fjord, von dem aus Whymper seinen Versuch gemacht hatte, und von wo aus unser Landsmann Amund Helland aufs Eis gegangen war.
Das Aufsteigen auf das Eis begann am 28. Juni. Der Proviant, der auf 30 Tage berechnet war, und die übrige Ausrüstung wurden auf zwei amerikanischen, 11 Kilogramm wiegenden, Schlitten von Hickori gezogen. Man hatte Skier und kanadische Schneeschuhe mitgenommen, und diese scheinen fleißig benutzt worden zu sein. Statt eines Zeltes hatte man nur ein Persenning, womit man sich, im Schutz der Schlitten liegend, bedeckte. Als sie eine Strecke vorgedrungen waren (7. Juli), machten sie sich jeden Tag (sie schliefen bei Tage und gingen während der Nacht) Schneehütten, bis sie so weit landeinwärts gedrungen und so hoch hinaufgelangt waren (12. Juli), daß sich der Schnee nicht mehr dazu eignete. Am Abend des 2. Juli, als sie wegen heftigen Sturmes und Schneetreibens zwei Tage hatten still liegen müssen, beschloß man nach dem Zelt am Fjord zurückzukehren, um eine Aenderung des Wetters abzuwarten, während man die Schlitten und die Ausrüstung zurückließ.
Am 6. Juli kehrten sie wieder zu den Schlitten zurück und setzten ihren Weg landeinwärts vorwärts, nachdem sie ein Proviantdepot für 8 Tage zurückgelassen hatten. Als sie am nächsten Morgen über einen kleinen, mit dünnem Eis bedeckten See gingen, brach Maigaards Schlitten ein, doch gelang es ihm, ihn wieder herauszuziehen, „aber er war,“ sagt Maigaard[33] „infolge des vielen Wassers, das meine Bagage aufgenommen hatte, mindestens 100 Pfund schwerer geworden, als[S. 65] er vorher war,“ so daß er ihn nur mit großer Anstrengung ziehen konnte.
Die Temperatur war während des größten Theils der Reise unter Null und infolgedessen günstig für die Schneeschuhe, in der Nacht zwischen dem 12. und 13. Juli hatte man sogar −14° C. Am 9. Juli machte sich ein unangenehmer Umschlag im Wetter bemerkbar, indem ein südöstlicher Wind die Temperatur von −6° C. auf +8° C. brachte und den Schnee ganz weich machte. Es scheint dadrinnen auf dem Inlandseise ein förmlicher Föhn geweht zu haben.
Am 11. Juli legte man in einer Höhe von 5000 Fuß ein neues Proviantdepot und andere Ausrüstungsgegenstände nieder.
Am Morgen des 17. Juli erreichte man eine Höhe von ca. 7500 engl. Fuß in einer Entfernung vom Eisrande, die Peary nach einer Längenobservation auf etwa 100 engl. Meilen angiebt.
Hier wurden sie bis zum 19. Juli durch Sturm und Schneetreiben zurückgehalten, dann klärte sich das Wetter auf, so daß sie eine Mittagsobservation machen und sich am Abend gegen 6 Uhr auf den Heimweg begeben konnten. Da sie jetzt den Wind im Rücken hatten, banden sie die beiden Schlitten zu einem „Segler“ zusammen und verwandten einige Alpenstöcke als Masten, ein Persenning als Segel und einen Schneeschuh mit daran befestigter Axt als Steuer.
Mit diesem Fahrzeug segelte man nach Maigaard sechs geographische Meilen während der ersten, sieben geographische Meilen während der zweiten und zwölf geographische Meilen während der dritten Nacht, dann mußte man die Schlitten wegen der Beschaffenheit des Eises wieder ziehen.
Am Morgen des 24. Juli erreichte man den Zeltplatz am Fjord, nachdem man im ganzen 23 Tage und Nächte auf dem Eise zugebracht hatte.
[S. 66]
Das Eis, über das diese Expedition gegangen, war mit Ausnahme des allerersten Theiles durchschnittlich sehr eben, ja sogar ebener als Nordenskjöld es im Jahre 1883 angetroffen hatte. Auch hatte es nicht viele Spalten und unterscheidet sich von dem letztgenannten dadurch, daß es während des größten Theiles des Weges mit trockenem Schnee bedeckt war, in den Peary, als er sich am weitesten landeinwärts befand, seinen Stab sechs Fuß hinabstoßen konnte. Dies hat auch in hohem Grade die Reise erleichtert.
Leider beruhen Pearys Längenangaben scheinbar nur auf einigen Höhenobservationen, die mit einem leichten Reise-Theodolit an einem einzigen Tage, den 19. Juli, gegen Mittag unternommen wurden. Die Ausdrücke, deren er sich bedient, sind nicht ganz deutlich, er erwähnt nur „circummeridiane Höhen“ („circummeridian sights“), und desselben Ausdruckes bedient sich auch Maigaard in seinem Bericht. Diese sog. „einzelnen Mittagshöhen“ sind bekanntlich ziemlich unsicher zu Längenbestimmungen. Als Chronometer benutzte man eine Taschenuhr (der mitgebrachte Chronometer war stehen geblieben), die, wie Peary behauptete, sehr zuverlässig sein sollte; es geht jedoch, soweit ich es beurtheilen kann, keineswegs aus seinem Bericht hervor, daß man Observationen machte, um den Gang später an der Küste zu kontrolliren. Die angeführte Entfernung von 100 engl. Meilen (160 Kilometer) vom Eisrande kann folglich nicht als ganz genau betrachtet werden. Was möglicherweise auch für diese Vermuthung sprechen könnte, ist der Umstand, daß die hierzu erforderlichen Tagesmärsche, die von Maigaard auf 3–4 geogr. Meilen angegeben werden, mir ziemlich groß zu sein scheinen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß es schwer genug sein kann, eine solche Strecke am Tage mit einem schwerbeladenen[S. 67] Schlitten, bei einer wenn auch nur geringen Steigung zurückzulegen.[34]
Wie es sich nun auch hiermit verhalten mag, so ist diese Expedition immerhin eine der beachtenswerthesten, die auf das Inlandseis unternommen worden ist, und man muß die beiden Reisenden bewundern, daß sie soviel ganz allein und mit so geringen Mitteln erreichten.
Noch im selben Sommer besuchte Peary auch den Rand des Inlandseises an verschiedenen nördlicher gelegenen Stellen.
Wie man ersieht, ist im Laufe der Jahre durch diese vielen Expeditionen auf das Inlandseis und an dessen Rand ein großes Material von Beobachtungen zusammengebracht, das uns instandsetzt, einen einigermaßen zuverlässigen und vollständigen Begriff über die Beschaffenheit desselben an der ganzen Westküste entlang bis nach Upernivik zu bilden; durch zwei[S. 68] Expeditionen (Nordenskjöld 1883 und Peary 1886) haben wir auch erfahren, daß sich innerhalb des äußeren, mit Spalten und Unebenheiten angefüllten Eisrandes ein ausgedehntes, vollständig ebenes Schneefeld befindet, das sich sanft steigend nach dem unbekannten Innern zu erhebt.
Eine wesentliche Lücke in unserer Kenntniß dieses Inlandseises ist damit ausgefüllt, aber es bleibt noch vieles übrig, und Aufklärung über einen Theil derselben zu schaffen, war die Aufgabe unserer Expedition.
Von der Beschaffenheit des Inlandseises an der Ostküste wußte man nur wenig oder nichts; freilich hatte die dänische Frauenbootsexpedition unter Kapitän Holm viel von dessen Rand gesehen, aber man hatte keine Zeit gehabt, demselben weitere Aufmerksamkeit zu widmen, und das Eis selber war in jener Gegend noch von keinem Europäer betreten worden.[35] Schon eine Untersuchung der Beschaffenheit des Eises, des Steigerungsverhältnisses u. s. w. auf dieser Seite würde daher von Bedeutung gewesen sein.
Noch weit unbekannter war indessen das ganze Innere. Freilich konnte man aus den Resultaten der beiden letzten Expeditionen einzelne Schlußfolgerungen ziehen, wie es dort aller Wahrscheinlichkeit nach aussah, dies aber hatte nur einen geringen Werth, so lange Niemand dort gewesen war, und es erheben sich ja noch immer gewichtige Stimmen, welche die Ansicht[S. 69] verfechten, daß das Innere nicht ganz mit Schnee und Eis bedeckt sei. Obwohl ich niemals zu dieser Annahme geneigt hatte, erschien es mir, daß die Untersuchung der Höhen- und Steigerungsverhältnisse des Innern, mit anderen Worten die Form der ganzen Schnee- oder Eiskappe, welche Grönland bedeckt, von großem Interesse sein müsse.
Auf die meteorologischen Verhältnisse in Grönlands Innerm legte ich freilich ein noch größeres Gewicht. Zu einer irgendwie eingehenderen Kenntniß derselben hatten die früheren Expeditionen wenig oder nichts beigetragen, und ich sagte, scheinbar mit Recht, in meinem Artikel in „Naturen“ (Januar 1888),[36] „daß für den Meteorologen die Beobachtungen über das Klima, die Messungen der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Windes und der Windrichtungen, die Aufklärungen über die Niederschläge und die Wolkenbildung auf diesen ungeheueren Schnee- und Eisfeldern von großer Bedeutung sein müßten; es herrschten hier Verhältnisse, die so völlig verschieden von den Verhältnissen in den Gegenden sind, von welchen man regelmäßige Observationen erhält“. Wie man später ersehen wird, sollte ich in dieser meiner Annahme in hohem Grade bestärkt werden. Ich könnte vielleicht hinzufügen, daß auch für die Geologen solche Aufklärungen von Wichtigkeit sein müssen; denn wie soll man sich eine irgendwie begründete Ansicht über den inneren Haushalt des Inlandseises — wenn man sich so ausdrücken darf — bilden, ehe man die Niederschlag- und Temperaturverhältnisse und dergleichen kennt, die auf dessen Oberfläche herrschen.
Dies schienen mir die wichtigsten Aufgaben zu sein, die in dem unbekannten Innern Grönlands zu lösen waren.
Welchen Nutzen aber können solche Aufklärungen bringen?[S. 70] Dieselbe Frage ist so manchen Entdeckungsreisen gegenüber aufgeworfen und wird bei jedem neuen Unternehmen aufgeworfen werden. Man könnte viel darauf antworten und u. a. daran erinnern, welchen Einfluß ein solches Hochland von Eis und Schnee auf das Klima aller angrenzenden Theile der Erde haben muß, wie jeder einzelne Theil der Erdoberfläche in genauem Zusammenhang mit den übrigen steht; aber allein schon der Umstand, daß Grönlands Inneres ein Theil und zwar ein nicht ganz unbedeutender Theil der Oberfläche dieses Planeten ist, auf dem wir leben, genügt, um den Wunsch zu erwecken, es kennen zu lernen, und nicht zu ruhen, bis dies geschehen ist, sollte auch der Weg über Gräber gehen.
Je eher das erreicht werden kann, desto besser.
[2] Aus dem Brief des Direktors an den Rath in Grönland. Bergen, den 19. April 1723. Die angeführte Stelle ist P. Eberliens Artikel im „Archiv für Mathematik und Naturwissenschaft, Kristiania 1890,“ entnommen.
[3] Egedes Antwortschreiben, 31. Juli 1723. Beide Briefe befinden sich im Reichsarchiv zu Kopenhagen. Grönlandske Desseins Intagt- og Udgift-Forklaringer 1721–25.
[4] Von Assistent Fersler 1727. Reichsarchiv Kopenhagen 1727. Grönländische Expedition 1728–33.
[5] Aus Frederik IV. Instruktion an Major Paars, abgedruckt in den „Mittheilungen über Grönland“, Heft IX, S. 30–31. Kjöbenhavn 1889.
[6] Es ist dies das erste Mal, daß Pferde nach Grönland gesandt worden sind.
[7] Journal, geführt bei Godthaab. Abgedruckt im „Tilskuer“, Jahrgang 6, Seite 483–484. Kjöbenhavn 1889.
[8] Dies sowie die folgenden Citate von Paars Reise sind seinem Rapport an den König entnommen, der in Peter Eberliens Artikel im „Tilskuer“, Jahrgang 6, Seite 485–488, Kjöbenhavn 1889, abgedruckt ist.
[9] Es war mir nicht möglich, dies Buch zu Gesicht zu bekommen. Die hier angeführte Stelle ist Kapitän J. A. D. Jensens Buch: „Ueber das Inlandseis in Grönland“ u. s. w., Kjöbenhavn 1888, Seite 34 Anmerkung, entnommen.
[10] Kablunak oder richtiger Kavdlunak bedeutet auf Grönländisch „Europäer“, wird jedoch jetzt fast ausschließlich für Dänen angewandt.
[11] Welcher Nunatak dieser Omertlok gewesen ist, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, da auf der südlichen Seite von Fredrikshaab mehrere Nunataks im Inlandseise liegen und keiner von ihnen, soviel mir bekannt ist, jetzt von den Grönländern so genannt wird. Soweit ich Dalagers Bericht verstehe, hat er erst einen Nunatak besucht und dann am nächsten Tage seine Wanderung landeinwärts nach einem anderen, dem „öbersten Berge auf dem Eisfelde“ (möglicherweise dem nördlichsten) fortgesetzt. Es erscheint mir daher nicht sehr wahrscheinlich, daß dieser Berg (Amertlok) derselbe Nunatak, der Nasausak ist, der im Jahre 1878 von Kapitän J. A. D. Jensen und seiner Expedition besucht wurde, wie letzterer anzunehmen scheint (siehe sein vorhin erwähntes Buch: „Ueber das Inlandseis in Grönland“, Seite 24. Siehe auch seinen Bericht: „Mittheilungen über Grönland“, Bd. 1, Seite 48). Zwischen dem Nasausak und dem Rande des Inlandseises liegt kein Nunatak, auch beträgt die Entfernung von diesem keine Meile.
[12] O. Fabricius: „Ueber das Treibeis in den nördlichen Gewässern, vornehmlich in der Davisstraße“ (1784). Dansk Vid. Selsk. Skrifter, 1788, 3, 65–84.
[13] Gieseckes mineralogische Reise in Grönland von F. Johnstrup. Kjöbenhavn 1878, Seite 173.
[14] Schon im voraufgehenden Jahre (1859) hatte der Amerikaner Oberst Schaffner bei seinem bereits (siehe Bd. I S. 287) erwähnten Besuch in Julianehaab einen Ausflug auf das Inlandseis unter Führung von Lieutenant Höyer, Handelsassistent in der Kolonie, machen sollen. (Erwähnt in: Zeilau, Foxexpedition. Kjöbenhavn 1861.)
[15] Foxexpeditionen i Aarel 1860 etc. Kjöbenhavn 1861. Seite 156–171.
[16] Siehe die Diskussion in Veranlassung des Vortrags, den der Verfasser in London hielt: Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, August 1889.
[17] Edward Whymper „Explorations in Greenland“ in der Zeitschrift „Good Words“, herausgegeben von Donald Macleod, d. d. Januar, Februar, März 1884. Dies ist der einzige ausführlichere Bericht, den Whymper selber über seine Reise geschrieben hat. Sein Begleiter Robert Brown hat indessen ebenfalls einen Artikel darüber geschrieben: „Das Innere von Grönland“ in Petermanns Mittheilungen 1871.
[18] Robert Brown, der Einer von diesen Dreien war, stellt (in seinem Bd. II. S. 39 in der Anmerkung erwähnten Artikel in Petermanns Mittheilungen 1871, Seite 385) die sonderbare Behauptung auf, daß sie in weiter Ferne vor sich einen Nunatak oder eine Insel erblickten, die jetzt ganz von Eis umgeben ist, die aber noch in diesem Jahrhundert mit einem Kajak erreicht werden konnte und die zu der Zeit bewohnt war.
[19] Ein Bericht von der Nordenskjöldschen Expedition: „Redogörelse för en expedition til Grönland år 1870“ befindet sich in der Uebersicht des K. Vih. Akad. Förh. Stockholm 1870, Seite 973.
[20] Dr. H. Rink hat hierüber einen Bericht in „Petermanns Mittheilungen“ 1883, Seite 133, gegeben.
[21] Siehe Nordenskjöld: „Die zweite Dicksonska-Expedition nach Grönland etc.“ Stockholm 1885, Seite 155.
[22] Auch diese Reise ist in „Good Words“ 1884, Seite 101–103 und 183–189, geschildert worden.
[23] Helland hat seine Beobachtungen in Grönland im Archiv für Math. und Naturwissenschaften, Bd. 1, Kristiania 1876: „Über die mit Eis angefüllten Fjorde und die glacialen Bildungen in Nordgrönland“, beschrieben, sowie einem Artikel in „The Quarterly Journal of the Geological Society“ (London) Februar 1877, Seite 142–176, betitelt: „On the Ice-Fjords of North Greenland, and on the Formation of Fjords, Lakes and Cirgnes in Norweg and Greenland.“
[24] „Über das Binnenland Grönlands und die Möglichkeit, selbiges zu bereisen.“ Petermanns Geogr. Mitteilungen 1875, Heft VIII., Seite 297 bis 300.
[25] Außer Steenstrup nahmen daran Theil der cand. Kornerup und der damalige Pr.-Lieut. zur See G. Holm.
[26] Siehe hierüber: „Mittheilungen über Grönland“, Heft 1, Seite 6 (Kopenhagen 1879).
[27] Diese Expedition ist beschrieben in den „Mitth. über Grönl.“, Heft 2 (1881), Seite 1–27.
[28] Siehe hierüber „Mitth. über Grönl.“, Heft 1, Seite 8.
[29] Siehe hierüber Nordenskjöld: „Die zweite Dicksonsche Expedition nach Grönland u. s. w.“ Stockholm 1885, Seite 8 etc.
[30] Die zweite Dicksonsche Expedition u. s. w. Seite 129.
[31] Siehe übrigens hierüber: „Die zweite Dicksonsche Expedition u. s. w.“ Seite 233–235.
[32] Bulletin of the American Geographical Society, Bd. XIX., New York 1887, Seite 261–289.
[33] Maigaard, Geogr. Zeitschrift, Bd. 9, Kopenh. 1888, Seite 90.
[34] Wie weit die Höhenbestimmung (7525 engl. Fuß) ganz korrekt ist, ist schwer zu sagen, da sie nur auf Observationen beruht, die mit dem Aneroidbarometer gemacht sind. Obwohl wir auf unserer Wanderung 3 vorzügliche Aneroidbarometer bei uns hatten, die eigens für unsere Zwecke in London verfertigt waren, so würden wir doch, falls wir nicht die tägliche Kontrolle mit dem Kochbarometer gehabt hätten, die Höhe viel zu hoch angeschlagen haben (was ich auch gleich anfangs in meinem Brief von Godthaab aus an Etatsrath Gamél that, als die Kochbarometer-Observationen noch nicht ausgerechnet waren). Merkwürdigerweise sanken und stiegen alle 3 Barometer völlig regelmäßig und übereinstimmend mit einander und nahmen, als wir die Meeresfläche wieder erreichten, ungefähr wieder denselben Stand ein, den sie gehabt hatten, als wir die Ostküste verließen. Hieraus ersieht man, daß man sehr vorsichtig sein muß, Observationen, die ausschließlich mit dem Aneroidbarometer gemacht sind, ein allzu großes Gewicht beizulegen.
Die angegebene Höhe scheint indessen, falls die Entfernung von der Küste richtig ist, keineswegs zu hoch berechnet zu sein. Wir haben schon in einer Entfernung von 15 Meilen (110 km) von der Ost- und 22 Meilen (160 km) von der Westküste eine solche Höhe erreicht, und die Steigerungsverhältnisse müssen, meiner Ansicht nach, zwischen dem 69. und 70. Breitengrad ungefähr dieselben sein.
[35] Hier mag erwähnt werden, daß Kapitän Hovgaard, der Leiter der Dijmphna-Expedition, nachdem was er mir kürzlich selbst mitgetheilt hat, vor einer Reihe von Jahren einen Antrag an das Ministerium einreichte, der darauf hinausging, daß die beabsichtigte Frauenbootsexpedition an die Ostküste mit einer mit Hundeschlitten auszurüstenden Expedition über das Inlandseis von der Ost- bis zur Westküste verbunden werden möge, was er mit Leichtigkeit ausführen zu können meinte. Dem Plan scheint keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt worden zu sein.
[36] „Grönlands Inlandseis“, „Naturen“. Bergen 1888.
[S. 71]
 ie ersten Tage nach unserer Eiswanderung wurden, wie oben erwähnt,
zur Instandsetzung unserer Ausrüstung benutzt. Wir hatten bedecktes,
mildes Wetter mit Regen, weshalb wir unseren Aufbruch nicht beeilten;
wir hofften auf klares Wetter mit Nachtfrösten. Zu unserer Ernährung
bedienten wir uns in diesen Tagen im wesentlichen der Seevögel, die wir
während unserer Bootsfahrt an der Ostküste entlang geschossen hatten,
und die wir bis dahin aus Mangel an Zeit nicht verzehren konnten. Sie
mundeten ganz vorzüglich; es war ein köstlicher Anblick, uns auf dem
Berge um den Kochtopf herum — der aus einem Blechkasten bestand, in
dem wir Brot gehabt hatten — lagern zu sehen; mit den Fingern holten
wir uns dann je einen Vogel aus der Brühe, rissen ihn auseinander und
verzehrten ihn mit Hülfe der Zähne und Finger. So moderne Einrichtungen
wie Gabeln hatten wir selbstredend nicht; ich kann auch aus eigener
Erfahrung versichern, daß dies ganz überflüssige Geräthschaften
sind, — die Gabeln, die wir vom lieben Gott bekommen haben, sind
außerordentlich praktisch, wenn man sie nur nicht in allzuheiße
Kochtöpfe hineinsteckt; aber darin gewinnt man gar bald Uebung.
ie ersten Tage nach unserer Eiswanderung wurden, wie oben erwähnt,
zur Instandsetzung unserer Ausrüstung benutzt. Wir hatten bedecktes,
mildes Wetter mit Regen, weshalb wir unseren Aufbruch nicht beeilten;
wir hofften auf klares Wetter mit Nachtfrösten. Zu unserer Ernährung
bedienten wir uns in diesen Tagen im wesentlichen der Seevögel, die wir
während unserer Bootsfahrt an der Ostküste entlang geschossen hatten,
und die wir bis dahin aus Mangel an Zeit nicht verzehren konnten. Sie
mundeten ganz vorzüglich; es war ein köstlicher Anblick, uns auf dem
Berge um den Kochtopf herum — der aus einem Blechkasten bestand, in
dem wir Brot gehabt hatten — lagern zu sehen; mit den Fingern holten
wir uns dann je einen Vogel aus der Brühe, rissen ihn auseinander und
verzehrten ihn mit Hülfe der Zähne und Finger. So moderne Einrichtungen
wie Gabeln hatten wir selbstredend nicht; ich kann auch aus eigener
Erfahrung versichern, daß dies ganz überflüssige Geräthschaften
sind, — die Gabeln, die wir vom lieben Gott bekommen haben, sind
außerordentlich praktisch, wenn man sie nur nicht in allzuheiße
Kochtöpfe hineinsteckt; aber darin gewinnt man gar bald Uebung.
Am 14. August wurde das Wetter besser, und nun beschlossen wir, Ernst aus der Sache zu machen. Nach Sverdrups[S. 72] und meiner Ansicht ließ sich das Inlandseis am besten von dem Berge aus erreichen, auf dem wir in jener Nacht gewesen waren, d. h. falls derselbe von der See aus einigermaßen zugänglich war.

Wir ließen deshalb unsere Böte noch einmal ins Wasser hinab, packten alles hinein und zogen von dannen, um, wenn möglich, die Besteigung nun endlich in Angriff zu nehmen. Aber Niemand von uns hatte den Berg von unten gesehen, und nun stellte es sich heraus, daß er ganz steil war, und daß ein Erklimmen mit unserer schweren Ausrüstung mit zu großen Schwierigkeiten verknüpft sein würde. Da blieb uns denn nichts übrig, als zu unserem Zeltplatz zurückzukehren und von dort aus anzufangen.
Noch einmal wurden unsere Böte gelöscht, und erst spät in der Nacht waren wir mit allem fertig.
[S. 73]
Am folgenden Tage (15. August) wurden die Böte an ihre bleibende Ruhestätte in eine kleine Bergschlucht gebracht, wo sie einigermaßen geschützt waren. Wir legten sie sorgfältig hin, den Kiel nach oben und belasteten sie des Windes wegen mit schweren Steinen; hoffentlich liegen sie dort noch. Unter die Böte legten wir ein kleines Depot von Munition, getrocknetem Seehundsfleisch und a. m. Einiges Handwerkszeug, hauptsächlich zum Boote gehörend, blieb ebenfalls zurück, darunter ein Segelmacherhandschuh, den wir später schmerzlich entbehren sollten. Wie bereits früher erwähnt, war es auch meine Absicht, eine von unseren Büchsen hier zurückzulassen, als es aber so weit war, fanden wir jedoch, daß sie zu hübsch war, um sich davon zu trennen.
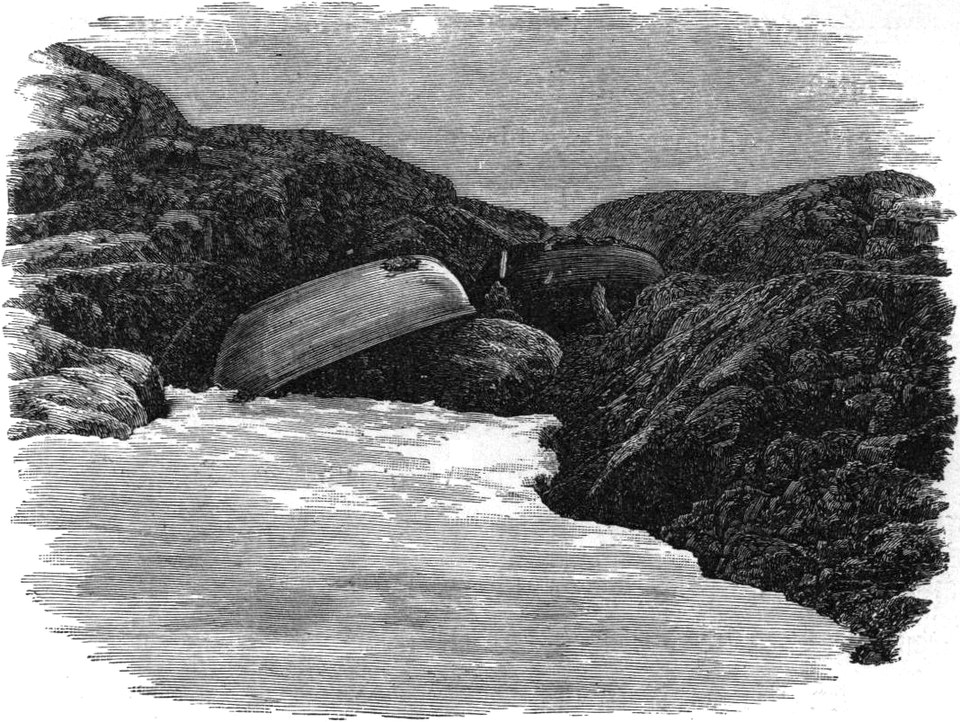
Auf ein kleines Stück Papier schrieb ich einen kurzgefaßten Bericht über das Schicksal der Expedition bis zu diesem Tage,[S. 74] verwahrte ihn gut in eine kleine Blechdose, und legte sie in die Brotkiste, die zu dem Walfischfangboot gehörte und die unter demselben aufbewahrt wurde. In diesem Bericht sage ich u. a., daß wir der besten Hoffnung sind, glücklich bis zur Westküste zu gelangen, wenn wir nur genug Frost bekommen. Davon sollten wir nun wahrhaftig mehr als genug verspüren!
Die Lappen schlugen vor, einen unserer großen Schlafsäcke zurückzulassen, in dem andern, meinten sie, könnten sehr wohl vier Mann schlafen, und sie wollten Beide in ihren Pelzen liegen; das könnten sie selbst bei einer Kälte von 40° aushalten. Ich hielt es jedoch für richtiger, die Sache erst ein wenig mit anzusehen, ehe wir uns von den Schlafsäcken trennten, wir konnten ja möglicherweise doch noch Verwendung für dieselben haben. Balto meinte ganz entschieden, daß diese Fürsorge überflüssig sei, es sei nur überflüssiges Gepäck, was wir da mit uns herumschleppten. Sehr lange sollte er jedoch nicht dieser Ansicht sein.
Da es am Tage sehr warm war, und der Schnee infolgedessen weich wurde, beschlossen wir, während der Nacht zu wandern und am Tage zu schlafen. Ungefähr um 9 Uhr Abends waren die Schlitten beladen, und wir begannen unsere Wanderung, deren Ziel Kristianshaab war. Im Anfang ging es nur langsam; die Schneefläche, über die wir hinzogen, reichte freilich bis an den Strand hinab, so daß wir die Schlitten von unten an ziehen konnten, aber die Steigung war steil, und wir mußten zu Dreien an jedem Schlitten ziehen und kurze Touren machen. Die Schlitten waren ziemlich schwer, auf jedem befanden sich über 100 kg. Als wir so hoch hinaufgekommen waren, daß wir sie einzeln ziehen konnten, luden wir den Inhalt ein wenig um, so daß jeder der vier Schlitten ungefähr 100 kg Gepäck enthielt, während der fünfte, der von Zweien gezogen wurde, ungefähr das doppelte Gewicht hatte.
[S. 75]
In dieser Nacht hatten wir gutes Wetter mit etwas Frost, gerade so viel, daß der Schnee ein wenig härter wurde. Mit Ausnahme der starken Steigung war die Eisfläche einigermaßen gut; auf Risse im Eise stießen wir nicht. Gegen Morgen kamen wir an ziemlich schlimmes Eis mit zahlreichen Schluchten und Unebenheiten, die Oberfläche war jedoch noch hart, so daß die Schlitten gut darüber hinglitten. Nachdem wir etwa eine halbe Meile zurückgelegt hatten, schlugen wir unser Zelt in einer Höhe von ungefähr 180 m auf. Es war ein wahrhaft himmlischer Genuß, ein halbes Dutzend Tassen warmen Thees mit kondensirter Milch trinken und dann in die Schlafsäcke kriechen zu können. Wir waren wohl Alle der Ansicht, daß wir angenehmere Arbeit gekannt hatten, aber wir schwiegen wohlweislich darüber. Gerade als wir uns schlafen legen wollten, entdeckten wir, daß wir unser einziges Stück Schweizer Käse an dem Orte hatten liegen lassen, wo wir gegen Mitternacht unsere Mittagsmahlzeit einnahmen. Dies Stück Käse im Stich zu lassen, war im Grunde zu viel verlangt, aber wir waren so müde, daß man ebenso wenig von uns verlangen konnte, jetzt zurück zu laufen und es zu holen. Da erbot sich Dietrichson freiwillig, zurückzugehen, er thäte es gern, sagte er, dann bekäme er einen Morgenspaziergang, ehe er sich schlafen legte, und könnte sich gleichzeitig ein wenig umsehen, was in Bezug auf seine Karte ganz praktisch sei. Voller Bewunderung sah ich ihm nach, wie er frank und frei dahinschritt, — ich konnte nicht begreifen, wie Jemand Lust verspürte, nach dieser anstrengenden Nachtarbeit einen Morgenspaziergang zu machen.
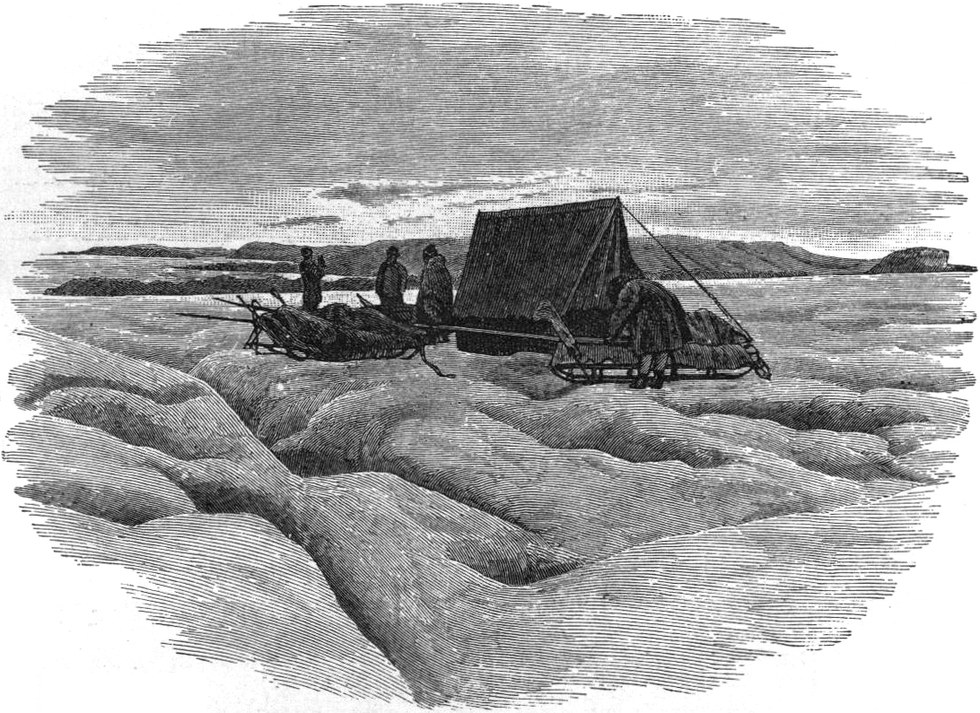
Gegen Abend zogen wir weiter über dasselbe unebene Eis. Um Mitternacht wurde es so dunkel, daß wir nicht sehen konnten, deshalb schlugen wir um 11 Uhr unser Zelt auf, kochten Schokolade und erwarteten das Tageslicht. Wir kamen jetzt an[S. 76] ebeneres Eis, aber der Schnee wurde loser und die Risse häufiger, die meisten derselben konnten wir jedoch mit ziemlicher Leichtigkeit umgehen. Als der Morgen dämmerte, fing es an zu regnen, und der Regen nahm allmählich derartig zu, daß es nicht mehr angenehm war. Natürlich zogen wir Alle unsere Regenkostüme an, aber die waren nichts weniger als wasserdicht; der Regen strömte so auf uns herab, daß wir bald bis auf die Haut durchnäßt waren. Wir hatten auch nicht einen trocknen Faden mehr auf dem Leibe. Zum Frieren hatten wir freilich keine Veranlassung, obwohl ein ziemlich scharfer Wind blies; die Arbeit hielt uns warm, und wir mußten uns aus Leibeskräften anstrengen, aber es war nicht angenehm zu fühlen, wie das Zeug Einem am Leibe festklebte und jede Bewegung hinderte. Bis über den Vormittag hinaus zogen wir rastlos weiter. Die Steigung war jetzt nicht mehr so stark, wir konnten die Schlitten jetzt zu Zweien ziemlich leicht ziehen. Da[S. 77] waren zahlreiche Spalten, weshalb wir uns in acht nehmen mußten. Wir konnten uns nicht mit den Seilen aneinander festbinden, da es zu schwer wurde; wir mußten uns damit begnügen, mit den Schlitten vermittelst des starken Ziehtaues verbunden zu sein, das an dem soliden Ziehgurt befestigt war, den wir um den Leib trugen. Wenn wir durch die Schneebrücken über den Rissen fielen, so blieben wir auf diese Weise dort hängen, und so lange der Schlitten nicht mit hinabgerissen wurde, was nicht sehr wahrscheinlich war, da er eine ziemliche Länge hatte, — konnten wir ohne Gefahr hängen bleiben, bis Einer der Anderen uns zu Hülfe kam. Es geschah übrigens nur selten, daß wir versanken und zwar nie weiter als bis an die Arme, brachten wir dann unsern Stock oder die Eisaxt quer über der Spalte an, so konnten wir uns ohne Hülfe aus dieser unangenehmen Lage befreien. Es war in der Regel leicht, die[S. 78] langen Schlitten über die Risse zu bringen, sie hatten eine so große gute Tragefläche, und es handelte sich nur darum, sie schnell hinüber zu bekommen, dann glitten sie sicher über den Abgrund hinweg, selbst wenn es hie und da unter ihnen krachte.

Gegen 12 Uhr des Vormittags machten wir endlich Halt und schlugen unser Zelt auf einer kleinen Fläche zwischen zwei mächtigen Spalten auf. Das Wetter war jetzt ganz unmöglich geworden. Wir bekleideten den äußeren Menschen mit trockenem Zeug und erwärmten den inneren durch unzählige Tassen heißen Thees. Nachdem wir unsere Stäbe und Schneeschuhe unter den Zeltboden gelegt hatten, um ein trockenes Lager herzurichten, und uns, so gut es ging, gegen den Regen geschützt hatten, krochen wir in unsere Kojen; die rauchenden Mitglieder der Expedition erhielten auch eine Pfeife Tabak, und nun befanden wir uns äußerst wohl, während draußen Sturm und Regen tobten. Drei Tage und drei Nächte, also vom Mittag des 17. August bis zum Vormittag des 20., wurden wir von einem furchtbaren Wetter mit Sturzregen und Sturm ans Zelt gebannt. Während dieser ganzen Zeit verließen wir unsere Schlafsäcke nur auf kurze Augenblicke, um uns Essen zu holen oder dergleichen. Den größten Theil der Zeit verschliefen wir, — gleich im Anfang schliefen wir volle 24 Stunden ohne Unterbrechung. Die Essenrationen wurden auf das kleinste Quantum beschränkt, da wir nicht arbeiteten, bedurften wir auch nicht so vieler Nahrung; ein wenig mußten wir freilich haben, um das Leben in uns aufrecht zu erhalten, deswegen aßen wir ungefähr einmal am Tage, — einige der Gefährten fanden allerdings, daß dies herzlich wenig war, und behaupteten, ihre Magen schrien vor Hunger. Wenn wir nicht aßen oder schliefen, füllte man die Lücken im Tagebuch aus, erzählte Geschichten, las in den Büchern der nicht sehr zahlreichen Bibliothek, die aus dem Seekalender,[S. 79] der Logarithmentabelle und anderen ähnlich interessanten Büchern, sammt einer Abhandlung von Professor Helland über die mit Eis angefüllten Fjorde Grönlands bestand. Ravna und Balto lasen, wie gewöhnlich, in ihrem Testament. Am liebsten verbrachten wir jedoch unsere Zeit damit, das Zeltdach zu studiren und dem Plätschern des Regens und dem Winde zu lauschen, der die Zeltwände und Pardunen rüttelte und schüttelte.
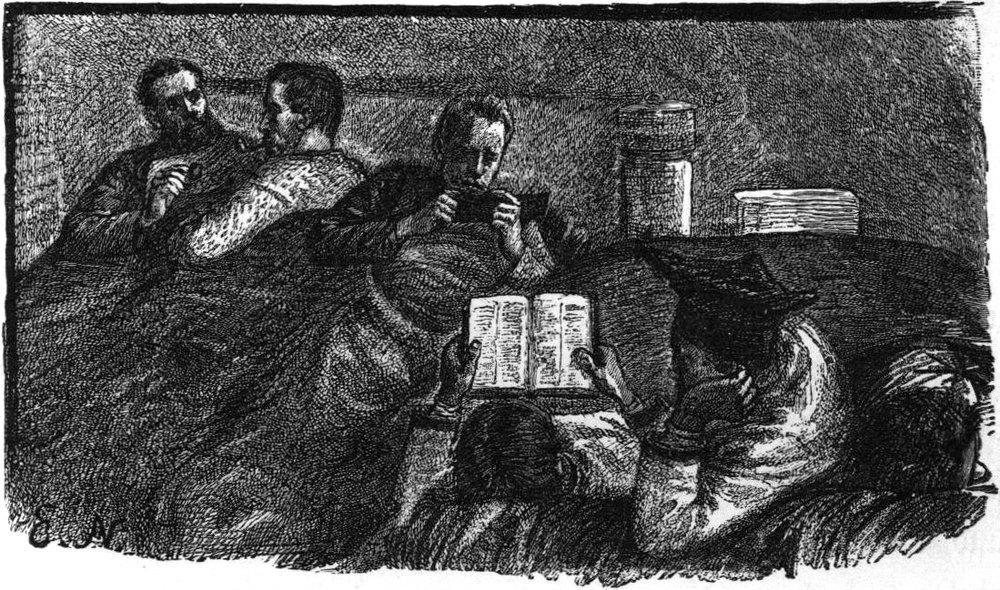
Endlich, am Vormittag des 20. August, besserte das Wetter sich so weit, daß wir unsere Wanderung fortsetzen konnten. Vorher nahmen wir aber noch eine kräftige Mahlzeit mit warmer Linsensuppe ein, die uns für die Hungerkur der vorhergehenden Tage entschädigen sollte.
Wir hatten noch immer stark zerklüftetes Eis; als wir den Versuch machten, eine Höhe zu erklimmen, die gerade vor uns lag, nahmen die Risse in dem Grade zu, daß wir nicht weiter kommen konnten, sie liefen nämlich nicht alle parallel, sondern schnitten sich in zwei Richtungen quer auf einander, und da ist man bald mit seiner Kunst zu Ende. Wir mußten zurück,[S. 80] um unsern Kurs nordwärts zu richten, und fuhren nun, auf den Schlitten sitzend, hinab, zwischen den Rissen hindurch, natürlich mußten wir aber gut acht geben, um nicht in der Tiefe zu verschwinden.
Weiter nach Norden zu wurde das Eis besser, die Steigung war nicht mehr so stark und der Weg überhaupt besser. An einzelnen Stellen konnten wir sogar Jeder einen Schlitten ziehen, nur Sverdrup und ich gingen mit dem schweren Schlitten voran, um das beste Eis auszusuchen. Der Regen hatte das Terrain scheinbar sehr verbessert, denn der Schnee war fester geworden oder auch zum Theil ganz weggewaschen. Wir sanken jedoch noch tief genug ein; sobald wir nur Frostwetter bekämen, würde es vorzüglich werden. Die Oberfläche war immer noch uneben, und Balto schreibt in seiner Schilderung darüber:
„Am 20. (soll 22. sein) wurde das Inlandseis schrecklich uneben, es sah aus wie große Meereswellen, und es war entsetzlich schwer, die Schlitten auf die Wellen hinauf zu schleppen, und wenn man dann wieder hinabging, kamen die Eisstücke hinter uns hergerollt. Das Seil, an dem wir die Schlitten zogen, schnitt so in die Schultern ein, daß wir ein Gefühl hatten, als seien wir verbrannt.“
Am Abend gegen 8 Uhr hatte es den Anschein, als ob der Himmel sich aufklären wollte, und da wir es als sicher ansahen, daß in dem Falle Frostwetter eintreten würde, machten wir sofort Halt und schlugen unser Zelt auf, um lieber zu warten, bis das Terrain hart geworden war.
Am nächsten Morgen, den 21. August, gegen 4 Uhr weckte ich die Kameraden. Der Himmel war wolkenlos, und obwohl das Thermometer zeigte, daß die Luft noch Wärmegrade enthielt, hatte sich doch eine so harte Kruste auf dem Eise gebildet, daß es uns trug. Die Steigung war noch immer stark, und[S. 81] die Spalten waren groß und zahlreich, aber ohne weitere Unglücksfälle rückten wir heute in dem herrlichsten Wetter vor und hielten im warmen Sonnenschein, der den Schnee weicher und weicher machte, bis hoch in den Vormittag hinein aus. Allmählich wurden die Anstrengungen jedoch unerträglich, und ein verzehrender Durst quälte uns. Trinkwasser gab es nicht mehr, wir sollten es erst an der Westküste wiederfinden. Den einzigen Ersatz dafür mußten wir in dem Wasser suchen, das wir gewannen, indem wir unsere Feldflaschen aus Blech mit Schnee füllten und sie an der Brust, zuweilen sogar am bloßen Leibe trugen. Wenige von uns waren jedoch warmblütig und geduldig genug, um zu warten, bis der Schnee sich in Wasser verwandelte, man sog lieber allmählich, als er anfing, ein wenig feucht zu werden, die Wassertropfen ab, und so konnte denn nichts aus dem Trinkwasser werden.
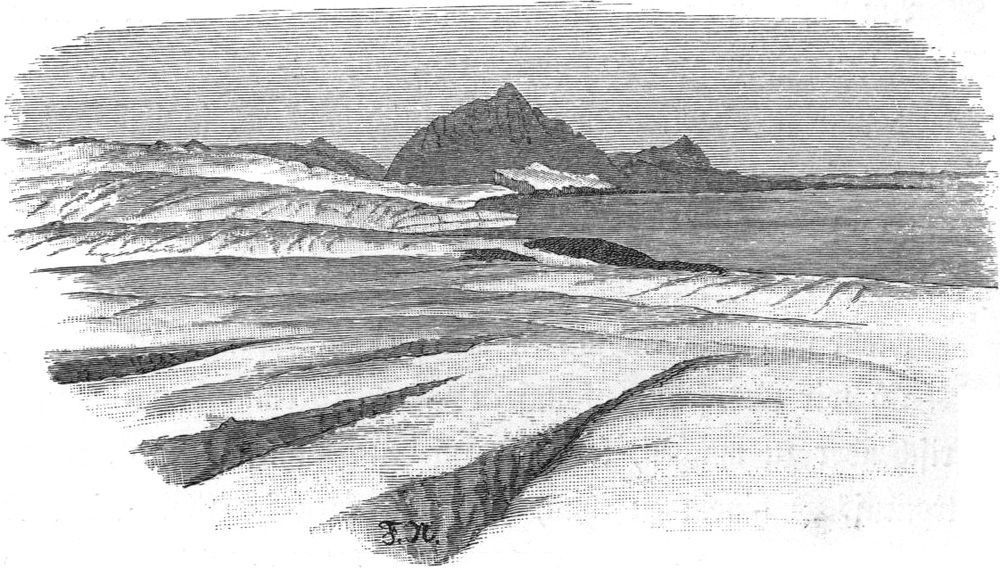
Endlich gegen 10 Uhr vormittags erreichten wir die Höhe, die wir uns als Ziel gesetzt hatten; wir waren ¾ Meilen an jenem Tage gegangen. Von hier aus war die Steigung[S. 82] nur schwach und das Eis ganz frei von Rissen. Wir waren der Ansicht, daß jetzt die erste Schwierigkeit auf dem Inlandseise überwunden sei, deswegen hielten wir eine ganz kleine Festmahlzeit, die aus einer Extraration Haferkakes, Mysekäse und Preißelbeerkompot bestand. Wir waren jetzt auf einer Höhe von ca. 870 m angelangt und konnten einzelne Nunataks weiter nach dem Lande hinein erblicken, — in nördlicher Richtung hatten wir deren schon eine ganze Reihe gesehen.
Am Morgen des 22. August um zwei Uhr zogen wir weiter. Wir hatten einen guten Nachtfrost gehabt (-5° C.), und der Schnee war steinhart, aber ungewöhnlich uneben, so daß unsere Schlitten sogar mehrmals umwarfen. Gegen 9 Uhr hatte die Sonne wieder so viel Kraft, daß wir unser Zelt aufschlagen mußten, nachdem wir ungefähr eine Meile zurückgelegt hatten.
Mehr und mehr empfanden wir jetzt den Mangel an Wasser, weshalb wir uns sehr auf unsern Thee freuten. Um ihn noch erfrischender zu machen, kam ich auf den genialen Einfall, etwas Citronensäure hinein zu thun, — wir wußten ja Alle, daß Thee mit Citronensaft vorzüglich schmecken sollte. Wir vergaßen freilich, daß wir bereits kondensirte Milch hinzugefügt hatten, und wer beschreibt unsere Enttäuschung als die Milch, sobald die Citronensäure sich mit dem Thee vermischte, in großen Klumpen an den Boden des Gefäßes fiel. Wir tranken den Thee dessen ungeachtet, aber der Versuch wurde nicht wiederholt.
Gegen 9 Uhr des Abends zogen wir wieder weiter. Das Eis war noch immer sehr uneben, die Schlitten mußten bald auf die Kämme der Eiswogen hinaufgezogen werden, bald stürzten sie in die Wellenthäler hinab. Es ruckte und zog höchst unangenehm in den Schultern und dem Oberkörper, und Baltos Ausdruck, daß man ein Gefühl hatte, als habe man sich verbrannt, ist sehr bezeichnend.
[S. 83]
Wenn also unsere Arbeit auch oft recht hart war, so hatten wir doch auch einen Ersatz in diesen Nächten mit Nordlicht und Mondschein, — denn auch dieser Theil der Erde besitzt seine Schönheiten. Wenn das ewig wechselnde Nordlicht seinen märchenhaften Tanz an dem südlichen Himmel in strahlenderer Pracht als sonst irgendwo antrat, so konnten wir alle Mühseligkeiten und alle Anstrengungen vergessen, oder wenn der Mond aufging und seine schweigsame Bahn über den sternbesäeten Himmel zurücklegte, auf den Gipfeln der Eiskämme spielend und die ganze todte, erstarrte Eiswelt in seinem Silberglanz badend, da senkte sich ein tiefer Friede über uns, und das Leben wurde uns zur Schönheitsoffenbarung. Ich bin fest überzeugt, daß diese nächtlichen Wanderungen über das grönländische Inlandseis einen unauslöschlichen Eindruck auf alle Theilnehmer der Expedition gemacht haben.
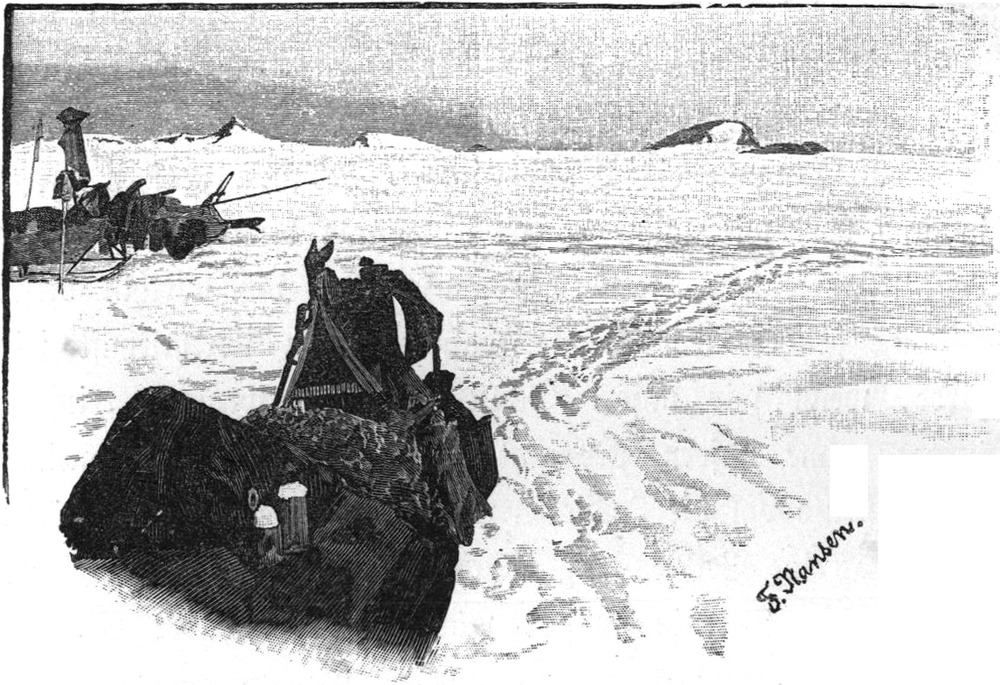
Als wir um Mitternacht an eine steile und schwierige Steigung kamen, verschlimmerte sich unsere Situation: für jeden[S. 84] Schlitten waren jetzt mehrere Personen erforderlich, und trotzdem war die Arbeit fast unüberwindlich. Als wir dann aber einige hundert Fuß hoch an eine Eisfläche kamen, die sich so weit erstreckte, wie das Auge im Mondlicht reichen konnte, und die so hart und glatt war, wie das Eis auf einem stillen Binnengewässer, — da kannte unsere Freude und unser Staunen keine Grenzen. Ueberaus froh zu Muthe, schlugen wir unser Zelt gegen 2 Uhr auf, um ein wenig zu ruhen, Kaffee zu kochen und ein wenig zu essen, ehe wir weiter zogen. Wir waren ganz außer uns vor Entzücken über dies herrliche Terrain, — man konnte wohl kaum ein besseres finden, — und sprachen lange hin und her, wie lange es wohl währen könne, bis wir die Westküste erreichten, falls der ganze Weg bis dorthin dieser Eisfläche gliche. Ich meinte, daß es ganz vortheilhaft sein würde, wenn wir unsere Schlittenlast ein wenig verringern könnten, ohne unsern Proviant zu schmälern. Balto meinte, wir könnten wohl die Indianertruger zurücklassen, für die hätten wir sicher keine Verwendung. Ich erwiderte, das sei zutreffend, so lange das Terrain so gut wäre; es könne aber Niemand wissen, wie lange das währen würde. Da entgegnete Balto: „Zum Teufel auch, Ravna dort ist Berglappe und hat 45 Jahre in den Bergen gelebt, aber er sagt, er hat niemals solch Zeug benützt, und Niemand soll ihn alten Mann jetzt dazu zwingen, und dasselbe sage ich auch. Ich bin ebenfalls Lappe, und Niemand soll uns Lappen etwas auf dem Schnee lehren.“ Ich antwortete ihm lachend: „Ihr Lappen haltet Euch freilich für entsetzlich klug, aber trotzdem könnt Ihr noch verschiedenes lernen, ehe Ihr wieder nach Hause kommt“ — und ich erinnerte ihn daran, wie es mit den Schneebrillen ging, die er, als ich sie ihm in Kristiania zeigte, etwas unnützes nannte. Die Lappen aber waren es, die der Brillen zuerst bedurften.
[S. 85]
Balto meinte, mit den Brillen, das sei etwas ganz anderes. Er könne ja nicht leugnen, daß er sie jetzt sehr zweckmäßig finde, aber diese Truger? Nein! Er verschwur sich hoch und heilig, daß er sie niemals an seine Füße schnallen werde. Er war jetzt so üppig geworden, daß er sich die Sünde, ganz nachdrücklich zu fluchen, häufiger leistete; das war übrigens für uns Andere ganz erbaulich, da es uns ein Beweis war, daß er sich wohl fühlte.
Leider währte die Freude mit dem glatten Eis nicht lange. Den Tag hindurch hielt es freilich an, und ein günstigeres Terrain wie dies hat wohl Niemand auf Grönlands Inlandseis erblickt. Wenn man es abgehobelt hätte, so könnte es nicht besser gewesen sein. Die Steigung war eben mit einem fast unmerklichen, langgestreckten Wogengang.
Um 11 Uhr des Vormittags machten wir Halt und schlugen unser Zelt auf. Die Sonne schien ebenso wie an den vorhergehenden Tagen derartig auf das Zelt, daß es dort ziemlich warm zum Schlafen war, einem der Gefährten wurde es sogar so warm, daß er hinausging und sich auf ein Persenning in den Schatten des Zeltes legte, um schlafen zu können.
Um ½7 Uhr waren wir wieder auf den Beinen. Als wir weiter kamen, verschlechterte sich das Terrain; ein feiner, frischgefallener Schnee bedeckte das harte Eis.
Wir merkten bald, daß wir mehr Nachtfrost bekommen würden, als uns lieb war, denn auf diesem staubfeinen, frischgefallenen Schnee glitten die Stahlschienen unter unsern Schlitten bei der Kälte von 7–8 Grad, die wir ungefähr hatten, wie über Sand, und nachdem wir ungefähr ¾ Meilen zurückgelegt hatten, sahen wir ein, wie thöricht es war, unsere Wanderung zu dieser Zeit fortzusetzen, jetzt war es vortheilhafter, am Tage zu gehen, wenn der Schnee nicht so hart war. Gegen 10 Uhr schlugen wir deshalb unser Zelt auf.
[S. 86]

Da die Last auf unsern Schlitten so groß war, daß es nicht schaden konnte, wenn sie ein wenig geringer würde, sannen wir lange darüber nach, ob wir nicht irgend etwas entbehren könnten. Zuerst verfielen wir auf die Oeltuchüberzüge zu unsern Schlafsäcken. Wir waren nun so weit gelangt, daß von außen her keine Feuchtigkeit zu befürchten war, außer in Form von Schnee, und der mußte abgebürstet und auf andere Weise vermieden werden, folglich waren die Ueberzüge überflüssig. Sie aber zurückzulassen, ohne daß sie irgend welchen Nutzen stifteten, das hielten wir für eine Thorheit, das Oeltuch war brennbar, folglich konnten wir damit kochen. Das war eine gute Idee, die allgemeinen Anklang fand. Es handelte sich nur darum, einen Kochtopf zu finden. Aber alle Brotdosen waren infolge der Behandlung und der Stöße, denen sie ausgesetzt gewesen, leck geworden. Endlich fanden wir eine, die einigermaßen dicht hielt, und nun machten wir uns drinnen im Zelt ans Kochen. Die Blechdose wurde wie gewöhnlich mit Schnee gefüllt und mit Hülfe der Stahlstangen, die unter unsern Schlittenschienen gewesen waren, so aufgestellt, daß wir Feuer darunter anmachen konnten. Wir zerrissen das Oeltuch in schmale Stücke und zündeten es in einer stählernen Schneeschaufel unter unserm Kessel an. Die Oeltuchstreifen brannten vorzüglich, die Flamme schlug hoch an den Seiten des Blechkessels in die Höhe und warf einen schönen röthlichen Schein in den Zeltraum und auf die 6 Männer, die um das Feuer herum saßen, in die Gluth starrend und bei sich denkend, daß das Leben jetzt erst anfange, wirklich gemüthlich zu werden. Aber alle Freuden auf dieser Erde sind von kurzer Dauer, und das Kochen mit Oeltuch in einem Zelt ohne Rauchfang, das ist die flüchtigste Freude, an der ich theilgenommen habe. Das Oeltuch rauchte nämlich derartig, daß das Zelt nach Verlauf von wenigen Minuten so voll von Rauch[S. 87] war, daß wir uns kaum gegenseitig hätten sehen können, selbst wenn wir im stande gewesen wären, unsere Augen aufzuhalten. Es nützte nichts, daß wir die Zeltthür öffneten, denn wenn auch etwas Rauch hinausging, so wurde er sofort ersetzt, und das Rauchmeer wurde dichter und dichter, die Freude an unserm Feuer war uns längst vergangen. Wenn man das eine Auge ein wenig öffnete, so erblickte man nur einen matten Lichtschimmer durch den dichten Nebel. Die meisten der Gesellschaft erwählten den vernünftigsten Theil, indem sie sich in die Schlafsäcke begaben und die Klappe über dem Kopf fest zuzogen. Zwei mußten jedoch ausharren, um auf das Feuer Acht zu geben,[S. 88] so daß der Schnee geschmolzen und der Thee gekocht werden konnte. Indem man bald das eine, bald das andere Auge ein klein wenig öffnete und den Kopf von Zeit zu Zeit aus der Zeltthür steckte, um eine Portion frischer Luft einzusaugen, ging es so einigermaßen, und der Schnee begann zu schmelzen. Das Kochgeschirr erwies sich jedoch leider als sehr leck und wir mußten etwas anderes ausfindig machen. Der Deckel von der Blechdose, die unsere Apotheke enthielt, war sicher dicht, aber er faßte nur die halbe Portion, die wir nöthig hatten. Uns blieb jedoch nichts anderes übrig, als ihn neben der Blechdose anzuwenden; indem wir letztere auf die Seite stellten, wo sie am wenigsten leckte, ging es einigermaßen. Wir heizten tüchtig unter und verwandelten das Zelt in eine wahre Hölle, bis das Wasser kochte und ich unsern Thee bereitete.
Am nächsten Morgen kochten wir abermals mit Oeltuch, waren nun aber so vernünftig, den Feuerherd draußen vor das Zelt zu verlegen. Wir schmolzen eine tüchtige Portion Schnee, die außer zu einer guten warmen Kerbelsuppe mit Fleischpepton ausreichte, um unseren Durst wirklich einmal ganz zu stillen. Das Wasser wurde durch einen Zusatz von Citronensäure, Citronenöl und Zucker in die köstlichste Limonade verwandelt. Dies war das letzte Mal, daß wir unseren Durst löschen sollten, bis wir an die Westküste gelangt waren, denn wir mußten sehr sparsam mit dem Brennmaterial umgehen.
Es gewährte einen ganz eigenthümlichen Anblick, als wir uns an jenem Morgen bei hellem Tageslicht wiedersahen. Großer Gott, wie wir aussahen! Mit unserer Gesichtsfarbe, die bis dahin ziemlich hell gewesen, und die Wind und Wetter ziemlich reingewaschen, war eine vollständige Veränderung vorgegangen. Hie und da saßen so dicke Rußkleckse, daß wir sie mit dem Messer abkratzen konnten, besonders alle Runzeln und Unebenheiten[S. 89] waren mit diesem Stoff gefüllt, wie sich große Mengen davon auf allen vorspringenden Gesichtstheilen, wie Augenbrauen, Kinnbacken, Unterlippe, Kinn u. s. w., angesammelt hatten. War man von Natur mit blondem Haar und Bart ausgestattet, so war dies jetzt ganz rabenschwarz geworden, nur die Augäpfel und die Zähne waren weiß geblieben und glänzten ganz unheimlich aus dem schwarzen Gesicht heraus.
Wenn ich erzähle, daß wir uns trotz solcher Unregelmäßigkeiten nicht wuschen von dem Augenblick an, wo wir den Jason verließen, bis zu dem Tage, wo wir die Westküste erreichten, so werden kurzsichtige Leser uns gewiß für große Ferkel halten. Aber das müssen wir hinnehmen. Ich will hier doch hinzufügen, daß wir unter gewöhnlichen Umständen die Gewohnheit hatten, uns zu waschen; wenn es aber auf dieser Reise nicht geschah, so hatte es seine guten Gründe. Erstens hatten wir auf dem Inlandseise nur das wenige Wasser, das wir am Morgen und am Abend auf Spiritus schmolzen, und das noch geringere Quantum, das wir im Laufe des Tages auf unserem eigenen Körper schmelzen konnten. Wenn man nun, wie das bei uns der Fall war, stets einen brennenden Durst hatte, und Einem die Wahl gestellt wurde, diese Portion Wasser entweder zum Waschen oder zum Trinken zu benutzen, oder auch, sich erst damit zu waschen und dann zu trinken, — so glaube ich, daß selbst die beschränktesten Menschen, wenn es so weit kommen sollte, es vorziehen würden, das Wasser ausschließlich zum Trinken zu benutzen.
Zweitens ist es ein sehr zweifelhaftes Vergnügen, sich bei einer Temperatur zu waschen, in der das Waschwasser gefriert, falls es einige Minuten steht, in der die Finger steif frieren, ehe sie aus dem Waschbecken an das Gesicht gelangen, und in der das Gesicht ebenso friert, sobald es mit dem Wasser in Berührung[S. 90] kommt. Ich glaube, es giebt nicht viele Menschen, die unter diesen Umständen etwas anderes als eine theoretische Beredsamkeit für die Reinlichkeit übrig haben.
Drittens aber war es uns geradezu untersagt, uns zu waschen, selbst so lange wir Wasser genug hatten und es warm genug dazu war, und zwar aus dem Grunde, weil es bei einem Sonnenschein, wo das Licht nicht allein von oben kommt, sondern auch von dem Schnee zurückgestrahlt wird, seine Gefahren hat, verschwenderisch mit dem Wasser umzugehen. Das Sonnenlicht greift nämlich in diesem Fall die Haut stark an, so daß sie spröde wird und abblättert, ja es können sogar Wunden dadurch entstehen, die große Unannehmlichkeiten und heftige Schmerzen verursachen. Ich glaube, Niemand wird lange zögern, wenn er zwischen diesen Uebeln und Unreinlichkeit seine Wahl treffen soll. Es würde vielleicht einen guten Eindruck machen, wenn wir anstandshalber sagen wollten, daß es uns sehr schwer geworden sei, uns während einer so langen Zeit nicht waschen und unsere Kleider nicht wechseln zu können, leider aber schulden wir es der Wahrheit, zu gestehen, daß wir uns ganz außerordentlich wohl dabei fühlten.
Während des 24. August hatten wir ein ganz elendes Terrain, der frischgefallene Schnee wurde härter und härter und war dabei so tief, daß wir jetzt oft bis zu vier Zoll versanken; außerdem hatten wir eine starke Steigung zu überwinden. Um den Muth aufrecht zu halten, wurde jede Viertelmeile, die wir zurücklegten, mit einer Tafel Fleischpulverschokolade pro Mann belohnt.
Unsere Mittagsmahlzeit, die wir am Nachmittag abhielten, wurde abermals mit Oeltuch gekocht, doch benutzten wir außerdem als Brennmaterial noch ein Reservestativ unseres Theodolits, das überflüssig war, sowie eine Anzahl von Holzschienen zum Verbinden gebrochener Arme und Beine, die wir bis dahin in[S. 91] unserer Apotheke mit uns geführt hatten; jetzt, wo wir das zerklüftete Eis glücklich hinter uns hatten, hielten wir die meisten dieser Schienen wie auch die Gipsverbände für überflüssig und entledigten uns ihrer.
Wir behielten nur einen ganz kleinen Bedarf zurück für den Fall, daß beim Herabsteigen durch das zerrissene und zerklüftete Eis, das wir an der Westküste vorzufinden glaubten, ein Unglück geschehen sollte.
Am Abend wurde es, sobald die Sonne untergegangen war, wieder fühlbar kalt, der Schnee wurde schwieriger denn je, und wir schlugen unser Zelt auf. Wir hatten an jenem Tage nicht mehr als eine Meile zurückgelegt.
Da nur wenige Stunden verflossen waren, seit wir unser Mittagsmahl verzehrt hatten, einigten wir uns dahin, vor dem Schlafengehen nur einige von den dünnen Haferkakes zu uns zu nehmen. Hierzu genossen wir etwas Schnee, den wir mit Citronenöl, Citronensaft und Zucker vermischt hatten und der das erquicklichste Dessert bildete, das ich je gegessen habe. Es glich vollständig dem in Italien so gebräuchlichen „Granita“, ja, wenn man frischgefallenen und ganz feinen Schnee dazu verwendet, schmeckt es noch weit besser. Es war eine eigenartige Stimmung, die mich ergriff, als wir da draußen vor dem Zelt saßen, unseren Schnee und die spärlichen Kakes in so kleinen Bissen wie nur möglich genossen und dabei zum Mond aufschauten, der sein silbernes Licht über dies unendliche Schneemeer ergoß; unwillkürlich flogen meine Gedanken zu den Umgebungen zurück, in denen ich zuletzt Granita gegessen. Es war ebenfalls Mondschein, aber es war eine warme Sommernacht im Golf von Neapel, und das Mondlicht zitterte auf den dunklen Wogen des Mittelländischen Meeres. — —
Am 25. August war die Steigung noch immer stark, und[S. 92] das Terrain war noch schlechter, wir hatten jetzt 6–8 Zoll losen Schnee; dabei blies uns ein scharfer Wind gerade ins Gesicht, was die Situation bedeutend verschlimmerte.
Da wir fanden, daß unsere Mittagsrast uns reichlich Zeit nahm, faßten wir den glücklichen Gedanken, auf dem Schlitten zu kochen, während wir auf der Wanderung waren, wodurch wir die lange Zeit sparten, die wir sonst mit dem Kochen verbrachten. Der Kochapparat wurde hinten auf den einen Schlitten gestellt, wir entzündeten das Feuer, und während der Schnee sich allmählich in Wasser verwandelte, in das wir Bohnenwurst thaten, zogen wir unbekümmert weiter, ganz stolz über diese geniale Erfindung. Als die Suppe anfing zu kochen, machten wir Halt, schlugen unser Zelt auf und trugen den Apparat vorsichtig hinein; aber gerade in dem Augenblicke, als wir uns hinsetzen und uns an diesem königlichen Mahl delektiren wollten, machte ich eine ungeschickte Bewegung, das Kochgeschirr fiel um, und die kostbare Bohnensuppe floß mit dem brennenden Spiritus, mit Wasser und halbgeschmolzenen Schneeklumpen aus dem oberen Schmelzgefäß zusammen über den Zeltboden. Wie auf einen Zauberschlag waren alle Mann auf den Beinen, alles, was im Zelte lag und stand, wurde hinausgeworfen, wir faßten den Boden des Zeltes an allen Ecken an, so daß die Suppe sich in der Mitte in einer Vertiefung ansammelte und von hier aus wurde sie dann wieder in das Kochgeschirr geschöpft und weiter gekocht. Es war kaum ein Tropfen verloren gegangen! Unter solchen Umständen ist es sehr zweckmäßig, einen wasserdichten Segeltuchfußboden zu haben. Balto sagt von dieser Bohnensuppe, „daß sie freilich nicht ganz rein war, da der Fußboden ziemlich schmutzig war, aber das durfte nicht schaden. Sie schmeckte uns deswegen ebenso gut, denn unsere Magen waren ziemlich leer.“ Daß die Suppe einen kleinen Zusatz von Spiritus erhalten hatte,[S. 93] erwähnt er nicht; es war nur sehr wenig, und seiner Meinung nach erhöhte es nur den Wohlgeschmack.
Als wir endlich warm und gut in unserem Zelt saßen und unser Mittagsmahl in aller Ruhe verzehrten, zog ein unliebsamer Schneesturm herauf, zunächst freilich nur ein Gestöber, aber wir hatten es gerade im Gesicht, als wir weiter zogen, und gegen Abend nahm auch der Wind zu. Bei einer Kälte von neun Grad war das nicht sehr angenehm. Wir gingen indessen, so gut wir konnten, dagegen an und erklommen eine steile Höhe, die Köpfe vorübergebeugt, gleich Mönchen in unsere Kapuzen gehüllt, während der feine Schnee alle möglichen Anstrengungen machte, um in alle Poren und Oeffnungen unserer Regenkleider zu dringen. Erst spät am Abend schlugen wir unser Zelt auf und krochen in die Schlafsäcke. Zwei Haferkakes, eine kleine Tafel Fleischpulverschokolade und ein wenig Citronengranita mundeten uns vorzüglich, während wir auf unserem Lager ausgestreckt lagen und der Mond sein friedliches Licht durch eine Spalte in der Zeltthür warf. Wind und Schneegestöber glaubten wir ausgeschlossen zu haben.
Der Schneesturm raste die ganze Nacht hindurch, und als ich am nächsten Morgen (26. August) aufstand, um Kaffee zu kochen, war ich nicht wenig überrascht, als ich mich selbst, die Schlafsäcke, die Säcke mit unsern Kleidern, kurz alles unter Schnee begraben fand; er war durch alle Spalten eingedrungen und hatte das ganze Zelt angefüllt. Als ich die Füße in die Schuhe stecken wollte, waren auch diese voller Schnee, und als wir uns nach unsern Schlitten umsahen, waren sie halb verschwunden. An allen Seiten des Zeltes lagen große Schneeschanzen. Wir hatten doch trotz alledem einen angenehmen Sonntagmorgen mit Kaffee und Frühstück im Bett.
Der Schneesturm raste den ganzen Tag hindurch, und es[S. 94] wurde schwerer und schwerer ihm entgegen zu gehen, da der Schnee immer loser wurde. Ich überlegte, ob ich die Schlitten nicht zusammenbinden und den Versuch machen sollte, mit Hülfe von Segeln gegen den Wind zu kreuzen. Auf diese Weise konnte es lange währen, ehe wir Kristianshaab erreichten. Wir mußten auf eine Veränderung zum Guten hoffen; — an diesem Tage blieb aber alles beim Alten. Wir arbeiteten uns durch den Schnee, so gut wir konnten. Nachdem wir eine Viertelmeile zurückgelegt hatten, gelangten wir an eine Höhe, die wir erklimmen mußten; die Steigung war jedoch so steil, daß wir die Schlitten nur zu Dreien hinaufbefördern konnten, und trotzdem war es noch eine sehr beschwerliche Arbeit. Bei einer Aufmessung stellte es sich heraus, daß die Steigung ungefähr 1 Fuß auf 4 Fuß vorwärts betrug. Als wir nach einer Wendung wieder hinabstiegen, wandte sich Kristiansen, der nur selten eine Bemerkung machte, an Dietrichson und sagte: „Großer Gott, daß die Menschen es so schlecht mit sich selbst meinen, daß sie sich auf so etwas einlassen können!“
[S. 95]
 pät am Abend des 26. August machten wir Halt, nachdem wir eine Höhe
von ungefähr 1990 m erreicht hatten. Infolge der Erfahrungen, die wir
in der letzten Nacht gemacht hatten, trugen wir jetzt Sorge dafür, uns
besser gegen den Schneesturm und den feinen, alles durchdringenden
Schneestaub zu schützen. Wir schaufelten den Schnee fort, so daß wir
eine Schneeschanze an der Windseite erhielten, stellten außerdem einen
Schlitten gegen die Zeltwand, die gleichfalls nach der Windseite lag
und bedeckten ihn mit Persenningen, wodurch wir uns ein ziemlich
warmes Nest schufen. Wir waren alle in rosigster Laune, lautes Lachen
erschallte, und der Theekessel summte über der Spiritusflamme, die ein
schwaches Licht auf die kleine seltsame Gruppe in dem kleinen Raum
warf, wo trotz aller Vorsichtsmaßregeln der Schnee lustig herumwirbelte
und alles mit einer feinen weißen Schicht bedeckte.
pät am Abend des 26. August machten wir Halt, nachdem wir eine Höhe
von ungefähr 1990 m erreicht hatten. Infolge der Erfahrungen, die wir
in der letzten Nacht gemacht hatten, trugen wir jetzt Sorge dafür, uns
besser gegen den Schneesturm und den feinen, alles durchdringenden
Schneestaub zu schützen. Wir schaufelten den Schnee fort, so daß wir
eine Schneeschanze an der Windseite erhielten, stellten außerdem einen
Schlitten gegen die Zeltwand, die gleichfalls nach der Windseite lag
und bedeckten ihn mit Persenningen, wodurch wir uns ein ziemlich
warmes Nest schufen. Wir waren alle in rosigster Laune, lautes Lachen
erschallte, und der Theekessel summte über der Spiritusflamme, die ein
schwaches Licht auf die kleine seltsame Gruppe in dem kleinen Raum
warf, wo trotz aller Vorsichtsmaßregeln der Schnee lustig herumwirbelte
und alles mit einer feinen weißen Schicht bedeckte.
Als der Thee fertig war, zündeten wir eins der fünf Stearinlichter an, die ich zum Photographiren mitgenommen hatte, und dies machte den Abend äußerst gemüthlich. Was kümmerte es uns, daß der Sturm draußen heulte und die Wände unseres Zeltes erzittern machte!
[S. 96]
Als wir am nächsten Morgen (27. August) erwachten, hatte sich der Schneesturm noch immer nicht gelegt, aber das Zelt war doch nicht so voller Schnee wie am vorhergehenden Morgen. Da ich das Stampfen in dem losen Schnee gegen den Wind satt hatte, so beschloß ich, daß wir gleich an jenem Morgen einen Versuch machen wollten, unsere Schlitten mit Segeln zu bespannen. Hier stieß ich jedoch auf ziemlich starken Widerspruch, besonders von seiten der Lappen. Ravna setzte ein ganz jämmerliches Gesicht auf, und Balto schimpfte unbeschreiblich.
„Nun ja, zum Teufel auch! So verrückte Leute sind mir noch niemals vorgekommen. Sie wollten auf Schnee segeln!“
Er meinte, wir könnten ihn gewiß mancherlei lehren, wie z. B. das Segeln auf der See und dergl. m., ihn aber etwas auf dem Lande und gar auf dem Schnee lehren zu wollen, nein, das sollten wir uns nur nicht einbilden, das sei ein „Satans-Unsinn“. Er sparte nicht an Worten, aber es half ihm alles nichts, er mußte sich fügen, die Schlitten wurden nebeneinander hingestellt und zu zwei Flößen zusammengebunden, — das eine aus zwei, das andere aus drei Schlitten bestehend. Zu dem ersten Floß wurde der Zeltboden als Segel benutzt, bei dem andern, zu dem Balto, Ravna und Dietrichson gehörten, sollten zwei Persennings dieselben Dienste leisten.
Es war anfänglich meine Absicht gewesen, die Zeltwände hierzu zu benutzen, wir wagten es jedoch nicht, sie preis zu geben; sie waren zu dünn, und etwas Unangenehmeres als eine Beschädigung des Zeltes in diesen Umgebungen konnte uns nicht begegnen. Als die Persennings aufgespannt waren, riß der Wind sie jedoch voneinander, und nun mußten sie zusammengenäht werden. Es war keine Kleinigkeit, in der Kälte und bei dem Schneetreiben mit bloßen Händen dazusitzen und zu nähen. Wir mußten gut acht geben und die Finger tüchtig schlagen,[S. 97] und so wurden wir denn nach den verschiedensten Schwierigkeiten und einer sechs- bis siebenstündigen Arbeitszeit endlich gegen Nachmittag flott.
Wir sahen jedoch gar bald ein, daß aus dem Kreuzen gegen den Wind nichts werden konnte. Jedenfalls erreichten wir damit nicht viel. Ich hatte mir in der Beziehung auch keine großen Hoffnungen gemacht und einen andern Plan gefaßt. Ich war mir ganz klar darüber, daß wir bei diesen Eisverhältnissen und diesem widrigen Wind keine Aussicht hatten, Kristianshaab vor Mitte September zu erreichen. Um die Zeit ging das letzte Schiff nach Kopenhagen ab, und damit war uns die Möglichkeit genommen, die Heimath noch in diesem Jahr zu erreichen. Diese Aussicht schien mir damals höchst fatal, ein ganzer Winter würde mit einem Winteraufenthalt in Grönland verloren gehen, und die Gefährten würden sich alle nach der Heimath sehnen. Meine Kenntnisse der Schiffahrtsverhältnisse an der Westküste von Grönland waren nur sehr mangelhaft, und ich nahm an, daß dasselbe Schiff, das Kristianshaab im September verließ, die südlich gelegenen Häfen anlaufen würde. Ich zog daraus die Schlußfolgerung, daß wir mehr Aussicht auf eine Rückkehr in die Heimath im Laufe dieses Jahres haben würden, wenn wir unsern Kurs auf einen dieser südlicheren Häfen richteten, und meinte, daß Godthaab in dem Fall ein guter Ort sein müsse. Auch andere Gründe sprachen dafür, diese Richtung einzuschlagen, vor allen Dingen glaubte ich, daß die Untersuchung des Eises dort von größerem Interesse sein müsse da es bis dahin ja völlig unbekannt war, während Nordenskjölds beide Expeditionen viele werthvolle Aufklärungen über die Eisverhältnisse südöstlich von Kristianshaab verschafft hatten. Als dritter Grund galt, daß die Jahreszeit so weit vorgeschritten war, und der Herbst[S. 98] auf dem Inlandseise wohl kaum gelinde sein würde. Der Weg bis an den Fjord, an dem Godthaab lag, war aber bedeutend kürzer als der bis nach Kristianshaab, daher konnten wir darauf rechnen, falls wir die erste Richtung einschlugen, schneller ans Ziel zu gelangen und keiner so scharfen Kälte ausgesetzt zu sein. Freilich wußten wir nicht, ob die Beschaffenheit des Eises dort sich zum Absteigen eignete, und ob der Weg bis zu der Kolonie selbst nicht ebensoviel Zeit erforderte wie der nach Kristianshaab, denn bei Godthaab war die Strecke über das kahle Land von dem Inlandseise aus so bedeutend länger, ja vielleicht hatte es seine großen Schwierigkeiten, dort vorwärts zu kommen. Auf irgend eine Weise mußten wir die Kolonie aber erreichen können, und wenn es keinen anderen Ausweg gab, so mußten wir unsere Zuflucht zu dem Wege über die See nehmen.
Dies alles ging mir an jenem Vormittag durch den Kopf, die Karte wurde fleißig studirt, in aller Stille Berechnungen gemacht, und das Resultat war, daß ich mich für den Weg nach Godthaab entschied. Ich war darauf vorbereitet, in der Nähe von Godthaab auf schwieriges Eis zu stoßen, weil dort so viele Gletscher sind, die das Eis abschieben, aber ich hatte die feste Zuversicht, daß es irgendwo gehen müsse.
Der Punkt, an dem ich zu enden gedachte, war genau derselbe, wo wir in Wirklichkeit anlangten — ungefähr beim 64° 10′ N. Br. Ich hielt diesen Punkt für den besten, weil sich hier kein Gletscher befand, während nach der Karte, die übrigens völlig unrichtig war, sowohl im Norden wie im Süden mächtige Gletscher sich bis ans Meer hinan erstrecken sollten. Meiner Meinung nach mußte man nun zwischen zwei Gletschern einen Gürtel oder, wenn man will, eine Vertiefung finden, in dem das Eis einigermaßen ruhig liegt, und wo es infolgedessen ziemlich eben ist. Soweit meine Erfahrung reicht, hat sich dies ja auch als zutreffend erwiesen.
[S. 99]
Als ich den Anderen meinen Entschluß, nach Godthaab zu gehen, mittheilte, waren sie Alle sehr damit einverstanden. Es schien, als habe man schon genug vom Inlandseis und sehne sich nach gastlicheren Gegenden. So wurden denn die Segel gehißt, und gegen 3 Uhr des Nachmittags zogen wir von dannen so hoch gegen den Wind, wie wir nur liegen konnten, aber es wurde niemals höher als quer, ja schließlich sogar einen Strich niedriger als quer. Da der Wind rechtweisend Nord bis West war, wurde unser Kurs auf diese Weise bedeutend südlicher als Godthaab, weil uns aber der Wind half, war es doch vortheilhafter für uns, die Segel zu benutzen und so niedrig zu liegen, statt zu ziehen. Wenn wir es so einrichteten, daß zwei von uns vorangingen und zogen, während einer hinterherging und steuerte, konnte es ganz gut gehen. Und obwohl wir so spät ausgerückt waren und ziemlich früh am Abend Rast machten, kamen wir an jenem Tage doch über eine Meile vorwärts.
Je weiter wir kamen, desto mehr beschäftigte mich der Gedanke, wie wir am besten vom Inlandseis zu den menschlichen Wohnungen hinabgelangen könnten. Nach der Karte zu urtheilen, schien es eine ziemlich wilde Gegend zu sein mit Bergen, Thälern und Fjorden, am besten war es scheinbar in der Richtung gegen den Wohnort Narsak, an der Südseite der Mündung des Ameralikfjord, südlich von Godthaab. Aber auch hier konnte es möglicherweise seine Schwierigkeiten haben, vorwärts zu kommen, und der Gedanke an den Seeweg drängte sich mehr und mehr in den Vordergrund. Es lag ja klar auf der Hand, daß wir in unseren beiden Waterproofs-Persennings und dem wasserdichten Segeltuchboden unseres Zeltes Material genug besaßen, um ein Boot zu bauen, — Holzmaterial für die Spille, die Ruder und dergleichen konnten wir von den Schneeschuhen, Stäben, Bambusstangen und dem Schlitten nehmen, es würde[S. 100] sich ausgezeichnet machen lassen —, und wenn wir allesamt an die Arbeit gingen, konnte es kaum lange währen, bis das Boot fertig war. Als ich erst zu diesem Resultat gekommen war, theilte ich eines Tages Sverdrup meinen Plan mit. Nach einigem Ueberlegen war er damit einverstanden, und nun beredeten wir während unserer Wanderung, wo es immer gut ist, wenn man die Gedanken mit etwas beschäftigen kann, häufig miteinander, wie das Boot in diesem Fall am besten zu bauen sei.
Während der folgenden Tage hatten wir dasselbe Wetter mit Sturm und Schneetreiben. Des Nachts fürchtete ich mehrmals, daß das Zelt zerrissen werden könne, — am Morgen, wenn wir weiter wollten, mußten die Schlitten aus den Schneeschanzen herausgegraben werden; wir mußten sie abladen, um die Schienen von Eis und Schnee zu befreien, sie wieder zusammenbinden und die Segel von neuem aufspannen, und diese Arbeit war nicht leicht bei starker Kälte und dem schneidenden Schneesturm; besonders das Zusammenbinden, das, wenn es halten sollte, mit bloßen Händen geschehen mußte, war ein saures Stück Arbeit. Hatten wir unsere Schlitten endlich flott gemacht, so mußten wir den ganzen Tag durch den Schnee stampfen, und das war schwer genug, man mochte vor den Schlitten gehen und ziehen oder hinterdrein und steuern. Am schwersten war es, am Abend das Zelt aufzuschlagen, denn erst mußte der Zeltboden mit den Zeltwänden verbunden werden, was vermittelst Schnürung geschah und mit bloßen Händen ausgeführt werden mußte, wobei man acht zu geben hatte, daß sie nicht abfroren. So geschah es mir eines Abends während der Arbeit, daß ich plötzlich entdeckte, daß meine Finger an beiden Händen bis zur Handfläche völlig weiß waren. Ich zog daran, sie fühlten sich völlig wie Holz an, so hart und leblos waren sie. Durch Reiben mit Schnee und Klopfen wurde der Blutumlauf[S. 101] jedoch bald wieder in Ordnung gebracht, und die Farbe kehrte zurück.
Am 28. August hatte Kristiansen das Unglück, am Rande einer Schneeschanze fehlzutreten und eines seiner Beine im Kniegelenk zu verrenken. Er war mehrere Tage lang so elend, daß ihm das Gehen schwer wurde, aber durch fleißige Massage erholte er sich bald wieder. Es machte einen merkwürdigen Eindruck, ihn mitten im Schneetreiben und in der schneidenden Kälte mit entblößtem Bein dasitzen zu sehen, während Dietrichson ihn massirte. Am 28. August bekamen auch die Lappen kranke Augen, — merkwürdigerweise waren sie, wie bereits erwähnt, die Ersten, die an Schneeblindheit litten, und sie blieben auch die Einzigen. Balto mußte ich Kokainlösung in seine Augen tröpfeln, und bei sorgfältiger Benutzung der Schneebrillen und des rothen Seidenschleiers wurden sie bald wieder gesund. Wir Anderen kamen glücklich um diese Krankheit hinweg, die viele arktische Reisende für ganz unvermeidlich erklärt haben. Wenn man dunkle Brillen und Schleier anwendet, kann man sich sehr wohl dagegen schützen. Obwohl wir die Sonne nur am Tage hatten, wirkte sie doch während der kurzen Zeit schlimm genug. Mitten am Tage konnte die Wirkung der Sonnenstrahlen geradezu intensiv sein. Im wesentlichen trug hierzu der Umstand bei, daß die Luft in der Höhe, in der wir uns befanden — 2000 m — sehr dünn war; eine starke Wirkung übten selbstverständlich aber auch die großen, ebenen Schneeflächen aus, welche die Sonnenstrahlen zurückwarfen. An unserer Gesichtshaut war dies mehr oder minder zu verspüren, wir waren ganz braun gebrannt, und an den vorstehenden Gesichtstheilen wie z. B. der Nase blätterte die Haut bei uns Allen ab. Besonders Kristiansens Gesicht litt sehr von der Sonne, seine Backen schwollen auf und waren mit Blasen bedeckt. Sie sahen aus, als seien sie abgefroren,[S. 102] und verursachten ihm große Schmerzen. Von nun an wurden wir sorgfältiger in Benutzung unserer rothen Seidenschleier, wodurch wir den schädlichen Einfluß der Sonne milderten.
Es sah ganz eigenthümlich aus, wie diese feinen Seidenschleier in der blauen Luft flatterten. Sie zogen unwillkürlich unsere Gedanken in die Heimath, auf unsere Promenaden, zu den prächtigen Equipagen, eleganten Damengestalten, den strahlenden Augen, — statt dessen erblickten wir hier sechs Männer, nichts weniger als elegant, die ihre eigenen Equipagen zogen, welche ebenfalls nicht an Eleganz litten, und hinter den Schleiern guckten nur sehr schmutzige, wettergebräunte Gesichter hervor.
Am Nachmittag des 29. August legte der Wind sich, weswegen es sich nicht mehr verlohnte zu segeln. Wir nahmen deshalb die Segel ab und fingen an zu ziehen mit direktem Kurs auf Godthaab.

An jenem Tage wurde der Schnee so lose und tief, daß Sverdrup, Dietrichson und ich die Indianertruger unter die Füße schnallten. Es verursachte uns jedoch im Anfang ziemliche Schwierigkeiten, diese Einrichtungen zu benutzen, welche wir früher nicht ausprobirt hatten. Bei den ersten Schritten fielen wir unaufhörlich auf die Nase: bald spreizten wir die Beine nicht genug, der eine Schneeschuh schlug gegen das andere Bein und kopfüber ging’s. Dann nahmen wir uns eine Weile in acht, bis wir die eine Truge auf die anderen setzten, und als wir wieder ausschreiten sollten, fielen wir abermals auf die Nase; nun spreizten wir die Beine mehr, und infolgedessen ging es gut, bis sich die Spitze einer Truge in den Schnee bohrte, und wir wieder da lagen. Auf diese Weise ging es eine ganze Zeit, — immer lagen wir auf der Nase und wühlten im Schnee, allmählich aber gewöhnten wir uns an die Benutzung der Schneeschuhe[S. 103] und fanden sie schließlich sehr praktisch. Sie hielten uns vorzüglich über dem Schnee, und wir konnten festen Fuß damit fassen. Jetzt bereuten wir, daß wir uns ihrer nicht früher bedient hatten. Auch Kristiansen machte einen Versuch, aber er konnte nicht damit fertig werden; nachdem er wohl zwanzigmal auf der Nase gelegen hatte, wurde er so ärgerlich, daß er sie auf den Schlitten warf und die norwegischen Truger anschnallte, aber die sanken in den Schnee und waren bedeutend schwerer. Die Lappen, die sich früher so hoch und heilig verschworen hatten, „diese dummen Einrichtungen“ niemals zu benutzen, konnten sich jetzt natürlich nicht dazu bequemen, sie in Gebrauch zu nehmen, sie sahen uns dumme Menschen voller Verachtung und Mißbilligung an, als wir sie anschnallten. Es gewährte ihnen[S. 104] scheinbar eine große Befriedigung, als sie uns im Anfang einmal über das andere auf die Nase fallen sahen; als es aber allmählich besser ging, und wir ihnen offenbar sehr überlegen waren, da konnte Balto es nach einer Weile nicht mehr aushalten, er kam mit einer vorsichtigen Anfrage, ob es sich wirklich gut darauf gehen ließ; und diese Frage wiederholte er mehrmals. Es war ganz klar, daß er die größte Lust hatte, die Truger einmal zu versuchen, trotz seiner früheren Verurtheilung dieser „dummen Einrichtung“. Da wurde am Morgen des 30. August der Schnee derartig, daß wir Skier anwenden konnten, und nun schnallte er diese statt jener an. Ravna wartete noch eine Weile, dann griff auch er — auf Baltos Rath — nach den Skiern. Es währte nicht lange, so hatte auch Kristiansen die seinen angelegt. Da ich indessen fand, daß die Indianertruger, so lange wir die starke Steigung hatten, vortheilhafter waren, so fuhren Sverdrup und ich mit der Benutzung derselben bis zum 2. September fort, während Dietrichson seine Skier schon einen Tag früher hervorholte.
Unser Leben verlief in dieser ganzen Zeit wie auch in den folgenden drei Wochen ganz ungewöhnlich einförmig und ohne jegliche Spur von erwähnenswerthen Ereignissen. Da war es denn kein Wunder, daß die geringsten Kleinigkeiten zu bedeutenden Begebenheiten anwuchsen und die Tagebuchblätter aus jener Zeit anfüllten. Daß wir zum letztenmal Land sahen, war z. B. ein Ereigniß, das erwähnt werden mußte; so schreibt Dietrichson: „Ungefähr um 10 Uhr des Vormittags (31. August) erblickten wir zum letztenmal bloßes Land. Auf dem Kamm einer Welle (oder eines schwachen Höhenrückens im Terrain) entdeckten wir eine Spur von einem Nunatak, der seit vielen Tagen außer uns selbst und den Schlitten der einzige dunkle Punkt gewesen war, auf den wir unsere Augen richten konnten. Jetzt verschwand er[S. 105] ebenfalls“. Diesem unseren letzten Nunatak gaben wir den Namen Gaméls Nunatak.
Daß ein so merkwürdiges Ereigniß wie der Anblick eines Schneesperlings notirt werden mußte, versteht sich von selbst. Ich schrieb darüber:
„Eine Stunde nachdem wir den letzten Nunatak aus den Augen verloren hatten, wurden wir nicht wenig überrascht, als wir plötzlich Vogelgezwitscher in der Luft vernahmen und einen Schneesperling auf uns zuflattern sahen. Er umkreiste uns ein paarmal, ließ sich dann dicht neben uns im Schnee nieder, legte das Köpfchen auf die Seite und schaute uns an, hüpfte darauf munter über den Schnee dahin, zwitscherte ein wenig und flog gen Norden, unseren Blicken verschwindend. Dies war der letzte Gruß, den das Land uns sandte.“
Während der letzten Tage des August hatten wir noch Steigung. Wir hofften beständig, das Hochplateau zu erreichen und an die letzte Steigung gelangt zu sein; wenn wir aber hinaufkamen, fanden wir stets eine Ebene und eine noch höhere Steigung dahinter. Die Schneefläche erstreckte sich in langen Wellenlinien höher und höher landeinwärts:
Am Abend des 1. September kamen wir auf eine große Welle hinauf und fanden auf deren Kamm eine große Fläche mit fast unmerklicher Steigung landeinwärts. Wir bemerkten eine auffallende Wetterveränderung; im Westen am Horizont thürmten sich schwere Wolkenbänke auf mit runden Kumulusformen, wie wir sie bis dahin hier oben über der Schneefläche nicht bemerkt hatten. Ich hielt es für wahrscheinlich, daß sich diese Wolken durch feuchten Luftzug bildeten, der vom Meere aus über den westlichen Abhang der Schneefläche gezogen kam, und vermuthete infolgedessen, daß wir nun so weit gekommen seien, um über diese hinwegsehen zu können.
[S. 106]
Auch im Süden und Osten hatten sich Wolken angesammelt, während der Himmel gerade über uns klar war, und ebenfalls im Norden, wo die Schneefläche anstieg, während sie im Süden und Westen abfiel. Alles schien mir darauf hinzudeuten, daß wir jetzt die Höhe von Grönlands Innerem erreicht hatten, und als dies den Anderen mitgetheilt wurde, erregte es allgemeinen Jubel, den wir waren längst der starken Steigungen überdrüssig, die uns besonders in der letzten Zeit viel zu schaffen gemacht hatten. Sanguinisch, wie wir waren, hofften wir nun bald die Abschrägung nach Westen zu zu erreichen, wo es bergab ging, und wo alles Herrlichkeit und Freude sein würde. In der übermüthigsten Stimmung sahen wir an jenem Tage die Sonne strahlend und rothglühend hinter die Wolkenbänke versinken und den westlichen Himmel in die stimmungsvollste Farbendichtung verwandeln.
Für uns auf dieser Schneefläche umfaßte der Abend und der Sonnenuntergang alles, was schön war, das ersehnte Ziel schien dahinter aufzutauchen. Wir sollten jedoch noch lange warten!
Selbstverständlich wurde dieser Abend durch Extrarationen, die wie gewöhnlich aus Haferkakes, Mysekäse und Preißelbeerkompot bestanden, festlich begangen, und nach der Mahlzeit wurde eine Pfeife geraucht. Es war ein äußerst gemüthlicher Abend.
Unsere Aneroïd-Barometer waren jetzt infolge der Höhe und des geringen Luftdrucks derartig gesunken, daß nichts mehr von der Skala zu sehen war. Wir befanden uns jetzt auf einer Höhe von 2400 m; wenn wir noch höher kamen, würde es seine Schwierigkeiten haben, Observationen anzustellen. Mit Hülfe der beweglichen Höhenskala, die an den Barometern angebracht war, halfen wir uns jedoch ganz gut aus der Verlegenheit, trotzdem der Luftdruck späterhin noch tiefer sank.

[S. 108]
Von einer Senkung des Terrains ließ sich jedoch nichts verspüren; wochenlang arbeiteten wir uns durch die endlose, flache Schneewüste hindurch, ein Tag verging wie der andere, es war dieselbe ermüdende Einförmigkeit, dieselbe anstrengende Arbeit; wer es nicht erlebt hat, kann sich schwerlich einen Begriff davon machen. Alles war flach und weiß, wie ein in Schnee verwandeltes Meer, am Tage sahen wir nur Dreierlei in dieser Natur, die Sonne, die Schneefläche und uns selber. Wir nahmen uns aus wie eine verschwindend kleine, schwarze Linie, die durch eine einzige weiße Unendlichkeit zog, — überall derselbe Gesichtskreis, nirgends ein Punkt, auf dem das Auge ruhen konnte. Wir mußten häufig nach dem Kompaß sehen und die Richtung so gut wie möglich innehalten, indem wir auf die Sonne achteten, wenn sie sich blicken ließ, die vier Männer ansahen, die in einiger Entfernung hinter uns herkamen und unsere eigene Spur nicht aus den Augen ließen, — dies war die einzige Art und Weise, wie wir Krümmungen unserer Wanderung vermindern konnten. Wir wußten ungefähr, wo wir waren, und wußten ebenfalls, daß wir fürs erste keine Veränderung in Aussicht hatten.
Die Schneefläche, über die wir uns hinbewegten, war beinahe ganz eben, sie wölbte sich nur in schwachen, langen Wellen, die man kaum mit dem Auge wahrnehmen konnte, von der einen Uferabschrägung bis zur anderen; die Richtung der Wellenthäler ging ungefähr von Süden nach Norden (rechtweisend).
Ueber die Oberfläche des Schnees schrieb ich am 30. August, daß die lose, frischgefallene Schneeschicht, die über dem vollständig hartgefrorenen alten Eisschnee liegt, heute nur 4–5 Zoll beträgt, und daß sie eben und glatt ist, während sie an den vorhergehenden Tagen ein Fuß hoch gewesen, und dazu zu Schanzen zusammengeweht war, über die die Schlitten nur[S. 109] schwer hinweggleiten konnten. — Von diesem Tage an war die Oberfläche glatt wie ein Spiegel ohne andere Unebenheiten als die Spuren, die wir selber hinterließen.
Unsere Tagesmärsche waren in der Regel nicht lang, sie schwankten zwischen 1–2 Meilen. Dies hatte seinen Grund darin, daß der Weg ziemlich mühselig war. Wären wir früher im Sommer gekommen, etwa um Johannis, so würden wir eine ausgezeichnet glatte, harte Schneeschuhbahn vorgefunden haben, wie wir sie zu Anfang unserer Wanderung (22. und 23. August) gehabt hatten. Nun hatte sich jedoch auf den hartgefrorenen Schnee loser, frischgefallener Schnee gelegt, der fein und trocken wie Staub und von dem Wind zusammengeballt war, so daß sowohl die Schneeschuhe wie die Schlitten nur langsam und schwer darüber hinglitten. Bei der starken Kälte, die wir bekamen, war dies ganz ungewöhnlich schlimm, es war, als arbeiteten wir uns durch Sand hindurch, und je weiter wir kamen, desto schlimmer wurde es. Oft fiel auch feiner, frischer Schnee, der die Sache wenn möglich noch verschlimmerte. Es war so schwer, vorwärts zu kommen, daß wir uns nur mit Aufbietung aller Kräfte durcharbeiteten, jeder Schritt kostete große Anstrengungen, und das ist auf die Dauer sehr ermüdend.
Meine Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit tragen unverkennbar das Gepräge, daß wir unsere Wanderung sehr beschwerlich fanden. Ich will zur Probe einige derselben mittheilen. Am 1. September schrieb ich: „Heute war das Terrain ungewöhnlich ermüdend, es lag ein ungefähr 8–9 Zoll hoher frischgefallener, loser Schnee, der fein wie Staub und hart wie Sand die Kruste überzog, welche ein paar Zoll dick den alten, ebenfalls losen Schnee bedeckt. Gegen Mittag, als die Sonne auf den Schnee einwirkte, wurde es schlimmer denn je. In unserer Verzweiflung schraubten Sverdrup und ich die Stahlplatten[S. 110] unter unseren Schlittenschienen ab, weil wir glaubten, daß die Holzschienen bei einer solchen Kälte glatter über den Schnee hinweggleiten würden. Das Resultat war jedoch zweifelhaft. Es war und es blieb ein schweres Stück Arbeit, — scheinbar wird die Sache mit jedem Tag schwieriger!“ — —
Ein wenig später schreibe ich: „An einzelnen Tagen ist das Terrain besser, aber diese Freude ist stets nur von kurzer Dauer, und hinterher pflegt es schlimmer denn je zu werden. Sowohl des Nachts wie am Tage fällt häufig ein feiner Schnee, auf dem das Ziehen der Schlitten noch beschwerlicher ist als auf dem alten Schnee. Die Sonne hat, obwohl sie warm scheint, doch selbst zur Mittagszeit nicht so viel Macht, daß sie den Schnee an der Oberfläche soweit schmelzen kann,[37] daß sich eine Kruste darauf bildet.“
Am 8. September heißt es: „Der Weg ist unglaublich beschwerlich, schlimmer denn je, obwohl er hart ist; dieser Schnee ist widerspenstig wie Sand. Wir arbeiten gegen Wind und Schneetreiben an.“ — Und weiter am 9. September: „Es wurde im Laufe des Tages schlimmer mit dem Schneefall, und der Weg wurde schlechter und schlechter, — es war noch weit schlimmer als gestern; wenn ich sage, daß es war, als wenn wir die Schlitten über ein Lehmfeld zögen, so ist das keine Uebertreibung. Wir mußten bei jedem Schritt mit aller Macht anziehen, um die schweren Schlitten vorwärts zu bewegen, und am Abend waren Sverdrup und ich, die voran gingen und den Weg pflügten, fast ganz erschöpft. Die Anderen hatten[S. 111] es verhältnißmäßig leichter, da sie in unserer Spur gehen konnten, und ihre Schlitten mit den Stahlschienen glitten besser. Aber der Abend im Zelt mit einem guten Brei aus Brot, Bohnenwurst und Pemikan ließ uns alle Beschwerden des Tages vergessen.“

Die hier mitgetheilten Auszüge beweisen wohl zur Genüge, wie schlecht die Beschaffenheit des Weges war. Uebrigens muß[S. 112] ich noch erwähnen, daß der Schlitten, den Sverdrup und ich gemeinsam zogen, weit schwerer zu ziehen war als alle die anderen, deswegen ließen wir ihn auch schließlich zurück. Hierüber schreibe ich: „Am 11. September fanden Sverdrup und ich, daß es schlimmer und schlimmer mit unserem Schlitten wurde, wir konnten ihn nur noch mit großer Anstrengung von der Stelle bewegen. Wir wußten nicht recht, woran dies liegen könne, er war immer schwieriger zu ziehen gewesen als alle die anderen, und Sverdrup meinte, der Teufel selber hocke gewiß hinten auf. Deswegen beschlossen wir am Vormittage, ihn zurückzulassen, statt dessen nahmen wir Baltos Schlitten, der seine Last mit auf Ravnas legte, und von nun an zogen die beiden Lappen also gemeinsam. Durch diese Veränderung ging förmlich eine neue Sonne über Sverdrups und meinem Dasein auf, wir kamen mit dem neuen Schlitten so schnell vorwärts, daß es den Anderen schwer wurde, uns zu folgen; das Leben erschien uns fortan beinahe angenehm.“
Uebrigens waren wir nicht die Einzigen, die das Leben schwer fanden; die Lappen klagten beständig, und eines Tages machte Balto Halt und sagte zu mir:
„Als wir beiden Lappen in Kristiania gefragt wurden, wie viel wir ziehen könnten, antworteten wir, daß wir Jeder 3 „Vog“ ziehen könnten, aber nun haben wir Jeder 6 „Vog“ zu ziehen, und das will ich nur sagen, wenn wir diese Last bis an die Westküste ziehen können, so sind wir stärker als Pferde.“
Um der Ansicht vorzubeugen, daß wir wenig oder doch nur geringen Nutzen von unseren Schneeschuhen hatten, was man infolge meiner Berichte über die schlechte Schneeschuhbahn etc. schließen könnte, will ich nur sagen, daß die Schneeschuhe eine absolute Nothwendigkeit waren. Ohne dieselben wären wir wohl nicht weit gekommen, wir hätten entweder einen jämmerlichen[S. 113] Tod erlitten oder wären zur Umkehr gezwungen gewesen. Die Skier sind, wie bereits erwähnt, für Denjenigen, der sie zu benutzen weiß, den indianischen Schneeschuhen bei weitem vorzuziehen, selbst wenn man einen Schlitten zu ziehen hat. Sie ermüden weniger, weil man sie nicht aufzuheben braucht und weil man nicht nöthig hat, die Beine mehr als sonst zu spreizen. 19 Tage hintereinander gingen wir vom frühen Morgen bis zum späten Abend auf unseren Skiern und legten gegen 50 Meilen auf ihnen zurück.
Das Wetter war ungefähr während unserer ganzen Wanderung über das Inlandseis ziemlich klar, und die Sonne schien von Zeit zu Zeit. Nur ganz ausnahmsweise war der Himmel völlig bedeckt. Selbst wenn Schnee fiel, was oft der Fall war, war er selten so dicht, daß man die Sonne nicht sehen konnte. Der Schnee an und für sich war immer sehr fein und glich mehr gefrorenem Nebel, der herabfiel, als Schnee, so wie wir ihn in Europa kennen. Es war ungefähr dasselbe, was wir in einzelnen Gegenden in Norwegen unter dem Namen Frostschnee kennen, und der sich bildet, indem die Feuchtigkeit der Luft direkt in fester Form herabfällt, ohne Wolken zu bilden.
Wenn dann die Sonnenstrahlen durch diese mit fallendem Frostschnee gefüllte Luft drangen, bildeten sich stets Ringe um die Sonne, und diese, sowie Nebensonnen und Axen durch die Sonne u. s. w. waren deswegen, so lange wir uns im Innern von Grönland befanden, ein fast tägliches Phänomen. Wenn die Sonne sich dem Horizont so weit näherte, daß ein Theil des Ringes unter den Horizont kam, pflegten sich an den Punkten, wo der Sonnenring den Rand der Schneefläche schnitt, kräftige Nebensonnen zu bilden, und gleichzeitig bildete sich eine entsprechende Nebensonne auf der Schneefläche gerade unter der Sonne.
[S. 114]
Die Kälte nahm mehr und mehr zu, je weiter wir in das Innere eindrangen. Die Sonne hatte aber, wenn das Wetter nur einigermaßen klar war, eine große Macht, und zur Mittagszeit konnte sie oft so stark brennen, daß die Wärme geradezu unangenehm wurde. Am 31. August erwähne ich u. a. in meinem Tagebuch, daß die Sonne in den letzten Tagen so geschienen hat, daß sie den Schnee ganz feucht und weich machte; die Schlitten glitten nur mühsam hindurch, und wir bekamen nasse Füße. — Wenn es dann wieder fror, sobald die Sonne zu sinken begann, glitten die Schlitten freilich leichter, aber für die Beine sah es schlecht aus, und man mußte sich in acht nehmen, damit sie nicht abfroren. Es geschah häufiger, daß die Schuhe des Abends, wenn wir sie ausziehen wollten, mit den Ueberstrümpfen und den Strümpfen zu einem Stück zusammengefroren waren.
Später vermochte die Sonne den Schnee nicht feucht zu machen, aber sie hatte doch eine große Macht in der Höhe, in der wir uns jetzt befanden, wo die Luft selbstverständlich sehr dünn ist und verhältnißmäßig wenig von ihren Wärmestrahlen in der Athmosphäre absorbirt wird. Als Beispiel von der Wirkung, welche die Sonne hatte, will ich nur anführen, daß ein Spiritusthermometer, das am ersten September in die Sonne gelegt wurde, +29,5° C. zeigte, während die Temperatur der Luft nur −3,6° C. betrug (mit dem Schwungthermometer gemessen). In der Nacht hatten wir −16° C. gehabt.
Am 3. September zeigte ein Spiritusthermometer, das wir um die Mittagszeit auf einen Schlitten in die Sonne legten, eine Temperatur von +31,5° C., während das Schwungthermometer um dieselbe Zeit zeigte, daß die Luft eine Temperatur von −11° C. hatte.
Dieser große Unterschied zwischen der Temperatur in der Sonne und im Schatten hat zweifelsohne seinen Grund in der[S. 115] starken Ausstrahlung in der dünnen, wenig feuchten Luft in dieser Höhe über dem Meeresspiegel. Schon vor vielen Jahren ist ein ähnliches Verhältniß in Sibirien von unserem berühmten Landsmann, dem Astronomen Hansten, beobachtet worden. In einem Brief aus Irkutsk vom 11. April 1829 schreibt er:
— — — „Die ziemlich hohe Lage des Landes und die bedeutende Entfernung vom Meere machen die Luft trocken und dunstfrei und bewirken ein starkes Strahlen der Wärme, welches letztere mit ein Grund zu der niedrigen Temperatur des Ortes ist. Die Gewalt der Sonne im Frühling ist hier so stark, daß bei einer Kälte von 20–30° R. im Schatten des Mittags an der Sonnenseite das Wasser von den Dächern tröpfelt.“[38]
Sobald der Nachmittag herannahte und die Sonne tiefer am Himmel stand, sank die Temperatur der Luft auffallend, aber besonders bemerkbar war dies, sobald die Sonne unterging.
Die Skala unserer Schwungthermometer reichte nur bis auf −30°, da Niemand um diese Zeit des Jahres eine so niedere Temperatur in dem Innern Grönlands erwartet hatte. Aber nach dem 3. September sank die Quecksilbersäule, sobald die Sonne am Abend verschwunden war, schnell tief unter die Skala. Wie tief die Temperatur sank, kann ich leider nicht mit Bestimmtheit angeben. Als ich am 11. September schlafen ging, versuchte ich, den Minimumthermometer unter mein Kopfkissen zu legen, als ich aber am Morgen danach sehen wollte, war die Quecksilbersäule weit unter die Skala gesunken, die bis −37° reichte. Wahrscheinlich war die Temperatur bis unter −40° gefallen, und das war in unserm Zelt, wo wir sechs Mann schliefen, und wo unser Essen auf einer Spirituslampe gekocht wurde.
Das Merkwürdige bei der Temperatur dort oben war der[S. 116] große Unterschied von mehr als 20° zwischen Tag und Nacht; einen so starken Wechsel findet man nicht an vielen Stellen auf der Welt. Am nächsten kommen die Beobachtungen, die man in der Wüste Sahara angestellt hat, wo es am Tage erstickend heiß sein kann, während des Nachts das Wasser gefriert.
Auffallend ist es, daß man nicht früher ein ähnliches bemerkenswertes Sinken der Temperatur während der Nacht auf dem Inlandseise Grönlands beobachtet hat. Der Grund ist wohl hauptsächlich darin zu suchen, daß ungefähr alle früheren Expeditionen, die ein Stück in das Innere hineingedrungen sind, zu einer Jahreszeit und auf einem Breitegrad stattgefunden haben, wo die Sonne des Nachts nicht unterging.[39] Auch ist von früheren Reisenden kein detaillirtes meteorologisches Tagebuch geführt worden.
Nach der Art und Weise, wie die Temperatur gegen Abend fiel, hat Professor Mohn ausgerechnet, daß wir in den kältesten Nächten ungefähr −45° C. gehabt haben müssen. Während dieser Zeit stieg die Temperatur der Luft gleich nach Mittag auf −20 bis −15°. Das war also Mitte September. Dies ist ohne Zweifel die niedrigste Temperatur, die um eine entsprechende Jahreszeit auf der Oberfläche unserer Erde beobachtet worden ist. Was für eine Temperatur man in diesen Gegenden mitten im Winter finden würde, entzieht sich jeglicher Berechnung.
Fragt man dagegen, welche Temperatur in Grönlands Innern um die wärmste Zeit des Sommers herrscht, und ob dann irgend welches Schmelzen des Schnees stattfinden kann, so haben wir dafür möglicherweise einen Anhaltspunkt, nämlich, indem wir den Bau des Schnees ein wenig in der Tiefe untersuchen und sehen, ob der alte Schnee dem Schmelzen ausgesetzt war. Dies thaten wir auch, soweit die Zeit es gestattete.
[S. 117]
Bis zu der Höhe, die wir am 30. August erreichten (1980 m), fanden wir den alten Schnee völlig hartgefroren und zum Theil in eine Art körniges Eis verwandelt, oder wenn man will, in einen eisig zusammengefrorenen Kornschnee. Dieser Schnee war offenbar starkem Thauwetter ausgesetzt gewesen, auf das Frost gefolgt war. Oben auf diesem Schnee lagen in der Regel 5–10 oder sogar 12 Zoll loser, trockener, frischgefallener Schnee nach den Sommermonaten.
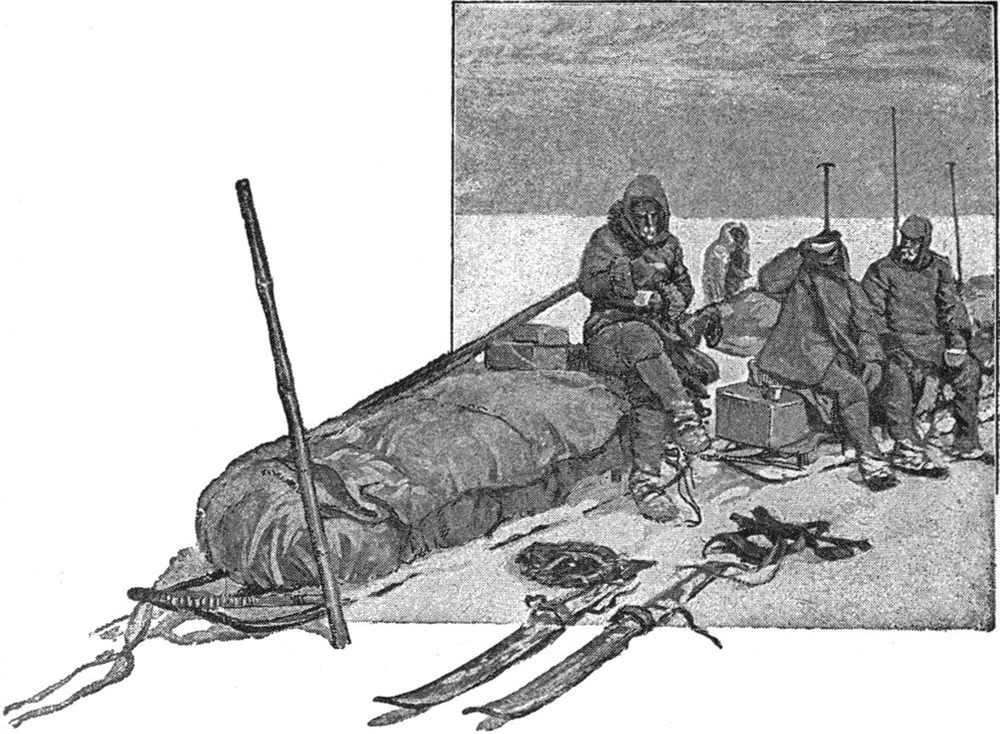
Am Abend des 31. August entdeckten wir zu unserem Staunen, als wir die Schneeschuhstäbe einrammen wollten, um das Zelt aufzuschlagen, daß sich freilich über dem alten Schnee, der unter dem frischgefallenen lag, eine feste Kruste befand; durchbrachen wir aber diese Kruste, so konnten wir die Stäbe bis in das Unendliche einbohren. Dies war ein deutlicher Beweis, daß wir uns schon damals auf der Höhe (2270 m) befanden, wo die Sonne nur mitten im Sommer eine dünne Schneeschicht[S. 118] weich oder feucht machen kann, und diese Schneeschicht gefriert dann des Nachts wieder, wenn die Sonne niedrig steht. Das Schmelzen des Schnees kann folglich die Schneemenge in dieser Höhe nicht im geringsten vermindern, denn das verschwindend kleine Quantum Schmelzwasser, das sich bildet, kann nirgends fortkommen, sondern wird vom Nachtfrost festgehalten.
Ein ähnliches Verhältniß fanden wir überall im Innern des Inlandseises, das Schmelzen des Schnees war kaum nennenswerth. Uebrigens war der schichtenweise Bau des alten Schnees ganz eigenthümlich. Am 3. September bemerke ich hierüber, daß ich an jenem Tage wiederholt den Versuch gemacht habe, den Stab durch den Schnee zu stecken, und daß ich da in der Regel ganz oben eine dreizöllige Schicht losen, frischgefallenen Schnees fand, dann folgte eine Eiskruste, die ungefähr ½ Zoll dick war, dann 7 Zoll loser Schnee und darauf wieder eine härtere Eisschicht, die sich nur mit Mühe durchbohren ließ, darauf ließ sich der Stab 1–2 Fuß tief durch härter und härter werdenden Schnee bohren, bis er ungefähr eine Elle von der Oberfläche nicht weiterzubringen war. An einer anderen Stelle, wo ich in der Frühe desselben Tages einen gleichen Versuch machte, lagen ganz oben mehrere Schichten in ungefähr demselben Verhältniß; der Stab ließ sich hier jedoch zwei Fuß durch härteren und härteren Schnee bohren, bis ihn eine ganz feste Schicht am Vordringen hemmte.
Ueberall landeinwärts fanden wir eine ähnliche Schichtenbildung im Schnee. In der Regel konnten wir den Stock ungefähr so weit wir wollten, einrammen. Alles deutete darauf hin, daß sich das Schmelzen des Schnees in Grönlands Innern darauf beschränkte, daß die Sonne während der wärmsten Zeit des Jahres die oberste Schneeschicht ein wenig feucht macht und diese in der Nacht wieder friert.
[37] Dieser Fall trat doch am 30. August ein. Wir bekamen eine dünne Kruste über dem Schnee, von der ich in meinem Tagebuch berichte, daß sie zweifelsohne durch die starke Einwirkung der Sonne gegen Mittag und den dann folgenden Frost gebildet sei. Diese Kruste war zwar nicht dick genug, um die Schlitten zu tragen, aber sie trug doch dazu bei, daß sie leichter glitten. Leider währte dies nur einen Tag.
[38] Astronomische Nachrichten, Bd. 7, Seite 327.
[39] Vergl. Seite 400–401 von Dalagers Expedition.
[S. 119]
 s war nicht immer angenehm, sich beständig in einer solchen Kälte
zu bewegen, wie sie hier herrschte. Oft bildete sich so viel Eis im
Gesicht, daß der Bart mit den Hüllen, die wir um den Kopf trugen,
vollständig zu einem Stück Eis zusammenfror, und es oft recht schwierig
war, den Mund zu öffnen, wenn man sprechen wollte. Unter solchen
Umständen ist es am besten, den Bart abzunehmen, dazu hatten wir aber
weder Zeit noch Lust in dieser Umgebung.
s war nicht immer angenehm, sich beständig in einer solchen Kälte
zu bewegen, wie sie hier herrschte. Oft bildete sich so viel Eis im
Gesicht, daß der Bart mit den Hüllen, die wir um den Kopf trugen,
vollständig zu einem Stück Eis zusammenfror, und es oft recht schwierig
war, den Mund zu öffnen, wenn man sprechen wollte. Unter solchen
Umständen ist es am besten, den Bart abzunehmen, dazu hatten wir aber
weder Zeit noch Lust in dieser Umgebung.
Wenn der Wind in dieser Höhe wehte, wurde die Situation noch weniger angenehm. In meinem Tagebuch finde ich folgende Notizen über den Wind:
„Am Vormittag des 4. September hatten wir herrlich stilles Wetter, in der Nacht war ganz loser, leichter Schnee gefallen. Die Sonne schien auf die unendliche, einförmige Schneefläche herab, die sich mit kaum merklicher Steigung vor uns ausbreitete wie ein einziger weißer, diamantenbesäeter Teppich, fein und weich wie Daunen, in schwachen, fast unsichtbaren Wellen. Aber am Nachmittage veränderte sich die Landschaft bedeutend; von Nordwest (rechtweisend) blies ein schneidender Wind, er peitschte den frischgefallenen Schnee vor sich her und verwandelte das Ganze in eine einzige Schneewolke. Der Himmel[S. 120] bezog sich und es wurde kälter und kälter. Das Thermometer sank auf -19°. Der Wind nahm beständig an Stärke zu und ging bald in Sturm über, es war schwer, dem entgegenzuarbeiten, und man mußte vorsichtig sein, um nicht zu erfrieren. Zuerst fror die Nase ab, das bemerkte ich jedoch früh genug, um sie durch Reiben mit Schnee zu retten. Jetzt glaubte ich außer Gefahr zu sein, da hatte ich ein merkwürdig kaltes Gefühl unter dem Kinn und bemerkte nun, daß die Halsparthie um den Kehlkopf herum steifgefroren und gefühllos war. Durch Reiben mit Schnee, und indem ich einige wollene Fausthandschuhe und andere Bekleidungsgegenstände um den Hals packte, half ich mir auch darüber hinweg. Aber nun kam das Schlimmste von allem. Der Wind drang durch die Kleider in die Magengegend, und ich empfand die heftigsten Schmerzen; ich legte einen Filzhut dorthin und rettete so auch diesen Theil meines Körpers. Mit Sverdrup sah es eine Weile beinahe ebenso schlimm aus; wie es den Andern, die hinter mir herkamen, erging, weiß ich nicht, ich vermuthe jedoch, daß es auch mit ihnen nicht viel besser aussah. Es war an jenem Abend noch angenehmer als gewöhnlich, ins Zelt zu kommen und unseren warmen Brei zu verzehren.
„Am nächsten Vormittag hatte der Wind sich gelegt, aber gegen Nachmittag brach abermals ein Sturm mit Schneegestöber aus Südwesten los. Es währte die ganze Nacht und nahm eine mehr und mehr südliche Richtung. Ich freute mich schon in dem Gedanken an einen guten Segelwind, als wir aber am nächsten Morgen (6. September) aufbrechen wollten, hatte der Wind sich dermaßen gelegt, daß ich es nicht der Mühe werth hielt, Segel aufzusetzen. Späterhin am Vormittage hob der Wind sich jedoch wieder, und um Mittag wehte es direkt aus Süden (rechtweisend). Ich hielt es deswegen für gerathen, die Segel zu hissen, da ich[S. 121] aber auf so einstimmigen Widerspruch bei den Gefährten stieß, die keine Lust hatten, in diesem Schneetreiben die Segel zu hissen und das mühsame Aneinanderfügen der Schlitten vorzunehmen, so unterließ ich es thörichterweise. Wir sollten es später bitter bereuen, denn je weiter wir kamen, desto mehr wehte der Wind von hinten, desto stärker wurde er. Er ging bald in einen vollständigen Schneesturm über, der nach Ost-Süd-Ost oder Osten umsprang, wir hatten ihn deshalb ganz direkt im Rücken, und er trieb sowohl uns als auch die Schlitten vorwärts. Da nun das Terrain auch merklich abfiel, ging es mit guter Fahrt westwärts. Das Schneegestöber nahm in dem Grade zu, daß Sverdrup und ich die Anderen in einer Entfernung von 20 Schritten nicht zu sehen vermochten, deswegen mußten wir häufig warten, um sie nicht zu verlieren. Als wir gegen acht Uhr des Abends Halt machten, war es keine Kleinigkeit, das Zelt in dem furchtbaren Sturm aufzuschlagen, und wehe dem Unglücklichen, der am Tage leicht gekleidet gewesen war, und der nun die Jacke auszog, um etwas mehr Unterzeug anzulegen! Der Sturm wehte den Schneestaub bis direkt auf die Haut durch alle Poren der wollenen Unterjacke und des Hemdes, es war, als stehe man ganz nackend da. Ich selber war nahe daran, mir bei dem Geschäft die linke Hand abfrieren zu lassen, und nur mit größter Beschwerde konnte ich mein Zeug wieder zuknöpfen. Aber auch diesmal gelang es uns, das Zelt aufzuschlagen; aus dem Kochen wurde an jenem Abend freilich nichts, es drang zu viel Schnee durch alle Oeffnungen hindurch; wir begnügten uns mit ein Paar Biskuits, ein wenig Leberpastete und Pemikan und freuten uns, in unsere Schlafsäcke kriechen und den Deckel über den Köpfen zuziehen zu können. Wir verzehrten dort unser Abendbrot und schliefen bald ein, dem Sturm die Herrschaft draußen überlassend. An jenem Tage[S. 122] waren wir ein gutes Stück weitergekommen, meiner Schätzung nach ungefähr 4 Meilen (es waren jedoch kaum mehr als 2½ Meilen).
„Der Sturm raste die ganze Nacht hindurch und sprang nach Osten um (rechtweisend). Gerade als ich am nächsten Morgen (7. September) erwachte, hörte ich, daß etwas sprang; es war eine der Pardunen an der östlichen Wand des Zeltes, auf die der Wind mit einer Gewalt stand, daß ich jeden Augenblick erwarten mußte, die Zeltwand auseinander platzen zu sehen.
„Mit Hülfe einiger aufeinander gestapelter Packsäcke halfen wir dem Schaden so gut wie möglich ab, ich fürchtete freilich noch immer, daß die Wand springen könne, und überlegte, was zu machen sei, wenn das Schneetreiben direkt zu uns ins Zelt hinein stände. Uns blieb in dem Falle wohl nichts anderes übrig, als uns gut in die Säcke zu verkriechen und uns einschneien zu lassen.
„Wir hofften, daß der Wind sich legen würde; inzwischen setzte ich Wasser auf und kochte Thee und Brei, was unseren hungrigen Magen sehr wohl that. Der Wind hatte ein wenig nachgelassen, und ich glaubte, daß wir weiter ziehen könnten. Wir machten uns fertig, bereit, dem Unwetter zu trotzen, und gingen hinaus, um die Segel zu hissen; heute wollten wir nach Herzenslust segeln. Balto war zuerst reisefertig und kroch aus der Zeltthür heraus, was keine leichte Arbeit war, da sich während der Nacht eine Schneeschanze davor aufgethürmt hatte. Es währte nicht lange, so kam er wieder hereingesprungen, Gesicht und Kleider ganz voller Schnee, völlig außer Athem, — der Wind und das Schneegestöber hatten ihm so arg mitgespielt. Das erste, was er sagte, sobald er sich ein wenig verpustet hatte, waren die Worte: „Heute wird es nichts mit der Reise.“ Ich steckte den Kopf zur Thür hinaus und[S. 123] sah die Richtigkeit seiner Worte nur zu gut ein. Wir mußten bleiben, wo wir waren, aber das Zelt mußte gestützt und Speisen aus den Schlitten ins Zelt hineingeholt werden, ehe wir ganz einschneiten. Balto und Kristiansen sollten diese Arbeiten übernehmen. Sie packten sich extra ein und banden alle Kleidungsstücke, wo es sich nur machen ließ, fest zusammen, damit der Schnee nicht durchdringen sollte. Balto war zuerst damit fertig, und ich sah ihm durch die Zeltöffnung nach, aber er hatte nur wenige Schritte gemacht, als das Schneetreiben ihn meinen Blicken entzog. Die Schlitten waren fast ganz verschwunden, er mußte eine ganze Zeit darnach suchen, bis er sie fand, und es war keine Kleinigkeit, bis zu den Speisen durchzudringen, deren wir bedurften. Als Kristiansen aus dem Zelt heraus wollte, um an der Windseite mehrere Sturmpardunen zu befestigen, erfaßte ihn der Wind derartig, daß er auf allen Vieren kriechen mußte. Trotz aller Hindernisse kam doch allmählich alles einigermaßen in Ordnung. Mit Hülfe von Schneeschuhen wurde die Zeltwand auf der Innenseite die Kreuz und die Quer gestützt, und unter der Dachfirststange wurden die Skierstäbe zur Verstärkung angebracht. Wir konnten jetzt einigermaßen sicher sein, daß es halten würde. Alsdann wurden alle Oeffnungen und Spalten, so gut es ging, mit Reservekleidern und dergleichen zugestopft, — ganz dicht bekamen wir das Zelt jedoch niemals, nach und nach sammelten sich große Schneehaufen bei uns an, und der Raum, der an und für sich klein genug war, wurde immer beengter, theils infolge des eindringenden Schnees, theils auch durch die Schneemassen, die das Zelt von außen beschwerten. Wir hatten es aber trotzdem ganz warm und gut. Der Schnee, der sich an der Außenseite anhäufte und das Zelt allmählich begrub, wärmte sehr und schützte gegen den Wind. Gleich nach Mittag ließ der Wind plötzlich nach, es war, als habe man[S. 124] ihn mit einem Schlage abgeschnitten, — nun trat eine völlige Windstille ein.
„Es war ein ungemüthliches Schweigen, wußten wir doch Alle, daß der Sturm im nächsten Augenblick von der entgegengesetzten Seite mit erneuter Kraft losbrechen würde. Wir hatten ein Gefühl, wie man es an Bord eines Schiffes hat, wenn inmitten eines Orkans plötzlich die wohlbekannte Todtenstille eintritt. Wir lauschten mit gespannter Erwartung; eine Weile blieb alles ruhig. Einige von uns meinten, daß es doch möglicherweise vorbei sei. Aber nun kam ein schwacher Windstoß aus Nordwest (rechtweisend) gerade auf die Zeltwand los, in der sich die Thür befand, dann fuhr ein Windstoß nach dem andern mit immer zunehmender Gewalt über uns hin, und ein förmlicher Orkan, weit schlimmer als alles, was wir bisher erlebt hatten, brach los, gerade auf die Zeltthür stehend und die ganze Luft drinnen bei uns mit Schnee füllend, der durch alle Spalten und Oeffnungen eindrang. Balto, der den Augenblick benutzen sollte, war gerade draußen, um den Kochapparat mit Schnee zu füllen, und nur mit genauer Noth fand er sich zu uns zurück.
„Jetzt war guter Rath theuer. Die Wand, in der sich die Thür befand, war die schwächste von allen, und deshalb sorgten wir stets angelegentlich dafür, sie vom Winde abzuwenden. Mit Hülfe von Schneeschuhen, Skistäben, Indianertrugern und Wollzeug wurde die Wand einigermaßen stark und die Thüröffnung so ziemlich dicht gemacht, daß es auszuhalten war. Aber wir saßen nun doch faktisch da wie Mäuse in einer Falle. Alle Oeffnungen waren geschlossen, hinaus konnten wir nicht kommen, so gern wir es auch gewollt hätten.
„Wir machten uns das Leben nun so angenehm wie möglich, kochten Kaffee, was, wie oben erwähnt wurde, für den täglichen Gebrauch abgeschafft war, und krochen in unsere Schlafsäcke.[S. 125] Die Raucher erhielten zum Trost für das Unwetter eine Pfeife Tabak.
„Nur Ravna war trotz des Kaffees die ganze Zeit untröstlich. Ich suchte ihn zu trösten, er aber erwiderte: „Ich alter Berglappe weiß sehr wohl, daß ein Schneesturm, der im September kommt, sehr lange anhält,“ und dabei blieb er trotz aller Vorstellungen.
Als wir am nächsten Morgen (den 8. Septbr.) erwachten, hatte der Wind sich soweit gelegt, daß wir unsere Wanderung fortsetzen konnten. Es war aber keine leichte Sache, hinauszukommen, wir mußten uns aus dem Schnee herausgraben, denn das Zelt war dermaßen eingeschneit, daß nur der First herausguckte. Die Schlitten konnten wir anfänglich gar nicht entdecken, und es kostete große Anstrengungen, bis wir sie ausgegraben hatten und soweit in Ordnung waren, daß wir weiterziehen konnten. Das Terrain war schwieriger denn je.“
Diese Gefangenschaft im Zelt beschreibt Balto folgendermaßen:
„Eines Tages bekamen wir ein ganz schreckliches Wetter mit Schneetreiben und Sturm. Trotzdem zogen wir bis zum Abend weiter. Im Anfang blies der Sturm aus dem Norden (soll Süden heißen), nachher wurde es aber Ostwind. Am Morgen, als wir Kaffee gekocht hatten, wollte ein Mann hinaus, um etwas zu holen, als er jedoch die Zeltthür öffnete, fuhr er wieder zurück, das Wetter draußen war so schrecklich, daß es eine Unmöglichkeit war, hinaus zu kommen. Ich nahm ein Tuch über den Kopf, so daß ich nur ein wenig mit den Augen hindurchgucken konnte, und wagte mich hinaus. Ich entfernte mich einige Schritte von dem Zelt, um nach den Schlitten zu sehen, aber ich konnte nicht einen einzigen Schlitten entdecken; sie waren alle vom Schneesturm begraben. Auch das Zelt[S. 126] konnte ich nicht mehr sehen, weswegen ich anfing, laut zu rufen, und erst als sie mir vom Zelte her antworteten, konnte ich den Weg zurückfinden. Auch das Zelt war vollständig im Schnee begraben. Am nächsten Tage hatten wir gutes Wetter und gingen nun mit aller Macht daran, unsere Sachen wieder aus dem Schnee herauszugraben.“
Das tägliche Leben ging in dieser Zeit seinen regelmäßigen Gang und zeichnete sich nur durch seinen Mangel an bemerkenswerthen Ereignissen aus.
Das Unangenehmste am ganzen Tage war, des Morgens eine Stunde vor den Anderen aufstehen zu müssen, um Koch zu sein. Wenn man erwachte, fand man den Kopf drinnen im Schlafsack gewöhnlich vollständig von Eis und Reif umgeben; es war der Athem, der gefroren war und sich in den Haaren und auf der Haut festgesetzt hatte. Wenn man dann den Schlaf aus den Augen gerieben und sich im Sack aufgerichtet hatte, saß man in einem Raum, dessen Temperatur ungefähr −40° betrug, und wo an allen Wänden, mit Ausnahme derjenigen, auf die der Wind stand, zolllange Reiffrangen hingen. Stieß man ungeschickterweise an eine der Wände, so bekam man ein wenig angenehmes Morgenbad aus Reif. Dann sollte der Kochapparat angezündet werden; allein das Berühren des Metalls war höchst unangenehm bei der herrschenden Temperatur, und nicht besser war es, die Lampe zu füllen und die Dochte in Ordnung zu bringen; denn wenn sie gut brennen sollten, mußte man sie mit Spiritus anfeuchten, den man dabei auf die Finger bekam, und das konnte bei der starken Kälte große Schmerzen verursachen. Um die Dochte trocken zu halten und diesen Uebelstand dadurch, soweit es ging, zu vermeiden, pflegte ich sie in der Hosentasche mit mir herumzutragen.
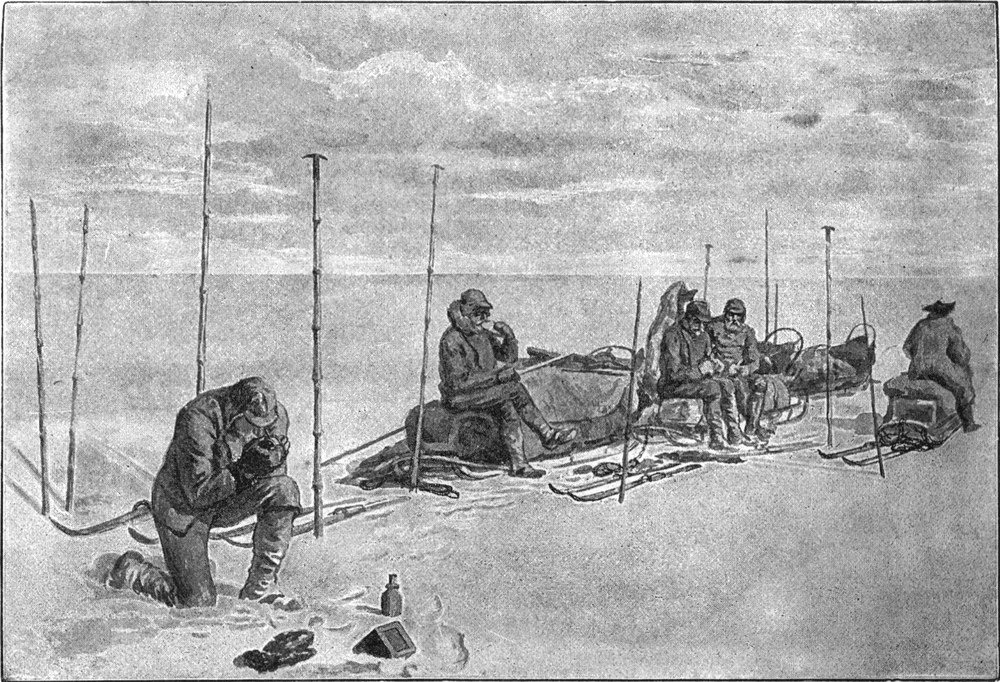
Nachdem man dann angeheizt und das Kochgeschirr aufgesetzt[S. 128] hatte, mußten die Flammen genau beobachtet werden, denn wenn sie zu stark brannten, so daß der Spiritusbehälter warm wurde, konnte leicht eine Explosion stattfinden. War diese Gefahr im Anzuge, so wurde der Behälter mit Schnee abgekühlt. Zu niedrig durften die Flammen jedoch auch nicht brennen, denn dann dauerte es zu lange, bis man fertig war. Wenn endlich der Thee oder die Schokolade kochte, wurden Alle zum Frühstück geweckt, das wir im Schlafsack zu verzehren pflegten. Wenn das Frühstück verzehrt war, galt es, sich so schnell wie möglich zum Aufbruch bereit zu machen; die Schlittenschienen wurden an der Unterseite sorgfältig abgekratzt, die Bagage verstaut und gehörig festgeschnürt und das Zelt abgebrochen. Zuweilen stellten wir auch am Morgen einige Observationen mit dem Kochbarometer an, ehe wir unser Lager aufhoben.
Wenn dies alles besorgt war, zogen wir von dannen, aber schon nach Verlauf von wenigen Stunden wurde Halt gemacht, um eine Tafel Fleischpulverschokolade einzunehmen, dann ging es einige Stunden rastlos weiter bis zur Mittagsmahlzeit, die wir auf den Schlitten sitzend und so schnell wie möglich verzehrten. Nach einigen Stunden gab es abermals eine Tafel Fleischpulverschokolade pro Mann. Wiederum nach Verlauf von zwei Stunden wurde das Vesperbrod, das sog. „Nonsmad“ eingenommen. Dann zogen wir weiter bis zum Abend und machten inzwischen nur eine kleine Rast, um eine Tafel Schokolade zu genießen.
Bei der strengen Kälte war es oft keine Kleinigkeit, am Tage die astronomischen Beobachtungen zu machen. Es war sehr schwierig, die feinen Instrumente mit den dicken Fausthandschuhen zu hantiren; wenn die Observationen recht genau gemacht werden sollten, mußte dies mit bloßen Händen geschehen, da mußte man aber natürlich sorgfältig acht geben, daß die Finger nicht am Metall hängen blieben. Trotz alledem[S. 129] wurden unsere Beobachtungen mit dem Sextant wie mit dem Theodolith so genau gemacht, wie dies mit so kleinen Instrumenten nur möglich ist. Einen Sextant und einen künstlichen Horizont im Schneegestöber zu handhaben, war fast eine Unmöglichkeit, denn der Schnee lagerte sich derartig auf dem Dach des Horizonts, daß man seine Observationen, wenn überhaupt etwas daraus werden sollte, sehr schnell machen mußte. Wenn es zu schlimm war, mußte man seine Zuflucht zum Theodolith nehmen, die Benutzung desselben war jedoch mit nicht weniger Beschwerden verbunden; die Observationen wurden freilich eben so genau.
Wenn wir unsere Abendrast machten, gingen fast alle Mann sofort daran, den Zeltplatz zu fegen, das Zelt zu errichten, es zu stützen und die Wände auf der Windseite mit Persennings zu versichern. Ravnas Arbeit am Abend — und ich glaube, es war die einzige Arbeit, die er außer dem Ziehen seines Schlittens auf der ganzen Wanderung zu verrichten hatte — bestand darin, die Kochgefäße mit Schnee zu füllen. Als alter Berglappe, der sich den ganzen Winter hindurch des Schnees statt des Wassers zum Kochen bedient, hatte er natürlich einen guten Blick dafür, welcher Schnee am besten schmolz. Sobald wir Halt machten, nahm er stillschweigend den Kochapparat, grub sich ein Loch in den Schnee bis zu dem alten Schnee hinab, der bekanntlich beim Schmelzen weit mehr Wasser ergiebt als der frischgefallene. Sobald Ravna damit fertig war, trug er den Kochapparat nach dem Zelt, und wenn dies schon aufgeschlagen war, so setzte er sich mit gekreuzten Beinen hin, um sich nicht wieder zu erheben, bis die Abendmahlzeit vertheilt wurde. Erst nachdem ich ihn viele Abende hintereinander dazu aufgefordert hatte, verrichtete er diese seine einzige Arbeit, ohne dazu ermahnt zu werden, damit hielt er dann aber seine Mission auf dieser Welt für mehr als erfüllt.
[S. 130]

Die Abendstunden im Zelt, wenn alle Mann auf ihren Kleidersäcken Platz genommen hatten, nachdem sie sich sorgfältig von Schnee gereinigt, um ihn nicht mit in das Zelt zu bringen, waren ohne Frage die Glanzpunkte unseres Lebens in dieser Zeit. Der Tag mochte noch so hart, die Arbeit noch so ermüdend und das Wetter noch so kalt gewesen sein, so war doch, sobald wir um unsern Kochapparat herumsaßen, zu den schwachen Lichtstreifen hinabstarrten, welche die Spiritusflammen durch die Löcher im Lampenraum warfen, und auf unser Abendessen warteten,
Und wenn dann die Suppe, der Brei, oder was es nun sein mochte, gekocht war und wir die Rationen vertheilt hatten[S. 131] und der kleine Stummel Licht, den wir besaßen, angezündet wurde, damit wir beim Essen sehen konnten, ja dann hatte unser Glück seinen Höhepunkt erreicht.
Nach beendeter Abendmahlzeit wurden allerlei Vorbereitungen für den kommenden Morgen getroffen, wir füllten die Kochgefäße mit Schnee, damit sie am Morgen nur übers Feuer gesetzt zu werden brauchten, zerkrümelten die Schokolade, um sie gleich ins Wasser schütten zu können etc. Wenn dies gethan war, krochen wir in unsere Säcke, schlossen sie so gut wie möglich und schliefen so fest, wie es nur in dem besten europäischen Bette möglich ist.
Die Mahlzeiten waren für uns natürlich der Mittelpunkt des Daseins. Wenn wir uns irgend etwas Schönes wünschten oder dachten, so war es stets reichliches Essen in der einen oder der anderen Form; besonders um das Fett drehten sich unsere Gedanken; wie bereits mitgetheilt, hatten wir zu wenig davon mitgenommen, und dieses Entbehren brachte uns schließlich so weit, daß wir an einem förmlichen Heißhunger auf Fett litten.
Ich wog jede Woche ¼ kg Butter pro Mann ab, und so lange diese Ration währte, war es eine wahre Wonne für uns, in großen Klumpen davon zu essen, ohne etwas anderes dazu zu genießen. Für Einzelne von uns war dieser Genuß stets nur von kurzer Dauer; Kristiansen war der Schlimmste in dieser Beziehung. Er verzehrte die ganze Ration am ersten Tage, was sehr wenig haushälterisch war. Der Fetthunger ging sogar so weit, daß Sverdrup mich eines Tages fragte, ob ich glaube, daß es ihm schaden könne, wenn er die Stiefelschmiere austränke, die aus altem gekochten Leinöl bestand.
In der Regel wurden selbstverständlich die Rationen für jeden Mann sorgfältig abgewogen. Diese Rationen mußten meiner Berechnung nach durchaus genügend sein — sie beliefen sich auf ungefähr 1 Kilogramm Speisen pro Mann. Als wir[S. 132] uns der Westküste näherten, stellte ich es den Gefährten indessen frei, so viel von dem gedörrten Fleisch zu essen, wie sie wollten, da wir einen Ueberfluß davon hatten. Merkwürdigerweise aber hatte trotzdem Niemand von uns das Gefühl, je satt zu werden. Balto wurde nach seiner Rückkehr gefragt, ob er jemals satt geworden sei. „Nein, ich war kein einziges Mal satt,“ erwiderte er. „Erinnerst du dich noch, Sverdrup,“ wandte er sich an diesen, der neben ihm stand, „wie wir die Festmahlzeit auf dem Inlandseis hielten und doppelte Rationen vertheilt wurden, und wie ich da nach dem Essen zu dir sagte: „Bist du satt, Sverdrup?“ und du mir antwortetest: „Ich bin hungrig wie ein Wolf!“

Unser Speisezettel für den Tag lautete:
Frühstück: Schokolade, in Wasser gekocht (als die Schokolade verbraucht war, nahmen wir statt dessen Thee mit Zucker), Fleischbiskuits, Knäckebrot, ein wenig Leberpastete, Pemikan.
[S. 133]
Mittagessen: Knäckebrot, ein wenig Leberpastete, Pemikan. Dessert: 2 Haferkakes, ein wenig Citronensaft und Zucker, um den Schnee damit anzufeuchten.
Vesperbrot: Knäckebrot oder Fleischbiskuits, ein wenig Leberpastete, Pemikan.
Abendbrot: Erbsensuppe (oder Bohnen- oder Linsensuppe), Fleischbiskuits, Pemikan. Statt der Suppe wurde zuweilen ein Brei aus Pemikan und Erbswurst gekocht, häufig fügten wir auch einige Fleischbiskuits hinzu, wodurch das Gericht sehr an Wohlgeschmack gewann. Zuweilen genossen wir statt Suppe auch Thee.
Außerdem erhielten wir, wie bereits erwähnt, jede Woche unser halbes Pfund Butter, davon konnten wir nach Belieben zu jeder Mahlzeit essen. Am liebsten aßen wir die Butter mitten am Tage, da wir der Ansicht waren, daß sie, allein genossen, den Durst löschte, was vielleicht eine einzig dastehende Erfahrung ist, wenn man bedenkt, daß die Butter gesalzen war.
Unsere Bereitung des Essens war nicht von der zierlichsten Art, und die Art und Weise des Kochens war höchst eigenthümlich. Wie bereits erwähnt, hatten wir keinen Ueberfluß an Wasser, infolgedessen hatten wir nichts, worin die Kochgefäße ausgewaschen werden konnten — es wäre dies bei der Kälte auch eine wenig angenehme Arbeit gewesen. Wenn wir am Abend Erbsensuppe oder unsern Brei gekocht hatten, wurde das Gefäß als besondere Vergünstigung einem der Gefährten, der beim Kochen behülflich gewesen war, übergeben, damit er es reinigen sollte. Balto pflegte der Glückliche zu sein, dem diese Arbeit zufiel, und er führte sie aus, indem er das ganze Kochgefäß so rein ausleckte, wie sich dies mit Zunge und Fingern bewerkstelligen ließ; dies will nun freilich nicht viel sagen, da das Gefäß sehr tief und im Boden so eng war, daß man nicht gut mit der Hand[S. 134] hinuntergelangen konnte. In einem solchen Geschirr wurde dann am nächsten Morgen die Schokolade oder der Thee gekocht, und wenn es dann geleert war, konnte man zuweilen auf dem Grunde einen wunderlichen Bodensatz finden, der aus allen möglichen Ueberresten unserer Breispeise oder Erbsensuppe in lieblichem Verein mit halbaufgelöster Schokolade oder Theeblättern bestand. Daß dies verzehrt wurde und dem glücklichen Finder vorzüglich mundete, brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Wenn der Abend kam, wurde dann wieder Suppe, oder was es nun sein mochte, mit den Ueberresten der Schokolade zusammengekocht. Hierüber wird wohl manche Hausfrau die Nase rümpfen, ich kann diese hochverehrten Damen aber versichern, daß sie nie in ihrem Leben mit all’ ihrer Reinlichkeit Speisen bereitet haben, die so gut schmeckten, wie uns unser selbstgekochtes Essen mundete.
Fast ebenso hoch wie die Butter wurde im Innern Grönlands der Tabak geschätzt, — ich entsinne mich, daß für eine kleine Pfeife eine Krone geboten wurde. Wie bereits erwähnt, hatte ich keinen großen Vorrath an Tabak mitgenommen, weil ich das Rauchen bei so starken Anstrengungen für schädlich halte. Die Pfeife, die man am Sonntag erhielt, mußte lange herhalten. Erst rauchte man den Tabak und dann sog man so lange wie möglich auf der Asche und dem Holz des Pfeifenkopfes. Aber es hielt doch nicht für die ganze Woche vor, deswegen stopfte man getheertes Tauwerk in die Pfeifen und rauchte das. — Am schwersten wurde es Balto, den Tabak zu entbehren; wenn man ihm eine Pfeife versprach, konnte man alles von ihm erreichen. Kautabak hatten wir nicht mitgenommen, aber mehrere der Kameraden kauten statt dessen große Stücke getheerten Tauwerks. Weil ich glaubte, daß man möglicherweise dem brennenden Durst dadurch vorbeugen könne, versuchte ich[S. 135] es auch eines Tages, aber das Stück Tau kam schneller wieder aus dem Munde heraus, als es hineingekommen war.
Weit angenehmer fand ich es, während des Marsches auf Holzsplittern zu saugen; das hält bekanntlich den Mund feucht und löscht den Durst. Ich benutzte bisweilen ein Stück Bambusrohr, das beste war jedoch, sich einen Splitter von den norwegischen Trugern abzuschneiden, die zum Theil aus wildem Kirschbaum angefertigt waren; besonders die Borke dieses Holzes war vorzüglich, und sowohl Sverdrup wie ich arbeiteten dermaßen auf die Truger los, daß sie ziemlich dünn waren, als wir endlich die Westküste erreichten, — glücklicherweise war dies der einzige Gebrauch, den wir für die Truger hatten.
[S. 136]
 m die Mitte des September hofften wir mit jedem Tage, der verging,
an die Abschrägung zu kommen, die wir an der Westküste zu finden
glaubten. Nach dem Besteck mußten wir näher und näher kommen. Ich hegte
jedoch den geheimen Verdacht, daß unser Besteck beträchtlich vorging
im Verhältniß zu unseren Observationen, mit Absicht unterließ ich es
aber, diese auszurechnen, da es mehreren der Gefährten eine schlimme
Täuschung bereiten würde, wenn es sich herausstellte, daß wir nicht
so weit gekommen waren, wie wir annahmen. Es fiel freilich Allen auf,
daß wir noch immer keine Abschrägung erblicken konnten. Am 11. war
die Senkung jedoch bemerkbar, und infolge einer Aufmessung mit dem
Theodolith stellte es sich heraus, daß sie 22 Minuten betrug.
m die Mitte des September hofften wir mit jedem Tage, der verging,
an die Abschrägung zu kommen, die wir an der Westküste zu finden
glaubten. Nach dem Besteck mußten wir näher und näher kommen. Ich hegte
jedoch den geheimen Verdacht, daß unser Besteck beträchtlich vorging
im Verhältniß zu unseren Observationen, mit Absicht unterließ ich es
aber, diese auszurechnen, da es mehreren der Gefährten eine schlimme
Täuschung bereiten würde, wenn es sich herausstellte, daß wir nicht
so weit gekommen waren, wie wir annahmen. Es fiel freilich Allen auf,
daß wir noch immer keine Abschrägung erblicken konnten. Am 11. war
die Senkung jedoch bemerkbar, und infolge einer Aufmessung mit dem
Theodolith stellte es sich heraus, daß sie 22 Minuten betrug.
Am 12. September verzeichnete ich in meinem Tagebuch: „Wir sind Alle in ganz vorzüglicher Laune, voll Hoffnung auf einer baldige Veränderung zum Bessern. Dietrichson und Balto behaupten steif und fest, daß wir noch heute bloßes Land in Sicht bekommen; sie müssen sich wohl in Geduld fassen, wir befinden uns noch 2800 m (in Wirklichkeit waren es 2570 m) hoch; lange kann es jedoch nicht mehr währen. Wir rechneten heute Morgen aus, daß wir uns nach dem Besteck 17 Meilen[S. 137] vom Lande befänden,[40] und heute begünstigt uns die Senkung sowie der ebene Weg sehr.“
In den folgenden Tagen nahm die Senkung nach Westen ganz merklich zu, sie war jedoch nicht mehr eben — die Oberfläche des Schnees zog sich in langen Wellen hin, genau so wie wir es beim Aufsteigen an der Ostküste getroffen hatten.
Am 14. sollten wir nach unserm Besteck nur noch 8 Meilen zurückzulegen haben,[41] aber noch immer erblickten wir kein Land, und dies wurde den Lappen verdächtig. Ravna setzte ein immer saureres Gesicht auf, und eines Abends sagte er: „Ich alter Berglappe, ich Dummkopf, ich glaube, wir erreichen die Westküste niemals.“ Hierauf antwortete ich ihm: „Ja, Ravna, du hast vollkommen Recht, wenn du sagst, daß du ein Dummkopf bist!“ Er fühlte sich augenscheinlich sehr getröstet durch dies zweifelhafte Kompliment. Mit ähnlichen trostlosen Aussprüchen kam Ravna übrigens häufiger.
Ein ander Mal rief Balto plötzlich aus: „Ach, verdammt und verflucht! Wie weit es von einer Küste bis zur andern ist, das kann Niemand wissen, denn hier ist noch niemals ein Mensch vor uns gegangen!“ Es war natürlich schwer, ihm begreiflich zu machen, daß man trotzdem die Entfernung berechnen könne, aber, aufgeweckt wie er war, schien ihm doch eines Tages, als ich es ihm auf der Karte zeigte, eine Ahnung darüber zu dämmern. Ebenso wie bei Ravna schien es auch bei Balto das beste Trostmittel zu sein, daß wir uns über ihre Feigheit lustig machten.
Als wir am 16. mehrere starke Senkungen nach Westen hatten, faßten Alle frischen Muth, und als wir am Abend nur[S. 138] noch −17,8° hatten, kam uns die Luft förmlich warm vor; es war, als seien wir wieder zum Sommer zurückgekehrt. Nach dem Besteck sollten wir jetzt nur noch 2 Meilen zurückzulegen haben, bis wir an bloßes Land gelangten.
Am 17. September waren gerade zwei Monate verflossen, seit wir den „Jason“ verließen. Es traf sich zufällig so, daß an jenem Morgen Butterrationen vertheilt werden sollten, was selbstverständlich zu den angenehmsten Ereignissen während unseres Inlandslebens gehörte; und als der Thee mit Zucker rings umher an den Betten servirt wurde, war die Stimmung sehr animirt, es schien eine allgemeine Zufriedenheit zu herrschen. Zum erstenmal seit langer Zeit hatte sich in dieser Nacht keine dicke Reifgarnitur an der Innenseite des Zeltes gebildet.
Während wir unser Frühstück verzehrten, glaubten wir zu unserer größten Ueberraschung plötzlich Vogelgezwitscher zu vernehmen. Bald verstummte es jedoch, und wir waren nicht sicher, ob wir uns nicht getäuscht hatten. Als wir aber gegen 1 Uhr des Nachmittags weiterzogen, vernahmen wir abermals Vogelgezwitscher in der Luft. Wir machten Halt und erblickten einen Schneesperling, der hinter uns hergeflogen kam. Er umkreiste uns mehrmals und nahm verschiedentlich einen Anlauf, sich auf unsere Schlitten zu setzen, dann aber schien er es nicht so recht zu wagen und ließ sich im Schnee ganz in unserer Nähe nieder, flog jedoch bald wieder auf und setzte seinen Weg munter zwitschernd fort.
Wie herzlich willkommen war uns dieser kleine Sperling! Brachte er uns doch einen Gruß vom Lande, dessen Nähe wir verspürten. Wenn man an gute Engel glaubt, so muß man diese beiden Schneesperlinge — den, der uns an der Ostküste ein Lebewohl zuzwitscherte, und diesen, der uns hier so freundlich willkommen hieß — für solche halten. Getrost zogen wir[S. 139] weiter, obwohl wir an jenem Tage keine bemerkenswerthe Senkung hatten. Am 18. Septbr. war es in dieser Beziehung ganz bedeutend besser, es wurde auch viel milder und das Leben schien uns von neuem zuzulächeln.
Gegen Abend erhob sich ein südöstlicher Wind und ich hoffte, daß wir endlich einmal günstigen Segelwind bekommen würden. Wir hatten lange genug voller Sehnsucht darauf gewartet, trotz Baltos Versicherung, „daß aus dieser Segelfahrt nichts anderes werden würde als Unsinn!“
In der Nacht hob sich der Wind und gegen Morgen wehte eine frische Brise. Obwohl man wie gewöhnlich nicht viel Neigung bezeigte, die Schlitten aufzutakeln und die Segel in der Kälte und im Schneegestöber zu hissen, wurde natürlich beschlossen, dies so schnell als möglich zu bewerkstelligen. Kristiansen, Sverdrup und ich übernahmen das eine Gefährt, aus Kristiansens und unserm Schlitten bestehend, zu dem der Zeltboden als Segel verwendet ward. Die drei Anderen takelten ihre beiden Schlitten auf.
Das vielfache Zusammenschnüren war nicht sehr angenehm bei der Kälte, das Schlimmste aber war, daß es, während wir damit beschäftigt waren, eine Weile so aussah, als wenn der Wind abflauen wolle. Glücklicherweise war dies jedoch nicht der Fall, und endlich waren beide Schlitten segelfertig. Ich war ungeheuer gespannt, wie die Sache ablaufen, und ob das Segel ausreichen würde, um die beiden Schlitten allein zu ziehen. Es wird gehißt und gut befestigt, — es giebt auch einen gewaltigen Ruck, aber die Schlitten sind während der Arbeit festgeschneit und rühren sich nicht vom Fleck. Es zerrt und rückt am Mast und in der Takelage, als sollte alles in Fetzen zerrissen werden, deshalb spannen wir uns schnell vor. Wir ziehen an und machen unser Fahrzeug flott. Kaum aber ist es[S. 140] losgekommen, als der Wind es uns auf die Hacken treibt und wir zu Boden stürzen. Wir stehen auf und machen einen neuen Versuch, aber es geht uns nicht besser, — sobald wir wieder auf den Beinen stehen, werden sie unter uns weggestoßen, und wir sitzen wieder im Schnee. Nachdem sich dies einigemale wiederholt hatte, sahen wir ein, daß wir auf diese Weise zu keinem Resultat kommen würden. Einer mußte auf Schneeschuhen vor dem Schlitten stehen und ihn mit Hülfe einer Stange steuern. Zu diesem Zweck befestigten wir ein Bambusrohr zwischen den beiden Schlitten, der Steuermann nahm es in die Hand und hielt sich das Gefährt auf diese Weise vom Leibe, während er selber vorwärts geschoben wurde. Die beiden Anderen konnten entweder auf den Schienen stehen und sich hinten am Schlitten festhalten oder folgen so gut sie vermochten.
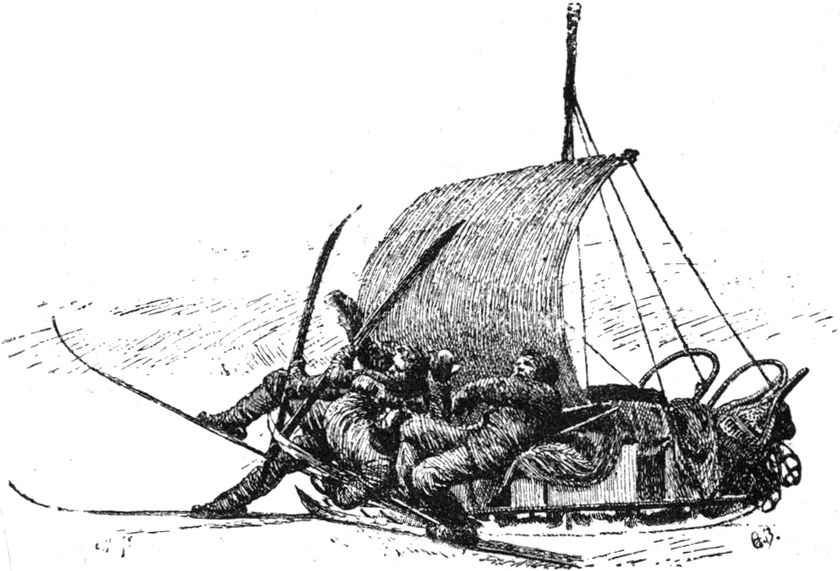
Nun konnte die Fahrt beginnen, und Sverdrup, welcher das Steuer zuerst übernehmen sollte, hatte die Stange kaum ergriffen, als es mit schwindelnder Eile von dannen ging. Ich klammerte mich hinten auf dem einen Schlitten fest, auf meinen[S. 141] Schneeschuhen stehend, und mich an der Rückwand des Schlittens haltend, so gut ich konnte, während Kristiansen, dem dies zu halsbrecherisch erschien, auf seinen Schneeschuhen hinterher gelaufen kam.
So sausten wir dahin über den unebenen Schnee, über Höhen und Tiefen hinweg, daß Einem Hören und Sehen verging. Die Schlitten glitten über alle Unebenheiten hinweg, die Spitzen der Schneeschanzen oft nur wie im Tanz berührend. Ich hatte alle Mühe, mich da hinten fest zu halten. Dann fiel das Terrain plötzlich ab und zwar stärker denn je zuvor. Die Fahrt wurde schneller und schneller, die Schlitten berührten jetzt den Schnee kaum mehr. Gerade vor mir stach das vordere Ende eines Schneeschuhs aus dem Schlitten heraus, der quer über beide Schlitten festgeschnürt war, um sie zusammen zu halten. Es war nicht möglich, ihn zu entfernen, und er verursachte mir viel Beschwerde. Besonders schlimm war es, wenn wir über die Schneeschanzen hinwegglitten, die Schneeschuhe wurden dann festgeklemmt, und ich verlor jegliche Herrschaft über sie. So schlug ich mich lange mit dieser verzweifelten Schneeschuhspitze herum, während Sverdrup vorne am Steuer stand und glaubte, daß wir Beide hinten aufsäßen. Mit immer wachsender Geschwindigkeit ging es vorwärts. Der Schnee wirbelte um uns und hinter uns auf, und die Gefährten hinter mir im Schneegestöber wurden kleiner und kleiner.
Da aber begann eine Eisaxt, die auf dem Schlitten lag, sich zu lösen und machte Anstalten, abzufallen. Die mußte gerettet werden. Ich machte mich vorsichtig vorüber, ganz auf die Spitze des Schneeschuhes, und war gerade im Begriff, die Axt zu befestigen, als wir an eine hohe Schneeschanze kamen. Das Ende des Schneeschuhs auf dem Schlitten schnitt mich in die Beine, und da lag ich und starrte dem Schlitten und dem[S. 142] Segel nach, die dahinsausten und im Schneegestöber kleiner und kleiner wurden. Es war ganz unheimlich, wie schnell das ging! Und ich lag da und hatte das Nachsehen. Allmählich raffte ich mich jedoch auf und lief hinterdrein in dem Kielwasser des Schlitten, so lange meine Augen ihn zu erblicken vermochten.
Zu meiner Freude entdeckte ich, daß ich mich auf meinen Schneeschuhen mit Hülfe des Windes ganz schnell vorwärts bewegen konnte.
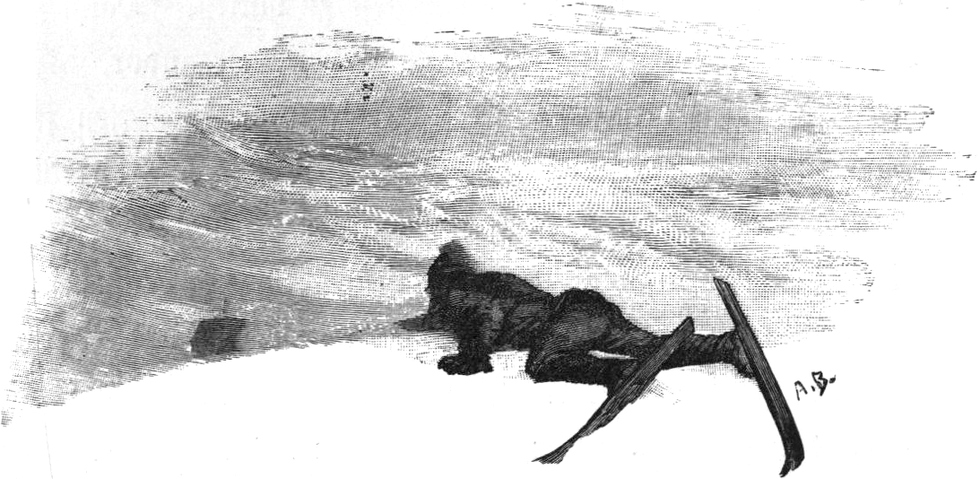
Ich war noch nicht lange gelaufen, als ich die Axt fand, die ich vorhin hatte befestigen wollen. Eine Strecke weiter schimmerte mir auf der weißen Schneefläche, durch das Schneegestöber hindurch, ein viereckiger, dunkler Gegenstand entgegen. Es war eine Schokoladendose, mit unserer kostbaren Fleischpulverschokolade, die selbstverständlich nicht liegen bleiben durfte. Jetzt ging es eine ganze Meile in Ruhe und Frieden weiter, die Schokolade unter dem einen, die Axt und den Skistab unter dem andern Arm. Dann aber entdeckte ich abermals verschiedene dunkle Gegenstände im Schnee. Diesmal war es eine mir gehörende Pelzjacke sowie nicht weniger als drei Pemikandosen, die zerstreut umher lagen. Das war mehr, als ich bewältigen[S. 143] konnte. Hier war nichts anderes zu thun, als sich ruhig hinzusetzen und auf Hülfstruppen zu warten. Von meinem Platz aus konnte ich unser stolzes Fahrzeug überblicken, das Segel glich einem kleinen, viereckigen Lappen. Rastlos in fliegender Fahrt sausten die Schlitten dahin, plötzlich machten sie eine Wendung, die Sonne blitzte auf den Blechdosen, und das Segel fiel. Dann kam Kristiansen, und eine Weile später segelten die drei anderen Gefährten herbei. Sie mußten zwei von unseren Blechdosen aufnehmen, als wir sie aber festschnüren wollten, entdeckte Balto, daß auch sie nicht weniger als drei Pemikandosen eingebüßt hatten. Das war ein unersetzlicher Verlust, deswegen mußten sie zurückgehen und sie aufsuchen.
Inzwischen sausten Kristiansen und ich von dannen, Jeder mit einer Blechdose unterm Arm, zu Sverdrup hin, den wir bald erreichten. Und hier warteten wir nun auf die Anderen, was in dem schneidenden Wind und ohne jeglichen Schutz ein saures Stück Arbeit war. Sverdrup erzählte, er habe tapfer darauf losgesegelt und gefunden, daß es ausgezeichnet ginge. Er habe geglaubt, daß wir Beide hinten aufsäßen, denn vor dem Segel sei nichts zu sehen gewesen. Nach einer Weile sei es ihm so auffallend gewesen, daß die Passagiere da hinten so still waren, er habe einen Anlauf zu einer Unterhaltung genommen, aber es sei keine Antwort gekommen. Nachdem er eine Strecke weiter gesegelt, habe er abermals gerufen, diesmal lauter als vorher, schließlich habe er aus Leibeskräften geschrien, — es sei aber alles still geblieben. Er habe dies genauer untersuchen wollen und deshalb gegen den Wind an gesteuert, sei dann hinten herum gegangen und habe hinter das Segel geguckt. Wer beschreibt aber seinen Schrecken, als er dort Niemanden fand! Er schaute nun durch das Schneegestöber hindurch, den Weg entlang, den er gekommen war, und es schien ihm, als[S. 144] könne er ganz im Hintergrunde einen schwarzen Punkt entdecken. Das war meine Wenigkeit, auf den verlorenen Blechdosen thronend, und dann drehte er das Segel, was keine leichte Arbeit bei dem starken Winde war, und wartete geduldig auf uns.
Es währte jedoch eine lange Zeit, bis die Andern kamen. Wir konnten die Schlitten durch das Schneegestöber sehen, soweit es sich aber erkennen ließ, war kein Segel gehißt. Von den Gefährten war nichts zu erblicken. Endlich entdeckten wir einige kleine dunkle Punkte in weiter Ferne auf dem Schnee, sie schleppten etwas Glänzendes herbei, was zweifelsohne die Blechdosen waren. Einen Augenblick später wurde das Segel gehißt, es wurde größer und größer, und bald waren sie bei uns.
Wir schnürten unsere Schlitten jetzt noch fester aneinander und befestigten die Last sorgfältig, damit ein solcher Zwischenfall sich nicht wiederholen sollte. Dann brachten wir hinten auf den Schlitten einige Taue an, an denen wir uns halten oder mit denen wir uns festbinden konnten, während wir auf den Schneeschuhen standen. Auf diese Weise ging es vorzüglich, und diese Schneeschuhfahrt ist ohne Zweifel die amüsanteste, die ich jemals mitgemacht habe.
Nach einer Weile wurde Sverdrup des Steuerns überdrüssig, deswegen nahm ich seinen Platz ein. Wir hatten jetzt viele anhaltende und starke Senkungen, sowie günstigen Wind, — die Schlitten sausten dahin, als ging es einen guten, steilen Schneeschuhberg hinab, und dies Terrain veränderte sich stundenlang nicht. Es ist sehr spannend, vorn zu stehen und zu steuern, man muß auf das genaueste acht geben und darf vor allen Dingen nicht fallen, denn sollte dieser Fall eintreten, so würde in blitzschneller Fahrt das ganze Gefährt über den Unglücklichen[S. 145] hinsausen, man unter die Schienen gerathen und vorwärts geschoben werden und müßte froh sein, wenn man mit heilen Gliedern davonkäme. So etwas darf nicht geschehen, — man muß jede Bewegung berechnen, jede Muskel muß angespannt sein und die Schneeschuhe müssen gut zusammengehalten werden, während die Hand die Steuerstange sicher umschließt und das Auge unverwandt vorwärtsspäht; sorgfältig müssen die schlimmsten Schneeschanzen vermieden werden, im übrigen aber läßt man das Gefährt dahinsausen, mit den Schneeschuhen über Höhen und Tiefen hinweggleitend.

Das Einnehmen der Mahlzeit war an jenem Tage gar nichts Angenehmes, deswegen suchten wir so schnell wie möglich damit fertig zu werden.
Gerade als wir am Nachmittag im vollen Segeln sind, erklingt plötzlich von den Schlitten hinter uns ein Jubelschrei; es ist Baltos Stimme, welche uns zuruft: „Land in Sicht!“
[S. 146]
Durch das Schneegestöber hindurch, das gerade ein wenig schwächer geworden ist, schimmert über der Schneefläche im Westen ein länglicher dunkler Berggipfel, und südlich davon ein kleinerer. Wir stimmten Alle in den Jubel ein, das Ziel, für das wir so lange gekämpft hatten, lag endlich sichtbar vor unsern Augen.
Dies Ereigniß schildert Balto auf folgende Weise:
„Am Abend, als wir mit unsern Schlitten segelten, erblickte ich weit im Westen einen dunklen Punkt. Ich starrte und starrte, bis ich sah, daß es wirklich nackter Erdboden war; da rief ich Dietrichson zu: „Ich sehe nackten Boden!“ Dietrichson schrie sofort den Andern zu, daß Balto im Westen nackten Erdboden sehen könne. Hurrah! Hurrah! — Und nun sind wir froh, daß wir diesen Anblick endlich haben, denn wir hatten uns schon so lange danach gesehnt, und wir bekamen neuen Muth und neue Hoffnung, glücklich und ohne Schaden über dies Eisgebirge hinüberzukommen, denn es ist das größte auf der ganzen Welt. Wenn wir noch mehrere Tage im Eise hätten zubringen sollen, fürchte ich, daß es Einigen von uns schlimm ergangen wäre. — Sobald Nansen dies hörte, machte er Halt und theilte Jedem von uns zwei Stücke Fleischschokolade aus. Es war so Gebrauch bei uns, jedesmal, wenn wir an einen Punkt gekommen waren, nach dem wir uns lange gesehnt hatten, von dem Besten zu essen, was wir besaßen. So z. B., als wir von dem Meereis auf das Land gelangten, als wir nach Umivik kamen, als wir den höchsten Punkt von Grönland erreichten, als wir die Westküste erblickten, und zum Schluß, als wir schneefreies Land an der Westküste betraten, — dies Gute bestand hauptsächlich aus Eingemachtem, aus amerikanischen Hafercakes und aus Butter.“
Das Land, das wir zuerst erblickten, lag freilich nördlich[S. 147] von der Richtung, die wir bisher eingeschlagen hatten, aber ich lenkte den Kurs doch dahin, um so mehr, als das Eis in dieser Richtung scheinbar am niedrigsten war. Bald verhüllte das Schneegestöber das Land abermals, und den zunehmenden Wind direkt im Rücken, segelten wir den ganzen Nachmittag weiter, ohne wieder eine Spur vom Lande zu erblicken. Eine Abschrägung nach der andern wurde zurückgelegt, und es ging „Gloria“, wie wir uns ausdrückten, wenn etwas ungewöhnlich gut ging, was freilich nur selten der Fall war.
Am Nachmittag war das Terrain eine Weile ziemlich flach, und der Wind flaute ab, gegen Abend aber hob er sich wieder, und die Senkung wurde wieder stärker. Mit immer wilderer Fahrt sausten wir dahin, während das Schneegestöber zunahm. Es begann schon zu dunkeln, als ich plötzlich durch das Schneegestöber und die Finsterniß hindurch vor mir auf dem Schnee etwas Dunkles erblickte. Ich hielt es für eine gewöhnliche Unebenheit im Schnee, achtete nicht darauf und segelte ruhig weiter. Wenige Schritte davon entfernt, entdeckte ich jedoch meinen Irrthum, schnell wie ein Gedanke drehte ich das Steuer, so daß die Schlitten gegen den Wind wendeten. Es war auch die höchste Zeit, denn wir befanden uns hart an einer breiten Spalte — eine Sekunde weiter, und wir wären verschwunden, um nie wieder das Licht des Tages zu erblicken. Aus Leibeskräften schrien wir den Andern, die hinter uns herkamen, zu, daß sie anhalten sollten. Balto berichtet hierüber:
„Am Abend, als wir im besten Segeln waren, die Uhr mochte wohl halb acht sein, und es war schon ziemlich dunkel, sahen wir, daß Nansen, der voraussegelte, uns gewaltig zuwinkte und laut rief: „Segelt nicht weiter, es ist hier gefährlich!“ Wir waren in voller Fahrt begriffen und hatten alle Mühe, unsere Schlitten zum Stehen zu bringen. Wir[S. 148] legten uns schräg vor den Wind und warfen uns selber auf die Seite. Im selben Augenblick entdeckten wir gerade vor uns eine entsetzliche Eisspalte, die mehrere hundert Meter tief war.“
Ueber diese Segelfahrt berichte ich ferner in meinem Tagebuch: „Dies war die erste Spalte, aber es war nicht wahrscheinlich, daß es die letzte war, deshalb mußten wir darauf gefaßt sein, mehrere zu treffen. Die Gefährten äußerten ihre Bedenken, die Segelfahrt an jenem Abend fortzusetzen, aber ich fand, daß es zu früh war, um uns zur Ruhe zu begeben, wir mußten den Wind ausnutzen. Ich verließ deshalb meinen Schlitten und lief voraus, um das Eis zu untersuchen, während Sverdrup das Steuer übernahm und wir die Segel an beiden Schlitten, die mir in einiger Entfernung folgten, verkleinerten. Der Wind wehte so stark, daß er mir tüchtig half, ich konnte ganze Strecken lang auf meinen Schneeschuhen stehen, ohne die Beine zu bewegen, und es ging auf diese Weise schnell vorwärts. Sobald mir das Terrain verdächtig erschien, ging ich vorsichtig zu Werk und fühlte stets mit dem Skistab nach, ob sich nicht hohler Grund unter dem frischgefallenen Schnee befand. Trotz dieser Vorsichtsmaßregel wäre es doch beinahe geschehen, daß Sverdrup und Kristiansen mit Schlitten und Bagage verschwunden wären. Dicht hinter ihnen stürzte der Boden ein, als sie gerade über eine Spalte hinübergekommen waren. Indessen nahm der Wind noch immer zu, und die Segel mußten mehrmals verkleinert werden, damit die Schlitten mir nicht zu unmittelbar folgten. Als der Hunger sich endlich allzu fühlbar machte, vertheilten wir zwei Fleischbiskuits pro Mann, ohne jedoch deswegen Halt zu machen, — wir mußten während der Fahrt essen.
„Die Dunkelheit senkte sich schnell herab, aber der Vollmond ging auf und leuchtete genügend durch das Schneegestöber hindurch,[S. 149] um mir die schlimmsten Spalten zu zeigen. Es machte einen eigenthümlichen Eindruck, die beiden Fahrzeuge mit den breiten vikingsartigen Segeln über die einförmige, von der großen Mondscheibe erhellte weiße Fläche dahinsausen zu sehen.

„In immer rasenderer Eile ging es vorwärts, während das Eis schwieriger und schwieriger wurde und ich beim Mondschein deutlich erkennen konnte, daß es vor uns noch schlechter aussah. Im nächsten Augenblick war ich dort, — es sind Unmengen von Spalten, die aber mit Schnee angefüllt und daher größtentheils ungefährlich sind. Hin und wieder stößt der Stab auf hohlen Grund, aber die Spalte ist schmal, und die Schlitten gleiten darüber hin. Dann kommt eine breitere Spalte und ich erblicke im Mondschein in geringer Entfernung vor mir eine dunkle, breite Schlucht. Ich mache Halt, nähere mich vorsichtig auf dem glatten Eis, auf dem sich jetzt kaum mehr frischgefallener Schnee befindet, und schaue in die tiefe, dunkle Schlucht hinab. Vor mir sehe ich[S. 150] Schlucht auf Schlucht, — tiefblaue Streifen, die sich parallel nebeneinander hinziehen. Ich gebe den Andern ein Zeichen und mache Halt. Hier ist an kein Vordringen mehr zu denken, wir müssen unser Zelt aufschlagen. Im Westen, wo noch ein schwacher Schein des entschwundenen Tages den Abendhimmel erhellt, ragt das Land empor. Es war dasselbe Land, das wir am Vormittage gesehen hatten, aber es erhebt sich jetzt hoch am Horizont und daneben, im Süden, ist eine ganze lange Landstrecke aus der Eisfläche emporgestiegen.
„Es war ein schwieriges Stück Arbeit, das Zelt in dem starken Wind und auf dem glasharten Eis aufzuschlagen, wo sich die Pardunen nirgends befestigen ließen. Die Haken wollten nicht halten, und wir mußten mit der Axt Löcher für die Skistäbe hauen, um die Pardunen daran zu befestigen. Endlich, nachdem wir mehr als gewöhnlich gefroren hatten, war das Zelt aufgeschlagen und wir fanden einigermaßen Schutz. Niemand hatte an jenem Abend Lust, etwas zu kochen, dazu war der Wind, selbst im Zelt, zu empfindlich. Die Festmahlzeit, die ich versprochen, sobald wir bloßes Land erblickten, und auf die wir uns so sehr gefreut hatten, wurde bis zum nächsten Morgen verschoben. Wir theilten den Rest unseres Schweizerkäses und krochen in unsere Schlafsäcke, höchst zufrieden mit unserm Tagewerk. In den Sack gekommen, bemerkte ich erst, daß mir während der Segelfahrt die Finger an beiden Händen abgefroren waren. Jetzt war es zu spät, sie mit Schnee zu reiben, sie fingen schon an aufzuthauen, und die Schmerzen waren während der ganzen Nacht fast unerträglich, bis ich endlich einschlief.“
Früh am nächsten Morgen fuhr ich plötzlich auf, voller Schreck mich erinnernd, daß ich vergessen hatte, die Uhr aufzuziehen. Unglücklicherweise war es Sverdrup ebenso ergangen. Wir zogen sie sofort auf, aber nun war es zu spät.
[S. 151]
Als wir den Kopf zum Zelt hinaussteckten, sahen wir das ganze Land südlich vom Godthaabs-Fjord sich vor uns ausbreiten; — es war ein bergiges, unebenes Terrain mit vielen hohen Felsspitzen und Gipfeln. Entsinnst du dich, wie du zum erstenmal als Kind das Hochgebirge daliegen sahest, voller Gletscher und Schluchten? Entsinnst du dich, wie diese ganze unbekannte Welt dich zog und lockte? Ja, dann wirst du verstehen können, was wir empfanden! Wir waren wie die Kinder. Wir hatten ein eigenthümliches Gefühl im Halse, während unser Blick den Thälern folgte und vergebens nach einer Spur von See spähte. Es war eine schöne Landschaft, wild und großartig, wie an der Westküste Norwegens. Oben auf den Bergen lag frischgefallener Schnee, dazwischen aber schoben sich dunkle Schluchten, deren Boden die Fjorde bildeten; wir konnten sie zwar nicht sehen, aber wir ahnten sie. Ueber dies Gebirgsland bis nach Godthaab zu gelangen, schien uns eine Kleinigkeit zu sein.

Wir nahmen unsere Festmahlzeit in aller Ruhe ein, kochten uns Thee „en masse“ und aßen Mysekäse und Haferkakes nach Herzenslust. Erst spät am Vormittag brachen wir auf. Wir hatten uns in der Nacht in ein häßliches Spaltenterrain hineingesegelt und mußten nun unsern Kurs in südlicher Richtung nehmen, um auf besseres Eis hinaufzugelangen. Der frischgefallene Schnee war auf der ganzen Strecke, die wir an diesem Tage passirten, zum Theil zu Schanzen zusammengeweht, besonders war dies überall da der Fall, wo das Terrain uneben war, an anderen Stellen war er ganz fortgefegt, so daß die harte, glatte Eisoberfläche ganz frei dalag. Nach einer Weile kamen wir an eine mächtige, lange Halde, die wir hinuntermußten. Sverdrup und ich hatten unsere Schneeschuhe angeschnallt und sausten mit Windeseile dahin, aber die Schlitten waren schlecht zu steuern und zu beiden Seiten hatten wir große[S. 152] Schluchten, endlich mußten wir uns entschließen, die Schneeschuhe abzulegen. Nun ging es die Halde hinab, während wir selber auf den Seiten standen und hemmten und lenkten, so gut wir konnten, um die Spalten zu vermeiden; die Lappen waren ganz ausgelassen und fuhren mit windesgeschwinder Fahrt dahin. Nach einer Weile stießen wir auf Blankeis, auf dem es sich sehr schwer gehen ließ, dem Anschein nach mußte es ein großer, zugefrorener See sein. Jenseits desselben stießen wir wieder auf unsicheres Eis. Nachdem wir hier mehrmals auf Spalten gerathen waren, fanden wir es am sichersten, die Schneeschuhe wieder anzuziehen, denn wenn wir quer über die Schluchten hinglitten, hielten die langen Schienen uns besser oberhalb derselben. Einmal sah die Sache schlimm genug aus, unser Schlitten kam der Länge nach an eine Spalte, und eine der Schienen durchschnitt die Schneedecke, welche darüber gebreitet war, sie begann schon, an dem ganzen Schlitten entlang zu streben, als es uns noch im letzten Augenblick gelang, den Schlitten auf festen Boden zu ziehen. Ravna und Balto erging[S. 153] es beinahe noch schlimmer, als sie einen kürzeren Weg einschlagen wollten, als den, welchen Sverdrup und ich genommen hatten; sie kamen an den Rand einer noch breiteren und tieferen Spalte, wo die eine ganze Schiene versank und der Schlitten nahe daran war, umzuwerfen. Nur mit Noth und Mühe zogen sie sich aus der Klemme; — ich war natürlich wüthend und schalt sie gehörig aus, weil sie unserer Spur nicht gefolgt waren. Meiner Ansicht nach wäre es doch genug, sagte ich, daß Diejenigen, welche die Führung übernommen hatten, solchen Gefahren ausgesetzt seien. — Auch Kristiansen war nahe daran gewesen, seinen Schlitten bei einer ähnlichen Gelegenheit einzubüßen.
Am Nachmittag zog ein Hagelwetter mit Sturm aus Süden und Süd-Osten auf. Die Hagelkörner peitschten uns ins Gesicht, und die Schlitten wurden von dem Wind wieder und wieder quer herum geworfen, so daß das Ziehen sehr beschwerlich war, besonders mein und Sverdrups Schlitten machte viele Mühe, da die Last auf demselben groß und hoch war und infolgedessen eine so beträchtliche Windfläche darbot. Jetzt wären die Stahlkiele unter den Schienen besonders angebracht gewesen, aber wie erwähnt waren sie früher in dem unebenen Eis an der Ostküste zerbrochen.
Am Abend machten wir auf einer kleinen Ebene Halt, wo etwas zusammengewehter frischer Schnee lag, in den wir unsere Skistäbe einrammen konnten und wo wir infolgedessen unser Zelt verhältnißmäßig schnell aufschlugen.
Wir hatten uns ursprünglich mit der Hoffnung geschmeichelt, dem Lande bedeutend näher zu kommen, wenn nicht gar, es noch am selben Abend zu erreichen; hierin täuschten wir uns aber sehr, es erschien uns, als seien wir ebensoweit davon entfernt als am vorhergehenden Abend.
[S. 154]
Am nächsten Tage (21. September) hatten wir Schneewetter und konnten nichts vom Lande und auch nichts vom Eise ringsumher erblicken. So tasteten wir beinahe blindlings umher, — es war unmöglich zu sehen, wo das Terrain am günstigsten war.
Gegen Mittag machten wir Halt, um wenn möglich eine Mittagshöhe zu bestimmen; die Sonne blickte nämlich ein wenig aus den Schneewolken hervor, und es war für uns von größter Wichtigkeit zu wissen, wo wir uns befanden. Am vorigen Mittag war ich nämlich zu spät gekommen, da ich mich in der Zeit irrte, — ich hatte ja vergessen, meine Uhr aufzuziehen. Glücklicherweise war die Sonne gerade lange genug sichtbar, ich bestimmte die Mittagshöhe und berechnete die Breite auf 64° 14′ N. Br. Dies war etwas weiter nördlich, als ich wünschte, ich hatte während der Segelfahrt zu sehr in nördlicher Richtung gesteuert, nachdem wir Land in Sicht bekamen, und nun mußten wir, wie man ersehen wird, mehrere Tage dafür büßen. Hätten wir unseren südlichern Kurs innegehalten, wären wir wahrscheinlich direkt auf das Land herunter gesegelt.
Jetzt setzten wir unsere Fahrt mit südlichem Kurs fort. Gegen Nachmittag geriethen wir auf einen Höhenrücken zwischen so entsetzliche Spalten, daß wir froh waren, umkehren und so schnell wie möglich südwärts gelangen zu können. Jetzt kamen wir auf ziemlich ebenes Eis, auf den Boden eines Thals, das zwischen zwei Bergrücken lag, die an allen Ecken und Kanten mit Spalten durchzogen waren. Nach vorne zu verengte sich das Thal, bis es schließlich eine Schlucht bildete, wo die beiden Felsrücken sich beinahe berührten, und wo es ein schroffer Abhang mit wildzerklüftetem Eis wurde. Hier sah es völlig undurchdringlich aus, es war überflüssig, unter diesen Umständen weiter vorzudringen, aller Wahrscheinlichkeit nach waren wir schon zu weit gegangen.
[S. 155]
Wir beschlossen nun, daß Ravna, Balto und Dietrichson das Zelt aufschlagen sollten, während Kristiansen, Sverdrup und ich eine Wanderung in das zerklüftete Eis unternahmen, um zu sehen, ob an ein Vordringen zu denken sei. Balto, der zum Unterkoch ernannt war, erhielt den Auftrag, den Kochapparat in „Schwung“ zu setzen, gute warme Erbsensuppe zu kochen und in dem oberen Gefäß warmes Wasser zu halten, damit wir nach dem Essen einen Citronentoddy machen könnten. Dies alles sollte fertig sein, wenn wir zurückkamen.
Wir drei Untersuchungsreisenden banden uns das Alpenseil um die Taille und zogen bergabwärts. Das Eis war ganz ungewöhnlich schlecht, wir konnten uns nur mit Mühe fortbewegen, überall stießen wir auf scharfe Eiskanten und Schluchten; gefährlich war das Terrain jedoch nicht, da die Schluchten in der Regel nicht tief waren.
Wie groß war mein Staunen, als ich, nachdem wir eine Strecke zurückgelegt hatten, mitten zwischen schneebedeckten Eisgipfeln eine kleine dunkle Fläche erblickte. Allem Anschein nach mußte es Wasser sein, aber es konnte ja auch Eis sein, deswegen sagte ich den Andern nichts. Als wir aber dahin gelangten und sich beim Einstecken des Stabes herausstellte, daß es weich war, da kannte unsere Freude keine Grenze. Wir warfen uns nieder, legten den Mund an die Wasserfläche und sogen das herrliche Naß nach Herzenslust ein. Nachdem wir monatelang unsern Durst nur durch spärliche Wasserrationen hatten befriedigen können, gewährte es uns einen unbeschreiblichen Genuß uns endlich einmal satt trinken zu können. Wie viele Liter wir zu uns nahmen, vermag ich nicht zu sagen, — eine ganz beträchtliche Anzahl war es aber. Wir konnten förmlich fühlen, wie unsere Magen anschwollen und groß und rund wurden. Dann zogen wir weiter, ein wenig schwerer als zuvor.[S. 156] Wir waren nicht weit gegangen, als wir Jemand rufen hörten und den kleinen Ravna, was das Zeug halten wollte, auf uns zueilen sahen. Wir warteten auf ihn, ganz besorgt, daß den Kameraden ein Unglück zugestoßen sein könne. Bald hatte er uns erreicht, und ich war nicht wenig erfreut, als ich erfuhr, daß er nur gekommen sei, um die Dochte zu den Spirituslampen zu holen, die ich wie gewöhnlich in der Tasche trug. Ich war sehr gespannt, ob Ravna wohl das Wasser entdeckt hatte, denn er war am schlimmsten vom Durst geplagt und ich fürchtete fast, daß er zuviel trinken könne. Schließlich konnte ich es doch nicht lassen, ihn geradezu zu fragen. Ja, er habe das Wasser gesehen, er habe jedoch keine Zeit zum Trinken gehabt, wolle nunmehr aber das Versäumte nachholen, und damit trabte er wieder von dannen.
Wir setzten unsere Wanderung fort und kamen nun in das unebenste und unwegsamste Terrain, das uns bis dahin vorgekommen war. Alles, was ich durch Kapitän Jensens Beschreibung von unebenem Eis gehört hatte, war nichts hiergegen. Völlig undurchdringlich war es zwar nicht, aber Eiswände, von denen die eine immer schärfer und unzugänglicher war als die andere, erstreckten sich nach allen Richtungen hin, unterbrochen von tiefen Schluchten, die häufig Wasser enthielten, über dem eine dünne Eisschicht lag, durch welche man hindurchbrach. Es dunkelte bereits stark, als wir endlich heimkehrten. Der Rückweg, auf dem wir unsern Weg durch den frischgefallenen Schnee bahnen mußten, war sehr ermattend, und mit großer Freude begrüßten wir deswegen den Anblick des Zeltes. Als wir an der ersten Wasserlache vorüberkamen, thaten wir noch einen guten Trunk. Wir legten uns flach zu Boden und ließen das Wasser in reichlichen Mengen durch unsere Kehlen strömen, — unsere Stirne umrieselte es eiskalt, aber das schadete nicht,[S. 157] es war ein wahrhaft himmlischer Genuß, sich endlich einmal nach Herzenslust satttrinken zu können. Bei dem Betreten des Zeltes, in dem die Kameraden um den Kochapparat kauerten, schlug uns ein belebender Duft warmer Erbsensuppe entgegen. Balto war sehr stolz darauf, meinen Anordnungen wörtlich nachgekommen zu sein, — alles war fertig und warm, — wir konnten an die Mahlzeit gehen.
Wie es den Andern während unserer Abwesenheit ergangen war, das schildert Balto auf folgende Weise:
„Die anderen Drei zogen von dannen mit dem Seil um den Leib, um einen Weg auszukundschaften. Ich, Ravna und Dietrichson blieben zurück, um das Zelt aufzuschlagen, und ich sollte Erbsensuppe kochen, denn ich war Koch. Ich holte die Kochmaschine heraus, entdeckte aber, daß keine Dochte darin waren. Nansen hatte sie in der Tasche. Da sandte ich Ravna hinter Nansen her, um die Dochte zu holen. Als Ravna zu uns zurückkam, erzählte er, daß er Wasser gefunden und sich den Magen voll getrunken habe. Sobald ich das hörte, ergriff ich einen leeren Blechkasten und lief in einem Sprung, bis ich den Teich erreichte. Dort warf ich mich nieder und trank. Von Zeit zu Zeit mußte ich den Kopf in die Höhe heben, um mich ein wenig zu verpusten, dann trank ich weiter. Es schmeckte genau so wie süße Milch, denn wir waren Tag für Tag seit einem ganzen Monat ohne Wasser gewesen. Dann füllte ich den Blechkasten und trug ihn zum Zelt zurück. Sofort warf Dietrichson sich bei dem Blechkasten nieder und trank, was das Zeug halten wollte. Der Blechkasten war groß, aber es blieb nur gerade genug für die Erbsensuppe übrig. Von dem Tage an fanden wir überall hinreichend Wasser.“
Ja, wir erinnern uns wohl Alle noch des 21. September, als wir zum erstenmal Wasser bekamen!
[S. 158]
Sobald wir in das Zelt gekommen waren, wurde die herrlich duftende Suppe in Tassen gegossen, und wir sprachen der Mahlzeit mit mehr als gewöhnlichem Appetit zu, was sehr viel sagen will. Jetzt konnte auch Ravna essen. Bis dahin hatte er immer behauptet, er könne nicht ordentlich essen, weil er sich nie satt trinken dürfe. Er hob häufig von seinen Rationen auf und ärgerte uns Andere oft, indem er vier bis fünf Fleischbiskuits hervorholte und sie uns zeigte, um uns den Mund wässern zu machen. Wahrscheinlich bedurfte sein kleiner Körper nicht einer so reichlichen Menge Speisen wie unsere großen Leiber. Nach dem Abendessen wurde Citronentoddy servirt, der aus Citronensaft, einigen Tropfen Citronenöl und Zucker in warmem Wasser bestand. Wie wir so in unseren Schlafsäcken dalagen und dies Getränk in langen Zügen einsogen, mundete es uns ganz vorzüglich.
Ich war lange nicht so ermüdet gewesen wie heute. Dies stundenlange Stampfen durch den frischgefallenen Schnee greift die Beinmuskeln an. Auch den Andern ging es nicht viel besser. Aber hinterher im Zelte senkte sich über solche Abende ein unsagbares Gefühl des Wohlseins, und über alle Mühen und Beschwerden des Tages legt sich der mildernde Schleier des Vergessens.
Ein kleiner Lichtstummel, der letzte, den wir besitzen, erleuchtet, so lange wir essen, den kleinen Raum. Endlich ist man fertig, alles wird für den nächsten Morgen vorbereitet, das Licht wird ausgeblasen, man zieht den Kopf ganz unter den Deckel des Schlafsacks und schlummert bald in das Land der Träume hinüber.
[40] Wir befanden uns zu der Zeit in Wirklichkeit etwa 26 geograph. Meilen vom eisfreien Lande entfernt.
[41] Es waren in Wirklichkeit etwa 20 Meilen.
[S. 159]
 m Morgen des 22. September vor dem Frühstück, während Balto
Thee kochte, unternahmen Sverdrup und ich einen
Rekognoszirungsausflug auf den südlich vom Zelt gelegenen Höhenrücken,
der von bodenlosen, breiten Spalten quer durchschnitten war. Einmal
fiel ich durch eine Schneebrücke, aber die Spalte war so schmal, daß
ich an beiden Seiten Halt hatte und nach einigen Anstrengungen wieder
in die Höhe kam.
m Morgen des 22. September vor dem Frühstück, während Balto
Thee kochte, unternahmen Sverdrup und ich einen
Rekognoszirungsausflug auf den südlich vom Zelt gelegenen Höhenrücken,
der von bodenlosen, breiten Spalten quer durchschnitten war. Einmal
fiel ich durch eine Schneebrücke, aber die Spalte war so schmal, daß
ich an beiden Seiten Halt hatte und nach einigen Anstrengungen wieder
in die Höhe kam.
Vom Gipfel des Bergrückens hatten wir eine prächtige Aussicht über das Eis rings umher. Es sah aus, als wäre es überall schwer fortzukommen, gespaltete Eisrücken zogen sich in westlicher Richtung bis an den Eis-Fjord Kangersunek, den wir jetzt dort vor uns liegen sahen, während wir früher im Zweifel waren, was für ein Thal oder ein Fjord es sei. Wir konnten uns jetzt gründlich orientiren und sahen ganz deutlich, daß wir eine ganze Meile nördlicher gekommen waren, als wir beabsichtigten. Um auf die leichteste Weise fortzukommen, mußten wir noch eine Weile in westlicher Richtung gegen den Fjord ziehen, und dann vielleicht ein wenig mehr gegen Süden.
Wir kehrten nach dem Zelt zurück, wo das Frühstück auf uns wartete. Nach dem Frühstück gingen Sverdrup und ich auf Schneeschuhen voran, um einen Weg zu suchen. Die Anderen[S. 160] sollten versuchen, uns mit den vier Schlitten, so weit sie konnten, zu folgen und an dem letzten Bergrücken, den wir zu sehen vermochten, Halt machen. Wir hielten nördlich von dem Terrain, in das wir gestern Abend hinabgestiegen waren, und da der Wind uns half, ging es in sausender Fahrt dahin auf unseren glatten Eichen-Skiern.

Wir kamen so weit, daß wir in den mit Gletschereis angefüllten Fjord hinabsehen konnten, und noch immer war das Terrain einigermaßen günstig. Dann aber begannen die Spalten wieder. Im Anfang liefen sie alle in paralleler Richtung, ohne sich zu schneiden, und wir kamen über eine ganze Anzahl glücklich hinweg. Dann aber gelangten wir an ein ganz unmögliches Terrain, wo breite bodenlose Spalten einander nach allen Richtungen hin schnitten. Das Eis ragte wie kleine viereckige Inseln zwischen den tiefblauen Abgründen empor. Ein mehr zerrissenes Eis ist wohl nirgends zu finden. Es lag klar auf der Hand, daß wir hier nicht weiter kommen konnten. Wir krochen in den[S. 161] Schutz einer zugefrorenen Spalte und nahmen unsere Mittagsmahlzeit ein, während die Sonne ihr Bestes that, um uns unser Daheim so angenehm wie möglich zu machen.
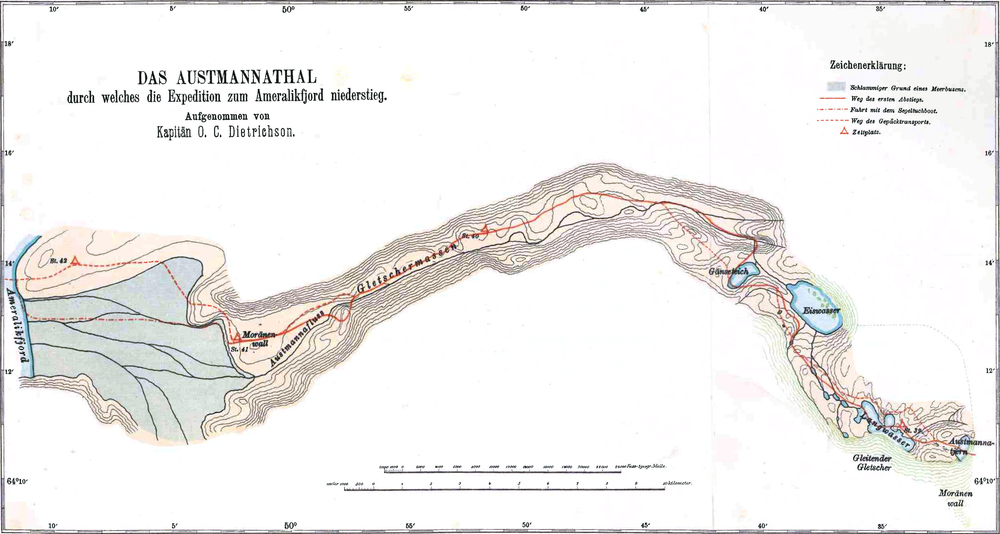

Auf dem Rückweg fiel ich mit beiden Schneeschuhen in eine Spalte und blieb unter den Armen hängen. Es sah nicht gerade gemüthlich aus, denn obwohl die Spalte nur schmal[S. 162] war, machte es mir doch große Mühe, mich mit den Schneeschuhen auf den glatten Eisrand wieder in die Höhe zu arbeiten, und ich war ganz allein; Sverdrup war vorausgelaufen und ahnte nichts von meiner unbequemen Lage. Nach ein wenig Zappeln kam ich glücklich wieder in die Höhe. Merkwürdigerweise versanken wir niemals tiefer als bis an die Arme.
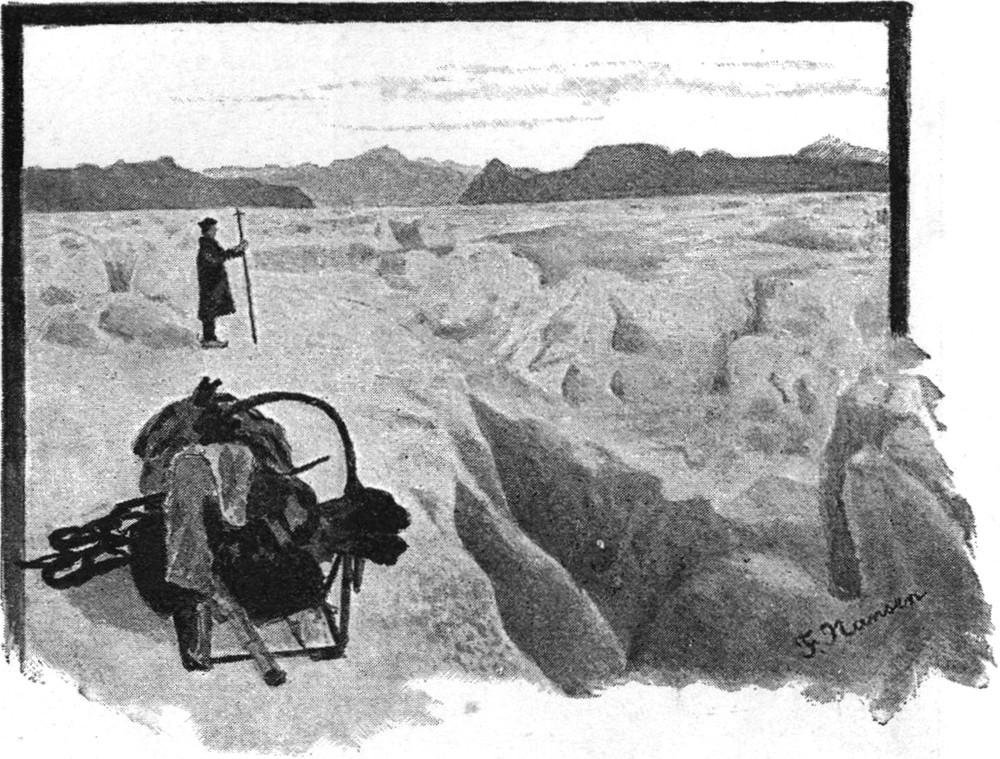

Wir waren nicht weit zurückgegangen, als ich nördlich von uns auf dem Höhenrücken, den wir den Gefährten angewiesen hatten, das braune Zelt erblickte. Sie waren ungefähr vor einer halben Stunde angekommen und hatten nun den Kaffeekessel „in Schwung“ gesetzt. Wir waren ja jetzt in der Nähe der Westküste, da wurde es mit dem Kaffeeverbot nicht so genau genommen. Es währte indessen eine ganze Weile, bis der Kaffee fertig war, was uns nicht weiter unangenehm war,[S. 163] da uns eine kleine Ruhe nach unserer Skitour sehr wohl that. Als der Kaffee getrunken war, brachen wir das Zelt ab und richteten den Kurs gen Süden, um südlich von dem Eisstrom zu gelangen, der sich in den Fjord hineinschiebt, und in den wir hineingerathen waren. Das Eis war im Anfang gut, und es ging schnell vorwärts, obwohl der Wind hin und wieder Anstrengungen machte, die Schlitten nach der Seite herumzudrehen. Gegen Abend, als es bereits zu dämmern begann, kamen wir indessen an einen Rücken mit schlimm zerklüftetem Eis. Hier mußten wir eine kleine Rekognoszirung vornehmen, ehe wir weiter gingen, deswegen blieb uns nichts übrig, als das Zelt aufzuschlagen und bis zum nächsten Tage zu warten. Während das Abendessen bereitet wurde, unternahmen Sverdrup und ich einen kleinen Ausflug. Das Eis war ganz abscheulich,[S. 164] noch schlimmer als am vorhergehenden Abend, aber man konnte doch bei einiger Vorsicht ziemlich vorwärtskommen, und der Rücken war glücklicherweise nicht sehr breit.
Am folgenden Morgen (23. September) unternahm Sverdrup noch eine Rekognoszirungstour und kehrte mit verhältnißmäßig befriedigenden Nachrichten zurück. Das Eis war nicht so schlimm, wie es uns auf den ersten Blick erschienen war. Es war sogar möglich, die Schlitten hinüberzubefördern, ohne sie zu tragen, wenn wir uns zu je Dreien um einen Schlitten vereinigten.
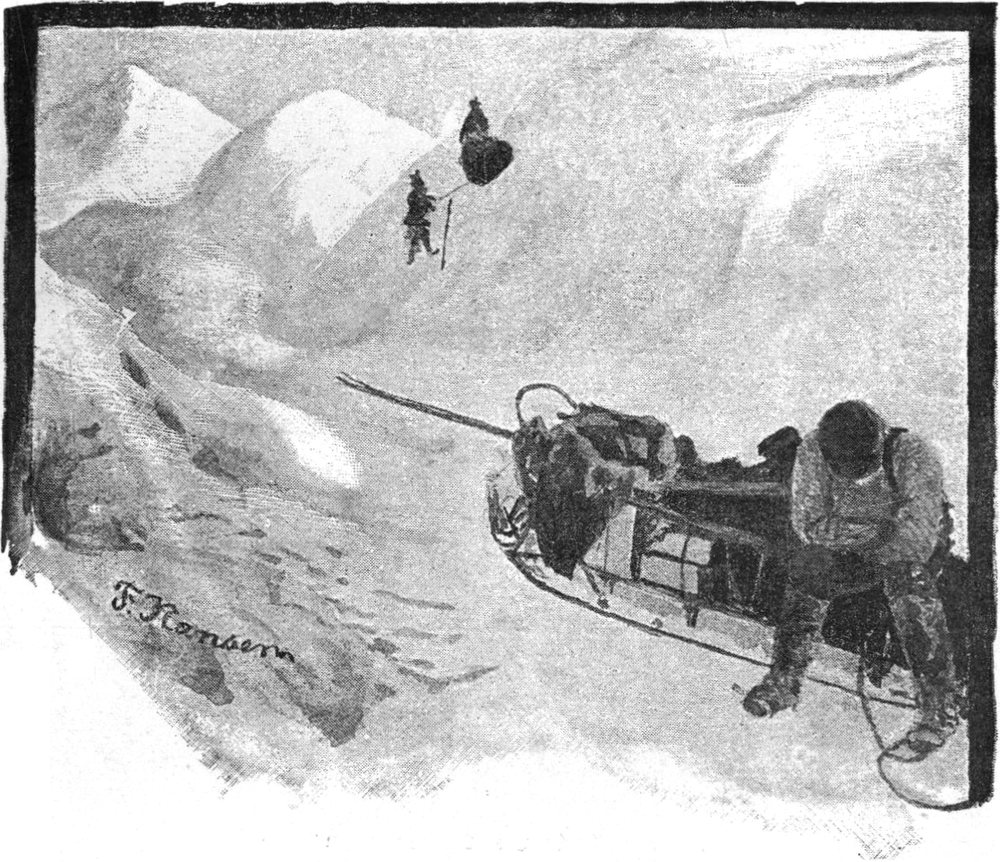
So wurde denn das Lager abgebrochen, und wir begannen die mühsamste Eiswanderung, die wir überhaupt gehabt hatten. An vielen Stellen mußten die Schlitten über die steilen, hohen Eisrücken hinüber gehoben werden. Ging es bergab, so mußte[S. 165] der Unglückliche, der hinterher ging, aus allen Kräften zurückhalten, sonst glitt er aus und stürzte mitsamt dem Schlitten den Vorangehenden auf die Hacken und das ganze Gefährt sauste bergab. An mehreren Stellen hatten wir das Glück, zugefrorene Bäche zu finden, die ganz gute, freilich ein wenig gewundene Wege zwischen den hohen und scharfen Eisrücken mit oft lothrechten Wänden bildeten. Auf einer Stelle mußten wir durch eine Schlucht, die gerade breit genug war, um uns hindurch zu lassen. Den Boden dieser Schlucht füllte ein Bach aus, der nicht ganz zugefroren, und dessen Wasser uns fast bis an die Knie reichte.
Endlich, im Laufe des Nachmittags, hatten wir das schlimmste Eis hinter uns. Jeder konnte nun wieder seinen eigenen Schlitten ziehen. Das Eis war jetzt erträglich und wurde allmählich immer besser, aber der Wind war schlimm und riß die Schlitten immer nach der Seite herum. Als wir eine beträchtliche Strecke zurückgelegt hatten, entdeckte ich auf dem Eis eine Moräne, die sich in östlicher Richtung von dem bloßen Lande aufwärts zog. Diese Moräne mußte meiner Ansicht nach auf der Grenze zwischen zwei Eisströmen liegen, um so mehr, als sie sich in einer Senkung befand, und da ich nicht geneigt war, in eine neue Eisströmung hineinzugerathen, beschloß ich diesseits der Moräne das bloße Land zu erreichen. Wir machten Halt, schlugen unser Zelt auf und entsandten Balto, um Wasser für unsern Kaffee herbeizuschaffen, während Sverdrup und ich eine Entdeckungsreise in der Richtung auf das Land zu antraten, um zu sehen, ob das Eis einigermaßen gangbar sei. Wir waren noch nicht weit gekommen, als wir uns klar darüber waren, daß wir hier hinabgelangen konnten. Es hatte den Anschein, als ob wir uns auf der Südseite des Eisstroms befänden, der sich in den Godthaab-Fjord hineinschob, denn die Eisfläche senkte[S. 166] sich nach Süden oder vielmehr nach dem Lande zu, das wir vor uns hatten. Wir kehrten mit dieser tröstlichen Nachricht zurück, und der Kaffee wurde in heiterster Stimmung eingenommen. Die Aussicht, abermals bloßes Land unter den Füßen zu haben, war jetzt nicht mehr fern, und konnte uns wohl fröhlich stimmen. So schnell wie möglich brachen wir wieder auf, und jetzt, wo wir den Wind im Rücken hatten, ging es leicht über das verhältnißmäßig ebene Eis hinweg, dessen Senkung stellenweise ganz beträchtlich war. Unsere Hoffnung, schon an diesem Abend das Land zu erreichen, wurde getäuscht, es fing bald an dunkel zu werden, und wir mußten Halt machen. Wir waren jedoch zufrieden mit unserm Tagewerk, denn wir waren weiter gekommen, als wir am Morgen erwartet hatten.


Am nächsten Morgen (24. September) rückten wir früh aus und begannen unsere Wanderung mit dem festen Vorsatz, das[S. 167] Land noch am selben Tage zu erreichen. Es ging schnell vorwärts, die Senkung war theilweise ganz beträchtlich und half uns gut. Auch der Wind begünstigte uns, das Eis war gut, und alles ging nach Wunsch. Als wir eine Strecke hinabgekommen waren, mußten wir eine Rekognoszirung vornehmen, da das Eis etwas unebener wurde. Ich begab mich bergab und war noch nicht weit gegangen, als ich mich auf einem Eisabhang befand, der gegen einen kleinen, felsumgebenen See abfiel, dessen mir entgegengesetzte Seite sich in eine bachdurchströmte Felskluft öffnete. Gerade unter mir ging das Eis ganz eben in Steingeröll über. Hier war leicht vorwärts zu kommen, und das Eis war den ganzen Weg entlang gut. Es währte nicht lange, so befanden sich alle Mann auf dem Eisabhang und genossen den Anblick des nahe gelegenen Landes. Nachdem ich einige[S. 168] photographische Aufnahmen gemacht hatte, setzten wir uns in Bewegung, über die letzte Senkung hinweg. Sie war sehr steil, die steilste, die uns bisher vorgekommen war, es galt tüchtig gegenzuhalten, aber es ging munter vorwärts, und bald waren wir unten auf dem See unter dem Gletscher, — das Inlandseis lag für immer hinter uns!
Wir richteten den Kurs quer über den See nach der anderen Seite hinüber; hier war das Eis jedoch nicht ganz sicher. Nur mit größter Vorsicht gelangten wir ohne ein kaltes Bad bis an die Steine, schnallten die Steigeisen, die wir die letzten Tage benützt hatten, ab und sprangen nun leicht wie die Rennthiere über das Land dahin. Worte vermögen es nicht zu beschreiben, was es für uns Alle war, endlich einmal wieder Erde und Steine unter den Füßen zu fühlen! Eine wahre Wonne durchrieselte uns, als wir mit unseren Füßen das Heidekraut berührten und der würzige Duft von Gras und Moos uns in die Nase stieg. Hinter uns lag das Inlandseis, sich in einer langen, kalten und grauen Abschrägung nach dem See zu senkend, vor uns aber weideten wir uns an dem Anblick des bloßen Landes. Durch das Thal hindurch erblickten wir einen Hügelrücken nach dem andern, die sich wie Woge auf Woge am Horizont erhoben. Hier mußten wir weiterziehen; dieser Weg führte uns an den Fjord.
Auch Ravnas Antlitz strahlte endlich einmal. Der arme Bursche hatte manch’ liebes Mal die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder festen Grund unter den Füßen zu fühlen. Er und Balto hatten, als sie ihre Schlitten los waren, nichts Eiligeres zu thun, als spornstreichs in die Berge hinauf zu klettern, ganz wie damals, als wir auf der Ostküste ans Land gelangten.
Jetzt war es aber höchste Zeit geworden, an unser Mittagessen zu denken; selbst das überströmendste Gefühl, das Ziel[S. 169] erreicht zu haben, vermag nicht die materiellen Bedürfnisse zu übertäuben, — im Gegentheil, das Gefühl, eine Schwierigkeit überwunden zu haben, erhöht den materiellen Genuß.
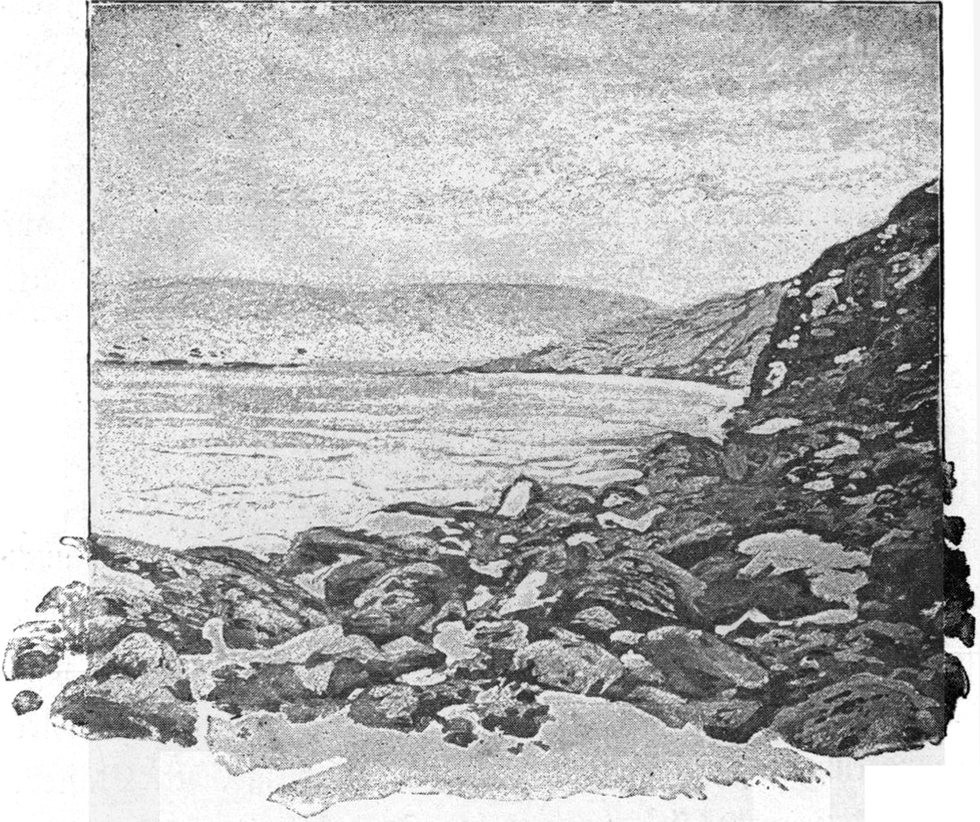
Als wir endlich mit dem Mittagessen fertig waren, machten wir uns schnell daran, unsere Bündel zum Herabsteigen zu schnüren. Es galt, so viel wie möglich von dem Nothwendigsten mitzunehmen, aber auch nicht zu viel, da eine zu schwere Last unsere Wanderung verzögern würde, und wir gern so schnell als möglich zwei Mann nach Godthaab entsenden wollten.
Um für etwa eintretende Fälle gleich ein wenig Material zum Bootsbau bei der Hand zu haben, nahmen wir einige Bambusstangen mit und beschlossen während des Bootsbaus weitere zu holen. Die Sachen, die wir nicht mitbringen konnten, wurden oben auf die Schlitten gelegt und gut mit Persennings zugedeckt.[S. 170] Als dies geschehen war, waren wir endlich am Nachmittag fertig, in das Thal hinabzuziehen.
Bei dieser Gelegenheit wurde es uns erst so recht klar, welche Kraft in dem kleinen Ravna wohnte. Er hatte während der Wanderung über das Inlandseis am wenigsten von uns Allen gezogen, da er stets darüber klagte, daß es für ihn alten Mann zu schwer sei; er blieb auch oft zurück. Jetzt hatte ich das Nothwendigste, was wir mitnehmen wollten und was wir bewältigen zu können glaubten, in sechs Haufen vertheilt. Wie wunderte ich mich, als ich sah, daß Ravna außer seinem Theil noch seinen Kleidersack mit allerlei Reservezeug und dergl. auf den Rücken nahm. Ich sagte ihm, das würde zu viel, ich wollte nicht, daß er sich überanstrenge; er aber erwiderte, er könne sich nicht von seinem Kleidersack trennen, in dem er sein Neues Testament habe, er würde schon damit fertig werden. Und mit seiner schweren Bürde, unter welcher er selbst fast verschwand, machte er sich auf den Weg und hielt fortdauernd Schritt mit uns. Er meinte wohl, daß nun kein Grund mehr vorhanden sei, mit seinen Kräften zu sparen, und wollte uns scheinbar zeigen, was er vermochte, und Balto hatte ganz recht, wenn er voller Bewunderung sagte: „Ravna, der Kerl hat, weiß Gott, Kräfte“.
Das Terrain fiel an manchen Stellen steil ab, der Weg führte über Steingeröll und Sümpfe, unsere Lasten waren schwer, und es war kein Wunder, wenn es nicht so schnell vorwärts ging. Mehrmals während unserer Wanderung sagte Ravna ganz begeistert zu mir: „Hier riecht es gut, genau so, wie auf den Bergen in Finnmarken, wo gute Rennthierweide ist.“ Und er hatte recht, es roch sowohl nach Berggras wie nach Rennthiermoos; mit wahrer Wollust sogen wir die würzige Luft in langen Zügen ein. Gegen Abend gelangten wir an einen langen See (wir nannten ihn „Langvandet“), in den sich zu unserer Verwunderung[S. 171] von Westen her ein mächtiger Eisgletscher hineinschob; es war offenbar ein Ausläufer des Inlandseises, das sich an dem westlich von uns gelegenen Felsen vorüberdrängte.

Als wir eine Strecke über den See hingekommen waren auf sehr unsicherem Eise, wo wir mehrmals fast hineinfielen und nur mit Noth ans Land kamen, machten wir am Abend Halt an der Ostseite des Sees auf einem guten Zeltplatze. Zum erstenmal während unserer ganzen Expedition lagerten wir uns auf wirklich weichem Heidekraut. Voller Behagen streckten wir unsere Glieder aus, während die Bergluft über uns hinsäuselte, vermischt mit jenem eigenthümlich betäubenden Tannengeruch, der von einer eigenen Art Heidekraut herrührt, das in großen Mengen in Grönland wächst.
[S. 172]
Während wir unser Abendessen im Zelt verzehrten, erhielt Ravna, der der Zeltöffnung zunächst saß, den Auftrag, ein Feuer aus Heidekraut vor dem Zelte anzuzünden. Das nöthige Brennmaterial war bereits gesammelt und wir meinten, daß der Anblick eines Feuers gemüthlich sein müsse. Aber Ravna schien dies nicht einsehen zu können, und mit der bekannten Trägheit des Berglappen hatte er sofort eine ganze Reihe von Einwänden bei der Hand. Nein, darin sei kein Sinn und Verstand, mit dem Brennmaterial wollten wir lieber morgen früh kochen. Ich erwiderte ihm, daß ringsherum Brennmaterial in Hülle und Fülle zu finden sei. Dann wandte er ein, daß er keine Baumrinde zum Anzünden habe, da aber lachten wir ihn aus, und sagten ihm, er würde, wenn er bis morgen früh wartete, nicht mehr Baumrinde haben wie jetzt. Er solle nun nur nicht viele Umstände machen, sondern gefälligst Feuer anlegen. So bequemte er sich denn endlich dazu, und es währte nicht lange, bis ein mächtig knisterndes Feuer vor dem Zelte aufflammte, Wärme und Licht in dem vorhin so dunklen Zeltraum verbreitete und eine Rembrandts Beleuchtung über die sitzenden Gestalten warf, die sich froh und beinahe satt aßen. Die Tassen wurden fleißig zu Munde geführt, man verzehrte ganz unglaubliche Quantitäten Suppe. Es war ein ganz ungewohnter Genuß für uns, so gut sehen zu können, was wir zu Munde führten, — es war keine unwillkommene Veränderung, nachdem wir so oft in rabenschwarzer Finsterniß hatten essen müssen.
Ich forderte Ravna mehrmals auf, wieder hereinzukommen, es sei nun nicht mehr nöthig, nach dem Feuer zu sehen, — es brenne gut genug, — aber nein! Jetzt war er nicht von dem Feuer fortzubekommen.
Nach dem Abendessen zündeten die rauchenden Mitglieder der Expedition sich eine mit Moos oder Gras gestopfte Pfeife[S. 173] an, und dann lagerte man sich mit den dampfenden Pfeifen um das wärmende Feuer herum, um sich so recht an dem Bewußtsein zu erquicken, daß das Inlandseis nun überwunden und das Ziel erreicht war.
Ich meinerseits lag auf dem Rücken da und freute mich über den fast schelmischen Ausdruck in Ravnas sonst so mürrischem Gesicht. Er lächelte fast ununterbrochen, und auf die Frage, ob ihm das Land gefiele und ob er die Bergluft merken könne, antwortete er voller Begeisterung, hier möchte er wohl wohnen. Ich fragte ihn nun allen Ernstes, ob er Lust habe, mit seinen Herden hierher zu ziehen. Er erwiderte, Lust habe er wohl, aber es würde ihm zu theuer. Als ich meinte, dann müsse der dänische oder der norwegische Staat ihn gratis hinüberbefördern, da sagte er, daß er sich keinen Augenblick bedenken würde. Hier sei Weide genug und wilde Rennthiere seien hier auch, er habe am Nachmittag Spuren davon gesehen. Hier würde er schnell reich werden. Die einzige Schwierigkeit würde das Brennmaterial im Winter verursachen, da müsse man es so machen, wie einige Lappen es in der Heimath gemacht hätten, — man müßte Torf für den Winter einsammeln. Der alte Ravna schloß seine Lobrede mit den Worten: „Ich mag die Westküste gern, hier ist ein guter Ort für einen alten Berglappen, es sind viele Rennthiere hier, es ist hier gleichsam wie auf den Gebirgen Finnmarkens.“
Es war eine herrliche Nacht mit einer eigenartig milden Luft. Eine weiche Stimmung macht uns schweigen, ein Gedanke folgt dem andern in die Ferne und verwebt sich mit den Strahlen des Mondes, der eben über dem Hügelrand heraufgestiegen ist, — bis das Ganze zu einem Gedankengewebe wird, dessen Fäden man nicht mehr zu entwirren vermag, da ein wohlthuender Halbschlummer sich auf die müden Lider lagert. Erst spät in der[S. 174] Nacht rafft man sich auf und kriecht in die Schlafsäcke. Sverdrup behauptet, nie im Leben einen so herrlichen Abend erlebt zu haben, wie diesen grönländischen Abend, in dem er an dem ersten Heidekrautfeuer lag und Moos rauchte, — und ich glaube, die Mehrzahl von uns wird darin mit ihm einig sein.
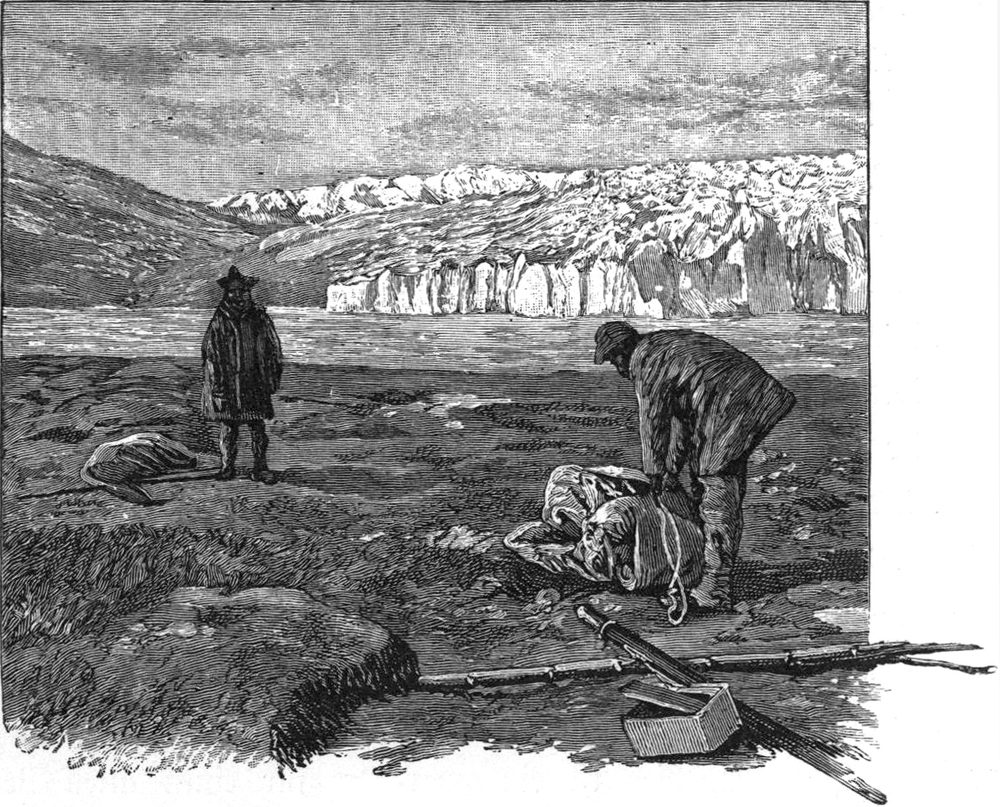
Am nächsten Morgen (25. Septbr.), ging es wieder von dannen, die Last auf dem Rücken. Am Ende des Sees angelangt, ruhten wir ein wenig aus und sahen einen Hasen, der herangesprungen kam und sich unter einen Felsblock setzte. Schnell holte ich die Büchse hervor und näherte mich ihm bis auf circa zweihundert Ellen und war wirklich so glücklich, ihn in dieser großen Entfernung todt zu schießen, unter lautem Jubelgeschrei der Kameraden, die in großer Spannung gewesen waren, ob sie zur Nachtkost frisches Fleisch bekommen würden oder nicht.
[S. 175]
Nun setzten wir unsern Marsch durch ein zum Theil sehr enges Thal fort, wo wir viele steile Abhänge und unwegsame Moränen zu passiren hatten. Links von uns zog sich ein Arm des Inlandseises noch ein gutes Stück ins Thal hinab, hier unten aber wälzte es mächtige Moränen vor sich her und bildete stellenweise hohe Eiskegel und Blöcke, die indessen derartig mit Lehm und Steinen bedeckt waren, daß man sie nur schwer von dem bloßen Lande unterscheiden konnte.
Am Vormittag gelangten wir an eine steile Felsschlucht und hatten abermals ein Gewässer unter uns, in das sich von Osten her das Inlandseis hineinschob. Wir konnten hier weithin über das Eis schauen bis zu dem Nunatarsuk nördlich von Kangersunek, und der Punkt, zu dem Sverdrup und ich während unserer Ski-Tour am 21. September hinuntergelangt waren, lag nicht sehr fern. Der Bach, dessen Lauf wir bis dahin gefolgt waren, ergoß sich in einen Strom, der nicht weit von dem Felsabhang aus dem See kam, folglich stellte es sich heraus, daß die Karte, auf die wir uns verlassen hatten, ganz falsch war. Wir mußten noch über zwei Meilen bis zum Fjord haben, sahen also unsere Hoffnung, noch heute bis dahin zu gelangen, getäuscht.
Gegen Mittag kamen wir an einen See, der theilweise von flachen, breiten Ufern umgeben war, auf dem wir zahlreiche Gänsespuren und Gänseexkremente erblickten, woraus wir schlossen, daß dies ein beliebter Ruheplatz für den Schwarm wilder Gänse war, die speciell im Herbst, wenn das Wasser offen ist, an dem Strande des Inlandseises entlang ziehen.
In dem Lehm waren auch, wie überall auf unserem Wege, wo Spuren denkbar waren, Unmengen von Rennthierspuren, die zum Theil erst ein paar Tage alt zu sein schienen. Sämtlich gingen sie in der Richtung nach dem Fjord hinab. Ich strengte[S. 176] meine Augen an und ließ sie unermüdlich an den braunen Felswänden entlang schweifen, die uns von allen Seiten umschlossen, — aber es half mir nichts, keines der gehörnten Thiere ließ sich blicken. An der Südseite des Gewässers, dem wir den Namen „Gänseteich“ gaben, lagerten wir uns im hohen Heidekraut und ließen uns das Mittagessen schmecken. Es war ein prächtiger Tag, die Sonne schien warm, der Himmel wölbte sich klar und blau über uns, und ringsumher breitete sich die schönste Landschaft aus, die ein Jäger sich nur wünschen kann. Ein wenig früher im Jahre, wenn das Rennthier sich hier in Rudeln aufhält und die Wildgans um die Wette mit Enten, Schnepfen und anderen Wasservögeln, an denen Grönland ja so reich ist, schreit, — da muß es hier ein wahres Eldorado sein.
Am Abend schlugen wir unser Zelt auf einer Fläche bei einem kleinen Gewässer auf, das von den prächtigsten Rennthierweiden mit sanft abfallenden heidekrautbewachsenen braunen Abhängen umgeben war. Der am Morgen erlegte Hase wurde in einem Kessel gekocht, den wir aus einem Spiritusbehälter herstellten. Als das Gericht eben fertig war, fiel der Kochtopf ins Feuer, und alle Suppe ging verloren; der Hase aber wurde gerettet und vertheilt. Es kam auf den Mann zwar nur wenig von so einem Zwergthierchen, aber das Wenige, das wir erhielten, schmeckte dafür auch desto besser. Wir waren nicht mehr an frisches Fleisch gewöhnt, und es war auffallend leichter zu kauen, als der harte Pemikan, der für Jemand, dessen Zähne schlecht waren, kaum hinunterzubringen war. Aus dem Grunde suchten Sverdrup und ich, die in dieser Beziehung von der Natur am schlechtesten ausgerüstet waren, stets nach den Stücken, die ein wenig verschimmelt waren, denn diese ließen sich besser kauen. Das Feuer flammte lustig auf, die Erbsensuppe war warm und die Stimmung wenn möglich noch wärmer.
[S. 177]
Am 26. September hatten wir endlich eine einigermaßen begründete Hoffnung, den Fjord zu erreichen. Wir gingen in dem Flußthal entlang und kamen theils über breite, sandige Bodenmoränen, theils über flache Sandebenen, in die sich der Fluß mit steilen Ufern tief hineingegraben hatte. Hier wuchsen mannshohe Weiden und Erlen. Das Laub der letzteren war noch grün, aber das der Weiden war bereits gelbbraun und welk, wahrscheinlich infolge von früheren Nachtfrösten, jetzt hatten wir freilich während des Tages 12° Wärme im Schatten, und die Nächte waren mild, wie die Septembernächte in der Heimath. Diese Ebenen sind auch der Quere nach von Flußbetten durchkreuzt, die sich in den weichen, sandigen Lehm eingegraben haben, und die uns, wenn ihre hohen Ufer mit Weidengebüsch bewachsen waren, viele Schwierigkeiten beim Ueberschreiten machten.
Das Thal, das wir jetzt durchschritten, war übrigens in geologischer Hinsicht hochinteressant. An einer Stelle tief unten hatte der Strom eine frische Schicht im sandigen Ufer aufgewühlt, und hier lagen Unmengen von leeren Blaumuscheln (Mytilus edulis) zwischen dem Sande. Diese Muschelschalen lassen keinen Zweifel über die Entstehungsart dieser großen Sandebenen aufkommen, die den Thalboden füllen. Früher ist hier ein Fjord gewesen; Lehm und Kies, von dem Gebirgsbach aus den Moränenbildungen des Inlandseises mit fortgeführt, haben sich auf dem Boden des Fjords gelagert und diesen allmählich mit einer horizontalen Lehmschicht angefüllt. Später hat das Land sich gehoben. Daß dies letztere wirklich der Fall ist, beweisen am sichersten die Schalen dieser Salzwassermuschel, die sich in einer Höhe von mehr als 20 m über dem Meere finden. Wie aber diese Hebung vor sich gegangen ist, ob sie ruckweise geschehen ist, wie ein bekannter norwegischer Geologe behauptet, oder ob sie sich ganz allmählich gebildet hat, wie man in jüngster Zeit anzunehmen[S. 178] geneigt ist, darüber läßt sich noch nichts mit Bestimmtheit sagen. Die meisten Umstände sprechen freilich für die letztere Annahme. Diese Lehmschichten oder Meeresanschwemmungen liegen allerdings in Terrassen, dies läßt sich aber dadurch erklären, daß der Bergstrom während einzelner Perioden mit starken Niederschlägen bedeutend größere Mengen festen Stoff mit sich geführt haben kann als während der dazwischenliegenden trockneren Zeiträume, wodurch eine solche Treppenbildung hat entstehen müssen. Je nachdem der Boden des Fjords über die Meeresfläche emporstieg und Terrassen bildete, grub sich der Bergstrom sein gewundenes Bett durch abgelagerten weichen Sand und durch Lehmschichten. Es ist leicht, diese Schichten aufzuwühlen und sie zu unterminiren, und so ist denn auch eine Sandmenge nach der anderen durch den Bergstrom fortgeführt und im Laufe der Jahre in den Fjord hinausgeschwemmt, um dort neue, ähnliche Ablagerungen zu bilden. Die Naturkräfte kommen hier niemals zur Ruhe, — gewaltige Kräfte sind hier in Bewegung gesetzt, einige graben nach bestem Vermögen Thäler und Fjorde aus, andere, oder vielmehr andere Formen derselben Kräfte thun das Ihre, um auszuebnen und auszufüllen, was früher ausgegraben wurde. Die Eisgletscher graben und scheuern die Thäler und Fjorde — diese wohlbekannten engen Eisfjorde mit den steilen, glatt abgeschliffenen Seiten — in den harten Gneisfelsen aus. Dieselben Eisströme schieben mächtige Dämme in Form von Moränen vor sich her. Wo die Strömung sich zurückzieht, bilden sich Wälle quer vor den Fjordmündungen und Thälern, welche die Rennthierjäger auf ihren Wanderungen durch das Thal hemmen. Aber unter den Gletschern kommen Flüsse hervor, und der Lehm und der Kies, der von dieser Gletschermilch mit fortgeführt wird, fällt schließlich auf den Boden eines der engen Eisfjorde und füllt denselben aus, so gut er[S. 179] kann, sowie wir es aus dem Trondhjemsör, Lärdalsör und vielen andere Werdern in der Heimath kennen, und noch heute bilden sie sich zu Hunderten an der grönländischen Küste.
Aus diesem Grunde ist das Studium der jetzigen Eisperiode Grönlands für den Naturforscher von so ungeheurer Bedeutung; dadurch werden viele Erscheinungen, die sonst für ihn unverständlich sein würden, in ein klares Licht gestellt. Er sieht hier ganz aus erster Hand die mächtigen Kräfte in voller Thätigkeit, von denen er sich sonst nur durch den Spiegel der Phantasie eine Vorstellung machen kann, oder die er im besten Fall an den kleinen Zwergerscheinungen studiren kann, die in Europa aus jenen Zeiten zurückgeblieben sind, als ganz Nordeuropa und die Alpen von ähnlichen Eisfeldern überschwemmt waren, wie jetzt das mächtige grönländische Hochland.
Tief unten im Thal mußten wir durch den Gebirgsbach waten, um weiter zu kommen. Eine Strecke weiter entdeckten wir zu unserem Aerger, daß auch an dem anderen Ufer des Baches kein Vorwärtskommen möglich war, und hier war der Bach zu tief, um zu waten. Wir mußten entweder zurück oder einen Versuch machen, über den westlich von uns gelegenen Bergrücken zu klettern. Während wir hierüber nachgrübelten, beschlossen wir unser Mittagessen einzunehmen.
Nach der Mahlzeit verschwand Balto, und es währte nicht lange, als ich ihn plötzlich oben auf dem Gipfel des Berges erblickte; er schwang triumphirend seine Mütze, jubelte und zeigte nach Westen. Offenbar konnte er den Fjord sehen. Nach einer Weile kam er zurück, und berichtete, daß er ein großes blaues Wasser gesehen habe, das wohl der Fjord sein müsse. Auf dem innersten Theile läge jedoch Eis. So schnell unsere Füße uns zu tragen vermochten, erklommen wir jetzt den Berg, wir sehnten uns Alle danach, die See zu[S. 180] sehen. Außerdem lockten die von Balto verheißenen Preißelbeeren uns ebensosehr, wie die zahllosen Fliegen hier unten uns den Aufenthalt im Thal unleidlich machten. Von dem Berge herab hatten wir die herrlichste Aussicht über das Thal, wo der Bach sich durch flache Sandebenen schlängelte und weiterhin auf den Fjord, der sich wie eine blaue Fläche bis an die hohen Felsen erstreckte, welche das Ganze einrahmten. Was Balto für Eis gehalten hatte, war eine Sandanschwemmung, die den inneren Theil des Fjords vollständig anfüllte.
Wir hatten jetzt nicht mehr weit bis zum Ziel. Groß war unsere Freude, als wir ein wenig weiter nach unten einige alte Spuren von grönländischen Kamiken im Sande am Ufer des Baches entdeckten. Wahrscheinlich stammten sie von einem Rennthierjäger her, der vor Monaten dies jetzt so menschenleere Land durchstreift hatte; der stark betretene Weg ließ deutlich erkennen, daß sich hier zu gewissen Jahreszeiten Unmengen von Rennthieren aufhielten. Dieses war die erste Spur menschlicher Wesen an der Westküste mit Ausnahme einiger Exkremente, die nach Baltos Ansicht von einem Menschen oder einem Bären stammen mußten.
Nachdem wir noch einen mit Weidengesträuch bewachsenen Berg erklommen hatten, lag endlich der Fjord vor uns. Bis zu den Sandanschwemmungen, durch die sich der Bach hindurchwand, hatten wir nur noch einen kleinen Abhang hinabzusteigen. Gerade unter uns befand sich eine kleine, mit Heidekraut und Buschwerk bewachsene Fläche mit einem kleinen Teich. Hier mußte ein herrlicher Zeltplatz sein, um so mehr als uns die Berge vor dem Ostwind schützten, der sich erhoben hatte und durch die Thalschlucht von dem Inlandseis her wehte. Wir eilten dorthin, warfen erst unsere Last und dann uns selber ins Heidekraut und erquickten den müden Leib in dem Bewußtsein, dem Ziele so nahe zu sein.
[S. 181]
Freilich war noch mancherlei für uns zu thun. Die vier Kameraden sollten den Rest des Gepäcks holen, Sverdrup und ich wollten nach Godthaab, um ein Boot und Hülfe herbeizuschaffen. Wie dies am besten zu bewerkstelligen sei, darüber waren wir uns noch nicht klar. Eines aber ließ sich nicht abstreiten, — jetzt befanden wir uns wieder auf gleicher Höhe mit dem Meeresspiegel, wenn wir auch noch nicht ganz an die Meeresküste gelangt waren, und nun haben aller Wahrscheinlichkeit nach unsere Leiden und Strapazen ein Ende. Eine Schwierigkeit, die von vielen Sachverständigen, ja von der großen Mehrzahl als unüberwindlich betrachtet wurde, war jetzt siegreich überwunden. War es ein Wunder, daß wir uns da in einer glückseligen Stimmung befanden? Nachdem wir ein wenig geruht und gegessen hatten, unternahmen Einige von uns einen Ausflug auf das im Osten gelegene Gebirge, um eine Aussicht über den Fjord zu gewinnen. Das Land auf der Nordseite des Fjords erschien, von hier aus gesehen, so zerrissen, daß wir kaum an die Möglichkeit denken konnten, Godthaab auf dem Landwege zu erreichen.
Weit leichter würde es sein, wenn wir uns nach Narsak auf der Südseite des Fjords begeben wollten, aber wir waren nicht sicher, hier Leute anzutreffen, die Europäisch verstanden, deswegen war der Seeweg immer der sicherste. Fest entschlossen, uns, so gut es sich mit den uns zur Verfügung stehenden Materialien machen ließ, in der Bootsbaukunst zu versuchen, kehrten wir nach dem Zelt zurück. Wir hatten vom Inlandseis zwei Bambusstangen und einen Skistab mitgenommen, Bootsrippen dagegen hatten wir gar nicht, dazu sollten die gebogenen Eschenstäbe in den Schlitten dienen. Die lagen aber jetzt oben im Gebirge, und es würden wenigstens 2–3 Tage vergehen, ehe wir sie herbeischaffen konnten; da mußten wir etwas ausfindig machen, was wir statt ihrer verwenden konnten. Selbstverständlich verfielen[S. 182] wir auf das Weidengebüsch, das uns in Fülle umgab. Balto sollte uns beim Nähen behülflich sein, während die Anderen schon morgen in aller Frühe nach dem Inlandseis zurückkehrten.
Am Morgen des 27. September standen wir früh auf, kochten unsere letzte Portion Thee, wozu wir ein sehr knappes Frühstück, aus Brot und ein wenig Pemikan bestehend, einnahmen. Pemikan hatten wir zwar von unserem großen Vorrath auf dem Inlandseis reichlich mitgenommen; wir hatten aber erstaunlich viel davon gegessen (18 Platten von 25) und von dem Rest mußten Sverdrup und ich so viel wie möglich auf unsere Bootstour mitnehmen, da wir nicht berechnen konnten, wie lange dieselbe währen würde.
Nach dem Frühstück machten sich Sverdrup und Balto unverzüglich an den Bootsbau, während ich einige Observationen anstellte und die Anderen sich für die Rückkehr vorbereiteten. Nachdem sie ihren Proviant für den Tag, bestehend aus etwas Brot, Fleischpastete und ein wenig Fleischpulverschokolade erhalten hatten, waren sie bald reisefertig und erhielten gemeinsam mit Balto, der ihnen ja späterhin folgen sollte, ihre Instruktionen.
Vor allen Dingen sollten sie auf die Instrumente, die Tagebücher, Formulare etc. acht geben, von der übrigen Last mußte so viel wie irgend möglich mitgenommen werden; daß vom Proviant nichts zurückbleiben durfte, verstand sich von selbst.
So zogen sie denn thalaufwärts von dannen, geleitet von den besten Wünschen und dem herrlichsten Wetter, und wir setzten unsern Bootsbau fort. Ursprünglich war es meine Absicht gewesen, das Boot lang und schmal zu bauen, damit es sich leichter rudern ließe, Sverdrup meinte jedoch, daß das zuviel Näherei erfordern würde, es sei besser, den Zeltboden so zu verwenden, wie er war, ihm nur die Form eines Bootes zu geben und das Segeltuch zu flicken, wo es undicht war.[S. 183] Wir würden auf die Weise kein schönes Boot erhalten, aber die Konstruktion würde ungleich leichter werden. Ich ordnete mich natürlich dem Seemann unter. Unglücklicherweise hatten wir, wie bereits früher erwähnt, unsern Segelhandschuh an der Ostküste zurückgelassen; hätten wir den gehabt, so würde das Nähen ungleich schneller von statten gegangen sein, jetzt mußten wir das harte Segeltuch mit den bloßen Händen nähen. Noch weit unangenehmer waren die zahllosen kleinen Fliegen, die uns umschwärmten und uns ganz abscheulich stachen. Es war eine völlige Unmöglichkeit, sich davon zu befreien, sie waren fast noch schlimmer als die Mücken an der Ostküste. Nachdem ich mich eine Weile mit der Segeltuchnadel abgemüht und gefunden hatte, daß ich eigentlich nicht zu der Arbeit taugte, überließ ich sie den beiden Andern, die wahre Meister in dieser Kunst wie in vielem anderen waren, und zog mit der Axt in den Wald, d. h. in das nahegelegene Weidendickicht, um passende Zweige für die Bootsrippen zu holen. Das Gestrüpp war zum Theil so hoch, daß ich völlig darin verschwand und kaum die Spitzen der Sträuche mit ausgestreckter Hand erreichen konnte. Hier waren genügend dicke Zweige, ich fand sogar einen Busch, dessen Zweige an der Wurzel so dick waren wie der Schenkel eines ausgewachsenen Mannes, sie waren aber alle so knorrig, daß es keine Kleinigkeit war, das passende Material zu finden. Endlich hatte ich so ungefähr gefunden, was ich suchte, es war zwar nicht allzuschön, aber wenn man nichts Besseres hat, so muß man vorlieb nehmen. Am Abend war das Boot fertig. Es war zwar kein Prachtexemplar, seine Form hatte große Aehnlichkeit mit der Schale einer Schildkröte, aber es trug uns beide, als wir einen Versuch damit auf dem Teich machten, und darüber waren wir sehr erfreut. Es war 2,56 m lang, 1,42 m breit und 61 cm tief.
[S. 184]
Unsere Ruder hatten wir freilich noch nicht fertig; ich hatte zwar einige gespaltene Weidenzweige gefunden, die ich als Ruderblätter zu benutzen gedachte, indem ich Segeltuch zwischen die beiden ausgespreizten Arme spannte, und zu den Ruderstangen dachte ich Bambusstöcke zu verwenden, — ich war aber noch nicht weit damit gekommen, dann plagte mich ebenso wie an den vorhergehenden Tagen ein entsetzlicher Kopfschmerz, und alles, was ich unternahm, ging nur langsam von statten.
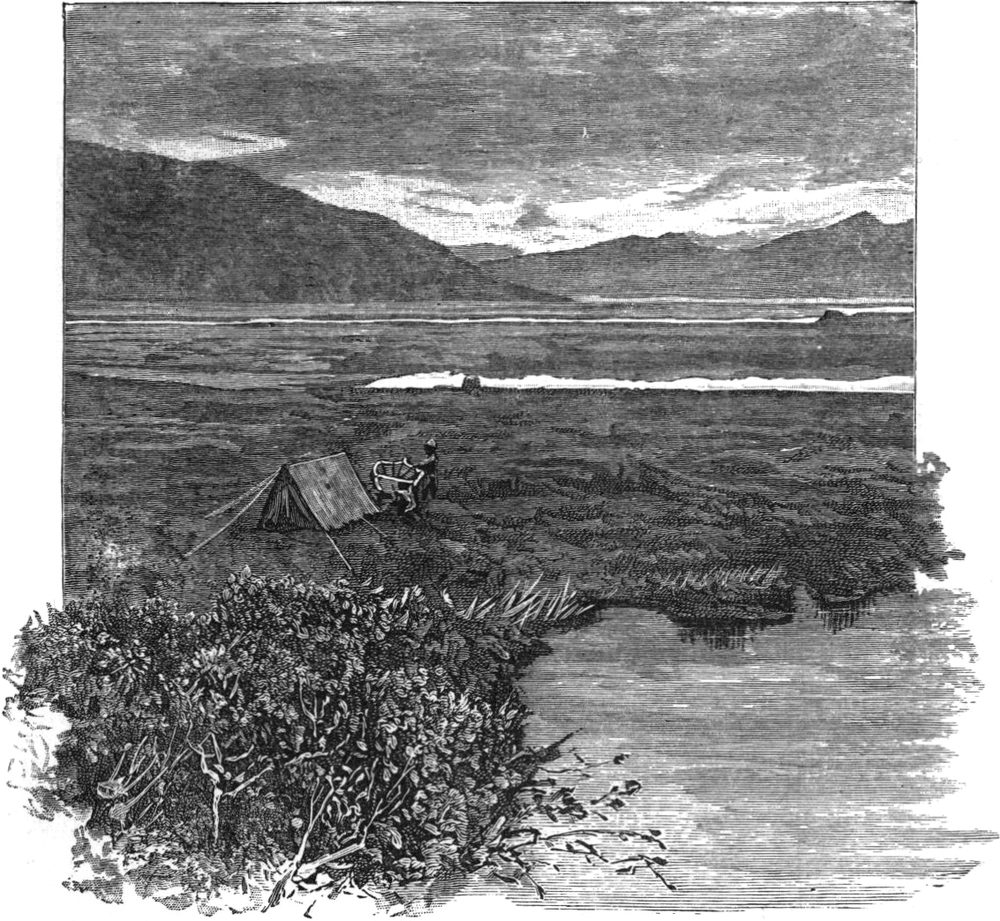
Am nächsten Morgen (28. September) sollte auch Balto uns verlassen. Ehe er fortzog, nahmen wir ein kleines Frühstück ein, das Balto mit folgenden Worten schildert:
[S. 185]
„Nansen hatte für sich etwas Vorrath zurückbehalten, wovon er und Sverdrup bis nach Godthaab zehren wollten, aber trotzdem durften wir davon essen, denn die Beiden meinten, sie könnten auf der See Vögel schießen und hin und wieder einmal kochen. Als wir mit der Mahlzeit fertig waren, fragte ich: „Hast du genug gegessen, Sverdrup?“ — Er antwortete: „Nein, durchaus nicht, ich bin noch eben so hungrig als zu Anfang der Mahlzeit.“ Nansen sagte: „Ach das thut nichts! Laß das nur gut sein, Sverdrup, wenn wir nach Godthaab kommen, soll dein Bauch schon voll werden!“

So verließ uns denn Balto, und der frische Bursche sprang mit beneidenswerther Leichtigkeit durch das Thal dahin, um noch am selbigen Abend die Andern ganz oben unter dem Inlandseis zu erreichen.
Um die Mittagszeit waren auch unsere vier Ruder fertig[S. 186] und das Boot lag klar zum Gebrauch da. Am schwierigsten war das Anbringen der Ruderbänke. Wir hatten nur das schmale, runde Theodolith-Stativ aus Eschenholz für die eine und zwei schmale Bambusstäbe für die andere Bank. Im Interesse eines gewissen Körpertheils will ich wünschen, daß es lange währt, bis ich mich wieder mit einem so schmalen Sitz behelfen muß.
Nachdem wir zu Mittag ungefähr eben so viel gegessen hatten wie zum Frühstück, wurden die Schlafsäcke, das Zeug und alles, was wir nicht mitnehmen wollten, in das Zelt eingewickelt, das wir mit Steinen beschwerten und gegen etwaiges Regenwetter so gut wie möglich schützten. Unsere beiden Säcke, in denen sich das nothwendigste Zeug, ein Hemd, Strümpfe, Schuhe, ein Paar Ueberzieh-Beinkleider, Fausthandschuhe, Regenzeug etc. befand, nahmen wir mit in das Boot. Außerdem hatten wir zum Schlafen während der Nacht die beiden Rennthierfellwämse der Lappen geliehen und unsere „Komager“ mit dem entsprechenden Senngras eingepackt. Auch unsere photographischen Apparate, Patronen für die Büchse, sowie zwölf Tafeln Erbswurst, eine Blechdose mit sieben Pfund Fleischschokolade, ein Segeltuchsack mit Knäckebrot, eine Dose Leberpastete, drei Pfund Butter und fünf Tafeln Pemikan, meine Segeltuchsbeinkleider, worin dreiunddreißig Fleischbiskuits, zwei Becher, die auch als Schöpfschaufeln benutzt wurden, ein Kochgeschirr, wozu der obere Theil des Kochapparats, von dem der Filzbezug entfernt war, benutzt wurde, sowie endlich eine Büchse nahmen wir noch mit.
Das Gepäck wurde erst auf die Sandaufschwemmung gebracht und dann das Boot. Wir hofften, in dem Boot den Bach hinunterrudern und von hieraus direkt in die See stechen zu können. Aber auch hier sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen, indem der Bach so seicht war, daß man an ein Rudern nicht denken konnte. Jedenfalls war es eine völlige Unmöglichkeit[S. 187] wenn wir Beide im Boot saßen. Deswegen ging ich, als der schwerste zu Fuß über die Sandanschwemmung, während Sverdrup versuchen sollte, allein weiterzustängeln. Aber es wurde nicht viel besser. Er mußte in dem kalten Wasser waten und das Boot hinter sich herziehen, und das war kein Vergnügen. Nur an wenigen Stellen konnte er stängeln, an Rudern war gar nicht zu denken, und das Ganze ging nur sehr langsam.
Wir hatten die unglaublichsten Schwierigkeiten der verschiedensten Art zu überwinden, oft lagen wir bis an den Magen im Lehm und im Wasser. Wir wanderten einen halben Tag in diesem Brei herum, der sich um unsere Füße festsog und uns auf jedem Schritt festhielt. Endlich erreichten wir eine Landspitze draußen im Fjord, von wo aus wir in die See hinauszugelangen hofften. Hier entdeckten wir jedoch, daß wir noch weit vom Ziel entfernt waren. Der Bach verzweigte sich in ein Delta und wurde so seicht, daß kein Gedanke mehr daran war, das Boot zu ziehen. Es mußte den Rest des Weges getragen werden. Da es aber schon spät am Abend war, hielten wir es für gerathen, Rast zu machen. Die letzte Abendröthe im Westen hinter den Bergen war verschwunden und ein Stern nach dem andern erglänzte an dem dunkelnden Himmel, wo das Nordlicht sein nächtliches Schauspiel aufführte. Bald lächelte auch der Mond auf uns Beide herab, die wir an dem ersterbenden Feuer saßen und von Grönlands Inlandseis als von einem längst entschwundenen Traum sprachen.
Nach beendeter Abendmahlzeit suchten wir uns Jeder einen Weidenbusch aus, unter dem wir in unseren Pelzen zusammenkrochen und einschliefen.
[S. 188]
 m nächsten Morgen, den 29. September, trugen wir das Boot über das
angeschwemmte Land an die See. Mit der Last durch den zähen Lehm zu
stampfen, war ein schlimmeres Stück Arbeit, denn je, — die Füße
versanken, sogen sich fest und gaben bei jedem Schritt ein Geräusch von
sich wie der Stempel in einer Luftpumpe. Endlich erreichten wir das
Ufer und legten das Boot hin, um zurückzugehen und die anderen Sachen
zu holen. Hier draußen waren Unmengen von Möven, — wir hatten uns
schon auf das frische Fleisch gefreut, leider aber hielten sie sich in
einer allzu ehrerbietigen Entfernung. Zu unsern Sachen zurückgekehrt,
fanden wir, daß wir jetzt mehr als genug von dieser Lehmstampferei
hatten. Wir beschlossen deshalb, den Versuch zu machen, den Rest über
das unebene Terrain zu tragen.
m nächsten Morgen, den 29. September, trugen wir das Boot über das
angeschwemmte Land an die See. Mit der Last durch den zähen Lehm zu
stampfen, war ein schlimmeres Stück Arbeit, denn je, — die Füße
versanken, sogen sich fest und gaben bei jedem Schritt ein Geräusch von
sich wie der Stempel in einer Luftpumpe. Endlich erreichten wir das
Ufer und legten das Boot hin, um zurückzugehen und die anderen Sachen
zu holen. Hier draußen waren Unmengen von Möven, — wir hatten uns
schon auf das frische Fleisch gefreut, leider aber hielten sie sich in
einer allzu ehrerbietigen Entfernung. Zu unsern Sachen zurückgekehrt,
fanden wir, daß wir jetzt mehr als genug von dieser Lehmstampferei
hatten. Wir beschlossen deshalb, den Versuch zu machen, den Rest über
das unebene Terrain zu tragen.
Als ich wieder zu unserm Boot zurückkam, sah ich es weit draußen auf der See schwimmen. Das Wasser war inzwischen gestiegen und hatte den ganzen äußeren Theil des aufgeschwemmten Landes überfluthet. Glücklicherweise war Sverdrup, obwohl wir uns so weit vom Ufer befanden und ganz sicher zu sein glaubten, so vorsichtig gewesen, das Boot an einem Stock zu befestigen, den er in den Lehmboden einbohrte. Während ich[S. 189] unsere Sachen bis an eine Landzunge trug, die weit in die See hinausreichte, watete Sverdrup bis an das Boot und ruderte es bis zu demselben Punkt, und so war denn endlich nach fast 24stündigen Anstrengungen auch dies Hinderniß glücklich überwunden, und wir hatten das offene Fahrwasser erreicht.
Wir verzehrten unser Mittagessen und traten unsere erste Seereise an, deren Ziel nichts Geringeres war, als die nördliche Seite des Fjordes, wo wir uns am Lande entlang zu halten beabsichtigten. Zu unserer Freude bemerkten wir jetzt, daß das Boot nicht ganz so schwer zu rudern war, wie wir erwartet hatten. Man konnte zwar nicht sagen, daß unsere Fahrt besonders schnell von statten ging, aber wir kamen doch vorwärts und erreichten das jenseitige Ufer unserer Ansicht nach in ziemlich kurzer Zeit. Dichtigkeit gehörte freilich nicht zu den Tugenden unseres Fahrzeuges, es leckte dermaßen, daß wir das Wasser ungefähr alle zehn Minuten mit unsern Bechern ausschöpfen mußten.
Die Bucht, die sich vor uns ausbreitete, war in unsern Augen ganz ungewöhnlich schön. Ein liebliches, stilles Thal, umgeben von langgestreckten, braunen Weideplätzen und runden, niedrigen Hügeln, erstreckte sich bis an das Ufer. Es war ein Land, das sich ganz vorzüglich zur Rennthierjagd eignen mußte. Alles, was wir mit Nahrung und mit Jagd in Verbindung setzen konnten, interessirte uns am meisten. Der poetische Leser muß es uns nicht verargen, wenn wir diesen Maßstab an die Natur legten.
So ruderten wir denn an Ameragdlas[42] steiler Nordseite entlang und landeten am Abend an einem Punkt, wo wir das Boot aufziehen und einen Schlafplatz finden konnten, was sich nicht überall machen ließ. Wir waren an diesem Tage nicht[S. 190] weit gekommen, aber waren doch zufrieden, uns wieder einmal auf der See tummeln zu können. Den größten Genuß gewährte es uns jedoch, daß wir jetzt nach einer 46tägigen Fastenzeit, in der wir ausschließlich von gedörrten Nahrungsmitteln gelebt hatten, endlich nun wieder frisches Fleisch essen, und zwar uns darin satt essen konnten. Während unserer Bootstour hatte ich sechs von den großen Blaumöven (Larus glaucus) geschossen.

Wir beschlossen, für Jeden von uns zwei dieser großen Vögel zur Nachtkost zu kochen. Sie wurden von Haut und[S. 191] Federn befreit, zu zweien in den Kessel mit kochendem Wasser über das Feuer gesetzt und so wenig wie möglich gekocht. Sverdrup wurde später einmal gefragt, ob wir sie ausgenommen hätten: „Ach, das weiß ich wirklich nicht,“ erwiderte er. „Ich sah wohl, daß Nansen etwas ausnahm, wahrscheinlich waren es die Gedärme.“ — Ob sie denn geschmeckt hätten? — „Ja, — etwas Besseres habe ich in meinem ganzen Leben nicht gegessen.“
Wir zerlegten die Vögel mit Zähnen und Händen, so gut und so schnell wir vermochten. Es währte auch nicht lange, bis die ersten Vögel mit Kopf, Füßen und allem verschwunden waren. An die zweite Portion gingen wir mit größerer Ruhe heran, wir hatten mehr Genuß davon und tranken von der Suppe dazu. Die Sprache hat keine Ausdrücke, um das Wohlsein der beiden Wilden zu beschreiben, die an jenem Abend an dem nördlichen Ufer des Ameragdlas saßen und mit den Händen in den Kochtopf langten, während der Schein des Feuers fast durch ein ungewöhnlich strahlendes Nordlicht verdunkelt wurde. Der ganze Himmel stand in Flammen, im Süden wie im Norden zuckte es hell auf; plötzlich aber war es, als wenn ein gewaltiger Wirbelsturm über den ganzen Himmel hinzog und alle Flammen vor sich hertrieb, sie am Zenith zu einer wirbelnden Feuermasse vereinend. Das Auge wurde fast davon geblendet. Dann legte sich der Sturm, das Licht schwand mehr und mehr, und schließlich flatterten nur noch einzelne matte Lichtnebel über die Sternenwölbung hin, die in ihrem früheren Glanz funkelte. Und abermals stand man ganz verwundert da. Ein ähnliches Nordlicht habe ich niemals, weder früher noch später gesehen. Und dort unten zu unsern Füßen lag der Fjord, kalt und leidenschaftslos.
Am nächsten Tage (30. Septbr.) ging es nicht so gut mit[S. 192] unserm Boot wie am ersten. Am Vormittage erhob sich ein widriger Wind, der schließlich derartig stürmte, daß wir — statt vorwärtszukommen — zurückgetrieben wurden, und unsere kleine Nußschale von Boot derartig auf den Wellen schaukelte, daß es aussah, als ob wir rettungslos umkippen mußten. Unser Boot war jedoch äußerst seetüchtig, kein Wassertropfen kam zu uns herein, — natürlich mit Ausnahme der Unmengen, die durch den Segeltuchboden eindrangen. Es war ein schweres Stück Arbeit, gegen den Wind zu rudern. Wir zogen deswegen unser Boot ans Land, schliefen ein wenig und warteten, bis der Wind sich gegen Abend gelegt hatte. Dann setzten wir unsere Reise fort. Es währte nicht lange, bis wir an die Landzunge „Nua“ kamen, wo der Itivdlek-Fjord, ein Arm des Ameralik-Fjords, nördlich in das Land schneidet.
An dem schönen, stillen Abend setzten wir über den Fjord, und bei hereinbrechender Dunkelheit erreichten wir das Vorgebirge auf der Südseite. Hier gingen wir an Land, um ein wenig zu Abend zu essen, aber wir fanden kein Brennmaterial und kein Wasser und mußten uns deshalb mit kalter, trockener Kost begnügen, was ja übrigens nichts Neues für uns war. Wir hatten die Absicht gehabt, während der Nacht weiter zu rudern, aber von Westen her, über der wilden Gebirgslandschaft mit dem steilen, scharf geschnittenen Felsgipfel an der Nordseite des Fjords zogen unheilverkündende Gewitterwolken auf. Es wurde so dunkel, daß nicht daran zu denken war, nach der Nordseite hinüberzurudern, wie wir anfänglich beabsichtigt hatten. Deshalb beschlossen wir, das Boot ans Land zu ziehen und ein wenig zu schlafen, vielleicht würde der Mond später aufgehen. Als wir das Boot hinauftragen wollten, hatte Sverdrup das Unglück, ins Wasser zu fallen, was nicht sehr angenehm ist, wenn man sich schlafen legen will und kein trockenes Zeug zum Wechseln hat.
[S. 193]
Das Wetter wurde nicht besser, und wir schliefen bis an den hellen Morgen (1. Oktober), der mit strahlendem Sonnenaufgang und einer schwachen, günstigen Brise anbrach.
Am Vormittag kamen wir an die Nordseite des Fjords hinüber, wo wir an Land gingen und uns ein solides Mittagessen mit 2 Möven pro Mann samt einer Suppe bereiteten, die wohl kaum je ihresgleichen gesehen hat. Wir verkochten Erbsen und Brot in der Mövenbrühe, die so stark war, daß wir förmlich fühlten, wie unsere Kräfte wuchsen, während wir die Suppe literweise zu uns nahmen. Wir aßen uns satt und froh. An dieser Stelle, wo wir gelandet waren, wuchsen unglücklicherweise Unmengen von Krähenbeeren (Empetrum nigrum). Es war ganz natürlich, daß wir zum Dessert davon aßen. Sie schmeckten unbeschreiblich erquickend, Obst ist gesund, wir hatten es lange entbehren müssen, und infolgedessen aßen wir, anfangs stehend, dann sitzend, und als auch das nicht mehr gehen wollte, legten wir uns hin, und nun konnten wir es unglaublich lange aushalten. Als wir landeten, war es ganz windstill gewesen, aber während wir aßen, erhob sich ein starker Nordwind, der gerade auf den Fjord stand, so daß wir nicht daran denken konnten, den Kampf gegen Wind und Wetter aufzunehmen. Wir mußten liegen bleiben, wo wir waren, und fuhren mit dem Verzehren der Krähenbeeren fort. Schließlich waren wir so faul, daß wir sie nicht mehr mit den Händen, sondern, auf dem Bauche liegend, die Beeren mit dem Munde pflückten. Dann schliefen wir so, wie wir lagen, ein und schliefen bis zum Abend; als wir aber die Augen aufschlugen, hingen uns die Beeren groß, saftig und blauschwarz vor dem Mund. Natürlich aßen wir wieder, bis wir abermals einschliefen. Wenn die Behauptung begründet ist, daß die Unmäßigkeit zu den größten Sünden gehört, so werden wir Beide, die wir an jenem Tage am Ameralikfjord Krähenbeeren[S. 194] aßen, eine entsetzliche Strafe zu verbüßen haben. Merkwürdigerweise folgte sie nicht gleich auf dem Fuße, — dazu waren unsere Magen wohl in zu guter Ordnung.
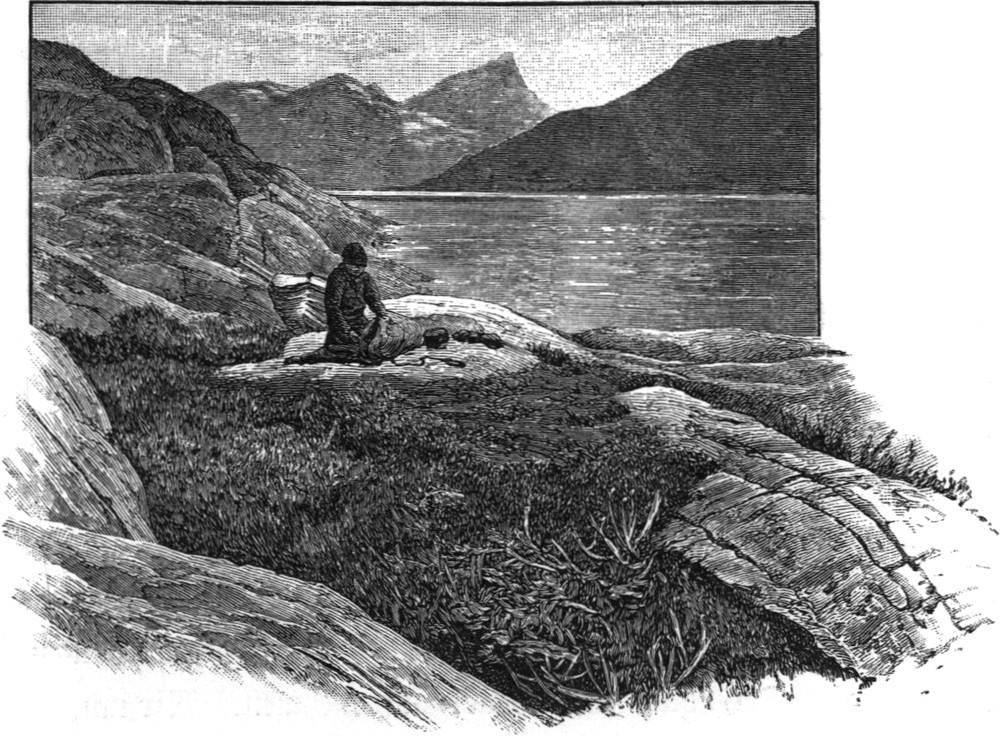
Um Mitternacht flaute der Wind ab, und ich weckte Sverdrup, der sich am Abend trotz des unmäßigen Beerengenusses doch so viel hatte rühren können, daß er Holz sammelte und Wasser für eine eventuelle Nachtmahlzeit holte. In aller Eile kochten und aßen wir. Um 1 Uhr saßen wir im Boot und konnten nun mit frischen Kräften darauf los rudern. Schnell glitt unser Boot in der rabenschwarzen Nacht unter den steilen Felswänden an der Küste entlang. Das Meerleuchten glühte so stark, daß es unter südlichen Himmelsstrichen nicht heller leuchten kann. Unsere Ruder glichen geschmolzenem Silber, und wenn sie das Wasser berührten, so glitzerte und funkelte es bis in die Tiefe hinein mit phosphorartigem Glanz.
[S. 195]
An diesem Tage schien es fast, als wenn das Glück uns günstig sei, und in der Beziehung waren wir nicht sehr verwöhnt. Wir hatten gutes Wetter ohne Wind.
Gegen Morgen hörten wir an einer Stelle, wo wir Rast machten, Unmengen von Schneehühnern gerade über uns im Heidekraut gackern. Wir hätten sie mit Leichtigkeit schießen können. Das Jägerblut in mir kochte, aber wir fanden, daß wir keine Zeit hatten, deswegen anzulegen; so bewiesen wir denn die heroische Charakterstärke, diesen köstlichen Leckerbissen den Rücken zu wenden und weiter zu rudern.
Den ganzen Vormittag setzten wir unsere Fahrt ohne Unterbrechung fort. An der ganzen Küste entlang fiel das Ufer so steil in die See ab, daß sich eine Landung nur an sehr wenigen Stellen hätte bewerkstelligen lassen. Gegen Mittag näherten wir uns zu unserer Ueberraschung der Mündung des Fjords. Da wir hier ein Vorgebirge mit einem schönen, flachen Strand fanden, machten wir Halt. Unser Entzücken, so weit gekommen zu sein, kannte keine Grenzen. Es konnte gar nicht mehr weit bis nach Godthaab sein, und in dieser Veranlassung bereiteten wir uns ein Mittagsmahl, das die Mahlzeit des vorhergehenden Tages noch bei weitem übertraf. Ich erinnere mich, daß wir infolge dieser Mahlzeit große Schwierigkeiten hatten, wieder in unser Boot zu kommen, und ich mußte alle Kräfte aufbieten, um mich vorüberbeugen und zu den Rudern greifen zu können.
Zu unserer Ueberraschung bekamen wir jetzt auch günstigen Wind, und es ging am Nachmittag trotz unserer vollen Magen ziemlich schnell vorwärts. Der einzige dunkle Punkt in unserm Dasein waren die schmalen Stöcke, auf denen wir statt auf Ruderbänken saßen. Ein gewisser Theil des Körpers schmerzte derartig, daß ich wünschte, ihn entbehren zu können. Das Glück ist hier auf Erden selten ganz ungetrübt.
[S. 196]
So kamen wir denn aus dem Fjord heraus, und in den Strahlen der untergehenden Sonne sahen wir das Meer, die vielen größern und kleinern Inseln vor uns liegen. Die weichen, gesättigten Farbentöne des Himmels spiegelten sich im Meere wieder, das die dunklen Inselchen und Scheeren umwogte. Es sah aus, als schwebten sie frei in einem dunkelglühenden Himmelsraum. Wir hielten mit dem Rudern inne — ein Gefühl der Heimath überkam uns. Genau so liegen die wetterzerklüfteten Inseln daheim im Meere! Der aufspritzende Meeresgischt, der liebkosende Sonnennebel umgiebt sie und dahinter erhebt sich das Land, erstrecken sich die Fjorde. Kein Wunder, daß unsere Vorfahren sich von diesem Lande angezogen fühlten.

Wir ruderten aus allen Kräften bis in den Abend. Da aber die Strömung uns direkt zuwider war, mußten wir schließlich auf einer Landzunge landen. Die Uhr war jetzt ungefähr 9, und mit Ausnahme eines kurzen Frühstücks und eines[S. 197] kaum längeren Mittagessens hatten wir nun seit 20 Stunden auf unseren Marterbänken gesessen. Ich kann nicht leugnen, daß es ein wahrer Hochgenuß war, die Glieder auf einer breiteren Grundlage auszustrecken.
Wenn die Mittagsmahlzeit lukullisch gewesen, so war das Abendessen es nicht minder. Zum erstenmal, seit wir den „Jason“ verlassen hatten, aßen wir uns nach Herzenslust satt in Brot, Butter und Leberpastete. Besonders der Butter sprachen wir tüchtig zu. Und zum Dessert gab es so viel Fleischpulverschokolade, wie wir nur essen mochten, und das will etwas sagen. Wir machten ausfindig, daß die Tafeln, fett mit Butter bestrichen, ganz vorzüglich schmeckten. Dazu tranken wir Wasser mit Zucker und Zitronensaft und thaten alles, was in unsern Kräften lag, damit nichts von alledem, womit wir nun so lange gegeizt hatten, zu Menschen kommen sollte, für die es völlig werthlos war, denn das wäre doch zu ärgerlich gewesen.
Zum letztenmal — ehe wir zu Menschen und zu Luxus gelangten — genossen wir den wunderbaren Abend. Während wir dort auf dem Berge unter dem sternhellen Himmel saßen, hatten wir ein Gefühl, als wenn wir Abschied von dieser Natur und diesem Leben nehmen sollten, in das wir uns nun so hineingelebt hatten, und das uns so vertraut geworden war.
Unsere Reise war nun bald beendet, es hatten sich uns viel Mißgeschick und viele unerwartete Hindernisse in den Weg gestellt, aber wir waren doch glücklich über alles hinweggekommen. Wir hatten uns einen Weg durch das Treibeis am Ufer wie über das Inlandseis gebahnt, waren trotz widrigen Winden in unserem gebrechlichen Boot über den Fjord gelangt, wir hatten harte Kämpfe zu bestehen gehabt und große Entbehrungen erduldet, bis wir an das Ziel gekommen waren, dem wir uns jetzt so nahe sahen, — und welche Gefühle bewegten uns jetzt?[S. 198] Waren es die des glücklichen Siegers? Für meine Person muß ich diese Frage mit „Nein“ beantworten. Es war mir nicht möglich, ein anderes Gefühl als das des Gesättigtseins zu empfinden, und das war ja recht gut, aber das Ziel, — nein, auf das hatten wir zu lange gewartet, das kam zu wenig unvorbereitet.
Wir krochen in unseren Pelzen auf einem Heidefleck am Bergabhang zusammen und schliefen in dieser letzten Nacht, die wir unter freiem Himmel verbrachten, so gut wie seit langer Zeit nicht.
Es war bereits spät am Tage (den 3. Oktober), als wir endlich erwachten. Der Wind hatte schon eine ganze Weile an dem Sund entlang auf Godthaab zu gestanden und uns an die Arbeit gerufen, aber endlich hatten wir einmal keine Eile, wir konnten ausschlafen, wir kamen noch immer früh genug ans Ziel.
Wir verzehrten unser Frühstück mit der ehrlichsten Absicht, dem Proviant, den wir noch hatten, ein Ende zu machen; wir aßen Brot und Leberpastete und hieben mächtig auf Butter und Schokolade ein, aber wir mußten es schließlich aufgeben und in See stechen. Später am Vormittag gelangten wir an ein Vorgebirge, südlich von Godthaab, wo wir mehrere Eskimohütten und ein großes europäisches Haus erblickten. Wie wir späterhin erfuhren, war es Neu-Herrnhut, eine der Stationen, welche die deutsche Herrnhut-Mission in Grönland errichtet hat.
Als sich plötzlich ein starker ungünstiger Wind erhob, beschlossen wir über Land bis nach Godthaab zu gehen und richteten den Kurs unseres kleinen Troges dem Lande zu, wo schon eine ganze Schar von Eskimos, hauptsächlich alte Weiber, aus den Häusern gestürzt kamen und an den Strand liefen. Hier scharten sie sich unter Geschrei und Geschwätz zusammen und machten genau dieselben eigenthümlichen Gebärden, von denen wir schon[S. 199] eine Menge an der Ostküste kennen gelernt hatten. Für uns war der Unterschied nur gering, das gleiche Aussehen, die gleiche Häßlichkeit, die gleiche fettglänzende Freundlichkeit.
Sobald wir landeten, versammelten sie sich um uns, halfen uns, die Sachen hinauf zu tragen und das Boot an den Strand zu ziehen, was alles unter ohrenbetäubendem Geplapper, Lachen und verwunderten Ausrufen über uns beide armen Menschen, die in einem halben Boot kamen, vor sich ging. Dieser Name für unser gebrechliches Boot war ganz bezeichnend; es war dem Vordertheil eines Bootes ganz ähnlich. Während wir dastanden und acht auf unsere Büchse und andere werthvolle Dinge gaben, ohne an alle die vielen Menschen um uns her zu denken, die wir ja nicht verstanden, erblickten wir einen jungen Mann, der auf uns zukam. Er trug gewissermaßen grönländische Kleider, hatte aber eine Tam’o-Shanta-Mütze auf dem Kopfe und besaß ein hübsches, blondes Gesicht, das nicht die geringste Aehnlichkeit mit den Eskimos hatte. Man konnte sich nicht irren, — es mußte ebenso wie die ganze Erscheinung aus dem guten alten Kopenhagen importirt sein. Er trat an uns heran und begrüßte uns, ich erwiderte seinen Gruß. Dann fragte er: „Do you speak English?“ Der Accent verrieth die dänische Zunge, so daß mich diese Frage gewissermaßen in Verlegenheit versetzte, denn ich fand, daß wenig Grund vorhanden war, die Unterhaltung auf Englisch fortzusetzen, wenn wir uns unserer Muttersprache bedienen konnten. Glücklicherweise fragte er, noch ehe ich antworten konnte: „Are you Englishmen?“
Hierauf antwortete ich in gutem Norwegisch: „Nein, wir sind Norweger!“ — „Darf ich nach Ihrem Namen fragen?“ — „Mein Name ist Nansen, und wir kommen über das Inlandseis.“ — „Ach, dachte ich’s doch, darf ich Ihnen dann zu Ihrem Doktorgrad gratuliren!“
[S. 200]
Das Erste, wonach ich fragte, war das Schiff nach Dänemark, und ob es schon fort sei? — Ja, das letzte Schiff hatte Godthaab vor zwei Monaten verlassen, und jetzt könnten wir keine Schiffe mehr erreichen. Die einzige Möglichkeit sei, daß man den „Fox“ in Ivigtut einhole, aber der solle Mitte Oktober abgehen und es seien siebzig Meilen bis dahin. Diese Aussichten waren sehr wenig tröstlicher Natur. Die Hoffnung, das Dampfschiff nach Europa zu erreichen, hatte uns über das Inlandseis vorwärts getrieben, der Gedanke an das Schiff hatte uns unablässig im Kopfe gespukt und uns keinen Augenblick unser Dasein genießen lassen. Wir hatten uns damit getröstet, daß wir auf der Heimfahrt alles nachholen könnten, und jetzt — wo wir glücklich soweit waren — hatte das Dampfschiff Godthaab bereits verlassen, ehe wir unsere Eiswanderung antraten. Ein ganzes Luftschloß von schönen Hoffnungen war mit einem Schlage ins Meer versunken. Besonders für die andern war es schlimm, die Freunde und Verwandte, ja selbst Frau und Kinder hatten, nach denen sie sich sehnten, und die so oft davon geredet hatten, wie herrlich es sein würde, wenn sie nun bald nach Hause kämen! Sie sollten einen langen Winter und einen ganzen Frühling warten, während ihre Lieben in der Heimath sie längst für todt hielten. Das durfte nicht geschehen, — so schnell wie möglich mußte eine Post an den „Fox“, unser letzter Rettungsanker, entsandt werden. Während wir hierüber sprachen, kam noch ein zweiter Europäer hinzu; es war der Herrnhuter Missionar, Herr Voged. Er begrüßte uns sehr freundlich, hieß uns willkommen und ließ uns nicht, ohne uns zum Eintreten einzuladen, an seiner Thür vorübergehen.
Er wohnte in dem kirchenähnlichen Gebäude, das sowohl als Kirche wie als Missionshaus diente. Es war eine Veränderung, unsern Fuß wieder in ein civilisirtes Heim zu setzen.[S. 201] Die einfache Ausstattung der Wohnung dieses frommes Mannes erschien uns wie der größte Luxus, — auf einem Stuhl zu sitzen war für uns allein eine Wonne und ganz wunderbar war es, wieder an einem Tisch mit schneeweißem Gedeck zu essen, sich weißer Steingutsteller wie Messer und Gabeln zu bedienen. Ob es uns schmeckte? So unbedingt kann ich das nicht behaupten. Es hatte uns ganz vorzüglich geschmeckt draußen am Feuer, — und es hatte ein eigenartiger Reiz darin gelegen, die Möven mit den Zähnen und den Fingern zu zerlegen, ohne Teller, Messer und Gabeln, ohne alle Ceremonien.
Während wir aßen, kam Pastor Balle aus Godthaab und ein wenig später der Arzt des Oertchens, Dr. Binzer. Das Gerücht von unserer Ankunft war schon bis zur Kolonie gedrungen, da waren die beiden Herren gleich hinausgeeilt, um uns herzlich willkommen zu heißen.
Nun entstand ein Fragen und ein Erzählen über die Reise, man lauschte uns mit dem lebhaftesten Interesse. Dann brachen wir auf und nahmen Abschied von unseren liebenswürdigen Wirthen.
Groß war unsere Verwunderung, als wir wieder ins Freie kamen und sahen, daß es regnete. Wir waren also vom Glück begünstigt gewesen und hatten die menschlichen Wohnungen rechtzeitig erreicht. In unserem kleinen Trog würde der Regen eine sehr unangenehme Zugabe gewesen sein.
Nachdem man uns versprochen hatte, unser Boot und unser Gepäck sicher zu befördern, zogen wir in einem wahren Platzregen über die Hügel gen Godthaab.
Endlich kamen wir an einen Bergabhang, und nun lag die ganze Kolonie zu unsern Füßen. Es waren nicht viele Gebäude, — etwa vier bis fünf europäische Häuser, eine hochgelegene Kirche und eine Reihe grönländischer Hütten. Der[S. 202] ganze kleine Ort lag in einer Thalsenkung an einer kleinen freundlichen Bucht. Die dänische Flagge wehte von der hohen Flaggenstange oben auf dem an der Bucht gelegenen Flaggenberg. Ringsumher wimmelte es von Menschen, alles war auf den Beinen, um die räthselhaften Inlandsmenschen zu sehen, die in dem halben Boot gekommen waren.
Und dann ging’s bergab. Kaum waren wir in die Nähe der Häuser gekommen, als ein Kanonenschuß über die See hinrollte, ein zweiter folgte und ein dritter, — ein donnernder Salut. Unter Kanonendonner hatten wir Abschied von der Civilisation genommen, unter Kanonendonner zogen wir wieder in die civilisirte Welt ein, denn dazu muß man die Westküste von Grönland rechnen. Man hätte glauben sollen, daß wir sehr kriegerisch gesinnte Individuen seien. Wie viele Schüsse abgefeuert wurden, kann ich nicht sagen, aber eine ganze Menge waren es jedenfalls. Die kleinen Menschen dort oben bei der Flaggenstange hatten ihre liebe Mühe zu putzen und zu laden, während wir uns den Häusern näherten, vor denen sich die Grönländer und Grönländerinnen versammelt hatten, und wo sie in langen Reihen zu beiden Seiten des Weges standen. Sie nahmen sich sehr hübsch aus in ihren malerischen Trachten, besonders die Frauen. Lächeln und Freundlichkeit strahlte uns aus allen Gesichtern entgegen. Es war, als läge heller Sonnenschein über dem Leben.
Aber da kommen die Europäerinnen — die vier dänischen Damen der Kolonie —, die uns entgegengegangen waren. Wir wurden vorgestellt. Es war ganz sonderbar zwischen all diesen mit Pelzen und Beinkleidern angethanen Schönen einmal wieder Frauenröcke zu erblicken.
In der Direktorialwohnung, wo die Frau des Hauses uns in ihrem und in ihres Mannes Namen herzlich willkommen[S. 203] hieß, wurde ein Glas auf unsere glückliche Ankunft geleert, worauf uns der Doktor zu Mittag um vier Uhr einlud.

Es war noch lange bis dahin, aber wir konnten die Zeit gut gebrauchen, um uns zu waschen und Toilette zu machen. Zu dem Zweck wurden wir in Baumanns Zimmer geführt. Dies kleine gemüthliche Dachzimmer in der Direktorialwohnung machte einen unvergeßlichen Eindruck auf mich. Eine Spieldose spielte uns „die letzte Rose“ vor. Wie erschraken wir aber, als wir unsere eigenen schmutzigen wettergebräunten Gesichter in einem Spiegel erblickten! Wir sahen gerade nicht salonfähig[S. 204] aus nach unserer langen Enthaltsamkeit in Bezug auf Waschen und Wechseln von Kleidungsstücken.
Es war ein unbeschreiblich wohlthuendes Gefühl, den Kopf ganz in das Waschbecken stecken und eine gründliche Wäsche vornehmen zu können. Ganz rein wurden wir das erstemal freilich nicht. Dann zogen wir reines Unterzeug an, das wir selber mit über das Inlandseis geschleppt hatten. Wir fühlten uns wie neugeboren und waren dazu aufgelegt, das flotte Diner des Doktors einzunehmen.
So waren wir denn in den sicheren Hafen eingelaufen, nun handelte es sich nur darum, unseren Kameraden im Ameralikfjord so schnell wie möglich zu Hülfe zu kommen. Sie wußten ja nicht, ob wir glücklich ans Ziel gelangt oder elend zu Grunde gegangen waren, um sie dem Hungertod preiszugeben. Dann galt es dem „Fox“ unverzüglich eine Botschaft zukommen zu lassen.
Am Nachmittag versuchten wir diese Angelegenheiten zu ordnen, freilich ohne Erfolg. Gleich nachdem wir angekommen waren, brach ein so heftiger Südsturm los, daß die Eskimos, die sehr mäßige Seeleute sind, wenn sie nicht in ihren Kajaks sitzen, sich weigerten, mit einem Boot über den Ameralikfjord zu rudern, um die Andern zu holen. Der Bescheid an den „Fox“ mußte durch einen oder zwei Kajakmänner ausgeführt werden, in der Kolonie fand sich aber Niemand, der dies Amt in diesem Wetter übernehmen wollte. Wir mußten bis zum folgenden Tage warten.
Dann kam die Nacht und wir mußten uns zur Ruhe begeben. Sverdrup sollte oben bei Frederiksen, dem Zimmermann und Bootbauer des Ortes, schlafen, während mir Baumann sein Zimmer zur Verfügung stellte.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, in ein ordentliches Bett[S. 205] zu kommen, nachdem wir ein ganzes halbes Jahr hindurch diese Einrichtung hatten entbehren müssen. Ich reckte und streckte mich auf der weichen Unterlage und ein prickelndes Gefühl des Wohlseins durchzuckte alle meine Glieder, vielleicht zum Theil durch das Bewußtsein hervorgerufen, daß unser heißersehntes Ziel jetzt endlich erreicht war. Der Schlaf fiel jedoch nicht so gut aus, wie ich erwartet hatte; ich lag zu weich, war zu sehr an den Schlafsack und das Eis oder den Felsboden als Unterlage gewöhnt und empfand möglicherweise doch eine leise Sehnsucht darnach.
Am Morgen des 4. Oktober erwachte ich aus meinen unruhigen Träumen dadurch, daß eine junge Grönländerin mir Thee und Butterbrot ans Bett brachte — ein neuer Genuß. Nach dieser frühen Mahlzeit stand ich auf und ging hinaus, um mich ein wenig im Orte umzusehen.
Am Strande herrschte Leben und Bewegung, denn eine Ladung Seehunde, die an einem Fangplatz in der Nähe erbeutet waren, wurden ans Land gebracht und zerlegt. Ich begab mich mit Baumann dorthin, — es war ein ganz neuer Anblick für mich, dies Leben hier am Strande. Eine ganze Anzahl von Grönländerinnen lag mit aufgestreiften Aermeln vor den aufgeschlitzten Seehunden. Von einigen wurde das Blut in Eimern aufgefangen, von anderen wurden die Gedärme ausgelöst oder der Speck und das Fleisch zerschnitten. Alles wurde beachtet und benutzt.
Nachdem wir uns an diesem blutigen Schauspiel sattgesehen und die Gewandtheit, die Anmuth und die theilweise sehr hübschen Gesichter der Grönländerinnen zur Genüge bewundert hatten, gingen wir zu Sverdrup hinüber, um zu sehen, ob er aufgestanden sei, und ihn in dem Falle zum Frühstück beim Direktor abzuholen.
[S. 206]
Als wir ankamen, saß jedoch Sverdrup bereits mit Herrn Frederiksen an einem opulenten Frühstückstisch mit frischgebratenen Schneehühnern, Schweinefleisch und anderen Delikatessen. Ich bedauerte, daß Sverdrup schon frühstückte, da ich gehofft hatte, wir könnten zusammen essen. Dem sei ja nichts im Wege, meinte Sverdrup. Dies sei sein erstes Frühstück, etwas so Angenehmes könne man ja aber immer wiederholen; er esse erst bei Frederiksen und nachher nochmals beim Direktor, auf diese Weise bekäme er alle Mahlzeiten doppelt. Drei Tage lang ging auch alles gut, dann aber hielt der Magen es nicht mehr aus, und Sverdrup mußte einen halben Tag das Bett hüten. Uebrigens währte es lange, ehe wir uns so richtig satt fühlten und wieder wie gewöhnliche Menschen aßen.
Am Vormittag des 4. Oktober wurden wir endlich eines Menschen habhaft, der sich zum Kajakboten eignete und der bereit war, meinen Auftrag auszuführen. Er hieß Daniel und war aus Neu-Herrnhut. Er sollte sich nach dem ungefähr zwanzig Meilen südwärts gelegenen Wohnplatz Fiskernäs begeben und hier Kajakleute miethen, die mit der Post weiter nach Süden gingen. Ich versprach ihm, daß, wenn die Nachricht den „Fox“ rechtzeitig erreichte, er sowie die anderen beiden Kajakmänner auf der südlichen Station eine Extrabelohnung haben sollten.
In aller Eile schrieb ich nun einen Brief an Herrn Smith, den Betriebsdirektor des Kryolithbruches in Ivigtut. Der „Fox“ gehört nämlich der Kryolithcompagnie. Außerdem schrieb ich an den Kapitän des Schiffes. In diesen zwei Briefen bat ich, daß das Schiff uns aus Godthaab abholen möge, um uns nach Hause zu bringen, falls dies irgend möglich sei. Der Grund, weshalb ich bat, uns abzuholen, statt das Schiff in Ivigtut[S. 207] warten zu lassen, bis es uns möglich war, dort hinabzukommen, war, daß wir bei den schlechten Witterungsverhältnissen nicht berechnen konnten, wie viele Zeit wir gebrauchen würden, um die Andern vom Ameralikfjord zu holen und dann mit einem Boot die 70 Meilen bis Ivigtut zurückzulegen. Ich hielt es für weit einfacher für das Schiff, selbst zu kommen, es wurde dadurch Zeit erspart.
Für den Fall, daß die Kajakpost das Schiff erreichte und dies doch abgehen sollte, ohne uns zu holen, schrieb ich in fliegender Eile einige Zeilen an Etatsrath Gamél, in welchen ich ihm von unserer glücklichen Ankunft an der Westküste in Kenntniß setzte und ihm in kurzen Zügen über den Verlauf der Expedition berichtete.
Außer diesem Schreiben erhielt der Kajakmann noch einen Brief von Sverdrup an dessen Vater.
Der Kajakmann versprach, sofort am Nachmittag abzureisen. Er machte freilich auch, wie man uns sagte, einen Versuch, mußte aber wegen des drohenden Wetters wieder umwenden.
Als das Wetter am Abend noch immer schlecht war, machte der Pfarrer den Vorschlag, vorläufig ein paar Kajakmänner mit etwas Proviant und der Nachricht hinüberzuschicken, daß wir glücklich angelangt seien. Ueber diesen Vorschlag war ich natürlich sehr erfreut, und während der Pfarrer zwei Kajakmänner, die Brüder Terkel und Hoseas, zwei kecke Bursche aus Sardlok, für die Fahrt warb, machte man sich in der Kolonie daran, eine Sendung der ausgesuchtesten Leckerbissen für die armen Verlassenen fertig zu machen. Dieser Proviant wurde in die Kajaks verstaut, nachdem ich noch einige etwas konsistentere Nahrungsmittel wie Butter, Schweinefleisch und Brot, sowie last not least etwas Tabak und einige Pfeifen hinzugefügt[S. 208] hatte. Bei dieser Sendung befand sich eine große dänische Porzellanpfeife mit langem Rohr und ein Pfund Tabak speciell für Balto. Ich hatte es ihm bei irgend einer Gelegenheit im Inlandseise versprochen, als er sich besonders gut gemacht hatte. Als die Kajaks reisefertig waren, gab ich mit Hülfe des Pfarrers, der als Dolmetscher fungirte, dem ältesten der Brüder, Terkel, eine genaue Beschreibung, wo die Gefährten zu finden seien, auch zeigte ich es ihm auf der Karte, aus der er sich sehr gut vernehmen konnte.
Am folgenden Morgen, den 5. Oktober, verließen die Kajakmänner Godthaab, und schon am nächsten Vormittag erreichten sie ihren Bestimmungsort.
Am Vormittag des 5. Oktober machte auch ein Boot den Versuch, nach dem Ameralikfjord hinzurudern, nach wenigen Stunden kehrte es jedoch schon wieder zurück. Die Grönländer sind, wie gesagt, keine Helden, wenn es sich ums Rudern handelt. Gegen Nachmmittag machte das Boot einen zweiten Versuch und kehrte jetzt merkwürdigerweise nicht wieder um; wie wir später erfuhren, waren sie nicht weiter als bis an eine südlich von Godthaab gelegene Insel gelangt, wo die Besatzung in einem Zelt viele Tage liegen blieb, ohne umzuwenden, obwohl die Entfernung so gering war, daß sie in einer Stunde hätten nach der Kolonie zurückrudern können. Dies hat seinen ganz einfachen Grund darin, daß sie in dem Falle keinen Tagelohn erhalten haben würden, und daß sie sich lange nicht so schön hätten amüsiren können wie jetzt im Zelt. Deswegen blieben sie ruhig dort, bis sie ihren Proviant verzehrt hatten.
Am folgenden Tage, den 6. Oktober, kam der Koloniedirektor an in Begleitung des deutschen Missionars Heincke aus Umanak, einer Herrnhuter Missionsstation am Fjorde, etwa neun Meilen von Godthaab entfernt. Der Koloniedirektor war[S. 209] in Umanak gewesen, als einer der Kajakmänner, die von der Kolonie ausgesandt waren, ihn erreichte und ihm einen Brief mit der Nachricht von unserer Ankunft überbrachte. Er und Herr Heincke hatten sofort zwei Kajakmänner zu den vier Leuten geschickt, die sich noch am Ameralikfjord befinden sollten. Diese Kajakmänner überbrachten den Gefährten ebenfalls Speisen von ihm sowie von Herrn und Frau Heincke, und hatten den Befehl, bei ihnen zu bleiben und ihnen auf alle Weise behülflich zu sein.
Am 7. Oktober kehrten Terkel und Hoseas bereits vom Ameralikfjord zurück mit einem Brief von Dietrichson, der uns mittheilte, daß sie sich jetzt, wo sie Ueberfluß an Essen und Trinken hätten und Sverdrup und mich in Sicherheit wüßten, ausgezeichnet wohl fühlten.
Am 9. Oktober wurde das Wetter endlich so gut, daß ein Frauenboot, das ich vom Missionar Voged geliehen hatte, mit einer im wesentlichen aus Grönländerinnen bestehenden Besatzung nach dem Ameralikfjord abgehen konnte. An diesem Tage verließ endlich auch das andere Boot die Insel, wo es sich die ganze Zeit über aufgehalten hatte.
Mehrere Tage lang hörten wir nichts von den Kameraden, die wir jetzt nachgerade erwarten konnte. Besonders die Grönländer waren sehr gespannt, die zwei Lappen zu sehen; denn solche Menschen hatten sie früher nie gesehen.
Die beiden Kajakmänner, die vom Fjord zurückkamen, hatten übrigens ihre Begegnung mit den Gefährten ganz genau beschrieben: „Da waren zwei von dem Volk, das lange Bärte trägt (Norweger), außerdem waren da aber zwei, die ungefähr so waren wie wir, und die trugen eine ganz seltsame Kleidung etc.“ Sie hatten also eine klare Auffassung, daß die Lappen — trotz aller Verschiedenheit — doch einem Volk angehörten, das auf[S. 210] einer Kulturstufe stand, die der ihren sehr nahe kam und völlig verschieden von derjenigen der Dänen oder Norweger war.
Endlich am 12. Oktober kamen sie; die ganze Kolonie kam jetzt auf die Beine, sowohl Europäer wie Grönländer gingen ihnen auf dem Strande entgegen.
Besonders große Aufmerksamkeit erregten die Lappen. Die Grönländer nannten sie Weibspersonen, weil sie lange Gewänder trugen, die an die Röcke der europäischen Damen erinnerten, sowie Beinkleider aus Rennthierfell, was in Grönland nur Sitte für die Frauen ist. Balto schien die Aufmerksamkeit, deren Gegenstand er war, sehr ruhig hinzunehmen. Er schwatzte und erzählte und stand bald auf dem besten Fuße mit der ganzen Bevölkerung. Ravna ging wie gewöhnlich seinen eigenen, ruhigen Gang, er kam zu mir heran, verneigte sich tief, ergriff meine Hand, sagte nicht viel, strahlte aber vor Freude und Zufriedenheit über das ganze Gesicht.
[42] So heißt der innerste Arm des Ameralik-Fjords.
[S. 211]
 n diesem Kapitel will ich Dietrichson selbst erzählen lassen,
wie es ihm und seinen Kameraden ergangen ist, auch Balto wird
wiederholt Gelegenheit haben, zu Wort zu kommen.
n diesem Kapitel will ich Dietrichson selbst erzählen lassen,
wie es ihm und seinen Kameraden ergangen ist, auch Balto wird
wiederholt Gelegenheit haben, zu Wort zu kommen.
„Alle die Sachen, die wir vorläufig am Rande des Inlandseises hatten zurücklassen müssen,“ schreibt Dietrichson, „mußten an den Ameralikfjord hinuntergeschafft werden, deswegen kehrten Kristiansen, Ravna und ich schon am 27. September zurück, um dies zu beschaffen, während die übrigen drei Mitglieder der Expedition mit dem Bau des Segeltuchbootes beschäftigt waren, in welchem Nansen und Sverdrup nach Godthaab rudern wollten.
Die Entfernung bis zu dem Ort, an welchem sich die Sachen befanden, betrug ungefähr 4 Meilen. Obwohl wir unsere Kameraden erst um 8 Uhr des Morgens verließen, hofften wir doch vor Einbruch der Dämmerung am Ziel zu sein, wir rechneten nämlich darauf, eine bedeutende Strecke abschneiden zu können, indem wir die mit Eis bedeckten Gewässer überschritten, wie wir dies auf dem Wege bergab gethan hatten.
Auf den höher gelegenen Gewässern fanden wir auch noch eine Eisdecke vor, diese war aber jetzt so dünn, daß wir, sobald wir sie betraten, einbrachen. Deswegen blieb uns nichts anderes[S. 212] übrig, als die steilen Felsabhänge und unebenen Moränen zu erklimmen, wobei uns die angeschwollenen Bäche das Vorwärtsdringen sehr erschwerten. Deswegen gelangten wir erst um 7½ Uhr an das Endziel unserer Wanderung, nachdem die Sonne längst untergegangen und die ganze Landschaft in Dämmerung gehüllt war.
Wenngleich eine Dose Leberpastete, eine Portion Fleisch, Schokolade und Fleischbiskuits, woraus unser Proviant während des Bergsteigens bestand, ein ziemliches Quantum Nahrungsstoff enthält, so reichte es trotzdem nicht hin, um den Magen zu füllen und uns zu sättigen. Infolgedessen hatten wir, wie gewöhnlich, einen wahren Heißhunger, als wir am Abend unsern Kessel, der aus einer leeren Blechdose bestand, aufs Feuer setzten. Das Gericht, das wir bereiten wollten, war sehr zusammengesetzter Art, denn es bestand aus den Ueberresten der verschiedenen Proviantsorten, wie Pemikan, Erbswurst, Fleischpepton, Fleischbiskuits, Knäckebrot und Schnitzkohl. Wenn eine Blechdose leer war, hatten wir die zurückbleibenden Krumen in den Sack geschüttet, in welchem sich der Schnitzkohl befand, so daß der Inhalt dieses Sackes allmählich aus allen möglichen Speiseresten bestand. Diese sollten jetzt verwerthet werden. Das Gericht schmeckte indessen ganz vorzüglich, und nachdem wir unsere Mahlzeit eingenommen hatten, krochen wir in den Rennthiersack und schliefen unter freiem Himmel, da das Zelt bereits an den Fjord hinabgeschafft war.
Der nächste Vormittag wurde mit dem Zusammenstauen der verschiedenen Sachen verbracht, die wir auf den Schultern hinabtragen mußten. Erst gegen Mittag konnten wir damit beginnen, einen Theil der Bagage ins Thal hinabzuschaffen. Da wir entschlossen waren, unser sämtliches Hab und Gut in mehreren Wanderungen Stück für Stück hinabzutragen, so[S. 213] kehrten wir wieder um, nachdem wir unsere erste Last an die nördliche Bucht des Langvandet geschafft hatten, und fanden zu unserm Staunen Balto bereits am Lagerplatz. Er berichtete, daß sie nach eintägiger Arbeit mit dem Bau des Bootes bereits soweit vorgeschritten seien, daß er gut hatte entbehrt werden können, deswegen sei er gekommen, um uns zu helfen. Nach seiner Berechnung mußten Nansen und Sverdrup bereits am Mittag desselben Tages ihre Bootsfahrt angetreten haben. Balto hatte denselben Weg eingeschlagen, auf welchem wir hinuntergekommen waren, nur die eisbedeckten Gewässer hatte er umgehen müssen, bis er an das Langvandet gelangte. Da er seinen Weg bedeutend abkürzen konnte, wenn er dies Wasser überschritt, so wagte er den Versuch. Auf der Stelle, von der er ausgegangen, war die Beschaffenheit des Eises ziemlich gut, allmählich aber, je weiter er kam, desto schwächer wurde die Eisdecke, bis ihm, in der Mitte des Gewässers angelangt, nichts übrig blieb, als auf allen Vieren vorsichtig weiterzukriechen; auf diese Weise erreichte er dann mit Noth und Mühe das jenseitige Ufer.
Am nächsten Morgen langten wir mit unserer letzten Last am Ufer des Langvandet an. Balto wollte abermals den Versuch machen, über einen kleinen Arm des Gewässers zu gehen, er schnallte seine Schneeschuhe an und zog den Schlitten hinter sich her. Da ich eine Karte über das Terrain aufzunehmen hatte und infolgedessen oft zurückbleiben und eine Menge Abstecher machen mußte, so beschloß ich, um die Kameraden schneller einzuholen, denselben Richtweg einzuschlagen, dessen sich Balto bedient hatte. Ich schnallte deswegen meine Schneeschuhe an und begab mich auf das Eis, meinen Schlitten hinter mir herziehend. Als ich bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, bemerkte ich, daß das Eis ein wenig nachgab, da sich[S. 214] aber eine zweite Eisschicht darunter befand, so ging ich getrost weiter. Die Eisdecke wurde jedoch schwächer und schwächer und bestand schließlich nur noch aus losen, dünnen Schollen. Ich sah mich gezwungen, den kürzesten Weg ans Ufer einzuschlagen. Bald vermochten die Eisschollen mich jedoch nicht mehr zu tragen und ich sank, auf meinen Skiern stehend, durch das Eis. Im Handumdrehen hatte ich die Skier, die nicht an den Beinen festgebunden waren, abgestreift, und mußte nun die 15 bis 20 Ellen, die ich noch vom Ufer entfernt war, schwimmend zurücklegen.
Balto, der auch nahe daran gewesen war, ins Wasser zu fallen, und der gehört hatte, daß ich übers Eis gehen wollte, war, während sich dies zutrug, herbeigekommen. Er macht die folgende Beschreibung davon: „Da ich fürchtete, daß Dietrichson über das schlechte Eis gehen würde, ergriff ich eine Flöte (so nannte er einige kleine Signalhörner, deren wir uns bedienten), lief auf einen Felsgipfel und blies, Dietrichson antwortete sofort und ich lief dahin, um zu sehen, wie die Sache ablaufen würde. Gerade als ich anlangte, war Dietrichson auf das Eis hinausgegangen. Ich sah, daß das Eis sehr schwach war und rief ihm zu, an das Ufer zu mir zu kommen. Aber er kam nicht, er machte noch einige Schritte mit seinen Schneeschuhen und verschwand dann zwischen den Eisstücken. Da rief ich: „Laß den Schlitten fahren und schwimme an den Strand!“ Er that das und schwamm an den Strand. Wir nahmen die Instrumente aus seinen Taschen, damit sie nicht allzu naß werden sollten. Wir wußten aber keinen Rath, wie wir den Schlitten ans Land bringen sollten. Dietrichson meinte, er wollte wieder zurückschwimmen, ihn holen und ans Land bringen. Da sagte ich: „Thue das nicht, du frierst todt.“ Dann rief ich Kristiansen zu, daß er eine lange Stange, nämlich[S. 215] ein Bambusrohr, bringen solle und ein Tau, um den Schlitten damit ans Land zu bringen; aber Dietrichson kehrte sich nicht an meine Worte, sondern ging wieder auf den See hinaus. Sobald er auf eins der Eisstücke gekommen war, fing dies an umzukippen, und er verschwand kopfüber in dem See. Darauf schwamm er wieder an den Strand. Ich lief auf einen Felsgipfel hinauf und pfiff aus Leibeskräften. Da lief Kristiansen auf einen Felsgipfel hinauf und schrie: „Was ist da los?“ Ich rief: „Bringt ein Bambusrohr und ein Tau, Dietrichson ist in den See gefallen, und der Schlitten steht auf dem Eise.“ Kristiansen erschrak sehr, denn er glaubte, daß Dietrichson umgekommen sei und daß nur der Schlitten auf dem Eise stehe. Da lief Kristiansen mit diesen Dingen so schnell er konnte, und dann zogen wir den Schlitten und die Büchse an den Strand und begaben uns nach der Feuerstelle, wo die Andern Kaffee kochten, und dort blieben wir die Nacht, denn Dietrichson war durch und durch naß geworden.“
„Nachdem wir die Bagage aufs Land geschafft hatten,“ fährt Dietrichson fort, „wanderten wir weiter bis zu dem Ort, wo die Mahlzeit zubereitet war und wohin die Uebrigen die Sachen geschafft hatten, die am vorhergehenden Tage ans Wasser hinabgetragen waren. Eine Tasse Kaffee schmeckte vorzüglich und erwärmte im Verein mit einem theilweisen Wechsel der Kleidungsstücke meine erfrorenen Glieder gar bald wieder.
So hatten wir denn unsere Bagage wieder vollzählig beisammen. Wir merkten aber bald, daß wir nicht mehr im stande waren, so große Bürden wie bisher zu tragen. Wenn wir dieselben in der Weise verminderten, daß wir statt zwei Wanderungen drei unternahmen, so würden wir damit zu viel Zeit hinbringen, um rechtzeitig unten am Fjord sein zu können, wo uns der Verabredung gemäß die Böte abholen sollten. Ich beschloß[S. 216] deshalb, einen Schlitten und ein Paar Schneeschuhe zurückzulassen. Um sicher zu sein, daß die Lasten gleichmäßig vertheilt waren, machten wir aus Schneeschuhen, Bambusrohren und Tauen eine Wage, und während die Uebrigen damit beschäftigt waren, die acht Lasten abzuwägen, zog ich thalabwärts weiter, um meine Croquis aufzunehmen. Als ich am Abend zurückkehrte, waren sämtliche Sachen derartig vertheilt, daß alle Lasten gleich schwer waren. Wir krochen darauf in unsere Schlafsäcke, um am nächsten Morgen unsere Wanderung in aller Frühe wieder antreten zu können.
Um 6 Uhr waren wir Alle auf den Beinen, und nach einem strammen Marsch, auf dem wir u. a. durch einen kleinen Bach waten mußten, kamen wir gegen Abend am Gänseteich an, wo wir uns wieder in unseren Schlafsäcken zur Ruhe begaben.
Am nächsten Morgen (2. Oktober), nachdem wir einige Stunden marschirt hatten, kamen wir an einen langen, steilen, aber ziemlich ebenen grasbewachsenen Abhang. Hier setzten wir die Schlitten nieder, beluden sie mit unserem Gepäck, und nun ging es leicht und schnell bis an den unten fließenden Bach hinab. Hier sah es aber durchaus nicht verlockend für uns aus! Der Bach war nicht wiederzukennen, — in den vier Tagen, welche verflossen waren, seit wir ihn zuletzt gesehen hatten, war das Wasser ungefähr um das Vierfache gestiegen. Hinüber mußten wir indessen, denn weiter unten an der Seite, an welcher wir uns befanden, drängte der Bach sich bis hart an die lothrechte Felswand, so daß keine Rede von einem Vordringen sein konnte. Außerdem befanden sich unser Zelt und die übrigen am Fjord zurückgelassenen Sachen auf dem jenseitigen Ufer. An der zum Waten günstigsten Stelle betrug die Breite des Baches reichlich 100 Ellen; diese Strecke mußte also dreimal zurückgelegt werden, erst mit der einen Last, dann zurück, um die zweite zu holen,[S. 217] und abermals mit dieser hinüber. Während die beiden Lappen ihre Kleidungsstücke anbehielten, um sich dadurch gegen das eiskalte Wasser zu schützen, zogen Kristiansen und ich es vor, uns der Beinkleider und Strümpfe zu entledigen, um dieselben nach vollbrachtem Werk trocken wieder anziehen zu können. Die Schuhe behielten wir dagegen an, um unsere Füße nicht an den scharfen Steinen zu verletzen. Die Strömung war sehr reißend, wir mußten deshalb unsere Bambusstöcke in die Hand nehmen, um uns darauf zu stützen und unsern Weg tastend über den unebenen Boden zu finden. Denn wenn die Strömung uns die Füße unter dem Leibe weggerissen hätte, wären wir wohl kaum im stande gewesen, uns wieder aufzurichten, da das schwere Gewicht, das wir auf dem Rücken trugen, unfehlbar unsere Köpfe unter Wasser gehalten haben würde. Es war ein kaltes Vergnügen, diese drei- bis vierhundert Ellen durch das Eiswasser zu waten, das uns bis an den Magen reichte. Kristiansen und ich waren völlig blau an den Beinen, als wir endlich mit unserer zweiten Last das jenseitige Ufer glücklich erreicht hatten, nachdem wir aber die abgefrorenen Körpertheile tüchtig gerieben und unsere trockenen Kleidungsstücke wieder angezogen hatten, wurden wir gar bald warm, während die beiden Lappen das nasse, kalte Zeug anbehalten mußten und nichts weiter thun konnten, als es auszuwringen, so gut es eben gehen wollte. Falls der Bach im selben Maße fortfuhr anzuschwellen, wie er es in diesen vier Tagen gethan hatte, würde es zwei, ja selbst nur einen Tag später völlig unmöglich für uns gewesen sein, hinüber zu gelangen.
Es war noch nicht 12 Uhr, da wir hier aber Brennmaterial zur Hand hatten, beschlossen wir, eine Erbsensuppe zu kochen und unser Mittagessen ein wenig früher als gewöhnlich einzunehmen. Eine warme Mahlzeit war uns Allen nach dem kalten Bade äußerst erwünscht.
[S. 218]
Um 2 Uhr des Nachmittags (den 2. Oktober) langten wir mit unserer ersten Last am Ufer des Fjordes an. Hiermit ließen wir uns vorläufig genügen und den übrigen Theil der Bagage einstweilen eine Strecke thalaufwärts liegen, denn wir wollten den Rest des Tages zum Instandsetzen unseres Zeltes benutzen. Dieses sowie den einen Schlafsack und die übrigen Sachen, die wir mitgebracht hatten, als wir die Küste zum erstenmal erreichten, und die von unseren Kameraden zurückgelassen waren, fanden wir wohlbehalten unter einigen Büschen vor. Die Zeltstangen waren jedoch verschwunden, sie waren zum Bau des Bootes verwendet worden, deswegen mußten wir sie durch andere Bambusrohre ersetzen. Nachdem dies geschehen war, wurde das Zelt errichtet.
Sechs Tage waren jetzt vergangen, seit wir zuletzt hier gewesen waren. Während dieser ganzen Zeit waren wir ungewöhnlich vom Wetter begünstigt worden, des Tags hatten wir herrlichen Sonnenschein gehabt, ohne daß uns die Hitze lästig gewesen wäre, und des Nachts einen sternenklaren Himmel bei verhältnißmäßig milder Luft. Es konnte deswegen nur als eine Annehmlichkeit bezeichnet werden, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen.
Der Umstand, daß wir nur einen Schlafsack hatten und infolgedessen genöthigt waren, uns zu Vieren hineinzuzwängen, trug freilich sehr wesentlich dazu bei, daß wir nichts von der Nachtkälte verspürten.
Um 5½ Uhr am nächsten Morgen waren wir wieder auf den Beinen, und nachdem wir unser Frühstück verzehrt hatten, gingen wir thalaufwärts, um den Rest der Bagage zu holen; gegen Mittag trafen wir wieder an unserem Lagerplatz ein. Da wir auf die Möglichkeit gefaßt sein mußten, hier in aller Ruhe einige Tage zu verbringen, packten wir einen Theil unserer[S. 219] Sachen aus und ordneten alles auf die bequemste, angenehmste Weise. Der Proviant wurde nachgesehen und aufgezählt, und es stellte sich heraus, daß wir außer Pemikan für längere Zeit noch Brot für sechs und Erbswurst für fünf Tage hatten, wenn wir nur ein Minimum von diesen Sachen verwendeten. Fettstoff hatten wir dagegen gar nicht mehr, schon vor fünf Tagen hatten wir den letzten Rest verzehrt. Auch an Salz gebrach es uns, da einige von den Mitgliedern der Expedition in der letzten Zeit unverhältnißmäßig viel davon konsumirt hatten.
Wir konnten jetzt täglich Nachricht von unseren Kameraden erwarten, die nach Godthaab ausgezogen waren. Ja, wir hatten sogar im stillen gehofft, daß wir das Boot, das uns abholen sollte, schon vorfinden würden, wenn wir mit unserer Bagage den Fjord erreichten. Noch hatten wir keinen Grund über das Schicksal unserer Kameraden in Sorge zu sein, wenn aber noch acht Tage verstrichen, ohne daß wir von ihnen hörten, mußten wir versuchen, die Kolonie auf dem Landwege zu erreichen, denn dann konnten wir annehmen, daß sie verunglückt waren. Unser Proviant mit Ausnahme von Pemikan würde dann bereits seit mehreren Tagen verzehrt sein. Von diesem einen Nahrungsmittel war jedoch noch genügend vorhanden, um eine solche Wanderung unternehmen zu können.
Wir zündeten ein Feuer vor dem Zelt an, lagerten uns um dasselbe und genossen die Ruhe, deren wir so sehr bedurften. Den ganzen Nachmittag verbrachten wir auf dem Rücken in dem weichen Heidekraut liegend, in dem erhebenden Gefühl, daß jetzt die schwerste Zeit überstanden war, und daß jetzt voraussichtlich bessere und bequemere Tage für uns kommen würden.
Früh am Abend begaben wir uns zur Ruhe und erst spät am nächsten Vormittag steckten wir die Köpfe wieder zum Zelt hinaus. Ich benutzte den Vormittag, um mein Croquis zu[S. 220] vollenden. Kristiansen ging mit der Büchse über der Schulter aus, um auf Wild zu fahnden, kehrte aber schon nach einigen Stunden unverrichteter Sache wieder zurück. Den übrigen Theil des Tages verbrachten wir in aller Ruhe. Auch den folgenden Tag benutzten wir zur Rast.
Gerade vor unserem Zeltplatz war das Ufer des Fjordes völlig unzugänglich für ein Boot, deswegen begab ich mich am Vormittag des 6. Oktober auf eine Landspitze hinaus, die sich weit in den Fjord hineinerstreckte und die mit Gesträuch bewachsen war, theils um einen guten Landungsplatz für das Boot zu suchen, theils um mich nach Wild umzusehen. Als ich kaum den halben Weg zurückgelegt hatte, vernahm ich einen Schuß! Der konnte nur von einem Sendboten unserer Kameraden herrühren! Oder waren es etwa Grönländer, die gleich mir auf Jagd ausgegangen waren? Ich eilte auf den Höhenrücken, um zu sehen, ob ich irgend etwas entdecken könne, und es währte auch nicht lange, bis ich zwei Grönländer erblickte, die über die Landzunge gingen, auf dem Rücken Bündel und Säcke tragend, die nach Art der Eskimos in breiten über die Stirn laufenden Tragriemen hingen. Als ich sie anrief, machten sie sofort Halt, und wir gingen einander entgegen. Es stellte sich heraus, daß meine erste Vermuthung richtig gewesen war: es waren zwei Kajakmänner, die uns Botschaft von Nansen brachten. Sie überlieferten uns einen Brief, in dem er schrieb, daß sie glücklich angekommen seien und daß er uns vorläufig etwas Proviant sende, Böte mit reichlicheren Vorräthen würden bald nachkommen und uns abholen, wegen des starken Sturms sei es jedoch bisher nicht möglich gewesen, die Leute zur Abfahrt zu bewegen. Ich kehrte natürlich sofort um und führte die Ankömmlinge nach dem Lagerplatz.
Den ganzen Vormittag hatte mich ein wahrer Heißhunger[S. 221] gequält, aber trotzdem hatte ich mein einfaches Mittagsmahl, aus einem Stück trockenen Fleischbiskuits und etwas Pemikan bestehend, gewissenhaft aufbewahrt, um es erst zur Mittagszeit zu verzehren. Jetzt wußte ich, daß wir wenigstens vorläufig keine Noth leiden würden, da uns Nansen Proviant gesandt hatte. Deswegen konnte ich mein Mittagsmahl getrost in Angriff nehmen. Es währte nicht lange, bis ich es herausgeholt hatte, und im Handumdrehen war es verzehrt.
Zwischen der Landzunge, auf der wir uns befanden, und unserem Lagerplatz ragte ein steiler, hoher Fels empor, den wir erklimmen mußten, um an das Zelt zu gelangen. Oben angelangt, gab ich den Kameraden ein Zeichen. Sie stürzten aus dem Zelt heraus, und als sie meine Begleiter erblickten, begriffen sie sofort, daß sie Abgesandte unserer vor zehn Tagen abgereisten Genossen seien, weshalb sie meinen Ruf mit einem Freudengeheul beantworteten. Ich war ausgegangen, um nach Wild zu suchen, aber obwohl ich das Gesuchte nicht fand, bin ich doch niemals mit einer willkommeneren Jagdbeute heimgekehrt als an jenem Tage.
Am Lagerplatz angelangt, placirten wir uns Alle um die von den Grönländern mitgebrachten Sachen. Zuerst las ich Nansens Brief laut vor. Er enthielt nur erfreuliche Kunde mit Ausnahme der Nachricht, daß wenig Aussicht für uns vorhanden sei, noch in diesem Jahr nach Europa zurückzukehren. In unserem Freudenrausch hatten wir für diesen Kummer kaum Gedanken. Dann ging es an das Auspacken der Packete, und neugierig wie Kinder, die den Weihnachtstisch umstehen, öffneten wir eins nach dem anderen. Wir erfreuten uns an dem Anblick aller der guten Sachen, die uns gesandt waren, — Brot, Fleisch, Kaffee, Tabak. Den größten Jubel aber erregte der reichliche Vorrath an Butter und Speck, denn wir hatten den Mangel[S. 222] an Fettwaren sehr empfunden. Auch an Dilikateßwaren fehlte es nicht, indem die dänischen Damen in Godthaab uns mit Kuchen und Süßigkeiten bedacht hatten. Wir machten uns sofort ans Essen, und wohl niemals hat Einer von uns so in Fettstoff geschwelgt wie wir an jenem Tage; wir waren förmlich wild darauf.“
Balto schildert diese Scene folgendermaßen:
„Nachdem Dietrichson mit seinen Kakes in der Tasche fortgegangen war, stieg ich auf eine Felsspitze, die 300 Fuß hoch war. Sobald ich hinaufkam, erblickte ich drei Männer, die mir entgegenkamen, den einen Mann kannte ich, es war Dietrichson, der die Männer getroffen hatte, welche von Godthaab ausgesandt waren, um uns Proviant zu bringen. Ich lief gleich nach dem Zelt und erzählte den Beiden, die im Zelt waren, daß ich Leute kommen sähe. Die Beiden glaubten es nicht. Aber ich holte trockenes Holz, machte Feuer an, holte Wasser und füllte den Kaffeekessel und setzte ihn aufs Feuer, ehe die Leute kamen, denn ich dachte mir, daß sie Kaffee bei sich haben würden. Gleich nachdem sie ins Zelt gekommen waren, untersuchte Dietrichson, was für Nahrungsmittel sie uns aus Godthaab gesandt hatten. Ich sah, daß Nansen mir eine Pfeife und Tabak geschickt hatte, sofort nahm ich die Pfeife und den Tabak in die Hand und fing an zu rauchen, die Anderen fingen an zu essen. Das Brot wurde in fingerdicke Stücke geschnitten und ein halber Zoll Butter auf das Brot gelegt, und dazu aßen wir noch Schweinefleisch und tranken Kaffee dazu.“ — —
„Während wir noch mit der Mahlzeit beschäftigt waren,“ fährt Dietrichson fort, „vernahmen wir abermals einige Schüsse in der Richtung der Landzunge, wo ich die beiden Grönländer getroffen hatte, und bald darauf wurden zwei Männer auf der vorhin erwähnten Höhe zwischen der Landzunge und[S. 223] unserm Lagerplatz sichtbar. Sie kamen zu uns herab und überreichten uns Briefe aus Umanak und von dem Koloniedirektor Bistrup und von einem Grönländer, Buchdrucker Möller, beide aus Godthaab und auf Besuch in Umanak, sowie einen von dem deutschen Missionar des Ortes, Herrn Heincke. Außer diesen Briefen brachten sie uns auch Erfrischungen von Herrn Bistrup und Herrn Heincke mit. Es war uns eine große Freude, diese Briefe zu empfangen, denn die warmen und herzlichen Worte, in denen sie abgefaßt waren, zeigten uns, daß wir bald zu Leuten kommen würden, die sich aufrichtig über unsere Ankunft freuten, und die uns mit offenen Armen empfangen würden.
Wir luden unsere Gäste ein, in unser Zelt zu kommen, damit sie sehen konnten, wie es bei uns aussah. Als sie unsere Schlafsäcke sahen, zeigten die zuletzt angekommenen Grönländer erst auf sich selbst, dann auf die Schlafsäcke, legten die Hand an die Wange und schlossen die Augen. Dann zeigten sie auf das Zelt und auf alles, was darin war, machten eine Gebärde, als wenn sie es auf den Rücken legten, und winkten dann mit der Hand über den Fjord. Hieraus verstanden wir, daß sie bei uns übernachten und daß wir sie dann nach der Kolonie begleiten sollten. Die mitgebrachten Sachen hatten sie noch in den Kajaks draußen an der Landzunge liegen, weswegen Kristiansen und Balto sich anschickten, sie dort hinauszubegleiten, um alles herbeizuholen. Als auch Nansens Boten Miene machten, sich zu entfernen, brachte ich aus ihnen heraus, daß sie gleich nach Godthaab zurückkehren sollten. In aller Eile setzte ich nun einige Worte an Nansen auf, ihm für die übersandten Waren dankend und ihm in aller Kürze von unserem Ergehen berichtend.
Als die Gefährten mit der neuen Proviantsendung anlangten,[S. 224] fand abermals ein feierliches Auspacken statt. Die verschiedenen Gegenstände wurden, während sie aus ihren Hüllen zum Vorschein kamen, laut aufgerufen, und als der Eine „Branntwein“, der Andere „Zucker“ und ein Dritter „Lichte“ rief, waren wir uns sogleich darüber einig, den Abend mit einem Glase Grog im Zelte feierlich zu begehen. Es war bereits spät am Nachmittage, deshalb machten wir uns gleich daran, einen Punsch zu brauen. „Wie viel Wasser?“ fragte der Eine. „Ach, wir müssen wohl so viel machen, daß Jeder zwei Becher voll bekommt,“ antwortete ich. So wurde denn das Wasser gekocht und Zucker und Branntwein hineingethan. Seit wir den „Jason“ verließen, waren keine Spirituosen über unsere Lippen gekommen. Jetzt waren aber die Strapazen überstanden, und wir konnten getrost den erhaltenen Branntwein genießen. Einen starken Grog hätten wir wohl kaum vertragen können, den, der hier servirt wurde, konnten wir ruhig trinken, ohne befürchten zu müssen, daß er uns zu Kopf steigen würde, denn Balto hatte unglaublich viel Wasser hineingethan, und wir hatten nur wenig Branntwein. Das Schlimmste war aber doch, daß sich der Branntwein schließlich als Aquavitae entpuppte. Trotzdem schmeckte er uns ausgezeichnet.“
Balto, ein Kenner in solchen Dingen, sagt in seiner Beschreibung, „daß der Punsch dünne werden muß, wenn man von einer Flasche „Akevit“ sechs Flaschen Punsch macht, — es schmeckte nach nichts.“
„Auch an Cigarren fehlte es nicht, und aus diesen entsandten wir mächtige Rauchsäulen in das Zelt, als wenn wir so schnell wie möglich das Versäumte nachholen wollten, denn mit dem Tabak war es die ganze Zeit hindurch sehr schlecht bestellt gewesen, so daß einzelne Mitglieder der Expedition schließlich versucht hatten, ihn durch Werg zu ersetzen, das sie in die Pfeifen stopften.
[S. 225]
Nansen schrieb, er und Sverdrup lebten bei dem Kolonialdirektor in Godthaab wie die Prinzen, aber wir fühlten uns in diesem Augenblick nicht minder wohl, und wir waren uns Alle darüber einig, daß es der gemüthlichste Abend sei, den wir im Zelt verbracht hatten, denn das Bewußtsein, daß unsere beiden Kameraden glücklich bis an bewohnte Stätten vorgedrungen waren und daß wir täglich die nach uns ausgesandten Boote erwarten konnten, sowie der Umstand, daß wir so reichlich mit Speise und Trank versehen waren, hatte sämtliche früheren Leiden verwischt, so daß wir jetzt alles nur im rosigsten Lichte erblickten.
Wir wohnten nun wieder zu Sechsen im Zelt, diesmal aber waren drei Nationen vertreten. Unsere Gesellschaft bestand aus zwei Grönländern, zwei Lappen und zwei Norwegern, die alle ihre eigene Zunge sprachen, ohne von den Andern verstanden zu werden, mit Ausnahme der Lappen, denn Balto und auch zum Theil Ravna verstanden und sprachen norwegisch. Obwohl infolgedessen eine fast babylonische Sprachverwirrung im Zelte herrschte, war die Unterhaltung dennoch eine sehr lebhafte, und es wurde uns gar nicht so schwer, uns miteinander verständlich zu machen, denn außer zu Zeichen nahmen wir unsere Zuflucht zu einem grönländischen Wörterbuch und einer Sprachlehre, die wir mitgebracht hatten. Unsere beiden Gäste, Peter, ein vorzüglicher Fänger aus Godthaab, und Silas, ein tüchtiger Rennthierschütze aus Umanak, waren begabte und wohlunterrichtete Grönländer, die nicht nur schreiben und lesen, sondern auch zeichnen konnten. Ihre Risse von der Wohnung des Kolonialdirektors in Godthaab, wie von dem Hause des deutschen Missionars in Umanak waren so vortrefflich, daß wir die Gebäude später, als wir sie erblickten, sofort erkennen konnten.
Wir befanden uns an diesem Abend so wohl in unserem[S. 226] Zelt, daß es lange währte, ehe wir uns zur Ruhe begaben. Kristiansen, Balto und ich krochen in den einen Schlafsack, Ravna und die beiden Grönländer in den andern. Die Lichter wurden ausgelöscht und wir legten uns schlafen. Es sollte jedoch noch eine ziemliche Zeit vergehen, ehe wir einschliefen, denn kaum waren wir zur Ruhe gegangen, als unsere beiden Gäste anfingen, geistliche Lieder zu singen. Nachdem der dritte Gesang beendet war, beteten sie ein Vaterunser. Dies war die Abendandacht, die sie des Sonntags hielten, ehe sie sich zur Ruhe begaben. Ich nehme wenigstens an, daß sie die Andacht hielten, weil es ein Sonntag war, oder etwa auch, weil sie sich zwischen lauter fremden Menschen befanden und sich möglicherweise nicht ganz sicher fühlten. Als wir am nächsten Abend vergebens auf eine Wiederholung dieses Gesanges gewartet hatten, baten wir sie schließlich, zu singen, sie waren jedoch nicht dazu zu bewegen.“
Am folgenden Morgen ging Silas auf die Rennthierjagd. Dietrichson hatte große Lust, ihn zu begleiten, wollte aber die Gefährten nicht im Stich lassen, die an diesem Tage damit begannen, die Sachen von dem Zeltplatz weiter auf die Landzunge hinaus zu schaffen.
In seinem Tagebuchbericht fährt Dietrichson fort:
„Während einer unserer einfachen Mahlzeiten auf dem Inlandseis war einmal die Rede darauf gekommen, welches Gericht sich ein Jeder von uns in diesem Augenblick wünsche. Wir empfanden den Mangel an Fettstoff sehr, deswegen wurden wir uns sämtlich darüber einig, daß wir das größte Verlangen nach Buttergrütze (Smörgröd) hatten, und Nansen versprach uns, daß wir dies Gericht haben sollten, sobald wir nach Godthaab gelangten. Unter allen den guten Dingen, die er uns gesandt hatte, befand sich denn auch Butter und Weizenmehl, so daß wir[S. 227] nun instandgesetzt waren, diese oft von uns besprochene Speise zu bereiten. Unsere erste warme Mahlzeit nach Empfang der Proviantsendung bestand deswegen aus Buttergrütze, und der Appetit ließ denn auch nichts zu wünschen übrig. Wir hegten im Anfang einige Bedenken, unsern Hunger völlig zu befriedigen, da wir glaubten, daß es nicht so ganz gesund sein könne, da wir längere Zeit hindurch sehr knapp und ausschließlich von konzentrirten Eßwaren gelebt hatten, die den Magen nicht füllten, und nach deren Genuß man sich folglich nicht satt fühlen konnte. Dann aber dachten wir: „Ach was, wir haben so viel ertragen, da werden wir auch dies wohl ertragen können,“ und hieben aus allen Kräften ein.
Wir lagen noch im Gras und streckten unsere Glieder nach der Mahlzeit, als wir unsern Freund Silas oben auf dem Hügel erblickten. Er kam auf das Zelt zu, etwas großes, schweres auf dem Rücken schleppend. Sollte das wirklich ein Rennthier sein? Einige meinten Ja, andere Nein. Da sahen wir aber das Rennthiergeweih über seine Schulter ragen, und nun war kein Zweifel mehr möglich, — er mußte eins geschossen haben. Wir waren Alle sehr erfreut, die Lappen aber geriethen förmlich außer sich vor Glückseligkeit, denn nun sollten sie wieder ihr Nationalgericht kosten, das sie so lange hatten entbehren müssen. Balto lief ihm entgegen, hüpfte und tanzte im Kreise um ihn herum, klopfte ihm auf die Schulter und wußte nicht, wie er seiner Freude Ausdruck geben sollte. Inzwischen war der Jäger am Lagerplatz angelangt und legte nun seine Bürde ab, die aus der Haut, dem Kopf, einer Keule, Talg und den Markknochen bestand, — das Uebrige hatte er zur Abholung am nächsten Tage liegen lassen. Silas schenkte uns die Markknochen und gab Jedem ein Stück Talg, dann bedeutete er uns, daß wir den Kessel aufsetzen und dies zusammen mit der Keule[S. 228] kochen sollten, um das Gericht gemeinsam zu verzehren. Die Grönländer essen das Fleisch übrigens ebensogern roh wie gekocht, und unsere beiden Gäste hatten es schon in dieser Form in Angriff genommen. Es war nur eine gute Stunde vergangen, seit die Buttergrütze verzehrt war, aber trotzdem kam der Kessel sofort wieder aufs Feuer, und nach Lappenart lagerten wir uns um dasselbe herum und nahmen einen Probebissen nach dem andern aus dem Kessel heraus, so daß die meisten von uns ganz gesättigt waren, als das Fleisch völlig mürbe gekocht war, so wie die Lappen es wünschten. Späterhin am Abend machten wir uns abermals daran, und noch am selben Tage war das sämtliche Fleisch verzehrt. Man ersieht hieraus, daß unsere Mägen ziemlich elastisch waren, und daß sich unsere Gedanken in diesen Tagen hauptsächlich um das Essen drehten, aber dies ist sehr verzeihlich, wenn man bedenkt, daß wir so ausgehungert waren, daß wir niemals das Gefühl hatten, satt zu sein, selbst wenn wir so viel gegessen hatten, wie wir nur vermochten.“
„Von nun an“ — sagt Balto — „kamen bessere Tage, wir vergaßen allmählich die beschwerliche Reise, die wir hinter uns hatten, — mit Hunger, Durst, Frost und Trübsal im Eise.“
„Die beiden Grönländer,“ bemerkte Dietrichson weiter, „machten sich am nächsten Tage auf, um den Rest des Rennthieres zu holen, während wir das Zelt und die übrigen Sachen auf die Landzunge hinausschafften, denn nach Aussage der Grönländer konnten wir nun (es war der 8. Oktober) die Boote erwarten, die uns holen sollten.
Als die Grönländer am Nachmittag mit dem Rennthier zurückgekehrt waren, das sie an den Landungsplatz ihrer Kajaks trugen, fanden sie sich auf unserm neuen Lagerplatz mit einem großen Stück Fleisch ein, das sofort gekocht wurde. Weil es[S. 229] jetzt aber regnete, so konnte das Fleisch diesmal in aller Ruhe kochen, bis es gar war, worauf es im Zelt servirt wurde. Ein Schneehuhn, das Peter geschossen hatte, schenkte er uns ebenfalls. Vorher nahm er jedoch die Eingeweide heraus, wie wir glaubten, um sie für uns zu reinigen, zu unserm Staunen aber verzehrte er sie, und zwar scheinbar mit großem Appetit.“
Es vergingen noch mehrere Tage, ohne daß man etwas von den Booten erblickte; merkwürdigerweise war das Wetter am Fjorde gut, während es draußen stürmte und regnete.
„Am Morgen des 11. Oktober,“ fährt Dietrichson fort, „wurden wir um 7 Uhr durch den Laut mehrerer Schüsse aus unserm friedlichen Schlummer geweckt. Wir ahnten sofort, um was es sich hier handelte, deshalb sprangen wir aus den Schlafsäcken, ergriffen Gewehr und Patronen, steckten die Köpfe aus der Zeltthür und gaben eine Antwort durch mehrere Schüsse. Es konnte nur die Besatzung der sehnlichst erwarteten Boote sein, die gleich den früher angekommenen Grönländern ihre Ankunft durch Schüsse signalisirte. Im Handumdrehen waren wir in unsern Kleidern und standen jetzt vor dem Zelt, nach den Fremden ausspähend. „Da sind sie!“ hieß es, und über einem vorspringenden Abhang ward nun ein Grönländerkopf nach dem andern sichtbar. Wir fingen an zu zählen, aber dann wurde das unmöglich, in einer solchen Anzahl wimmelten sie plötzlich heran. Männer und Frauen, im Ganzen 14 Personen, näherten sich in lebhafter Unterhaltung, wieder und wieder ihre Gewehre abfeuernd, dem Zelte. Hier angelangt, trat einer der Männer vor und erklärte halb in dänischer, halb in grönländischer Sprache, daß sie mit zwei Booten gekommen seien, um uns abzuholen. Es war der im Dienste der dänischen Handelskolonie stehende Schmied Terkel, der als Dolmetscher fungirte.
Wir hatten unser Lager im Laufe der Zeit häufig genug[S. 230] abgebrochen, nie aber war dies mit einer ähnlichen Schnelligkeit bewerkstelligt worden, wie an diesem Tage. Eins, zwei, drei war alles zusammengepackt, jeder der Fremden nahm seinen Theil, und davon ging es mit der ganzen Karawane den Booten zu, die ungefähr 1000 Ellen vom Lagerplatz entfernt lagen“.
So schnell wie möglich ging es nun vorwärts. An der Nordseite des Fjordes wurde eine kleine Rast gemacht, um Kaffee zu kochen und eine Festmahlzeit abzuhalten. Den Grönländern, die seit längerer Zeit ihre Vorräthe verzehrt hatten, wurde ebenfalls vom Proviant mitgetheilt.
„Unser Freund, der Rennthierschütze,“ fährt Dietrichson fort, „traktirte seine Landsleute mit dem ihrer Ansicht nach wohlschmeckendsten Theil des Rennthieres, eine Delikatesse, die keiner von uns Europäern ihnen mißgönnte, denn wir waren ganz sicher, daß sie nicht nach unserm Geschmack sein würde, wenn wir uns darauf einlassen wollten, sie zu kosten. Der Magensack des Rennthieres wurde hervorgeholt, und schon bei dem bloßen Anblick desselben lief den Grönländern das Wasser im Munde zusammen; vorsichtig wurde er geöffnet und der Inhalt an die Gourmands vertheilt, die, nachdem sie die ihnen zuertheilte Portion verzehrt hatten, sorgfältig ihre Finger ableckten, um nicht das Geringste von diesem seltenen Leckerbissen zu verlieren.“
Endlich waren wir fertig und konnten nun allen Ernstes an unsere Reise denken. So ging es denn vorwärts, indem Peter das Holzboot und Silas das Frauenboot als Kajakmänner begleiteten. Nach Verlauf von wenigen Stunden mußte das Frauenboot jedoch schon wieder an Land gehen. Es war jetzt mehrere Tage im Wasser gewesen, und infolgedessen war die Haut durchweicht und schlaff, so daß das Boot zum Trocknen aufs Land geschafft werden mußte. Wir überließen der Besatzung ein wenig Proviant und zogen dann weiter.
[S. 231]
Im Laufe des Tages wurde das Wetter immer schöner, und gegen Mittag schien die Sonne strahlend hell. Spiegelblank breitete sich der Fjord um uns her aus, und die hohen steilen Felsen, die ihn umgeben, hatten genügend Gelegenheit, ihre eigene Schönheit in dem Spiegelbild zu bewundern, welches das blanke Wasser zurückwarf. Wir lagen höchst gemächlich hinten in dem kleinen, weißgemalten Boot und konnten uns in aller Ruhe der Betrachtung der großartigen Natur hingeben. Als die Sonne allmählich tiefer sank und die Felsen ihre langen Schatten über den Wasserspiegel warfen, schien die Natur selbst die bis dahin so munteren Grönländer feierlich zu stimmen; die lebhafte Unterhaltung und das fröhliche Gelächter verstummten allmählich, bis endlich eine völlige Stille eintrat. So ruderten wir eine lange Zeit weiter, nur das einförmige Plätschern der Ruder unterbrach die Stille, nichts Lebendes war zu erblicken, die ganze Natur ruhte. Allmählich wurde das Schweigen den Grönländern doch zu beklommen, der Ernst, der in dem todesstillen Dasein mitten in einer großartigen Natur liegt, ergriff die Besatzung, und plötzlich stimmte sie ein geistliches Lied an, dem bald andere folgten, und unter dem Absingen von Kirchenliedern glitt das Boot durch die zunehmende Finsterniß der Nacht dahin.“
Den nächsten Tag erreichte man Godthaab. In Dietrichsons Aufzeichnungen heißt es darüber:
„Wir konnten annehmen, daß wir um die Mittagszeit bei der Kolonie eintreffen würden. Was die Leute wohl dachten, wenn sie uns erblickten? Knochenmager, mit langem Haar, ungeschorenem Bart und dem alten Schmutz von drei Monaten auf unseren Körpern, sahen wir aus wie Vogelscheuchen. Am Ufer des Fjordes hatten wir vergebens versucht, einen Theil des Schmutzes mit warmem Wasser und Sand zu entfernen, —[S. 232] dazu bedurfte es der Seife, und die hatten wir nicht. Deswegen waren und blieben wir gleich schmutzig. Ein erneuter Versuch, uns zu putzen, würde ebenso fruchtlos gewesen sein, so sahen wir uns denn gezwungen, mit unserer Toilette zu warten, bis wir die Kolonie erreicht hatten.“
Dietrichson schließt seinen Bericht mit den Worten: „Als wir landeten, wurden wir auf das herzlichste empfangen von unseren später so liebenswürdigen Wirthen, dem Koloniedirektor Bistrup und Frau, sowie von den sämtlichen anderen dänischen Familien, die herbeigekommen waren, um uns willkommen zu heißen.
Nach 16tägiger Trennung von den Kameraden sahen wir uns am 12. Oktober wieder mit ihnen vereint!
Das Ziel war erreicht. Sicher und wohlbehalten hatten Alle eine dänische Kolonie an der Westküste erreicht, nachdem die Eisgefilde Grönlands von Osten bis Westen durchwandert waren.“
[S. 233]
 ls ganz eigenthümlich in seiner Art will ich hier noch einen Bericht
mittheilen, den Silas — einer der Kajakmänner, die aus Umanak
an den Ameralikfjord gesendet wurden — selbst in seiner Muttersprache
geschrieben hat.
ls ganz eigenthümlich in seiner Art will ich hier noch einen Bericht
mittheilen, den Silas — einer der Kajakmänner, die aus Umanak
an den Ameralikfjord gesendet wurden — selbst in seiner Muttersprache
geschrieben hat.
Derselbe wurde auf Grönländisch in der Zeitung „Atuagagdliutit“ veröffentlicht, die monatlich in einer Nummer in Godthaab erscheint und gratis an die Grönländer vertheilt wird.
Die hier wiedergegebene Uebersetzung ist freundlichst für mich von dem Koloniedirektor Brummerstaedt (Holstensborg) besorgt worden und schließt sich dem Originaltext so eng wie möglich an.
Dieser Bericht in seiner langgezogenen Umständlichkeit und seinen zahlreichen Wiederholungen ist äußerst charakteristisch für die ganze Erzählungsweise der Eskimos. Man darf nicht vergessen, daß der Verfasser ein ganz gewöhnlicher Seehundsfänger und Jäger ist, der keine andere Erziehung genossen hat, als wie sie Jedermann dort oben zu theil wird.
[S. 234]
Erzählung
von den Europäern, welche Grönland von Osten bis Westen über das Inlandseis durchfahren haben, sowie von ihrer Ankunft an dem Ameralikfjord und in Godthaab.
(Geschrieben von Silas aus Umanak.)
Ich will zuerst von unserer Reise nach Karkuk erzählen; wir Grönländer, die wir in den Fjorden wohnen, lassen es uns sehr angelegen sein mit unseren Fuchsfallen, da wir durch den Verkauf der Felle eine Menge Geld in die Hände zu bekommen pflegen. Ende September reisten wir vier Mann stark nach Karkuk, nämlich ich, Peter, David und mein Pflegesohn Konrad, der Letztere war nämlich im Mai durch den Vorstand in stand gesetzt, sich einen Kajak anzuschaffen. In Karkuk angelangt, gingen David und ich am nächsten Tage auf die Rennthierjagd, Peter und Konrad sahen nach den Fuchsfallen. Wir sahen eine Menge Spuren, aber keine Thiere, da es indessen nach Regen aussah, kehrten wir am nächsten Tage langsam um. Als der Wind sich legte, gingen David und ich quer über den Fjord, wir sahen einen kleinen Fjord-Seehund auftauchen, verfolgten ihn, schossen aber mehrmals vorbei, da der Seegang ziemlich stark war. Weil wir sonst kaum Seehunde mehr sahen, ging David von mir fort zu den beiden Anderen hin nach der entgegengesetzten Seite des Fjordes, wogegen ich meinen Kurs mitten über den Fjord beibehielt; als ich mich unserm Wohnort näherte und an einem kleinen Vorgebirge vorübergekommen war, bemerkte ich, daß draußen vor den Häusern ein hölzernes Boot lag; ehe wir reisten, hatte ich gehört, daß der Missionar Besuch von dem Direktor aus Godthaab erwartete, der in Karusk gewesen war; er war es auch wirklich, der angekommen war. Als ich dicht am Ufer anlangte, entdeckte ich zwei Kajaks, die nur ein wenig über den Hochwasserstand in die Höhe gezogen waren, es stellte sich heraus, daß es zwei Postboten in den Kajaks der Seminaristen waren.
Gerade als ich aus meinem Kajak herausgekommen war, kam mein Pflegesohn zu mir an das Ufer hinab und erzählte mir, daß Diejenigen, welche von der Ost- bis zur Westküste über das Inlandseis gegangen waren, glücklich am Ameralikfjord angekommen seien, vier von ihnen wären noch am Fjord, zwei von ihnen wären in einem aus Zeug angefertigten Boot nach Godthaab gekommen.
Als ich dies hörte, erstaunte ich sehr und sagte sofort, wenn ich ihnen doch im Sommer begegnet wäre, als ich auf Rennthierjagd bei Kapisilk war. (Wir hatten nämlich davon gehört, daß einige Leute die Reise über das Inlandseis versuchen wollten.) Dann sagte ich: „Wie haben sie es doch nur angefangen, vom Ameralikfjord bis nach Godthaab in einem Zeugboot zu reisen, der ganze Weg besteht ja aus lauter steilen[S. 235] unzugänglichen Felsklippen; das ist höchst sonderbar, den Weg hätte kein Grönländer in einem solchen Boot zurücklegen können.“
Ich ging dann in mein Haus hinauf, zog meine Pelzjacke und Beinkleider aus und fing an zu essen, bald darauf klopften die Kinder an die Fensterscheiben und sagten, daß Otto (der Missionar) mich rufe. Ich beeilte mich, meine Beinkleider wieder anzuziehen, aber die Kinder riefen mir durch das Fenster zu, Otto wäre im Begriff, in mein Haus zu gehen; da es zu lange gewährt haben würde, wenn ich meinen Anorak angezogen hätte, ging ich in Hemdsärmeln hinaus und traf ihn neben meinem Hausgang. Als ich hinauskam, sagte er zu mir: „Du kennst jeden Weg nach dem Ameralikfjord gut, da die vier Europäer, die sich dort befinden, sehr zu bedauern sind, so sollst du und Peter, der Kajakmann des Direktors, zu ihnen gehen, um ihnen Proviant zu bringen; beeile dich ein wenig und mache dich bereit für die Reise.“
Da ich, wie gesagt, erst soeben nach Hause gekommen war, hatte ich anfänglich keine sonderliche Lust zu der Reise, aber ich entschloß mich endlich doch dazu.
Es regnete sehr stark; als die Uhr vier nachmittags war und ich Kaffee getrunken hatte, ging ich, während ich auf die Briefe wartete, in das Besaetningszelt des Direktors, um etwas Neues zu hören. Der Bootsmann erzählte mir da, daß zwei von dieser Expedition Lappen seien, ich hatte ja freilich, als ich zur Schule ging, davon gehört, daß ein Volk existire, das Lappen hieß, aber über ihre Sitten und Gewohnheiten wußte ich nichts.
Als die Briefe fertig waren und wir (Peter und ich) unsere Kajaks mit Proviant, Spiritus etc. angefüllt hatten, reisten wir ab, um möglichst das Heringshaus noch vor der Nacht zu erreichen, da es zu stark regnete, um unter offenem Himmel zu liegen und keine großen Steine mit Höhlen darunter da waren, wo wir hätten übernachten können. Als es anfing dunkel zu werden, kamen wir dahin und gingen in das Haus hinein; da das Dach undicht war, tropfte der Regen stark in das Haus, ich hatte glücklicherweise einen Theekessel und eine Untertasse bei mir, die Untertasse benutzten wir als Lampe und schliefen, so gut es eben ging.
Am Morgen machten wir Kaffee und fuhren dann, sobald es hell wurde, von dort ab.
Als wir nach Itiodlek kamen, trugen wir erst den mitgebrachten Proviant etc. über Land an die entgegengesetzte Seite von unserem Landungsplatz, dann nahmen wir unsere Kajaks auf den Kopf und gingen mit ihnen über das Land, um das Umrudern dieses Landes zu sparen. Wir hatten erwartet noch am Abend den Ameralikfjord zu erreichen, da aber der Südwestwind mehr und mehr aufkam und die See unruhig war, kamen wir nur bis Kingaks Nordseite, da ich nicht um Kingaks Naes herumrudern wollte, weil ich es nicht genau genug kannte, um es bei dem[S. 236] starken Sturm zu passiren, und weil ich wußte, daß sich in der Nähe des Vorgebirges kein Ort befand, wo wir hätten anlegen können, falls der Sturm zu heftig wurde.
Dort fanden wir eine größere Höhle unter einem Stein, in die krochen wir hinein und schliefen dort.
Als es anfing hell zu werden und da es einigermaßen ruhiges Wetter war, fuhren wir von dort ab, nachdem wir unsern letzten Kaffee getrunken hatten. Als wir einige Zeit gerudert hatten, kamen wir endlich an dem Vorgebirge vorüber, vor dem ich mich am meisten geängstigt hatte, ruderten dann in den Fjord hinein, und da mein Begleiter diesen Weg nie zuvor gesehen hatte, nannte ich ihm die Namen der verschiedenen Felsen und erzählte ihm, welche Wege wir zu nehmen pflegten, wenn wir auf die Rennthierjagd gingen.
Wir wußten nichts Bestimmtes darüber, wo diese Menschen sich aufhielten, ich glaubte, daß es das Wahrscheinlichste sein würde, daß sie sich auf einem der Zeltplätze am Ufer des Fjords aufhielten. Als wir deswegen über den Fjord setzten und uns ein wenig vor Ivigtussok befanden, feuerten wir mehrere Schüsse ab, aber sie wurden nicht beantwortet; wir ruderten immer weiter, — trafen zwei Seehunde, die wir zu schießen versuchten, da aber der Wind zu stark war, gelang es uns nicht, — und langten am Ende des Fjordes an, feuerten abermals einige Schüsse ab, die ebenfalls nicht beantwortet wurden, worauf wir anfingen, die Befürchtung zu hegen, daß wir die von uns Gesuchten nicht treffen würden.
Bald darauf meinten wir jedoch einen Schuß zu vernehmen, ich glaubte, daß er von Umiviarsuit komme, ich sagte deshalb zu meinem Begleiter: „Laß uns hier bei Umiviarsuit an Land gehen und erst auf der anderen Seite des großen Baches nachsehen, ob sie dort nicht sind, das ist ja möglich.“
Nachdem wir unsere Kajaks durch den Lehm auf den festen Erdboden gezogen hatten, nahm ich den Brief und meine Büchse, Peter nahm die seine ebenfalls mit, damit wir Signalschüsse abfeuern konnten. Als ich einmal geschossen hatte (die Büchse meines Begleiters Peter war naß geworden, so daß sie nicht gebraucht werden konnte), hörten wir endlich ganz in der Nähe einen Schuß und entdeckten Spuren von großen Stiefeln. Da wir nun nicht länger daran zweifelten, daß wir sie treffen würden, wurden wir sehr guter Laune, namentlich, weil wir wahrscheinlich die Lappen zu sehen bekommen würden. Allmählich, als wir weiter vordrangen, trafen wir auf Spuren von Grönländern; wir hatten geglaubt, daß wir die ersten Grönländer sein würden, die zu ihnen kamen, aber wie wir später erfuhren, waren wir nur ein wenig später gekommen als die beiden anderen Grönländer. Nach einer Weile erblickte Peter ein Zelt und Menschen, die davor gingen. Während Peter Hurrah rief, schoß ich mit meiner Büchse vor Freude, — wir suchten nach dem besten[S. 237] Weg, um zum Zelt hinabzugelangen, da wurde uns auf Grönländisch zugerufen: „Amuinak!“ (d. h. geht gerade herunter). Da erkannten wir die beiden Grönländer, es stellte sich heraus, das es die beiden Brüder Terkel waren, der Vorsteher und sein jüngerer Bruder Hoseas aus dem Wohnplatz Sardlok, sie waren soeben dort angekommen, um gleichfalls Proviant zu bringen. Wir sahen die beiden Norweger und die beiden Lappen eine Mahlzeit einnehmen und Kaffee trinken, von dem, was ihnen gesendet war; sie hatten einen Tisch gedeckt, indem sie einen ihrer großen Schlitten als Tisch benutzten.
Als wir ganz zu ihnen hingekommen waren, reichte ich einem von ihnen die Briefe, als er sie erhalten hatte, gab er sie gleich dem, der am weitesten von ihm entfernt saß (Lieutenant Dietrichson).
Endlich erblickten wir die Lappen, nach denen wir uns gesehnt hatten. Wir erstaunten über ihre Tracht, weil sie ganz und gar nicht der Tracht gleicht, in welcher wir die Europäer hier oben zu sehen gewohnt sind, ihre Fußbekleidung glich Schlittschuhen, die Spitze war sehr gebogen, das eine Paar Stiefel hatte Sohlen, welche den Sohlen der grönländischen Fußbekleidung glichen; der andere Lappe, der ältere, hatte eine Fußbekleidung aus den Beinen der Rennthiere, ebenfalls die Spitzen sehr gebogen, auch trugen sie Beinkleider aus den Beinen der Rennthiere, die sehr stramm auf ihnen saßen, sie hatten unter den Unterbeinkleidern weiße wollene Hosen, in ihren Röcken hatten sie viele Taschen, das ganze Futter des Rockes wurde als Aufbewahrungsplatz benutzt; sie hatten Halstücher, an deren Enden sich Taschen befanden.
Der Jüngere, Samuel Balto, trug eine hohe Mütze mit vier Ecken, in denen Federn steckten, mit einem großen, breiten, rothen Band um die Mitte, der Aeltere, Ole Ravna, hatte eine lange, rothe Mütze, die nach oben zu enger und enger wurde, am Ende der Mütze saß ein Quast.
Nachdem die Briefe, die wir von dem Direktor und dem Missionar (Otto) mitgebracht hatten, durchgelesen waren, gaben sie uns Speise und Kaffee, welches wir genossen; als sie in das Zelt gingen, begleiteten wir sie, um zu versuchen, mit ihnen in ein Gespräch zu kommen; als wir hörten, daß sie ein Buch hätten und sahen, daß es auf Grönländisch und Dänisch gedruckt war (ebenso hatten sie zwei Schreiben, die in denselben Sprachen abgefaßt waren), gelang es uns endlich, uns dieser Bücher bedienend, ihnen verständlich zu machen, was für Sachen wir mithatten; wir veranlaßten zwei von ihnen, uns zu begleiten, um einige von den Sachen zu holen, da wir sie nicht alle allein tragen konnten.
Da Terkel und sein Bruder nach Godthaab reisen wollten, sollten Peter und ich hier auf das Boot warten, das diese vier Männer nach Godthaab führen sollte. Otto (der Missionar) hatte mir freilich gesagt, daß ich direkt nach Umanak zurückkehren sollte, aber ich wollte lieber warten und sie nach Godthaab begleiten, weil meine Bezahlung dann besser werden würde.
[S. 238]
Nachdem wir den Beiden, die mit uns kommen sollten, um die mitgebrachten Sachen zu holen, ein Zeichen gegeben hatten, gingen wir mit ihnen und mit Terkel und seinem Bruder zu den Kajaks hinab und fingen an, aus den Kajaks herauszuholen, was wir mithatten, die Beiden waren sehr froh über die Sachen, wir hatten ja auch viele verschiedene Dinge, unter anderem fünf Schwarzbröte und zwei Flaschen, in denen sich Wein befand.
Als wir zurückkehrten, um die Sachen nach dem Zelt zu bringen, wünschten wir vorerst Terkel und Hoseas eine gute Heimreise und verließen sie dann. Als wir an die Spuren im Sande kamen, erzählte ich Kristiansen und Balto, daß es meine und meiner Gefährten Spuren vom Sommer her seien, als wir hier im Juli auf Rennthierjagd gewesen; ich zeigte ihnen den Berg Akuliarusiarsuak, erzählte ihnen, daß meine Reisegefährten Konrad und Frederik hießen und daß wir damals fünf Rennthiere erlegten.
Als wir in die Nähe des Zeltes kamen, fing der Lappe an, Hurrah zu rufen, ich stimmte mit ein. Als der Herr (Lieutenant Dietrichson) sah, was wir mithatten, wurde auch er scheinbar sehr froh, und es wurde alles in das Zelt gebracht, worauf sie sich gleich daran machten, Kaffee in einem großen Kessel zu kochen.
Als der Kaffee kochte, tranken wir ihn und aßen uns satt, später tranken wir Punsch. Als wir uns zur Ruhe begeben wollten, sagten sie zu uns, daß wir hineinkommen sollten, und gaben uns einen Schlafsack, in welchem drei Mann liegen konnten, und darin sollten wir zusammen mit dem alten Lappen schlafen.
Mein Begleiter (Peter) wollte nicht mit ihm in einem Sack liegen und auch ich hegte einigen Aberglauben (Furcht) davor, mit Lappen in einem Sack zu liegen, das kommt daher, weil wir ja sonst niemals mit Europäern zusammen liegen.
Als Peter noch immer nicht wollte, legte ich mich in den Sack, aber schlafen konnte ich lange nicht, theils weil der Lappe (mein Schlafgefährte) sehr tief Athem holte, theils weil wir viel lachten, und weil die anderen Drei in dem anderen Sack einander die ganze Zeit hindurch neckten; als sie endlich still lagen, schliefen auch wir ein.
Als wir am nächsten Morgen erwachten und Kaffee getrunken und gegessen hatten, bekam ich Lust auf Rennthierjagd zu gehen, weil das Wetter so gut war und weil ich nicht müßig sein mochte.
Da Peter sagte, daß er noch keine Rennthiere gesehen habe, wollte ich ihn veranlassen, mich zu begleiten, weil aber seine Büchse naß war, wollte er es nicht. Gegen Vormittag ging ich denn, obwohl es ein Sonntag (7. Oktober) war. Wäre ich auf meinem Winterplatz Umanak gewesen, so würde ich an dem Tage kaum auf Erwerb ausgegangen sein, aber ich hatte so große Lust, den vier Fremden etwas Fleisch zu verschaffen, selbst wenn es nur ein Hase war.
[S. 239]
Während des Gehens erinnerte ich mich des Tages „daß der Sonntag Gott unserm Herrn gehört, und da betete ich denn ohne zu zweifeln: Unser täglich Brot gieb uns heute u. s. w.“ Wollten doch alle Christen, die auf Erwerb ausgehen, ohne zu zweifeln so beten!
Langsam ging ich den Berg hinauf, als ich ungefähr oben angekommen war, blickte ich in eine Kluft hinab und glaubte da unten in dieser Kluft einige zusammengekauerte Rennthiere sitzen zu sehen. Da ich vermuthete, daß es Rennthiere seien, blieb ich eine Zeit lang still sitzen und sah es an, als es sich aber gar nicht rührte, wurde ich zweifelhaft, ob meine Vermuthung wohl richtig sei und ging deshalb direkt hinunter, um zu sehen, was es sein könne. Als ich weiter hinunter kam, fing die Rennthierschar an zu laufen, ein großer Hirsch mit seinen Kühen und mehrere andere befanden sich darunter.
Ich war so ärgerlich auf mich selbst, daß ich zu mir sagte: „Ich Dummrian, daß ich mich nicht ordentlich vorsah! Da habe ich mir wieder durch meine Blindheit geschadet.“
Sie liefen anfänglich ziemlich schnell, standen aber bald darauf still; ich verhielt mich ganz ruhig und verlor sie nicht aus den Augen. Nach einer Weile liefen sie unten um den Berg herum, auf dem ich mich befand; als sie an mir vorübergekommen waren — das Rennthierkalb zu hinterst, ging ich weiter, um zu sehen, wo sie seien, da sah ich sie ein wenig unterhalb des Berges auf der anderen Seite. Sie kamen heran, die Kuh zuerst, aber sie war ziemlich weit von mir entfernt. Der Hirsch hinterher, ein wenig näher an mich heran. Da zielte ich auf ihn, obwohl ich die Kuh weit lieber gehabt hätte, und traf ihn, aber die Kugel streifte nur seine Keule; ich lud zum zweitenmal, lief hinterher und traf ihn, so daß er verendete. Nach den anderen Rennthieren sah ich mich nicht mehr um, weil ich glaubte, daß ich sie nicht mehr erreichen würde.
Nachdem ich dem Thiere die Haut abgezogen und einen Theil des Fleisches unter einigen Steinen geborgen hatte, packte ich das, was ich mitnehmen wollte, in das Fell und begab mich dann heimwärts, ohne mich weiter umzusehen, ob noch mehr Rennthiere in der Nähe waren. Eine kleine Strecke vor mir lief ein großes weißes Rennthier gerade über den Weg und eine Strecke weiterhin noch ein sehr großes, aber ich fand, daß sie zu weit weg waren, um auch sie zu schießen.
Als ich ganz von dem Berg heruntergekommen war, war es Nachmittag geworden, und als ich in die Nähe des Zeltes kam, wollte ich erst einen Schuß abfeuern, wie wir Grönländer es zu thun pflegen, wenn wir ein großes Rennthier erlegt haben, da die Bewohner des Zeltes aber Europäer waren, und da ich nicht viel Pulver übrig hatte, gab ich es auf. Es war Niemand im Zelt, weswegen ich mich eine Weile ganz ruhig verhielt. Peter kam zuerst aus dem Zelt heraus, und als er mich sah, fragte er, ob ich ein Rennthier geschossen habe, als ich diese Frage[S. 240] bejahte, ging er in das Zelt hinein und theilte Denen da drinnen, so gut er konnte, die Neuigkeit mit, als sie hinauskamen, starrten sie mich an.
Da ging ich ganz zu ihnen hinab, sie waren sehr, ja sogar außerordentlich froh, ich gab ihnen die eine Keule und sagte, sie sollten sie kochen, außerdem erhielt Lieutenant Dietrichson etwas Mark und Talg, weil er angefangen hatte, so viel von mir zu halten. Als ich Kaffee getrunken und gegessen hatte, erzählte der alte Lappe, während das Rennthierfleisch kochte, daß er selber 300 Rennthiere besäße.
Obgleich es nicht gar gekocht war, fingen sie schon an, von dem Fleisch zu essen, sie sagten zu Peter und mir, wir sollten mit aus dem Kessel essen, ich gab ihnen etwas mehr Fleisch zu kochen, es wurde allmählich, während es gekocht wurde, durch neues Fleisch ersetzt und so weiter, bis Niemand mehr von uns essen konnte.
Als wir uns zur Ruhe legten, fingen sie wieder an, einander zu necken. Weil ich sehr müde war, sagte ich zu Peter: „Nun geht es wohl wieder mit der Neckerei los, ich bin so müde, und sie wissen doch, daß es heute Feiertag ist.“ Dann sagte ich zu ihnen: „Heute ist Feiertag.“
Nach einer Weile, als sie beinahe still waren, begannen Peter und ich verschiedene Gesänge zu singen, die wir gelernt hatten, allmählich schwiegen sie ganz still und der Jüngere der Lappen begann ebenfalls einen Gesang zu singen.
Als wir aufwachten, gingen Peter und ich hin, um den Rest von dem Fleische meines Rennthiers zu holen, als wir uns unserem Zelt näherten, begann der Himmel wieder sich mit Wolken zu beziehen. Wir brachten das Fleisch zu unseren Kajaks hinab, sobald wir aber dort angekommen waren, kamen die Lappen zu uns, ich gab ihnen abermals ein Stück Fleisch zum Kochen und kehrte mit ihnen nach dem Zelt zurück. Später bekamen sie den Rücken und den Hals des Rennthieres zu essen.
Wir fingen an, uns da zu langweilen, weil es anfing zu regnen, und noch immer kein Boot kam, um uns zu holen. Am schlimmsten war es mit unserm Schuhzeug, obwohl wir Beide zwei Paar Schuhe bei uns hatten, waren sie beide ganz entzwei, so daß wir schließlich auf jeden Fuß einen verschiedenen Kamik ziehen mußten.
Wir fingen an, davon zu reden, daß wir versuchen wollten, sobald das Wetter gut würde, aus dem Fjord herauszukommen. Wir sagten den Europäern, daß wir am Abend wieder in unseren Kajaks schlafen wollten, weil wir des Morgens nicht so lange schlafen möchten wie sie, da es bei uns Grönländern keine Sitte sei. Weil sie nichts besonderes dagegen einzuwenden hatten, gingen wir an das Ufer, um in unseren Kajaks zu schlafen. Als wir am nächsten Morgen erwachten und nach dem Zelt gingen, fragten sie uns, ob wir gut geschlafen hätten, und als wir ja dazu sagten, dankten sie.
Am Abend, als wir gegessen hatten, sagten wir ihnen gute Nacht[S. 241] und gingen wieder fort, um in unseren Kajaks zu schlafen, mit dem Vorsatz, daß, wenn das Wetter es am nächsten Tage gestattete, fortzureisen, denn unser Schuhzeug war in seinem jetzigen Zustand zu unbequem.
Am nächsten Morgen war das Wetter sehr schön mit blauem Himmel, und da machten wir uns reisefertig. Wir fingen an, das Fleisch etc. zu ordnen, das wir mitnehmen wollten und waren beinahe damit fertig, als wir plötzlich draußen vom Fjord her einen Schuß vernahmen, gerade als die Sonne im Begriff war aufzugehen. Wir waren noch nicht ganz sicher, ob wir recht gehört hatten oder nicht, aber kurz darauf hörten wir wieder einen und dann mehrere Schüsse, da beantwortete ich den Schuß, ging nach dem Zelt hinauf und sah dann unten im Fjord die Böte mit einer ganzen Menge Menschen.
Es war sehr erfreulich für uns, als wir die Böte sahen, weil wir gefürchtet hatten, daß sie nicht kommen würden.
Es war ein Boot und ein Frauenboot, und als wir versammelt waren, war es sehr erfreulich, da wir nun ja wußten, daß wir Alle nach Godthaab kommen würden. Der Lappe Balto machte Kaffee, als er kochte, trank ich ihn und wollte dann fortgehen, aber Peter rief mir etwas zu; ich wandte mich um und erfuhr nun, daß sie wollten, ich sollte mit ihnen essen. Wir aßen uns da reichlich satt und tranken unsern Kaffee dazu.
Als sie sich zur Abreise anschickten und die Besatzung der Böte ihre Sachen zu den Fahrzeugen hinunterbrachten, gingen wir wieder zu unseren Kajaks hinab; nachdem wir sie belastet hatten, sah ich nach den Böten, und entdeckte da, daß sie schon im Begriff waren über den Fjord zu setzen, da ruderten wir zu ihnen hin und erreichten die entgegengesetzte Seite des Fjordes (die Sonnenseite), dort trank die Besatzung wieder Kaffee und aß, und dann zogen wir weiter; obwohl sie die letzte Nacht gar nicht geschlafen hatten, wollten die Ruderer doch lieber die Reise fortsetzen. Erst als wir an die Landzunge gekommen waren, beschloß die Besatzung des Frauenboots ihr Zelt aufzuschlagen und die Nacht dort zu bleiben, namentlich weil die Felle des Frauenboots zu naß waren, sie waren zu lange im Wasser gewesen, ohne zu trocknen, deshalb hielten wir es für gefährlich, wenn sie nicht ein wenig trockneten, auch wollten wir einige Löcher zunähen, welche in das Frauenboot gekommen waren. Ich blieb ebenfalls die Nacht da, um beim Aufziehen des Frauenboots und beim Hinablassen ins Wasser am nächsten Morgen zu helfen.
Mitten in der Nacht ging ich aus dem Zelt heraus, und als ich sah, daß es stilles Wetter war, fand ich, daß es vortheilhaft sei, die Reise fortzusetzen, weshalb ich sie weckte und sagte, daß es am besten sei, wenn wir uns nun aufmachten. Während der Kaffee gekocht wurde, belasteten wir das Boot und zogen dann weiter.
Bald näherten wir uns dem „Nunangiak“, da fing es an ein wenig zu wehen, als wir späterhin am Tage nach „Tuapagsuak“ kamen, [S. 242] ging ich voraus, um zu sehen, wo das hölzerne Boot geblieben sei, denn ich wußte nicht, wo die Anderen waren, ob sie die Reise fortgesetzt oder ein Zelt für die Nacht aufgeschlagen hätten.
Ich fing nämlich an, mich nach Hause zu sehnen, es war ja auch lange her, seit ich von dort fort war, im Sommer bleibe ich freilich oft lange von Hause fort, wenn ich auf Erwerb aus bin, aber dann habe ich immer einen Gefährten von meinem eigenen Heimathsort mit mir, mit dem ich zusammengehe.
Als es anfing ordentlich hell zu werden, und ich nach Tuaparsunguit hinkam, sah ich das Boot und das Zelt dort; sie waren gerade aufgestanden; als ich am Ufer anlegte, kam Peter zu mir herab und zog mich aufs Land hinauf. Er erzählte mir, daß sie Thee machten, es war ja auch sehr kalt, ein ziemlich frischer Ameralik-Ostwind wehte; wir tranken Thee und aßen, die Europäer freuten sich, als sie mich wiedersahen.
Als wir gegessen hatten, zogen wir weiter, als wir Kingiktorsup erreicht hatten, lachten Kristiansen und ich einander zu, weil wir nun glaubten, Godthaab noch am selben Tag erreichen zu können.
Als wir nach dem Uokusightsaps-Vorgebirge kamen, gingen Peter und ich voraus, um dem Leiter der Expedition einen Brief zu bringen, den sie geschrieben hatten.
Als wir uns Godthaab näherten, vermutheten die Bewohner dort, daß wir es seien, weshalb sie sich versammelten. Als wir landeten und sie in der Nähe sahen, kamen mehr und mehr Menschen herbei, die Grönländer sehnten sich sehr nach dem Anblick der Lappen, und als sie hörten, daß ich ein großes Rennthier geschossen hatte, wurden sie ganz eifrig, und ich hörte nichts weiter als die Bitten, ihnen Allen doch ein Stück Talg zu geben. Als Peter nach seinem Hause hinaufging, beglückwünschte ich ihn, ich beneidete ihn, daß er so weit gekommen war. Dort tranken wir Kaffee und gingen dann zu dem Direktor hinab, weil wir glaubten, daß wir unsere Bezahlung gleich erhalten würden; nach einer Weile hörten wir sie rufen, daß sich die Lappen näherten (d. h. daß sie von den Häusern aus gesehen werden konnten), deswegen ging ich nach Lars Heilmanns Haus hinüber und trank Kaffee bei seiner Frau (ich pflege nämlich, wenn ich in der Kolonie übernachte, in diesem Hause zu schlafen).
Nachdem ich Kaffee getrunken hatte, ging ich mit all den anderen Menschen hinab, um sie am Ufer landen zu sehen. Da sich die Europäer und Grönländer dort unten versammelten, wurde es eine große Schaar von Menschen; bald darauf kam das Frauenboot, welches die Sachen der Fremden an Bord hatte, und da sich dort auch mein Rennthierfleisch etc. befand, ging ich an das Ufer hinab, um es in Empfang zu nehmen. Nachdem ich einen Theil unter den Grönländern vertheilt hatte, verkaufte ich den Rest sehr vortheilhaft.
Für das Fleisch, das die Europäer im Fjord verzehrt hatten, erhielt [S. 243] ich 5 Kronen, für die Ausführung der Reise erhielt ich 20 Kronen, für den Rennthierkopf 3 Kronen, für das Fell 4 Kronen 50 Øre, für den Rest ungefähr 18 Kronen. Als ich all das Geld bekommen hatte, dachte ich stark daran, mir eine Büchse zu kaufen, das war schon lange das Ziel meiner Wünsche gewesen, aber ich hatte bisher nicht Geld genug gehabt, um mir eine zu kaufen; ich habe freilich eine alte Büchse, im Jahre 1874 tauschte ich mit Volontär Irmingers Hagelflinte (er verunglückte in einer Kajak) und erhielt eine ältere Büchse dafür; dieser Irminger wird den Grönländern wohl bekannt sein, damals als er umkam, war ich bei ihm.
Ich kaufte mir also eine Flinte und will nun meine alte Büchse an meinen Pflegesohn schenken, damit er sich damit üben kann, er ist 17 Jahre alt und für uns, die wir am Fjord wohnen, ist es von großer Wichtigkeit, eine Büchse zu haben, sowohl für Rennthiere als für Seehunde und alles andere Gethier.
Ich übernachtete in Godthaab, aber ich war nicht recht froh, denn die Mitglieder der Expedition quälten mich unablässig, ihnen das Fell des Rennthieres, das ich geschossen hatte, zu verkaufen, und ich wollte es am liebsten selbst behalten, da es ein herrliches, dickhaariges Fell war, worauf es sich im Winter, wenn es kalt ist, gut liegt. Ich erlegte ja freilich im August ein großes Rennthier, aber das Fell desselben war so dünne, daß ich es nicht als Kak (d. h. Unterlage auf der Pritsche) zurecht machen ließ.
Als sie dreimal kamen und fragten, ob sie es kaufen könnten, glaubte ich nicht länger nein sagen zu können und verkaufte es also.
Dann sagte ich zum Direktor, ich wollte eine Büchse kaufen und erhielt eine solche ausgeliefert.
Als ich den Handel abgeschlossen hatte, wollte ich reisen, denn ich sehnte mich sehr danach nach Hause zu kommen, aber der Nordostwind zwang mich, noch eine zweite Nacht in der Kolonie zuzubringen, da ich nicht gern bei Kasigiganguik passiren wollte, theils wegen des Windes, theils weil ich so viel in meinem Kajak mitzunehmen hatte.
Am Morgen des nächsten Tages, als ich aufstand, war das Wetter besser, und der Wind hatte sich gelegt. Da reiste ich denn über Konok in meine Heimath.
[S. 244]

 ls wir nun Alle versammelt waren, handelte es sich darum, uns in den
Bequemlichkeiten zurechtzufinden, die vorhanden waren. Freilich wußten
wir noch nicht ganz bestimmt, ob wir den Winter dort zubringen würden,
aber wir mußten doch auf jeden Fall für eine Weile ein Dach über
dem Kopfe haben. Dietrichson, Sverdrup und ich wurden
gastfrei im Hause des Kolonialdirektors aufgenommen, während die drei
Andern ein Zimmer oben in der sog. „alten Doktorswohnung“ erhielten.
Sie führten hier ihren eigenen Hausstand und bereiteten ihr Essen
selbst auf einem kleinen Kochofen.
ls wir nun Alle versammelt waren, handelte es sich darum, uns in den
Bequemlichkeiten zurechtzufinden, die vorhanden waren. Freilich wußten
wir noch nicht ganz bestimmt, ob wir den Winter dort zubringen würden,
aber wir mußten doch auf jeden Fall für eine Weile ein Dach über
dem Kopfe haben. Dietrichson, Sverdrup und ich wurden
gastfrei im Hause des Kolonialdirektors aufgenommen, während die drei
Andern ein Zimmer oben in der sog. „alten Doktorswohnung“ erhielten.
Sie führten hier ihren eigenen Hausstand und bereiteten ihr Essen
selbst auf einem kleinen Kochofen.
Die Neuangekommenen waren natürlich lange Gegenstand großer Aufmerksamkeit von seiten der Grönländer.
Ueber seine Ankunft berichtet Balto:
„Am ersten Abend, als wir Licht im Zimmer angezündet hatten — wir hatten keine Gardinen vor den Fenstern —[S. 245] kam eine große Menge von grönländischen Mädchen vor das Fenster und guckten uns an, so lange wir wach waren, und sie kamen jeden Abend wieder, so lange keine Gardinen vor den Fenstern waren.“
Es währte nicht lange, so waren wir Alle auf einem guten Fuß mit den Eingeborenen und erhielten viele Freunde unter ihnen. Bei den Dreien in der Doktorswohnung war ein stetes Zuströmen von grönländischen Gästen. Da wurde Karten und Violine gespielt, da wurde vom frühen Morgen bis zum späten Abend geredet. Balto führte natürlich das große Wort. Er übernahm die Pflichten eines Wirths, wie er selber sagen würde, „ganz und gar allein“. Er unterhielt die andächtig lauschenden Grönländer theils in seinem gebrochenen Norwegisch, das sehr bald einen Anflug von Dänisch erhielt, theils in einem ohrenzerreißenden Grönländisch. Er hatte sehr bald eine Menge von dieser schwierigen Sprache aufgeschnappt und warf höchst ungenirt mit den fremden Worten um sich. Das Thema seines Vortrages, der von einem Ueberfluß an erklärenden Gebärden und Zeichen begleitet war, handelte bald von unserm Zug über das „Sermersuak“, d. h. das große Landeis, — wie wir Norweger, die seiner Meinung nach richtige Teufelskerle waren, es verstanden hatten, den Weg durch diese große Schneewüste zu finden, wo es keinen Kaffee gab und nur des Sonntags eine Pfeife Tabak, — bald von den entsetzlichen Gefahren, die wir im Treibeis zu bestehen hatten, „wo diese Norweger rohes Fleisch aßen und wir Lappen beinahe bange (= sehr bange) waren.“
Dies alles interessirte natürlich die Grönländer sehr, am meisten aber, glaube ich doch, packte es sie, wenn er das Thema seines Vortrages aus seiner Heimath wählte, wenn er ihnen erzählte und zeigte, wie „wir Lappen mit Rennthieren fahren“[S. 246] und wie „man lebt und Kleider im Lande näht“. Das war etwas, was einen Anklang an das eigene Leben der Grönländer hatte, das konnten sie verstehen. Sicher verstehen nur Wenige von ihnen Dänisch oder Norwegisch, aber Gebärden sind nun einmal eine Universalsprache, die Allen zugänglich ist.
Kristiansen nahm eine zurückhaltendere Stellung ein und überließ dem Gefährten gern die Rolle des Repräsentanten, denn für das Reden war er nicht sehr. Handelte es sich dagegen um die Karten, so war er stets dabei, während der alte Ravna still umherging und nicht viel Gefallen an dem Ganzen fand. Er klagte mir oft seine Noth: „Ich alter Lappe mag die vielen Menschen nicht.“ Wenn die Stube ganz voll von rauchenden, speienden, spielenden, quäkenden Grönländern war, saß er entweder ganz still in einer Ecke auf seinem Bett und setzte ein höchst unglückliches Gesicht auf, oder auch er schlich hinaus und machte einen Besuch in irgend einem Grönländerhause, wo er stets willkommen war und wo er sich auf eine Bank setzte. Dort saß er einige Stunden und sah, ohne ein Wort zu sagen, vor sich nieder, worauf er wieder seiner Wege ging. Weshalb er dies so gemüthlich fand und weshalb er dieses Manöver jeden Tag wiederholte, ist mir noch jetzt ein Räthsel.
Dieser Mangel an Uebereinstimmung zwischen Ravna und seinem jüngeren Kameraden ist übrigens ganz erklärlich, wenn man bedenkt, daß er ein alter ehrwürdiger Familienvater war, während Balto und Kristiansen jung und lebenslustig waren. Ich muß jedoch bemerken, daß es — soweit ich es beurtheilen kann — stets ordentlich auf ihrem Zimmer zuging. Ihr Besuch gehörte ausschließlich dem männlichen Geschlecht an. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, wurde bestimmt, daß keine Frau dorthin kommen dürfe. Auf die Weise wurde die Moral des Ortes am besten gesichert, die Grönländerinnen sind leider[S. 247] nicht wegen allzu strenger Sitten bekannt. Uebrigens herrschte, soviel ich weiß, in der Beziehung das beste Verhältniß zwischen ihnen und den Mitgliedern der Expedition.
Dies strenge Verbot gegen das weibliche Geschlecht konnte es jedoch nicht verhindern, daß sich Balto sehr heftig in eine junge, anziehende, schöne Grönländerin verliebte. Zu seinem Kummer war sie jedoch schon mit einem grönländischen Katecheten verlobt, der zu der Zeit in einer nördlicher gelegenen Kolonie angestellt war, und mit dem sie sich im nächsten Jahre verheirathen sollte. Dies verhinderte jedoch nicht, daß sich zwischen Balto und seiner geliebten Sophie ein schönes und äußerst platonisches Verhältniß entwickelte. Es war eine ganz romantische Geschichte, die so weit ging, daß Balto Sophie einen langen Brief sandte, den ein Grönländer ihm in die grönländische Sprache übersetzen half. In diesem Brief erzählte er ihr von seiner Liebe, er liebe sie sehr, aber sie dürfe diese seine Liebe nicht mißverstehen. Es sei nicht seine Absicht, sich mit ihr zu verheirathen, nicht allein, weil sie bereits verlobt sei (denn das würde sie sicher ebensowenig davon abhalten, wie es ihn abhalten würde), sondern weil sie es nicht gut haben würde, wenn er sie mit sich in das Land der Lappen führen wollte, nämlich infolge der Sitten des fremden Volkes, d. h. der Lappen, — und wenn er hier in diesem Lande bleiben wollte, so würde er sich nach seinen Freunden und Angehörigen in Karasjok zurücksehnen. Deshalb wolle er ihr jetzt Lebewohl sagen und ihr sagen, daß er sie gern habe, daß er sich aber nicht mit ihr verheirathen wolle.
Ueber diesen Brief freute Sophie sich sehr, wie auch ihre Mutter sehr stolz darauf war, daß Balto Gefallen an Sophie fand. Sie sprach es sehr offen aus, daß sie weit lieber Balto zum Schwiegersohn haben wolle als den Katecheten. Dieser[S. 248] Brief hatte jedoch keinen weiteren Einfluß auf ihr Verhältniß, sie waren nach wie vor gleich viel zusammen, und wenn Balto anfing von Sophie zu reden, da erreichte seine Beredsamkeit ihren Höhepunkt. Sie sei nicht wie die Anderen, sie sei so verschämt und zurückhaltend, sie renne nicht auf dem Kolonieweg hinter den Männern her, wie es die anderen Mädchen thäten.
Als er Grönland verließ, ließ er einen Theil seines Herzens zurück. Der Abschied von Sophie war schwer. Auf der Rückreise über das Meer gedachte er ihrer mehrmals, und erst in Kopenhagen verließ ihn die Erinnerung an sie.
Am ersten Sonntag Abend nach der Ankunft der Gefährten fand im Tanzlokal der Kolonie — einer Böttcherwerkstatt — ein Tanzvergnügen statt. Es ist wohl nicht nöthig, mitzutheilen, daß alle Mitglieder der Expedition, mit Ausnahme von Ravna, bei dieser Gelegenheit zugegen waren, wie überall, wo getanzt wurde, und das war häufig der Fall.
Es ist nicht so ganz leicht, den Eindruck zu beschreiben, den der Anblick tanzender Grönländerinnen, ja auch der tanzenden Grönländer auf mich machte. Die malerischen, bunten Trachten in diesen dichten, wogenden Haufen, die vielen schönen Formen in starker Bewegung, die strahlenden Gesichter, in denen jede Muskel Leben war, die eifrigen Stimmen, das ansteckende Gelächter, die gewandten kleinen Beine und Füße in weißen, rothen und blauen Kamikkern, die vorzügliche Taktfestigkeit, mit der sie ihren „Reel“, ihre „Sekstur“ und die vielen anderen Tänze traten, — jeder Zoll des Raumes war Leben und Bewegung!
Das alles war für uns Inlandsmenschen etwas so eigenthümlich Neues, etwas so Anziehendes, ja so Bezauberndes, daß wir unwillkürlich mit fortgerissen wurden. Es war, als ob wir plötzlich entdeckten, welch’ Sprudeln von Freude und Lebenslust[S. 249] das Leben im Grunde doch enthält. Bei diesem Volk ist die Freude noch nicht vergessen.
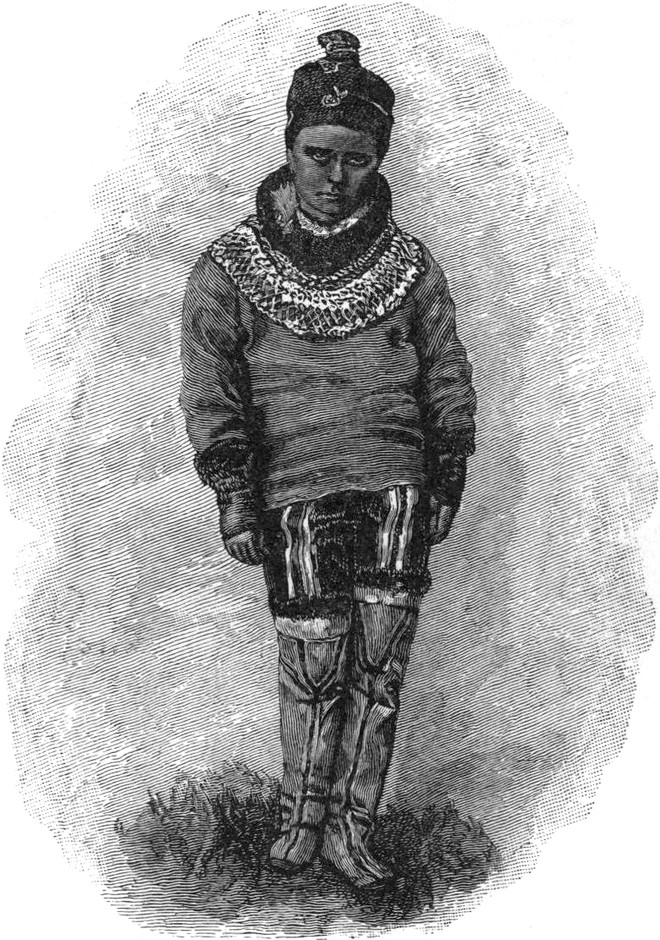
Die Art und Weise, wie man in Grönland tanzt, ist sehr wohlthuend. Man thut es wirklich, um die Glieder zu rühren und den Sinn aufzufrischen. Alles und Alle werden mit fortgerissen, sowohl Diejenigen, welche tanzen, wie die Zuschauer, keine süßsauren Anstandsdamen, keine steifen, verunzierten Gestalten mit langen Schleppen, keine blasirten Herren in schwarzen Schniepeln und weißen Halsbinden, keine Handschuhe, — kurz, nichts von all dem Unsinn, der in einem europäischen Tanzsalon[S. 250] sich durcheinanderbewegt, verlassen von allen Grazien, verlassen von allen guten Geistern, — du lieber Gott! Wie würden die Grönländer uns auslachen, wenn sie die traurige Vorstellung sähen, die wir einen europäischen Ball in der feinen Welt nennen.
Es währte selbstverständlich nicht lange, daß wir nur Zuschauer waren, und unsere völlige Unkenntniß mit den meisten Tänzen war durchaus kein Hinderniß. Wir wurden ohne weiteres von den kleinen Grönländerinnen fortgezogen und an den rechten Platz gepufft. Man wartete nicht verschämt, bis man engagirt wurde, sie waren scheinbar alle stolz, wenn sie sich eines der Mitglieder der Expedition bemächtigt hatten — was in der Regel nicht schwierig war. Ebenso unbarmherzig aber lachten sie uns auch aus, wenn wir verkehrt oder ungeschickt tanzten, was wir natürlich im Anfang sämtlich thaten. Man konnte sogar noch lange Zeit nachher mehrere der Ausgelassensten unter ihnen draußen auf dem Wege und vor den Häusern vor den Freundinnen tanzen sehen, wobei sie unsere Manieren und Eigenthümlichkeiten so täuschend nachzuäffen wußten, daß wir uns sofort wiedererkannten, wenn wir zufällig vorüberkamen, was dann eine allgemeine Munterkeit erregte. Die Grönländer haben einen merkwürdig scharfen Blick für alles Komische. Wir waren indessen sehr eifrig beim Tanzen und nach einiger Uebung lernten es Einige von uns so gut, daß wir uns förmlich in Respekt setzten. Die Lappen waren dagegen sehr ungeschickt dabei. Sie haben selber keine Tänze, und Ravna war nicht zu bewegen, mitzugehen und zuzusehen. Balto sah zu und betheiligte sich am Tanzen, aber er war und blieb eine Karikatur, er mochte sich im „Reel“ oder im Rundtanz versuchen. Er spreizte die Beine und hüpfte umher wie ein Hampelmann, während die Grönländer sich halbtodt[S. 251] lachten. Dies schreckte ihn jedoch nicht im geringsten zurück, er trat gern als Leiter des Balles und als Vortänzer auf, arrangirte den Tanz und theilte Jedem mit, was er zu thun habe. An Unternehmungslust und Selbstvertrauen fehlte es ihm selten.
Die grönländischen Tänze sind keine Nationaltänze. Sie sind zum größten Theil „Reeler“, die von englischen und amerikanischen Walfischfängern eingeführt wurden, die aber so sehr in den Geschmack der Grönländer fielen, daß sie überall an der Westküste aufgenommen sind und einen gewissen nationalen Zuschnitt erhalten haben. Außerdem werden auch Rundtänze, wie Walzer, Polka etc. getanzt, doch stehen diese nicht in so hohem Ansehen.
Die Einzigen unter den Grönländern, die nicht tanzen oder die vielmehr nicht tanzen dürfen, denn sie tanzen trotzdem, sind die sog. deutschen Grönländer, die zu den herrnhutischen Gemeinden gehören. Nach der Lehre der herrnhutischen Missionare ist das Tanzen nämlich eine große Sünde, und so sind denn diese Menschen kurzsichtig genug gewesen, diesem Volk eins seiner wenigen Vergnügen zu untersagen. Man hat vielleicht geglaubt, auf diese Weise die Moral der jungen Mädchen zu beschützen, aber ich habe nicht gehört, daß es damit in den deutschen Gemeinden besser stehen soll als im übrigen Grönland. Hiergegen wird man vielleicht einwenden, daß sie ja trotz des Verbotes tanzen.
Wie dem nun auch sein mag, so glaube ich, daß Jedem, der den Tanz der Grönländer gesehen oder theil daran genommen hat, die Augen dafür aufgegangen sein müssen, welch’ eine gesunde und herrliche Zerstreuung das ist, wie auch Niemand dafür blind sein kann, daß es ein schöner Anblick ist, und an manchem Abend haben wir Mitglieder der Expedition die Sünde begangen, uns zusammen mit diesen kindlichen Menschen[S. 252] zu ergötzen, während der Boden unter den taktfesten Tritten erzitterte und der Spielmann auf der Hobelbank saß und seine Fiedel strich, bis die Saiten sprangen.
Die erste Zeit, die wir in Godthaab verbrachten, war außerordentlich gemüthlich für uns, die wir über das Inlandseis gekommen waren. Dänen sowie Grönländer thaten alles, um uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen, und wir können wohl Alle mit Balto sagen, daß wir gar bald „das harte Leben und alle Trübsal vergaßen“, wie wir auch sämtlich so auffallend an Leibesfülle zunahmen, daß behauptet wurde, man könne das Zunehmen unseres Umfanges von einem Tage zum andern sehen.
Trotz alledem gab es doch eins, was uns verhinderte, uns ganz wohl zu fühlen, nämlich die Ungewißheit, ob wir den Winter über dort bleiben sollten. Wir hatten freilich nur geringe Hoffnung, daß unser Kajakbote den „Fox“ erreichen würde, aber es war doch, als ob wir von einem Tag zum andern darauf warteten, ein Schiff mit vollen Segeln und rauchendem Schornstein am Horizont auftauchen zu sehen. Und dies Gefühl hielt lange vor, man ging einher und wartete, daß sich etwas ereignen würde.
Das Schiff kam aber in jenem Herbst nicht mehr, und ich hatte mich schon längst mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß der „Fox“ unsere Botschaft nicht erhalten habe. Sverdrup und ich hatten uns sogar schon lange mit einem anderen Gedanken getragen. In der Kolonie befand sich nämlich eine alte Yacht, die dem grönländischen Handel gehörte und die benutzt wurde, um Waaren aus der Kolonie nach den umliegenden Orten zu schaffen. Nun waren wir der Ansicht, daß, wenn wir diese Yacht bekommen könnten, es ein Leichtes für uns sein müsse, nach Amerika hinüberzusegeln und auf dem Wege nach Hause[S. 253] zu gelangen. Dieser Plan strandete indessen an dem Koloniedirektor, welcher nicht das Recht zu haben meinte, uns das königliche grönländische Handelsfahrzeug zu leihen, das, wie es im Reglement heißt, „die Kolonie niemals verlassen darf, außer zu amtlichen Zwecken.“ Und diese Reise nach Amerika gehörte kaum dahin. Folglich mußten wir bleiben, wo wir waren.
Da wurde eines Tages, als wir bei Tische saßen, gemeldet, daß man zwei Kajaks von Süden her kommen sähe. Und gleich darauf brachte man mir ein Bündel Briefe. Sie wurden in schweigendem Staunen geöffnet; Niemand begriff, was das zu bedeuten haben könne. Wie verwunderten wir uns aber, als es sich herausstellte, daß es Briefe von dem Betriebsdirektor Smitte und dem Koloniedirektor im Süden waren. Der erste Brief benachrichtigte mich, daß mein Bote den „Fox“ im letzten Augenblick erreicht habe. Das Schiff habe die Kolonie am Tage vorher verlassen, um nach Europa zu gehen, dann aber habe der Sturm sie gezwungen, gleich in der Nachbarschaft einen Nothhafen zu suchen. Am andern Tage wollten sie gerade die Anker lichten, als sie in der Ferne zwei Kajakmänner erblickten, die in voller Fahrt auf das Schiff zukamen und winkten, daß man warten möge. Auf die Weise erhielt der Kapitän meinen Brief; er unterzog sich sogar noch der Mühe, zu dem Betriebsdirektor zu fahren und mit ihm zu berathschlagen, was zu machen sei, obwohl nach seiner Ansicht keine Rede davon sein konnte, daß der „Fox“ nach Godthaab ging. Dann kamen die Beiden überein, daß es eine Unmöglichkeit sei, der Kapitän kannte das Fahrwasser nicht, man fürchtete sich vor den dunklen Nächten, und das entscheidende Argument war, daß sich 40 Passagiere an Bord befanden, Arbeiter aus dem Kryolithbruch, die in die Heimath zurück wollten. Da wagte man es nicht, sich der Gefahr eines Schiffbruches[S. 254] dort oben auszusetzen, wodurch die 40 Passagiere gezwungen sein würden, in Godthaab zu überwintern. Das wäre ein solcher Zuwachs an Konsumenten geworden, daß es möglicherweise sehr ernste Folgen in Gestalt von Hungersnoth etc. nach sich gezogen haben würde.
Das Endresultat war, daß der „Fox“ ohne uns abging, aber meinen Brief an Etatsrath Gamél und Sverdrups Brief an seinen Vater mitnahm.
Hätten die beiden Kajakmänner ein wenig langsamer gerudert, so wäre keine Nachricht von uns in die Heimath gelangt. Welche Helden wären wir da geworden, mit welchem Jubel würde man unsere Rückkehr ins Leben begrüßt haben, wenn wir im Frühling aus unseren Eisgräbern auferstanden wären, — im Grunde war also wohl die Schnelligkeit unserer Boten ein Unglück für uns und für die Zeitungsschreiber.
Wie es dem „Fox“ mit seiner theuren Botschaft auf dem Heimwege erging, damit will ich mich nicht weiter aufhalten, sondern nur erwähnen, daß er infolge von Kohlenmangel gezwungen wurde in Skudenäs in Norwegen anzulaufen, wodurch denn unser Vaterland unseren ersten Gruß erhielt. Ich will auch nicht beschreiben, wie es der Botschaft erging, die also am 9. November 1888 nach Europa gelangte.
Ich bin fest überzeugt, daß der geehrte Leser das noch in guter Erinnerung hat und daß er eine weit lebhaftere Schilderung von diesem weltgeschichtlichen Ereigniß würde geben können als meine schwache Feder es vermag, um so mehr, als ich in Grönland saß und keine Ahnung davon hatte, zu welchen Riesengestalten wir an jenem Tage in den Augen der Welt plötzlich wurden.
Nachdem wir die sichere Nachricht erhalten hatten, daß die letzte Möglichkeit, die Heimath noch in diesem Jahre zu erreichen,[S. 255] zu Wasser geworden war, machten wir uns mit dem Gedanken vertraut, hier oben zu überwintern. Es war ganz selbstverständlich, daß wir allmählich in nähere Berührung mit den Eingeborenen kamen und immer mehr Interesse für sie gewannen.
Wir lernten nicht allein die Eskimos in Godthaab und Neu-Herrnhut kennen, sondern wir reisten auch nach den anderen, in der Nähe gelegenen Kolonien. So machten Einige von uns mit dem Koloniedirektor im Oktober einen Ausflug nach Kangek, das 2½ Meilen von Godthaab entfernt liegt, und im November nach dem südlich vom Ameralikfjord gelegenen Narsak.

Ich selber benutzte den größten Theil des Winters zum Studium ihres eigenthümlichen Lebens. Ich lebte mit ihnen in ihren Hütten, machte mich mit ihrem Fang, ihren Sitten und ihrer ganzen Lebensweise vertraut, ich erlernte, so gut es in[S. 256] der kurzen Zeit ging, ihre schwierige Sprache. Hierin erhielt ich im Anfang tüchtige Anleitung von dem Arzt des Ortes.
Da wir uns nun eine ganze Weile mit ihnen beschäftigen werden, liegt es nahe, dem Leser gleich im Anfang zu erklären, was ein Eskimo ist. Indem ich dies in einem speciellen Kapitel thue, will ich die Bemerkung vorausschicken, daß diese Schilderung keineswegs Anspruch darauf macht, nach irgend einer Richtung hin erschöpfend zu sein. Es liegt in der Natur der Sache, daß ein einwinterlicher Aufenthalt, wie sehr man auch die Zeit ausnutzen mag, bei weitem nicht hinreichend ist, um eine gründliche Kenntniß eines so eigenthümlichen Volkes, ihrer Denkart und Kultur zu erlangen; dazu bedarf es eines jahrelangen, anstrengenden Studiums. Es ist nur die flüchtige Skizze eines Reisenden, zu der ich einige der Eindrücke vereinte, die ich von dem Eskimo und seinem Leben erhalten habe. Es mag viel Fehlerhaftes in meiner Auffassung sein und vieles, was schon bekannt ist; doch mögen hier und da möglicherweise Bemerkungen über Dinge mitgetheilt sein, die dem Neuangekommenen, Durchreisenden in die Augen fallen, die aber dem vieljährigen Beobachter verloren gehen. Mag man nun in vielen Punkten meine Ansichten theilen oder nicht, so hoffe ich, daß man meine Bemerkungen in dem Geiste auffassen wird, in dem sie ausgesprochen sind, selbst wenn ich nicht immer die übliche Landstraße innehalte und alles Bestehende vorzüglich finde; ich hoffe, daß man Nachsicht mit mir haben wird, wenn ich schwach genug bin, Trauer über ein sinkendes Volk zu empfinden, das vielleicht nicht zu retten ist, denn es ist bereits von dem giftigen Stachel der Kultur gestochen; zu meiner Entschuldigung mag es dienen, daß kaum Jemand unter dieser Bevölkerung wird verweilen können, ohne Anhänglichkeit für dieselbe zu fassen.
[S. 257]
 er Eskimo gehört einem der merkwürdigsten lebenden Völkerstämme an,
er liefert einen schlagenden Beweis dafür, daß sich der Mensch den
Naturverhältnissen anpaßt und sich über die Erde verbreitet. So weit
wie man bis zum Nordpol vorgedrungen ist, ist man auf Spuren dieses
widerstandsfähigen Volkes gestoßen.
er Eskimo gehört einem der merkwürdigsten lebenden Völkerstämme an,
er liefert einen schlagenden Beweis dafür, daß sich der Mensch den
Naturverhältnissen anpaßt und sich über die Erde verbreitet. So weit
wie man bis zum Nordpol vorgedrungen ist, ist man auf Spuren dieses
widerstandsfähigen Volkes gestoßen.
So kraß, wie sich der Eskimo durch seine ganze Lebensweise, durch seine sinnreichen Geräthschaften, sein Aussehen und seinen Körperbau von allen anderen Volksstämmen unterscheidet, so gleichartig sind in jeder Beziehung die verschiedenen Eskimostämme untereinander. Ein ungemischter Eskimo von der Beringsstraße ist einem Ostgrönländer so sprechend ähnlich, daß man keinen Augenblick darüber im Zweifel sein kann, daß die Beiden derselben Rasse angehören. Auch ihre Sprache hat eine so auffallende Aehnlichkeit, daß ein Alaskaeskimo und ein Grönländer sicher ohne große Schwierigkeiten eine Unterhaltung miteinander führen könnten.
Kapitän Adrian Jakobsen, der Grönland und Alaska bereist hat, erzählte mir, daß er sich in dem letztgenannten Lande mit dem wenigen Grönländisch, das er konnte, zu behelfen vermochte.[S. 258] Und diese Völker sind durch mehr als 600 geographische Meilen — eine Strecke, die der Entfernung von London bis zum Sudan gleichkommt — getrennt. Eine solche Einheit in der Sprache bei so fern voneinander wohnenden Volksstämmen ist wohl einzig dastehend in der Geschichte der Menschheit.
Die Aehnlichkeit, welche nach jeder Richtung hin unter den Eskimostämmen herrscht, läßt darauf schließen, daß sie ursprünglich ein kleiner Stamm gewesen sind, der sich erst in späteren Zeiten über die jetzt von ihnen bewohnten Länder verbreitet hat.[43]
Daß sie sich über diese in verhältnißmäßig kurzer Zeit haben verbreiten können, ohne doch wie bei den größeren Völkerwanderungen in Horden aufgetreten zu sein, ist leicht erklärlich, wenn man bedenkt, daß ihre jetzige Heimath zu den ungastlichsten Ebenen unserer Erde gehört, zu Ebenen, die kaum jemals bewohnt gewesen sind, jedenfalls nicht für beständig, bis die Eskimos sie in Besitz nahmen, und wo sich ihrer Ausbreitung folglich nichts anderes als die Natur selber feindlich gegenübergestellt hat.
Der Strich, den die Eskimos jetzt bewohnen, erstreckt sich von der Westküste der Beringsstraße über Alaska, Nordamerikas Nordküste, die nordamerikanischen arktischen Inselgruppen und die Westküste Grönlands bis an dessen Ostküste.
Durch seine abgesonderte Stellung hat der Eskimo den Anthropologen viel Kopfzerbrechen verursacht, und über seine Zukunft haben sich die widerstreitendsten Ansichten geltend gemacht.
Es ist hier nicht der Ort, tiefer auf dies Thema einzugehen, das noch längst nicht abgeschlossen ist. Nur soviel läßt[S. 259] sich mit annähernder Sicherheit sagen, daß die Eskimos zuletzt von der an der Beringsstraße oder dem Beringsmeer gelegenen Küste (möglicherweise von der amerikanischen Seite) gekommen sind und sich von dort aus östlich über das arktische Amerika bis Grönland ausgebreitet haben.
Dr. Rink, der sich das Studium Grönlands und der Eskimos zur Lebensaufgabe gemacht hat, und der ohne Frage die größte Autorität auf diesem Gebiete ist, meint, daß die Waffen der Eskimos und ihre Geräthschaften jedenfalls im wesentlichen aus Amerika stammen. Er hält es für möglich, daß die Eskimos einmal im Innern von Alaska gewohnt haben, wo sich noch eine nicht geringe Anzahl von „Inlandseskimos“ findet. In verhältnißmäßig später Zeit soll ein Theil derselben nach den Küsten des Beringsmeeres oder Eismeeres ausgewandert sein, entweder von den Schätzen des Meeres[44] gelockt oder von feindlichen, kriegerischer gesonnenen Indianerstämmen vertrieben.[45]
Rink weist ferner nach, wie die Nordwestindianer sowohl auf dem festen Lande jagten, als auch Fischfang auf den Seen und Flüssen in ihren Kanoes aus Birkenrinde betrieben. Dasselbe müssen denn auch die ursprünglichen Inlandseskimos gethan haben,[46] und in ihren Kanoes sind sie wahrscheinlich auf die Nordwestseite Alaskas zu seewärts gezogen. Je weiter sie kamen, desto spärlicher wurden die Waldungen, so mußten sie denn darauf sinnen, ein Ersatzmittel für die Baumrinde zum Beziehen ihrer Kanoes zu finden, und da ist es denn nicht unwahrscheinlich,[S. 260] daß sie sich schon auf den Flüssen der Felle der gefangenen Seethiere bedient haben, denn noch jetzt sieht man Beispiele davon bei einzelnen Indianerstämmen.[47]
Erst als die Eskimos mit Seegang und Flußmündungen in Berührung kamen, fingen sie allmählich an, ihren Böten ein Deck zu geben, bis sie schließlich die Oberfläche ganz überzogen. Damit war der Kajak fertig, der auch in seiner ganzen Form und seinem Bau mehr an die indianischen Birkenkanoes als an jegliche andere nordasiatische Bootsform erinnert.[48]
An der Küste angelangt, entdeckten sie, daß ihre Existenz im wesentlichen von dem Seehundsfang abhängig sei, sie setzten infolgedessen ihre ganze Kraft darauf ein und die Kajaks führten zu der Erfindung der zahlreichen eigenartigen und bewunderungswürdigen Geräthschaften zum Kajakfang, die sich zu immer größerer[S. 261] Vollkommenheit entwickelten. Das Material zu diesen Geräthschaften erhielten sie abermals aus Amerika, indem die indianischen Pfeile mit den Steuerfedern, welche für die Landjagd benutzt wurden, ihnen die erste Wurfwaffe für die Seejagd lieferten. Solche kleine Harpunen oder Wurfpfeile mit Steuerfedern sind noch heutzutage auf dem südlichen Theil der Westküste von Alaska in Gebrauch.
Wenn man in nördlicher Richtung an dieser Küste entlang geht, so verschwinden die Vogelfedern jedoch bald, und eine kleine an dem Harpunenschaft befestigte Blase tritt an ihre Stelle. Man sah sich genöthigt, solche Mittel anzuwenden, um dem Untertauchen und dem Schwimmen der Seehunde ein Hinderniß in den Weg zu legen, ferner hielt man es für nothwendig, die Spitze so einzurichten, daß sie bei den Bewegungen des Seehundes nicht abbrach, sondern abfiel und in einem Riemen am Schaft hängen blieb. Auf die Weise entstand der sogenannte Blasenpfeil, der allen Eskimos bekannt ist.
Hieraus hat sich möglicherweise auch die sinnreiche Harpune mit Fangriemen und Blase entwickelt. Um größere Seethiere zu fangen, wurde die Blase dann größer und größer gemacht, der Uebelstand aber, daß sich dadurch ein zu großer Luftwiderstand bildete, so daß der Pfeil nicht weit und mit genügender Kraft geworfen werden konnte, hat sich bald eingestellt.
[S. 262]
Man trennte ihn dann von der Harpune und ließ ihn nur mit derselben oder vielmehr mit deren Spitze, von der er abfällt, mit einer langen, starken Leine, dem Fangriemen, verbunden sein; die Harpune selber wurde von nun an allein geworfen, den Riemen nach sich ziehend, die Blase warf man erst aus, nachdem das Thier getroffen war.[49]
Das zweiblättrige Kajakruder hat sich möglicherweise auch aus dem einblättrigen Ruder der Indianer entwickelt. Bei den Eskimos im südlichen Alaska findet man auch nur ausschließlich solche; erst auf der Nordseite des Jukonflusses trifft man zweiblättrige Ruder, die einblättrigen sind aber doch noch überwiegend. Weiter nach Norden und Osten zu findet man beide Formen, bis das zweiblättrige Ruder östlich vom Mackenzieflusse die Alleinherrschaft erhält.
Die Aleuten — ein Seitenzweig der Eskimos — scheinen wunderbarerweise nur die zweiblättrigen Kajakruder zu kennen.[50]
Die Kenntniß der asiatischen Eskimos ist in dieser wie in anderen Beziehungen spärlich, es scheint, als ob sie im wesentlichen nur zweiblättrige Ruder haben.[51]
Dies alles scheint also auf den Zusammenhang der Eskimos mit den Indianern hinzudeuten. Ein Geräth indessen unterscheidet[S. 263] ihn deutlich von diesen und nähert ihn den asiatischen Nomadenvölkern, nämlich der Hundeschlitten.
Wenn man die Inka-Peruaner ausnimmt, die das Lama als Lastthier benutzen, so kannte die amerikanische Urbevölkerung die Benutzung der Thiere zum Ziehen oder Tragen nicht. Allerdings hatten die Indianer eine Art halbgezähmter Hunde, aber diese wurden kaum zu irgend etwas verwendet. Der Schlitten und das Hundefuhrwerk bringt folglich den Eskimo Asien beträchtlich näher. Auch sollen die Hunde der Eskimos (nach Lütke)[52] dem kamtschadalischen Hund sehr ähnlich sein.
Die Anwendung des Hundes zum Ziehen verräth zweifelsohne einen hohen Grad der Entwickelung, und dieser Zug läßt den Zusammenhang der Eskimos mit den asiatischen Polarvölkern als sehr glaubhaft erscheinen. Es muß jedoch gleichzeitig hervorgehoben werden, daß die Eskimos selber das Rennthier niemals gezähmt und zum Ziehen benutzt haben, obwohl in ihren Sagen die Rede davon ist. Dagegen ist dies der Fall bei den meisten asiatischen Polarvölkern. Die Kamtschadalen bilden freilich eine Ausnahme, wodurch sie sich abermals den Eskimos nähern.
Es ist indessen nicht undenkbar, daß die Eskimos, die im übrigen einen so ausgeprägt erfinderischen Geist haben, selber auf den Gedanken gekommen sind, Zugthiere abzurichten und Schlitten anzufertigen.
Wenn sie noch keine Hunde gehabt haben, so haben sie möglicherweise den Polarwolf gezähmt, und es kann sein, daß ihre Hunde von diesem abstammen; einzelne der eskimoischen Sagen scheinen auch hierauf hinzudeuten. In diesem Falle würden also die Asiaten das Benutzen der Hunde zum Fahren[S. 264] von den amerikanischen Eskimos gelernt, wie auch von ihnen ihre Hunde erhalten haben.
Ein Geräth, welches den Eskimo sowohl von den Indianern Nordamerikas, wie von den asiatischen Völkern unterscheidet, ist das Wurfbrett.
Merkwürdigerweise kennt man nur in wenigen Gegenden — wahrscheinlich nur in dreien — diese höchst sinnreiche Erfindung, durch welche die Länge und die Kraft des Armes bedeutend erhöht wird, indem es wie eine Schleuder wirkt, — nämlich in Australien, wo das Wurfbrett sehr primitiv ist, im Lande der Coniboer und Picouer in dem oberen Amazonendistrikt, wo es ungefähr auf derselben Stufe steht wie in Australien, und endlich in den von den Eskimos bewohnten Ländern, wo es seine höchste Entwickelung erreicht.[53] Es ist kaum anzunehmen, daß das Wurfbrett an so verschiedenen Stellen erfunden worden ist. Um welche Zeit die Eskimos Grönland erreichten und sich für immer dort niederließen, ist meiner Meinung nach unmöglich zu bestimmen. Daß es wahrscheinlich erst spät geschah, geht aus dem bereits Gesagten hervor, es scheint mir aber durchaus nicht bewiesen, daß sie erst im 14. Jahrhundert an der grönländischen Westküste eingewandert sind, wie man aus den isländischen Sagen schließen will. Allerdings scheint es, daß die norwegischen Kolonien Vesterbygden und Österbygden erst um diese Zeit den ernsthaften Angriffen der Skrällinger (Eskimos) ausgesetzt gewesen sind, die in Horden aus dem Norden herangezogen kamen; deswegen können sie aber lange vor jener Zeit, ja lange vorher, ehe die Norweger nach Grönland kamen, dort ansässig gewesen sein. Sie scheinen in[S. 265] den ersten 400 Jahren, während die Norweger dort ansässig waren, nicht auf dem südlichen Theil der Küste gewohnt zu haben (bei Öster- und Vesterbygden), da nichts davon in den Sagen erwähnt wird, aber es wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die ersten Nordländer (Erik der Rothe u. A.), die sowohl nach Öster- wie nach Vesterbygden kamen, menschliche Wohnungen, Ueberreste von Böten und Steingeräthschaften fanden, so daß man daraus schließen konnte, daß die Skrällinger oder Eskimos früher dort gehaust hatten, und da man solche Ueberreste in beiden Ansiedelungen fand, liegt die Annahme ja nahe, daß sie sich nicht grade auf flüchtigen Besuchen dort aufgehalten haben. Es ist keine Unmöglichkeit, daß sich die Eskimos Hals über Kopf aus dem Staube gemacht haben, als die Schiffe der Vikinger herangesegelt kamen, daß dies aber so schnell geschehen sein sollte, daß die Nordländer sie nicht zu Gesicht bekamen, erscheint mir nicht wahrscheinlich. Ich neige mehr zu der Annahme, daß die Eskimos damals ihre festen Wohnsitze weiter nordwärts an der Küste, nördlich vom 68° N. Br. gehabt haben, wo sich eine reiche Seehunds- und Walfischjagd findet, und wohin sie auf ihrer Wanderung nach Norden (vgl. unten) zuerst gekommen sind.[54]
Von diesen ihren festen Wohnsitzen aus haben sie auf Eskimoart häufig kürzere oder längere Besuche nach dem südlicheren Theil der Westküste gemacht und dort ihre Spuren hinterlassen. Als die Norweger während ihres Aufenthalts im Lande gen Norden streiften, trafen sie schließlich mit den Eskimos zusammen. Prof. G. Storm[55] ist der Ansicht, daß[S. 266] dies erst im 12. Jahrhundert geschehen ist.[56] Die „Historia Norvegiae“ berichtet, daß die grönländischen Jäger in den unbewohnten Gegenden des nördlichen Grönland kleine Menschen trafen, welche sie Skrällinger nannten, und die steinerne Messer und Pfeilspitzen aus Fischbein benutzten. Nachdem die nördlichen Ansiedelungen übervölkert wurden, rückten die Eskimos gen Süden, und da die Norweger überall, wo sie ihnen begegneten, feindlich auftraten, haben sie vielleicht um das Ende des 14. Jahrhunderts Vergeltung geübt, indem sie zuerst (nach 1331) Vesterbygden angriffen und zerstörten und später im Jahre 1379 einen Raubzug nach Österbygden unternahmen; in dem dann folgenden Jahrhundert scheinen sie diese Kolonien gänzlich zerstört zu haben.[57] Um diese Zeit sollen also die Eskimos zuerst festen Fuß in dem südlichen Theil des Landes gefaßt haben.
Daß zwischen den alten Norwegern und den Eskimos Kämpfe stattgefunden haben, darüber haben sich auch bei den Letzteren mehrere Sagen erhalten. (Vergl. Rink, eskimoische Märchen und Sagen.) Daß aber die Eskimos förmliche Raubzüge[S. 267] unternommen haben sollen, scheint sehr wenig mit ihrem jetzigen Charakter in Einklang zu stehen. Daher kann ein Ausrottungskrieg wohl kaum der Grund zu dem Verfall der Kolonien gewesen sein; möglicherweise hat die Mischung der Kolonisten mit den Eskimos seinen Theil dazu beigetragen, da die Europäer der damaligen Zeit kaum weniger empfänglich für den Liebreiz der Eskimoschönheiten gewesen sein werden, als es die jetzigen sind.
Ueber den Weg, auf welchem die Eskimos nach der Westküste Grönlands eingewandert sind, hat eine große Meinungsverschiedenheit geherrscht. Dr. Rink stellt die Behauptung auf, daß die Eskimos, indem sie über den Smithsund kamen, nicht in südlicher Richtung an der Westküste entlang gezogen sind, was das Natürlichste zu sein scheint, sondern daß sie nördlich um die Nordspitze des Landes herumzogen und an der Ostküste herunterkamen, von hier aus sollen sie dann später ihren Weg südwärts um die Südspitze des Landes bis zu der Westküste genommen haben. Diese Annahme basirt im wesentlichen darauf, daß Thorgils Orrabeinsfostre die Eskimos an der Ostküste traf, — und dies war das erste Mal, daß die Norweger mit ihnen zusammenstießen. Auf die Unzuverlässigkeit dieses Berichts ist bereits bei früherer Gelegenheit aufmerksam gemacht worden. Uebrigens steht eine solche Annahme von der Einwanderung der Eskimos in direktem Widerspruch mit den Berichten der Sagen, indem aus denselben hervorgeht (vergl. oben), daß die Eskimos von Norden her und nicht aus dem Süden kamen (Vesterbygden wurde vor Österbygden zerstört). Noch ein anderer Umstand deutet meiner Meinung nach auf die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Wanderung hin, — wenn sie nämlich in nördlicher Richtung um die Nordspitze des Landes vorgedrungen sein sollen, so müssen sie während der Zeit, in welcher sie sich dort oben befanden, wie die arktischen Hochländer[S. 268] gelebt haben (d. h. wie die Eskimos bei Kap York und nördlich davon), sich wesentlich von der Jagd auf dem Eise ernährend, mit Hundeschlitten fahrend und weder Kajaks noch Frauenböte besitzend, da das stets mit Eis bedeckte Meer den Kajakfang und den Gebrauch der Böte fast zur Unmöglichkeit macht. Daß sie sich dann, wenn sie wieder in südlichere, eisfreie Gewässer an der Ostküste kamen, abermals Frauenböte und Kajaks gebaut haben, ist freilich an und für sich nicht unmöglich, da sie die Tradition wohl bewahrt haben müssen, daß sie aber, nachdem sie mit dem Kajakfang außer Uebung gekommen waren, diesen wie die dazu gehörigen Geräthschaften sogar zu einer größeren Vollkommenheit entwickeln konnten, als in anderen Gegenden, das muß denn doch unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich genannt werden.
Meiner Meinung nach ist es die natürlichste Erklärung, daß die Eskimos, als sie über den Smithsund kamen — und diesen Weg müssen sie natürlich eingeschlagen haben — südwärts an der Küste entlang zogen und sich dann später um die Südspitze des Landes herum bis an die Ostküste begaben. Ob dies Letztere bereits geschehen ist, ehe die Norweger nach Grönland kamen, wissen wir nicht.
Auf ihrem Wege nach Süden vom Smithsund aus stellte sich ihnen ein großes Hinderniß in Gestalt des Melville-Gletschers (ungefähr auf dem 76° N. Br.) entgegen; derselbe geht direkt in das Meer hinaus, dort, wo die Küste eine lange von Inseln unbeschützte Linie bildet; aber einestheils haben sie auf der Innenseite des Treibeises in ihren Fellböten vordringen können, und anderntheils sind diese Schwierigkeiten jedenfalls nicht größer als diejenigen, welche mit einer Wanderung nördlich um das Land herum verbunden sein würden.
Freilich wird diese letztere Annahme ein wenig dadurch erschwert,[S. 269] daß die Eskimos der Ostküste Hunde und Hundeschlitten haben, welche an der südlichen Westküste nicht benutzt werden. Bedenkt man indessen, wie verhältnißmäßig schnell die Eskimos in ihren Frauenböten reisen und wie sie in früheren Zeiten an der Küste auf und ab streiften, so liegt die Annahme nahe, daß die Hunde von demjenigen Theil der Westküste Grönlands, wo sie noch heute benutzt werden (Holsteinborg und das nördlicher gelegene Land), bis zum Kap Farvel mitgebracht worden sind, selbst wenn die südlicher wohnenden Völker die Hundezucht aufgegeben hatten, was freilich nicht anzunehmen ist, wenn man bedenkt, daß die Eskimos noch heute an der ganzen Westküste entlang Hunde halten. Wenn im wesentlichen auf Grundlage von Eigenthümlichkeiten die Behauptung aufgestellt ist, daß die Eskimos der Ostküste mehr Verbindung mit den Alaska-Eskimos gehabt haben sollen, als mit den Eskimos der Westküste (auf dem Wege nördlich um Grönland herum), da scheint die Einwendung nahe zu liegen, daß in diesem Falle ihre Sprache den Ersteren näher stehen müsse, was jedoch keineswegs der Fall ist.
Die jetzige Ausbreitung der Eskimos an der Westküste von Grönland erstreckt sich vom Smithsund bis zum Kap Farvel. Ihre Zahl in dem dänischen Theil der Westküste beläuft sich auf ca. 10000. An der Ostküste wohnen, wie wir von der dänischen Frauenboot-Expedition (1884–1885) wissen, Eskimos bis zu der Angmagsalik-Gegend (auf dem 66° N. Br.). Nördlich davon wohnten, wie die Eskimos Kapitän Holm mittheilten, soweit es ihnen bekannt war, keine für beständig.
Indessen werden häufig Reisen nach dem Norden unternommen, wahrscheinlich bis zum 68. oder 69. Breitengrad, und vor einigen Jahren hatten zwei Frauenböte den Weg eingeschlagen, ohne daß man später je wieder von ihnen gehört hätte. Ob nördlich vom 70. Breitengrad noch Eskimos wohnen,[S. 270] weiß man nicht mit Bestimmtheit. Clavering fand i. J. 1823 bekanntlich zwei Familien ungefähr auf dem 74° N. Br., seit jener Zeit hat man aber keine wieder gesehen, und die deutsche Expedition, die i. J. 1869–70 an dieser Küste entlang reiste und dort überwinterte, fand wohl Häuser und andere Ueberreste, welche die Eskimos dort hinterlassen hatten, aber keine Menschen, weshalb man annahm, daß diese ausgestorben seien. Dies kommt mir jedoch ziemlich unwahrscheinlich vor, denn die Eskimos sind eine sehr widerstandsfähige Rasse; daß man dort kein lebendes Wesen antraf, muß einen anderen Grund haben. Sie können grade zu jener Zeit weiter nordwärts oder gen Süden gezogen sein, und selbst, wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, so wohnen sie oft so zerstreut, daß man ihnen ganz zufällig nicht begegnet sein mag. Man darf nicht vergessen, um welche ungeheuren Strecken zerklüfteten Landes es sich hier handelt, auch ist es nicht sicher, daß, selbst wenn man in die Nähe ihres Aufenthaltsortes gekommen ist, man sie dort angetroffen hat, denn sie sind sehr furchtsamer Natur und können das Weite gesucht oder sich versteckt haben, und ihre Zelte und Häuser sind in einiger Entfernung nicht leicht zu entdecken. Meiner Meinung nach können noch heute sehr wohl Eskimos an jener Küste wohnen, und infolge ihrer abgesonderten Stellung, die jegliche direkte oder indirekte Verbindung mit der civilisirten Welt unmöglich gemacht hat, müssen diese zu den in ethnologischer Hinsicht interessantesten Völkern der Erde gehören.
Das Aussehen der ursprünglichen Eskimos hatte ich bereits früher Gelegenheit zu schildern.
Sie haben, wie dort gesagt wurde, ein breites, gutmüthiges[S. 271] Gesicht mit großen Zügen, kleine, dunkle, zuweilen ein wenig schrägliegende Augen, eine flache Nase, runde, fette Wangen, einen breiten Mund und starke Kiefern. Auf Schönheit können sie infolgedessen ja eigentlich keinen Anspruch machen, und doch können die ursprünglichen Eskimogesichter etwas sehr Anziehendes haben. Die Mischrasse, die durch Kreuzung von Europäern und Eskimos entstanden ist, pflegt hübscher zu sein als die ursprüngliche Rasse. Diese Mischeskimos haben in der Regel ein gewisses südländisches, zuweilen auffallend jüdisches Aussehen, mit dunklem Haar, dunklen Augenbrauen und theilweise sehr bräunlicher Hautfarbe. Es kommen häufig ganz edle Schönheiten[S. 272] unter ihnen vor, sowohl bei dem starken wie bei dem schwachen Geschlecht. Ein Beispiel dieser grönländischen Mischrasse findet sich auf Seite 203.
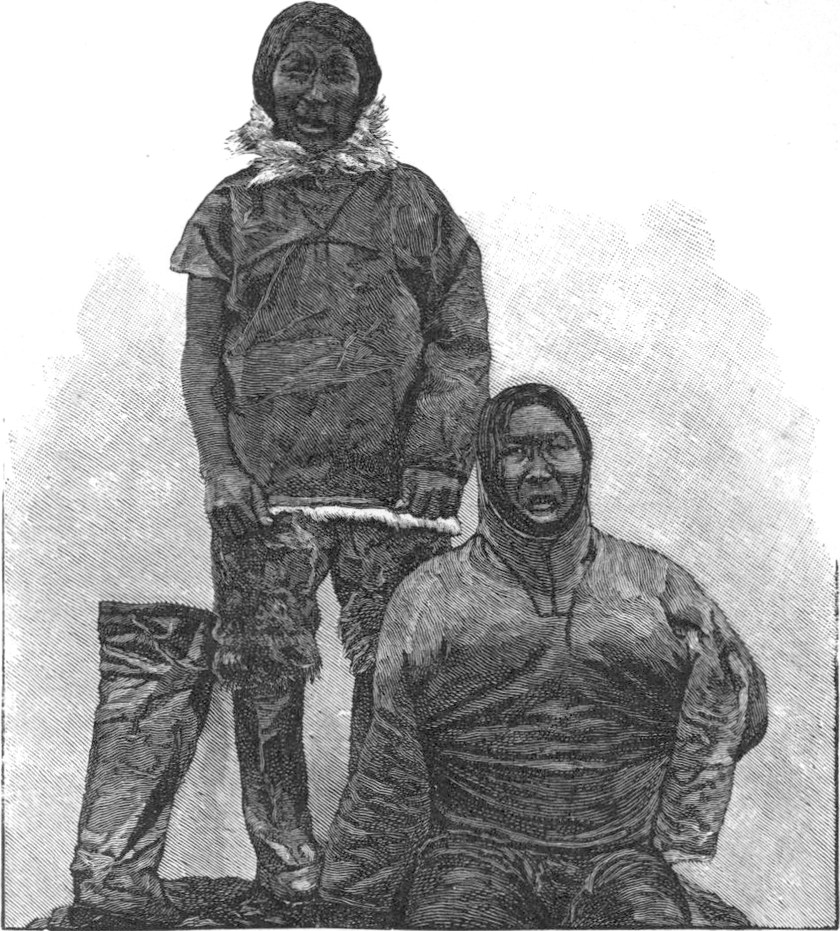
Die Hautfarbe ist bei den ursprünglichen Grönländern bräunlich oder bläulichgelb, und selbst bei den Mischlingen kann eine fast kastanienbraune Farbe vorkommen. Die neugeborenen Kinder sind heller, aber schon Saaby hat darauf aufmerksam gemacht, daß sie einen blauschwarzen Fleck auf dem Rückenkreuz haben, von dem sich die dunkle Farbe dann später verbreitet. Holm erwähnt etwas Aehnliches von der Ostküste,[58] ich selber habe indessen keine Gelegenheit gehabt, mich davon zu überzeugen, was das Gewöhnliche ist; es wird ein ähnliches Verhältniß sein, wie bei den Kindern der Japanesen.
Ueber die Kleidung der Eskimos wird man sich nach den in diesem Werke enthaltenen Illustrationen einen Begriff bilden. Die Männer in Südgrönland tragen auf dem Oberkörper einen sog. Timiak aus Vogelfell. Auf dem Lande verwendet man meistens das Fell der Eidergans, aus dem die Federn ausgerupft sind, so daß nur die Daunen sitzen bleiben, in den Kajaks dagegen Pelze aus Dohlenfell. Auch das Fell von Graculus carbo oder Scharf wird angewendet, das letztere ist das stärkste und beste von allen. Ueber dem Timiak haben sie einen Ueberzug aus Stoff (Anorak). Der Timiak ist mit einer Kapuze versehen, die über den Kopf gezogen werden kann. Die Beine sind mit Beinkleidern von Seehundsfell oder von europäischen Stoffen bekleidet, an den Füßen tragen sie eine eigene Art von Stiefeln, „Kamikker“ aus Seehundsfell. Diese haben inwendig eine Art Strümpfe aus Fell mit nach innen gekehrten Haaren, nach außen bilden sie einen Stiefel aus wasserdichtem[S. 273] Fell. Die Füße stecken bloß in den Kamikkern. Die Bekleidung der Frauen ist derjenigen der Männer sehr ähnlich, auf dem Oberkörper tragen sie einen Pelz aus Vogelfell, doch ohne Kapuze, dagegen mit einem breiten Perlenkragen um den Halsausschnitt. Sowohl bei den Männern wie bei den Frauen ist der Pelz an Hals und Handgelenken mit Hundefell eingefaßt, vorzugsweise mit schwarzem. Die Beine stecken in Beinkleidern aus Seehundsfell, die jedoch kürzer sind als bei den Männern; sie sind an der Vorderseite reich mit farbigem Leder und weißen Streifen aus Rennthierleder oder Hundeleder verziert. Zuweilen bestehen die Beinkleider der Frauen auch aus Rennthierfell. Die Kamikker sind länger als bei den Männern und gehen bis über die Kniee. Sie haben in der Regel eine krasse Farbe, vorzugsweise sind sie roth, aber auch blau, violett und weiß. Sie sind an der Vorderseite mit einem herunterlaufenden Streifen verziert.
Ursprünglich trugen die Frauen lange Pelze aus Vogelfell oder Anoraks wie die Männer,[59] nachdem aber die Europäer sie die Benutzung der weißen Leinwand lehrten, fanden sie dies zu schön, um es zu verbergen, und statt ihre Gewandung wie die europäischen Damen oben auszuschneiden, brachten sie nach unten zu einen Ausschnitt an, indem sie die Anoraks so kurz machten, daß zwischen denselben und den Beinkleidern, die ganz unterhalb der Hüften sitzen, ungefähr ein handbreites Stück unbedeckt blieb, so daß die Leinwand sichtbar wurde.
[S. 274]
Die Eskimos an der Ostküste haben eine ähnliche Tracht, doch verwenden sie fast gar kein Vogelfell zu ihren Pelzen, sondern größtentheils Seehundsfell. Dasselbe ist auch sehr häufig im nördlichen Grönland der Fall.
Im Hause ging der ursprüngliche Eskimo, sowohl Mann als Frau, vollständig nackend, mit Ausnahme des bereits früher erwähnten Nâtit, eines Bandes, das um die Lenden gebunden wurde. Dasselbe ist noch jetzt an der Ostküste Gebrauch.

Dies ist natürlich eine sehr gute und gesunde Sitte, denn die Fellkleider hindern die Ausdünstung der Haut, und deshalb ist es besonders ungesund, sie in warmen Räumen zu tragen. Ein natürliches Bedürfniß hat sie veranlaßt, sich im Hause der Kleider zu entledigen, wenn sie sie dort überhaupt jemals getragen haben. Als die Europäer ins Land kamen, verletzte indessen[S. 275] diese Sitte deren Anstandsgefühl, und die Missionare besaßen so wenig Einsicht, daß sie dagegen predigten. So ist denn diese Sitte jetzt an der Westküste abgeschafft, ob sich dadurch aber die Moral verbessert hat, wage ich nicht zu entscheiden, — ich bezweifle es freilich sehr, eins aber ist sicher, der Gesundheitszustand ist nicht dadurch gehoben worden.
Die Westländer geniren sich noch heutzutage sehr wenig davor, sich zu entblößen. Viele decken sich freilich zu, sobald Europäer ihre Hütten betreten, meiner Ansicht nach ist dies aber mehr Ziererei, von der sie glauben, daß sie uns gefällt, als wirkliches Schamgefühl, denn sie verrichten im übrigen die undenklichsten Dinge auf die natürlichste Weise von der Welt, ohne sich zu geniren. Entdecken sie, daß ein Europäer ihre Versuche, schamhaft zu sein, gar nicht beachtet, so bemühen sie sich auch nicht mehr.
Die Frauen nehmen ihr Haar in einem Knoten oben auf dem Kopfe zusammen. Dies geschieht, indem sie es von allen Seiten fest zusammenbinden. An der Westküste umbinden sie es dann mit einem farbigen Bande: die unverheiratheten Frauen tragen ein rothes Band, haben sie Kinder gehabt, so tragen sie ein grünes, während die Farbe der verheiratheten Frauen blau ist. Das Band der Witwen ist schwarz; gehen sie mit dem Gedanken um, sich wieder zu verheirathen, so bringen sie ein wenig Roth auf dem schwarzen Bande an. Aeltere Witwen, welche die Hoffnung auf eine abermalige Verehelichung aufgegeben haben, legen oft ein weißes Band an. Bekommt eine Witwe ein Kind, so muß auch sie ein grünes Haarband tragen.
Die Grönländerinnen sind kaum weniger eitel als ihre europäischen Schwestern, und da es sich darum handelt, daß der Haarknoten so steif wie möglich in die Höhe stehen soll, so ziehen sie es so stramm in die Höhe, daß sie es aus der Stirn,[S. 276] aus den Schläfen und dem Nacken förmlich herausreißen, weswegen sie im Alter fast alle kahlköpfig werden und dann weniger anziehend sind. Man hat da den besten Maßstab für ihre Eitelkeit.
Um dem Haar einen recht schönen Glanz zu verleihen, pflegen sie es, wenn sie es aufstecken, in Urin zu baden. Sie sind auch der Ansicht, daß ihnen dieses einen eigenartigen, jungfräulichen Duft verleiht. In derselben Flüssigkeit waschen sie sich auch mit Vorliebe. Der Geruch, der ihnen infolgedessen anhaftet, ist, wenigstens für europäische Nasen, durchaus nicht angenehm. Ich habe von einem Europäer in Nordgrönland gehört, der sich in eine Grönländerin verliebt hatte, den Geruch konnte er jedoch nicht ertragen. Er half sich dadurch, daß er eine Ladung Eau de Cologne aus der Heimath verschrieb, und damit wurde die Geliebte jeden Morgen besprengt. Auf die Weise machte er es wirklich möglich, sich mit ihr zu verheirathen.
Da die Existenz der Grönländer ausschließlich auf dem Kajakfang beruht, der ihnen die Mittel für ihren Lebensunterhalt liefert, so scheint es mir ganz natürlich, bei der Schilderung ihres Lebens hiermit zu beginnen. Ich komme indessen später noch häufiger darauf zurück und will mich deswegen hier nur ganz kurz fassen.
Der Kajak besteht aus einem hölzernen Speilerwerk, das von außen mit Fell bezogen ist, vorzugsweise mit dem Fell der Phoca grönlandica oder der Klappmütze;[60] das Fell der[S. 277] letzteren wird jedoch nicht für so stark und wasserdicht gehalten, kann man dagegen Fell von jungen Klappmützen bekommen, in dem die Poren der Haut nicht so groß sind, so soll auch dies sehr zweckmäßig sein.

Für das Speilerwerk benutzte man in früheren Zeiten fast ausschließlich Treibholz, und für die Rippen außerdem Weidenzweige, die an der Küste wachsen. In den letzten Jahren hat man in den Kolonien an der Westküste angefangen, für die Kajaks europäische Schiffsränder von der grönländischen Handelscompagnie zu kaufen, obwohl man das Treibholz für ein besseres Material hält. Ein gewöhnlicher grönländischer Kajak pflegt ungefähr 15 Fuß lang und 18–20 Zoll breit zu sein. Er hat in der Mitte eine Höhe von ca. 5–6 Zoll. Die Größe richtet sich natürlich nach dem Manne. Auf der Unterseite ist er ziemlich flach und hat keinen Kiel. Nach dem Vorder- und Hinterende zu verjüngt er sich langsam. Der Kajak ist so leicht, daß er mit seinem ganzen Zubehör und allen Geräthschaften ohne Schwierigkeit meilenweit auf dem Kopfe über Land getragen werden kann.
[S. 278]
Es liegt klar auf der Hand, daß ein Fahrzeug von dieser Form schwer auf dem rechten Kiel gehalten werden kann, wenn man darin sitzt, dafür kann man es aber auch, wenn man die nöthige Uebung erlangt hat, mit Hülfe des zweiblättrigen Kajakruders mit erstaunlicher Schnelligkeit durch das Wasser vorwärtsbewegen, und der Kajak ist ohne Frage das beste existirende Fahrzeug für eine Person. Bei gutem Wetter benutzt der Kajakruderer den sog. Halbpelz, der mit seinem unteren Ende wasserdicht auf den Ring paßt, welcher das Loch umgiebt, in dem er sitzt, und der ihm mit seiner oberen Kante bis unter die Arme reicht. Dies genügt, um kleinere Wellen an dem Eindringen in den Kajak zu hindern. Bei schlechtem Wetter bedient man sich des ganzen Pelzes, der gleich dem Halbpelz aus wasserdichtem, enthaartem Seehundsfell gemacht und mit Sehnen zusammengenäht ist. Er umschließt gleichfalls den Kajakring nach unten zu, hat aber Aermel und eine Kapuze, die man ganz über den Kopf ziehen kann und die rund um das Gesicht zugeschnürt wird, wie auch die Aermel an den Handgelenken fest geschlossen werden. Mit diesem Pelz bekleidet, kann der Eskimo quer durch die heftigsten Sturzseen fahren, kann kentern und sich wieder aufrichten, ohne naß zu werden oder auch nur einen einzigen Tropfen Wasser in seinen Kajak zu bekommen.
Die zum Kajakfang nöthigen Geräthschaften habe ich bereits früher erwähnt, ich will mich hier nicht weiter damit aufhalten, sondern nur die Harpune nennen, die mit Riemen und Blase[61][S. 279] die wichtigste Waffe des grönländischen Fängers ist. Dieses äußerst sinnreiche Geräth zeugt von einem hohen Grade von Erfindungsgeist und steht in der Beziehung bedeutend über den meisten Geräthschaften, die man bei wilden oder halbwilden Völkerstämmen antrifft. Die Harpune besteht aus einem Schaft, dem Harpunenschaft, an dessen Vorderende eine 4–6 Zoll lange Fischbeinspitze durch eine eigene Verbindung oder ein Glied derartig befestigt ist, daß sie nach der Seite umgebogen werden kann. Diese Fischbeinspitze paßt wie ein Zapfen in ein Loch an der Spitze der Harpune selber; letztere ist an dem Fangriemen befestigt, der durch ein kleines Stück Fischbein, in dem ein Loch angebracht ist, ein Stück von der Mitte entfernt nach hinten zu mit dem Harpunenschaft verbunden ist; an dem anderen Ende des Fangriemens ist die Blase angebracht. Die Harpune wird, wie alle Waffen der Eskimos, mit Hülfe eines Wurfbrettes geschleudert.[62]
Um ein tüchtiger Kajakruderer zu werden, muß man früh anfangen. Die grönländischen Knaben versuchen sich oft schon im Alter von sechs und acht Jahren mit dem Kajak ihres Vaters, und in einem Alter von zehn bis zwölf Jahren giebt der tüchtige Fänger seinen Söhnen oft ein eigenes Boot — wenigstens war das früher die allgemeine Regel. Von der Zeit an fahren sie immer in ihren Kajaks, im Anfang pflegen sie Fische zu fangen, später beginnen sie auch mit dem schwierigen Seehundsfang. Um ihren Arm und ihr Auge zu üben, giebt der vernünftige Grönländer seinen Söhnen, noch während sie ganz jung[S. 280] sind, kleine Vogelpfeile und Harpunen als Spielzeug, und hiermit kann man die 3–4jährigen angehenden Fänger sich an Vögeln, an den Hühnern und Enten des Koloniedirektors und allem üben sehen, was ihrer Jägerlust würdig ist und ihnen vor die Augen kommt. Es ist natürlich von hoher Bedeutung für die grönländische Bevölkerung, daß die Jugend zu tüchtigen Fängern erzogen wird, denn darauf beruht ja die ganze Zukunft.
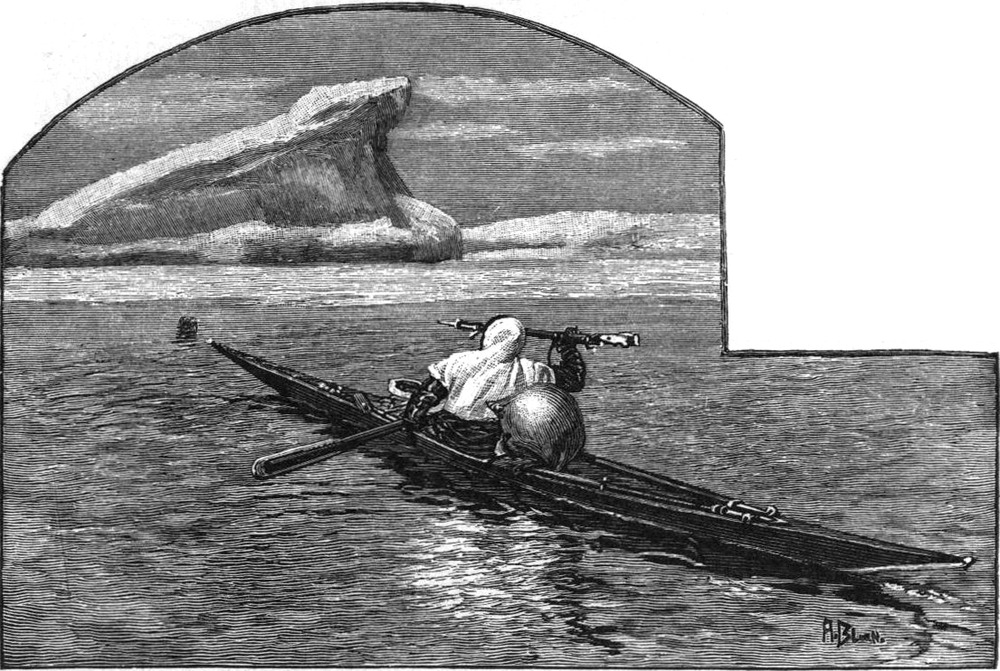
Die wichtigste Bedingung, um ein vollendeter Kajakruderer zu werden, ist die Erwerbung der Kunst, sich wieder auf den rechten Kiel aufrichten zu können, wenn man mit dem Kajak gekentert ist. Dies geschieht dadurch, daß man das Ruder an dem einen Ende ergreift, es auf die Seite des Kajak aufsteckt, so daß das andere Ende nach vorne zu auf die Spitze zeigt, und es dann schnell nach der Seite[63] hin umdreht,[S. 281] so nahe wie möglich dem Wasserspiegel, wobei man den Oberkörper fest gegen den Kajak preßt und sich dann mit dem Ruder in die Höhe hebt; kommt man nicht ganz in die Höhe, so ist noch ein Winkelzug mit dem Ruder erforderlich. Ein wirklich tüchtiger Kajakruderer richtet sich selbst ohne das Ruder vermittelst des Wurfbrettes oder auch ohne dies, nur mit Zuhülfenahme des einen Armes auf. Dies ist von großer Wichtigkeit, denn es kommt zuweilen vor, daß das Ruder beim Kentern verloren geht. Derjenige, welcher in dieser Kunst nicht bewandert ist, muß, falls Niemand in der Nähe sich befindet, um zu helfen in dem Augenblick, in welchem er kentert, als verloren angesehen werden. Das Kentern aber ist leicht genug möglich, eine einzige Sturzwelle oder das Festhängen des Fangriemens in dem Augenblick, wo ein Seehund harpunirt wird, kann ein solches Unglück veranlassen, oft genug geschieht es auch bei stillem Wetter durch eine einzige unbedachtsame Bewegung.
Gar mancher Eskimo findet jahraus, jahrein seinen Tod auf diese Weise. Als Beispiel mag hier angeführt werden, daß im Jahre 1888 von 162 in Südgrönland vorgekommenen Todesfällen 24 durch Ertrinken in dem Kajak verursacht waren, also 15%.
In früheren Zeiten verstand sich jeder tüchtige Kajakruderer an der Westküste Grönlands auf diese Kunst, in den letzten Jahren aber, nach Einführung der europäischen Civilisation und dem damit unvermeidlich in Zusammenhang stehenden Verfall ist es auch damit zurückgegangen. Es ist jedoch an manchen Stellen noch etwas ganz Gewöhnliches bei den Fängern; so kann ich aus eigener Erfahrung anführen, daß bei Kangek (in der Nähe von Godthaab) die meisten Fänger dieser Kunst mächtig waren. An der Ostküste scheint es nach Kapitän Holms Berichten etwas ganz Gewöhnliches zu sein, daß man im stande ist, sich wieder aufzurichten, obwohl es auch dort nicht mehr so allgemein ist,[S. 282] wie es früher an der Westküste war. Hierüber kann man sich ja auch gar nicht wundern, da es an der Westküste, wo nur wenig Treibeis und fast stets Seegang ist, vielmehr Zweck hat.
Ein Kajakruderer, der die Kunst, sich aufzurichten, vollkommen besitzt, kann jeglichem Wetter trotzen; wenn er umgeworfen wird, so richtet er sich eben wieder auf.
Sehr oft wird gegen den Eskimo die Beschuldigung ausgesprochen, daß er einen sehr feigen Charakter hat; dies hat seinen Grund theilweise darin, daß Diejenigen, welche dies sagen, ihn hauptsächlich auf dem Lande oder bei gutem Wetter auf der See gesehen haben, und da ist er zu gutmüthig oder theilweise auch zu bequem, um Muth zu zeigen; oft ist er auch wohl zu etwas aufgefordert worden, wozu er keine Lust oder keinen Verstand hat. Ich persönlich hege eine ganz andere Auffassung. Um zu entscheiden, ob ein Mensch groß ist, soll man ihn in seinem Wirkungskreis sehen, man muß deswegen den Eskimo bei schlechtem Wetter auf die See begleiten, ihn dort sehen, wo sein Beruf liegt, und man wird gar bald eine andere Ansicht von ihm erhalten. Wie aus dem eben Angeführten hervorgeht, führt der Kajakfang viele Gefahren mit sich, aber trotzdem und obwohl möglicherweise Vater und Brüder in dem Kajak umgekommen sind, geht der Eskimo tagaus tagein ruhig an seine Arbeit. Ist das Wetter gar zu stürmisch, geht er nicht gern hinaus, denn er weiß aus Erfahrung, daß in einem solchen Wetter Viele umkommen, ist er aber erst einmal draußen, so bewahrt er die größte Seelenruhe und fährt dahin, als sei es das Natürlichste von der Welt; es ist ein stolzer Anblick, ihn gegen die hohen Wellen ankämpfen zu sehen, die ihn ganz unter sich begraben, oder ihn wie einen Sturmvogel durch Wellen und Unwetter hindurchfliegen zu sehen mit der gleichgültigsten Miene von der Welt und einer ganz überlegenen Tüchtigkeit. Da ist er groß!
[S. 283]
Oder man muß ihn in seinem kleinen Kajak sehen, wie er mit der ihm angeborenen Ruhe die Klappmützen oder das Walroß angreift, das ihm jeden Augenblick den Tod bringen kann, wenn seine Hand nicht sicher ist. Dieser Anblick allein kann uns davon überzeugen, daß es ihm, wenn es darauf ankommt, nicht an Muth fehlt.
Ich will ein paar Beispiele von der Widerstandsfähigkeit der Eskimos anführen, wie von den Gefahren, die er tagtäglich zu bestehen hat, da mir das eine gute Hülfe zu sein scheint, wenn man seinen Charakter kennen lernen will.
Ein Kajakmann aus Tornait bei Fiskernaesst ging eines Tags im Februar d. J. 1876 gen Norden in See. Als er an den Fangplatz kam, tauchte vor ihm ein Seehund auf, er holte die Büchse aus dem Kajak, um zu schießen, die Kugel prallte aber ab und ging ihm selbst durch den Unterleib. Als er wieder zur Besinnung kam, stieg er auf ein Stück Eis und legte sich flach darauf nieder, dann aber erhob sich ein starker Nordwind, der die Wellen über die Eisscholle hinweg trieb, so daß er sich gezwungen sah in den Kajak zurückzugehen und gen Süden zu rudern, man muß sich aber — so heißt es in dem Bericht — über die Zähigkeit des Mannes verwundern, der sich mit seiner schweren Verletzung auf die See hinauswagte, man denke nur! er umschiffte die Inseln, erreichte die Heimath, zog sein Kajak ans Land und stellte ein Merkmal auf, dann aber sank er am Rande des Eises nieder, denn er vermochte nicht bis an die Häuser zu gehen, die eine Strecke vom Landungsplatz entfernt lagen. Als man ihn später fand und sein Kajak sah, konnte Niemand verstehen, daß er noch lebte, nachdem er einen so starken Blutverlust erlitten hatte. Als sie ihn hinaufgetragen hatten, glaubten sie, daß er die Nacht nicht würde überleben können, doch starb er erst am dritten Tage darauf!
[S. 284]
Sie sagten, er habe keine Angst vor dem Tode gehabt, sei aber gewesen wie Einer, dem eine große Gnade widerfahren sei.
Ein andermal, ebenfalls im Februar, waren sechs Fänger von Kangarmiut nach einem Walroß aus, und als sich ein Sturm erhob, zogen sie sich mit dem Walroß im Schlepptau auf eine kleine Insel am äußersten Rande des Meeres zurück. Diese Insel aber umtobte eine so heftige Brandung, daß sie in ihren Kajaks nicht in die See hinausgehen konnten, ohne zurückgeworfen zu werden. Da aber die Insel keinen Schutz gegen den Sturm bot, fingen ihre dünnen und durchnäßten Kleider an zu erstarren, nachdem sie die ganze Nacht hindurch auf der niedrigen Insel zusammengekauert gesessen hatten. Da versuchten erst zwei von ihnen, sich, in den Kajaks sitzend, in die Brandung hinauszustürzen, der eine trieb kieloben weiter, richtete sich aber doch glücklich wieder auf, und Beide kamen mit dem Leben davon. Bei diesem Wagestück waren aber Diejenigen, welche ihnen behülflich gewesen waren, fast von der See fortgerissen, so daß ihnen die Lust verging, denselben Versuch zu wagen. Drei von ihnen setzten sich ruhig hin, der Vierte aber entdeckte eine Höhlung in dem felsigen Ufer, die eine Rinne bildete, gerade groß genug, um ein Kajak hindurchgleiten zu lassen. Allerdings endete sie mit einem Abgrund über dem Meere, so daß der Kajakmann kopfüber ins Wasser fallen mußte, doch glaubte er bei Hochwasser das Wagestück unternehmen zu können. Als nun die Andern diese Stelle sahen, erschraken sie anfänglich sehr, aber sie dachten: wenn wir noch eine Nacht hier bleiben, so erfrieren wir, und ob wir nun auf der See oder dem Land umkommen, das bleibt sich ja im Grunde einerlei. Sie versuchten die gefährliche Rutschbahn und gelangten glücklich nach Hause.
Ein Kajakmann aus Kornok hat mir erzählt, wie er in Gemeinschaft mit seinem Bruder und einem andern Begleiter[S. 285] von einem Sturm in der Bucht von Godthaab überfallen wurde und Zuflucht auf dem Lande suchte. Hier war indessen der Rand des Eises so hoch und steil, daß sie nicht landen konnten, aber sie wurden von der See förmlich hinauf geschleudert.[64] Als er sich ein wenig besonnen hatte und den Bruder noch am Leben fand, befreite er ihn von seinem Kajak und versuchte eine Häuserruine zu erreichen, um Schutz vor dem Sturm zu finden, der ihre Glieder in den nassen Kleidern zu erstarren drohte. Den Bruder bald tragend, bald leitend, erreichte er die Ruine und grub ein Loch in den Schnee für ihn und seinen Begleiter. Aber während er ein wenig Stroh sammelte, das aus dem Schnee hervorguckte, merkte er erst, daß sein Begleiter, der weniger gut gekleidet war als er, schwächer und schwächer wurde und schließlich seinen Geist aufgab. Bald begannen auch die Arme des Bruders zu erstarren, der heftige Schneesturm machte alle seine Anstrengungen zu Schanden. Als er nun den hoffnungslosen Zustand seines Bruders erkannte, redete er zu ihm von einem Leben nach dem Tode, bis er merkte, daß er nichts mehr hörte. Da ergriff mich, so erzählte er, eine Angst und ein Beben, und während ich ihn anstarrte, wandte er sich nach mir um, lächelte mir zu und hauchte seinen letzten Seufzer aus.[65]
Ich will noch ein Beispiel anführen, das sich in Sukkertoppen im Frühling des Jahres 1889 zutrug und das mir von den Grönländern, als wir bald nachher dort hinkamen, mitgetheilt[S. 286] wurde. Eines Tages waren drei Fänger zur See gegangen, um Seehunde zu fangen, sie wurden von einem Unwetter überrascht und mußten den Heimweg antreten, indessen kenterte der Eine von ihnen und konnte sich nicht wieder aufrichten; da eilten die beiden Anderen herbei, um ihm zu helfen; aber bei der erregten See, die über sie hereinbrach, war dies nicht leicht, und bei dem Versuch gerieth der Gekenterte aus dem Kajak, der sich selbstverständlich sofort mit Wasser füllte. Jetzt verschlimmerte sich ihre Lage. Sie versuchten jedoch ihn über Wasser zu halten, während sie sein Kajak zwischen sich nahmen und sich bemühten, ihn von Wasser zu entleeren, um ihn dann wieder hinein zu praktiziren. Dies war indessen eine schwierige Sache, wieder und wieder schlugen die Wellen über sie hin und füllten den Kajak, sobald er leer war. Bei diesen Versuchen kenterte auch der zweite Kajakmann und konnte sich nur mit Mühe und Noth wieder aufrichten; sie wandten sich nun dem zuerst Gekenterten wieder zu, aber ihre Kräfte begannen zu schwinden und die See war zu erregt, sie konnten ihn nicht retten und mußten sich allein nach Hause begeben.
Ich könnte lange damit fortfahren, ähnliche Erlebnisse von diesem Volk zu erzählen, das feige und erbärmlich genannt wird und auf das so viele Europäer mit Verachtung herabsehen. Es ist ganz an der Tagesordnung, daß der Beruf des Eskimo Leiden und Gefahren mit sich bringt, und doch giebt er sich ihm mit Lust und Liebe hin.
Die grönländischen Eskimos bringen den größten Theil ihrer Zeit in ihren Kajaks zu; wenn der Morgen graut, ziehen sie aus, um erst spät am Tage mit ihrem Fang heimzukehren. Die Frauen dagegen halten sich zu Hause und besorgen ihre Wirthschaft.
Im Winter wohnen die Eskimos in festen Häusern, die[S. 287] aus Stein und Torf gebaut sind, und deren Fußboden oft niedriger liegt als die Erdoberfläche. Diese Häuser haben nur einen Raum, in dem sich die ganze Familie aufhält, oft bewohnen auch mehrere Familien ein solches Haus, — Männer und Frauen, Alte und Junge, alles bunt durcheinander.
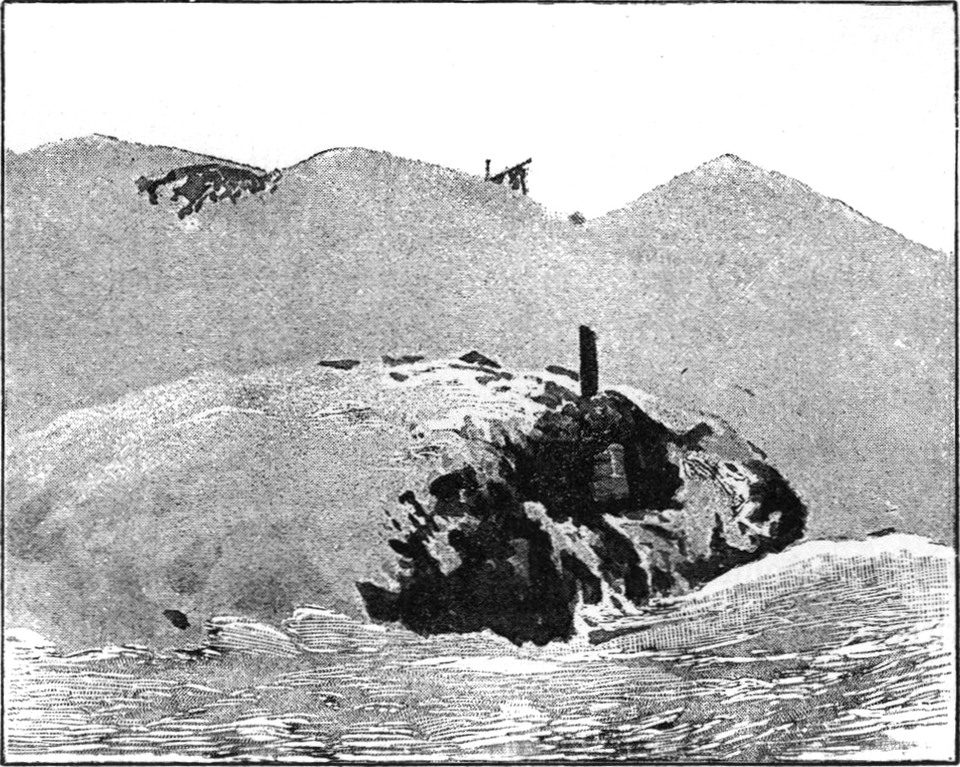
Dieser Raum ist in der Regel so niedrig, daß man nur zur Noth aufrecht darin stehen kann, und hat eine länglich viereckige Form. An der ganzen Hinterwand entlang läuft die Hauptpritsche, die 5–6 Fuß tief ist, und auf der die Bewohner des Hauses schlafen, d. h. größtentheils nur die Verheiratheten sowie die unverheiratheten Töchter; hier liegen sie Seite an Seite nebeneinander, mit den Beinen nach der Wand zu und den Köpfen nach dem Zimmer hinein, die unverheiratheten Männer pflegen auf kleineren Pritschen unter den Fenstern zu liegen, die sich an der entgegengesetzten Wand befinden und[S. 288] deren es eine, in wohlhabenden Häusern zwei, selten jedoch mehr giebt. An den Seitenwänden — den Kurzwänden — befinden sich in der Regel gleichfalls Pritschen; hier wie auf den Pritschen unter den Fenstern, falls dort Platz ist, pflegen die Gäste zu schlafen. Wohnen mehrere Familien in demselben Hause, was ziemlich allgemein ist, so ist die Hauptpritsche durch ganz niedrige Querwände in verschiedene Stände für je eine Familie getheilt.
In den alten grönländischen Häusern gab es keine Feuerherde, man erwärmte die Häuser durch Thranlampen, die Tag und Nacht brannten — ein Eskimo schläft nur im äußersten Nothfall im Dunkeln — und die gleichzeitig zum Kochen benutzt wurden, was in dem gemeinsamen Raum geschah. So ist es noch heute an der Ostküste, auch an der Westküste werden die Häuser in der Regel noch jetzt ausschließlich durch Thranlampen[66] erwärmt, das Essen aber wird jetzt doch gewöhnlich mit Torf oder Mövenhaufen auf eigenen Herden gekocht, die neben dem Hause errichtet sind (als Seitentheil des unten beschriebenen Hausganges). Früher benutzte man Kochtöpfe aus Stein, an der Westküste sind an deren Stelle jedoch auch eiserne Töpfe getreten, die man von der grönländischen Handelscompagnie kaufen kann.
Ein langer, enger Gang, der noch niedriger liegt als das Haus, und in den man von der Erdoberfläche vermittelst eines Loches zu gelangen pflegt, führt in das Haus. Er pflegt so eng und so niedrig zu sein, daß man nur kriechend hindurchgelangen kann, und wenn man groß ist, so kostet es Mühe,[S. 289] überhaupt in die Häuser zu kommen. Der Zweck dieser Gänge ist es, den Zutritt der kalten und das Entweichen der warmen Luft zu verhindern, deswegen sind sie auch so eng und liegen so tief.
Früher verließen die Grönländer, sobald der Sommer kam, ihre räucherigen Häuser, deren Dächer zum besseren Auslüften aufgerissen zu werden pflegten, und streiften den ganzen Sommer mit ihren Zelten von dem einen Fangplatz bis zum andern, einen Monat (im Juli oder August) verweilten sie dort, wo sich Rennthiere fanden, und diese Jagdzeit pflegte die schönste Zeit des Jahres für sie zu sein mit Rennthiertalg und Mägen.[67] Dies Sommerleben in den Zelten ist auch nebenbei sehr gesund für die Grönländer. Leider ist es infolge der in letzter Zeit eingetretenen Veränderungen an der Westküste nicht mehr so allgemein, denn die Zahl der Fänger, die im stande sind, genügend Felle für die Zelte und Frauenböte zu schaffen, ist sehr im Abnehmen begriffen — beides ist aber selbstverständlich für diese Reisen ganz unentbehrlich. Statt dessen sind sie jetzt gezwungen, das ganze Jahr in den engen, dumpfen Winterhäusern zu verbringen. Der Rückschritt in dieser Beziehung ist in den letzten Jahren ganz beunruhigend gewesen.
Es ist keineswegs eine leichte Aufgabe, eine Schilderung von der westgrönländischen Bevölkerung und ihrer jetzigen socialen Einrichtung zu machen, denn infolge des Einflusses der Europäer wie ihres vielfach direkten Eingreifens während der letzten 150 Jahre sind die alten bürgerlichen Verhältnisse theilweise in Verfall gerathen.
[S. 290]
Ursprünglich herrschte dort ein sehr geregeltes bürgerliches Leben, mit bestimmten Sitten und Vorschriften für alles Dahingehörige, und diese umging man selten oder niemals, denn die Bevölkerung bestand aus guten, friedlichen Menschen, die einander ungern Verdruß bereiteten. Dann kamen die Europäer ins Land. Ohne das Volk zu kennen, gingen sie selbstverständlich von der Annahme aus, daß es von Grund auf einer Reform bedürfe und griffen so störend in seine bürgerliche Ordnung ein. Sie suchten ihm ein ganz neues Gepräge aufzuzwingen, gaben ihm eine neue Religion, untergruben die Achtung vor den alten Sitten, ohne ihnen statt dessen neue zu geben. Kurz, die Europäer machten es in Grönland genau so, wie sie es überall zu machen pflegen, wo sie im Namen der christlichen Religion auftreten, um „die wilden, unmündigen Völker der Segnungen der ewigen Wahrheit theilhaftig zu machen“.
Anfänglich lauschten die Eskimos den fremden Menschen ganz verwundert. Sie waren sehr zufrieden mit sich selber und dem ganzen Dasein gewesen, hatten keine Ahnung davon, daß das Leben und die Menschen so elend seien und verstanden nicht, wie eine Religion so grausam sein könne, daß sie die Menschen zum ewigen Höllenfeuer verdammen ließ. „Die Erbsünde konnten sie wohl als etwas ganz Allgemeines bei den Kavdlunakkern (Europäern) anerkennen, denn daß diese zum größten Theil schlecht waren, das sahen sie wohl,[68] da aber die Kalatlit (Eskimo) gute Menschen waren, so mußten sie ohne Frage in den Himmel kommen.“ Und sie lachten die dummen Europäer[S. 291] aus, die nichts von ihrem Fang oder alledem verstanden, was das Wichtigste im Leben ist.
Durch die Macht, welche eine höhere Kultur verleiht, siegten diese jedoch bald und haben im Laufe der Zeiten das westgrönländische bürgerliche Leben zu einer unsicheren Mischung von ursprünglich eskimoischen und europäischen Sitten gemacht.
Viele wesentliche Züge von dem ursprünglich eskimoischen Leben haben sich jedoch erhalten, und mich hauptsächlich an diese haltend, will ich es versuchen, eine Schilderung von der Einrichtung des bürgerlichen Lebens zu geben.
Wie bei allen Jagdvölkern ist bei den Grönländern der Eigenthumsbegriff sehr beschränkt, wenn man aber glaubt, daß ein solcher Begriff gar nicht bei ihnen vorhanden ist, so irrt man.
In Bezug auf die meisten Sachen herrscht eine gewisse Gütergemeinschaft, die sich aber stets auf weitere oder engere Kreise, je nach der Natur des Gegenstandes, beschränkt. Der engste Kreis ist die Familie, dann kommen die Hausgenossen und die nächsten Verwandten und endlich alle am Orte ansässigen Familien. Als strengstes Privateigenthum werden die Kajaks, die Kajakkleidung und die Fanggeräthschaften betrachtet. Diese Gegenstände gehören dem Fänger allein, und Niemand darf sie anrühren, denn durch sie erhält er sich und seine Familie, und er muß natürlich immer sicher sein, sie dort finden zu können, wohin er sie gelegt. Er verleiht sie nur sehr selten. In früheren Zeiten hielten sich gute Fänger gewöhnlich zwei Kajaks, dies ist jetzt nur noch selten der Fall. Etwas, was man auch[S. 292] zu den Fanggeräthschaften rechnen kann, sind die Schneeschuhe, da diese jedoch erst durch die Europäer eingeführt worden sind, gilt ihnen das Eigenthumsrecht nicht in so hohem Grade, und während ein Eskimo niemals die Fanggeräthschaften eines Andern anrührt, besinnt er sich nicht, die Ski Anderer zu benutzen, ohne vorher um Erlaubniß zu fragen. Die Flinte und die Hagelbüchse scheinen ebenfalls nicht in den Begriff strengen Privateigenthums mit aufgenommen zu sein.
Nach den Fanggeräthschaften und den privaten Kleidungsstücken kommen andere, im Hause verwendete Geräthschaften, z. B. Messer, Aexte, Sägen, Nähutensilien, Fellmesser u. s. w. Diese darf man zur Noth als Privateigenthum betrachten, für mehrere derselben macht sich jedoch oft eine weitbegrenzte Gütergemeinschaft geltend.
Anderes Hausgeräth ist Gemeingut der Familie oder doch der Hausgenossen. Das Frauenboot gehört dem Hausvater, Nekor, oder seiner Familie, ebenso das Zelt, wenn eins vorhanden ist. Auch das Haus gehört der Familie, und falls mehrere zusammenwohnen, was ursprünglich allgemein Sitte war, so ist es gemeinsames Eigenthum derselben.
Einen Grundbesitz kennen die Eskimos nicht, doch scheint die Regel zu herrschen, daß sich Niemand dort, wo Leute wohnen, ein Zelt aufschlagen oder eine Hütte erbauen darf, ohne deren Zustimmung einzuholen.
Als Beispiel ihrer Rücksichtnahme aufeinander in dieser Beziehung kann ein Zug angeführt werden, der vor über hundert Jahren von dem früher erwähnten Dalager beschrieben worden ist.
„Im Sommer, wenn sie ihre Zelte und Bagage mitnehmen und sich an einem Orte niederzulassen gedenken, wo sich bereits andere Grönländer aufhalten, rudern sie sehr langsam dem Ufer zu; haben sie es auf Schußweite erreicht, halten sie still, ohne[S. 293] etwas zu sagen. Schweigen die Leute am Ufer ebenfalls still, so glauben die Ankömmlinge, daß sie nicht gern gesehen werden und rudern deswegen so schnell sie können fort, um einen öden Fleck aufzusuchen. Wenn man aber am Lande, was gewöhnlich der Fall ist, ihnen Komplimente zuruft wie: „Seht hier! Hier sind gute Zeltplätze, gutes Lager für eure Frauenböte, kommt und ruht euch von den Beschwerden des Tages aus,“ — so rudern sie nach kurzer Berathschlagung auf das Ufer zu, wo man bereit ist, sie zu empfangen und ihnen beim Heraufschaffen der Bagage behülflich zu sein. Wenn sie aber wieder von dannen ziehen, so helfen sie ihnen nur dabei, das Frauenboot in die See zu schaffen, die übrige Arbeit überlassen sie ihnen allein, nur falls der Davonziehende ein besonders guter Freund ist, wird er mit denselben Ehrenbezeugungen entlassen, wie die, mit denen er empfangen wurde. Die Abschiedsworte lauten: „Euer Scheiden wird bei uns eine stille Erinnerung hervorrufen.“[69]
Ein Anklang an das Eigenthumsrecht scheint auch darin zu liegen, daß es dort, wo sie in lachsreichen Strömen Dämme gebaut haben, um die Fische zu sammeln, nicht gern gesehen wird, wenn Fremde kommen und ihre Dämme verändern oder Netze innerhalb derselben auswerfen, wie es die Europäer häufig in früheren Zeiten gethan haben. (Ebenfalls von Dalager erwähnt.)
Treibholz gehört Demjenigen, der es zuerst in der See treiben fand, gleichviel wo. Um sein Recht zu wahren, ist der Finder verpflichtet, es ans Land zu bugsiren und es bis an das Hochwassermerkzeichen zu wälzen. Vor diesem Eigenthum hat der Eskimo einen großen Respekt, und Derjenige, welcher Treibholz anrührt, das über das Hochwasserzeichen an den Strand geschafft ist, wird als Schurke betrachtet.
[S. 294]
Gegen diese Regel haben sich nun freilich die Europäer bis in die jüngste Zeit mit oder ohne ihr Wissen versündigt (vgl. Dalager, Seite 23–24). Als Beweis für die Ehrlichkeit des Eskimos mag angeführt werden, daß Jeder, der Treibholz auf den Strand hinauf geschafft hat, falls nicht Europäer dort gewesen sind, sicher sein kann, es jeder Zeit, ja selbst noch nach Jahren wieder zu finden.
Zur Beleuchtung ihrer Auffassung in betreff des durch Handel und Tausch erworbenen Eigenthumsrechts will ich hier anführen, was Dalager darüber erwähnt: „Leiht ein Mann einem Anderen etwas, als da sind Böte, Pfeile, Angelschnüre oder irgend welche andere Seegeräthschaften und kommt selbiges zu Schaden, entweder dadurch, daß der Seehund oder das Thier mit dem Pfeil fortläuft oder der Fisch die Schnur zerreißt, oder auch daß der Fisch oder Seehund dem Boot einen Schaden zufügt, so geht dies alles auf Kosten des Besitzers, und der Leihende hat nichts dafür zu erstatten. Entleiht Jemand ohne das Wissen des Besitzers Pfeile oder Geräthschaften und kommt selbiges zu Schaden, so ist der Leihende verpflichtet, dem Besitzer einen Schadenersatz zu geben. Dies geschieht jedoch nur sehr selten, ein Grönländer muß auch schon sehr bedürftig sein, ehe er einen Anderen bittet, ihm etwas zu leihen, aus Furcht, daß selbiges zu Schaden kommen könne.“
„Kauft Jemand von einem Anderen kostbare Dinge wie Böte oder Flinten und ist der Käufer nicht im stande, den Verkäufer zu kontentiren für die geforderte Bezahlung, so wird ihm Kredit gegeben, bis er es prästiren kann. Stirbt aber der Debitor vorher, so macht der Kreditor seine Ansprüche niemals geltend. Dies ist — fügt Dalager hinzu — ein sehr nachtheiliger Artikel für die Kaufleute der Kolonie, die stets Kredit geben müssen, ich selber habe das in diesem Jahre mehrmals[S. 295] empfunden, da mehrere meiner Debitoren entschlafen sind und mich dadurch in ein ziemliches Labyrinth versetzt haben“.
Mehr als das oben Erwähnte[70] kann ein Grönländer infolge der ursprünglich dort herrschenden Sitte nicht wohl besitzen.
Selbst wenn er Sinn dafür hätte, sich Reichthümer zu sammeln, was jedoch nur sehr selten der Fall ist, würden seine Genossen Ansprüche auf sein überflüssiges Eigenthum machen können. So entsteht denn in Grönland das natürliche Mißverhältniß, daß die ins Land gezogenen Europäer, die von den Eingeborenen leben, sich Reichthum sammeln und im Ueberfluß leben können, während die Eingeborenen selber es nicht können, selbst wenn sie es wollten.
Nicht einmal über seinen Fang hat der Grönländer freie Verfügung. Es giebt aus alten Zeiten herstammende Regeln, wonach derselbe vertheilt wird, und nur ganz einzelne Thierarten darf er einigermaßen für sich und seine Familie behalten. Hierzu gehört der Atak (Phoca grönlandica) aber auch hiervon muß er jedem der Kajakmänner, die gleich nach dem Fang herbeikommen, ein Stück Speck geben, ebenso erhält jedes Kind des Wohnortes, sobald es nach Hause gekommen ist, ein kleines Stück Speck. Für andere Seehundsarten giebt es bestimmte Regeln, nach denen das ganze gefangene Thier unter die beim Fang Anwesenden oder doch unter die verschiedenen Häuser des Wohnortes vertheilt wird. Das letztere ist besonders bei Walrossen und bei verschiedenen Walarten der Fall, wie z. B. beim Delphin, von dem der Fänger nur einen verhältnißmäßig kleinen Theil erhält, selbst wenn er ihn ganz allein gefangen hat. Werden größere Wale an Land gebracht, so soll es ein ganz unheimlicher Anblick sein, alle Bewohner des Ortes mit Messern bewaffnet über das Thier[S. 296] herstürzen zu sehen, während es noch im Wasser ist, um Jeder sein Theil zu ergattern.[71]
Nicht allein für die größeren Thiere gelten solche Regeln, sondern auch für einzelne Fische ist dies der Fall. Wird z. B. eine Hellflunder gefangen, so ist es die Pflicht des Fängers, den anderen Kajakmännern, die auf dem Fangplatz liegen, jedem ein Stück von der Haut zu geben, die als großer Leckerbissen gilt. Außerdem theilt er, wenn er nach Hause kommt, den Hausgenossen und Nachbarn von seinem Fange mit.
Aus dem hier Angeführten wird zu ersehen sein, daß die Gesetze darauf ausgehen, den Fang, soweit es möglich ist, dem ganzen Wohnort zu gute kommen zu lassen, so daß die einzelnen Familien nicht ganz davon abhängig zu sein brauchen, daß ihre Fänger jeden Tag etwas fangen. Diese Gesetze haben sich auf Grundlage einer langen Erfahrung begründet und durch die Gewohnheit vieler Jahrhunderte eingebürgert.
Selbst wenn ein Fänger den eben angeführten Gesetzen Genüge gethan hat, so kann er doch nicht immer den ihm gesetzmäßig[S. 297] zukommenden Theil seines eigenen Fanges unangefochten behalten. Fängt er z. B. in einer Zeit, wo Mangel und Hungersnoth herrscht, da ist es seine Pflicht, entweder ein Gastmahl zu veranstalten oder den anderen Häusern, deren Bewohner möglicherweise lange kein frisches Fleisch gesehen haben, vom Fang mitzutheilen.
Hat ein guter Fang stattgefunden, so werden Festmahlzeiten abgehalten, und man ißt, so lange man kann. Wird nicht alles aufgegessen und ist auch in den anderen Häusern genug, so wird das übrige als Wintervorrath aufbewahrt, herrscht aber Hungersnoth, so kann man sicher sein, daß alle Diejenigen, die keine Vorräthe mehr haben, sich bei Denjenigen einfinden, die noch mit Lebensmitteln versehen sind, und da ist es denn die Pflicht dieser zu helfen, so lange sie etwas haben, nachher hungern sie gemeinsam und zuweilen verhungern sie auch. Daß Einige im Ueberfluß leben, während Andere Noth leiden, wie es in den europäischen Ländern an der Tagesordnung ist, das ist etwas ganz Unerhörtes in Grönland, natürlich abgesehen von den dort wohnenden Europäern, die mit der ihnen eigenen Fürsorglichkeit oft im Ueberfluß sitzen, während die Grönländer Hunger leiden. Bei den Grönländern untereinander würde dies ganz unerlaubt sein.
Die Grönländer sind überhaupt der Noth Anderer gegenüber die mitleidsvollsten Seelen von der Welt. Ihr erstes Gesetz ist, Anderen zu helfen. Auf diesem Gesetz wie auf dem festen Zusammenhalten im Guten wie im Bösen beruhen alle die kleinen grönländischen Existenzen. Ein hartes Leben hat ihn gelehrt, daß, selbst wenn er ein tüchtiger Mensch ist und sich in der Regel selber helfen kann, doch Zeiten kommen können, wo er ohne die Hülfe seiner Mitmenschen unterliegen würde, deswegen ist es am besten, stets hülfbereit zu sein. „Was ihr[S. 298] wollt, daß Andere euch thun, das thut auch ihr ihnen,“ diese Lehre, eine der vornehmsten und wichtigsten des Christenthums, hat die Natur selber den Grönländer gelehrt, und er führt sie wirklich im Leben aus, was kaum immer von den Christen gesagt werden kann. Zu beklagen ist es, daß diese Lehre ihre Kraft auch hier in dem Maße zu verlieren scheint, in dem die grönländische Gemeinde von der Civilisation beeinflußt wird. Doch ist der Trieb, ihren Nebenmenschen zu helfen, so mit dem Charakter dieser Naturkinder verwachsen, daß ich fest überzeugt bin, sie würden selbst einem Europäer, der einem Grönländer seinen Beistand verweigerte, ihre Hülfe nicht versagen, wenn er in Noth käme.
Ebenso wie diese aufopfernde Nächstenliebe ist auch die Gastfreundschaft gegen Fremde ein wichtiges Gesetz in Grönland. Der Reisende kehrt in die erste, beste Hütte ein, zu der er kommt, und bleibt dort, so lange es nöthig ist. Man nimmt ihn freundlich auf und bewirthet ihn nach besten Kräften, selbst wenn er ein Feind ist. Wenn er fortzieht, giebt man ihm sehr häufig noch Speisen mit. Ich habe Kajakmänner mit Hellbuttfleisch beladen von den Häusern fortziehen sehen, wo sie des Sturmes wegen hatten einkehren müssen. Es ist unmöglich, eine Bezahlung für den Aufenthalt zu entrichten. Selbst ein Europäer, der sich auf der Reise befindet, wird überall gastfrei empfangen, obwohl der Grönländer gar nicht auf den Gedanken kommen würde, dieselbe Anforderung an ihn zu stellen, wenn er auf der Reise an sein Haus kommen sollte. Die Europäer geben jedoch häufig eine Art Vergütung, indem sie Kaffee und dergl. bei sich haben, womit sie ihre Wirthe traktiren und worauf die Grönländer großes Gewicht legen. Deswegen sind die Europäer als Gäste gerne gesehen, wenigstens so lange sie traktiren können.
Kapitän Holm erzählt mehrere merkwürdige Beispiele,[S. 299] welche beweisen, daß die Gastfreundschaft auch an der Ostküste Grönlands als Pflicht betrachtet wird. Ich erinnere an seine Erzählung von dem Mörder Maratuk, der seinen Stiefvater ermordet hatte, und der ein schlechter Mensch war, mit dem Niemand zu schaffen haben wollte. Trotzdem wurde er doch, wenn er zu den nächsten Angehörigen des Ermordeten kam, gastlich aufgenommen und lange unterhalten, sobald er aber abgereist war, sprach man schlecht von ihm.
Zur Gastfreiheit zwingen den Grönländer selbstverständlich auch die harten Naturverhältnisse, denn er wird häufig fern von der Heimath von einem Unwetter überfallen und gezwungen, in dem nächstgelegenen Hause Zuflucht zu suchen.
Leider scheint die Gastfreiheit in den letzten Jahren an der Westküste in der Abnahme begriffen zu sein. Die Europäer geben den Ton darin an. Es soll sogar vorgekommen sein, daß sie die genossene Gastfreundschaft geradezu bezahlt haben, und daß so etwas demoralisirend wirkt, liegt klar auf der Hand.
Der Grönländer hält keine bestimmten Mahlzeiten inne, sondern ißt, wenn er hungrig ist und Speisen hat. Die Fänger essen in der Regel des Morgens, ehe sie in ihre Kajaks gehen, nichts. In früheren Zeiten tranken sie nur ein wenig Wasser, jetzt nehmen sie eine oder zwei Tassen Kaffee zu sich. Sie behaupten, daß sie dann leichter in den Kajaks sitzen. Mit diesem kärglichen Imbiß können sie es dann den ganzen Tag aushalten. Fangen sie etwas, so nehmen sie gerne ein Stück Seehundsspeck zu sich. Sie besitzen eine ganz merkwürdige Fähigkeit zu hungern, können dafür aber auch ganz erstaunliche Mengen auf einmal zu sich nehmen.

Die Speisen werden gewöhnlich in einer Schüssel mitten[S. 300] auf den Fußboden gesetzt, dann nehmen Alle ringsumher auf den Pritschen Platz und langen nach besten Kräften mit den Fingern zu. Die Schalen auf eine Kiste oder dergleichen zu setzen, — Tische haben sie nicht —, wie wir es thun würden, das fällt ihnen nur selten ein. Es scheint fast, als wenn sie eine gewisse Vorliebe für das Bücken haben. Die Erzählung einer jungen Frau, die nach Grönland gekommen war, giebt uns ein Beispiel davon. Sie hatte mehrere Grönländerinnen zu einer Wäsche im Hause. Als sie in die Waschküche hinaus kam, sah sie sie über den Zuber, der auf der Erde stand, gebeugt dastehen, und da sie dies natürlich sehr beschwerlich fand, gab sie ihnen einige Bänkchen, auf die sie den Zuber stellen[S. 301] sollten. Eine Weile darauf kam sie abermals herein, war aber nicht wenig erstaunt, als sie den Zuber noch immer auf demselben Fleck vorfand, während die Grönländerinnen nun auf den Bänkchen standen und wuschen. Si non e vero, e ben trovato!
Die Zubereitung der Speisen des Eskimos ist ziemlich einfach, auch kennen sie nur wenige Abwechselungen in ihren Speisen. Fleisch und Fisch wird theils in rohem, theils in gefrorenem Zustand gegessen, und zwar ist dies das Gewöhnlichste, theils wird es gekocht und theils läßt man das Fleisch eine Art Fäulnißprozeß durchmachen, ehe es gegessen wird. Ein außerordentlich beliebtes Gericht ist verfaulter Seehundskopf. Der Speck des Seehundes und des Walfisches wird nicht gekocht, sondern roh gegessen. Die Annahme, daß die Eskimos geschmolzenen Thran trinken, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die ursprünglichen Grönländer aßen allerlei Pflanzen, wie Engelwurz (Angelika), Cichorie, Sauergras, Krähenbeeren, Bickbeeren und verschiedene Tangarten. Eine ihrer größten Delikatessen ist der Inhalt der Rennthiermägen. Dies liegt ohne Zweifel hauptsächlich darin, daß sie ein so großes Verlangen nach vegetabilischer Nahrung haben, denn der Inhalt dieser Rennthiermägen besteht ja ausschließlich aus Moos und anderen Pflanzenstoffen, die das Rennthier gefressen hat, und die nur eine kleine Veränderung durchgemacht haben infolge ihrer Mischung mit dem Magensaft; ein wenig säuerlich schmeckt das Gericht freilich. Der Inhalt eines Rennthiermagens mit Krähenbeeren und Speck zusammen gekocht, ist ein Leibgericht des Eskimos. Von anderen Leckerbissen will ich noch die Haut (Matak) der verschiedenen Walfischarten nennen. Sie wird zusammen mit der obersten Speckschicht abgezogen und roh verzehrt, besonders die Delphin-Matak gilt als höchst delikat. Ich stimme vollständig mit[S. 302] den Eskimos in der Vorliebe für dies Gericht ein, das wie eine Mischung von Nußkernen und Austern schmeckt. Die meisten in Grönland ansässigen Europäer mögen diese Matak gerne, doch kochen sie sie in der Regel, wodurch sie meiner Ansicht nach sehr verliert.
Fleisch, das nicht fett ist, findet der Grönländer weniger wohlschmeckend, deswegen zieht er die Wasservögel den Schneehühnern vor, obwohl diese in großen Mengen vorkommen. Die Eingeweide werden allerdings mit dem größten Appetit verzehrt, die Schneehühner selber aber pflegen sie an die Europäer zu verkaufen.
Es geschah einmal in einer der Kolonien Südgrönlands, daß ein Pfarrer, der gerade erst ins Land gekommen war, einige Grönländer zu einem Gastmahl einlud und seine Gattin die Gäste mit dem Besten, was sie hatte, traktirte, nämlich mit gebratenen Schneehühnern. Die Grönländer nahmen aber nur sehr wenig zu sich, die Frau des Pfarrers nöthigte sie und fragte, ob sie denn keine Schneehühner möchten. „Ja, gegessen würden sie schon, aber nur im Falle großer Hungersnoth,“ lautete die Antwort.
Von europäischen Waren ist es hauptsächlich der Kaffee, dem die Grönländer verfallen sind. Das Kaffeetrinken ist an der Westküste Grönlands fast bis zum Laster ausgeartet, — Branntwein können sie glücklicherweise nicht kaufen. Sie machen sehr starken Kaffee und trinken selten weniger als zwei gute Tassen auf einmal. In der Regel trinken sie 4–5 mal des Tages Kaffee, „er schmeckt so gut und erheitert,“ sagen sie. Ueber den schädlichen Einfluß sind sie sich jedoch völlig klar, deswegen erhalten junge Männer nur wenig oder gar keinen Kaffee, damit sie gute Fänger werden. Der Schwindel, an dem die Fänger häufig leiden, und der schuld daran ist, daß[S. 303] sie sich nicht grade in dem Kajak halten können, soll ihrer Meinung nach einzig und allein von dem Genuß des Kaffees herrühren. Diese Erfahrung stimmt auffallend mit den neueren physiologischen Untersuchungen überein, durch welche festgestellt worden ist, daß die gefährlichsten Gifte des Kaffees, das Kaffeïn etc., gerade den Theil des Nervensystems angreifen, der das Gleichgewicht berührt.
Nächst dem Kaffee schätzen sie Tabak und Brot am höchsten. Der Tabak wird an der Westküste hauptsächlich geraucht und gekaut, das Schnupfen ist die Leidenschaft der Ostgrönländer, doch wird es auch von den Frauen an der Westküste viel gethan, und man kann häufig die unangenehme Entdeckung machen, daß eine schöne, anziehende Grönländerin eine Prise nimmt.
Der Kautabak wird gewöhnlich in hohen, dänischen Porzellanpfeifen bereitet, indem man diese zur Hälfte voll Rauchtabak stopft, der mit Wasser angefeuchtet wird, worauf man den übrigen Theil der Pfeife voll trockenen Tabak stopft. Die Pfeife wird dann so weit geraucht, bis das Feuer den nassen Tabak erreicht und von ihm gelöscht wird. Dann klopft man die Asche aus, schüttet den Schmirgel, der aus dem Pfeifenrohr, dem Schmirgelbehälter etc. zusammengekratzt werden kann, über die schon tüchtig durchgezogenen Reste, und der Tabak ist fertig.
Der Verkauf von Branntwein an die Grönländer ist von der Regierung verboten. Die in Grönland ansässigen Europäer haben dagegen die Erlaubniß, sich Branntwein aus der Heimath zu verschreiben und den Grönländern davon abzugeben. So kennen sie diesen Genuß also, und es ist etwas ganz allgemeines, daß sie auf Bootsreisen und nach jedem abgeschlossenen Geschäft etwas Branntwein erhalten. Frauen wie Männer lieben ihn leidenschaftlich, nicht weil er gut schmeckt, wie sie mir oft erzählten, sondern weil es eine so herrliche Empfindung ist, betrunken[S. 304] zu sein, und betrunken waren sie denn auch bei jeder Gelegenheit. Im Gegensatz zu den Frauen anderer Länder fanden die Grönländerinnen in der Regel ihre Männer, wenn sie betrunken waren, so besonders anziehend. Sie nennen den Branntwein silakrangitsok, d. h. das, wodurch man den Verstand verliert.
Die Stellung der Frau in Grönland muß im allgemeinen eine gute genannt werden, jedenfalls ist sie nicht unterdrückt, obwohl sie als weit unter dem Manne stehend angesehen wird. So will ein Grönländer sehr gern Söhne, dagegen aber sehr ungern Töchter haben, und sowohl Vater als Mutter sind in der Regel unzufrieden oder doch betrübt, wenn eine Tochter geboren wird.
Es herrscht eine bestimmte Arbeitseintheilung. Der Mann hat sein schweres Leben als Fänger und Familienversorger, wenn er aber ans Land oder in sein Haus kommt, so ist seine Arbeit beendet, und der Fang wird den Frauen überlassen. Sie empfangen den Fänger am Strande, wenn er, seine Beute bugsirend, naht, helfen ihn ans Land ziehen, und während er seinen Kajak und seine Waffen in Sicherheit bringt und sie an ihren bestimmten Platz trägt, liegt es den Frauen allein ob, die Beute ins Haus zu bringen. In früheren Zeiten war es unter der Würde eines Fängers, bei dieser Arbeit zu helfen, und so ist das Verhältniß auch noch heute im großen und ganzen geblieben. Die Frauen ziehen den Seehunden die Haut ab und zerschneiden den Fang nach bestimmten Regeln, während die Hausfrau der Vertheilung vorsteht. Außerdem ist es die Aufgabe der Frau, Essen zu kochen, die Häute zuzubereiten, die[S. 305] Kajaks und Frauenböte mit Fell zu beziehen, die Kleider der Männer zu nähen und alle häuslichen Arbeiten zu verrichten. Sie müssen auch die Häuser bauen, Zelte aufschlagen und die Frauenböte rudern (daher der Name), wenn sich die Familie auf der Reise befindet. Früher wenigstens war es unter der Würde eines Fängers, ein Frauenboot zu rudern, dagegen war es das Amt des Hausvaters, es zu steuern. Jetzt kommt es allerdings häufig vor, daß ein Eskimo im Boote sitzt und rudert, besonders, wenn dieses von Europäern zu ihren Reisen gemiethet ist. Es macht keinen guten Eindruck, sie so zu sehen, statt in ihren stolzen Kajaks, welche ihre eigentliche Lebensbedingung sind und bleiben, weshalb sie keine Gelegenheit unbenutzt lassen sollten, sich in ihrer Handhabung zu üben. Ein Großfänger hält sich auch noch heute für zu gut, um in einem Frauenboot zu sitzen, es sei denn als Steuermann.
Daheim in den Häusern wird man die Frauen in der Regel fleißig mit irgend einer Arbeit beschäftigt sehen, während die Männer nichts thun als essen, faulenzen, einander Geschichten erzählen und schlafen. Nehmen sie etwas anderes vor, so beschäftigen sie sich höchstens mit ihren Waffen, verzieren sie mit Knochenschnitzereien oder bessern sie aus, wenn es nöthig ist.
Wenn die Familien auf die Rennthierjagd ziehen, so schießen natürlich die Männer die Rennthiere, während es den Frauen obliegt, das erlegte Thier bis an das Zelt zu schleppen, was oft eine anstrengende Arbeit ist, bei der sie eine große Ausdauer nöthig haben.
Die Frauen bedienen sich nur sehr selten der Kajaks, der einzige Fang, den sie betreiben, ist der Angmasaetfang (Mallobus villosus). Dieser findet im Frühsommer statt, wenn der Angmasaet in so dichten Schwärmen an die Küste kommt, daß man ihn förmlich in das Frauenboot hineinschöpfen kann. Man[S. 306] fährt dann so lange mit dem Fang fort, bis man genug für den Wintervorrath zu haben meint, und wenn auch noch Unmengen von Fischen da sind, hält man es nur selten der Mühe werth, mehr zu fangen. Die gefangenen Fische werden von den Frauen zum Trocknen über den Steinen und Felsen ausgebreitet und dann zusammengestaut.

Kapitän Holm erzählt, daß in Imarsivik an der Ostküste zwei Frauen in Kajaks fuhren. Es herrschte ein ungleiches Verhältniß zwischen Männern und Frauen, indem von 21 Bewohnern nur 5 dem männlichen Geschlecht angehörten. Ob diese Frauen eine ebensolche Fertigkeit im Fangen erreicht hatten, erwähnt er leider nicht.
Diese beiden Frauen waren gänzlich zu der Lebensweise der Männer übergegangen; sie kleideten sich wie Männer, trugen ihr Haar wie diese und traten überhaupt ganz auf, als gehörten sie[S. 307] dem männlichen Geschlecht an. Als sie die Erlaubniß erhielten, zwischen Holms Tauschgegenständen zu wählen, fiel ihre Wahl nicht auf Nähnadeln und ähnliche weibliche Geräthschaften, sondern auf Pfeilspitzen und dergleichen zu ihren Waffen. Es muß sehr schwer gewesen sein, sie von Männern zu unterscheiden, und es ist sehr wahrscheinlich, daß wir sie am 5. August bei Singiartuarfik gesehen haben, ohne zu wissen, welchem Geschlechte sie angehörten.[72]
Holm erzählte, daß noch zwei andere Mädchen am selben Ort zu Fängern ausgebildet werden sollen, daß sie damals aber noch zu jung gewesen seien.
Die Ehen wurden in früheren Zeiten in Grönland ohne viele Umstände geschlossen. Hatte man Neigung zu einem Mädchen, so begab man sich nach ihrem Hause oder ihrem Zelte, zog sie an den Haaren, oder wo man sie sonst zu fassen bekam, ohne weitere Umstände mit sich in sein Haus,[73] wo ihr ein Platz auf der Pritsche angewiesen wurde; wenn es hoch kam, schenkte ihr der angehende Gatte einen neuen Wassereimer oder dergleichen, und damit war die Geschichte fertig. Jetzt dagegen gehört es in Grönland ebenso wie an anderen Orten zum guten Ton, daß die betreffende Dame es sich unter keiner Bedingung anmerken lassen darf, daß sie ihren Freier haben will, selbst wenn sie ihn noch so sehr liebt; sie muß sich deswegen widersetzen, muß jammern und klagen, so daß es weithin schallt; wenn sie recht wohlerzogen ist, so jammert und weint sie wohl gar[S. 308] mehrere Tage, ja entflieht ein oder mehrere Male aus dem Hause ihres Gatten. Wenn die Wohlerzogenheit zu weit geht, kann es wohl vorkommen, daß der Mann, falls er ihrer nicht bereits überdrüssig geworden ist, sie ein klein wenig unter die Fußsohlen ritzt, so daß sie nicht gehen kann, und bis die Wunden geheilt sind, pflegt sie dann eine glückliche Hausfrau geworden zu sein.
Diese Art und Weise, sich zu verheirathen, ist noch heute die einzige Art der Eheschließung in Grönland, und bei einer solchen Entführung kann es oft sehr gewaltsam zugehen, aber die Angehörigen der betreffenden Dame sehen doch mit der größten Gemüthsruhe zu, — die ganze Sache ist eben völlig privater Natur. Die Vorliebe der Grönländer, in gutem Einverständniß mit ihren Landsleuten zu leben, bewirkt, daß sie sich nur ungern in die Angelegenheiten Anderer mischen.
Es kommt natürlich auch vor, daß das junge Fräulein seinen Freier wirklich nicht haben will; in dem Falle setzt es seinen Widerstand so lange fort, bis es sich endlich in sein Schicksal gefunden hat, oder bis sein Freier es aufgiebt. Wie schwierig es für einen Zuschauer ist, zu entscheiden, was ihre wirklichen Wünsche sind, davon theilt uns Graah ein schlagendes Beispiel mit.[74]
Kellitiuk, eine tüchtige Ruderin seines Bootes, wurde eines Tages von einem Ostgrönländer namens Siorakitsok geraubt und in die Berge geschleppt, obwohl sie den heftigsten Widerstand leistete. Da Graah der Ansicht war, daß sie ihn durchaus nicht haben wollte, was auch von ihren nächsten Angehörigen bestätigt wurde, ging er ihr nach und befreite sie. Einige Tage später, als sie im Begriff waren, sich reisefertig zu[S. 309] machen, und das Boot grade flott gemacht war, sprang Kellitiuk in dasselbe, kroch unter eine Ruderbank und deckte sich mit Säcken und Fellen zu. Es verlautete bald, daß sie dies gethan, weil Siorakitsok im nämlichen Augenblick auf der Insel gelandet war, seinen Vater als Sekundanten mitbringend. Graah wurde hiervon benachrichtigt, und überzeugt, daß sie wirklich Widerwillen gegen ihren brutalen Freier nähre, hielt er es für seine Pflicht, sie zu befreien. Als er herzukam, hatte der Freier sie schon halb aus dem Boot herausgezogen, und der Vater stand am Ufer, bereit, bei der Entführung behülflich zu sein. Als Graah sie ihm entriß und ihm eine Anweisung auf die „schwarze Dorthe“, eine andere Ruderin gab, die er gern los sein wollte, hörte ihm der Enttäuschte ruhig zu, murmelte einige unverständliche Worte in den Bart und entfernte sich mit böser Miene und drohendem Blick. Der Vater nahm sich das Schicksal des Sohnes nicht weiter zu Herzen, „er half uns, das Fahrzeug zu beladen,“ berichtet Graah, „und sagte uns dann sein sicher aufrichtig gemeintes Lebewohl.“ Als sie abfahren wollten, war indessen Kellitiuk nirgends zu finden, obwohl man überall auf der kleinen Insel nach ihr suchte und sie rief; sie mußte sich irgendwo versteckt haben, und man fuhr schließlich ohne sie von dannen. Sie hatte doch eine Neigung zu Siorakitsok genährt.
Die ursprünglichen Grönländer trennen ihre Ehen ebenso schnell wie sie sie eingehen. Wird der Mann seiner Frau überdrüssig oder umgekehrt (was jedoch seltener der Fall ist), so sammelt sie ihr Pelzwerk zusammen und kehrt in das Haus ihrer Eltern zurück, als ginge sie die Sache nicht weiter an.
Hat ein Mann eine Neigung zu der Frau eines Anderen, so nimmt er sie ohne weiteres, falls er der Stärkere ist. Als Papik, ein angesehener Fänger an der Ostküste bei Angmagsalik,[S. 310] ein Auge auf Patuaks junge Frau geworfen hatte, begab er sich nach Patuaks Zelt und nahm einen leeren Kajak mit. Er ging hinauf, führte die Frau an den Strand hinab, wo er sie den leeren Kajak besteigen hieß und ruderte mit ihr fort. Patuak, der jünger ist als Papik und sich in Tüchtigkeit und in Kräften nicht mit diesem messen kann, mußte sich ruhig in den Verlust seiner Frau finden.[75]
Es giebt an der Ostküste Beispiele, daß Frauen mit einem Dutzend Männer verheirathet gewesen sind. Utukuluk aus Angmagsalik hatte 8 verschiedene Männer ausprobirt, zum 9. Mal verheirathete sie sich wieder mit ihrem 6. Mann.[76]
Die Scheidung läßt sich, so lange keine Kinder da sind, sehr leicht ausführen; hat die Frau ein Kind bekommen und besonders wenn dies ein Knabe ist, so tritt gewöhnlich ein festeres Verhältniß ein. Der ursprüngliche Grönländer pflegt sich zu verheirathen, sobald er eine Frau versorgen kann. Der Grund hierzu ist häufig der Umstand, daß er einer Frau bedarf, die ihm bei Zubereitung seiner Felle und dergl. mehr behülflich ist. Er verheirathet sich oft, ehe er im stande ist, Kinder zu zeugen, ja an der Ostküste ist es etwas ganz Gewöhnliches, daß er vor der Zeit bereits 3 bis 4 mal verheirathet war. Ist jedoch erst ein Kind geboren, so wird, wie gesagt, die Scheidung seltener.[77]
Kann ein Fänger an der Ostküste mehr als eine Frau unterhalten, so nimmt er gern noch eine dazu, die meisten guten Fänger haben deshalb zwei Frauen, aber niemals mehr.[78] In der[S. 311] Regel scheint die erste Frau es nicht gern zu sehen, wenn sie eine Rivalin bekommt; zuweilen geschieht dies jedoch auf ihren ausdrücklichen Wunsch, wenn sie der Hülfe bei ihren häuslichen Arbeiten bedarf. Der Grund hierzu kann auch ein anderer sein. „Einmal fragte ich eine Frau,“ erzählt Dalager, „weshalb ihr Mann eine Nebenfrau genommen habe. Ich bat ihn selber darum, antwortete sie, da ich des Kindergebärens überdrüssig bin.“ (Grönländische Relationen Seite 8.)
Bei der Einführung des Christenthums wurde natürlich diese ursprüngliche bequeme Art und Weise der Eheschließung an der Westküste Grönlands abgeschafft, und dort wird man jetzt unter ähnlichen religiösen Ceremonien verehelicht wie in Europa. Auch braucht die Braut sich jetzt nicht mehr so sehr zu widersetzen wie früher.
Wenn es aber früher leicht war, eine Frau zu bekommen, so ist das jetzt um so mehr erschwert worden. Die Trauung muß nämlich von einem Pfarrer vollzogen werden, die eingeborenen Katecheten, welche die Stellvertreter der Pfarrer an den verschiedenen Wohnorten sind, dürfen es nämlich nicht thun. Wenn man nun an einem Ort wohnt, wohin der Pfarrer nur vielleicht einmal im Jahre kommt, muß man sich also danach einrichten, gerade um die Zeit einig mit seiner Braut zu sein. Hat aber ein junger, kräftiger Bursche Lust sich kurz nach der Abreise des Pfarrers zu verheirathen, so muß er also ein ganzes Jahr warten, bis der Pfarrer wiederkommt und seiner Ehe den obligaten Segen verleiht.
Daß eine solche Ordnung dazu führt, daß man losere Verbindungen eingeht oder als Ehepaar ohne kirchlichen Segen miteinander lebt, scheint unvermeidlich zu sein, selbst wenn die Grönländer nicht schon von Natur dazu neigten. Diese Ordnung kann daher nur schädlich und herabwürdigend für die Handlung[S. 312] wirken, der man wohl im Grunde dadurch mehr Ansehen hat verleihen wollen, daß nur der Pfarrer sie vollziehen kann.
Bei der Einführung des Christenthums wurde natürlich auch die Vielweiberei abgeschafft. Im Jahre 1745 hatte ein Heide bei Frederikshaab Lust, Christ zu werden, als er aber dazu kam, daß er sich von seiner Nebenfrau trennen sollte, wurde er schwankend, weil er zwei Söhne von ihr hatte, von denen er sich bei der Gelegenheit also ebenfalls trennen mußte, deswegen sattelte er um und ging seiner Wege![79] Verdenken kann man dem Mann das eigentlich nicht.
Aehnliche Fälle, wo verlangt wird, daß ein Mann sich von der einen seiner Frauen trennen soll, mit der er möglicherweise lange Jahre glücklich gelebt hat, kommen noch heute vor, wenn sich die Grönländer von der Ostküste an der Westküste (in der Nähe von Kap Farvel) niederlassen und getauft werden. Es braucht wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, zu welchem Unrecht der Mann hier gegen seine einmal angenommene Frau gezwungen wird. Schon Dalager hält dies für eine Ungerechtigkeit und „es scheint ihm ein Problema zu sein,“ inwiefern es gegen Gottes Ordnung streitet, daß ein Mann mehr als eine Frau hat.
Vielweiberei kommt noch zuweilen an der Westküste vor, und eine Nebenfrau scheint das Erste zu sein, was ein tüchtiger Grönländer sich anschafft, wenn er sich überhaupt auf Weitläufigkeiten einläßt. In Godthaab wurde mir ein Beispiel hiervon erzählt.
Renatus, der tüchtigste Fänger am Grädefjord, hatte sich in ein junges Weib verliebt und nahm sie zur Nebenfrau. Das Verhältniß zwischen ihm und seiner ersten Frau schien indessen ein gutes zu sein, und alles verlief ruhig, bis der Missionar[80][S. 313] davon Kunde erhielt. Dieser hielt dem Manne die große Sünde vor, die er beging, und versuchte es, ihn zu bewegen, daß er seine Nebenfrau aufgeben sollte, was ihm jedoch nicht gelang. Inzwischen wurde von dem Vorstand[81] in Godthaab eine Klage eingereicht. Renatus erschien und allmählich brachte man ihn dahin, sich gutwillig zu fügen. Er sandte seine Frau nach Kangek (außerhalb Godthaab), wo sie im Hause des Katecheten Simons aufgenommen wurde. Gleichzeitig zog er jedoch weiter nördlich in die Nähe von Narsak, und da er dadurch einen gemeinsamen Fangplatz mit den Kangekern erhielt, geschah es häufiger, daß er mit ihnen zusammentraf und sie nach Hause begleitete, wodurch er Gelegenheit hatte, mit seiner zweiten Frau zusammen zu sein. Da indessen später von seinem früheren Wohnplatz aus große Klage geführt wurde, weil man dort Noth litt, nachdem er, der beste Fänger des Ortes, fortgezogen war, so kehrte er wieder dorthin zurück und hat seither ein sittsames Leben geführt. Dies geschah vor einigen Jahren, die Nebenfrau lebt noch immer in Kangek, wo ich sie gesehen habe. Sie trägt ein grünes Haarband zum Zeichen, daß die von ihr geborenen Kinder als unehelich betrachtet werden.
Ein anderer tüchtiger Fänger in der Nähe von Lichtenfels hatte ebenfalls eine Nebenfrau genommen. Als der Missionar dies hörte, ließ er ihn zu sich kommen und versuchte auf ihn einzuwirken, was ihm aber nichts half, denn es trat keine Veränderung ein. Da schrieb der Missionar, erhielt aber keine Antwort, er schrieb strenger und strenger und ließ schließlich[S. 314] ernsthafte Drohungen einfließen; hierauf erhält er eine Antwort, die nur das eine Wort „Susa“ enthielt, was ungefähr so viel bedeutet als: „Ich scher mich den Teufel darum!“ Später scheint der Mann jedoch seiner Nebenfrau überdrüssig geworden zu sein, denn er ließ sich von ihr scheiden.
Die Stellung der Frau in der Ehe ist in Grönland wie in anderen Ländern der Welt sehr verschieden und hängt im wesentlichen von den Individuen ab. In der Regel führt der Mann das Regiment, aber ich habe auch Beispiele gesehen, daß er unter dem Pantoffel der Frau war; im ganzen gehört dies jedoch zu den Ausnahmen. Bei den ursprünglichen Eskimos scheint die Frau im Grunde als Eigenthum des Mannes betrachtet zu werden.
An der Ostküste geschieht es nicht selten, daß bei der Verehelichung ein förmlicher Handel geschlossen wird, indem „ein Jüngling dem Vater eine Harpune oder dergl. bezahlen muß, um seine schöne Tochter zur Ehe zu erhalten“, wie umgekehrt gute Fänger von den Eltern bezahlt werden, wenn sie die Töchter nehmen, und die Letzteren sind gezwungen, sich zu verheirathen, wenn die Väter es wünschen.[82] An der Ostküste geschieht es auch nicht selten, daß zwei Fänger sich darüber einigen, auf kürzere oder längere Zeit mit den Frauen zu tauschen, zuweilen behalten sie die eingetauschte Frau auch ganz. Das Austauschen der Frauen findet auch noch jetzt an der Westküste statt, besonders wenn man im Sommer in Zelten landeinwärts wohnt und sich auf der Rennthierjagd befindet, zu welcher Zeit man sich allerlei Freiheiten erlaubt.
Das Verhältniß zwischen den Ehegatten scheint in der Regel ein sehr gutes zu sein. Ich habe es niemals gesehen oder[S. 315] gehört, daß zwischen Mann und Frau ein unfreundliches Wort gewechselt wurde. Dies ist auch die allgemeine Erfahrung. Die grönländischen Gatten sind überhaupt äußerst rücksichtsvoll gegeneinander, ja man kann häufig sehen, daß sie sich liebkosen. Sie küssen sich, indem sie die Nasen gegeneinander drücken oder sich anschnupfen.
Auch an der Ostküste scheint das Verhältniß zwischen Mann und Frau in der Regel sehr gut zu sein, doch kommen dort nach Kapitän Holms Angaben oft blutige Auftritte vor.
Als Sanimuinak eines Tages mit einer neuen Frau (der vorhin erwähnten Utukuluk mit den 9 Männern) zu seiner Gattin Puitek nach Hause kam, ward diese böse und schalt ihren Mann. Er wurde wüthend, ergriff sie beim Schopf und schlug sie mit der Faust auf den Rücken und ins Gesicht. Schließlich ergriff er ein Messer und stach sie in das Knie, so daß das Blut herausspritzte.[83] Dergleichen Fälle scheinen jedoch bei diesem friedliebenden Volk zu den Ausnahmen zu gehören.
Eine tiefere Liebe zu einander scheinen die Ehegatten nur ausnahmsweise zu haben, und stirbt der eine Theil, so tröstet der Hinterbliebene sich in der Regel sehr schnell. „Verliert ein Mann seine Frau,“ sagt Dalager, „so kondoliren ihm in der Regel nicht sehr Viele seines eigenen Geschlechts. Die Frauen dagegen postiren sich bei ihm hinter der Pritsche und beweinen die Verstorbene, wozu er schluchzt und sich die Nase trocknet.“ Nur wenige Tage später fängt er jedoch bereits wieder an, sich zu schmücken, und gleich wie in den Tagen seiner Junggesellenzeit werden sein Kajak und seine Waffen aufgeputzt, denn hiermit macht der Grönländer am meisten Staat. Wenn er dann in so glänzender Ausrüstung zu den andern Eskimos auf die[S. 316] See kommt, so sagen sie: „Gebt acht, da kommt ein neuer Schwager.“ Hört er das, so schweigt er und lächelt still vor sich hin. Nimmt der Mann eine neue Frau, so läßt sie es sich angelegen sein, über ihre eigenen Unvollkommenheiten zu klagen und die Tugenden der früheren Frau zu loben, „woraus man ersieht, daß die Grönländerinnen ebensosehr danach angethan sind, interessirte Rollen zu spielen wie die Evastöchter anderer Länder und Zonen.“
Aus dem Obenangeführten wird man ersehen können, daß die Tugend in keinem besonders hohen Ansehen in Grönland steht. Die ursprünglichen Grönländer scheinen in der Beziehung sehr vage Begriffe zu haben, und ein Vergehen gegen das sechste Gebot wird kaum als ein Unrecht betrachtet.
Dies geht ganz deutlich aus alledem hervor, was wir jetzt von den Ostgrönländern kennen, ebenso wie aus den Berichten Egedes und der ersten Missionare über die Heiden an der Westküste. Es gilt weder bei den Heiden an der Ostküste noch bei den Christen an der Westküste als Schande für ein unverheirathetes Frauenzimmer, Kinder zu bekommen. Hiervon habe ich sehr häufig Beispiele erlebt. Zwei Mädchen in der Nähe von Godthaab, die guter Hoffnung waren, bemühten sich keineswegs, dies zu verbergen, ja sie legten schon lange, ehe es nöthig war, ein grünes Haarband[84] an, sie schienen beinahe auf ihre grüne Farbe stolz zu sein. Ich habe Grönländerinnen gesehen, welche die grüne Farbe nicht nur zum Haarband benutzten, sondern die auch ihren Anorak damit verzierten, was weder vorgeschrieben noch gebräuchlich ist.
Obwohl die Pfarrer gegen diese schlaffe Moral geeifert haben und bemüht gewesen sind, von der Schulbank aus eine strengere Zucht einzuführen, so ist dadurch ihre Auffassung nur[S. 317] wenig verändert worden, und die jungen Grönländerinnen versuchen es gar nicht, ein Hehl daraus zu machen, wenn sie in einem Verhältniß zu einem Manne stehen; ist dies ein Europäer, so prahlen sie geradezu damit. Hieran sind freilich die Europäer zum großen Theil Schuld, denn die jungen unverheiratheten Männer, die nach Grönland gekommen sind, haben sich in der Beziehung den Grönländerinnen gegenüber schlecht benommen, und infolge des Respekts, in den man sich zu setzen gewußt hat, ist es so weit gekommen, daß der gewöhnlichste europäische Matrose dem besten grönländischen Fänger vorgezogen wird. Dies hat denn auch sichtbare Folgen getragen, indem die Rasse in den 150 Jahren, seit die Europäer sich im Lande niedergelassen haben, derartig mit europäischem Blut vermischt ist, daß es jetzt an der ganzen Westküste äußerst schwer ist, einen unvermischten Eskimo zu finden, wenn es deren überhaupt noch giebt.[85] Und dies ist der Fall, obwohl die Zahl der Europäer im Lande nur einen geringen Bruchtheil der Eingeborenen beträgt, es kommen etwa einige wenige hundert Europäer auf 10000 Eskimos.
Es ist ganz selbstverständlich, daß die Vergehen der Europäer gegen das sechste Gebot nicht dazu beigetragen haben, den Pfarrern die Arbeit mit der Einführung der neuen Moral zu erleichtern. Meine eigene, wie wohl auch die allgemeine Erfahrung geht darauf hinaus, daß die Grönländerinnen in der Nähe der Kolonien, wo sich viele Europäer befinden, leichtfertiger sind als bei den ausschließlich eskimoischen Wohnplätzen. Als Beispiel will ich anführen, daß die Frauen bei Sardlok und theils auch bei Kornok einen weit besseren und tugendhafteren[S. 318] Eindruck machten als die Frauen bei Godthaab, Neu-Herrnhut und Sukkertoppen.
Uebrigens nehmen es nicht allein die unverheiratheten Grönländerinnen in dieser Beziehung so leicht. Die Verheiratheten sind, besonders bei den Heiden, wenn möglich noch weniger eigen damit. Es ist bereits erwähnt worden, daß man an der Ostküste häufig die Frauen austauscht, dies geschieht jedoch stets zwischen bestimmten Männern, und ein Gatte sieht es in der Regel nicht gern, daß Andere als Derjenige, dem er seine Frau überlassen hat, in einem Verhältniß zu ihr stehen, er selber behält sich volle Freiheit vor. Im Winter, während sie in ihren Hütten wohnen, spielen sie jedoch häufig das sogenannte „Lampenauslösch- oder Frauenaustauschspiel“, bei dem die Lampen gelöscht werden und allen Anwesenden völlige Freiheit gestattet ist.
Ein ganz ähnliches Spiel gab es auch bei den Westgrönländern, ehe sie getauft wurden, ob es nicht noch jetzt im Geheimen an den Orten gespielt wird, wo der Pfarrer und die Autoritätspersonen es schwerlich entdecken können, dafür will ich nicht einstehen.
Die Grönländer scheinen indessen nicht von Natur allen Sittlichkeitsgefühls bar zu sein. Sie führen sich im täglichen Leben sehr anständig auf, darüber sind alle Reisenden sich einig, und selbst die Heiden geben im täglichen Leben keine Veranlassung zu irgend welchem Aergerniß.
Wenn ein Heide (und wohl auch mancher christliche Grönländer) die Frau eines anderen Mannes nicht anrührt, obwohl er Lust dazu hat, so scheint in der Regel der Grund hierzu mehr die Furcht zu sein, daß er sich deswegen mit dem anderen Manne entzweien könnte, als der Gedanke ein Unrecht zu begehen. Daß die Grönländer aber nur einen sehr schwachen Begriff in dieser Beziehung haben, davon zeugt unter anderem[S. 319] folgende Redensart, die bei Angmagsalik gebräuchlich ist: „Die Walfische, Moschusochsen und Rennthiere haben sich verlaufen, weil die Männer zu viel Umgang mit den Frauen anderer Leute gepflegt haben.“ Viele Männer behaupten freilich, der Grund hierzu sei der Umstand, „daß die Frauen eifersüchtig waren, weil die Männer zu viel Umgang mit den Frauen anderer Leute pflegten“.
Dies letztere soll auch bewirkt haben, daß der Sund, der das Land früher vom Sermilikfjord bis zur Westküste durchschnitt, sich mit Eis gefüllt hat.[86] Egede erzählt, daß das Gebot von der Monogamie besonders den Frauen sehr zugesagt habe und daß sie ihn häufig aufforderten, es den Männern beim Religionsunterricht recht nachdrücklich vorzuhalten.
In anderer Beziehung scheint dagegen das moralische Bewußtsein der Grönländer weit mehr entwickelt zu sein als dies bei uns der Fall ist. So wird es z. B. als unstatthaft betrachtet, sich mit einem Geschwisterkind oder mit irgend einem nahen Verwandten zu verheirathen, am liebsten soll man eine Ehe mit Jemand schließen, der auswärts ansässig ist. Dies ist eine Regel, die eine kräftige Nachkommenschaft sichert.
Die ungemischten Grönländer sind in der Regel sehr wenig fruchtbar. Zwei bis vier Kinder sind das Gewöhnliche in einer Ehe, doch giebt es auch Ehen mit sechs bis acht, ja mit noch mehr Kindern. Die Grönländerinnen gebären ungeheuer leicht. Graah erzählt ein Beispiel davon, wie wenig Umstände sie sich damit machen. Als er auf seiner Reise an der Ostküste entlang den Bernstorff-Fjord passirte, sollte eine der Frauen gebären. Sie ruderten schleunigst ans Ufer und landeten an einem kahlen Berg auf der Nordseite des Fjords. Während die Entbindung vor sich ging, streckte sich der Ehemann der Länge nach auf dem[S. 320] Berge aus und schlief, bald aber weckte man ihn mit der erfreulichen Nachricht, daß ihm ein Sohn geboren sei. Dies wird, wie bereits erwähnt, als ein Glück angesehen, während die Töchter etwas Unbedeutendes sind. „Auch gab Emenek, so hieß der Mann, seiner Gattin seine Zufriedenheit zu erkennen, indem er ihr ein „Ajungilatit“ (Du bist nicht übel) zulächelte. Mit unserm neuen Passagier setzten wir dann unsere Reise fort.[87]“
Die heidnischen Grönländer tödten verwachsene wie kränkliche Kinder, von denen man annimmt, daß sie nicht leben können, auch solche Kinder, deren Mutter bei der Geburt stirbt und die Niemand säugen kann, werden umgebracht. Dies pflegt zu geschehen, indem man sie im Freien an die Erde oder auch ins Meer wirft.[88]
So grausam dies auch manchen europäischen Müttern vorkommen mag, so kann man doch im Grunde nicht leugnen, daß es eine vernünftige Einrichtung ist, denn bei den harten Lebensbedingungen, unter welchen der Grönländer sein Dasein fristet, wird es begreiflich erscheinen, daß man ungern eine schwächliche Nachkommenschaft aufzieht, die niemals im stande sein wird, Nutzen zu schaffen, sondern darauf angewiesen ist, sich von der Gemeinde ernähren zu lassen. Aus demselben Grunde stehen auch Leute, welche so alt geworden sind, daß sie keinen Nutzen mehr schaffen können, nur in geringem Ansehen, weshalb sie sich oft sehnen, aus der Welt zu kommen.
An der Ostküste soll es vorkommen, daß man alte Leute, von denen man glaubt, daß sie sterben werden, ertränkt oder daß sie sich selber ertränken.
Die grönländischen Kinder werden sehr lange gesäugt. Drei bis vier Jahre ist nichts Ungewöhnliches, und ich habe sogar[S. 321] erzählen hören, daß Knaben von zehn bis zwölf Jahren noch die Brust erhielten.
So theilte mir ein Europäer in Godthaab mit, daß er gesehen habe, wie ein junger 12jähriger Held mit einem eben gefangenen Seehund in seinem Kajak heimgekehrt und sofort zu der Mutter ins Haus gestürzt sei, wo er zwischen ihren Knien stehend, einen Skondrok verzehrte und sein Getränk aus der mütterlichen Brust sog.
Die Grönländer sind ungewöhnlich stolz auf ihre Kinder und thun alles, um sie zufriedenzustellen, besonders wenn es Knaben sind, die stets als angehende Fänger und Stützen der Familie betrachtet werden.


Diese kleinen Tyrannen pflegen in der Regel das ganze Haus zu regieren, und das Wort des Weisen Salomo: „Wer sein Kind lieb hat, der züchtigt es beizeiten,“ wird nicht anerkannt; die Grönländer züchtigen ihre Kinder nie oder nur selten, und ich habe nicht einmal einen Eskimo ein hartes Wort zu einem seiner Kinder sagen hören. Man sollte erwarten, daß die Eskimokinder bei dieser Erziehung unartig und ungezogen würden. Dies ist jedoch keineswegs der Fall; obwohl ich mich ziemlich viel unter den Eskimos an der Westküste bewegt habe, so sind mir nur ein einziges Mal unartige Eskimokinder begegnet, und zwar in einem mehr europäischen als grönländischen Hause. Wenn die Kleinen einigermaßen zur Vernunft gekommen sind, so reicht ein vernünftiges Wort von seiten des Vaters oder der Mutter aus, um sie zu regieren. Niemals habe ich weder im Freien noch in den Häusern gesehen, daß Eskimokinder uneinig waren, sich zankten oder gar sich prügelten.[S. 322] Ich habe sie stundenlang bei ihren Spielen beobachtet, habe sogar an ihrem „Fußball“ theilgenommen (ein eigenartiges Spiel, das viel Aehnlichkeit mit dem englischen Football hat), und dabei kann bekanntlich gar leicht eine Uneinigkeit entstehen, nie aber sah ich unfreundliche Mienen oder Heftigkeit. Wo in Europa würde das wohl möglich sein? Was der Grund zu diesem auffallenden Unterschied zwischen europäischen und Eskimokindern ist, kann ich nicht mit Gewißheit sagen, im wesentlichen beruht es wohl in der äußerst friedlichen und gutmüthigen Natur der Grönländer. Zum Theil mag es auch darin liegen, daß sich die Eskimofrau stets mit ihren Kindern in einem Raum aufhält und sie, wenn sie sich im Freien bewegt, in der Amaute auf ihrem Rücken trägt, ja sie sogar mit auf ihre Arbeit nimmt; sie giebt sich folglich weit mehr mit ihren Kindern ab (sie säugt sie ja auch viel länger), als die europäischen Mütter selbst in den niederen Schichten thun, geschweige denn in den höheren, wo[S. 323] ja die Kinder den Mädchen oder Bonnen fast gänzlich überlassen sind. Infolgedessen herrscht natürlich in Grönland ein weit innigeres Familienleben zwischen Kindern und Eltern als in Europa. Daß die Eskimojungen sich hin und wieder einmal damit belustigen, nach den Enten und Hühnern des Koloniedirektors oder des Pfarrers zu werfen, muß man ihnen nicht zur Last legen, ebensowenig, wenn sie einmal in den Garten des Koloniedirektors eindringen und dort Unheil anstiften.

Man darf nicht vergessen, daß die Achtung vor dem Grundeigenthum völlig außerhalb ihres Fassungsvermögens liegt, wie sie auch nicht begreifen können, daß man nicht alles fangen und nehmen darf, was auf dem Felde wächst und sich dort bewegt; man mag ihnen das noch so viel einprägen, sie werden es doch niemals fassen.
Es ist bereits früher erwähnt worden, daß die Knaben schon zeitig zu ihrem Beruf erzogen werden; auf gleiche Weise erlernen auch die Mädchen den ihren; sie müssen schon in jungen Jahren nähen und der Mutter in ihren häuslichen Verrichtungen zur Hand gehen.
Der Grönländer hat einen äußerst munteren und sorglosen Sinn, er gleicht in dieser Hinsicht einem Kinde. Wenn er einen Kummer hat, was jedoch nur selten vorkommt, so giebt er sich[S. 324] ihm im Augenblick vielleicht mit Heftigkeit hin, er ist aber schnell vergessen und gar bald ist er wieder so strahlend, so munter und so zufrieden mit seinem Geschick wie gewöhnlich.
Dieser sein sorgloser Leichtsinn hat es indessen im Gefolge, daß er nur selten an die Zukunft denkt, und hat er, wie bereits erwähnt, genügend Speise für den Augenblick, so ist er unbesorgt und ißt so lange als etwas da ist, wenn er dann auch später Noth leiden muß, was jetzt leider nur zu oft geschieht und was mit jedem Jahr allgemeiner wird. Man hat ihm dies oft in starken Ausdrücken vorgehalten, aber die Sache hat doch auch ihre guten Seiten, denn dadurch spart er sich die Angst vor der Zukunft, die wohl das größte Leiden unserer Armen ist. Bekommt der Eskimo dann wieder Speisen, so ist er vergnügt wie immer, und die Erinnerung an erlittene Qualen ist ebensowenig im stande, seinen Frohsinn zu trüben, wie die Aussicht auf die ihm möglicherweise bevorstehenden. Das Einzige, was seiner Freude Abbruch thun kann, ist das Gefühl, daß Andere Noth leiden, während es ihm selber gut geht. Hierin findet er sich deswegen auch nur sehr schwer.
Wie bereits mehrfach berührt, sind Gutmüthigkeit, Friedfertigkeit und Bequemlichkeit die hervorragendsten Züge im Charakter des Eskimos. Er widerspricht ungerne einem Anderen, selbst wenn dieser etwas erzählt, was sich ganz anders verhält, jedenfalls kleidet er seine Einwendung in die denkbar mildeste Form. Er sagt einem Anderen selten gerade heraus eine Wahrheit, von der er annehmen kann, daß sie ihm unangenehm ist, er will sich gerne so gut wie möglich mit seinen Nebenmenschen stehen, und nur ganz ausnahmsweise hat er einen Feind. Seine Friedfertigkeit geht sogar so weit, daß er, wenn ihm Jemand etwas stiehlt, was freilich nur sehr selten der Fall ist, das gestohlene Gut niemals[S. 325] zurückfordert, selbst wenn er weiß, wer es ihm genommen hat. Infolgedessen entstehen denn auch nur selten oder eigentlich niemals Zwistigkeiten, das Leben gleitet eben und ruhig dahin. Die Ehrlichkeit ist ein hervorragender Zug in dem Charakter des Eskimos. Wenn die Europäer das Gegentheil behauptet haben, so beruht dies im wesentlichen auf dem Gesichtspunkt, von dem man die Sache betrachtet. Hausgenossen oder Leute zu bestehlen, die am selben Ort wohnen, gilt für verwerflich und geschieht nur höchst selten. Fremde zu bestehlen, ist weniger schlimm, obwohl es keineswegs als erlaubt betrachtet wird und daher auch zu den Ausnahmen gehört. Daß die Eskimos die Europäer häufig bestahlen, als sie zuerst mit ihnen zusammenkamen, kann Niemand wunder nehmen, wenn man bedenkt, wie diese sie behandelten und sogar Einige von ihnen mit sich nach Europa entführten. Die Eskimos betrachteten sie halbwegs wie Feinde, jedenfalls nicht als Freunde, deshalb sahen sie nichts Böses darin, zu stehlen, wo sich die Gelegenheit bot. Dieselbe Auffassung hat sich möglicherweise noch heute in gewisser Beziehung erhalten, jedenfalls gilt es als bedeutend weniger unrecht, Europäer zu bestehlen als die eigenen Landsleute. Und doch kommt das nur selten vor. Ich habe es freilich gesehen, daß gutartige Eskimos Mehl aus den Tonnen der Handelsgesellschaft mausten; es genirte sie nicht im geringsten, daß ich ihnen zusah, sie stahlen ja von der unpersönlichen grönländischen Handelsgesellschaft, was sie allem Anschein nach nicht als Unrecht ansahen.
Als Beweis für ihre Ehrlichkeit den Moralgesetzen gegenüber, die sie achten, mag auf die bereits erwähnten Verhältnisse hingewiesen werden, daß sie z. B. niemals Treibholz anrühren, das über das Hochwasserstandszeichen gelegt ist. Wenn nun die Europäer, was sehr oft geschieht, sich gegen dies Gesetz versündigen,[S. 326] so haben die Grönländer genau so viel Recht, uns zu verachten, wie wir es haben, wenn sie sich gegen unsere Gesetze versündigen.
Wie man aus dem friedlichen Charakter der Grönländer schließen kann, kommt ein Mord nur äußerst selten vor, und sie halten es für sehr grausam, einen Nebenmenschen zu tödten. Der Krieg ist deswegen in ihren Augen etwas Verabscheuenswürdiges, und Soldaten wie Offiziere, die geradezu dazu erzogen werden, ihre Mitmenschen todtzuschlagen, erscheinen ihnen als Unmöglichkeit.
Ein Mord oder ein Mordversuch kommt wohl ausnahmsweise an der Westküste vor. Häufig ist dann, wie auch anderwärts eine Frau die Veranlassung dazu, und der Ueberfall geschieht gewöhnlich auf der See, indem der Eine versucht, dem Andern das Kajak aufzuschlitzen. Die dänische Obrigkeit hat große Schwierigkeiten gehabt, dergleichen Vorfälle zu strafen, da man die Grönländer in der Regel ungerne bestraft und sich nur nothgezwungen in solche Angelegenheiten mischt. Bei Holstensborg wurde vor einer Reihe von Jahren ein Mann, der seine Mutter getödtet hatte, dadurch bestraft, daß man ihm einen neuen Kajak und einige Vorräthe mitgab und ihn auf eine öde Insel verbannte, wo er sehen konnte, wie er allein fertig wurde. Als er indessen eine Weile später nach der Kolonie zurückkehrte und sagte, daß er da draußen nicht leben könne, geschah ihm nichts weiter, und folglich bestand die ganze Strafe, die ihm für die Ermordung seiner Mutter zutheil wurde, darin, daß er ein neues Kajak erhielt.
An der Ostküste werden solche Verbrecher durch den Trommeltanz gestraft. Dies ist die eigentliche Gerichtsbarkeit der ursprünglichen Grönländer, und wie man in der sogenannten civilisirten Welt einander fordert und mit Säbeln und Pistolen duellirt,[S. 327] so fordern die Grönländer sich zum Trommeltanz. Diese Prozedur pflegt bei größeren Versammlungen vor sich zu gehen und besteht, falls sie zur Schlichtung von Streitigkeiten angesetzt wurde, darin, daß die beiden Kämpfenden sich in die Mitte eines Ringes stellen und, von Zuschauern umgeben, auf ein Tamburin oder eine Trommel schlagen, wobei sie Schimpflieder aufeinander singen. Derjenige, der die Lacher auf seiner Seite hat, geht als Sieger aus dem Kampfe hervor. Lächerlich gemacht oder von seinen Mitbürgern ausgelacht zu werden, ist die größte Strafe, die einem Grönländer widerfahren kann, und es kommt vor, daß er sich gezwungen sieht, aus diesem Grunde den Wohnort zu wechseln.
Es ist ganz klar, daß dieser Trommeltanz eine sehr nützliche Institution und ein vorzügliches, leichtausführbares Mittel zur Schlichtung von Streitigkeiten ist. Auch an der Westküste fanden in früheren Zeiten diese Trommeltänze statt, da aber die ersten Missionare es sich in den Kopf gesetzt hatten, daß sie unmoralisch und schädlich seien, wurden sie leider mit der Einführung des Christenthums unterdrückt und ausgerottet. Auch Dalager war durchaus nicht mit dieser Vorgangsmethode einverstanden, und man muß ihm völlig Recht geben, wenn er sagt: „Wahrlich, wenn man bei uns mit gleichem Nutzen und Zweck tanzen wollte, so würde man gar bald sehen, wie sich jeder zweite Moralist und Advokat in einen Tanzmeister verwandelte.“
Ein anderer Umstand, der die Missionare von der Abschaffung dieser Trommeltänze hätte zurückhalten müssen, ist der, daß dieselben ein großes Vergnügen für die Grönländer waren. Bekanntlich sind aber Vergnügungen gesund, und die Grönländer haben deren nicht allzu viele.
Der Eskimo hat ein ausgeprägtes Freiheits- und Selbstständigkeitsgefühl.[S. 328] Er ist daran gewöhnt, sein eigener Herr zu sein und nach eigenem Belieben umherzustreifen. Allerdings übt der Hausvater in jeder Familie ein gewisses Regiment aus, doch ist dies so gelinde und so wenig hervortretend, daß man es kaum empfindet. Dienstboten hat man in Grönland gewissermaßen auch, indem häufig Frauen im Hause des Großfängers aufgenommen werden, wo sie gemeinsam mit der Hausfrau, den Töchtern und Schwiegertöchtern die Arbeiten verrichten. Sie sind ihnen jedoch in der Regel gleichgestellt und leben ebenso wie sie im Hause, so daß das dienstbare Verhältniß mehr dem Namen nach als in Wirklichkeit existirt. Deswegen ist es kein Wunder, wenn es dem Grönländer schwer wird, in ein dienstbares Verhältniß zu treten, er betrachtet das als entwürdigend. Vor allen Dingen mag er sich nichts befehlen lassen. Der grönländische Fänger kann deswegen mit Fug und Recht auf die Frage, wen er für höher gestellt betrachte, sich oder den Landesinspektor (ungefähr was bei uns ein Gouverneur ist), die Antwort geben, daß er das nicht wisse, denn der Inspektor habe seine Vorgesetzten im Heimathslande, er selber aber habe Niemanden, der ihm etwas befehlen könne. Aus diesem Grunde war es anfänglich sehr schwer für die Europäer, Dienstboten zu bekommen. Allmählich hat jedoch die Civilisation die Eingeborenen in dieser Hinsicht genügend demoralisirt, so daß sie jetzt gerne in den Dienst der Europäer treten; es kommt sogar häufig vor, daß selbst Fänger Dienste bei der Handelscompagnie annehmen, sie sind sogar oft stolz darauf, denn dann erhalten sie wie andere dänische „Beamten“ jeden Morgen ihren Schnaps, und den können die übrigen Grönländer nicht bekommen.
Noch immer aber haben die Hausfrauen über den Stolz ihrer grönländischen Dienstmädchen viel zu klagen. Diese sind tüchtig und fügsam, so lange sie gut behandelt werden, sagt[S. 329] man ihnen aber ein einziges hartes Wort, so genügt das oft für sie, um ohne weiteres auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden, und wenn die Hausfrau nicht zu Kreuz kriechen will, so muß sie sich nach einem andern Mädchen umsehen.
Ursprünglich besaßen die Grönländer keine entwickelte Religion. Sie hatten jedoch viel Aberglauben und viele Sagen, die von verschiedenartigen übernatürlichen Wesen handelten, von deren Kräften und Eigenschaften sie freilich nur sehr unklare Begriffe besaßen. Ihre Priester und Weisen, die sog. Angekak, suchten ihre Landsleute durch mancherlei wunderliche Künste zu mystifiziren, um die Herrschaft über sie zu erlangen. Sie waren übrigens in der Regel die Verständigsten unter ihnen und konnten oft auch mit wirklich vernünftigen Rathschlägen helfen. Die getauften Grönländer haben ihren alten Glauben übrigens durchaus nicht ganz aufgegeben, sie sind noch bis auf den heutigen Tag sehr abergläubisch und sprechen in vollem Ernst von den wunderbaren Fabelwesen, die auf dem Inlandseise, weiter ins Land hinein, am Strande und auf dem Meere hausen. Die alten Sagen werden noch vielfach des Abends von dem Einen oder dem Anderen einem aufmerksam lauschenden Kreise vorgetragen; die Grönländer sind vorzügliche Erzähler und begleiten ihren allerdings oft ein wenig breiten Vortrag mit lebhaften Gebärden, die häufig darauf berechnet sind, die Zuhörer ins Lachen zu bringen.
Der Grönländer hat einen sehr scharfen Verstand in Bezug auf alles, was innerhalb seines Erfahrungskreises liegt. Hiervon zeugen ja auch seine sehr sinnreichen Geräthschaften, bei denen das vorhandene Material so gut wie nur möglich ausgenutzt[S. 330] worden ist. Selbst der kleinste knöcherne Knopf, die geringste Schnalle ist so vorzüglich, daß sie nicht besser herzustellen ist, und wir können sie in der Beziehung nichts lehren. Ihre Bemerkungen den Europäern gegenüber können oft sehr treffend und verständig sein. Hiervon erhielten auch die ersten Missionare allerlei fühlbare Beweise, indem die Fragen der Grönländer in Bezug auf manche Punkte der christlichen Lehre sie oft in eine schiefe Stellung brachten. Als Beweis für ihre leichte Auffassung mag erwähnt werden, daß sie verhältnißmäßig leicht lesen und schreiben lernen, so daß die Mehrzahl von ihnen es jetzt kann, ja Viele haben es sogar sehr weit darin gebracht. Domino und Brettspiele, ja sogar Schach lernen sie sehr leicht.

Ihr Formsinn ist ziemlich entwickelt, und sie zeigen sogar häufig große Anlagen zur bildenden Kunst. Sie werden häufig gute Zeichner, und als Beweis ihrer Tüchtigkeit in der Schnitzkunst[S. 331] mag auf die beiden geschnitzten Köpfe, die auf Seite 330 abgebildet sind, hingewiesen werden. Man kann keinen Augenblick im Zweifel sein, daß der Verfertiger hier seine eigene Rasse hat nachbilden wollen.
Durch ihre obenerwähnte Sagendichtung, die von Dr. Rink[89] zusammengestellt und übersetzt worden ist, erhält man einen guten Einblick in das Seelenleben der Grönländer. Sie zeugt von einer großen Phantasie wie auch von Gefühl und von einer gewissen poetischen Auffassung vieler Dinge in der Natur. Außer der Sagendichtung und ihren Erzählungen von verschiedenen Heldenthaten haben die Eskimos ursprünglich noch eine andere Dichtung, die aus Gesängen verschiedener Art besteht. In früheren Zeiten waren dies entweder Spottlieder über Andere, die bei den früher erwähnten Trommeltänzen gesungen wurden, oder es waren gewöhnliche Lieder, die verschiedene Dinge oder Ereignisse schilderten und häufig auf eine eigenartig kindliche, ansprechende Weise bei den Schönheiten der Natur und des Lebens verweilen. Oft sind es auch Liebesgesänge sehr kindlicher Art, in denen die Sehnsucht des Liebenden und die Tugenden der Geliebten beschrieben werden.
Bei meinem vielfachen Umherstreifen hatte ich häufig Gelegenheit, die Bemerkung zu machen, daß die Grönländer viel Sinn für Naturschönheiten haben. So geschah es einmal, als ich mit meinem Freunde Joel, von dem ich später eingehender erzählen werde, in meinem Kajak im Ameralikfjord ruderte, daß wir an einer Bergspitze vorüberkamen und plötzlich die Felsen am Ende des Fjordes sonnenbeleuchtet daliegen sahen; es war nebliges Wetter, aber die Wolken hatten sich zertheilt und hingen in Fetzen über den Gipfeln, während die Schneemassen im[S. 332] Sonnenlicht erglänzten. Es war ein Anblick strahlender Schönheit; Joel hielt mit dem Rudern inne und brach in den Ruf „binne kaok“ (wie schön!) aus. Er war im übrigen ziemlich unbeleckt von der Kultur, so daß man ihm kaum derartige Gefühle zugetraut haben würde. Ich habe auch die Grönländer ihr Sommerleben, die Rennthierjagd und die Schönheit der Natur zu dieser Zeit in den schönsten Farben beschreiben hören.
Die Musik zu den Liedern wird häufig von dem Dichter selber komponirt, und da die Grönländer auffallend musikalisch sind, so kann diese Musik trotz ihrer Einförmigkeit oft einen ganz eigenthümlichen Charakter haben. Als Probe ihrer Lieder und ihrer Musik mag der untenstehende neue Gesang von Grönlands Ostküste mitgetheilt sein, der mir freundlichst von Frau Signe Rink überlassen wurde.[90] Dieselbe Dame hat verschiedene werthvolle Liederproben gegeben; leider gestattet mein Raum es nicht, sie hier aufzunehmen. Die Melodie ist von Frau Ganglen in Julianehaab aufgezeichnet worden.
Klagelied des Eskimos.
Eine Eskimogruppe, im Treibeise festgehalten, ist von Hungersnoth bedroht.
Langsam und durch die Nase.
Bei der Einführung des Christenthums und der Civilisation wurde, wie wir gesehen haben, der Trommeltanz abgeschafft, und damit trat auch ein Verfall oder eine theilweise Veränderung der Verskunst ein. Noch immer aber ist das Dichten bei den Grönländern ganz allgemein.
Der Inhalt der Lieder kann zum Theil scherzhafter Art sein, indem sie auf mehr oder weniger unschuldige Art die Eigenheiten ihrer Mitmenschen lächerlich zu machen suchen, — die Grönländer haben nämlich einen scharfen Blick für das Komische. Es existiren auch mehrere derartige Lieder über die Mitglieder der Expedition, doch ist es mir leider niemals gelungen, derselben habhaft zu werden. Einzelne Lieder behandeln auch allerlei Ereignisse und Begebenheiten. Sehr allgemein sind die Kinderlieder, die häufig für irgend ein bestimmtes Kind gedichtet und diesem von dem Verfasser zum Geburtstag geschenkt werden.
Die Musik zu den Liedern wird zum Theil bekannten europäischen Melodien entlehnt, häufig werden aber auch eigene Melodien dazu gedichtet, die freilich in der Regel auch von europäischer Musik, sowohl weltlicher wie geistlicher, beeinflußt sind. Die Grönländer singen sehr gern; besonders im Sommer, wenn sie in den Frauenböten rudern, kann man sie häufig ihre Lieder, theils geistlicher, theils weltlicher Art, im Chor anstimmen hören. Es klingt sehr feierlich, wenn dieser Gesang des Abends[S. 335] über die spiegelblanke Wasserfläche dahinschallt, und er ersetzt das Hirtenhorn und das melodische Geläute der Herdenglocken, die daheim bei uns in den Bergen ertönen.
Der Kirchengesang ist sicher dasjenige, was den Grönländern beim Gottesdienst am meisten zusagt. Als Beweis für ihre musikalischen Fähigkeiten mag hier noch angeführt werden, daß sich in Godthaab ein Seminar zur Ausbildung von Katecheten befindet, in welchem das Hauptgewicht auf die Ausbildung in der Kirchenmusik gelegt wird. Alljährlich zur Jubelfeier wird ein Chorgesang von den am Orte ansässigen Grönländerinnen und den Katechetenlehrlingen des Seminars eingeübt. Dieser Chor singt ungemein schön und enthält viele gute Stimmen.
Wenn man die Frage aufwirft, ob wir mit unserer Civilisation dem grönländischen Volke Nutzen gebracht haben, so muß die Antwort leider verneinend lauten. Wir haben den Grönländern nichts gebracht, was ihnen den Kampf ums Dasein erleichtert hat. Seine Waffen haben wir nach keiner Richtung hin verbessern können. Eisen hat er allerdings bekommen, aber theils besaß er es bereits vorher, theils kann er es sehr gut entbehren. Es wird den Anschein haben, als wenn die Einführung der Gewehre ein großer Fortschritt für ihn gewesen sein müsse, aber dies ist durchaus nicht der Fall, im Gegentheil, die Schußwaffen haben einen nicht geringen Schaden angestiftet. Durch die Büchse ist der weit wichtigere Fang mit Harpune und Blase in Verfall gerathen. Der Letztere kann bei jeglichem Wetter vorgenommen werden und ist weit sicherer als der Büchsenfang, wozu man gutes Wetter haben muß, und wobei man ungefähr doppelt so viele Thiere, wie man bekommt, anschießt oder tödtet.[S. 336] Außerdem hat die Schrotbüchse in manchen Gegenden die Fänger veranlaßt, über dem Vogelschießen den Seehundsfang zu vernachlässigen, der doch stets dasjenige ist und bleiben wird, worauf die Lebensfähigkeit der eskimoischen Bevölkerung beruht, denn der Seehund giebt Fleisch und Speck für die Speisen, wie zur Feuerung, er giebt Fell zu der Kajakbekleidung, zu der täglichen Kleidung, den Stiefeln, dem Kajak, dem Frauenboot, dem Zelt, dem Haus etc., — mit anderen Worten, es kann nicht ersetzt werden. Ein anderer Umstand, der in Bezug auf die Schrotbüchse nicht außer acht zu lassen ist, ist der, daß die Grönländer durch dieselbe in stand gesetzt sind, einen so intensiven Fang auf verschiedene Vögel, wie z. B. auf die Eidergans, zu betreiben, daß ihre Zahl jährlich bedeutend verringert wird, was sich bald genug bemerkbar machen muß. Dies wird um so schlimmer sein, als der Vogelfang jetzt zum Theil eine Lebensbedingung für viele Familien geworden ist, so z. B. lebt jetzt die Bevölkerung in der Gegend von Godthaab den größten Theil des Winters fast ausschließlich davon.
In früheren Zeiten fingen die Eskimos Vögel mit einem Wurfpfeil; sie konnten viele damit fangen, doch war die Zahl der erlegten Vögel nicht größer als ihr Zuwachs, und alles, was er verwundete, wurde die Beute des Jägers. Wenn er jetzt aber in eine Schar Eidergänse hineinschießt, so macht er viele lebensunfähig, ohne daß sie ihm zu gute kommen. Wir können uns deswegen nicht damit schmeicheln, daß wir seine Fangmethode verbessert haben.
Dagegen haben wir ihm einen unersetzlichen Schaden mit allen unseren europäischen Produkten zugefügt. Wir haben ihm Gefallen an Kaffee, an Tabak, Brot, europäischen Stoffen und Putz beigebracht, und er hat uns seine unentbehrlichen Seehundsfelle und seinen Speck verkauft, um sich diese augenblicklichen[S. 337] zweifelhaften Genüsse zu ermöglichen. Inzwischen verfielen sein Frauenboot sowie sein Zelt in Ermangelung von Fellen, ja, es geschah sogar, daß der Kajak, die Bedingung für sein Dasein, ohne Bezug am Strande lag, die Lampen im Hause mußten oft im Winter gelöscht werden, weil es an Speck fehlte, da man den Wintervorrath zum Theil schon im Herbst verkauft hatte. Der Grönländer selber hüllte sich während des Winters oft in schlechte europäische Lumpen statt in die guten, warmen Pelzkleider, die er früher getragen, die Armuth griff mehr und mehr um sich, die Sommerreisen mußten zum größten Theil eingestellt werden, da ja Frauenboot und Zelt fort waren, und man mußte das liebe lange Jahr in den engen Häusern leben, wo ansteckende Krankheiten mehr denn je herrschten.
Als schlagendes Beispiel, wie sehr es mit den Grönländern zurückgegangen ist, mag hier angeführt werden, daß sich an einem Wohnplatz in der Nähe von Godthaab vor einigen Jahren noch 11 Frauenböte[91] befanden, — jetzt war nur noch eins dort, und dies gehörte dem Missionar.
An diesem Platze herrschten jedoch ganz eigenartige Verhältnisse, die zu dem Rückschritt beigetragen hatten, wie das Fortziehen mehrerer guter Fänger etc. Allerdings hat es nach der Zählungsliste den Anschein, als wenn die Bevölkerung im Zunehmen begriffen sei, da sich eine schwache Vermehrung der Einwohnerzahl bemerkbar macht; aber dies sind nur übertünchte Gräber. Es ist noch nicht soweit gekommen, daß der Zuwachs im Stillstand begriffen ist, aber Niemand kann darüber im[S. 338] Zweifel sein, daß dies bevorsteht, und dann wird es ebenso sicher bergab gehen, und zwar mit großer Geschwindigkeit. Die Kränklichkeit hat in den letzten Jahren in beunruhigendem Maße zugenommen, besonders sind die Auszehrung und die Tuberkulose der Krebsschaden der grönländischen Bevölkerung. Es giebt kaum ein Volk, in dem eine so verhältnißmäßig große Zahl davon ergriffen ist. Während wir in Godthaab waren, starben 2 Auszehrungspatienten, und 10–12 andere gingen einem sicheren Tode entgegen, — einige von ihnen starben bereits im folgenden Jahre, und dabei zählte die ganze Gemeinde nur etwa 100 Seelen! Die Krankheit war so allgemein, daß es beinahe leichter war, Diejenigen aufzuzählen, welche sie nicht hatten, als Diejenigen, welche damit behaftet waren. Allerdings scheinen die Grönländer eine ganz ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen diese Krankheit zu besitzen, sie können so krank sein, daß sie schon in jungen Jahren starkes Blutspucken haben, und dabei doch ein verhältnißmäßig hohes Alter erreichen. Ich habe Fänger gekannt, die in hohem Grade schwindsüchtig waren, die einen Tag einen Blutsturz hatten, am nächsten aber schon wieder auf den Fang ausgingen.
In der Regel sind sie aber schwächlich und können nur wenig Nutzen schaffen, was natürlich in hohem Grade lähmend auf eine so kleine Gemeinde wirkt. Eine Seuche, die ihre Opfer schnell dahinrafft, wäre natürlich sehr vorzuziehen.
Es kann zwar nicht behauptet werden, daß wir Europäer die Krankheit ins Land geschleppt haben, sie war vor uns da, der europäische Einfluß hat sie aber zur Blüthe gebracht, indem er, wie bereits nachgewiesen wurde, bewirkt hat, daß die Grönländer jetzt zum größten Theil in den kleinen feuchten Häusern leben, wo die Ansteckungskeime selbstverständlich den vorzüglichsten Boden finden. Außerdem ist die magere europäische[S. 339] Kost nicht gesund für diese Leute, die gewohnt sind, von Fleisch und Speck zu leben. Der beste Beweis hierfür ist der Umstand, daß die Krankheit vorzugsweise in der Nähe der Kolonien vorkommt, wo die von der Handelscompagnie Angestellten zum großen Theil von europäischen Waren leben. Als andere mitwirkende Ursache könnte möglicherweise auch erwähnt werden, daß sie jetzt häufig im Winter Mangel an Speck leiden und in kalten Häusern und in schlechter Bekleidung sitzen müssen.
Ein stetig fortschreitender Rückgang von ehemaligem Wohlstand und Gedeihen zu theilweise hoffnungsloser Armuth und Schwäche, — das ist die Ausbeute, auf welche die Grönländer zurückblicken können!
Haben wir ihnen aber dafür nicht das Christenthum und die Aufklärung gebracht?
Ja, freilich, es kann nicht geleugnet werden, daß Egede einzig und allein nach Grönland ging, um den Heiden das Licht des Evangeliums zu bringen, und aus demselben Grunde haben die Europäer seine Wirksamkeit fortgesetzt. In der Beziehung ist ein schönes Resultat erreicht worden: alle Bewohner der Westküste Grönlands sind jetzt Christen, jedenfalls dem Namen nach, und die Aufklärung geht so weit, daß die meisten jetzt lesen und schreiben können.
Es liegt indessen klar auf der Hand, daß man einem Eskimo unmöglich höhere geistige Interessen beibringen und gleichzeitig verlangen kann, daß er ein ebenso guter Fänger ist wie zu jenen Zeiten, als ihn nur ein einziges Interesse beseelte, nämlich das, sich zu einem tüchtigen Kajakruderer und Seehundsfänger auszubilden. Er lebt sozusagen am Rande des Daseins, eine Anspannung aller seiner Kräfte ist erforderlich, wenn er den Kampf mit der harten Natur erfolgreich aufnehmen soll, — ein wenig mehr Ballast, und er wird sinken.
[S. 340]
Da drängt sich uns die Frage auf: kann diese geistige Gelehrsamkeit den Rückgang ersetzen, den die Berührung mit der Civilisation nothwendigerweise im Gefolge hat? Was ist vorzuziehen, — ein getaufter Eskimo, der lesen und schreiben kann, der alle möglichen geistigen Interessen hat, der aber nicht im stande ist, seine Familie zu ernähren, dessen Gesundheit untergraben ist, und der tiefer und tiefer in das Elend versinkt, — oder ein Heide, der freilich, wie ein Missionar sagen würde, „in geistiger Finsterniß“ lebt, der aber eine kräftige Gesundheit hat, sich gut steht, seine Familie ernährt und immer zufrieden ist? Von dem Standpunkt der Eskimos betrachtet, kann man wohl kaum über die Antwort im Zweifel sein.
Und doch sind die Grönländer nachsichtiger behandelt worden als jegliches andere uncivilisirte Volk, das unseren Civilisationsversuchen ausgesetzt war. Man kann der dänischen Regierung für ihr Auftreten nur die höchste Anerkennung zollen.
Das wirkliche Wohl der Grönländer ist ihr wesentlicher Beweggrund gewesen. Es giebt kein zweites Beispiel, daß sich ein Jagdvolk, welches mit der Civilisation in Berührung kam, so gut und so lange gehalten hat, wie das hier der Fall gewesen, und die Behandlung der Grönländer kann in dieser Beziehung anderen Staaten als leuchtendes Beispiel dienen.
Trotzdem ist das Resultat, wie wir gesehen haben, ein sinkendes Volk. Dies ist wahrlich eine ernste Mahnung, nicht von dem Gedanken auszugehen, daß jegliche Missionswirksamkeit nützlich ist; freilich kann dadurch einzelnen Heiden das Licht des Christenthums gebracht werden, den meisten Völkern aber wird nur ein Rückschritt durch die plötzliche Berührung mit der Civilisation oder vielmehr deren Produkten verursacht, denn die civilisirten Völker theilen den uncivilisirten stets zuerst ihre Laster, nicht aber ihre Tugenden mit.
[S. 341]
Stellt man dann zum Schluß die Frage, ob denn keine Rettung für die grönländische Bevölkerung möglich ist, so muß man einräumen, daß das einzige Mittel in dem Rückzuge der Europäer bestehen würde, — man müßte dem Grönländer das Land völlig wieder überlassen, dann würde er, von europäischen Produkten nicht in Versuchung geführt, möglicherweise im stande sein, sich wieder zu erheben. Aber eine solche Möglichkeit ist kaum denkbar; es würden andere civilisirte Völker kommen, und der schädliche Einfluß würde in gleichem Maße fortgesetzt werden. Außerdem droht dem Grönländer noch eine andere Gefahr, — nämlich das beunruhigende Abnehmen der Seehunde. Dies beruht nicht so sehr auf dem Fang, den er selber betreibt, da dieser so verschwindend ist im Verhältniß zu demjenigen, den die europäischen und amerikanischen Seehundsfänger betreiben, besonders auf dem Treibeis bei New-Foundland, wo die neugeborenen Jungen jährlich zu Hunderttausenden geschlachtet werden.
Es ist also abermals die weiße Rasse, die ihm Schaden zufügt. Aber selbst wenn er es wüßte, würde es nicht in seiner Macht liegen, diesem Vorgehen eine Grenze zu setzen.
So ist denn dies Volk ganz sicher und unwiderruflich dem Untergang geweiht, es wird in einer näheren oder ferneren Zukunft unterliegen und zu einem Schatten von dem, was es früher gewesen, hinschwinden. Und doch ist der Grönländer zufrieden und glücklich, vielleicht glücklicher als die Meisten von uns, er haßt uns nicht, sondern ist fröhlich und freundlich, wenn wir zu ihm kommen. Die europäischen Nationen könnten viel von den Eskimos lernen!
[43] Diese Aehnlichkeit ließe sich ja übrigens auch dahin erklären, daß es eine sehr alte Rasse ist, bei der alles zu bestimmten Formen erstarrt ist, und die sich jetzt allmählich verändern; hierauf scheint ja auch ihre nach jeder Richtung hin abgesonderte Stellung wie ihre vollkommenen Geräthschaften zu deuten. Andere Verhältnisse scheinen jedoch theilweise gegen eine solche Annahme zu sprechen.
[44] Diesen Grund giebt Dr. Rink in seiner Abhandlung: „The Eskimo Tribes“ an. Mittheilungen über Grönland, Bd. XI., Kopenhagen 1887, S. 32.
[45] Dr. Rink „Eskimoische Märchen und Sagen“, Supplement, Kopenhagen 1871, S. 217.
[46] Die Inlandseskimos in Alaska betreiben noch heutzutage Fischfang auf den Flüssen in Kanoes aus Birkenrinde.
[47] Das Beziehen der Böte mit Fellen scheint an mehreren Stellen der Erde, ganz unabhängig voneinander, erfunden zu sein. Coracle oder Korbböte (aus Korbgeflecht angefertigt und mit Fellen bezogen) wurden von den alten Briten und Gelen benutzt, um über große Ströme und Buchten zu setzen. Aehnliche Böte sollen noch jetzt bei der ländlichen Bevölkerung Großbritanniens und Irlands benutzt und mit Fellen oder mit Wachstuch überzogen werden. Jedenfalls weiß ich, daß die Fischer an der Westküste von Irland ganz allgemein Fellböte benutzen, die große Aehnlichkeit mit den grönländischen Frauenböten haben. Ferner sollen ähnliche Fellböte seit undenklichen Zeiten in Indien in Gebrauch sein. In Afrika, Amerika, Australien und Polynesien hat man sie bei halbwilden Volksstämmen gefunden unter Verhältnissen und mit Abweichungen, welche die Annahme berechtigt erscheinen lassen, daß sie an Ort und Stelle erfunden und nicht von anderen Völkern eingeführt sind. Die Ree-Indianer benutzen ebenfalls solche Böte.
[48] Die Türken haben ein Wort „Kajek“ für eine gewisse Bootsart. Dasselbe Wort kommt auch in der serbischen, der bulgarischen wie in den meisten slavischen Sprachen vor — theilweise unter der Form Kajuk — bis nach Sibirien hinein; ferner findet man es im Griechischen, Rumänischen, Kurdischen etc. Ich habe es indessen nicht durch Asien verfolgen können. Wahrscheinlich ist es ein türkisches Wort und stammt in diesem Falle mehr aus Osten. Die Kamtschadalen benutzen auf den Flüssen Böte, die sie Koiakh-taktim nennen. Dies ist möglicherweise dasselbe Wort, indem taktim eine auffallende Aehnlichkeit mit taktou hat, dem Namen für eine Bootsart, die auf dem Meere gebraucht wird. (Siehe Kracherinnikow, Hist. et deser. de Kamtschatka, Amsterdam 1770. Bd. I.) Der erste Theil von Koiakh erinnert stark an das Kajek der Türken und das Kajak der Eskimos, es bedarf indessen eines umfangreicheren Materials, um zu entscheiden, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Wörtern stattfindet. Die Entfernung zwischen dem Ort, von dem die Türken gekommen sind, und der Heimath der Kamtschadalen ist jedoch möglicherweise nicht so sehr groß.
[49] Die Nordwestindianer und Tschuktschernen benutzen übrigens auch Harpunen und die große Blase zum Fang der großen Seethiere, indem sie diese Waffen von größeren offenen Kanoes oder Fellböten aus werfen. Es hat jedoch den Anschein, als wenn sie die Benutzung von den Eskimos gelernt hätten.
[50] Siehe u. A. Cook and King, „A voyage to the Pacific Ocean etc. third edition“, London 1785, vol. II., S. 513. Siehe ebenfalls spätere Schriftsteller wie Eliot u. A.
[51] Merkwürdig ist es, daß die Bewohner der Insel St. Lawrence die Kajaks gar nicht zu kennen scheinen. Sie haben nur große, offene Fellböte vom selben Bau wie die Tschuktschernen. Vergl. Nordenskjölds Vegareise um Asien und Europa (Kristiania), Zweiter Theil, Seite 249.
[52] F. v. Lütke Ermans Archiv, Bd. III., Seite 446–464, 1843.
[53] Ueber die verschiedenen Formen des Wurfbrettes bei den Eskimos siehe Masons Abhandlung darüber: Annual Report etc. of Smithsonian Institution von 1884, Part II., Seite 279.
[54] Dort oben haben sie den ganzen Winter viele Seehunde auf dem Eise fangen können und dies ist eine Fangart, die sie höher im Norden erlernt haben müssen, und die dort ihre Hauptfangart gebildet hat.
[55] Gustav Storm, Studien über die Vinlandsreisen u. s. w. Jahrbücher für Nordische Alterthumskunde und Geschichte 1887, Kopenhagen 1888, Seite 56.
[56] Ueber das Zusammentreffen mit den alten Norwegern besitzen auch die Eskimos selber mehrere Sagen. Siehe Rinks eskimoische Sagen und Märchen.
[57] Man hat gewöhnlich aus der Flóamannasage den Schluß ziehen wollen, daß der früher bereits erwähnte Thorgils Orrabeinsfostre bereits um das Jahr 1000 die Eskimos an der südlichen Ostküste Grönlands getroffen haben soll, indem die dort erwähnten „Zauberinnen“ solche gewesen sein müssen. Schon Professor Storm hat darauf aufmerksam gemacht (Studien über die Vinlandsreisen, Sonderdruck, Seite 56), daß der abenteuerliche Charakter dieser Sage uns nicht gestattet, einen Schluß nach dieser Richtung hin zu ziehen. Man darf auch nicht vergessen, daß die Handschrift des ersteren aus dem Jahre 1400 stammt, also lange nach der Zeit, in welcher die Norweger mit den Eskimos an der Westküste zusammentrafen. Selbst wenn mit der Zauberin wirklich Eskimos gemeint sind, was höchst zweifelhaft ist, so kann dies eine spätere Hinzufügung sein.
[58] Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 58.
[59] Die ursprünglichen Frauenpelze pflegten nach unten zu in eine Schnippe auf dem Magen und eine auf dem Rücken zu enden, die einem Schwanze glich. Etwas Aehnliches scheint auch bei den Kamtschadalen oder Itelmernen gebräuchlich gewesen zu sein; Steller erwähnt, daß die Kuklanka der Frauen mit einem Schwanz versehen sei. Er erzählt auch, daß die Itelmerner Winter- und Reiseschuhe haben mit Sohlen aus Seehundsfell und das übrige aus Rennthierfüßen. Diese heißen Kamas, was ihm einen Anklang an das grönländische „Kamikker“ zu haben scheint.
[60] Zuweilen benutzt man auch das Fell des blauen Seehundes (phoca barbata) oder das des Ringseehundes phoca foetida. Das Erstere ist das stärkste von allen Seehundsfellen, aber diese Seehundsart findet sich auf der Westküste nur sehr selten; an der Ostküste dagegen ist sie die gewöhnlichste von allen, weswegen das Fell sehr häufig für die Kajaks verwendet wird.
[61] Dieselbe pflegt aus dem ganzen Fell eines jungen Ringseehundes (Phoca hispidia) gemacht zu sein, das enthaart, aufgepustet und dann getrocknet wird. Der Fangriemen besteht aus dem Fell der Bartrobbe, Phoca barbata (Ugsuk), das in dünne Streifen geschnitten wird. Für noch besser sieht man die Haut des jungen Walrosses an.
[62] Eine Ausnahme hiervon bildet eine besondere Art Harpune (Siga gut), die bei Kangamiut und nördlich davon zur Walroßjagd benutzt wird. Sie ist ziemlich groß, hat zwei Handgriffe, einen für den Daumen an der einen Seite und einen für die anderen Finger an der anderen Seite, sie wird mit der Hand ohne Wurfbrett geworfen.
[63] Man hält das Ruder, indem man damit nach der Seite ausholt, in einer etwas schrägen Lage, so daß das Ruderblatt durch die Bewegung das Wasser unter sich wegdrückt und dadurch selber eine aufwärtsstrebende Bewegung erhält.
[64] Wo das Wasser im Winter an Grönlands Westküste offen ist, staut sich doch stets Eis am Strande auf, und bei Ebbe kann dies ungefähr eine 10 Fuß hohe, lothrechte, glatte Eiswand bilden.
[65] Diese und viele ähnliche Berichte sind von den Grönländern selbst in ihrer eigenen Sprache geschrieben und in dem grönländischen früher erwähnten „Atuagagdliutit“ in Godthaab veröffentlicht. Die hier mitgetheilten Züge sind später von Dr. Rink in seinem Buch: „Ueber die Grönländer, ihre Zukunft u. s. w., Kopenhagen 1882“ veröffentlicht.
[66] In einer ganzen Anzahl von Häusern, namentlich in der Nähe der Kolonien, findet man jetzt jedoch häufig Oefen, die von der grönländischen Handelscompagnie gekauft sind und die mit Torf und Mövenhaufen (Guano) geheizt werden. Gleichzeitig brennen freilich auch stets Thranlampen.
[67] Der Inhalt dieser Rennthiermägen ist, wie bereits früher in diesem Buche erwähnt wurde, eine große Delikatesse für die Grönländer.
[68] Es kann uns nicht wundern, daß die Eskimos, besonders im Anfang, eine sehr schlechte Meinung von den Europäern erhielten, denn viele von den Leuten, die ausgesandt wurden, waren zum Theil Verbrecher, die durch ihr Benehmen den guten Grönländern ein Aergerniß gaben. Dies war u. a. der Fall mit den Männern und Frauen, die im Jahre 1728 mit Major Paars ausgesandt wurden. Die Heiden fragten oft, woher es käme, daß die Europäerinnen so frech wären und jeglichen weiblichen Anstandes ermangelten. Ob das Benehmen der Europäer nach jener Zeit stets danach angethan gewesen ist, ihnen eine bessere Ansicht beizubringen, ist wohl sehr zweifelhaft.
[69] Dalagers „Grönlands Relationer“ 1752, Kopenhagen, S. 15–16.
[70] Für die nördlicher wohnenden Grönländer kommen noch Hunde und Hundeschlitten dazu.
[71] Wenn Mehrere zusammen auf Jagd gegangen sind, so giebt es auch da bestimmte Regeln. Schießen zwei oder mehrere Personen auf ein Rennthier, so gehört es Demjenigen, der es zuerst getroffen, selbst wenn er es nur ganz leicht verwundet hat. Ueber die bei der Seehundsjagd geltenden Regeln sagt Dalager: „Trifft ein Grönländer mit seinen leichten Pfeilen einen Seehund oder ein anderes Seethier, so daß es nicht stirbt, sondern mit dem Pfeil davonläuft, so gehört es, falls auch ein Anderer kommt und es mit seinem Pfeil trifft, doch dem Ersten, hat er aber die gewöhnliche Harpune benutzt und ist die Leine zerrissen, und kommt dann ein Anderer, der trifft, so hat der Erste sein Recht verloren, — schießen sie dagegen gleichzeitig und treffen Beide, so wird das Thier der Länge nach mit Haut und Haar getheilt. Treffen Beide gleichzeitig einen Vogel, so theilen sie ihn der Quere nach. Wird ein todter Seehund mit einer Harpune im Leibe gefunden, so erhält der Besitzer, falls er bekannt und in der Nähe ansässig ist, seine Harpune wieder, der Finder aber behält den Seehund.“ Ganz ähnliche Regeln scheinen auch an der Ostküste zu herrschen.
[72] Holm erzählt nämlich von der einen, daß sie die Tochter eines Zwerges bei Imarsivik gewesen, und dieser wird gewiß mit dem kleinen buckeligen Manne identisch sein, den wir dort trafen. Daß wir auch seine Tochter gesehen haben, falls sie zu Hause war, ist sehr wahrscheinlich.
[73] Es kam auch wohl vor, daß man Andre bat, dies für sich zu besorgen, doch mußte es stets in Form eines Ueberfalles oder Raubes geschehen.
[74] Graahs Entdeckungsreise an die Ostküste von Grönland, Kopenhagen 1832, S. 145–148.
[75] Siehe Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 96.
[76] Siehe Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 103.
[77] Siehe ebendaselbst S. 94.
[78] Dalager erwähnt, daß zu seinen Lebzeiten an der Westküste kaum der zwanzigste Theil der Grönländer zwei Frauen hatte, sehr selten hatten sie drei und ganz ausnahmsweise vier, doch hat er einen Mann gekannt, der deren elf hatte. Grönl. Rel. S. 9.
[79] Dalager, Grönl. Relat. S. 9.
[80] Die Bewohner des Grädefjords gehören der Herrnhuter Gemeinde an.
[81] Dies ist eine Art von Thing oder Versammlung, die im wesentlichen aus Abgesandten der verschiedenen Wohnorte des Distrikts besteht. Die Europäer der Kolonien nehmen auch theil daran, und Einer von ihnen pflegt den Vorsitz zu führen. Die grönländischen Abgesandten heißen Partisok.
[82] Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 96.
[83] Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 102.
[84] Wie bereits erwähnt wurde, wird ein grünes Haarband von solchen Frauen getragen, die in unverehelichtem Stande Kinder geboren haben.
[85] Ein weiterer Grund hierzu ist auch die natürliche Wahl der Geschlechter, indem die Abkommen solcher Mischlinge gewöhnlich schöner sind als die reinen Eskimos und deswegen bei Eheschließungen häufig vorgezogen werden.
[86] Siehe Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 100.
[87] Graah, Entdeckungsreise, S. 141.
[88] Siehe Holm, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 91.
[89] H. Rink, Eskimoische Sagen und Märchen. Ueber ostgrönländische Sagen, siehe ebenfalls Holm, Mitth. über Grönland, Bd. 10.
[90] Frau Rink ist H. Rinks Gattin. Sie ist in Grönland geboren und hat fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Wir besitzen von ihrer Hand mehrere in Novellenform abgefaßte Schilderungen über das Leben der Grönländer.
[91] Hat ein Mann ein Frauenboot, so wird das als Zeichen des Reichthums angesehen, denn er muß viele Seehunde fangen, um genügend Felle dafür zu erhalten, und indem es ihn in den Stand setzt, im Sommer verschiedene Fangstellen zu besuchen, trägt es in nicht geringem Grad dazu bei, den Wohlstand und das Wohlsein seiner Familie und Genossen zu vermehren.
[S. 342]
 ir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, einmal am Ameralikfjord
auf Rennthierjagd zu gehen, doch hatte uns bis dahin stets die
geeignete Schneeschuhbahn gefehlt. Endlich, am Freitag, den 23.
November, saßen wir im Boot, das nach vielem Hin- und Herreden mit
den mancherlei für einen solchen Ausflug in dieser nicht sehr milden
Jahreszeit erforderlichen oder doch wünschenswerthen Gegenständen
beladen war.
ir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, einmal am Ameralikfjord
auf Rennthierjagd zu gehen, doch hatte uns bis dahin stets die
geeignete Schneeschuhbahn gefehlt. Endlich, am Freitag, den 23.
November, saßen wir im Boot, das nach vielem Hin- und Herreden mit
den mancherlei für einen solchen Ausflug in dieser nicht sehr milden
Jahreszeit erforderlichen oder doch wünschenswerthen Gegenständen
beladen war.
Am Strande standen mehrere der in der Kolonie ansässigen Europäer und die meisten der grönländischen Schönheiten versammelt, um uns ihr Lebewohl zuzuwehen, ja es sollen sogar nasse Augen vorhanden gewesen und Thränen geflossen sein, weil die norwegischen Freunde sie auf so lange Zeit verlassen wollten.

Das Boot stieß vom Ufer ab, die Segel wurden gehißt und wir nahmen unter einer frischen, nördlichen Brise unsern Kurs südwärts, ein anderes Boot und einen Kajak im Schlepptau mit uns führend, sechs herzensfrohe Menschen im Boot. Unter diesen Sechsen befanden sich fünf Mitglieder der Expedition. Ravna wollte nicht mit, er sagte nur: „Ich alter Lappe, mir allzu kalt!“ An seiner Statt hatten wir Joel mitgenommen, der ein köstlicher Typus eines Eskimo ist. Von Natur ist Joel klein, er hat einen kräftigen starken Oberkörper, sein Gesicht ist breit und rundlich mit einem gutmüthigen, schalkhaften Ausdruck,[S. 344] einem breiten, lächelnden Mund, zwei kleinen, schwarzen, stets feuchten Augen, ein wenig Bartwuchs auf Kinn und Oberlippe, struppiges rabenschwarzes Haar, das ihm in Büscheln an den Seiten des Kopfes und in den Nacken hineinhängt. Er ist ein tüchtiger Kajakruderer, aber kein Fänger — man beschuldigt ihn der Trägheit — und infolgedessen ist er arm. Zum Fischen, ein Handwerk, auf das die Großfänger mit Verachtung herabsehen, zur Rennthierjagd und jeglichem anderen zufälligen Sport ist er gut zu gebrauchen. Er ist grundfaul, böse Zungen sagen ihm auch nach, daß er keine ganz klaren Begriffe über das „Mein“ und „Dein“ hat. Er ist mit einer Dame seines eigenen Kalibers, Namens Anne Kornelia verehelicht.
Wir erreichten an jenem Nachmittage die Mündung des Ameralikfjords, wo wir durch widrige Winde am Vordringen gehindert wurden. Nachdem wir uns eine ganze Weile im Dunkeln abgemüht haben — das Tageslicht ist dort oben um diese Zeit von sehr kurzer Dauer, — und nachdem wir mehrere Stunden damit zugebracht hatten, für einen Zeltplatz den Schnee hinweg zu schaffen und Zeltsteine das steile Ufer hinauf zu schleppen, ist endlich alles in Ordnung, der Ofen ist aufgestellt, ein lustiges Feuer knattert darin und der Theekessel summt ganz lustig, in unser kleines, gemüthliches Zelt sein lebhaftes Aroma aus dem fernen Osten entsendend, das uns, während draußen Sturm und Schnee tosen, an die Heimath und die Freuden des Familienlebens erinnert.
Die Abendmahlzeit wird verzehrt, wir zünden unsere Cigarren an, und eine behagliche Gemüthlichkeit verbreitet sich in dieser norwegisch-lappisch-grönländischen Versammlung, wir überlassen uns einem angenehmen Dolce far niente, zufrieden in dem Bewußtsein, daß wir jetzt keine solche Eile mehr haben wie damals, als wir früher auf dem Inlandseis in unserm Zelt kampirten.
[S. 345]
Am nächsten Tage war Joel der Ansicht, daß es nicht gerathen sei, weiter zu reisen, da ein ziemlich heftiger Sturm in widriger Richtung wehte. Wir gingen deswegen auf Schneehühnerjagd. Am andern Tage war es besser, freilich war der Wind noch immer widrig, aber es war doch möglich, vorzudringen; so ruderten wir denn weiter, von Joel in seinem Kajak geleitet.
Als wir uns am Nachmittage in der Dämmerung Kasigiangiut, der Stelle an der Südseite des Fjords, wo wir landen sollten, näherten, führte uns Joel auf die unerklärlichste Weise herum, ehe wir unsern bleibenden Zeltplatz erreichten. Erst kamen wir bis an das Ende einer tiefen Bucht, wo Joel in einen Fluß hinaufruderte, um Wasser zu trinken und sich gütlich zu thun, während er uns ruhig warten ließ, dann ging er aus der Bucht heraus, am andern Ufer entlang, darauf lag er eine Viertelstunde vor einer Landzunge still, mit einer räthselhaften Arbeit beschäftigt, die, soweit ich es begriff, hauptsächlich darin bestand, daß er eigentlich nichts that. Dann ging es weiter bis an das Ende einer andern Bucht und abermals an dem andern Ufer entlang. Was in aller Welt das zu bedeuten hatte, war uns ganz unmöglich zu verstehen. Die Antwort hierauf lag möglicherweise in dem Vortrag, mit dem uns Joel unausgesetzt unterhielt, da wir aber nicht so glücklich waren, ihn zu verstehen, ist es mir bis auf den heutigen Tag ein Räthsel geblieben. Hungrig, müde und ärgerlich wie wir waren, gaben wir uns keine weitere Mühe, Joels Streiche zu ergründen, sondern beschlossen, uns nicht länger von ihm zum Narren halten zu lassen. Sobald wir eine Strecke aus dieser Bucht herausgekommen waren, landeten wir. Da aber vernahmen wir Joels Stimme draußen im Dunkeln, — wir sollten dorthin kommen. Wir hatten jedoch durchaus nicht die Absicht, uns[S. 346] vom Fleck zu rühren, ehe wir sicher waren, deshalb fragten wir zum letztenmal, und vernahmen denn auch endlich das langersehnte „Ajungilak“. (Hier ist es gut).
Es war übrigens ein vorzüglicher Zeltplatz, Wasser gerade vor der Thür, ein guter Hafen für die Kajaks, gutes Wildterrain ringsumher, — wenn Joel uns nur sofort hierher geführt hätte, so wäre alles gut gewesen.
Das Zelt wurde aufgeschlagen und der Ofen aufgestellt. Joel machte Feuer an, holte Wasser und brachte den Theekessel „in Schwung“. Er war jetzt der personifizierte Diensteifer, was er wohl kaum gewesen wäre, wenn er die vielen Flüche verstanden hätte, die an jenem Nachmittage über sein sündiges Haupt ergossen waren.
Hier verbrachten wir neun gemüthliche Tage, theils auf der Rennthier- und Schneehühnerjagd, theils im Kajak. Dann zogen wir ein wenig weiter bis Iterdtlak.
Es würde zu weitläufig und zu einförmig sein, eine Beschreibung von dieser ganzen Zeit zu geben. Um aber doch einen Begriff von dem Jägerleben dort oben in Grönland zu bekommen, kann man uns ja, falls man nicht bereits genug bekommen hat, noch ein paar Tage auf der Jagd begleiten.
Den 27. November. Die Sonne war schon aufgegangen, die Berggipfel auf der andern Seite des Fjords errötheten gerade in ihren ersten Strahlen, als Joel und ich in unseren Kajaks an das Ende der westlich von unserm Zeltplatz gelegenen Bucht kamen, wo uns Joel an dem Abend unserer Ankunft auf so unbegreifliche Weise umhergezerrt hatte.
Hier wurden die Kajaks auf das Ufer gezogen, die Schneeschuhe angeschnallt, und dahin ging es, das Thal entlang. Heute haben wir es auf das Rennthier abgesehen.
Wir waren noch nicht sehr weit gelaufen, als wir schon[S. 347] die Spuren zweier Thiere im Schnee fanden, die den vorhergehenden Tag das Thal passirt haben mußten. Wir folgten der Spur, die Augen schweiften unablässig von dem einen Gebirgsabhang bis zum andern, aber kein Thier war zu erblicken.
Wir gelangten an einen See, hier gingen die Spuren zurück, aber wir setzten trotzdem unsern Weg thaleinwärts fort, kamen über den See, tranken aus dem Bach unter Gefahr, kopfüber hineinzustürzen, während wir auf der morschen Eisdecke lagen, setzten unsern Weg dann aufwärts fort und waren gerade im Begriff, einen kleinen Hügel zu erklimmen, als ich plötzlich Joel, wie vom Blitz getroffen, den Kopf herabbeugen und auf die Ostseite des Thals zeigen sah, wobei er mit leiser Stimme „Tugtut“ (Rennthier) rief.
Mit Blitzesgeschwindigkeit senkte sich jetzt auch mein Kopf dem Erdboden zu, — dort, in nicht weiter Entfernung von uns, standen sechs Thiere! Schnell zogen wir uns zurück, so daß wir Deckung durch einen Hügel erhielten. Ich zog mein weißes leinenes Ueberziehhemd und die dazu gehörigen Beinkleider heraus, die eigens zu dem Zweck angefertigt waren. Joels Antlitz, als er mich in dieser Kleidung erblickte, drückte das unverhohlenste Staunen aus, und er rief ein einziges „Jupinnekaok“ (du gerechter Schöpfer) aus.
Der Zweck dieser Schneekleidung war ihm jedoch sofort klar, weshalb er mich aufforderte, voranzugehen, und sich selber hinter meinem Rücken verkroch. Als wir nähergekommen waren, mußten unsere Waffen nachgesehen, von Schnee und Eis befreit werden etc. Um zu einem neuen Schuß mit seiner Mundladebüchse bereit zu sein, nahm Joel eine Kugel in den Mund. Da ich fand, daß dies ein sehr praktischer Aufbewahrungsort war, und ohne an die Kälte zu denken, wollte ich dasselbe mit einer Büchsenpatrone thun, kaum aber berührte[S. 348] das Metall die Zunge, als es auch schon festhing. Ich riß die Patrone heraus, es blieb aber ein Stück von der Zunge daran hängen.

Vermuthlich habe ich ein furchtbares Gesicht geschnitten, denn Joel bekam einen krampfhaften Lachanfall. Die Patrone wurde nun mit einigen anderen in dem einen Fausthandschuh angebracht, und wir krochen vorsichtig weiter. Es war gerade keine leichte Arbeit, still und unbemerkt zu gehen, wenn man bei jedem zweiten Schritt bis an den Magen in den Schnee versinkt — die Schneeschuhe hatten wir natürlich wieder abnehmen müssen, da wir auf ihnen nicht kriechen konnten — und noch dazu zwischen den großen Kieselsteinen in einem grönländischen Flußbett! Mein weißer Ueberrock bildete indessen einen vorzüglichen Schutz, was den Anblick betraf, der Schnee dämpfte[S. 349] den Laut, und der kleine Joel verbarg sich, so gut er vermochte, hinter meinem breiten Rücken oder vielmehr hinter dem Körpertheil der, wenn man auf allen Vieren kriecht, davorliegt.
Endlich kamen wir an den Rand eines Hügels und hatten nun die ganze Rennthierherde auf einer Ebene vor uns, sie befand sich aber außer Schußweite. Da war nichts, was uns hätte Deckung gewähren können, deswegen mußten wir abermals zurückgehen und versuchen, weiter ostwärts vorzudringen.
Hier kamen wir in dem Schutz einiger hoher Hügel gut vorwärts, spürten gleichsam einen schwachen Luftzug hinter uns im Nacken, und Joel mußte mit einer Wollflocke ausprobiren, aus welcher Richtung der Wind kam. Da erblickte ich plötzlich einen jungen Rennochsen, der allein stand und uns ansah, und den wir noch nicht bemerkt hatten. Wir bückten uns Beide, er aber kam plötzlich auf uns zugesprungen. Ein Höhenrücken entzog ihn unserm Blick — wir hielten die Büchsen bereit —, da kam er in guter Schußweite oben auf einem Hügel zum Vorschein, ich legte an und zielte, aber der Schuß ging nicht los.
In größter Hast spannte ich den Hahn von dem zweiten Lauf, der inzwischen mit einer Rundkugel glattgebohrt war, und legte abermals an. Jetzt knallte mein Schuß gleichzeitig mit Joels. Das Thier zuckte zusammen, es war offenbar in den Rücken getroffen, das rechte Vorderbein schleppte. In wilden Sprüngen entfernte es sich von uns. Ich versuchte nochmals meinen Büchsenlauf, aber er versagte wieder. Schnell steckte ich eine neue Patrone hinein, diesmal knallte es und von der Expreßkugel hinten getroffen, fiel das Thier todt um. Ich sprang nun vor, um nach den andern Rennthieren zu sehen, die waren aber nirgends zu erblicken. Da es bereits über die Mittagsstunde war und die Tage nur kurz waren, hielt ich es[S. 350] für zu spät, um sie zu verfolgen, und wir kehrten nach unserer Hütte zurück, unsere Beute hinter uns herschleppend.
Das Erste, was ich that, war jedoch, daß ich niederkniete und einen tüchtigen Trunk warmen Blutes aus der Schußwunde sog. Das schmeckt an so einem kalten Tage! Joel stand da und sah mir verwundert zu. Ich fragte ihn, ob er nicht auch einen Schluck haben wolle, da aber lächelte er verschmitzt über das ganze Gesicht, schüttelte den Kopf und zeigte auf die Schnauze und den Magen des Thieres, was so viel heißen sollte, als „aus dem Blute macht der Eskimo sich nichts, die Schnauze und der Inhalt des Magens sind aber für ihn eine Delikatesse, die er dem ganzen übrigen Rennthier vorzieht“.
Es handelte sich nun darum, unsere Beute an den Fjord hinunter zu schleppen, wo unsere Kajaks lagen, aber dies war keine leichte Arbeit. Wir holten unsere Schneeschuhe, verfertigten eine Art Schlitten, indem wir sie alle nebeneinander legten, und packten das Rennthier darauf. Dann spannten wir uns vor das Gefährt und zogen es. Es war aber kein leichtes Stück Arbeit, um so weniger, als wir keine Schneeschuhe mehr an den Füßen hatten und oft bis an die Hüften in den Schnee versanken. Am schlimmsten war es, wenn wir auf Geröll kamen, wo wir unablässig zwischen die großen Steine fielen, die der Schnee verrätherisch bedeckte.
Aber es ist alles nur ein Uebergang, wie der Fuchs sagte, als er geschunden wurde!
Gegen Nachmittag erreichten wir den Fjord. Es war eigentlich unsere Absicht gewesen, unsere Kajaks zusammenzubinden, das Rennthier hinten quer darüber zu legen und es so auf gewöhnliche Eskimomanier bis an unser Zelt zu schaffen; aber wir fanden, daß es zu spät und zu dunkel geworden war, deshalb zogen wir es vor, unsere Beute einstweilen liegen zu lassen.
[S. 351]
Nachdem wir den Bauch geöffnet, das Herz und die Leber herausgenommen und von der letzteren einen Theil verzehrt hatten, sammelten wir Steine, um das Thier damit zu bedecken, warfen Schnee darüber, steckten einen Skistab daneben und banden einige Lappen daran fest, um Füchse, Raben und Raubvögel fernzuhalten.
Dann bestiegen wir unsere Kajaks und zogen fröhlich heimwärts. Wir waren nicht gar weit gekommen, als Joel die Melodie zu dem „ewig munteren Kupferschmied“ anstimmte, die damals in Grönland in der Mode war, und der man grönländische Worte untergelegt hatte. Unter Gesang glitten die Kajaks durch die Dunkelheit dahin, und die Kameraden konnten uns schon aus der Ferne hören.
Sverdrup und Balto, die ebenfalls auf Rennthierjagd gewesen waren, erzählten, daß sie vier Thiere in einem hochgelegenen Thal gesehen hätten, aber nicht bis auf Schußweite an sie herangekommen wären.
Am folgenden Tage war das Wetter schlecht, wir schafften das Rennthier mit dem Boot bis an unser Zelt, zogen die Haut ab und zerlegten es. Das Blut war nicht ganz rein. Unvorsichtigerweise hatte ich nämlich ein Loch in einen Darm geschnitten, als ich am vorhergehenden Abend den Bauch öffnete. Es war aber doch schade, dies gute Blut fortzuschütten, deswegen versetzten wir es mit Mehl und kochten trotzdem eine Blutspeise davon in unserem Kaffeekessel, der so leck war wie ein Sieb. Er mußte mit Grütze und Fleisch und allem, was wir finden konnten, dicht gemacht werden. Den Ausguß banden wir mit Stroh, Mehl und Tauwerk zu. Es war wirklich ein schöner Anblick!
Und dann speisten wir unser Schwarzsauer! Die ersten Löffel voll hatten eine große Neigung, wieder zurückzukommen,[S. 352] aber die Gewohnheit ist ein guter Lehrmeister, wir gingen mit Todesverachtung darauf los, und bald schmeckte es auch besser. Joel sah dieser Zubereitung mißvergnügt zu, und als er aufgefordert wurde, an der Speise theilzunehmen, schüttelte er den Kopf und sagte: „Ajorpok“, was auf Deutsch heißt „das ist Dreck“. Um sich zu trösten, holte er ein ungekochtes Schneehuhn hervor, öffnete den Bauch, zog den Magen und die Gedärme heraus und verschlang sie auf einmal, als sei ihm in unserer Blutspeise nicht genügend Darminhalt. Dieser Anblick war Balto denn doch zu viel, er rief: „Nein, nein!“ steckte den Kopf zur Zeltthür hinaus, und dann folgten einige unartikulirte Laute, wie von einem Menschen, welcher seekrank ist. Joel setzte indessen ruhig seine Mahlzeit fort, rupfte das Schneehuhn und verzehrte es mit Haut und Haaren. Das Einzige, was zurückblieb, war ein Federbüschel. Dies war in Baltos Augen sehr heidnisch und er sagte: „Das sieht gerade so aus wie ein Adler.“
Später kochten wir einen Theil des Rennthieres, aber es schmeckte leider fast ebensosehr nach dem Inhalt des Darmes, wie die Blutspeise. Dies schien jedoch Balto und Joel zu behagen, die Beiden aßen ganz gehörig, ja, sie tranken sogar die Brühe dazu, an deren Geruch wir Anderen mehr als genug hatten.
Ueberhaupt war unsere Zubereitung des Essens nicht gerade ausgesucht. Wenn wir Mehlbrei kochten, wurde er fast immer halbgar verzehrt und schmeckte wie Kleister, denn wir ließen uns niemals Zeit, zu warten, bis er ganz gar war. Brieten wir Rennthierfleisch, so geschah es auf die Weise, daß wir die gefrorenen Stücke auf den Ofen legten und die äußere Rinde abschälten, sobald sie warm wurde. Balto behauptete, daß wir es nicht in Godthaab hätten aushalten können, weil es dort zu[S. 353] reinlich herginge und wir unser Leben auf dem Inlandseise nicht vergessen könnten, deswegen seien wir nach „Ameralik“ gezogen, um „Schweinerei“ zu machen. Das sei der einzige Grund gewesen!
Balto war übrigens unser steter Spaßmacher. Sobald wir unsere Abendmahlzeit im Zelt eingenommen und Cigarren und Pfeifen angezündet hatten, holte er die Karten hervor, die bald so schmutzig waren, daß wir Mühe hatten, sie zu unterscheiden; die eifrigsten Kartenspieler holten sofort eine Kiste herbei, die als Tisch dienen mußte, und dann fing das Spielen an, das bis tief in die Nacht hinein währte und von diesen pelzgekleideten Männern bei einer Temperatur von −15° ebenso lebhaft betrieben wurde, als säße man in dem wärmsten Zimmer jenseits des Meeres. Wenn die Finger gar zu steif wurden, so machte man einige schlagende Armbewegungen, um das Blut wieder in Cirkulation zu bringen, und dann begann das Spiel wieder mit erneuter Kraft.
Durch seine Bemerkungen in seinem oft höchst wunderlichen Norwegisch verschaffte uns Balto viel Amusement. Wenn er z. B. sagte: „Morgen will ich auf die Jagd gehen und Rennthiere schießen, wenn ich aber nichts bekomme, dann gehe ich nie wieder auf Rennthierjagd, sondern nehme meine Bürschte (Büchse) und schieße Schneehühner,“ da konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Oder wenn er uns erzählte: „Tod und Teufel! Ueber Nacht will ich einen Fuchs sitzen!“ so wirkte auch das unwiderstehlich komisch; er meinte damit, er wollte Füchsen auflauern, die in der Nacht an den Strand hinab zu kommen pflegten.
Den 4. Dezember. Das Tageslicht dämmerte schwach, als ich erwachte. Ich steckte meinen Kopf aus dem Schlafsack und war angenehm überrascht, als ich Joel schon in seinem kalten[S. 354] Segel aufgerichtet sitzen sah, mit seiner höchst primitiven Morgentoilette beschäftigt, die darin bestand, daß er sich mit den Fingern durch sein rabenschwarzes Haar fuhr, das ihm wie Hörner nach allen Seiten hin abstand. Dann steckte er den Kopf zur Zeltthür hinaus, ließ die Augen über die Berggipfel zu beiden Seiten des Fjordes gleiten und zog den Kopf wieder zurück. „Nun, Joel, wie sieht’s heute mit dem Wetter aus, eignet es sich wohl für die Rennthierjagd?“ „Asukiak, imekame.“ („Ich weiß nicht, es ist möglich.“) Ich kenne Joel genügend, um zu wissen, daß dies so viel bedeutet als: „Das Wetter ist schlecht.“ Es ist eine Eigenthümlichkeit, die ich nicht bei unserem Freunde Joel allein, sondern ganz allgemein bei den Grönländern gefunden habe, daß sie einem Europäer nicht gern widersprechen oder ihm eine Antwort geben, die ihm unangenehm sein könnte. In letzterem Falle kleiden sie ihre Worte gern in eine etwas zweideutige Form. Dies ist ja im Grunde ein hübscher Zug ihres Charakters, der aber für Diejenigen, die mit ihnen zu thun haben, oft recht unangenehm sein kann.
Ich kannte Joel, wie gesagt, und erwiderte ihm: „Du meinst also, daß es heute wieder schlecht aussieht?“ „Soruna Ajorpok.“ („Freilich, es sieht schlecht aus.“) „Der Wind steht thalaufwärts.“ Nun, dabei war nichts zu machen. Wenn der Wind thalaufwärts steht, so daß man ihn, wenn man dem Rennthier nachspürt, im Rücken hat, da soll man die Sache lieber ganz aufgeben, denn man erreicht nichts weiter, als daß das Wild scheu wird. Freilich sagte Joel oft, daß der Wind ungünstig sei, wenn er selber faul war (und das kam häufig vor), da mußte ich denn selber hinaus und mich davon überzeugen, und gelangte dann häufig zu dem Resultat, daß es sich schon machen ließe. Diesmal verhielt es sich jedoch so, und wir beschlossen, wie gewöhnlich in solchen Fällen, auf die Schneehühnerjagd[S. 355] zu gehen. Joel kleidete sich an, heizte ein und ging an den Bach, um Wasser für unsern Kaffeekessel zu holen, wobei er gewöhnlich einigemale auf dem Glatteis fiel, so daß man ihn und den Kaffeekessel deutlich hören konnte. „Da liegt Joel wieder,“ pflegte Sverdrup zu sagen.
Endlich war dann der Kaffee fertig, und wir verzehrten unser Frühstück in den Schlafsäcken, wobei wir berathschlagten, wohin die Einzelnen heute gehen wollten, und wo wohl am meisten Aussicht auf Schneehühner sei. Sobald das Frühstück eingenommen war, kleideten wir uns an, griffen nach den Büchsen, gingen hinaus, schnallten die Schneeschuhe unter die Füße und verschwanden Jeder in seiner Richtung.
Es währte eine ganze Weile, bis ich fertig war, mehrere von den Gefährten hatten sich bereits auf und davon gemacht, besonders waren Balto und Kristiansen heute sehr früh auf den Beinen gewesen. Als ich die Schneeschuhe angezogen hatte, ging ich über einige Bergrücken ein wenig östlich vom Zelt, wo es aussah, als könnten dort Schneehühner sein. Der Weg war beschwerlich, er führte über unebene Stellen, wo das Schneehuhn sich gern aufhält. Das Auge späht und späht nach allen Richtungen zwischen den Steinen, aber ich hatte heute kein Glück, nichts war zu entdecken, was auf die Nähe eines Schneehuhns schließen ließ, kein schwarzer runder Punkt, der dem Auge eines Schneehuhns[92] gleichen konnte, hob sich von der weißen Schneedecke ab, nirgends eine Spur oder ein gackernder Laut! Ich vernahm nichts als meine eigenen Schritte auf dem Schnee. Ich stieg immer höher und erreichte einen Bergrücken, der eine Aussicht über das Land nach dem Inlandseise gewährte.[S. 356] Wie wunderbar leblos, nicht einmal ein kreisender Adler oder ein krächzender Rabe, an denen es doch sonst niemals zu fehlen pflegt. Rings umher stehen die schweigsamen schneebedeckten Berge mit den dunklen Abhängen, an denen der Schnee nicht liegen bleibt. Tief unten, an der steilen Felswand entlang, schlängelt sich der dunkle Ameralikfjord schwermüthig dem Meere zu, von allem Leben, allem Sonnenlicht vergessen, — bis an sein Gestade dringt den ganzen Winter nicht ein einziger Sonnenstrahl. Kein Wald, keine Bäume, ja nicht einmal ein Busch oder Strauch ist zu erblicken. Und doch ist es schön hier! Jetzt wirft die Sonne ihr Streiflicht über die Berggipfel an der anderen Seite des Fjordes, der Schnee erglänzt, erröthet. Die Natur bedarf, um schön zu sein, nicht immer des Lebens.
Ich lenkte meine Schritte weiter landeinwärts. Vor mir lag eine flache Ebene mit einer Moorstrecke, und jenseits derselben eine steile Felswand. Ich hatte noch nicht viele Schritte zurückgelegt, als es mir vorkam, als vernähme ich dort oben auf der Felswand einen Laut. Ich glaubte, daß es möglicherweise ein Rennthier sein könne, das sich verlaufen hatte. Ich blickte hinauf, konnte aber nichts entdecken, und fand es auch ganz natürlich, kein flügelloses Wesen konnte den steilen Abhang erklimmen. Abermals schritt ich landeinwärts weiter, da vermeinte ich ganz deutlich ein rasselndes Geräusch zwischen den Steinen zu hören, und diesmal konnte ich mich nicht getäuscht haben. Ich hielt an, ich blickte hinauf, entdeckte aber nichts; es mußte dennoch ein Irrthum gewesen sein, und abermals setzte ich meinen Weg fort, indem ich darüber grübelte, wie ich mich im Grunde so irren könnte. Da erschallten plötzlich Schritte von der Bergwand her, diesmal aber so scharf und deutlich, daß von einem Irrthum nicht die Rede sein konnte, und so suchte ich denn mit meinen Augen die ganze Bergwand nach[S. 357] dem vermeintlichen Rennthier ab. Es währte lange, bis ich etwas fand, — ich suchte zu weit nach unten; als ich aber bis an die Mitte der steilen Felswand kam, wie staunte ich da, als ich einen Menschen erblickte, der dort oben gleich einer Mücke zwischen den Steinen umherkroch. An dem langen Wams und der viereckigen Mütze erkannte ich Balto, er ging gerade mit seinen Schneeschuhen über einen kleinen schneebedeckten Abhang, der über die steile Felswand hinausragte. Ich stand wie angenagelt da. Soweit der Abstand es gestattete, verfolgte ich jede Bewegung. Ich konnte sehen, wie er die Schneeschuhe in die Schneewand hineinstampfte, um festen Fuß zu fassen, die Büchse hing ihm schräg über den Rücken, den Kopf wandte er der Bergwand zu. Er bewegte sich vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts, während er sich auf seinen Stab stützte. Ich konnte nicht begreifen, woher er, der doch sonst so für sein Leben besorgt war, plötzlich diesen Muth bekommen hatte. Da glitt ein Fuß aus, er hieb den Stab fest ein, da glitt auch der andere Fuß aus, — in sausender Fahrt ging es bergabwärts, — das Blut erstarrte mir förmlich in den Adern. Der Schnee wurde mit hinabgerissen, es ging in immer wilderer Fahrt, und gerade unter ihm befand sich eine tiefe Schlucht. Da blieben seine Kleider an einem Felsvorsprung hängen, der über dem Abgrund aus dem Schnee hervorragte. Einen Augenblick blieb er in der Schwebe, zappelnd und bemüht, festen Fuß zu fassen, dann aber gab das Felsstück nach. Nun folgte eine Luftreise, dann ging es über eine schneebedeckte Strecke, dann abermals an einem steilen Abhang hinab, bis er als unbewegliche Masse auf einem Felsabsatz liegen blieb. Ich hielt ihn für todt oder doch jedenfalls völlig gerädert.
Da ward ein Arm sichtbar, der sich vorsichtig im Gelenk bog, dann ein zweiter, und dann der Kopf, der sich ein wenig[S. 358] aufrichtete und einige vorsichtige Nackenbewegungen machte, dann die Beine — merkwürdigerweise schien alles heil geblieben zu sein —, und nun erhob er sich. Ich konnte nicht so recht sehen, was er eigentlich wollte, dann erklang aber ein Schuß. War seine Büchse losgegangen? Ich sah ihn mit etwas beschäftigt, konnte aber nicht erkennen, was es war. Ein zweiter Schuß folgte. Was hatte dies nur zu bedeuten? Er ging auf dem kleinen Absatz umher, augenscheinlich nach einem Ausweg spähend, der nicht zu finden war. Nun aber nahm er die Schneeschuhe auf den Nacken und fing vorsichtig an, die Bergwand an einer Stelle hinabzusteigen, wo er einigermaßen festen Fuß fassen konnte. Schritt für Schritt ging er. Als ich ihn endlich unten im Steingeröll außer Gefahr sah, zog ich weiter. Ich fand an dem Tage jedoch keine Schneehühner, ich hatte kein Glück. Da vernahm ich einen Schuß von Balto, er befand sich nun nicht weit von mir oben zwischen dem Steingeröll an der anderen Seite einer Felsspalte. Ich blickte hinüber und gewahrte einen Flug Schneehühner, die von ihm weg flatterten und sich zwischen dem Steingeröll in der Bergspalte niederließen. Da es nicht weit von mir war, ging ich den Weg hinauf und gewahrte bald Unmengen von Schneehühnern, die in dem Schnee zwischen den Steinen umhertrippelten. Sobald man sich näherte, standen sie still und reckten ängstlich die Hälse aus, ließen mich aber doch bis auf Schußweite herankommen. Ich schoß ein paar Vögel, scheuchte aber damit den ganzen Schwarm tiefer in das Geröll hinein, wo Balto gerade zum Vorschein kam, und wo er nun seine Mundladebüchse lud und damit schoß, als gälte es sein Leben. Da ich sah, daß er sehr gut allein damit fertig werden konnte, setzte ich mich hin, schaute ihm zu und wartete auf ihn. Die Schneeschuhe hatte er abgenommen und sprang nun von einem Stein zum andern, überall vorsichtig[S. 359] umherspähend. Es mußte ihm sehr heiß sein, denn er hatte die Mütze abgeworfen, obwohl es 15 Grad Kälte waren. Erblickte er ein Schneehuhn, so schlich er sich an dasselbe heran, theils krummgebeugt hinter den Steinen gehend, theils auf allen Vieren kriechend, bis es ihm oft so nahe kam, daß er es fast hätte mit dem Büchsenkolben tödten können, — ein langes vorsichtiges Zielen, dann ein Knall, und das Schneehuhn lag in der Regel todt da. Dann lud er und sah sich, ehe er sich näherte, vorsichtig um, ob mehr Schneehühner in der Nähe wären. War das Thier angeschossen, so entstand eine wilde Jagd, es flatterte voran und Balto eilte hinterdrein, so daß der Schnee um ihn her aufstob, hin und wieder trat er fehl und versank bis an den Magen zwischen den Steinen. Schließlich stürzte er sich über den Vogel und biß ihm den Kopf ab. Endlich war er fertig und kam nun barhäuptig und außer Athem zu mir hinab, während ihm die Schneehühner von der Schulter herabhingen, mich fragend, ob ich ein angeschossenes Huhn gesehen habe, das ihm nach dieser Richtung hin entwischt sei. Wenn er das bekäme, hätte er gerade fünfzehn. Nein, ich hatte es nicht gesehen. Dann fand er aber Spuren im Schnee und bald auch das Schneehuhn selber, jetzt entstand eine neue Jagd, die damit endigte, daß es oben zwischen einigen Steinen gefangen wurde. Dann sammelte er seine Siebensachen und wir zogen heimwärts; auf dem Wege erklärte er mir, daß unter dem einen Bergabhang einige Schneehühner liegen müßten, die dort hinuntergefallen seien, und richtig, wir fanden sie dort. Er war in rosigster Laune, sichtlich erfüllt von seinem Jägerglück, und erklärte mir ganz genau, wie er die einzelnen Schneehühner geschossen habe. Im Laufe des Gesprächs erwähnte er auch, daß er nahe daran gewesen sei, das Leben zu verlieren, er sei einen Berg hinabgefallen. Ich ließ[S. 360] ihn ruhig erzählen. Als er geendet hatte, sagte ich ihm, daß ich Augenzeuge des Ganzen gewesen, daß es mir aber nicht klar geworden sei, was die beiden Schüsse zu bedeuten gehabt hätten. Er erwiderte, daß er, als er sich vergewissert hatte, daß alles an ihm heil geblieben sei, sich umgesehen und plötzlich bemerkt habe, daß er neben zwei Schneehühner gefallen sei, die ihn mit schiefen Köpfen verwundert anschauten. Er holte die Büchse hervor und schoß das eine Schneehuhn, das andere blieb ruhig sitzen, während er lud, auch das habe er erlegt. „Aber,“ schloß er seinen Bericht, „jetzt hab’ ich’s fürs Erste satt, Schneeschuhe auf steilen Felswänden zu benutzen,“ und das bewies er auf dem Rückwege, denn sobald er an einen steilen Abhang kam, nahm er seine Schneeschuhe ab und trug sie.
Wir hatten nun alle Rennthierstriche um Kasigianguit herum besucht und sehnten uns nach Abwechselung und neuen Jagdgebieten. Joel erzählte, daß sich weiter ins Land hinein bei Iterdtlak vorzügliche Rennthierweiden befinden sollten, und so brachen wir denn eines Morgens unser Lager ab, schoben das Boot ins Wasser, belasteten es und zogen weiter, während Joel uns mit seinem Kajak den Weg zeigte. Die See vor dem Zeltplatz war ruhig, als wir auszogen, sie lag vor den Winden geschützt da. Sobald wir aber an der nächsten Landzunge in den Fjord hinausgekommen waren, sollten wir indessen andere Erfahrungen machen. Vom Ende des Fjordes her wehte ein heftiger Ostwind, der auf die hohen Felsen stieß und das Wasser hoch aufpeitschte. Unser langes, jämmerliches Boot, „der Walfischfänger“, das trotz seines Namens nie Dienste als solcher gethan hat, durchschnitt die hohen, wilden Wogen gleich einem Keil mit seinem spitzen Bug, so daß jede Welle darüber zusammen schlug. Dies hätte nichts zu sagen gehabt, falls wir hätten schöpfen können, aber es war so kalt, daß das Wasser,[S. 361] das sich schon auf dem Gefrierpunkt befand, in dem Augenblick, wo es mit dem kalten Holz oder Eisen des Bootes in Berührung kam, gefror. Bis zu mir, der ich hinten am Steuer saß, gelangte auch nicht ein nasser Tropfen, während Sverdrup, der vorne saß und ruderte, bald in einen vollständigen Eisharnisch gehüllt war. Wir mühten uns lange ab, es wäre eine Schande, die Flinte ins Korn zu werfen, um so mehr, als Joel in seinem kleinen Kajak nur über das Ganze lachte, dann aber half es nicht mehr, wir mußten wenden, das Boot war dem Sinken nahe. So ging es denn in fliegender Fahrt zurück nach unserem alten Zeltplatz. Sobald wir in dessen Schutz kamen, bemerkte ich, daß die Nase mir völlig abgefroren war, sie war weiß und gefühllos wie ein Eiszapfen. So eine gefrorene Nase ist kein schöner Anblick, wenn sie nachher wieder auftaut und zu einem rothen Gewächs mit Fransen von abfallender Haut anschwillt.
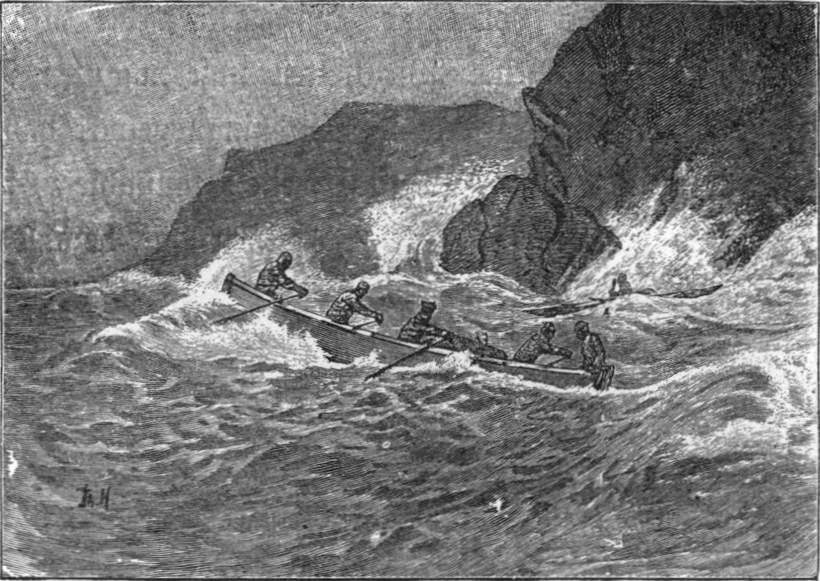
Es war kein geringer Genuß nach all den Beschwerden[S. 362] des Tages, die ja die Würze des Jägerlebens sind, das Boot ans Land zu ziehen, das Zelt aufzuschlagen und eine gute Tasse warmen Kaffee in den Schlafsäcken zu sich zu nehmen.
Am 5. Dezember hatten wir besseres Glück und gelangten trotz des starken Seeganges nach Iterdtlak, wo wir indessen statt der erwarteten Rennthiere die Thäler mit Steingeröll und Moränen angefüllt fanden, die für das Auge eines Geologen interessant genug waren, für einen Jäger aber wenig Interesse boten. Dies ist diejenige Art von Land, auf welcher die Rennthiere am allerwenigsten gedeihen. Wir hatten unseren guten Freund Joel in Verdacht, daß er uns nur da hinausgelockt habe, um Fuchsfallen aufzustellen und möglicherweise Blaufüchse zu fangen, deren Fell nach grönländischen Verhältnissen gut bezahlt wird. Die Handelscompagnie bezahlt ein solches Fell mit 4 Kronen, um es in Europa für etwa 100 Kronen wieder zu verkaufen.
Als wir uns über zwei Wochen im Ameralik-Fjord aufgehalten hatten, fing unser Proviant an auf die Neige zu gehen, alles Brot war verzehrt, auch an Mehl gebrach es uns, und die Rennthiere waren fast gänzlich verschwunden. Als deswegen am 10. Dezember ein günstiger Wind wehte, beluden wir unser Boot und zogen heimwärts. Wir spannten unsere beiden Segel auf, eins auf jeder Seite, und in fliegender Fahrt durchschnitten wir die Wellen auf unserm Wege aus dem Fjord hinaus.
Joel leistete Erstaunliches in seinem Kajak, denn trotz unseres schnellen Segelns konnte er es mit uns aufnehmen. Bald erreichten wir die Mündung des Fjordes, da wir aber nun eine nördliche Richtung einschlagen mußten, so hatten wir den Wind entgegen und mußten rudern.
Bald brach die Dunkelheit herein, der Wind flaute ab und bei dem herrlichsten Mondschein zogen wir über die dunkle Wasserfläche dahin, von der sich die schneebedeckten Felsen und[S. 363] Inseln weiß und schweigend abhoben; hinter uns blitzte unser Kielwasser im Mondschein wie ein langer silberner Streif.
Eine grönländische Winternacht kann unvergleichlich schön sein!
In der Nähe von Godthaab wurde Joel mit seinem Kajak vorausgesandt, und als wir am Landungsplatz anlangten, war die ganze Kolonie dort versammelt, um uns in Empfang zu nehmen. Grönländer und Europäer standen nebeneinander unten am Strande. Diese Menschenmengen nahmen sich phantastisch aus in dem glänzenden Mondlicht, mit der winterlich gekleideten Kolonie im Hintergrunde.
Viele Hände waren behülflich unsere Sachen ans Land zu schaffen. Ein wenig Reinlichkeit, etwas europäischer Komfort und ein erwärmtes Zimmer, das that gut nach dem mehrwöchentlichen Zeltleben in Eis und Schnee.
[92] Die weißen Schneehühner sind nämlich für jedes ungeübte Auge schwer von dem Schnee zu unterscheiden; am leichtesten erkennt man sie an dem schwarzen Schnabel und den schwarzen Augen.
[S. 364]
 as Kajakrudern übte natürlich auf uns Europäer eine große
Anziehungskraft aus. So schnell wie möglich hatte ich mir einen
Kajak anfertigen lassen, den ich, wie bereits erwähnt, auch auf den
Jagdausflug an den Ameralikfjord mitgenommen hatte. Jedoch erst Ende
Dezember war er vollständig eingerichtet mit Pelzwerk für schlechtes
Wetter etc., so daß die Uebungen allen Ernstes vor sich gehen konnten.
as Kajakrudern übte natürlich auf uns Europäer eine große
Anziehungskraft aus. So schnell wie möglich hatte ich mir einen
Kajak anfertigen lassen, den ich, wie bereits erwähnt, auch auf den
Jagdausflug an den Ameralikfjord mitgenommen hatte. Jedoch erst Ende
Dezember war er vollständig eingerichtet mit Pelzwerk für schlechtes
Wetter etc., so daß die Uebungen allen Ernstes vor sich gehen konnten.
Dem Ungeübten wird das Kajakrudern anfänglich sehr schwer. Es ist nicht leicht, dies schmale, schlanke Fahrzeug zu balanciren. Wenn man die Eskimos leicht wie Seevögel über die Wogenkämme dahinhuschen sieht, so hat das Ganze freilich den Anschein, als wäre es ein Tanz.
Sobald mein Kajak fertig war, ging es an den Strand. Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen gelang es mir, die Beine und die Hüften durch die Kajaköffnung zu zwängen und mich zu setzen, was für den Ungeübten keine Kleinigkeit ist, wenn der Kajak so klein ist, wie er sein muß. Dann wurde ich vorsichtig ins Wasser hinausgeschoben, aber das Gefühl, das mich in dem Augenblick erfaßte, als der Kajak den festen Boden verließ, läßt sich nicht beschreiben. Erst schwankte er auf die eine, dann auf die andere Seite, jeden Augenblick war ich darauf gefaßt, mich herumzudrehen. Mit hoffnungsloser Sehnsucht und Neid sah ich[S. 365] die Eskimos an, die natürlich alle in ihren Kajaks draußen waren und den Anblick von „Nalagak“ im Kajak genießen wollten. Die Uebung hat aber einen merkwürdigen Einfluß, und schon nach wenigen Malen fand ich mich einigermaßen damit zurecht. Noch besser wurde es, nachdem ich mir zwei „Kajakjunge“ hatte machen lassen. Dies sind kleine Unterstützungsböte von 2 Fuß Länge aus Holzwerk und ähnlich wie ein Kajak von außen mit Fellen bezogen, auch die Form gleicht der des Kajaks. An jede Seite des Kajaks wird eins dieser Böte befestigt, wodurch der Ruderer mehr Halt bekommt. Die Eskimos selber bedienen sich ihrer jedoch nur äußerst selten.
Eines Tages gerieth ich beim Rudern in eine Schar Delphine, die ich bis weit ins Meer hinaus verfolgte. In meinem Jagdeifer bemerkte ich nicht, daß der Tag auf die Neige ging, und als ich endlich den Rückweg antrat, hatte es bereits angefangen zu dunkeln. Unglücklicherweise erhob sich ein heftiger Südwind, den ich von der Seite hatte, und der mir das Rudern sehr erschwerte. Erst gegen Abend erreichte ich Godthaab. Hier war man meinetwegen schon in großer Sorge, denn alle Fänger waren längst zurückgekommen. Die ganze Kolonie, Grönländer wie Europäer, war auf den Beinen.
Balto schildert die kleine Begebenheit folgendermaßen:
„Als es anfing zu dunkeln, fingen wir an, uns zu verwundern, daß Nansen noch nicht kam. Wir warteten noch eine gute Weile auf Nansen, er kam aber noch immer nicht. Da geriethen Alle in große Bekümmerniß darüber, denn wir hatten gehört, daß Nansen nicht nach Neuherrnhut fahren wollte, wohin die anderen Europäer gefahren waren, um den Geburtstag des Missionar Voged zu feiern. Trotzdem sandten wir einen Boten dahin, aber er war nicht dort. Sogleich, als ich hörte, daß Nansen nicht dort sei, fiel ich auf das Bett[S. 366] nieder, und meine Thränen begannen zu rinnen. Bistrup versammelte alle Einwohner der Kolonie und befahl ihnen, sich fertig zu machen und hinauszurudern, um Nansen zu suchen. Sie waren gleich bereit, und Dietrichson fuhr mit und nahm Büchse, Licht und Horn, um damit rufen zu können. Gerade, als das Boot vom Lande abstieß, kam Nansen guter Dinge am Ufer an, und da erhoben die Grönländer ein schreckliches Gebrüll und riefen: „Kujanak, Kujanak, Nansen tigipok, ajungilak“, d. h. „Gott sei Dank, Nansen ist gekommen“, oder „Danke, danke, Nansen ist gekommen, es ist gut“. Dann kam das Herz wieder auf seinen rechten Fleck, und wir waren fröhlich wie vorher.“
Nachdem ich mich eine Zeit lang im Kajakrudern geübt hatte, und meine Kameraden sahen, daß es einigermaßen gut ging, bekamen noch mehrere von ihnen Lust, es zu versuchen. Sverdrup war der erste von ihnen, der einen Kajak bekam. Er fing nun auch an, sich zu üben, und erlangte bald eine große Fertigkeit. Balto hatte bereits gleich nach unserer Ankunft den Wunsch geäußert, im Kajak zu rudern, und fragte mich, ob ich glaube, daß es schwer zu lernen sei. Inzwischen hatten dann die am Orte ansässigen Dänen, von denen keiner in dieser Kunst bewandert war, ihm die damit verknüpften Gefahren vorgestellt und ihm erzählt, wie Viele jährlich dabei verunglückten, und Balto, der sich gerade nicht durch Muth auszeichnete, hatte die Sache aufgegeben und es ruhig mit angesehen, daß ich mich auf der See tummelte; als aber auch Sverdrup anfing, wurde ihm die Versuchung denn doch zu stark.
Sowohl Sverdrup wie ich stellten ihm vor, daß es durchaus keine leichte Sache sei, im Kajak zu rudern, und daß er sich sehr dabei in acht nehmen müsse. Aber Balto hatte jetzt große Rosinen im Sack und sagte, er würde schon damit[S. 367] fertig werden, denn er sei daran gewöhnt in dem „Pulk der Lappen“ zu fahren. Sverdrup meinte indessen, er würde schon gewahr werden, daß dies nicht dasselbe sei wie das Fahren in dem „Pulk der Lappen“. Balto aber blieb bei seiner Meinung. Sverdrups Kajak wurde an den Strand hinabgetragen, und ein großer Theil der Godthaaber Bevölkerung, sowohl Europäer als auch Grönländer, hatten sich eingefunden, um bei dem großen Ereigniß zugegen zu sein. Ich lag in meinem Kajak, bereit, ihn wieder aufzufischen.
Balto setzte sich in den Kajak, zwängte sich in die Oeffnung hinein, steckte sein langes Wams hinein und machte sich mit sehr überlegener Miene bereit, jetzt wollte er ihnen einmal zeigen, wozu ein Lappe im stande ist. Als er fertig war, griff er nach dem Ruder, nahm es fachmäßig in beide Hände und bat, daß man ihn jetzt ins Wasser hinab lassen möge.
Kaum berührte jedoch der Kajak den Wasserspiegel, als seine Miene auch schon ein wenig bedenklich wurde, aber er wollte doch den Flotten spielen und versuchte sogar, den Kajak mit ins Wasser hinein zu helfen, jetzt war nur noch ein kleines Ende auf dem festen Lande. Da wich alle seine Zuversicht dem Ausdruck grenzenlosester Angst, der Kajak glitt hinaus, ungemüthlich schwankend. Balto machte einige verzweifelte Bewegungen mit dem Ruder in der Luft, wohl mit der Absicht, das Ruder ins Wasser zu stecken, sein Antlitz drückte die hellste Verzweiflung aus und dann rief er: „Å så dä, å så dä — —“.
Weiter kam er aber nicht, denn dann ging der Mund und der ganze Kerl unter, und wir sahen nichts mehr als den Boden des Kajak und seine viereckige Federmütze, die oben auf dem Wasser schwammen. Glücklicherweise war es so flach, daß er den Grund mit den Armen erreichen konnte, und der Kajak war dem Ufer so nahe, daß man ihn von dort aus erreichen[S. 368] und aufs Trockene ziehen konnte. Er wurde mit einem unbarmherzigen Hohngelächter von allen Anwesenden, besonders von den Mädchen begrüßt. Dann kroch er aus dem Kajak heraus, und während er so am Ufer stand, mit Armen und Beinen zappelnd, während ihm das Wasser aus den Kleidern tropfte, die ihm am Leibe fest klebten, sah er aus wie eine Vogelscheuche.
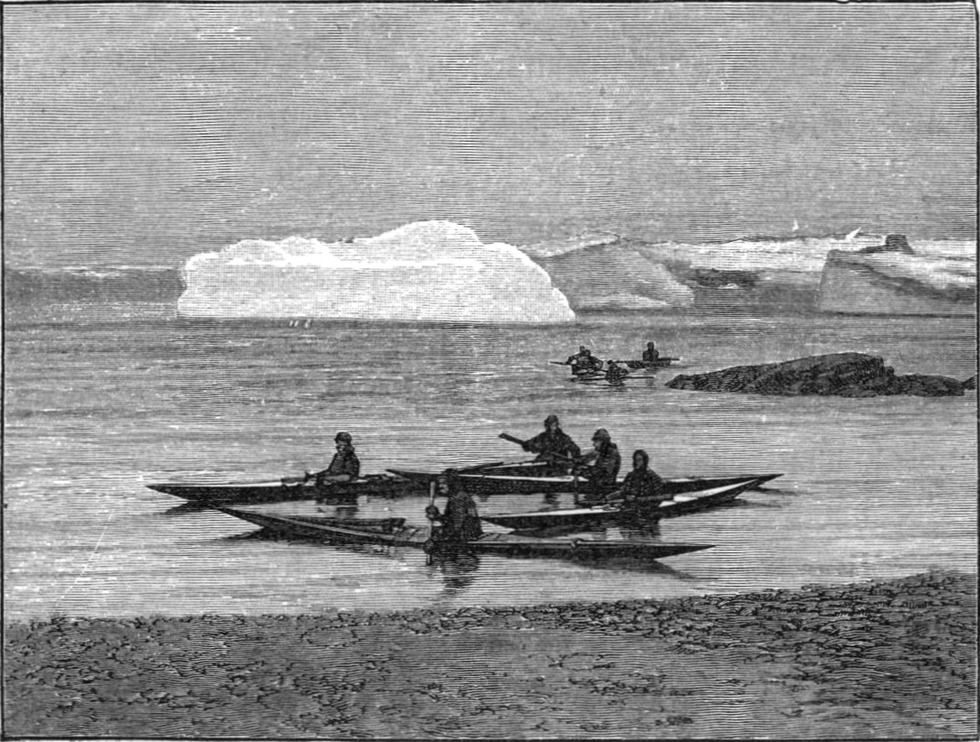
Das Erste, was er sagte, war: „Nun, ich bin beinahe naß!“ (Er gebrauchte häufig das Wort „beinahe“ statt „ganz“). Dann besann er sich eine Weile und sagte: „Ja, das muß man aber sagen, ein Kajak ist ein Teufelsboot!“
Es währte lange, ehe Balto wieder einen Versuch im Kajakrudern machte. Kurz darauf ließ sich übrigens auch Dietrichson einen Kajak machen, und gar bald war er ein tüchtiger Ruderer.
Als Balto und Kristiansen sich dies eine Weile ruhig[S. 369] mit angesehen hatten, konnten sie es nicht länger aushalten, am Lande zu stehen. Sie machten sich Beide selbst einen Kajak, indem sie sich von den Grönländern mit der Form etc. helfen ließen. Bald waren ihre Fahrzeuge fertig und wurden von den Grönländerinnen mit Fell bezogen, worauf sie anfingen, sich fleißig zu üben. Balto war nun jedoch so vorsichtig geworden, daß er sich von Anfang an der „Kajakjungen“ bediente. Er wollte nicht Gefahr laufen, daß es ihm wieder so erging wie das erste Mal. Kristiansen war weniger verzagt. Er flößte uns Allen große Angst ein, indem er sich schon am ersten Tage ohne die Kajakjungen weit in die See hinaus wagte, aber er zog sich merkwürdig gut aus der Affaire.
Als der Frühling kam, konnte man alle Mitglieder der Expedition mit Ausnahme des alten Ravna in ihren Kajaks auf Jagd nach Seevögeln ausziehen sehen.
Seehunde giebt es im Winter nur wenig, weswegen es sich nicht verlohnt, des Vergnügens halber Jagd auf sie zu machen. Wir legten uns hauptsächlich auf das Vogelschießen, und besonders die Eidergansjagd übte große Anziehungskraft auf uns aus. Während der ersten Hälfte des Winters wird diese Jagd hauptsächlich des Abends betrieben, wenn die Eidergans in größeren oder kleineren Schwärmen am Ufer des Fjordes entlang zieht. Die Kajaks liegen da in Reih und Glied an den Landzungen, und von dort aus schießt man die Vögel im Fluge. Es war ganz spannend, so auf der Lauer zu liegen. Das Auge ist unverwandt gen Süden gerichtet, von woher der Vogel erwartet wird. Plötzlich beugen die hintersten Kajakmänner, so weit man sie erkennen kann, sich vorüber und treiben die Kajaks mit aller Kraft vorwärts, die ihnen Zunächstliegenden machen es ebenso, und die ganze Kajaklinie neigt sich nach vorne. Dann liegen[S. 370] die Fernsten eine Weile ganz regungslos da, auf einmal durchdringt ein Blitz die Finsterniß, ein Knall folgt, noch ein Blitz und noch einer, bis es sich die ganze Reihe hinauf verpflanzt. Eine dunkle Masse wird im Süden sichtbar, sie kommt lautlos an der Oberfläche des Wassers entlang, man drängt die Kajaks noch ein wenig mehr vor, um einen besseren Halt zu haben, das Ruder wird unter den Riemen gesteckt, und man hält die Büchse bereit. Jeder Vogel ist jetzt zu unterscheiden, und im selben Augenblick, wo der Schwarm vorüberkommt, legt man an und zielt auf eine kleine Strecke vor dem Punkt, an welchem die Vögel am dichtesten fliegen; der Schuß knallt, und wenn man Glück hat, fallen oft zwei oder mehr Vögel. Dann ladet man wieder, die Vögel werden aufgesammelt, hinten auf den Kajak gelegt, und man hält sich zum Empfang des nächsten Schwarms bereit. Auf diese Weise fährt man fort, bis es dunkel ist, die Kajaklinie beugt sich vorwärts und rückwärts, je nachdem die Vögel näher oder weiter vom Lande fliegen.
Diese Jagd erfordert eine nicht geringe Fertigkeit im Schießen, denn die Eidergans fliegt bekanntlich sehr schnell, außerdem muß man völlige Herrschaft über den Kajak haben, um sich in richtiger Schußweite zu halten und einigermaßen sicher treffen zu können. Hierin besitzen die Eskimos zum Theil eine ganz erstaunliche Tüchtigkeit. Die Geschwindigkeit, mit der sie die Kajaks bewegen, die Ruder befestigen und die Büchse anlegen, sowie die Sicherheit, mit der sie treffen, selbst wenn es nur ein einziger Vogel ist, auf den sie schießen, muß die Bewunderung des besten Vogelschützen erregen, um so mehr, als das leichte Fahrzeug auf der See unablässig hin- und herschwankt.
[S. 371]
 nd dann kam das Weihnachtsfest heran. In Bezug auf dessen festliche
Begehung wollen die Grönländer hinter keinem anderen Volk zurückstehen.
Schon Monate vorher beginnen die Vorbereitungen. Die Frauen sind eifrig
mit dem Anfertigen einer Unmenge von schönen Kleidungsstücken, Anoraks,
Beinkleidern und Kamikern beschäftigt, die mit strahlenden Stickereien
verziert werden. Die ganze Familie, von den allerjüngsten bis zu den
ältesten Mitgliedern muß von Kopf zu Fuß in neuen festlichen Gewändern
erscheinen. Besonders die jungen, unverheiratheten Mädchen müssen sich
putzen. Gehören sie einer der bessergestellten Familien an, die im
Dienst der Handelscompagnie stehen, so pflegen die Eltern im Sommer mit
dem Schiffe etwas besonders Schönes an Stoffen aus Kopenhagen kommen zu
lassen, wie man es nicht in der Kolonie findet, am liebsten Seide, ja
es ist sogar vorgekommen, daß sie Sammet für ihre Töchter verschrieben
haben. In ihrem neuen Staat, der gewöhnlich in aller Stille angefertigt
wird, kommen sie dann plötzlich an dem großen Fest zum Vorschein, eine
immer strahlender als die andere.
nd dann kam das Weihnachtsfest heran. In Bezug auf dessen festliche
Begehung wollen die Grönländer hinter keinem anderen Volk zurückstehen.
Schon Monate vorher beginnen die Vorbereitungen. Die Frauen sind eifrig
mit dem Anfertigen einer Unmenge von schönen Kleidungsstücken, Anoraks,
Beinkleidern und Kamikern beschäftigt, die mit strahlenden Stickereien
verziert werden. Die ganze Familie, von den allerjüngsten bis zu den
ältesten Mitgliedern muß von Kopf zu Fuß in neuen festlichen Gewändern
erscheinen. Besonders die jungen, unverheiratheten Mädchen müssen sich
putzen. Gehören sie einer der bessergestellten Familien an, die im
Dienst der Handelscompagnie stehen, so pflegen die Eltern im Sommer mit
dem Schiffe etwas besonders Schönes an Stoffen aus Kopenhagen kommen zu
lassen, wie man es nicht in der Kolonie findet, am liebsten Seide, ja
es ist sogar vorgekommen, daß sie Sammet für ihre Töchter verschrieben
haben. In ihrem neuen Staat, der gewöhnlich in aller Stille angefertigt
wird, kommen sie dann plötzlich an dem großen Fest zum Vorschein, eine
immer strahlender als die andere.
Unterhalten sich die Frauen anderer Länder über Putz und Kleider, so thun es die getauften Grönländerinnen nicht minder. Ich kann freilich nicht leugnen, daß die westgrönländischen Mädchen am Weihnachtsabend oft so bezaubernd aussehen, daß ein[S. 372] Vergleich für die Schönheiten jenseits des Meeres trotz ihres europäischen Pompes nicht immer vortheilhaft ausfallen würde.
Aber nicht allein mit dem Anzuge macht man sich vor dem Fest zu schaffen. Um gehörig in körperlichen Genüssen schwelgen zu können, spart man wochenlang Geld zusammen, soweit ein Grönländer überhaupt im stande ist zu sparen, und wenn man nichts hat, so verschafft man sich etwas, indem man die nothwendigsten Geräthschaften an den Kaufmann verkauft. So z. B. ist es nichts Ungewöhnliches, daß der Grönländer die Federn aus seinen Betten verkauft, um dafür einige Leckereien zu erstehen, und dann den Rest des Winters in aller Kälte, nur mit einem baumwollenen Bezug bedeckt, daliegt. Vor allen Dingen gilt es, sich Ueberfluß an Kaffee zu schaffen.
Hieraus ersieht man, daß das Weihnachtsfest durch Ueberführung auf grönländischen Grund und Boden seinen Charakter nicht verbessert hat. Es ist der Ruin besorgter Familienväter und das Verderben aller Mägen. Es bringt eine kurze Freude, der oft ein langer fühlbarer Mangel folgt. Daß dies in den Geschmack der Eskimos fällt, die sich mehr als jedes andere Volk die Lehre der Bibel: „Sorget nicht für den morgenden Tag“ zu Herzen genommen haben, ist ganz selbstverständlich.
Auch bei dem Koloniedirektor war man eifrig mit Vorbereitungen beschäftigt. Schon seit langer Zeit hatte unsere liebenswürdige Wirthin, Dietrichson und Sverdrup, Tüten, Körbe und andere Sachen aus buntem Papier verfertigt, während der Direktor einen Tannenbaum fabrizirte, indem er grönländische Wachholderzweige in einen Stock einfügte, der als Stamm diente.
Und dann kam der Weihnachtsabend. Am Vormittage wurde der Tannenbaum aufgeputzt.
Um 2 Uhr fand eine große Festfeier in der Kirche statt,[S. 373] es betraf die Prüfung der Schulkinder; bei einer solchen Gelegenheit sind natürlich alle Grönländer zugegen.
Sobald die Feier beendet ist, stürzen einer alten Gewohnheit gemäß alle Kinder nach der Wohnung des Koloniedirektors, wo sie jedes eine Tüte mit Feigen erhalten. Als dieser Schatz nach Hause gebracht war, kamen sie auch zu uns, um sich von uns ein ähnliches Geschenk abzuholen. Es war eine ganze Völkerwanderung von diesen kleinen Pelzmenschen. Alle Kinder, die nur eben gehen können, kommen herangetrippelt. Sind sie unter dem Alter, so werden sie von ihren Müttern getragen, für die Allerkleinsten nehmen es die Andern mit.
Am Nachmittag um 5 Uhr fand ein Kirchenkonzert statt. Von einem aus Grönländern und Grönländerinnen bestehenden Chor, der lange vorher in aller Stille eingeübt war, wurden Weihnachtslieder gesungen, die theils von den Katecheten verfaßt, theils von ihnen ins Grönländische übersetzt waren. Das Ganze machte einen liebenswürdig-kindlichen Eindruck. Die Melodien waren frisch und schön, nicht schleppend und monoton, wie es die Melodien von Kirchenliedern leicht sind. Ein älterer halbcivilisirter Grönländer, der sein Licht nicht gern unter den Scheffel setzte, meinte, daß der Kirchengesang ja freilich nicht mehr auf derselben Höhe stände, wie zu seiner Zeit, daß er aber trotzdem „sehr schön“ sei, — es wäre ungefähr so, als wenn man das Geräusch eines Taterat-Berges (Mövenberges) höre, wo die Tateraten[93] unter stetem Geschrei auf- und niederflattern.
Nach dem obligaten Reisbrei und dem Rennthierbraten beim Koloniedirektor, wo alle Mitglieder der Expedition eingeladen waren, wurde der Weihnachtsbaum unter großem Jubel angezündet.
[S. 374]
Als die Fröhlichkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurde ein großer, runder Kopf mit einer fürchterlichen Perrücke zur Thür hineingesteckt. Er gehörte unserm Freund Joel, der nach einer Bierflasche fragen wollte, die er sich bei den Lappen gegen einige Eidergänse eingetauscht hatte, die er aber mit verschiedenen anderen Sachen zurückgelassen hatte, während er sich etwas beim Doktor zu schaffen machte, um bei der Gelegenheit in Veranlassung des Festes einen oder auch gar zwei Schnäpse zu ergattern. Er schien seinen Zweck erreicht zu haben. Große Heiterkeit erregten die lebhaften Gebärden, mit denen er beschrieb, wie lang ihm das runde Gesicht geworden sei, als er, wiedergekommen, fand, daß alles verschwunden war, „bogase nami mitit nami clisa nami damase nami,“ d. h.: „Flasche nichts, — Eidergänse nichts, Angelschnüre nichts, alles gar nichts.“ Er ließ sich jedoch durch eine neue Bierflasche bald über seinen Verlust trösten. Seine Verwunderung und der Glanz seiner dunklen Augen, die beim Anblick des Weihnachtsbaums und all der Lichter zu zwei runden Punkten wurden, erheiterten uns sehr. Groß war seine Freude, als er einige Tüten mit Weihnachtskonfekt erhielt. Reich wie ein Krösus kehrte er schwankenden Schrittes über die Berge zu seiner lieblichen Ehehälfte bei Neu-Herrnhut heim.
Als ich am Morgen des ersten Weihnachtstages gegen 6 oder 7 Uhr in meinem süßesten Schlummer lag und mich im Traum nach Norwegen zurückversetzt glaubte, erschallte plötzlich ein Kindergesang, der sich mit meinen Träumen verwob. Der Gesang wurde lauter und lauter, ich erwachte und hörte nun den lebhaftesten Weihnachtsgesang, der von einem großen Chor in dem Gang vor unserer Thür gesungen wurde. Die ganze Nacht hindurch war dieser Chor umhergegangen, hatte in allen Grönländerhäusern gesungen und endete seinen Rundgang nun damit, daß er alle am Orte ansässigen Europäer mit Gesang erweckte.[S. 376] Ich muß gestehen, daß es schön klang, und daß ich meinestheils niemals auf so schöne Weise geweckt worden bin, als aber der Gesang verstummt und der Chor weitergezogen war, schlief ich abermals sanft ein, um den verlorenen Faden im Lande der Träume wieder aufzunehmen.

Als ich am Morgen in die Küche hinaus kam, stand Balto dort und unterhielt die Mädchen. Er sprach sich in einem längeren Vortrag über die grönländische Art und Weise, Weihnachten zu feiern, aus. Dieselbe gefiel ihm sehr. Er war die ganze Nacht von Haus zu Haus gezogen. Der herrliche Kaffee, den er überall bekommen hatte! Es war noch nicht zehn Uhr des Morgens, und doch hatte er es an „diesem Morgen“ bereits fertig gebracht, vierundzwanzig große Tassen Kaffee zu trinken. Es hatte auch allerlei gegeben, was stärker war, was er freilich verschwieg, obwohl es aus seinen Augen und seiner Rede sprach. Ein solches Weihnachtsfest hatte er noch niemals erlebt! Es war alles zu herrlich gewesen.
Bald nach Mittag gingen nach guter alter Sitte alle am Platze ansässigen erwachsenen Grönländer, Frauen wie Männer, bei den Europäern herum, um ihnen die Hand zu schütteln und ein fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen, worauf man nur „ivdlitlo“ d. h. „Du auch“ zu antworten hat, was freilich einförmig genug werden kann, wenn es zu mehr als fünfzig Menschen wiederholt werden soll.
Zum Nachmittag um 3 Uhr waren die vornehmsten von den in der Kolonie ansässigen Grönländern, die Katecheten, der Buchdrucker, die Kifaker (d. h. im Dienste der Handelscompagnie Angestellte), sowie die Fänger sämmtlich mit ihren Frauen zu dem Koloniedirektor eingeladen, um mit Kaffee, Schokolade und Kuchen traktirt zu werden. In ihrem besten Feststaat kamen sie Alle, begrüßten die Gastgeber und setzten sich ruhig an die[S. 377] Wände. Es ging sehr feierlich zu, was ja auch kein Wunder war, denn sie befanden sich jetzt in dem Gesellschaftssalon des Nevertoup (d. h. Kaufmann), eines der hohen Herren. Bald verbreitete sich indessen eine gemüthlichere Stimmung über die Versammlung. Die Bewirthung übte hier wie gewöhnlich ihre Wirkung aus. Einer von den Grönländern, der in Kopenhagen gewesen war und der seinen Landsleuten zeigen wollte, wie es in der großen Welt zuging, bot einer der hervorragenden grönländischen Damen den Arm, mit einer sehr ungeschickten Verbeugung. Sie verstand natürlich dies Manöver nicht, und er mußte sie mit Gewalt mit sich schleppen, um sie, wie er sich ausdrückte an einen würdigeren Sitz weiter in die Stube hineinzuziehen. Nachdem dies besorgt war, wandte er sich an mich, um mir auseinanderzusetzen, wie dumm seine Landsleute seien, und wie sie geleitet werden müßten, wenn es sich um den feineren geselligen Ton handelte. „Jetzt können Sie,“ sagte er, „meine Frau nehmen und sie an einen Ehrenplatz führen.“ Ich dankte ihm für die mir zugedachte Ehre und bedauerte, daß ich mich deren nicht würdig fühle. Der Mann hatte an jenem Abend übrigens etwas im Kopf.
Er gehörte zu den wenigen Grönländern, denen am Fest Branntwein geschenkt werden durfte. Infolgedessen war er während der Festzeiten selten ganz klar. Des Nachts war er ganz unmöglich, so daß seine niedliche kleine Frau das Haus verlassen oder auf dem Boden schlafen mußte, obwohl sie sich nach Kräften dagegen zu wappnen suchte, indem sie Zeichen machte und Amuletts unter die Stuhlsitze befestigte, damit der Mann in der Trunkenheit gut sein sollte, so wie es der grönländische Aberglaube erheischt.
Endlich verabschiedete man sich und zog weiter auf der heiligen Weihnachtswanderung, um in einem andern Hause von neuem wieder zu beginnen.
[S. 378]
Am dritten Weihnachtstage gab der Koloniedirektor ein Gastmahl für die Kifaker und die besten Fänger der Kolonie. Man hatte zu diesem Zweck einen Raum im Krankenhause gemiethet, und dort wurde mit grauen Erbsen, Schweinefleisch, gesalzenem Rennthierfleisch und Branntwein und Apfelkuchen als Dessert traktirt. Später gab es Punsch, Kaffee und Cigarren. Zu dergleichen Bataillen stellte man sich mit Teller, Tasse oder Schüssel, einem Löffel und einem Punschgefäß bewaffnet ein. Was man von seiner zuertheilten Portion nicht verzehrt, nimmt man mit nach Hause für Frau und Kinder, die sich häufig auch während der Mahlzeit einfinden, um sich ihren Antheil zu holen.
Erst spät am Abend endete dies Fest, das mit Tanz und Lustbarkeit in der Böttcherwerkstatt beschlossen wurde.
[93] Taterat ist eine Mövenart.
[S. 379]

6. Februar. Ich wohne in einer Erdhütte, halb unter der Erdoberfläche, der Raum ist sehr niedrig, ich kann nur so eben aufrecht stehen. In die Hütte hinein gelangt man, wie dies bei allen Eskimowohnungen der Fall ist, durch einen langen, noch tiefer liegenden Hausgang, der so niedrig und eng ist, daß man, um hindurch zu kommen, fast auf allen Vieren kriechen muß. Das Haus ist völlig vom Schnee begraben. Das Einzige, was ich sehen kann, ist ein Stückchen vom Fenster, das, so weit es sich machen läßt, von Schnee frei gehalten wird, sowie das Loch, durch das man in den Hausgang hinabkriecht.
Es war schon längst meine Absicht gewesen, nach Sardlok zu reisen, und da der Doktor im Januar hierher mußte, um sich[S. 380] nach einem Kranken umzusehen, so reiste ich in Begleitung meines Freundes Joel mit. Sardlok liegt drei Meilen von Godthaab entfernt, es war eine ungewohnte Bewegung für die Arme, und die gezwungene Stellung der gerade ausgestreckten Beine im Kajak war sehr ermüdend für den noch ungeübten Ruderer. Als der Nachmittag kam, dachte ich deswegen nicht ohne Sehnsucht an das Ziel unserer Reise.
In Joel hatte ich indessen, wie der Leser weiß, einen munteren Gefährten. Bald sang er Lieder, bald erzählte er eine Menge unverständliches Zeug über die Orte, an denen wir vorüber kamen, bald machte er, wenn er eine Schar Eidergänse fliegen sah, ganz entsetzliche Anstrengungen, um die Büchse aus dem Kajak herauszuholen, was ihm jedoch nur einmal rechtzeitig gelang, und da schoß er vorbei (er war gerade kein Meisterschütze), bald brüllte er, daß er ans Land müsse, und dann ruderte er, was das Zeug halten wollte, um seinen Kajak zu entleeren. Derselbe war halb voll Wasser, da er sich wie die ganze übrige Person in einem sehr schlechten Zustand befand und grausam leckte.
Der Abend war dunkel. Drohend standen der „Sattel“ und die übrigen Berge da und verschlossen die Ostseite des Fjords, während über uns die Sternenwölbung funkelte. Wir ruderten schweigend nebeneinander, außer dem Plätschern der Ruder und dem Rieseln des Wassers gegen die Kajakwände war kein Laut zu vernehmen.
Endlich, als wir an einer Landzunge vorübergekommen waren, schien uns ein Licht vom Lande her freundlich entgegen, und wir befanden uns am Ziel. Der Doktor war etwas vor uns angekommen.
Es hat seinen eigenen Reiz, durch den Hausgang zu kriechen, in die kleinen aber gemüthlichen Räume zu gelangen und mit der den Eskimos eigenen Gastfreiheit empfangen und[S. 381] gepflegt zu werden. Ich halte mich in dem Hause des alten Katecheten Johan Ludwig auf. Außer ihm und meiner Wenigkeit wohnt hier seine Gattin, eine Tochter und ein junger Sohn. Johan Ludwig erzählte mir mit sichtlichem Stolz, daß sein Großvater ein Norweger gewesen, der wegen seiner ungeheueren Stärke sehr berühmt war. Er selber war früher ein sehr tüchtiger Fänger, jetzt war er aber über 70 Jahre alt und ging nicht mehr auf Fang aus. Er hat mehrere Söhne gehabt, die tüchtige Fänger waren, zwei von ihnen sind jedoch im Kajak umgekommen. Jetzt ist nur noch ein 18jähriger Sohn bei ihm zu Hause, der aber kein guter Fänger ist. Die Eltern sind zu besorgt, um ihn hinaus zu lassen.

Der vierte Sohn,[94] Johannes, der einmal der Stolz der[S. 382] Familie gewesen, lag jetzt, als wir kamen, bleich und abgemagert auf der Pritsche. Er litt an Schwindsucht. Er hatte einen zehrenden Husten und konnte fast nichts genießen, aber während er so dort lag, ohne jegliche Hoffnung, jemals wieder von seinem Krankenlager zu erstehen, weilten doch alle seine Gedanken bei der Jagd und dem Leben in freier Luft. Die Erinnerung an alte Zeiten, als er der erste Fänger des Ortes gewesen, tauchten wieder in seiner Seele auf, und wenn der Husten es gestattete, wurde er nicht müde, von seinen Heldenthaten zu erzählen. Dann glänzten seine Augen, ein Lächeln umspielte seine Lippen, er saß abermals im Kajak, er sah den Seehund, er erhob den mageren, kraftlosen Arm, um zu harpuniren, er bugsirte sein Fahrzeug durch Wind und Wellen. Dann kamen die Hustenanfälle, er spie Blut und sank auf das Kissen zurück, schöne Traumgebilde umgaukelten ihn, er warf die Harpune zum letztenmal.
Der Arzt nahm ihn mit, um ihn im Krankenhaus zu Godthaab zu pflegen. Jetzt hat er ausgelitten.
Im Hause nebenan liegt Johannes’ Vetter, Justus; auch er war einstmals einer der besten Fänger von Sardlok, liegt jetzt aber noch elender an Schwindsucht darnieder als Johannes und macht es wohl nicht mehr lange.[95] Beide hinterlassen eine Familie. Der Letztere hat mehrere hoffnungsvolle Söhne, Justus dagegen hat nur einen. Es ist unheimlich, zu sehen, wie dies arme Volk von dieser schleichenden Krankheit dahingerafft wird.
Es ist gerade kein sehr thatenreiches Dasein, das ich hier führe, ich werde immer mehr zum echten Eskimo. Ich lebe das Leben dieses Volkes, esse ihre Speisen, lerne ihre Leckerbissen[S. 383] schätzen, wie rohen Speck, rohe Hellbutthaut, wintergefrorene Krähenbeeren mit ranzigem Speck etc.
Ich schwatze mit ihnen, so gut ich kann, rudere mit ihnen im Kajak, fische, schieße, gehe mit ihnen auf die Jagd, kurz es wird mir klar, daß es nicht ganz unmöglich für einen Europäer ist, ein Eskimo zu werden, wenn ihm nur die nöthige Zeit dazu gelassen wird.
Unwillkürlich fühlt man sich wohl in der Gesellschaft dieser Menschen. Ihr unschuldiges, sorgloses Wesen, ihre anspruchslose Zufriedenheit und Güte wirken ansteckend und vertreiben allen Mißmuth, alles unruhige Sehnen.
Es war meine ursprüngliche Absicht, auf Rennthierjagd zu gehen, ich war auch eines Tages auf Schneeschuhen aus, da ich aber keine Spur entdecken konnte, gab ich es seither auf. Mein größtes Vergnügen war es, Hellbutt zu fangen. Es giebt kein interessanteres Fischen, als diese großen, kräftigen Thiere, die im stande sind, ein Boot zum Kentern zu bringen, in dem schmalen Kajak sitzend, aus dem Wasser zu ziehen.
Man kann lange, ja häufig tagelang, daliegen, ohne einen einzigen Biß zu haben, und gewöhnlich ist das keine Kleinigkeit bei einer Kälte von 20° und einem beißenden Nordwind, der oft mit Schnee vermischt ist; man muß sich sehr in acht nehmen, daß nicht ein kleinerer oder größerer Theil des Gesichts abfriert.

Beißt der Fisch aber endlich, so ist alles vergessen. Man fühlt aber in der Regel nicht sofort einen heftigen Ruck, es ist mehr, als wenn die Schnur mit langsamer aber unwiderstehlicher Kraft hinabgezogen wird, dann werden die Rucke fühlbarer, in einem Nu fährt das Ruder unter den Riemen[96], man ergreift[S. 384] die Leine mit beiden Händen und zieht so hart und so heftig daran, wie man nur irgend kann, wiederholt das mehrmals, dann kann man fühlen, ob der Fisch noch da ist; ist dies der Fall, und zuckt er wieder, so zieht man abermals an, dies wiederholt sich einmal über das andere, man sieht zuletzt aus wie ein Rasender, aber es gilt, fest zuzugreifen und wenn sich das Ziehen durch hundert Klafter Angelleine fortpflanzen soll, so muß es schon recht kräftig geschehen. Endlich hat der Fisch fest genug angebissen, und man beginnt, die Leine aufzuziehen. Es ist nicht leicht, denn der Fisch widerstrebt heftig, und die Leine ist lang, die Arme werden lahm dabei. Die Leine wird regelrecht auf dem Kajak hingelegt und um sie vor dem Zusammenfrieren zu bewahren, mit Seewasser besprengt. Falls der Fisch abermals zu Grunde gehen und mit der ganzen Leine fortlaufen sollte, wirft man die[S. 385] Blase, welche an das eine Ende der Leine befestigt ist, neben dem Kajak aus, man läßt den Fisch dann ruhig laufen, folgt der Blase, die oben auf dem Wasser schwimmt und nimmt die Leine erst wieder auf, wenn der Fisch matt geworden ist.
Es ist wunderbar, wie lang eine Schnur sein kann, wenn man einen Hellbutt aufzieht. Endlich merkt man, daß das Ende da ist, man sieht, wie die Leine den Bewegungen des Thieres folgt, der Widerstand wird stärker, man vermag es kaum mehr zu halten, Zug für Zug geht es in die Höhe, jetzt kommt der Senkstein, — noch ein Zug, und nun ragt ein mächtiger Fischkopf über dem Wasser empor, mit einem Maul und ein paar Augen, daß einem angst und bange davor werden kann. Man greift nach der Holzkeule, die hinten auf dem Kajak liegt und versetzt ihm, wenn es möglich ist, einige tüchtige Schläge auf den Hirnkasten. Mit einem verzweifelten Ruck fährt der Kopf unters Wasser und in pfeilschneller Fahrt gehts wieder auf den Grund. Wehe Dem, der die Leine dann nicht in Ordnung hat, so daß es irgend wo hapert. Ist dies der Fall, so wird man, ehe man sichs versieht, mit dem Kajak rund herum gedreht. Ist der Fisch auf den Grund gekommen, so vermindert sich die Schnelligkeit, und man kann abermals anfangen, aufzuziehen. Man zieht ihn zum zweitenmal an die Oberfläche, aber möglicherweise geht er nochmals auf den Grund. Es ist keine leichte Arbeit, einen Hellbutt drei- bis viermal aus einer Tiefe von hundert Klaftern an die Oberfläche zu ziehen. Endlich gelingt es, ihn ganz in die Höhe zu ziehen und ihm einige wohlgezielte Schläge zwischen die Augen zu versetzen. Das Thier wird matter, man schlägt so hart und so schnell wie möglich darauf los, es macht noch einige verzweifelte Versuche, hinab zu tauchen, allmählich aber betäuben es die Schläge. Man steckt nun das Messer ins Gehirn und Rückenmark. Dann[S. 386] wird die Fangblase an seinem Mund befestigt, um es an der Oberfläche schwimmend zu halten; man nimmt die Schnur, die an dem Fisch befestigt ist, zwischen die Zähne und rudert dem Lande zu. Ich muß gestehen, daß mir dies Bugsiren das Unangenehmste von der ganzen Geschichte war, denn jedesmal, wenn der Kajak auf den Kamm einer Welle gehoben wurde, hielt die Schnur plötzlich gegen, und es gab einen Ruck in den Zähnen, so daß ich häufig glaubte, sie würden mir aus dem Munde gerissen. Dies kann ein Eskimo wahrscheinlich nicht verstehen, denn ihm hat die Natur so feste Zähne gegeben, daß er ohne alle Schwierigkeit Nägel damit ausziehen kann.
Sobald man ans Land gekommen ist, wird der Hellbutt sorgfältig derartig an die Seitenwand des Kajak gebunden, daß er aufrecht im Wasser steht, mit dem Kopf voran, um beim Bugsiren so wenig Schwierigkeit wie möglich zu verursachen; dann geht es heimwärts.
Ein solcher Fang ist übrigens nicht zu verachten. Diese Fische wiegen 100–200 Kilogramm und bieten im Winter, wo es an anderem Fang gebricht, eine vorzügliche Nahrung. Von den beiden Fischen, die ich fing, lebten wir fünf Menschen ungefähr drei Wochen und hatten während der ganzen Zeit fast keine andere Speise.
Als wir eines Tages bei stillem Wetter auf dem Fangplatz lagen, verdunkelte sich der Himmel plötzlich im Süden und ein Südwind zog herauf. In größter Eile sammelten Alle ihre Fangleinen, ehe wir aber noch damit fertig waren, brach das Unwetter los, — zuerst kamen ein paar gelindere Windstöße, die aber bald an Heftigkeit zunahmen. Die See brauste schwarz-weiß heran, und bald war die eben noch spiegelblanke Fläche in ein einziges Schaummeer verwandelt. Strömung und See kämpften miteinander, grünlich-weiße Wellen rollten daher, die[S. 387] Kajaks verschwanden gänzlich in den Wellenthälern. Wir mußten an Land rudern, um unseren Fang und uns selber in Sicherheit zu bringen, und quer durch die Wellen hindurch ging es, so schnell unsere Ruder uns vorwärts zu zwingen vermochten.
Für die Grönländer war dies ja natürlich etwas ganz Alltägliches, für mich aber hatte es das ganze Interesse der Neuheit, und meine Fertigkeit im Kajakrudern wurde auf eine harte Probe gestellt. Man mußte die schweren Sturzwellen aufmerksam verfolgen. Schlug so eine über den Kajak dahin, ehe das Ruder auf der Windseite fertig war, so konnte man auf das Allerschlimmste gefaßt sein.
Wir hielten uns hart an der Küste, um Schutz zu suchen. Den Wind im Rücken, ging es nun mit fliegender Fahrt nordwärts, aber es ist noch schwieriger als vorhin, die Wellen kommen hinter uns her gerollt, und man muß das Ruder mit der größten Vorsicht handhaben, um nicht umgeworfen zu werden. Da kommt eine schwere Sturzsee, ein paar schnelle Ruderschläge, das Ruder flach auf der einen Seite, und das Hintertheil des Kajaks wird hoch in die Höhe gehoben, man legt sich aber hinten über, die Welle bricht sich, man bekommt sie wie einen Schlag in den Rücken, hoch spritzt das Wasser über dem Kopf auf und man fühlt sich auf der Spitze des schäumenden Wellenkammes durch die Luft geschleudert. Dann rollt sie weiter, man sinkt hinab in das Wellenthal, dann wieder ein paar schnelle Ruderschläge, eine neue Sturzsee und man wird wieder dahin getragen.
Ich hatte einen guten Begleiter und Lehrmeister in Eliase, der sich stets so nahe an meiner Seite hielt, wie die Wellen es gestatteten. Bald jagte er wie ein Sturmwind an mir vorüber auf dem Kamm einer Welle reitend, bald überholte ich ihn auf einer anderen Woge. Es war ein Tanz mit den Wellen und ein Spiel mit Gefahren.
[S. 388]
Dann wurde das Ufer höher, und wir kamen in Schutz, ein Eisgürtel legte sich uns aber hindernd in den Weg. Hindurch mußten wir, da galt es denn, die Kajaks in acht zu nehmen, daß sie nicht zwischen den unruhigen Eisschollen zerdrückt wurden. Wir entdeckten eine kleine Oeffnung; der Augenblick mußte ausgenutzt werden, und mit ein paar raschen Ruderschlägen trieb ich den Kajak auf dem Kamm einer großen Welle glücklich hindurch.
Terkel, Sardloks stolzer Fänger, und sein Bruder Hoseas hatten jeder ihre Hellbutt im Schlepptau, und sie kamen erst eine Weile nach uns in den Schutz. Wir hofften, daß der Wind sich ein wenig legen würde, während wir die Beute an den Kajaks befestigten und andere Vorkehrungen trafen, aber es trat keine Veränderung ein, und wir mußten wieder ins Unwetter hinaus, um nach Sardlok zu gelangen. Da wir aber den Wind mit uns hatten, ging es schnell, und wir befanden uns bald im sichern Hafen.
Ich werde oft in die andern Häuser zum Hellbuttessen eingeladen, nachdem ich mich schon zu Hause darin satt gegessen habe, und muß dann essen, so lange der Magen es annehmen will. Besonders oft bin ich in Terkels Haus, welches das größte hier am Ort ist. Neulich abends, als ich dort saß, ward ich Zeuge eines eigenthümlichen Schauspiels. Hoseas’ Sohn, der etwas über ein Jahr alt war, tanzte den „Mardleck“ mit Terkels dreijährigem Töchterchen. Der kleine Bursche tanzte im bloßen Hemd, das ihm bis an die Mitte des Magens reichte, die Arme hielt er steif vom Leibe ab und mit der ernstesten Miene von der Welt hüpfte er bald auf dem einen, bald auf dem andern Bein, dann drehte er sich rund herum, alles in vollständig richtigem Takt mit der Musik, die aus Gesang bestand, und immer mit der gleichen Miene das kleine, hübsche Mädchen[S. 389] anschauend, die ihr Haar und ihre Kleidung genau so trug wie eine erwachsene Grönländerin und dabei ein so kokettes Gesicht aufsetzte, als sei es nicht das erste Mal, daß sie mit Herren zu thun habe. Der ganze Anblick war unwiderstehlich lächerlich. Die eskimoischen Kinder sind sehr früh entwickelt.

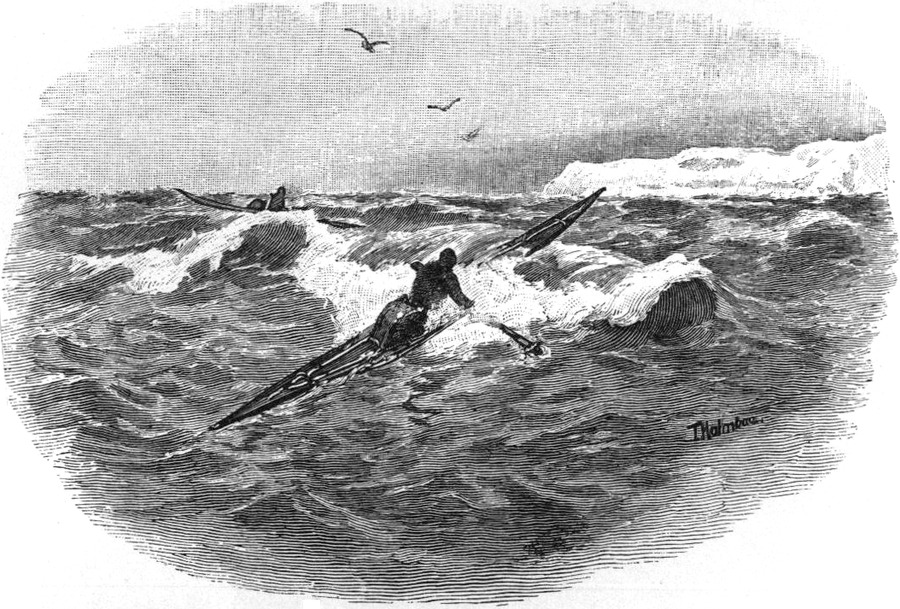
Am 14. Februar kehrte ich wieder nach Godthaab zurück, nachdem ich mich ungefähr einen Monat in Sardlok aufgehalten hatte. Unsre Reisegesellschaft bestand außer Joel und mir noch aus Hoseas aus Sardlok. Alle Kajaks waren mit Hellbuttfleisch,[S. 390] Vögeln und dergl. schwer belastet. Deswegen war es kein leichtes Rudern, als wir von einem heftigen Westwind überfallen wurden. So lange wir uns an dem westlichen Ufer hielten, ging es einigermaßen gut, da der Wind hier keine Macht hatte, als wir aber über den Godthaaber Fjord setzten, wurde es schlimmer. Je mehr wir uns vom Lande entfernten, desto höher wurden die Wellen und wir verschwanden gänzlich zwischen ihnen. Als es nun auch anfing zu schneien, so daß wir nicht die Hand vor Augen sehen konnten, wurde es den Eskimos bedenklich und sie riefen mir zu, daß wir umwenden müßten, um wieder unter den Schutz des Landes zu kommen. Ich war der Meinung, daß es trotz des Schneetreibens leicht sein müsse, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen, und bestand darauf, daß wir es noch eine Weile versuchen wollten, es ging auch noch eine Zeit lang, die Wellen kamen halb von hinten, aber es wurde von Minute zu Minute schlimmer, und nun halfen keine Bitten mehr, sie[S. 391] riefen mir wieder etwas zu, was ich nicht verstand und wandten sich dann um, ohne meine Antwort abzuwarten. Wir arbeiteten gegen den Wind nach dem Lande zurück, wo wir im Schutz lagen, und warteten ab, ob sich das Wetter nicht ändern würde. Unsere Bootslast, die hinten auf den Kajaks lag, wurde an Land gebracht und mit Steinen und Schnee belastet, da wir sie am folgenden Tage, wenn das Wetter es erlaubte, abholen wollten. Es ist nicht gut, die Kajaks bei Seegang zu sehr zu belasten, weil sie dann dem Kentern zu leicht ausgesetzt sind. Als das Schneetreiben sich ein wenig verzogen und der Wind sich gelegt hatte, machten wir uns wieder auf den Weg und gelangten glücklich über den Fjord nach Godthaab.
Kangek, 28. Februar.
Heute schreiben wir den 28. Februar — auch dieser Monat ist schon zu Ende. Vielleicht noch einer — dann kommt das Schiff und dann geht es fort von diesem Leben und diesen Menschen auf Nimmerwiedersehen.
Aber das läßt sich nicht ändern, deswegen ist es am besten, den Gedanken daran fahren zu lassen.
Es ist so frisch hier draußen am Rande des Meeres. Die Wellen stehen mit voller Kraft aufs Land, sie spielen mit dem Kajak, als sei es ein Knäuel Garn, brausen schäumend weiß dahin und donnern gegen Klippen und Felsen, während der Schaum hoch hinaufspritzt bis über das schneebedeckte Land.
Es ist ein herrliches Leben, Wind und See bespülen die Wange, während Hirn und Muskeln sich in steter Spannung befinden, um den Kajak auf den rechten Kiel zu halten, und das Auge nach der Windseite ausspäht, um die Sturzsee jedesmal richtig abzupassen. — — —
Und dann die Nächte, die oft ganz still sind, still und[S. 392] schweigend stehen die Felsen da, sich schwarz von dem weißen Schnee und dem Meere abhebend, das in melancholischem Takt gegen das Ufer schlägt und in dem sich ein schwacher Widerschein des dunklen sternenglitzernden Himmels widerspiegelt. Hin und wieder huscht ein glänzendes Nordlicht, bald in bläulichem, bald in röthlichem, in gelbem, dann wieder in bläulichem Schein über das nächtliche Firmament, bald als wogende, stets wechselnde Bänder, bald als Flammen an dem südlichen Himmel dahinrollend, sich bald in blendenden Strahlenbündeln sammelnd; es brennt und leuchtet, breitet sich aus, sammelt sich wieder und verschwindet. Dann kommen neue Feuergarben, neue Flammen sprühen auf — es ist ein ewiger Wechsel, stets dasselbe, und doch stets etwas Neues — gleich räthselhaft und fesselnd —, das Meer aber rollt wie vorhin in schweren Wellenschlägen gegen das Ufer.
Vor kurzem war ich in Sardlok, jetzt bin ich hier draußen — und weshalb? Ich weiß es nicht. Vielleicht warte ich auf den Frühling, wo die Tage länger werden, die Sonne wärmer scheint und der Schnee schmilzt. Ich fühle mich ihm hier draußen gleichsam näher gerückt, wenn er vom Süden her übers Meer gezogen kommt, werde ihn aber doch nicht mehr hier oben erleben, trotzdem aber ist es wohlthuend, zu sehen, wie die Tage länger werden, zu sehen, wie das Meer in der höher aufsteigenden Sonne erglänzt, sie beinahe wärmend zu fühlen, und mit dem grauenden Tag auf Fang auszuziehen, gegen Abend heimzukehren, ohne daß der Tag schon zu Ende ist. Die menschliche Gesellschaft, ihre großen Gedanken und ihr großes Elend — alles liegt gleich fern — nur das Gefühl der Freiheit, die reine Freude am Leben ist geblieben.
Am 17. Februar kam ich hier heraus. Es ist ein guter Ort, um sich im Kajakrudern zu üben. Die Strömung ist[S. 393] reißender als sonst irgendwo, sie stürzt zwischen den Scheeren und an den Landzungen vorüber wie ein Fluß, und wo sie den großen Wellen draußen in dem offenen Meer begegnet, da thürmen diese sich auf und zischen wild in die Höhe. So ist es denn kein Wunder, daß die Kangeken die besten Kajakruderer hier in der Gegend sind, und schwerlich findet man ihres gleichen in ganz Grönland. Auf dem offenen Meere suchen sie ihren Erwerb, oft setzen sie dabei das Leben aufs Spiel, Viele kommen um, aber unberührt davon bewegen sie sich tagaus, tagein auf dem tückischen Element. Es ist ein Vergnügen, sie mit den hohen Wellen tummeln zu sehen, die gleich galoppirenden Pferden mit ihnen herangestürmt kommen, die flatternden Mähnen mit weißem Schaum bedeckt. Keine Welle ist ihnen zu hoch. Kommt ihnen einmal eine Sturzsee zu schwer heran, so stemmen sie die Seite des Kajaks dagegen, stecken das Ruder unter den Riemen an der Windseite, beugen sich tief über den Kajak und lassen die Sturzwelle über sich hinrollen, oder sie legen auch das Ruder flach gegen die Windseite und indem die Welle sich bricht, wälzt sich der Ruderer mitsamt seinem Kajak in den Abgrund hinab und schwächt dadurch ihre Macht. Sobald sie vorübergerollt ist, richtet er sich wieder auf dem Ruder auf. Man hat mir erzählt, daß die wirklich überlegenen Kajakruderer noch einen anderen Kunstgriff haben. Ist eine Welle so hoch, daß sie sie nicht auf andere Weise zu bezwingen glauben, so kentern sie ihren Kajak in demselben Moment, wo die Welle sich über sie ergießt, und lassen den Boden den Stoß aufnehmen, ist die Welle vorüber, so richten sie sich wieder auf.
Die Stöße, welche eine solche Welle versetzen kann, müssen oft sehr heftig sein. Es wurde mir erzählt, daß ein Mann durch eine Welle, die mit ihrer ganzen Gewalt über ihn hereinbrach, derartig auf den Kajak gedrückt wurde, daß er eine[S. 394] Rückgratsverletzung davon trug, die ihn fürs Leben zum Krüppel machte. Trotzdem kenterte er aber nicht. Es ist bewunderungswerth, welche Geistesgegenwart und Herrschaft über die Kajaks diese Eskimos besitzen!
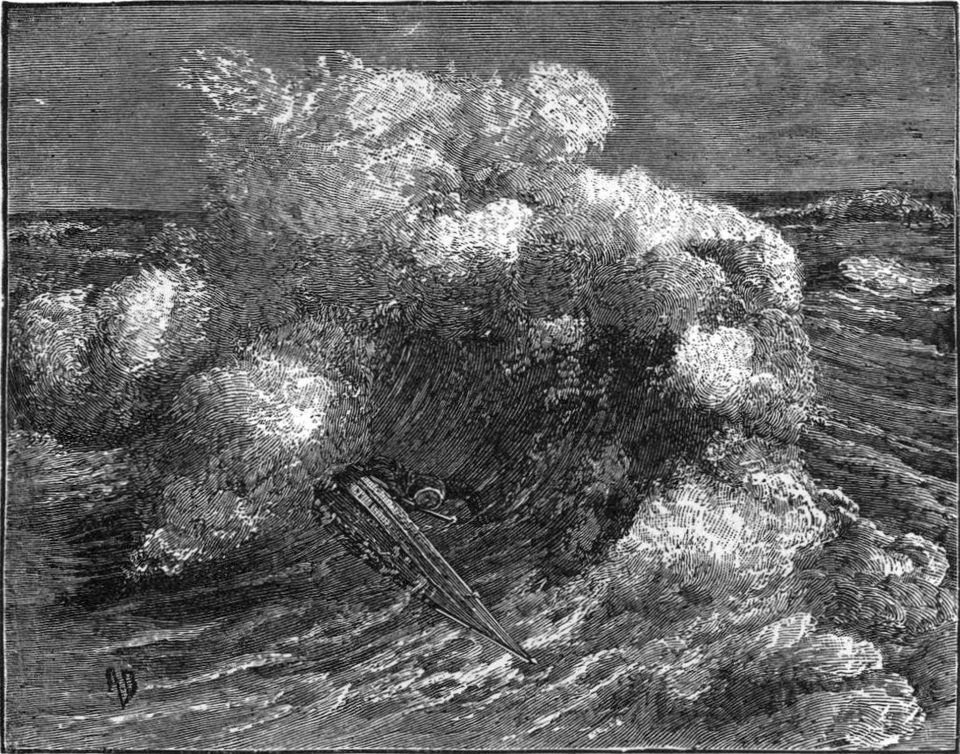
Anton, ein hervorragender Fänger aus Karusuk (einem tief in den Fjord hineingelegenen Wohnort), kam eines Tags auf Fang nach Kangek. Die See war sehr erregt, und, unbekannt wie er war, jagte er auf einer Welle über eine Untiefe dahin. Plötzlich saß er fest und im nächsten Augenblick stürzte sich eine neue Welle über ihn. Er glaubte, daß es mit ihm aus sei, beugte sich aber vorüber, klemmte das Ruder gegen den Kajak und verschwand unter dem schäumenden Wasser. Als die Sturzsee sich verlaufen hatte, war auch Anton wieder flott geworden und schoß in seinem Kajak dahin, genau so überlegen wie vorher.
[S. 395]
Hauptsächlich betreibe ich hier Jagd auf Eidergänse. Man hat dazu die beste Gelegenheit hier draußen bei einigen kleinen Inseln und Werdern, die Jemerigsek genannt sind.

Man schießt die Eidergänse hier gewöhnlich auf andere Weise als in Godthaab, indem man selber umherzurudern und die Vögel aufzusuchen pflegt. Bemerkt man Eidergänse auf dem Wasser, so hält man sich auf der Windseite und nähert sich ihnen, soweit man kann. In der Regel kommt man ihnen jedoch nicht sehr nahe, bevor sie auffliegen, da sie aber gegen den Wind auffliegen müssen, so sehen sie sich gewöhnlich gezwungen, in Schußweite an den Kajaks vorüber zu kommen. Da gilt es denn, eine solche Stellung einzunehmen, daß sie an der richtigen Seite vorüberfliegen und man zum Schuß kommen kann. Ein Mensch,[S. 396] der nicht links zu schießen versteht, kann nämlich nicht rechts schießen, wenn er im Kajak sitzt, sondern muß die Vögel gerade vor sich oder auf der linken Seite haben. Der Kajak gestattet keine großen Schwenkungen. Wenn die Vögel auffliegen und man sieht, welche Richtung sie einschlagen, muß man also, wenn der Kajak nicht die richtige Lage hat, ihn in aller Eile wenden, das Ruder unter den Riemen stecken, den rechten Fausthandschuh abziehen, die Büchse aus dem Sack holen und an die Wange legen — dann knallt der Schuß! Will man aber Aussicht auf Erfolg haben, so muß dies alles Sache eines Augenblicks sein, und bei hoher See muß man so verwachsen mit seinem Kajak sein, daß man die Büchse ebenso sicher hantirt als auf dem Lande, natürlich darf man, wenn der Schuß knallt, nicht kentern. Viele von den Kangeken haben diese Jagd zu einer großen Vollkommenheit gebracht. Ich habe sie bei hohem Seegang ihr Dutzend Eidergänse und mehr schießen sehen, und zwar indem sie nur auf einzelne Vögel zielten. Zuweilen ging ich mit einem Fänger Namens Pedersuak — der große Peter — weit in See hinaus. Er war ein guter Vogelschütze, und ich habe oft mit ihm um die Wette geschossen, zog aber zu seinem Entzücken gewöhnlich den Kürzeren dabei. Eines Tages, als wir zusammen auf der See lagen, kamen zwei Eidergänse in voller Geschwindigkeit mit dem Winde daher geflogen. Sie befanden sich außerhalb meiner Schußweite, flogen aber in der Richtung auf Pedersuaks Kajak zu. Ich machte ihn auf sie aufmerksam, er bemerkte sie auch, ließ sie aber ruhig an sich vorüberfliegen, ich konnte gar nicht begreifen, was er damit beabsichtigte, plötzlich aber erhob er die Büchse, es knallte und beide Vögel fielen. Er erklärte mir später, er habe nur gewartet, um sie beim Schießen auf einer Linie zu haben. Ich hielt das Ganze für einen bloßen Glückszufall, aber wir hatten gar nicht lange gerudert, als abermals[S. 397] zwei Eidergänse genau so wie vorhin herangeflogen kamen, diesmal aber noch in besserer Schußweite für Pedersuak. Er steckte das Ruder unter den Riemen und hielt die Büchse bereit, jedoch ohne zu schießen. Endlich als sie längst vorüber waren, knallte ein Schuß, und abermals fielen die beiden Vögel. Ich habe das später häufig erlebt, ja ich habe sogar drei Vögel, die zusammen dahergeflogen kamen, auf einen Schuß fallen sehen, indem der Schütze den Augenblick abwartete, wo sie aneinander vorbei flogen und sich alle auf einer Linie befanden. Die Eskimos schießen nur mit einer Mundladebüchse, die sie indessen gut zu laden wissen und mit der sie in einer ganz unbegreiflichen Entfernung treffen können. Oft, wenn ich mit ihnen auf Jagd gerudert war, unterließ ich es, auf die vorüberfliegenden Vögel[S. 398] zu schießen, weil mir der Abstand viel zu groß erschien, dann aber hat ein Eskimo neben mir sofort angelegt, gezielt und den Vogel getroffen. Es ist gar nicht leicht, diese Büchsen zu laden, wenn die See über die Kajaks hereinbricht; man legt sie mit dem Kolben vorn auf den Kajak und kehrt die Mündung dem Gesicht zu oder stützt sie auf die Schulter, während man Pulver, Zündhütchen etc., das man, nur um es trocken zu halten, in der Mütze aufbewahrt, hervorholt. Auf diese Weise kann man sich selbst bei dem stärksten Seegang so einrichten, daß kein Wasser in den Büchsenlauf kommt. Zur Aufbewahrung der Büchse, die man am liebsten immer bei der Hand hat, dient ein oben auf dem Vordertheil des Kajaks liegender Sack.


[S. 399]
Eine andere Art der Vogeljagd, die, falls man Uebung darin hat, im Grunde ein noch größerer Sport ist, wird mit dem Vogelpfeil betrieben, doch ist hierzu noch mehr Uebung erforderlich. Hierin sind jedoch die Kangeken wahre Meister. Es ist ein wahres Vergnügen, sie ihre Vogelpfeile werfen zu sehen.
Nach einem dreiwöchentlichen Aufenthalt in Kangek kehrte ich wieder zurück. Bei der Gelegenheit erhielt ich einen guten Beweis von dem Aberglauben der Grönländer. Als ich in Godthaab ankam, wurde ich wie gewöhnlich von einer ganzen Schar von Grönländerinnen empfangen. Ich muß unfreundlicher und wortkarger als gewöhnlich gewesen sein, vielleicht war ich auch, da ich den ganzen Tag auf Jagd nach Vögeln umhergestreift hatte, ermüdet. Die Grönländerinnen waren sich aber sofort darüber einig, daß ich einem großen, unheimlichen Kobold begegnet sein müsse oder einem Wesen, das auf den Inseln da draußen hausen und den einsamen Kajakmännern erscheinen soll, die sich in die Nähe dieser Inseln wagen (sie nennen dies Wesen Tupilik, weil es in der Form einem Zelt gleicht). Kehren die Jäger heim, nachdem sie dies Wesen gesehen haben, so pflegen sie noch lange nachher stumm zu sein. Hieran glauben die Grönländer steif und fest, und die Kajakmänner nähern sich aus diesem Grunde niemals allein diesen Inseln und wollten es auch mir nicht erlauben, so viel allein umherzustreifen, wie ich es that, jetzt hofften sie, daß ich mein Lehrgeld bezahlt hätte.
[94] Man lese nur die Beschreibung, die Lieutenant Bluhme im Jahre 1864 von ihm macht.
[95] Er starb noch bevor wir Grönland verließen.
[96] Das Ruder wird unter den an dem Kajak befestigten Querriemen gesteckt, so daß es gegen die Seitenwand des Kajaks liegt. Durch den Widerstand, welchen das Ruderblatt im Wasser leistet, trägt das Ruder sehr dazu bei, die Lage des Kajaks zu befestigen.
[S. 400]
 ir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, wenn der Frühling
kommen würde, eine Schneeschuhtour über das Inlandseis zu unternehmen,
um zu untersuchen, ob diese Jahreszeit nicht die geeignetste zur
Befahrung der äußeren Theile des Eises sei. Nach allem, was wir schon
im September gesehen hatten, schien es, als ob alle Spalten und Risse
im Laufe des Winters durch starke Schneefälle und anhaltende Winde
ausgefüllt und geebnet werden müßten.
ir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, wenn der Frühling
kommen würde, eine Schneeschuhtour über das Inlandseis zu unternehmen,
um zu untersuchen, ob diese Jahreszeit nicht die geeignetste zur
Befahrung der äußeren Theile des Eises sei. Nach allem, was wir schon
im September gesehen hatten, schien es, als ob alle Spalten und Risse
im Laufe des Winters durch starke Schneefälle und anhaltende Winde
ausgefüllt und geebnet werden müßten.
Ich war deswegen der Ansicht, daß künftige Schiffsexpeditionen, deren Zweck es ist, den äußeren Rand des Inlandseises zu untersuchen, hauptsächlich die Monate April, Mai und vielleicht auch die erste Hälfte des Juni benutzen müssen. Man wird da sicher verhältnißmäßig leicht die meisten Stellen des äußeren Inlandseises befahren können, ohne im wesentlichen von den vielen Unebenheiten und Spalten gehindert zu werden, die später im Jahr bloßgelegt werden und die durch die Wirkung der Sonne und das Schmelzen des Schnees entstehen. Wenn man zu einer solchen Untersuchung ein eigens dazu eingerichtetes Schneesegelboot benutzte, das sicher große Vortheile bieten würde, so wäre ebenfalls der Frühling und der Vorsommer die günstigste[S. 401] Zeit, da alsdann außer einer guten Schlittenbahn auch noch der Wind zu statten käme. Möglicherweise könnte man mit einem solchen Fahrzeug ohne große Schwierigkeit den ganzen Rand des Inlandseises von dem südlichen Theil bis nach Norden hinauf, ja vielleicht auch selbst die nördliche Spitze besegeln.
Da lag es denn für mich sehr nahe, als der Frühling herankam, einen Ausflug auf das Inlandseis zu machen. Es erschien mir von größtem Interesse, gerade die Strecke zu untersuchen, auf der wir heruntergekommen waren, um zu sehen, welche Veränderungen dort im Laufe des Winters vor sich gegangen waren.
Da man in der Kolonie das Schiff, das uns nach Hause bringen sollte, schon vom ersten April an erwarten zu können glaubte, durften wir uns freilich nicht allzu weit entfernen. Einige von uns beschlossen deswegen, im März einen Versuch zu machen, obwohl es etwas früh war, um auf eine wirkliche Ausbeute rechnen zu können. Die Ausrüstung, die sich auftreiben ließ, war übrigens nach mehr als einer Richtung hin höchst mangelhaft. Alles, was wir bekommen konnten, beschränkte sich auf gedörrte Angmagsetts, hartes Brot und Butter. Von dem zum Schmelzen des Schnees erforderlichen Spiritus hatten wir nur sehr wenig.
Am 21. März fuhren Sverdrup und Kristiansen in einem Boot, ich selber aber in meinem Kajak in den Ameralikfjord hinein. Wir erreichten Kasigianguit, wo wir, ehe wir uns auf das Inlandseis begaben, einige Rennthiere zur Vermehrung unseres Proviants zu erlegen hofften. Hier wurden wir indessen fünf Tage durch Schneesturm und Thauwetter aufgehalten. Wir lagen den größten Theil des Tages im Zelt und lebten von unseren Angmagsetts und Schiffsbrot mit Butter, während der nasse, alles durchweichende Schnee sich auf uns legte und Eis und Schnee[S. 402] unter uns schmolzen. Die letzten Tage wohnten wir buchstäblich in einer Wasserlache, und da der Schlafsack, in dem wir alle Drei lagen, ziemlich feucht war, untersuchten wir ihn und fanden, daß sich mehrere Zoll Wasser darin befanden, besonders unter denjenigen Körpertheilen, die, wenn man auf dem Rücken liegt, hauptsächlich mit der Unterlage in Berührung kommen. Wir konnten das Wasser mit den Händen herausschöpfen, es half uns aber nicht viel, denn es war sofort wieder da. Sverdrup meinte, unser Zeltleben auf dem Inlandseise sei im Vergleich hiermit der reine Genuß gewesen.
Als gegen Ende des Monats die Zeit heranrückte, wo nach der allgemeinen Ansicht das Schiff erwartet werden konnte, hatte es keinen Zweck unsern Ausflug noch in die Länge zu ziehen; so begaben wir uns denn am 28. März nach Godthaab zurück.
Am selben Tage, an welchem wir diesen Ausflug antraten, ruderten Dietrichson und Balto in ihren Kajaks in den Godthaabsfjord hinein, wo sie die Wohnplätze Sardlok, Kornok, Umanak und Karusuk besuchten. Sie kehrten erst einige Tage nach uns wieder heim. Als sie sich auf dem Rückwege, am letzten Tage ihres Ausflugs unterhalb des „Sattels“ befanden, rief Balto plötzlich Dietrichson zu, daß er an Land gehen müsse, sein Kajak lecke und sei halb mit Wasser angefüllt. Dietrichson erwiderte, das könne ihm gar nicht nützen, das Land sei so steil, daß sie nirgends landen könnten, sie müßten weiter rudern, vielleicht würde das Ufer allmählich flacher. Da antwortete Balto mit kläglicher Stimme: „Ja, dann muß ich elend zu Grunde gehen.“ Indessen ruderten sie, was das Zeug halten wollte, und bald darauf kamen sie an einige Steine, auf die Balto hinaufkriechen konnte, so daß es ihnen gelang, seinen Kajak zu entleeren. Auf dem Boden befand sich ein Loch, sie[S. 403] hatten aber nichts anderes zum Verstopfen desselben als einen Handschuh und ein wenig Butter; dies genügte jedoch und sie konnten ihren Weg fortsetzen.
Eine Weile später wurden sie plötzlich von einem heftigen Sturm überfallen, zum Glück befanden sie sich an einer Stelle, wo sie landen konnten. Wäre der Sturm ein wenig früher oder später gekommen, so ist es sehr zweifelhaft, wie sie davon gekommen wären, denn da war kein Zufluchtsort, und in dem Unwetter hätten sie sich wohl schwerlich auf der See halten können. An demselben Tage verunglückte ein Grönländer bei Umanak. Sie mußten nun volle 7 Stunden auf dem schmalen Felsvorsprung liegen bleiben, wo sie gelandet waren. Am Abend legte der Sturm sich ein wenig und sie kamen wohlbehalten nach Godthaab zurück, wo sie mit Jubel von den Grönländern begrüßt wurden, die es für eine gute Leistung erklärten, an dem Tage hinaus zu rudern, — sie selber hatten es nicht gewagt.
Als ich ungefähr eine Woche in Godthaab gewesen war, ohne daß sich eine Spur von dem viel besprochenen Schiff zeigte, beschloß ich, einen neuen Versuch zu machen, auf das Inlandseis zu gelangen und begab mich zu dem Zweck am 4. April mit Aperavigssuak (dem großen Abraham, einen alten, bekannten Kajakruderer aus Kangek) in meinem Kajak in den Godthaabsfjord hinein. Am selben Tage erreichten wir Kornok, das acht Meilen von Godthaab entfernt liegt, und am nächsten Morgen setzte ich in Begleitung von zwei Kajakmännern — Karl und Larserak — meine Reise über den Fjord nach Ujaragsuit fort, wo ich auf das Inlandseis zu gehen gedachte. Da das Ende des Fjordes mit Eis bedeckt war, gingen wir in die Bucht bei Kanguisak, zogen die Kajaks ans Land, schnallten die Schneeschuhe an und liefen an das Ende dieser Bucht, die gleichfalls mit Eis bedeckt war; dann begaben wir uns über[S. 404] Land nach dem Godthaabsfjord; hier angelangt, schlugen wir unser Zelt auf, das wir ebenso wie den nothwendigsten Proviant mitgenommen hatten. Unser Vorrath war jedoch lange nicht ausreichend, deswegen mußten wir Schneehühner schießen, die auf Art der Eskimos roh verzehrt wurden und die in dieser bequemen Gestalt wirklich vorzüglich schmecken, nur muß man sie, bevor man sie verzehrt, kalt werden lassen. Eines Tages, als ich sehr hungrig war, versuchte ich es, ein Schneehuhn, unmittelbar nachdem es geschossen war, zu verzehren, es hatte aber einen ganz eigenthümlichen Geschmack, und das Fleisch zitterte förmlich zwischen den Zähnen, — ich stand sofort von dem Versuch ab und habe ihn seither nicht wiederholt.

[S. 405]
Am nächsten Tage (6. April) liefen wir auf Schneeschuhen weiter über den Fjord auf den Ujaragksuikfjord zu. In der Mitte dieses Fjords angelangt, gewahrte ich indessen von einem Berge aus, den ich bei der Verfolgung einiger Schneehühner erklommen hatte, daß die ganze innere Seite des Fjords offen war, so daß wir dort unmöglich würden landen können. Der Bach, der unter dem Inlandseise hervorbricht, ergoß sich hier in den Fjord.
Um das Inlandseis zu erreichen, würde es nothwendig sein, bei Ivisartok auf der Ostseite des Fjords zu landen, aber dann würden wir mindestens zwei Tage gebrauchen, um bis an den Rand des Eises zu gelangen, und da ich es nicht für richtig hielt, mich wegen des zu erwartenden Schiffes so weit zu entfernen, so blieb mir nichts anderes übrig, als abermals umzuwenden.
Dieses Mal war die Ausbeute aber doch ein wenig ergiebiger als das letzte Mal, denn wenn ich auch das Inlandseis nicht dort erreicht hatte, wo ich es zu erreichen wünschte, so hatte ich doch den Gletscher gesehen, der sich zwischen Ivisartok und Nunatarsuak hinausschiebt. Es zeigte sich indessen, daß dieser Gletscher nicht so sehr mit Schnee bedeckt war, wie ich es erwartet hatte, und das Eis sah beinahe ebenso blau und zerklüftet aus, wie gewöhnlich. Auch ringsumher auf dem Lande war die Schneemenge auffallend klein. Auf weiten Strecken guckte das bloße Land hervor, und der Unterschied mit Godthaab war ganz auffallend. Offenbar haben die hohen Berge draußen und weiter im Süden das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.
Die Veränderung, welche mit der Oberfläche des Inlandseises im Laufe des Winters vorgegangen war, mochte daher gar nicht so groß sein, wie ich es angenommen hatte, wenigstens[S. 406] nicht dort, wo sich ein breites Außenland vor dem Eise befindet, so wie es an diesem Theil der Küste der Fall ist. Das Außenland nimmt nämlich einen großen Theil des Schnees fort. Eine andere Ausbeute bestand in der Wahrnehmung der Wassermassen, welche der Fluß aus dem Inlandseise dem Fjord selbst im Winter zuführt. Es war noch nicht so warm gewesen, daß ein Schmelzen im Außenlande stattgefunden haben konnte, nicht einmal in Godthaab. Es ist eine bekannte Sache, daß es drinnen am Inlandseise immer bedeutend kälter ist als außerhalb desselben, und welch ein Unterschied zwischen der Wärme der Oberfläche des Inlandseises und derjenigen des Außenlandes herrscht, das hatten wir bei unserer Eiswanderung gründlich erfahren. Trotz alledem aber hatte der Fluß einen starken Strom, und die Eskimos erzählten, daß selbst mitten im Winter keine Stockung eintrete. Hieraus geht deutlich hervor, daß in den tieferen Schichten des Inlandseises ein von der Temperatur der Oberfläche unabhängiges Schmelzen stattfindet. Welche große Rolle dies im inneren Haushalt der Eismassen spielen muß, werde ich im Anhang noch eingehender behandeln.
Am Abend schlugen wir ein Zelt auf einem Vorgebirge an der Mündung des Ujaragsuitfjordes auf. Da wir nun keine weitere Eile hatten, richteten wir uns so gemüthlich wie möglich ein. Es machte keine Schwierigkeit, eine genügende Grasmenge auf dem aus den Schnee hervorragenden Landrücken zu sammeln. Hiermit bedeckten wir den ganzen Zeltboden und schufen uns dadurch ein gutes trockenes Lager. Dann wurde Kaffee gekocht und die Eskimos kamen mit einem sehr wohlschmeckenden Gericht zum Vorschein, das in gefrorenem Rothfisch oder „Ur“ bestand, der roh verzehrt wurde, außerdem verzehrten wir pro Mann mindestens ein Schneehuhn und befanden uns ganz vorzüglich dabei. Wir legten uns in unseren Kleider schlafen, die Schlafsäcke[S. 407] hatte ich diesmal nicht mitgenommen, da ich die Last zu schwer fand.
Am nächsten Morgen gingen wir über den Fjord zurück. Ich hatte die größte Lust, länger in diesem Eldorado der Jäger zu verweilen, denn das gerade gegenüberliegende Ivisartok- und Nunatarsuak-Land ist wegen seiner guten Rennthierjagden berühmt, außerdem gab es hier auf dem Eise im Fjord viele Seehunde, und wenn man nur genügend Zeit dazu hat, so ist dies eine sehr interessante Jagd. Die alten Norweger wußten wohl, was sie thaten, als sie sich hier niederließen. Hier und im Ameralikfjord hat nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach der reichste Theil des alten „Vesterbygd“ gelegen, man findet überall zahlreiche Ueberreste, die darauf hinweisen, besonders ist Ujaragsuik wegen seiner großen Ruinen bekannt.
Als wir über das Land kamen, wo wir bei unserer Ankunft hinabgestiegen waren, fanden wir einen ziemlich steilen Abhang vor. Ich sollte hier die Erfahrung machen, wie mangelhaft es mit dem Schneeschuhlaufen der Grönländer bestellt ist. Sie blieben während der ganzen Zeit zurück, und schließlich mußte ich dem Einen fast seine ganze Last abnehmen, damit er nur mitkommen konnte. Als sie an diesen Abhang kamen, besannen sie sich nicht lange, sondern schnallten die Schneeschuhe ab und trugen sie. Nachdem ich unten angelangt war, hatte ich deswegen das Vergnügen, ungefähr eine Stunde auf sie zu warten, während sie sich durch den Schnee hindurchstampften. Und erst als sie das Fjordeis erreichten, wagten sie es, die Schneeschuhe wieder anzuziehen. Einer von ihnen machte allerdings bei einer kleinen Senkung einen Versuch, da er aber sofort fiel, gab er es wieder auf.
Auf dem Fjordeise schoß Karl einen Ring-Seehund (netsak), der also auch bis an die Kajaks geschleppt werden mußte. Endlich[S. 408] am Nachmittag erreichten wir diese. Wir wußten nicht, wie spät es am Tage sei, da der Himmel bedeckt war und Niemand von uns eine Uhr hatte. Ich wollte gerne noch am selben Tage nach Kornok kommen, da ich es für möglich hielt, daß die Nachricht von der Ankunft des Schiffes da sei. Obwohl besonders Larserak keine Lust dazu hatte, bestiegen wir dennoch unsere Kajaks. Wir waren indessen noch nicht weit gerudert, als es sich herausstellte, daß es bedeutend später war, als wir geglaubt hatten; es wurde nämlich vollständig dunkel. Draußen im Fjord empfing uns eine steife Westbrise, wodurch die Verhältnisse nicht gebessert wurden. So lange wir an der Küste entlang rudern konnten, ging es doch noch einigermaßen. Aber bei einem Vorgebirge Namens Kangersuak mußten wir über den Fjord, um nach Kornok zu kommen. Hier wurde es schlimmer. Der Wind und die Wellen standen hier mit voller Gewalt auf das Land und in der Finsterniß war es keine leichte Sache, die Wellen zu sehen und sich vor ihnen in acht zu nehmen.
Wir lagen still und überlegten. Die beiden Grönländer fragten mich, ob ich es mir getraue, weiter zu rudern; ich wollte mich ungern schwächer zeigen als sie und fragte, ob sie es sich getrauten. Schließlich zogen wir weiter, aber wir sollten gar bald erkennen, daß es kein Kinderspiel war, besonders für Karl, der den Seehund hinten auf dem Kajak liegen hatte, war es schwer, das Gleichgewicht zu halten. Er rief uns zu, er müsse an Land gehen, um sich seiner Last zu entledigen, aber an ein Landen war nirgends zu denken, überall bildete das Ufer eine einzige, steile Bergwand. Deswegen halfen wir ihm, seinen Seehund ins Wasser zu werfen, und er schleppte ihn nun ein Ende mit, aber es ging zu langsam, und wir mußten ihm behülflich sein, das Thier abermals auf den Kajak zu legen. Im[S. 409] Anfang war es ganz dunkel gewesen, dann aber wurde die Wolkenschicht ein wenig lichter, hin und wieder riß der Wind eine Oeffnung hinein, so daß der Mond durchkommen konnte; das war ein großer Vortheil für uns, denn jetzt konnten wir doch die herannahenden Wellen sehen und unseren Weg finden. Es war eine schwere Arbeit, gegen den Wind anzukämpfen, allmählich aber erreichten wir das gegenüberliegende Land. Hier stießen wir indessen auf eine andere Schwierigkeit, nämlich auf Unmengen von treibendem Fjordeis, das uns eine ganze Zeit lang den Weg vollständig versperrte. Erst um 1 Uhr des Nachts kamen wir nach Kornok, wo wir den Einwohnern durch unsere späte Ankunft einen großen Schrecken einjagten.
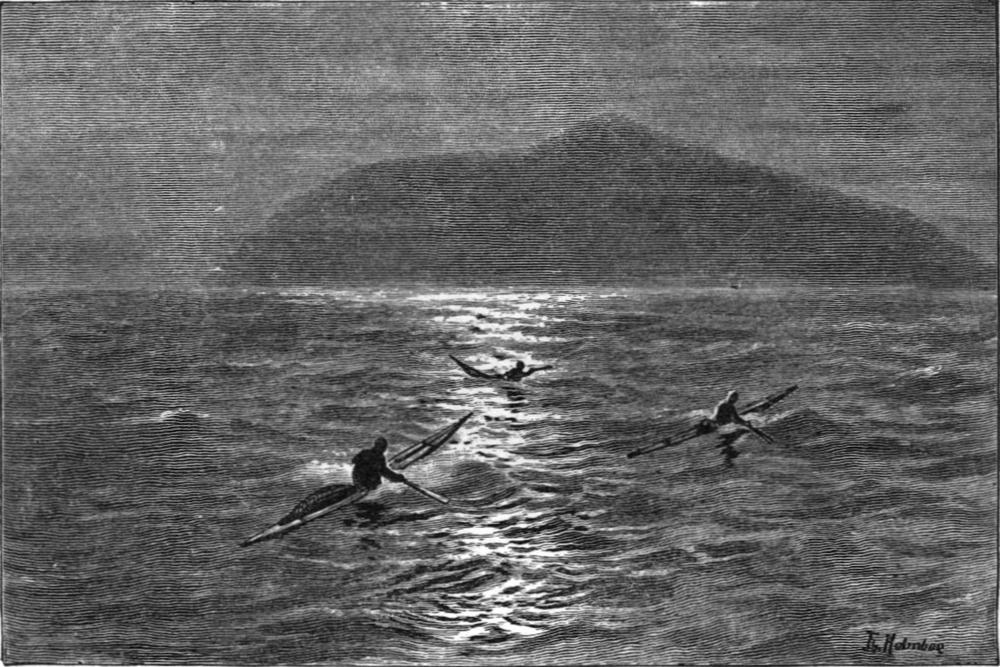

Es war keine Nachricht in Bezug auf das Schiff von Godthaab gekommen, und am folgenden Tage reiste ich deswegen nach Umanak, um diesen Ort kennen zu lernen, an dem die Herrnhuter[S. 410] Mission eine Kolonie hat, und um den Missionar Herrn Heincke zu besuchen, bei dem ich vier sehr angenehme Tage verlebte.
Am 12. April war ich wieder in Kornok. Da es am folgenden Tage regnete, hatte mein Freund Aperavigssuak keine Lust, nach Godthaab zu reisen; während ich fortgewesen war, hatte er sich die Zeit damit vertrieben, in den Häusern zu Kornok und Umanak in Gesellschaften zu gehen. In Erwiderung dieser Gastfreundschaft gab ich am Tage meiner Rückkehr sämtlichen Grönländern in Kornok einen Ball. Um 4 Uhr des Nachmittags begann der Ball, die Bewirthung bestand aus Kaffee und Schiffsbrot, und wir amüsirten uns bis tief in die Nacht hinein ganz vorzüglich. Schließlich war ich so müde, daß ich meine Gäste bitten mußte, nach Hause zu gehen, damit ich Ruhe bekam.
Am folgenden Tage, den 14. April, ruderten wir bei verhältnißmäßig gutem Wetter nach Godthaab. Wie schnell man[S. 411] in einem Kajak vorwärts kommen kann, ist daraus zu ersehen, daß wir, obwohl wir während der ersten drei Stunden die Strömung und während der letzten Stunde eine steife Briese gegen uns hatten, die 8 Meilen doch in 8 Stunden zurücklegten, und das ist nichts im Vergleich zu der Schnelligkeit, welche ein geübter Kajakruderer erlangen kann. So erzählte mir z. B. Herr Heincke, daß, als seine Frau vor mehreren Jahren im Dezember heftig erkrankte, ein Fänger aus Umanak, Namens Ludwig, am Morgen vor Tagesgrauen nach Godthaab gerudert sei, um Rath von dem Arzt zu holen. Trotz des kurzen Wintertages wäre er aber schon bei Anbruch des Abends wieder zurückgekehrt. Die Entfernung von Umanak bis Godthaab beträgt 9 Meilen!
In der Kolonie hatte man bei unserer Ankunft noch nichts von dem Schiff gehört.
Am 15. April hatten wir heftiges Schneetreiben und waren uns infolgedessen sämtlich darüber einig, daß das Schiff auch an dem Tage nicht kommen könnte. Plötzlich, als wir nach Tisch im Hause des Koloniedirektors bei unserem Kaffee saßen und uns gemüthlich mit dem Doktor unterhielten, erschallte die ganze Kolonie von einem einzigen Geheul: „Umiarsuit! Umiarsuit!“ (Das Schiff! das Schiff!) Wir stürzten hinaus, starrten auf das Meer, konnten aber nichts sehen als Schnee. Da ward auf einmal ein dunkler Schatten hoch oben in der Luft sichtbar. Es war das Takelwerk des „Hoidbjörnen“, der sich bereits dicht vor uns in der Bucht befand. In größter Eile sprang man nun in die Böte und Kajaks, und als wir den Fuß auf Deck setzten, wurde die norwegische Flagge gehißt und den Norwegern ein donnernder Salut gegeben. Die Mitglieder der Expedition wurden auf das herzlichste empfangen und beglückwünscht von dem Führer des „Hoidbjörnen“, Lieutenant[S. 412] Garde, dessen Name bereits häufiger erwähnt worden ist, sowie von den übrigen Europäern, die sich an Bord befanden.
Es wurden Grüße aus Europa gebracht und Fragen ausgetauscht, die kein Ende nehmen wollten. Wir feierten sofort ein Fest an Bord des Schiffes, es herrschte Frohsinn und Freude, und erst spät am Abend kehrten wir wieder nach Godthaab zurück.
So schlug denn endlich die Abschiedsstunde! Ich hatte lange mit Wehmuth daran gedacht, jetzt ließ sich der Gedanke nicht mehr zurückdrängen, und nicht ohne Trauer schieden wir von dem Ort und dem Volk, bei dem wir uns so unsagbar wohl befunden hatten.
An dem letzten Tage vor unserer Abreise sagte einer meiner besten grönländischen Freunde, in dessen Hause ich viel verkehrt hatte, zu mir: „Nun kehrst Du zurück in die große Welt, von der Du zu uns gekommen bist, Du triffst dort viel Neues und wirst uns vielleicht bald vergessen, wir aber können Dich niemals vergessen.“
Ein paar Tage nachher reisten wir, und das noch schneebedeckte Godthaab lächelte uns ein freundliches Lebewohl in der Frühlingssonne zu. Wir standen lange da und schauten zurück, und die Erinnerung an die vielen glücklichen Stunden, die wir dort mit Grönländern und Europäern verlebt hatten, tauchte wieder auf. Gerade als wir im Begriff waren, den Fjord zu verlassen, begegneten uns drei Kajaks, es waren die drei besten Fänger von Godthaab, Lars, Michael und Jonathan. Sie waren hierher gerudert, um uns die letzte rührende Abschiedssalve aus ihren drei Büchsen zu geben. Mit vollem Dampf ging es jetzt ins Meer hinaus. Eine Weile sahen wir unsere Freunde noch zwischen den Wellen auf und ab tauchen, dann waren auch sie unseren Blicken entschwunden.
[S. 413]
Der Bestimmung nach sollte der „Hoidbjörnen“ nördlich nach Sukkertoppen und Holstensborg gehen, ehe er den Heimweg antrat.
Am nächsten Morgen (26. April) kamen wir in Sukkertoppen an. Als Beispiel für die Postverhältnisse in Grönland mag erwähnt werden, daß man hier keine Ahnung davon hatte, daß wir den Winter in dem 20 Meilen südlicher gelegenen Godthaab zugebracht hatten.
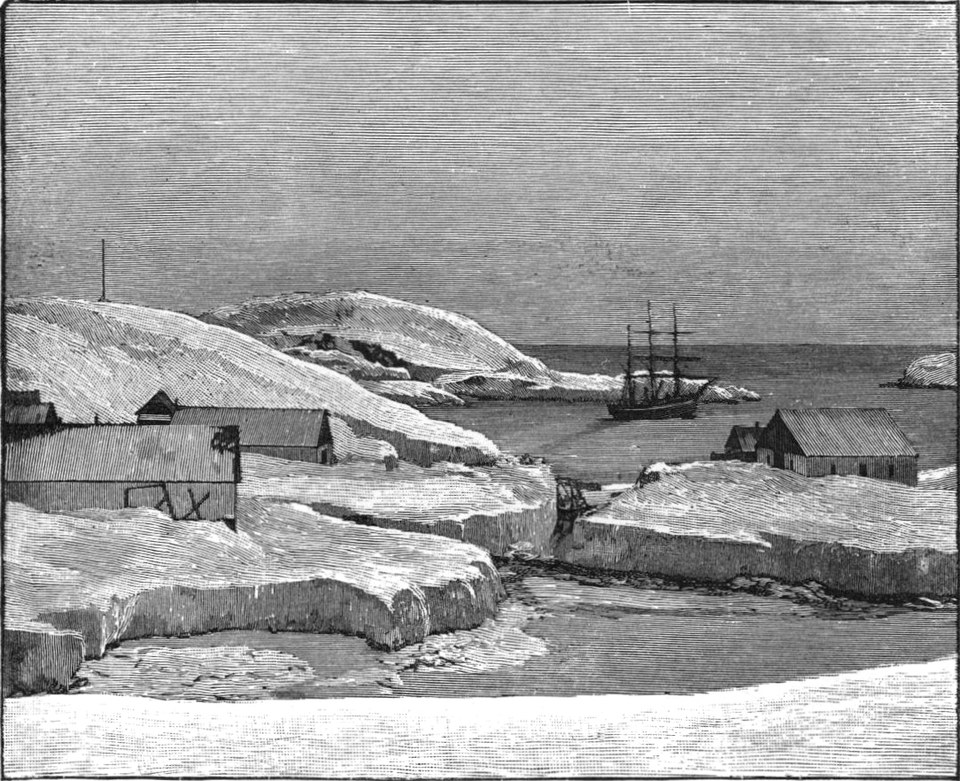
Nach einem sechstägigen Aufenthalt in Sukkertoppen mit viel Tanz und Geselligkeit lichteten wir am 3. Mai die Anker, um nordwärts nach Holstensborg zu gehen. Auf dem Wege dorthin begegneten wir dem „Nordlyset“, einer Bark, die ebenfalls der grönländischen Handelscompagnie gehört. Sie saß im Eise fest, und wir schleppten sie noch am selben Tage nach[S. 414] Sukkertoppen. Am Abend machten wir einen zweiten Versuch, nordwärts zu gelangen, trafen jetzt aber das ganze Meer nach Norden zu mit einer oft zehnzölligen Eisschicht bedeckt, durch die wir nicht vordringen konnten.
Da blieb uns denn nichts anderes übrig, als Holstensborg aufzugeben und umzuwenden. Am Morgen des 4. Mai ankerten wir zum dritten Mal im Hafen von Sukkertoppen. Am Nachmittage gingen wir in See und sagten nun Grönland zum letztenmale Lebewohl.

Als wir am Abend schon eine gute Strecke durch die Davisstraße gekommen waren, fand ich Balto in Gedanken versunken am Schiffsrande stehen, er blickte nach der Richtung des Landes hin, was jedoch schon längst unseren Blicken entschwunden war. Dietrichson fragte ihn, weshalb er betrübt sei: „Hast Du etwa Sofia vergessen?“ erwiderte er.
Wir verbrachten 17 Tage an Bord des „Hoidbjörnen“, an dem Kapitän hatten wir eine vorzügliche Gesellschaft, wohl Wenige konnten ein solches Interesse an der Expedition haben wie er. Dank der uns erwiesenen Gastfreundschaft verging die Zeit auf das angenehmste, während wir uns trotz widriger Winde und starken Seegangs der Heimath näherten; wir werden noch an diese Tage zurückdenken und uns u. a. der Vormittagsfeste erinnern,[S. 415] wo wir um den Salontisch sitzend den Champagner tranken und das Konfekt aßen, das den Mitgliedern der Expedition aus Europa gesandt worden war; das war eine andere Kost als wie sie uns das Inlandseis geboten.

Am 21. Mai ankerten wir auf der Innenrhede von Kopenhagen. Meine Feder ist zu schwach, um den gastfreien Empfang zu schildern, der uns in Etatsraths Gaméls Hause, sowie überall in Kopenhagen und in Norwegen zu theil wurde. Ich will auch keinen Versuch machen, dem Leser zu beschreiben, wie viele Toaste ausgebracht wurden und wie viele Erwiderungsreden ich halten mußte, wie viel Wein getrunken und wie viele Gerichte bei einer solchen Festlichkeit verzehrt werden mußten, auch will ich ihn nicht mit der Schilderung der Qualen beschweren, welche eine gewisse Species der Menschheit, die sich Interviewer nennt, einem armen Burschen, der sich keines Verbrechens bewußt ist, verursachen kann. Sie zertheilen förmlich unser geistiges[S. 416] Innere unter sich. Es war keine Kleinigkeit, Grönland zu durchqueren, aber es ist mein bitterer Ernst, wenn ich sage, daß es in dieser Beziehung noch weit schlimmer ist, in die Heimath zurückzukehren.
Am 30. Mai zogen wir bei dem herrlichsten Wetter in den Kristiania-Fjord ein, wo wir von Hunderten von Seglern und einer ganzen Flotte von Dampfschiffen empfangen wurden, den Tag wird wohl keiner von den Mitgliedern der Expedition jemals vergessen. Selbst auf Ravna machte es einen überwältigenden Eindruck. Als wir uns dem Hafen von Kristiania näherten, und den Festungswall und alle Brücken ganz schwarz von Menschen sahen, sagte Dietrichson zu Ravna: „Ist es nicht hübsch mit allen den Menschen, Ravna?“ „Ja, sehr hübsch, — wenn es nur alles Rennthiere wären!“ erwiderte Ravna.

[S. 417]
Wer Grönland jetzt in seinem öden Zustand mit seinen mächtigen Gletschern erblickt, wird sich schwerlich eine Vorstellung davon machen können, daß es Zeiten gegeben hat, in denen von Schnee und Eis keine Spur vorhanden war. Die Felsen geben uns indessen an verschiedenen Stellen einen nicht zu verkennenden Beweis, daß ihr Boden einstmals mit üppigen Wäldern, mit Palmen und anderen tropischen Pflanzen bedeckt war wie man sie jetzt an den Ufern Aegyptens findet.
Das Land besteht zum größten Theil aus Bergarten, welche der ältesten Bildung der Erde, dem Grundgebirge angehören. Dasselbe besteht aus Gneis, Glimmerschiefer, Hornblende u. a., außerdem aus Graniten, Syeniten und anderen nicht in Schichten getheilten Bergarten. Da diese einen ganz überwiegenden Theil des Landes bilden, das nicht mit Eis bedeckt ist, so ist es anzunehmen, daß dasselbe der Fall mit dem eisbedeckten Lande ist. Diese Felsen sind bekanntlich zu alt, um irgend welche Aufklärung über das Klima und das Pflanzenleben früherer Zeit zu geben.
Indessen kommen an einzelnen Stellen weit jüngere Bergarten vor, die zu den Kreide- und Tertiärformationen gehören, welche ihrer prachtvollen Pflanzenversteinerungen wegen berühmt sind. Da dies von bedeutenden Veränderungen in dem Klima Grönlands wie dem der Erde zeugt, so will ich die Schichten hier in aller Kürze besprechen.
Die größte Ausdehnung in dem bekannten Theil Grönlands haben die an der Westküste zwischen dem 69° 15′ N. Br. und 72° 15′ N. Br. gelegenen Sandstein- und Schieferschichten, zwischen denen sich hie und da Kohlenschichten befinden; besonders auf der Disko-Insel, wie auf den Halbinseln Nugsuak und Svartenhuk bilden sie einen großen Theil des festen Landes. Diese Bergarten sind verhältnißmäßig lose und infolge ihrer geringen Widerstandsfähigkeit würden sie dem Scheuern des Eises wohl[S. 418] nicht widerstanden haben, wenn nicht mächtige vulkanische Basaltdecken sich über sie gelegt und sie vor der allgemeinen Zerstörung geschützt hätten.
An den Küsten des Vaigatts z. B. kann man die unterste Schicht sehen, die dieser jüngeren Formation angehört und die einen Höhendurchschnitt von 600–900 m hat, darüber liegt dann der Basalt, so daß sich das Land hier bis zu einer Höhe von 1700–1800 m erhebt. In den unter dem Basalt liegenden Schiefer- und Sandsteinen, die außer Kohlenschichten auch Thon- und Thoneisensteinschichten enthalten, findet man die fossilen Pflanzen, und zwar in einer solchen Mannigfaltigkeit so wohlerhalten, und an vielen Stellen, daß Nordgrönland wohl der beste Fundort für fossile Pflanzen aus der Kreidezeit und der tertiären Zeit genannt werden kann.
Die Kohlen in Nordgrönland sind schon aus alten Zeiten bekannt gewesen. Der bekannte deutsche Geolog Gisecke, der, wie bereits früher erwähnt wurde, Grönland von 1806–1813 bereiste, wies nach, daß sich in den kohlenhaltigen Schichten fossile Pflanzen befänden. Spätere Beobachter wie Rink, Olrik, Whymper, Brown und Pfaff haben Versteinerungen aus diesen Schichten gesammelt, namentlich aber haben Nordenskjöld und K. J. V. Steenstrup zahlreiche fossile Pflanzen mitgebracht, und diese sind von dem jetzt verstorbenen Professor O. Heer untersucht worden. Heer theilt die Schichten in
Komeschichten aus unterer Kreide mit 88 Arten von Pflanzenversteinerungen,
Ataneschichten aus oberer Kreide mit 177 Arten,
Patootschichten aus der obersten Kreideperiode mit 118 Arten.
Hierzu kommen noch die tertiären Schichten mit 282 Pflanzenarten.
Von den in den Komeschichten auftretenden 88 Pflanzenarten gehören 43 zu den Farren, 10 zu den Cykadeen, 21 zu den Koniferen (Nadelhölzern), 5 zu den Monokotyledonen (Pflanzen mit einem Keimblatt) und nur 1 zu den Dikotyledonen (Pflanzen mit zwei Keimblättern).
Die Farren, die überwiegend sind, gehören zum Theil Arten an, die mit den in der gemäßigten Zone vorkommenden Farren nahe verwandt sind. Die Koniferen mit den wichtigsten Familien Sequoia und Pinus scheinen stellenweise ganze Wälder gebildet zu haben. Von Laubhölzern findet sich nur die Pappel vor.
Durch Vergleichung dieser Flora mit der jetzigen der Erde ist Heer zu dem Resultat gekommen, daß die mittlere Temperatur Nordgrönlands zu jener Zeit, als sich die Komeschichten ablagerten, zwischen +21 und +22° C. gewesen sein muß. Er zieht diesen Schluß hauptsächlich aus dem Vorhandensein der Cykadeen und mehrerer Farrenarten, auch die Nadelbäume zeugen von einem subtropischen Klima oder doch von einem Klima, wie es in dem wärmeren Theil der gemäßigten Zone herrscht.
Gehen wir höher hinauf durch die Schichtenreihen bis zu den[S. 419] Ataneschichten mit ihren 177 Arten, so finden wir, daß die Flora hier eine bedeutende Veränderung durchgemacht hat. Von den 96 Arten, die von dem Fundort am unteren Atanikerdluk stammen, gehören nicht weniger als 57 zu den Dikotyledonen. Die Laubhölzer treten jetzt in Unmengen auf — der Feigenbaum, der Lorbeerbaum und andere erstreckten zu jener Zeit ihre Zweige über den grönländischen Erdboden. Die Farren sind mehr in den Hintergrund gedrängt und treten nur mit 14 Arten bei Atanikerdluk auf, die Nadelhölzer mit 14 und die Cykadeen mit 4 Arten. Noch läßt sich keine merkliche Abnahme der Temperatur mit Sicherheit nachweisen.
Wenn wir zu den Patootschichten hinaufgelangen, so sind die Cykadeen verschwunden, die Nadelhölzer treten mit 18 Arten auf und die Dikotyledonen mit 69 Arten, so daß diese mehr als die Hälfte der Pflanzen ausmachen. Die Eichen in 7 Abarten und die Platane kommen jetzt am häufigsten vor, dann die Birke, der Erlen-, Ahorn-, der Feigen-, Wallnuß- und Lorbeerbaum. Man findet hier Pflanzenarten, die nämlich der temperirten Zone angehören, daneben aber auch tropische und subtropische Formen, so daß die Flora in diesen Schichten auf eine Temperatur schließen läßt, die sich derjenigen nähert, welche während der Bildung der Kome- und der Ataneschichten herrscht, wenngleich sie auch ein wenig abgenommen hat.
Für tertiäre Pflanzen kennt man in Nord-Grönland zwanzig Fundorte mit 282 Arten, von denen 31 zu den Kryptogamen und 251 zu den Blumenpflanzen gehören. Unter den letzteren befinden sich nach Heer von Nadelhölzern: Sumpfcypressen, Mammuthbäume, breitblätterige Ginkgo, Fichten- und Tannenarten. Und noch zahlreicher sind die Laubhölzer, es gab damals nicht allein Pappeln, Birken, Erlen, Ulmen, Platanen, Eschen, Ahornbäume, Buchen und Kastanien, sondern auch einen wunderbaren Reichthum an Eichen und Wallnußbäumen. Dazu kamen vier verschiedene Lorbeerarten, 3 Ebenholzbäume, 6 Magnolien, 1 Seifenbaum und 2 Fächerpalmen. (?) Daß es zu jenen Zeiten in den Urwäldern auch nicht an Schlingpflanzen gefehlt hat, beweisen 2 Arten von Weinranken und 1 Smilax.
Vergleicht man diesen üppigen Reichthum mit der jetzigen kümmerlichen Flora Grönlands, die keinen einzigen Baum aufzuweisen hat, da ist der Unterschied wirklich auffallend. Es ist eine Flora, die völlig von der jetzigen arktischen abweicht, und wir müssen 20–25 Breitengrade südlicher gehen, um in Europa, Nordamerika und Asien eine ähnliche Pflanzenwelt anzutreffen.
Heer hat hieraus geschlossen, daß die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Tertiärzeit ungefähr auf dem 70° in Nordgrönland nicht niedriger als +12° gewesen sein kann. Prof. Nathorst, die größte Autorität der Jetztzeit auf dem Gebiete der tertiären Pflanzen, meint indessen, daß diese Temperatur ein wenig zu hoch gegriffen ist, denn die[S. 420] Blätter, die Heer für Palmenblätter gehalten, sind ganz sicher keine solche. Hierzu kommt noch, sagt er, daß Grönlands tertiäre Flora, nicht wie Heer meint, einem einzigen Horizont angehört, sondern mehreren, und man thut am besten, wenn man die grönländische Tertiärflora, die vor der Bildung der Basaltschicht vorhanden war, von derjenigen trennt, die sich unter derselben befand. Beide Perioden haben freilich verschiedene Arten gemeinsam, aber der basaltischen Flora fehlen bereits alle die Arten, welche Heer als Beweise für ein wärmeres Klima anführt. Aber wenn auch die basaltische Flora in Grönland von einer etwas niedrigeren Temperatur zeugt als die vorbasaltische, so ist das Klima doch auch zu der Zeit ziemlich warm gewesen, so reiften doch auch z. B. noch Wallnüsse auf dem 70° 25′ N. Br.
Tertiäre Pflanzen, wie die hier erwähnten, sind z. B. noch auf Grinnell-Land unter dem 82° N. Br. zu finden und sind auch an der grönländischen Ostküste auf dem 70° N. Br. wie auf der Sabineinsel auf dem 73–1/3° N. Br. nachzuweisen. Nach dieser Ausdehnung kann man ziemlich sicher darauf schließen, daß weite Strecken des jetzt unter Eis begrabenen Landes noch in der tertiären Zeit, also in der letzten geologischen Periode vor der jetzigen mit einer reichen Flora bewachsen waren, die ein Klima mit einer Temperatur wie die vorhin erwähnte von 12° C. erfordert.
Die jährliche Durchschnittstemperatur an dem Theil der nordgrönländischen Westküste, wo die fossilen Pflanzen gefunden werden, muß jetzt auf ungefähr −9° C. angeschlagen werden, und hiernach wäre also die Temperatur Nordgrönlands seit der tertiären Zeit um 21° gefallen. Das Land hat sich in jener Periode eines Klimas erfreut, das dem jetzt in Neapel herrschenden gleicht, und noch früher, in der Kreidezeit, war die Temperatur subtropisch wie jetzt etwa in Aegypten.
Es ist übrigens eine bekannte Sache, daß nicht Grönland allein in der tertiären Zeit in klimatischer Beziehung so begünstigt war. Sowohl Spitzbergen als Island haben ähnliche Fundstätten für tertiäre Pflanzen aufzuweisen, und diese sind zum Theil ganz analog mit denen Grönlands.
Interessant ist es allerdings, daß die tertiäre Flora an den verschiedenen Orten nicht auf das völlig gleiche Klima schließen läßt. So kann z. B. angeführt werden, daß Heer zu dem Resultat gelangt ist, daß Spitzbergen auf dem 78° N. Br. eine Temperatur von +9° C. hatte zu einer Zeit, wo die Durchschnittstemperatur an der Westküste Nordgrönlands (ungefähr beim 70° N. Br.) +12° C. betrug, und Grinnell-Land auf dem 81° 44′, wo zu jenen Zeiten noch Sumpfcypressen wuchsen, sollte damals eine Temperatur von +8° C. gehabt haben.
Einen krassen Gegensatz zu der Ueppigkeit jener Zeiten bildet Grönlands Gegenwart mit seiner mächtigen Eisdecke, seinem schmalen Landstreifen an den Küsten entlang und seiner kümmerlichen Flora. Man kennt aus Nordgrönland 260 jetzt vorkommende, dagegen aber 600 fossile[S. 421] Pflanzen, und die uns erhaltenen sind doch wohl nur ein kleiner Bruchtheil der damaligen Flora. Nicht eine einzige Art hat sich nach Heer von der tertiären Zeit bis jetzt erhalten, und auch die meisten Gattungen sind andere. Es scheint also, als wenn kein direkter Zusammenhang zwischen der damaligen grönländischen Flora und der jetzigen existirt, daß ein Zeitraum zwischen der Ausrottung der ursprünglichen und der neu eingewanderten liegen muß. Wie dies vor sich gegangen ist, werden wir bald sehen.
Eben so sicher wie wir uns darüber sind, daß es einstmals wärmer in Grönland gewesen ist als jetzt, ebenso bestimmt können wir auch behaupten, daß es seit jener Zeit ein oder mehrere Perioden gegeben hat, in denen das Klima kälter gewesen ist als das jetzige.
Wenn wir nämlich die Form der Felsen, die Seiten der Fjorde und den Bau der losen Erdschichten in dem äußeren Küstenlande studiren, so werden wir bald einsehen, daß auch dies alles einstmals mit Eis bedeckt gewesen ist, das sich vorwärts bewegte, die Felsen abrundete und seine Spuren selbst ganz weit hinaus an den am Meeresrande belegenen Insel hinterließ. In jener Zeit ragte auf weiten Strecken auch nicht ein einziger Stein über die Schnee- und Eisdecke empor, und selbst die höchsten Berggipfel waren sicher nur an einzelnen Stellen sichtbar.
Daß die üppige Flora jener warmen Zeit vor dem vorwärtsrückenden Eise fliehen und einer arktischen Flora das Feld räumen mußte, liegt auf der Hand, und die letzten Ueberreste mußten bereits ganz untergegangen sein, ehe das Eis seine größte Ausdehnung erreichte.
Dann aber ist eine Periode eingetreten, in der die Gletscher anfingen zurückzuweichen und das äußere Küstenland frei blieb, auf das dann eine neue Flora aus den südlicheren Ländern einwanderte, möglicherweise haben sich auch auf den Nunataks einzelne von den Pflanzen von früherher erhalten können, die sich dann, sobald mehr Land eisfrei wurde, ausbreiteten. So kann man sich die Entstehung der jetzigen Ordnung der Dinge denken.
Es giebt indessen, wie bereits früher erwähnt, auch an anderen Stellen der Erde große Landstrecken, die einst mit einem ähnlichen Inlandseis bedeckt waren. Als der wesentlichste dieser Striche kann das ganze nördliche Amerika bis zu dem 40° und zum Theil noch weiter südlich gelten, ebenso das nördliche Europa, wo das Inlandseis Skandinavien vollständig bedeckte und sich von dort über einen großen Theil von Rußland, über das ganze nördliche Deutschland bis ungefähr zum 50° N. Br. sowie über England mit Ausnahme des südlichen Theils verbreitete. Ferner waren gleichzeitig große Theile der Alpen und der ringsumherliegenden Flachländer mit Eis bedeckt. Von andern Ländern, die ihr Inlandseis gehabt haben, mögen noch die Faröer, Island, Patagonien und Neu-Seeland erwähnt werden.
Es kann wunderbar erscheinen, daß die verschiedenen Länderstriche[S. 422] eine so große Temperaturveränderung durchgemacht haben, noch wunderbarer ist es, daß man in verschiedenen der hier genannten Länder zwei verschiedene Eisperioden mit einem dazwischenliegenden wärmeren Zeitraum hat nachweisen können, in welchem z. B. Löwen, Nashörner und Flußpferde die Wälder Südenglands durchstreift haben sollen.
Es giebt sogar Geologen, welche fest überzeugt sind, daß sie noch die Spuren weit früherer Eisperioden auf der Erde nachweisen können, und einzelne dieser Spuren scheinen ganz untrüglich zu sein, so verdienen diejenigen der Erwähnung, die auf eine Eiszeit während der Kohlenperiode hindeuten.[97]
Alles spricht dafür, daß merkwürdige Veränderungen und Wechsel in Bezug auf das Klima in verschiedenen Gegenden unserer Erde vor sich gegangen sind und wahrscheinlich auch in Zukunft noch stattfinden werden.
Um eine Erklärung hierfür zu finden, sind viele und verschiedene Theorien aufgestellt worden, aber kaum eine davon ist wirklich überzeugend, weswegen es sich bei dem beschränkten Raum nicht verlohnt, hier weiter darauf einzugehen.
Um aber einen Begriff davon zu geben, auf was für verschiedenen Gebieten man seine Gründe gesucht hat, will ich einige der bekanntesten Theorien erwähnen, besonders diejenigen, welche zu erklären suchen, weshalb die Eisperioden eintreten und wie man sich die Entstehung des Inlandseises denkt.
Es würde das Natürlichste und Vernünftigste sein, wenn man, indem man die Verhältnisse und Kräfte gruppirt, die jetzt auf der Erde in Wirksamkeit sind, auf andere Weise die nothwendigen Bedingungen hervorbringen könnte. Es sind auch verschiedene, bisher freilich vergebliche Versuche in dieser Richtung gemacht worden.
Man hat gemeint, daß eine andere Vertheilung von Land und Wasser auf der nördlichen Halbkugel Eisperioden hervorbringen könnte. Man hat die Sahara oder auch Rußland, Finnland und große Theile von Deutschland unter Wasser gesetzt und damit die Bedingungen für eine europäische Eisperiode erfüllt zu haben geglaubt. Durch die Landenge von Panama und Mittel-Amerika grub man einen gewaltigen Kanal und leitete durch denselben den Golfstrom in den Stillen Ocean, in der Meinung, dadurch[S. 423] die Bedingungen für eine Eisperiode in Amerika zu erfüllen. Mit anderen Worten, man nahm an, daß eine größere Ausdehnung des Wassers und eine Beschränkung des Landes genügen würde, um auf gewissen Theilen der nördlichen Halbkugel eine Eisperiode hervorzubringen. In diesem Falle müßte indessen die südliche Halbkugel augenblicklich günstigere Bedingungen bieten, das Klima ist dort ja auch freilich kälter als auf der nördlichen, aber weder in Patagonien noch auf Neuseeland hat man Eisperioden, obwohl solche dort einmal gewesen sind. In der Nähe des Poles auf dem antarktischen Kontinent scheint sich allerdings ein Inlandseis zu befinden, dasselbe erreicht aber keine niedrigeren Breitengrade als den südlichen Polarkreis, während wir es doppelt so weit von dem Pol oder bis auf den 40° Südl. Br. verlegen müßten, um eine der Ausdehnung des amerikanischen Inlandseises entsprechende Fläche zu haben. Hiergegen könnte freilich der Einwand erhoben werden, daß das antarktische Inlandseis sich möglicherweise weiter nach Norden hin ausbreiten würde, wenn nur das Land, worauf es ruht, vergrößert würde. Aber selbst wenn dieser Fall eintrete, würde eine solche Ausdehnung, wie oben angedeutet, kaum denkbar sein, da die jährliche Durchschnittstemperatur in dem südlichen Himmelsstrichen nicht niedriger zu sein scheint als in den entsprechenden nördlichen.
Andere haben den ganz entgegengesetzten Weg eingeschlagen und gemeint, daß man, indem man eine Ausdehnung des Landes auf der nördlichen Halbkugel vornehme — indem man durch eine Landbrücke Europa mit den Faröern und Island, ja sogar mit Grönland verbände und den Golfstrom in seinem Laufe hemmte — die Bedingungen für eine Eisperiode zu schaffen vermöge. Aber selbst wenn dies in Bezug auf Europa möglich wäre, was keineswegs der Fall ist, so läßt sich dadurch doch immer die amerikanische Eisperiode nicht erklären. Außerdem darf man nicht außer acht lassen, daß für eine Bildung von Inlandeis starke Niederschläge oder eine große Feuchtigkeit in der Luft erforderlich sind, welches beides vom Meere herkommen muß, weshalb man sich hüten sollte, allzuviel Land in die arktischen Gewässer hinauf zu legen, da dies auf die Dauer keinen fördernden Einfluß auf die Gletscherbildung haben kann.
Einige haben gemeint, daß es früher Zeiten gegeben hat, in denen die Erdatmosphäre viel feuchter war als jetzt, und daß dies hinreichend gewesen ist, um Eisperioden zu bilden; auf der einen Seite sind aber keine positiven Gründe nachgewiesen worden, die eine so allgemeine Zunahme der Feuchtigkeit verursachen könnten, und auf der anderen Seite müßte in diesem Falle diese Feuchtigkeit als Schnee herabfallen. So lange die Erde die gleiche eigene Wärme gehabt und die gleiche Sonnenwärme wie jetzt empfangen hat, scheint sich dies indessen schwer erklären zu lassen.
Endlich giebt es Leute, welche meinen, daß die mit Eis bedeckten Länder vor der Eiszeit bedeutend höher gelegen haben als jetzt, wodurch[S. 424] die Bedingungen zur Ansammlung von Gletschern günstiger gewesen sind. Man hat auch an einzelnen Stellen Senkungen nach der präglacialen Zeit nachweisen zu können vermeint und geglaubt, daß diese möglicherweise auf die Eisschicht selber zurückzuführen seien, indem diese im Wachsen mit ihrem Gewicht die Unterlage herabdrückte. Aber auch dies ist kaum ein befriedigender Grund, denn für die Bildung eines so mächtigen und südlich gelegenen Inlandseises wie das amerikanische und das europäische, ist eine nicht geringe Hebung des ganzen nördlichen Theils dieser Kontinente erforderlich, und eine solche ist keineswegs nachgewiesen. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, müßte man mindestens zwei Hebungen und zwei Senkungen voraussetzen, um die beiden mit Bestimmtheit bekannten Eisperioden erklären zu können. Und ehe eine solche Erklärung anerkannt werden könnte, müßte die Ursache zu so großen Niveau-Veränderungen oder das wirkliche Stattfinden derselben erst nachgewiesen werden.
Wenn sich nun also durch diese verschiedenen Theorien die Eisperioden wirklich erklären ließen, so haben wir dadurch immer noch keine Erklärung für die wärmeren Klimate, die, wie oben nachgewiesen wurde, u. a. einmal in Grönland geherrscht haben müssen. Mit Zuhülfenahme aller günstigen Bedingungen, die aufgebracht werden können, ist und bleibt es unter den jetzigen Verhältnissen doch unmöglich, üppige Wälder auf Grinnell-Land (unter dem 82° Nördl. Br.) hervorzubringen, oder Palmen in dem eisbedeckten Boden Grönlands und Spitzbergens keimen zu lassen. Hierzu müssen andere Bedingungen, als wir sie jetzt kennen, vorhanden gewesen sein.
Das Naheliegendste — falls man annimmt, daß die Erde einst glühend gewesen ist — muß ja die Annahme sein, daß die Erde seit jener glühenden Periode infolge der Wärmeausstrahlung in steter Abkühlung begriffen war, und daß diese warmen Klimate der nördlichen Zonen in eine Zeit gefallen sind, wo die Erdkruste so viel wärmer war, wie jene Klimate vermuthlich wärmer gewesen sind als das jetzige; das würde also — für Nordgrönland — einen Unterschied von 20–30° C. ausmachen. Dies könnte möglicherweise das warme Klima jener Zeiten erklären, falls man annehmen könnte, daß eine so reiche Vegetation, wie sie zu jener Zeit z. B. auf Grinnell-Land stattgefunden hat, unter den dortigen Lichtverhältnissen mit den monatelangen Winternächten und den ebenso langen Sommertagen gedeihen könnte. Bedenkt man indessen, daß zwischen diesen warmen Klimaten wahrscheinlich Eisperioden stattgefunden haben, so verliert diese Annahme jeglichen Halt, und selbst abgesehen hiervon ist sie garnicht danach angethan, eine Erklärung dafür zu geben, weshalb jedenfalls nach jener letzten warmen Zeit Eisperioden mit einem älteren Klima wie das jetzige eingetreten sind.
Eine andere Betrachtungsweise muß uns indessen auch gar bald die völlige Unhaltbarkeit dieser Theorie beweisen. Sollte nämlich die Temperatur[S. 425] der Erdkruste in einem so kurzen Zeitraum wie von der Tertiärperiode bis jetzt 21° C. gesunken sein, so brauchen wir wahrlich nicht sehr lange in die geologische Zeit zurückzugreifen, ehe wir auf eine Temperatur stoßen, die jegliches organische Leben unmöglich macht. Gehen wir z. B. doppelt so lange zurück, so erhalten wir schon eine wenigstens 42° höhere Temperatur, gehen wir den vierdoppelten Zeitraum zurück, so steigt die Hitze auf 84° C., und damit wäre die Grenze für das jetzige organische Leben bereits erreicht, während der Zeitraum, den man damit erreicht hätte, z. B. im Verhältniß zu dem ungeheuren Alter der Silurformationen, nur ein sehr geringer ist. Indessen herrschte bereits damals ein bedeutendes organisches Leben, was darauf schließen läßt, daß die Abnahme der Wärme infolge von Ausstrahlung nach jener Zeit nicht sehr beträchtlich gewesen sein kann.
Am leichtesten würde es sein, die Eiszeit, ebenso wie die wärmeren Klimate der verschiedenen Himmelsstriche zu erklären, wenn man nur ein wenig an der geographischen Lage der Erdachse rütteln könnte. Könnte man z. B. den Nordpol zwischen den 60° und 65° auf Grönlands Westküste oder in die Nähe davon versetzen, so könnte man sehr leicht eine Eisperiode in Europa wie in Amerika hervorbringen. Der Umstand, daß bisher weder im östlichen Rußland noch in ganz Nordasien[98] eine Eisperiode hat nachgewiesen werden können, scheint diese Annahme zu stützen. Auch in Alaska scheinen die Beweise für eine Eisperiode zweifelhaft zu sein. Hiernach hat sich die Eisperiode scheinbar strichweise mit dem angegebenen Punkt als Centrum verbreitet. Man hat auch die Ursachen zu einer etwaigen Verschiebung der Erdachse nachweisen zu können geglaubt. Als solche hat man z. B. die Veränderung und Versetzung der Stoffe theils durch Flüsse, theils durch Gletscher und dergleichen angeführt. Es ist ganz sicher, daß solche Umwälzungen ebenso wie große Ansammlungen von Eis den Schwerpunkt verrücken und dadurch die Achse ein wenig verschieben können, aber man hat doch nicht die Möglichkeit so gewaltsamer Umwälzungen oder Veränderungen nachweisen können, die erforderlich wären, um die Erdachse 20–30° zu verschieben.
Daß sie wirklich verschoben werden kann, scheint daraus hervorzugehen, daß die Beobachtungen auf mehreren deutschen Observatorien (Berlin, Potsdam, Prag und Straßburg) auf merkwürdige Weise darin[S. 426] übereinstimmen, eine Pol-Verschiebung von mehr als einer halben Sekunde im Laufe eines halben Jahres zu konstatiren;[99] außerdem scheinen zuverlässige Observationen, die in Greenwich, Washington, Mailand, Neapel, Pulkova und an anderen Orten gemacht sind, ebenfalls auf eine Veränderung der Polarhöhe[100] hinzudeuten. Sollte es sich wirklich so verhalten, daß sich der Pol z. B. ungefähr eine Sekunde im Laufe eines Jahres bewegen kann, da bedarf es, von geologischem Standpunkt gesehen, keines langen Zeitraums, um die Lage des Pols bedeutende Strecken zu verändern, — im Laufe von 3600 Jahren kann er sich einen ganzen Grad bewegen, und zu den 20–30 Graden nach der Eisperiode bedurfte es nicht mehr als 72000–108000 Jahre.
Wie es sich auch mit diesen Observationen einer Veränderung der Polhöhe verhalten mag, so steht jedenfalls die Thatsache fest, daß die Astronomen eine solche Möglichkeit nicht ableugnen können.
Wir können auch auf ein anderes Verhältniß hinweisen, dessen Ursache wir ebensowenig kennen, über dessen Vorgang wir jedoch keinen Augenblick im Zweifel sind, nämlich auf die Wanderungen des magnetischen Pols. Es muß wohl als wahrscheinlich angesehen werden, daß diese ihren Ursprung irgend welchen Veränderungen in der Erde selbst verdanken, welcher Art diese Veränderungen aber sind, haben wir bisher nicht erforschen können. Dies alles bildet eine große Lücke in unserem Wissen, aber a priori kann man kaum sagen, daß das Eine unwahrscheinlicher ist als das Andere.
Das Schwierige bei dieser Theorie ist indessen außer dem Mangel an genügenden Gründen für die Bewegung der Achse auch der Umstand, daß viele solche Veränderungen stattgefunden haben müssen. Um eine hinreichende Erklärung für die warmen Klimate auf Grönland, Spitzbergen und Nowaja Semlja zu geben, muß der Nordpol fast ganz nach der Beringsstraße oder nach einem noch südlicheren Ort verlegt werden. Hier geräth man jedoch in Zwiespalt mit der tertiären Flora in Alaska und an anderen Orten. Daß er in der Tertiärperiode 20° weiter nach der Küste von Sibirien zu oder ungefähr auf dem 70° Nördl. Br. und dem 120° Oestl. L. gelegen haben soll, meint Professor Nathorst daraus erkennen zu können, das Japans tertiäre Flora auf ein bedeutend kälteres Klima schließen läßt, als wie es ungefähr um dieselbe Zeit z. B. in Grönland[S. 427] geherrscht hat. Was außerdem dafür sprechen könnte, ist der Umstand daß u. a. auch Spitzbergen und Grinnell-Land damals ein kälteres Klima gehabt haben, als die nordgrönländische Westküste. Das Einzige, was nach Professor Nathorsts Ansicht gegen eine solche Lage des Poles in der Tertiärzeit sprechen könnte, sind die letzten auf den neusibirischen Inseln gemachten Funde, die aus tertiären Pflanzenversteinerungen bestehen, die möglicherweise auf ein wärmeres Klima schließen lassen, als es sich in der Nähe des Poles denken läßt. Diese Versteinerungen sind indessen so schlecht erhalten, und die ganze Sache ist so wenig untersucht worden, daß sich augenblicklich mit Sicherheit nicht viel darüber sagen läßt.
Es läßt sich bei einer solchen Lage des Poles auch nicht recht erklären, daß man die Fundstätten für tertiäre Pflanzenversteinerungen an der Lena bei Tsjirimyi-Kaja[101] auf dem 85° Nördl. Br., auf Kamschatka auf dem 68–69° Nördl. Br., auf Sachalin auf dem 67°, auf Spitzbergen zwischen dem 64° und 65° Nördl. Br. etc. haben würde.
Man ersieht hieraus also, daß die tertiäre Flora die Fähigkeit besessen haben muß, sich weit höher nach dem Pol hinauf zu verbreiten, als es die entsprechenden Pflanzen unter unseren jetzigen klimatischen Verhältnissen zu thun vermögen. Daß sich aber die Pflanzen im Laufe der Zeit so entwickelt haben sollten, daß sie jetzt in geringerem Maße als früher ein arktisches Klima und die nördlichen Lichtverhältnisse zu ertragen vermögen, widerstreitet allen biologischen Gesetzen; infolge dieser Gesetze muß man im Gegentheil annehmen, daß sie mehr und mehr die Fähigkeit erlangen sollten, sich über die Erde zu verbreiten. Wir werden hierdurch zu der Annahme gezwungen, daß auf der ganzen Erde eine wärmere Temperatur geherrscht haben muß, und erhalten keine Erklärung dafür.
Es will mir indessen durchaus nicht als bewiesen erscheinen, daß die tertiären Schichten sich an allen Orten der Erde gleichzeitig abgelagert haben. Das häufige Auftreten einzelner Pflanzen und Thierarten hat wahrscheinlich Veranlassung dazu gegeben; weshalb diese aber gleichzeitig an verschiedenen Orten aufgetreten sein sollen, läßt sich schwerlich nachweisen. Wenn man bedenkt, wie lange sich verschiedene Thierarten oder doch jedenfalls Thierfamilien, während verschiedener geologischer Perioden gehalten haben, wie z. B. einzelne Fische (Ceratodus) sich seit der fernen Kohlenzeit bis zur Gegenwart gehalten haben, wenn auch nicht in derselben Art, wie Viele gemeint haben, so doch jedenfalls in derselben Familie, oder die einzelne Brachiopoden (die Familie terebratula) sich von der allerältesten Versteinerungsschicht bis auf den heutigen Tag gehalten haben, — da kann man sehr wohl zu der Annahme gelangen, daß eine ausgeprägte Fauna ihren Charakter einigermaßen während einer langen Periode aufrecht[S. 428] zu erhalten vermag. Daß die Tertiärzeit wirklich sehr lang gewesen ist, und daß es innerhalb derselben große Zeitabschnitte giebt, scheint ja außerdem nachgewiesen zu sein.
Meiner Ansicht nach spricht nichts dagegen, daß die Erdachse, falls sie sich überhaupt auf größere Verschiebungen eingelassen hat, genügend Zeit hatte um mehrere solche in dem Rahmen der Tertiärperiode vorzunehmen. Die Schichten auf den neusibirischen Inseln, welche tertiäre Versteinerungen enthalten, können in diesem Falle während einer Stellung der Erdachse abgelagert sein, während ähnliche Schichten in Japan und an andern Orten während anderer Achsenstellungen abgelagert wurden.
Es ist einleuchtend, daß die Flora, besonders aber die Fauna sich leicht nach anderen Orten und unter andere Himmelsstriche begeben haben kann, je nachdem der Pol seine Lage wechselte und das Klima sich veränderte; und sie würden infolgedessen den Schichten, die sich an Orten ablagerten, wohin sie jetzt gekommen waren, denselben Charakter verleihen, den sie den an andern Orten früher abgelagerten Schichten verliehen hatten.
Aber selbst wenn man die Möglichkeit einräumt, daß der Pol während der Tertiärperiode verschiedene Lagen gehabt hat, so muß er sich in einer verhältnißmäßig späten Zeit zweimal ganz nach Grönland hinüberbewegt und zweimal wieder zurückbewegt haben, um die bekannten Eisperioden erklären zu können. Das werden ziemlich weitläufige Bewegungen, und befriedigende Ursachen dazu kann man wie bereits erwähnt, nicht nachweisen.
Man hat es deswegen versucht, die Ursachen zu den klimatischen Veränderungen außerhalb der Erde zu suchen. Als das Zunächstliegende hat man an die Möglichkeit gedacht, daß die Ausstrahlung unserer Wärmequelle, der Sonne, Wechseln unterworfen ist oder mit anderen Worten, daß die Sonne ein veränderlicher Stern ist. Einige Gelehrte sind der Ansicht, daß die Wärme der Sonne durch ein ständiges Bombardement von Meteoren aufrecht erhalten wird, das durch seine Geschwindigkeit und die dadurch hervorgebrachte Reibung Wärme erzeugt. Ist dies der Fall, so könnte man wohl annehmen, daß es Zeiten mit größerem und kleinerem Bombardement gäbe, wie wir ja auch bestimmte Zeiträume mit größerem Sternenfall haben, je nachdem wir die verschiedenen Kometenbahnen passiren. Dergleichen Behauptungen sind indessen zu unbegründet, um sich darauf stützen zu können.
Infolge der Kant-Laplaceschen Theorie müssen wir annehmen, daß die Wärmeausstrahlung der Sonne in stetem Sinken begriffen ist, je nachdem sie mehr und mehr erkaltet. Dies ist indessen ebensowenig wie der eigene Wärmeverlust durch Ausstrahlung (siehe oben) geeignet, die vorliegenden Thatsachen zu erklären.
Andere sind der Ansicht, daß die kälteren und wärmeren Klimate ihren Grund darin haben, daß der Raum oder das Universum, durch das[S. 429] unser ganzes Sonnensystem sich bewegt, einen kälteren oder wärmeren Strich hat. Hierauf können wir nur antworten, daß wir, wenn dies auch sehr unwahrscheinlich ist, doch die Unmöglichkeit nicht beweisen können, es ist aber nichts nachgewiesen, was diese Annahme stützen könnte, folglich bleibt sie einstweilen nur ein unterhaltendes Gedankenexperiment.
Die Crollsche Theorie, welche annimmt, daß die Wechsel in der Excentrizität der Erdbahn die Ursache zu den klimatischen Wechseln sein sollen, hat die meisten Anhänger gefunden. Die Erdbahn ist bekanntlich zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger elliptisch, und nun ist Croll der Ansicht, daß dies erstens für das Klima jeder Halbkugel von großer Bedeutung ist, mag der Winter derselben auf den Theil der Erdbahn fallen, welcher der Sonne zunächst liegt (Perihelion) oder auf den, der ihr am fernsten liegt (Aphelion). In dem letzteren Falle würde nämlich der Winter mit der jetzigen Erdbahn sieben Tage länger werden als der Sommer. Die Wärme der Sonnenstrahlen in dieser Jahreszeit wird infolge des Abstandes vermindert, dies aber wird völlig dadurch aufgewogen, daß die Sonnenstrahlen im Sommer um so viel wärmer sind; dagegen wird der kürzere Sommer kaum die Wärme aufwiegen, welche die Erdoberfläche in den langen Winternächten durch den sieben Tage längeren Winter ausstrahlt. Deswegen würde eine solche Periode bessere Bedingungen für Gletscherbildung gewähren als eine andere; dies ist augenblicklich der Fall mit der südlichen Halbkugel, weshalb deren Temperatur jetzt niedriger ist als die der nördlichen.
Fällt indessen eine solche Periode mit verlängertem Winter mit einer Zeit zusammen, in der die Erdbahn ihre höchste Excentrizität oder die am längsten gestreckte Ellipsenform erreicht hat, so wird der Unterschied zwischen Winter und Sommer derartig erhöht werden, daß der Winter auf der einen Halbkugel 36 Tage oder mehr als einen Monat länger wird als der Sommer, und da, meint nun Croll, müssen alle Bedingungen für das Eintreten einer ausgeprägten Eiszeit vorhanden sein.
Er hat ausgerechnet, daß hiernach die günstigsten Bedingungen für die Bildung von großen Inlandseisen vor 200000 Jahren vorhanden gewesen sein müssen, ferner ist dies der Fall gewesen vor 750000, 850000, 2500000 und 2600000 Jahren. In Zukunft werden solche Eisperioden in 500000, 800000 und 900000 Jahren eintreten. Falls diese Theorie haltbar wäre, ließe sich also auf diese Weise eine Art Haltepunkt für eine geologische Zeitrechnung gewinnen, indem wir von den verschiedenen bekannten Eisperioden ausgehen würden.
Bei dieser Theorie ist jedoch auch der Fehler, daß sie, wenngleich sie auch die eine Art von Klimawechseln erklären könnte, doch für die andere Art keine Erklärung zu geben vermag. Wenn man sich hiernach auch denken kann, daß wir auf diese Weise zu bestimmten Zeiten Eisperioden haben können, so können doch auf diesem Wege nicht genügend günstige[S. 430] Verhältnisse hervorgebracht werden, um ein subtropisches Klima zu erklären, wie es doch einmal z. B. auf Grönland geherrscht hat.
Wir sehen hieraus, daß wir, von welcher Seite wir auch die bekannten Thatsachen betrachten mögen, dennoch nicht im stande sind, einen befriedigenden Grund für sie alle zu finden. Wir müssen das der Zukunft anheimstellen und uns vorläufig mit dem Bewußtsein begnügen, daß es einstmals so gewesen ist, und daß wir doch auch jetzt noch ein Inlandseis besitzen, das sich ganz bis an den 60° N. Br. herab erstreckt bis an denselben Breitengrad, unter dem Kristiania liegt und zwar, obgleich unsere Halbkugel gerade augenblicklich sehr ungünstig für eine Gletscherbildung gestellt ist.
Dies Inlandseis ist auch hinreichend groß genug, um mit guter Ausbeute die verschiedenen mit den Eisperioden verbundenen Verhältnisse studiren zu können, und eine Wanderung durch Grönland bietet daher, wie Nordenskjöld sagt, ein ebenso großes Interesse für den Geologen, wie es die Durchwanderung einer wohlerhaltenen Stadt aus der Pfahlbautenzeit für den Alterthumsforscher bieten würde.
Das nähere Eingehen auf die wissenschaftliche Ausbeute, welche diese Expedition gebracht hat, würde außerhalb des Rahmens dieses Buches liegen, deswegen werden wir anderweitig darauf zurückkommen. Ich will hier nur einige Beobachtungen anführen, denen ich die größte Bedeutung beilegen zu können glaube.
Durch unsere Expedition ist also endlich unumstößlich nachgewiesen worden, daß sich das Inlandseis, jedenfalls in dem von uns bereisten Theil Grönlands als zusammenhängende Decke über das Land, von einer Küste bis zur andern, erstreckt. Hieraus muß man schließen können, daß dasselbe der Fall mit dem ganzen südlichen Theil von Grönland unterhalb des 75. Breitengrades ist; denn es ist kein Grund vorhanden, etwas anderes anzunehmen, als daß hier durchgehends überall im Innern dieselben atmosphärischen Verhältnisse herrschen, und soweit die Untersuchungen reichen, scheint sich dies auch zu bestätigen. Wir können jetzt also mit großer Sicherheit sagen, daß sich keine schneefreie Oasen innerhalb dieser ganzen ausgedehnten Schneefläche befinden, wenn auch die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen ist, daß auch in dem Innern ganz vereinzelte Felsgipfel über die Schneedecke hervorragen, obwohl bisher in Grönland nichts beobachtet worden ist, was darauf schließen ließe. Die letzten Nunataks, die wir in der Nähe der Ostküste fanden, lagen nicht mehr als 52 km vom Rande des Inlandseises entfernt und können ebensogut als Küstenfelsen betrachtet werden.
[S. 431]
Die Raben, welche Nordenskjölds Lappen auf ihrer Schneeschuhfahrt ungefähr 120 Kilometer von den Küstenfelsen entfernt erblicken, und die dieser für einen möglichen Beweis hält, daß sich im Norden Oasen befinden müssen, woher sie gekommen sind, können in der Beziehung kaum einen weiteren Werth haben, wenn man bedenkt, daß wir ungefähr in derselben Entfernung von der Küste auf Schneesperlinge stießen, die wohl kaum von Oasen hergekommen sind und die doch weit weniger umherzustreifen pflegen als Raben.
Wie weit sich das grönländische Inlandseis als zusammenhängende Decke bis nach Norden erstreckt, ist bei unserer jetzigen Kenntniß des Landes nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Nur so viel wissen wir, daß es bis nördlich vom 75. Breitengrad reicht, denn, an der ganzen Westküste entlang nach Norden zu schieben sich mächtige Wandergletscher ins Meer hinaus, von denen wir den Upernivik (auf ca. 73° N. Br.) anführen wollen, der sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 99 Fuß in 24 Stunden bewegt. Diese Wandergletscher erheischen eine mächtige zusammenhängende Eisdecke im dem Innern des Landes, von der sie die großen Eismassen holen, die sie mit sich führen. Es muß ja nämlich jetzt einem Jedem, der die neueren Untersuchungen über die Gletscher verfolgt hat, klar sein, daß die Wandergletscher ihr Material aus den inneren Gletschermassen, dem inneren Schnee- und Eisreservoir beziehen und daß die Ausdehnung dieser Eismassen im wesentlichen ihre Größe und Schnelligkeit bedingt, nicht aber die schräge Lage, wie man es merkwürdigerweise oft behauptet sieht, besonders von Geologen, die nur die kleinen Gletschermassen der Alpen gesehen haben. Es ist im Gegentheil gewöhnlich so, daß die kleineren Wandergletscher stärker nach innen zu ansteigen als die größeren, und wenn man sieht, daß ein Wandergletscher eine sehr große Senkung hat, so kann man mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß er verhältnißmäßig unbedeutend ist.
Wir kennen nichts oder nur wenig von dem Rand des Inlandseises von Grönlands Ostküste nördlich vom 66. Breitengrade, wir wissen nur, daß er an vielen Stellen das Meer erreichen muß, weil sich Eisberge bilden. Hieraus wie aus dem, was oben von der Westküste gesagt worden ist, müssen wir schließen, daß das Inlandseis eine zusammenhängende Decke über ganz Grönland südlich von 75° N. Br. bildet.
Daß diese Eisdecke auch nördlich von diesem Breitengrade das Land bedeckt, erscheint annehmbar, wenn wir sehen, daß sich z. B. in dem Smithsund ein so gewaltiger Wandergletscher wie der Humboldtgletscher (zwischen 79° und 80° N. Br.) ergießt. Ueber seine Bewegungen wissen wir indessen nur wenig und da er ziemlich stark nach innen zu anzusteigen scheint, können wir vorläufig kaum annehmen, daß er seine Speisung von so großen Gletschermassen empfängt, wie man das auf den ersten Blick glauben sollte. Da ferner Grinnell-Land, das zum Theil dieselben Bedingungen[S. 432] für ein zusammenhängendes Inlandseis zu haben scheint, wie der gegenüberliegende Theil von Grönland, aber nicht ganz mit Eis bedeckt ist, so können wir jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, daß der nördlichste Theil von Grönland ganz von dem Inlandseis bedeckt ist, — möglicherweise sind die Niederschläge zu gering dazu.
Von der regelmäßigen Weise, in der sich die Oberfläche des Inlandseises von der einen Küste bis zur andern wölbt, wird man sich hoffentlich leicht ein Bild machen können, wenn man die Karte mit dem Querschnitt des Landes betrachtet. Sie ist von Prof. Mohn nach den zahlreichen verschiedenartigsten Observationen gezeichnet worden, welche gemacht sind, sowie was die kleineren Variationen betrifft, nach meinen Tagebuchaufzeichnungen. Die Höhe ist der Anschaulichkeit halber im Verhältniß zu der Länge im Querschnitt zwanzigmal vergrößert. Der höchste Punkt, den wir erreichten, sollte unseren Beobachtungen zufolge ungefähr 2718 m über dem Meeresspiegel liegen. Nördlich von unserer Route wurde die Schneefläche indessen scheinbar höher, so daß man dort vermuthlich bedeutendere Höhen finden kann.
Wie man aus der Querschnittszeichnung ersehen wird, steigt die Oberfläche des Eises zu beiden Seiten verhältnißmäßig steil vom Meere auf, besonders an der Ostküste, während sie im Innern ziemlich flach ist. Im Großen und Ganzen kann man wohl sagen, daß die Steigung allmählich abnimmt, je weiter man sich von den Küsten entfernt, und die Oberfläche des Eises hat infolgedessen die Gestalt eines Schildes, der jedoch nicht ganz regelmäßig ist, indem sich die Oberfläche in schwachen, dem Auge fast unsichtbaren Wellen bewegt, deren Kämme ungefähr in süd-nördlicher Richtung gehen, und indem der Höhenrücken nicht ganz mitten im Lande zu liegen scheint, sondern sich mehr der Ostküste nähert.
Wir erreichten unsern höchsten Punkt ungefähr 180 km von dem Ort entfernt, wo wir die Küste verließen und ungefähr 270 km vom Ende des Ameralikfjordes, wo wir abermals das Niveau des Meeresspiegels erreichten. Berücksichtigt man, daß das Ende des Ameralikfjordes ungefähr 90 km von dem äußeren Scheerenkreis oder der äußeren Küstenlinie des Landes liegt, während unser Aufsteigeort an der Ostküste nur ungefähr 20 km davon entfernt lag, so erhalten wir also — in einem Schnitt den wir in der Richtung unserer Route durch das Land vornehmen — folgendes Verhältniß zwischen dem Abstand des Höhenrückens von beiden Küsten: von der äußeren Ostküste ca. 200 km und von der äußeren Westküste ca. 360 km.
Hier muß man indessen zweierlei mit in Betrachtung ziehen. Erstens ging unsere Route nicht quer über die Längenachse des Landes, wenn diese in der Mitte von der Breite des Landes aus gelegt wird, und zweitens steigt das Inlandseis nach Norden zu an. Da wir uns im Anfang unserer Eiswanderung weiter nach Norden zu befanden als später[S. 433] und auch unser Kurs nördlicher ging, folglich lothrechter auf der Längenachse des Landes, haben wir natürlich eine Steigung gehabt, die verhältnißmäßig größer ist als die Abschrägung während des übrigen Theils unserer Wanderung, die in ein wenig südlicher Richtung ging, also auf verhältnißmäßig niedrigere Theile des Inlandseises zu. Wir müssen auf derselben auch früher an unsern höchsten Punkt gelangt sein, als dies sonst der Fall gewesen wäre, mit andern Worten, der Höhenrücken muß in Wirklichkeit näher nach der Mitte des Landes zu liegen, als es nach unserer Route scheinen könnte.
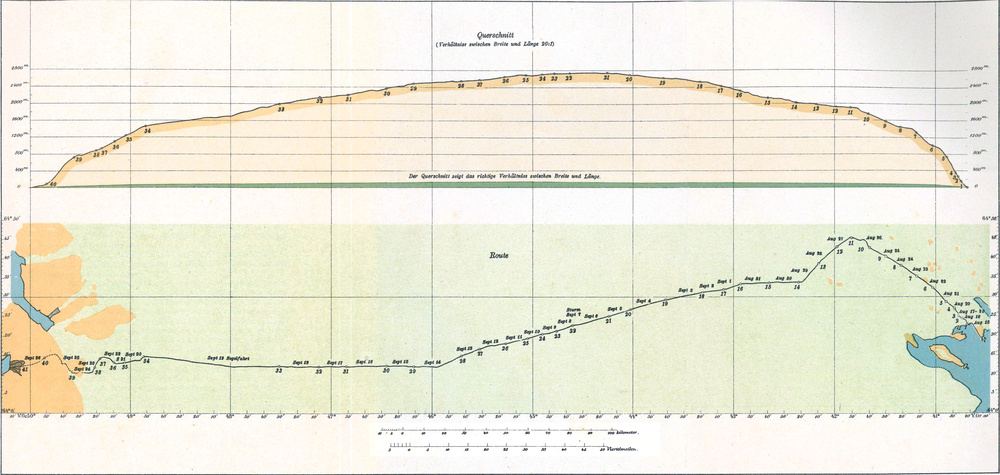
Entfernt man so viel wie möglich die Unregelmäßigkeiten in den Höhenmaßen, was eine Folge hiervon ist, was aber auch seinen Grund darin hat, daß unsere Route nicht gerade war, so stellt sich die Eigenthümlichkeit heraus, daß die Peripherie des Inlandseises in einem Schnitt quer über die Längsachse des Landes in der Breite, die wir überschritten, eine fast genaue mathematische Kurve bildet, die sich einem Zirkelbogen nähert. Wenn die vermehrte Krümmung, die durch die Form der Erdkugel verursacht ist, nicht in Betracht gezogen wird, müßte der Radius des Zirkelbogens ungefähr 10400 km betragen. Nur in der Nähe der Küsten weicht es ein wenig hiervon ab, indem es hier steiler abfällt. Mit andern Worten: das Inlandseis wölbt sich in diesem Theil des Landes sehr regelmäßig wie eine Cylinderfläche oder vielleicht richtiger wie eine Kegelfläche mit einer Steigung nach Norden von der einen Küste bis zur andern.
Es kann von Interesse sein, hiermit die Steigungsverhältnisse in den andern Theilen des Inlandseises zu vergleichen, soweit sie uns aus früheren Expeditionen bekannt sind.
Südlich von unserer Route sind nur an einem einzigen Ort Observationen vorgenommen, die in dieser Beziehung Material von Bedeutung bieten, nämlich auf der Westküste zwischen dem 62° 40′ und 62° 50′ N. Br., wo die dänische Expedition unter Kapitän Jensen eingedrungen war. Es war leider keine lange Strecke, die hier bereist war, aber sie genügt doch, um zu sehen, daß ein Querschnitt der Eisoberfläche auch an diesem Punkt so ziemlich mit einer Zirkelperipherie zusammenfällt, deren Radius indessen kleiner ist als der frühere, — er müßte ungefähr 9000 km betragen, wenn man auch hier die sphärische Form der Erde nicht berücksichtigt. — Gleich unserer Route fällt auch die Jensens nach der Küste zu steiler ab als der Zirkel. Interessant ist das Verhältniß, daß die Steigung bei dem inneren Theil der Eiswanderung niedriger ist, als wie sie sein würde, falls sie genau der Zirkelperipherie folgte. Der Grund hierzu ist offenbar der, daß das Eis hier im Schutz der Nunataks liegt (Jensens Nunataks) und gleichsam ein Gegenstrom in dem Eisstrom bildet, während das Eis auf der inneren Seite des Nunataks höher ist und wieder mit der Zirkelperipherie zusammenfällt. Falls sich die Eisfläche nach innen[S. 434] zu nach derselben Zirkelperipherie wölbt, müßte ihre Höhe in der Mitte des Landes — das an dieser Stelle ungefähr 400 km breit ist — ungefähr 2080 m betragen.
Begeben wir uns nördlich von unserer Route, so finden wir auf der Stelle, wo Nordenskjöld vordrang (auf dem 68½° Nördl. Br.), soweit er selbst gelangte, eine Steigung in der Eisfläche, die beinahe gleich von der Küste an merkwürdig genau mit einer Zirkelperipherie zusammenfällt. Der Radius dieser Zirkelperipherie ist sehr groß, ohne die Krümmung der Erdoberfläche müßte er ungefähr 23350 km betragen. Untersucht man die Steigung auf der angeblichen Expedition der Lappen, so zeigt es sich indessen, daß diese ganz außerhalb der Zirkelperipherie liegt und weit niedriger ist, und es sieht so aus, als wäre dieselbe plötzlich zu einer fast horizontalen Fläche hinaufgelangt. Daß eine solche nicht existirt, können wir getrost annehmen, ebenso, daß die Lappen ihren Barometer ganz richtig beobachtet haben, und daß demzufolge die Höhe 1947 m, welche sie erreicht haben wollen, ganz zuverlässig ist. Zur Erklärung dieses äußerst merkwürdigen Verhältnisses bleibt uns also nichts anderes übrig als die Annahme, daß die Lappen die von ihnen zurückgelegte Strecke sehr überschätzt haben. Es ist wenig Grund vorhanden, etwas anderes zu glauben, als daß die Steigung nach innen zu dieselbe Zirkelperipherie beschrieben hat, mit der die Steigung auf Nordenskjölds eigener Expedition so erstaunlich genau zusammentrifft. Hiernach müßte die von den Lappen erreichte Höhe (1947 m) ungefähr 70 km von Nordenskjölds innerstem Zeltplatz entfernt liegen, nicht aber 220 km, wie dies nach ihrer eigenen Angabe der Fall sein soll. Auf diese Weise erhält man auch eine Entfernung, die sie sehr wohl auf ihren Schneeschuhen zurückgelegt haben können, selbst bei der schlechten Schneeschuhbahn, die der feine Schnee in Grönlands Innerm giebt.
Daß dies Zurücklegen der von ihnen angegebenen Entfernung unter so ungünstigen Verhältnissen beinahe eine Unmöglichkeit ist, wird jeder erfahrene Schneeschuhläufer einsehen können. Wie leicht man die Entfernungen auf dem grönländischen Inlandseis überschätzen kann, davon können die Theilnehmer unserer Expedition mitreden, indem wir oft die zurückgelegten Entfernungen auf mehr als das Doppelte anschlugen.
Falls sich das Inlandseis quer über dem Lande an dieser Stelle nach derselben Zirkelperipherie wölbt, wie Nordenskjölds Steigung sie andeutet, kann ihre Höhe in der Mitte nicht mehr als 2360 m betragen, folglich ist sie geringer als die von uns erreichte Höhe.
Pearys Angaben in Bezug auf Entfernungen und Höhen sind leider mangelhaft; so weit man aber nach seinen und Maigaards Berichten schließen kann, scheint die Steigung während des größten Theils ihrer Wanderung (sie wurde ungefähr auf dem 69½° Nördl. Br. unternommen) merkwürdig genau mit der Zirkelperipherie zusammenzufallen,[S. 435] welche von Nordenskjölds Expedition angegeben wird. Während der ersten 40 km der Wanderung ist indessen die Steigung bedeutend steiler als die Zirkelperipherie; dies kann aber seinen Grund darin haben, daß sie an einem Arm der Disko-Bucht aufstiegen, der tief in das Inlandseis einschneidet, so daß der Anfang ihrer Wanderung dessen Herzen bedeutend näher lag als der Ort, von dem Nordenskjöld seine Expedition antrat.
Das Resultat dieser Zusammenstellung unserer Kenntniß von den Höhenverhältnissen des Inlandseises ist also folgendes: Das Inlandseis wölbt sich in merkwürdig regelmäßiger Weise wie eine Cylinderfläche von der einen Küste bis zur anderen. Der Radius des Cylinders ist indessen bedeutend verschieden auf den verschiedenen Breitengraden des Landes, indem er stark von Süden nach Norden zunimmt, so daß die Cylinderfläche selber flacher werden muß, je weiter nördlich man kommt.
Außer diesen Eigenthümlichkeiten in der Form der Oberfläche des Inlandseises verdient noch eine andere unsere Aufmerksamkeit, nämlich die bereits oben erwähnte schwache Wellenform. Bei Betrachtung des Querschnittes wird man zwei Arten von Wellen bemerken können, einige größere, die hauptsächlich in der Nähe der Küsten, besonders der Ostküste vorkommen, und die nach innen zu länger und flacher werden, und viele kleinere, die man den ganzen Weg entlang verfolgen kann, die aber ebenfalls weiter nach innen hinein länger und weniger bemerkbar werden. Aehnliche Wellen haben die meisten Expeditionen, die in das Inlandseis eingedrungen sind, bemerkt, sie erstrecken sich scheinbar stets in der Richtung von Norden nach Süden. Ich bin nicht der Ansicht, daß das darunterliegende Land im wesentlichen die Bildung dieser Wellen bedingt, jedenfalls nicht die der kleineren, ich glaube vielmehr, daß der Wind in genetischer Verbindung damit steht.
Was kann nun im großen und ganzen die Form der Schnee- und Eisdecke bedingen? Daß sie jedenfalls bis zu einem gewissen Grade von dem unterliegenden Gebirge unabhängig ist, darüber sind wir uns gar bald klar; denn Niemand wird behaupten wollen, daß dies Gebirge eine so regelmäßig ausgedehnte Ebene bilden kann, wie sie die Oberfläche des Inlandseises aufweist. Da Grönlands zerklüftete, felsige Küsten in hohem Grade an die norwegische Westküste erinnern, so liegt die Annahme sehr nahe, daß Grönlands Inneres, falls die Eisdecke entfernt würde, dem Norwegens gliche, ja, es würde wahrscheinlich noch zerklüfteter sein, da sowohl seine Ost- wie seine Westküste dies in hohem Grade ist. Mit anderen Worten, man müßte hohe Berge und tiefe Thäler antreffen, — und dies alles ist von der Eisdecke ausgeglichen und unter ihr verschwunden!
Um uns desto leichter einen Begriff davon machen zu können, was die Form der Eisdecke bedingt, wollen wir uns einen Augenblick vergegenwärtigen,[S. 436] wie dieselbe von Anfang an gebildet sein muß. Als die Temperatur sank, vielleicht gleichzeitig mit einem Steigen der Niederschläge, wurden die Schneemassen, die im Sommer nicht fortgeschmolzen werden konnten, von Jahr zu Jahr größer, besonders in den höheren Gebirgsgegenden. Der Schnee sammelte sich an und gestaltete sich zu Gletschern. Wie diese Ansammlung des Schnees vor sich gegangen sein muß, können wir an den norwegischen Hochgebirgen im Winter beobachten. Der Wind fegt allen trockenen, leichten Schnee, der fällt, von den Bergen in die Thäler hinab, die ersteren liegen fast kahl da, während sich die letzteren allmählich anfüllen. Wenn sich dann die Verhältnisse so gestaltet haben, daß diese Schneeanhäufung in den höchsten Gebirgsthälern größer gewesen ist als die Verminderung durch Abschmelzen im Sommer, so steigen folglich die Schneemengen in diesen Thälern von Jahr zu Jahr. So lange aber der Schnee in den Thälern noch niedriger liegt als die Berggipfel, setzt der Wind getreulich seine nivellirende Wirksamkeit fort.
Allmählich haben sich aber die Thäler ganz gefüllt, und die Oberfläche der Gletscher konnte jetzt über die Gipfel steigen und sie ganz verhüllen. Da die Gletscher in den höheren Regionen Wandergletscher in die niederen entsandt haben, und da die Temperatur gefallen ist, sind alle Bedingungen vorhanden, um denselben Prozeß auch hier zu wiederholen, und allmählich ist das ganze Land mit Schnee bedeckt worden, der regelmäßig von dem Winde geebnet und glatt gehalten wird, und der dann schließlich bis über die höchsten Gipfel hinaufgestiegen ist und alles mit einem einzigen Schneemeer überschwemmt hat.
Man kann natürlich nicht erwarten, daß dies Schneemeer überall gleich hoch ist. Es ist ganz natürlich, daß dort, wo die Niederschläge im Verhältniß zu den Kräften, welche dem Wachsen des Schnees ein Hinderniß in den Weg legen, am größten sind, sich auch die stärkste Schnee- und Eisschicht bildet. Ferner liegt es nahe, daß die Eisdecke nach den Küsten zu am dicksten wird, denn hier muß die feuchte Luft, die vom Meere herkommt, die meiste Feuchtigkeit absetzen. Schon die regelmäßig gewölbte Oberfläche der Schneedecke muß indessen den Verdacht aufkommen lassen, daß ein anderer Faktor von einfacherer mathematischer Natur bestimmend auf die Form einwirkt. Dieser Faktor ist der Druck.
Man darf nicht vergessen, daß die Eisdecke eine plastische Masse ist, die sich in Bewegung nach den Seiten zu befindet. Dort, wo der Widerstand gegen die Bewegung am größten ist, muß man erwarten, daß sich die Massen am höchsten anhäufen. Der Widerstand, auf den die Bewegung stößt, muß aber naturgemäß irgendwo in dem mittleren Theil des Landes am größten sein. Die Lage dieses Punktes muß zum Theil von den größeren Unebenheiten der Unterlage bedingt sein, indem diese den Widerstand vermehren oder verringern können. Von diesem Punkt ausgehend, nimmt der Widerstand nach beiden Seiten zu ab, und wir müssen[S. 437] folglich erwarten, eine regelmäßig gewölbte Eisdecke vorzufinden, sowie dies auch faktisch der Fall war.
Das weiter unten näher besprochene Schmelzen an der Unterseite der Gletscher muß auch dazu beitragen, daß sich die Schneefläche nach innen zu hebt, indem die Eisdecke dort am dicksten wird, wo die Temperatur am niedrigsten ist (siehe hierüber weiter unten).
Aus dem hier Angeführten muß erstens hervorgehen, daß die geringeren Unebenheiten der Unterlage keinen Einfluß auf die Formen der Oberfläche der Gletscher haben können, und zweitens, daß die größeren Unebenheiten der Unterlage ebenfalls nicht bestimmend einwirken können, da hier andere Faktoren von außen hinzutreten. So ist es z. B. durchaus nicht nachgewiesen, daß der Höhenrücken des Gletschers oder die Gletscherscheide, wenn wir uns so ausdrücken können, gerade über dem Höhenrücken oder der Wasserscheide der Unterlage liegt. Dies hängt ganz davon ab, ob es sich mit den Niederschlags-, Druck- und Schmelzverhältnissen vereinigen läßt. Daß die Unterlage in dieser Beziehung allerdings nicht ganz ohne Einfluß ist, haben wir bereits erwähnt. Der Beweis, daß der Höhenrücken der skandinavischen Gletscher nicht über der Wasserscheide des Landes liegt, ist jedenfalls zur Genüge geliefert. Er muß, wenigstens in der spätesten Eisperiode 160 km weiter nach Südosten zu gelegen haben.
Dies ist eine Frage, deren Beantwortung von höchstem Interesse sein würde, leider ist dies jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen, denn eine solche Messung würde mit ungeheuren Schwierigkeiten verknüpft sein.
Ich habe bereits früher erwähnt, daß Grönland in Bezug auf seine Gebirgs- und Höhenverhältnisse wahrscheinlich große Aehnlichkeit mit Norwegen hat. Gehen wir von diesem Gesichtspunkt aus, und denken wir uns Norwegen mit einer ähnlichen Eisschicht bedeckt wie Grönland, so werden wir sehen, daß selbst unser höchster Berg, der Galhöpiggen (2560 m), unter Schnee kommen würde, wenn er dem Höhenrücken so nahe läge. Ueber Stellen wie Fillefjield und Hardangervidden würde der Gletscher 1300–1600 m dick sein, über dem Boden von Valders, Haldingdal, Guldbrandsdalen u. s. w. würde er wenigstens 1900–2200 m dick sein. An einigen Stellen wie über Njösen, Randsfjorden u. a. würde die Schicht noch dünner werden, während sie an anderen Stellen wie über den Gebirgsrücken zwischen den Thälern dünner werden würde, doch nur um 1000 bis 2000 Fuß.
In Grönland muß ja ein ähnliches Verhältniß herrschen, und wenn wir uns auch vorstellen können, daß das feste Land dort zum Theil ein wenig höher als in Norwegen sein kann, so wird doch der Boden der Thäler dort in der Regel kaum mehr als 700–1000 m über dem Meeresspiegel[S. 438] liegen, und über diesen Thälern haben folglich die Gletscher eine Dicke von ungefähr 1700–2000 m, während sie ja an anderen Stellen dünner sein können. Der Druck, den ein Gletscher von 2000 m Dicke ausübt, ist jedenfalls nicht geringer als 160 Atmosphären, und wenn sich eine solche Masse über ihre Unterlage hinbewegt, wird man leicht verstehen können, daß sie eine mächtige Kraft besitzen muß, mit der sie scheuert und losreißt und alle hervorragenden Unebenheiten mit sich fortführt. Auf diese Weise müssen die sich stets der Küste zu bewegenden Gletscher sehr wohl im stande sein, im Laufe der Zeit die Thäler zu vertiefen und zu vergrößern, durch die sie sich bewegen, und je tiefer die Thäler werden, desto dicker werden auch die Gletscher und desto größer wird ihr Druck und ihre aushöhlende Fähigkeit. Auf die Weise wird es leicht verständlich sein, weshalb die Gletscher die ganze Unterlage nicht gleichmäßig ausgraben können, ihre Wirksamkeit muß sich mehr und mehr auf die Stellen konzentriren, wo sich Unebenheiten und Thäler befanden, ehe sich die Gletscher bildeten. Die grabende Fähigkeit ist natürlich nicht allein von der Dicke des Gletschers abhängig, sondern auch von der Schnelligkeit der Bewegung. Diese muß naturgemäß an dem äußern Rand des Gletschers größer sein als im Innern, da der Widerstand dort am geringsten und die Niederschläge am größten sind. Auf der andern Seite aber ist die Kraft am Rande geringer als weiter nach innen zu. Infolgedessen befindet sich die größte grabende Fähigkeit dort, wo das Produkt dieser beiden Faktoren am größten ist, nämlich eine Strecke von dem Rand des Gletschers entfernt. Das Eis hat sicher zu dieser seiner Arbeit auf dem unterliegenden Grunde eine bedeutende Hülfe in dem Wasser und den Bächen, welche durch Schmelzen der Eisdecke nach unten zu entstehen und auf die wir später zurückkommen werden.
Als vorzügliches Beispiel für die Gewalt, mit welcher die Wandergletscher ihre Ausgrabungen vorzunehmen vermögen, kann das Vaigat in Nordgrönland angeführt werden, jener wohl 20 Meilen lange und 2 Meilen breite Sund, der von der Disko-Bucht in nordwestlicher Richtung zwischen die Disko-Insel und die Halbinsel Nugsuak nach dem Meere zu einschneidet. Wie Prof. Amund Helland bereits angeführt hat, kann kein Geologe, der sich der Mühe unterzieht, die Verhältnisse zu untersuchen, in Zweifel darüber sein, daß die merkwürdigen Schichten aus der Kreidezeit und der Tertiärzeit (siehe den Anfang dieser Beilage) sowie die darüberliegenden jüngeren basaltischen Gebilde, die ungefähr in gleicher Höhe zu beiden Seiten dieses mächtigen Sundes auftreten, einmal ein zusammenhängendes Ganze gebildet haben. Der Sund kann unmöglich älter sein als die Bergarten, welche seine beiden Seiten bilden. Da einzelne der Tertiärbildungen sehr späten Ursprunges sind (sie gehören jedenfalls dem spätesten Theil der miocenen Zeit an), und da diese Schichten außerdem mit mächtigen Basaltschichten bedeckt sind, so muß die Bildung[S. 439] des Vaigats ganz neueren Datums sein, und wir kennen keine anderen Kräfte, die es gebildet haben können als eben die Wandergletscher. Es ist allerdings eine gewaltige Arbeit, die sie hier vollführt haben. Da die Basaltschichten zu beiden Seiten des Sundes in einer Höhe von tausend bis tausendfünfhundert Metern und mehr emporragen, und da der Sund selber tief ist, so muß die Steinmasse mindestens eine Dicke von zweitausend Metern, eine Breite von zwei Meilen und eine Länge von mehr als zwanzig Meilen gehabt haben, welche den Sund ausfüllte und die durch die Thätigkeit des Eises fortgeführt wurde.
Einen Einfluß anderer Art muß eine so mächtige Eisdecke dadurch auf die Unterlage haben, daß sie dieselbe niederdrückt. Hierdurch hat man auch die nach der Eiszeit eingetretene Senkung des Landes, die man an verschiedenen Stellen zu bemerken glaubte, zu erklären gesucht. Da die Gebirgsunterlage jedenfalls bis zu einem gewissen Grade elastisch ist, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß eine Steigung des Landes, die nach der Eiszeit in Europa und in Amerika, sowie auch nach der früheren größeren Verbreitung des Eises in Grönland vor sich gegangen ist, sich dadurch erklären läßt, daß sich das Land gehoben hat, nachdem sich das Eis zurück zog und der Druck geringer wurde. Daß sich dies wirklich so verhalten muß, scheinen Kand. Andr. M. Hansens Untersuchungen der Strandlinien in Norwegen[102] zu bestätigen; diese beweisen nämlich ganz deutlich, daß das Land sich nach innen zu — wo also die Eisdecke am dicksten und der Druck am größten war — mehr gehoben hat als nach dem Meeresrande zu; es scheint sogar ein fast konstantes Verhältniß zwischen dem Steigen und dem Abstande von der äußeren Küstenlinie zu bestehen.
Dies kann, wie Hansen meint, möglicherweise auch die Bildung der Terrassen erklären. Da man nämlich kaum annehmen kann, daß die Abnahme des Eises ganz gleichmäßig vor sich gegangen ist, so kann sich auch das Land nicht gleichmäßig gehoben haben. Es hat Perioden in den klimatischen Veränderungen gegeben und wahrscheinlich auch Zeiten, in denen sich die Gletschermassen sehr wenig verringerten oder gar wieder wuchsen. Infolgedessen hat sich das Land in einem einigermaßen konstanten Niveau erhalten. Während solcher Zeiten sind die Terrassen entstanden und je nach der Dauer der Perioden größer oder kleiner geworden. Dann sind Perioden mit einer Abnahme der Gletschermassen und einer entsprechend stärkeren Steigung des Landes gekommen, während dieser Perioden ist die Bildung der Terrassen wenigstens theilweise unterbrochen worden.
Um einen richtigen Eindruck von dem Einfluß des Inlandseises in dieser Beziehung wie von seinen grabenden Fähigkeiten zu bekommen,[S. 440] muß man bedenken, daß das grönländische Inlandseis im Verhältniß zu dem, welches Europa und Amerika bedeckte, nur klein ist, es ist auch jetzt längst nicht mehr so groß wie damals, als es Grönlands äußerstes Küstenland vollständig bedeckte.
Was ferner mit dazu beigetragen haben muß, daß das Land gestiegen ist, nachdem es mit Eis bedeckt war, ist die Verringerung des Druckes, die dadurch entstanden ist, daß die Decke an der Unterlage gezehrt und Material mit sich fortgeführt hat. Daß die dadurch entstandene Verringerung des Druckes nicht ganz unbedeutend ist, kann man an den Unmengen von Kies und Steinen erkennen, die von Skandinavien nach Rußland, Dänemark und den norddeutschen Ebenen übergeführt sind. Man darf jedoch nicht außer acht lassen, daß eine solche Steigung ja theilweise auch nur scheinbar sein kann, indem nicht das Land gestiegen, sondern das Meer gefallen ist. Man hat nämlich nachgewiesen, daß das Land eine Anziehungskraft auf die See ausübt, so daß der Meeresspiegel in der Nähe von steilen, hohen Gebirgsländern höher liegt als anderswo; etwas Aehnliches würde auch der Fall sein, wenn das Land aus Eis bestände. Es ist klar, daß je größer die Masse des Landes (oder auch des Eises) ist, desto stärker wird die Anziehungskraft, desto höher die Lage des Meeresspiegels. Wenn nun, sowie dies nach der Eiszeit der Fall war, die Masse des Landes durch das fortgegrabene Material und das Verschwinden des Eises verringert worden ist, so ist auch die Anziehungskraft kleiner geworden und der Meeresspiegel tiefer gesunken; daß dies jedoch nicht hinreicht, um die beobachteten Veränderungen zu erklären, geht deutlich aus Hansens früher erwähnten Strandlinie-Untersuchungen hervor; denn nach diesen müßte nämlich das Sinken der See regelmäßig zwischen den Fjorden und in einem dem Abstande von der Außenküste entsprechenden Verhältniß zugenommen haben. Allerdings muß die Anziehungskraft in den Fjorden etwas stärker sein, aber der Unterschied genügt keineswegs, um die vorliegenden Beobachtungen zu erklären, wie auch die ganze Verringerung der Anziehungskraft durchaus nicht im stande sein kann, ein Sinken zu verursachen, das groß genug ist, um ein scheinbares Steigen bis zu 700 Fuß zu erklären.
Von den Einwendungen, die dagegen erhoben sind, daß das Verschwinden des Eises die Ursache zu dem Steigen des Landes sein kann, will ich diejenige erwähnen, daß man in Schweden postglaciale Hebungen des Landes nachgewiesen hat. Diese scheinen sich meiner Ansicht nach sehr gut dadurch erklären zu lassen, daß sich, lange nachdem das Eis sich aus dem südlichen Schweden zurückgezogen hatte, noch größere Ueberreste desselben in Norwegen und Nord-Schweden fanden, und das Verschwinden dieser Ueberreste hat die schwedischen postglacialen Hebungen hervorgebracht.
Schwieriger zu erklären sind die in Asien nachweisbaren Landhebungen,[S. 441] denn hier hat ja keine Eisperiode stattgefunden. Man kann sich indessen denken, daß das Regenwasser und die Bäche an dem Lande gezehrt und seine Masse so verringert haben, daß ein merkbares Steigen dadurch hervorgerufen wurde; dies muß hauptsächlich in nördlichen Ländern der Fall sein, wo die Wirksamkeit des Wassers infolge der Kälte am größten ist. Daß das Zehren des Meeres an den Küsten von Island und den Faröern, wie bereits früher (Bd. I., S. 135) erwähnt ist, das Steigen derselben und dadurch die schräge Lage der Basaltschichten auf diesen Inseln verursacht haben kann, scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, welchen Einfluß die Erosion in dieser Beziehung haben kann.
Daß Grönlands Steigung in der Regel bedeutend geringer ist als Skandinaviens, stimmt auch durchaus mit der hier besprochenen Erklärung überein, denn Grönlands Inlandseis ist gewiß selbst in seiner größten Ausbreitung nicht so mächtig gewesen wie das skandinavische und nordeuropäische, außerdem hat sich das grönländische Inlandseis bisher nur theilweise zurückgezogen, und es ist noch eine große Aussicht auf eine Steigung des Landes bis zum völligen Schmelzen des Eises vorhanden. Mag sich nun das Land auch augenblicklich im Sinken befinden, wie einzelne Gelehrte anzunehmen geneigt sind, oder im Stillstand, so ist das hier von nur geringem Interesse; denn in diesem Falle hätten wir nur einen Beweis dafür, daß sich das Inlandseis augenblicklich in einer Periode befindet, in der es wächst oder seine gleiche Höhe behält. Daß es jedenfalls jetzt nicht sonderlich in der Abnahme begriffen ist, darüber werde ich mich später noch auslassen.
Wir stießen während unserer Expedition auf auffallend wenig Spalten. An der Ostseite begegneten wir ihnen nur bis zu 15 km von der Küste entfernt. In der Nähe der Westküste trafen wir die erste Spalte ungefähr 40–45 km vom Rande des Inlandseises entfernt. Im ganzen Innern trafen wir keine Spur davon. Bäche sahen wir so gut wie gar nicht auf dem Inlandseise, was nach Ansicht Mancher seinen Grund in der späten Jahreszeit haben kann. Auf der einen Seite ist die Mitte des August, zu welcher Zeit wir uns an der Ostküste befanden, keine späte Jahreszeit in Bezug auf das Schmelzen des Schnees, und auf der anderen Seite hätten wir ja, wenn auch die Bäche selber verschwunden wären, doch ihre Rinnen antreffen müssen. Davon sahen wir im Innern jedoch nicht das Geringste, in einer Höhe von 20–30 km vom westlichen Rande des Inlandseises wurden solche Bäche bemerkt. Ebenso können möglicherweise bis zu einer Entfernung von 15 km von der Ostküste kleinere Bäche über das Eis hinlaufen. Außer auf diesen kleinen Strecken in der Nähe der Küsten giebt es zu keiner Zeit des Jahres Bäche auf dem bisher bekannten Theil des Inlandseises.
[S. 442]
Von der Beschaffenheit der Oberfläche des Inlandseises im Innern wird man hoffentlich ein einigermaßen klares Bild durch die in Kapitel XVIII. enthaltene Schilderung bekommen. Wie man daraus ersieht (Bd. II., S. 117) besteht die Oberfläche bereits in nicht weiter Entfernung von der Ostküste aus trocknem Schnee, auf dem die Sonne nur dünne Eiskrusten zu bilden vermag. Aus solchem trocknen Schnee besteht die ganze Oberfläche der inneren Eiswüste. Wie tief wir eindringen müssen, um diesen Schnee in Eis verwandelt zu sehen, wissen wir nicht. Dies muß irgendwo durch Druck vor sich gehen. Das Merkwürdigste bei diesem trocknen Schnee ist der Umstand, daß die Masse des Schnees und Eises mitten im Lande sich nicht durch Schmelzen verringert; doch davon später mehr.
In Bezug auf die Oberfläche des Inlandseises will ich nur noch erwähnen, daß wir nur wenig oder nichts von fremden Gegenständen bemerkten.
Von Nordenskjölds Eisstaub oder Kryokonit sahen wir fast nichts an der Ostküste oder in der Nähe derselben. In der Nähe der Westküste dagegen fand ich ihn an mehreren Stellen bis zu 30 km vom Rande des Eises, es waren freilich stets nur geringe Mengen, was zum Theil der späten Jahreszeit zuzuschreiben ist, da die Wasserlöcher, in denen man den Kryokonit hauptsächlich zu finden pflegt, zugefroren waren. Von Moränenschlamm oder Steinen (erratischen Blöcken) bemerkten wir nirgendswo das Geringste auf dem Eise,[103] ausgenommen an der letzten kleinen Abschrägung an der Westküste, wo wir aufs Land hinabstiegen oder vielmehr an dem ersten kleinen Gewässer, also nur etwa hundert Ellen von dem alleräußersten Rand entfernt. Dies stimmt vollkommen mit den früher auf dem grönländischen Inlandseis gemachten Beobachtungen überein, widerspricht aber den Behauptungen, welche viele Geologen in Bezug auf die Gletscher der größeren Eisperioden aufstellen. Sie sind nämlich der Ansicht, daß diese großen Moränen auch Kies und Steinen auf ihrem Rücken mit sich fortgeführt haben, eine meiner Anschauung nach ganz absurde Behauptung, die kaum einer anderen Widerlegung bedarf als des Hinweises auf das grönländische Inlandseis. Die Auffassung, daß dies in Bezug hierauf nichts beweisen kann, da Grönland zu lange dem Scheuern des Eises ausgesetzt war, um noch erratisches Material von irgend welcher Bedeutung zu besitzen, ist ganz werthlos; denn selbst wenn man auch nicht wüßte, daß stets Wanderblöcke in die grönländischen Eisfjorde hinausgeschoben werden (was faktisch der Fall ist), so hat doch Niemand leugnen wollen, daß unablässig große Mengen Moränenschlamm mit den Bächen unter den Gletschern hervorkommen, und dies müßte doch jedenfalls an die Oberfläche der Gletscher hinaufgeführt werden, falls sich[S. 443] in ihrer Masse eine starke aufwärtssteigende Bewegung geltend machte wie man dies behauptet hat. — —
In meteorologischer Beziehung hat die Expedition überraschende Resultate erzielt. Temperatur. Wie bereits erwähnt, fiel nach Prof. Mohns Berechnungen die Temperatur in einzelnen Nächten (12.-14. Sept.) vermuthlich bis auf −45° C., und die Durchschnittstemperatur der Tage vom 11.-16. Sept., als wir uns ungefähr mitten im Lande oder ein wenig westlich von dem Höhenrücken befanden, betrug −30° bis −34° C. Dies sind mindestens 20° weniger als man infolge der allgemein angenommenen Gesetze für des Fallen der Temperatur mit steigender Höhe annehmen sollte, indem man von der Durchschnittstemperatur an den nahegelegenen Küsten ausgeht.
Auf die Meeresfläche reduzirt, ist diese Temperatur ohne Frage die niedrigste, die auf unserer Erde im Monat September beobachtet worden ist. Eine der kältesten Durchschnittstemperaturen dieses Monats, die uns bekannt ist, ist −9° C. auf Grinnells Land. In dem mittleren Theil Grönlands beträgt die kälteste Durchschnittstemperatur für den September sicher nicht viel weniger als −30° C. (also ein Unterschied von ungefähr 20°). Auf die Meeresfläche reduzirt, kann diese Temperatur jedenfalls nicht höher werden als −13° C.
Es kann daher scheinen, als wenn wir in Grönlands Innerem, wie Prof. Mohn sich ausdrückt, den zweiten Kältepol der nördlichen Halbkugel gefunden haben. Und wahrscheinlich ist das Innere Grönlands einer der kältesten Orte auf der ganzen Erde.
Bei der Temperatur verdient noch ein anderes Verhältniß Beachtung, nämlich der große Unterschied zwischen Tag und Nacht. Im Innern des Landes betrug derselbe 20–25°, indem wir während der kältesten Zeit der Nacht dem Anschein nach bis −45° C. hatten, während die Temperatur am Tage bis auf ungefähr −20° C. stieg. Ein so bedeutender Unterschied trat jedoch nur ein, als das Wetter Tag und Nacht hindurch völlig klar war.
Die Meteorologen können sich schwerlich eine Vorstellung von der niedrigen Temperatur machen, die wir im Innern Grönlands fanden, sie bildet sozusagen ein neues Phänomen, es müssen Faktoren vorliegen, mit denen man noch nicht gerechnet hat. Ich glaube, daß die niedrige Temperatur, sowie der große Unterschied zwischen der Tag- und Nachttemperatur sich am besten auf folgende Weise erklären läßt:
Daß die Ausstrahlung von Schneeflächen größer ist als von Erd- oder Steinflächen, darüber sind sich mehrere Forscher einig, da sie ausfindig gemacht haben, daß die Temperatur über den ersteren des Nachts, besonders bei klarem Wetter, stärker sinkt.
[S. 444]
Es kann befremdend erscheinen, daß dies der Fall ist, da wenig Grund zu der Annahme vorhanden ist, daß die weiße glatte Schneefläche eine größere Wärmeausstrahlung geben sollte, als die rauhe dunkle Erdoberfläche. Es widerspricht auch der allgemeinen Erfahrung. Wie jeder norwegische Bauer wissen wird, frieren die Moore nicht zu, selbst nicht in der stärksten Kälte, sobald sie mit Schnee bedeckt sind, er mag noch so dünn sein; dagegen würden sie bei derselben Temperatur bis auf den Grund ausfrieren, sobald der Schnee entfernt ist. Würde die Ausstrahlung wirklich durch die Schneeschicht befördert, so müßte auch das Gefrieren dadurch befördert werden, jedenfalls wenn die Schneedecke so dünn ist, daß die geringe Wärmeleitungskraft des Schnees keine große Rolle spielen kann.
Bei genauerer Erwägung muß es zweifellos erscheinen, daß die wirkliche Ausstrahlung der Erdoberfläche durch eine Schneedecke vermindert wird. Wenn es dagegen den Anschein hat, als ob sie erhöht wird, so hat dies seinen Grund in der schlechten Wärmeleitung des Schnees. In Schichten, welche gute Wärmeleiter sind, wird, selbst wenn die Ausstrahlung sehr stark ist, allmählich der Oberfläche Wärme von innen zugeführt werden, und auf die Weise werden folglich die Ausstrahlungen einen großen Wärmeverlust für die ganze Masse verursachen, während die Wärme auf der Oberfläche selbst nicht so sehr sinkt, wie sie es nothwendigerweise in Schichten thun müßte, die schlechte Wärmeleiter sind. Hier wird nämlich die Ausstrahlung im wesentlichen nur Bedeutung für die allerobersten Schichten haben, denn da nur wenig Wärme von innen zugeführt wird, kann die Temperatur auf der Oberfläche einigermaßen ungehindert sinken, während die Temperatur ein kleines Stück unter derselben bedeutend höher ist. Der Unterschied in dieser Beziehung zwischen schlechten und guten Wärmeleitern ist derselbe, wie zwischen schlechten Kleidern, die gute Wärmeleiter sind, und guten Kleidern, die schlechte Wärmeleiter sind. Die ersteren werden ihrem Träger einen größeren Wärmeverlust zuführen, während sie selber auf der Oberfläche wärmer sind, die letzteren werden einen geringen Wärmeverlust herbeiführen, selbst aber kalt auf ihrer Oberfläche sein.
Nun ist es klar, daß die alleroberste Schicht des Erdbodens entscheidend auf die Temperatur der zunächst gelegenen oder niedrigsten Luftschicht wirkt. Folglich muß, wie wir gesehen haben, bei der Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche die Temperatur der untersten Luftschichten über dem aus schlecht wärmeleitenden Schichten bestehenden Erdboden am niedrigsten werden, wenn auch die Ausstrahlung selber hiervon möglicherweise etwas geringer ist. Wir müssen daher darauf gefaßt sein, ein stärkeres Fallen der Temperatur während der Nacht über Schneefeldern zu finden, besonders bei dicken Schichten losen Schnees, als über Eisflächen, und ferner stärkeres Sinken über losen Erd- und Sandschichten — die schlechte Wärmeleiter sind — als über festem Erdboden, der etwa aus Felsen oder feuchter Erde besteht.
[S. 445]
Im Zusammenhang mit dieser schlechten Wärmeleitung steht natürlich auch die Thatsache, daß diese losen Schnee- und Sandschichten eine weit geringere Masse repräsentiren, als ein entsprechender Kubikinhalt Eis, Stein oder feuchter Erde, — folglich haben sie auch einen entsprechend geringeren absoluten Wärmegehalt. Der Verlust einer bestimmten Wärmemenge wird folglich ein weit bedeutenderes Fallen der Temperatur bei z. B. einem Kubikfuß losen Schnees oder Sandes verursachen, als bei einem Kubikfuß Eis oder fester Felsmasse.
An solchen Stellen mit losen Schichten muß selbstverständlich der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ein auffallend großer sein, indem auch die Sonne dort am Tage weit leichter die obenaufliegenden Schichten erwärmt, ohne daß diese den darunterliegenden Schichten allzu viel davon mittheilen. Dies stimmt überraschend mit den Beobachtungen überein, die in dieser Richtung bereits gemacht sind. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht betrug, wie wir bereits gesehen haben, in Grönlands Innerm 20–25°; ein ähnliches Verhältniß, wenngleich lange nicht in so auffallendem Grade, fand die britische Polarstation über den Schneeflächen bei Fort Rae (am großen Sklavensee) im März des Jahres 1883. Ferner sind die Sahara und die asiatischen Wüstenstriche wegen ihres großen Unterschiedes in Bezug auf die Tag- und Nachttemperatur bekannt, und derselbe scheint dort ebensogroß, wenn nicht größer sein zu können, als in der grönländischen Schneewüste.
In dem Innern dieser Eiswüste müssen wohl alle Bedingungen für eine starke Abkühlung durch Ausstrahlung vorhanden sein. Nur mitten im Sommer vermögen die Sonne und der Frost eine dünne Eiskruste über dem Schnee hervorzubringen, der also eine dichtere Masse, ein besserer Wärmeleiter und ein weniger guter Wärmeausstrahler ist. Während des größten Theils des Jahres ist die Oberfläche indessen mit völlig trockenem Schnee bedeckt, der freilich vom Wind zusammengestaut, aber unter niedriger Temperatur gefallen ist; er ist äußerst fein und folglich ein sehr schlechter Wärmeleiter.
Kann nun aber diese Ausstrahlung in den kalten Weltenraum von der Schneeoberfläche ein so großes Sinken der Temperatur der niedrigsten Luftschicht während einer Sommernacht zur Folge haben, welch eine niedrige Temperatur muß sie da erst im Winter über dieser Schneewüste hervorrufen, wenn die Sonne niedriger steht oder — weiter nordwärts — ganz verschwindet? Wir besitzen wohl kaum einen Maßstab, der uns in stand setzt, auch nur annähernd zu berechnen, wie tief die Temperatur da sinken kann. Man muß folglich annehmen, daß ein großer Unterschied zwischen der Winter- und Sommertemperatur besteht.[104]
[S. 446]
Deswegen glaube ich, daß die starke Abkühlung durch Ausstrahlung der allerobersten Schneeschichten im wesentlichen die Ursache zu der durchschnittlich geringen Temperatur ist, die wir während unserer ganzen Wanderung durch das Innere Grönlands beobachteten. Freilich wird es der Sonne entsprechend leicht, die obersten, schlecht wärmeleitenden Schneeschichten am Tage zu erwärmen, aber man muß bedenken, daß sie jedenfalls niemals weiter als bis höchstens zu 0° gelangt, und dann wirft die weiße Schneefläche nicht wenig von den wärmebringenden Sonnenstrahlen zurück.
Ein anderer Faktor, der in hohem Grade dazu beitragen muß, die Ausstrahlung zu vermehren und eine niedrige Temperatur zu schaffen, ist die dünne Luft, die sich in dieser Höhe über der Meeresfläche befindet. Man muß ferner bedenken, daß man bisher noch keine ähnliche ebene Fläche in einer Höhe von 2700 m über dem Meeresspiegel kennt. Sie ist nicht von Thalsenkungen durchschnitten, in welche die durch Ausstrahlungen abgekühlte Luft herabsinken oder aus denen die warme Luft aufsteigen kann. Der Luftdruck ist außerdem derartig, daß nur wenig Luft von den Küsten zugeführt wird, indem die Winde, meistens vom Innern kommend, sich nach den Küsten hin bewegen. Die Ausstrahlung muß mit großer Leichtigkeit vor sich gehen können in dieser dünnen kalten Luft, deren relativer Feuchtigkeitsgrad freilich groß ist, dessen absolute Feuchtigkeit aber doch nur gering ist. Außerdem darf man nicht außer acht lassen, daß wir die Luft nur bis zu Manneshöhe über der Schneefläche untersuchen konnten. Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, daß man höher aufwärts wärmere und verhältnißmäßig trockene Luft findet, welche in einem noch höheren Grade die Ausstrahlung begünstigt; die Luftschichten da drinnen sind verhältnißmäßig nur geringen Veränderungen unterworfen, und da dort kaum zu anderen Zeiten als im Sommer ein stark aufwärtsstrebender Luftstrom stattfinden kann, der den höheren Luftschichten Feuchtigkeit zuführen kann, indem die durch die Schneefläche abgekühlten Schichten als die schwersten herabsinken, so muß man nothwendigerweise erwarten, trockenere und bis zu einem gewissen Grade wärmere Luft in den höheren Luftschichten zu finden, sobald die Wärmeausstrahlungen größer sind als die Wärmezustrahlungen, und dies ist selbstverständlich während eines großen Theils des Jahres der Fall.
Noch einen dritten Faktor, der auch, wenngleich in geringerem Grad zu dem Sinken der Temperatur auf der Oberfläche der inneren Schneewüste beitragen kann, will ich hier erwähnen. Wie ich später auseinandersetzen werde, muß meiner Meinung nach ein stetes Schmelzen[105] auf der[S. 447] Unterseite der Schnee- und Eismassen dort vor sich gehen, wo sie das darunterliegende Land berührt. Ein solches Schmelzen bindet indessen eine Menge Wärme, die mit dem Schmelzwasser fortgeführt wird, das unter den Eismassen den Küsten zuströmt. Daß ein solches stetes Entführen von Wärme aus der unteren Schicht des Inlandseises nicht ganz ohne Einfluß auf dessen Oberflächentemperatur sein kann, ist so einleuchtend, daß es kaum einer weiteren Erklärung bedarf. Auf der einen Seite wird ja diese Wärme dem Inlandseis selber entzogen, und dies muß sich der Oberfläche in größerem oder geringerem Grade mittheilen, je nach der Dickigkeit der Eis- und Schneeschicht; auf der andern Seite wird sie der darunterliegenden Schicht entzogen, mit andern Worten: ein Theil von der innern Wärme der Erdoberfläche, die infolge des steten Wärmeverlustes auf der Oberfläche sozusagen stets auf der Wanderung von innen nach außen begriffen ist, wird hier angehalten und verbraucht, und die Oberfläche selber wird infolgedessen eines Theils der Wärme beraubt, die ihr von innen zugehen sollte. Nun ist freilich die Wärmeleitung durch die Eisschicht geringer und durch die zu oberst liegenden Schneeschichten noch geringer, und der auf diese Weise verursachte Wärmeverlust sollte folglich auf der Oberfläche weniger fühlbar werden, aber ganz ohne Rückwirkung bleibt er doch nicht.
Wie hieraus zu ersehen ist, müssen alle hier hervorgehobenen Verhältnisse zusammenwirken, um eine kalte Oberfläche hervorzubringen, und meiner Meinung nach müssen sie hinreichend sein, um die erstaunlich niedrige Temperatur dieser Schneewüste zu erklären.[106]
In Bezug auf die Feuchtigkeit und die Niederschläge stießen wir auf Verhältnisse, wie man sie hätte kaum erwarten können. Der Feuchtigkeitsgrad der Luft war über dem größten Theil des Inlandseises überraschend hoch, indem er meistens zwischen 90 und 100% ergab. Nur in der Nähe der Westküste fanden wir unter 79%, wir hatten aber damals einen Wind mit föhnartigem Charakter.
Man kann hieraus ersehen, daß, wenn auch die absolute Feuchtigkeit der Luft infolge der niedrigen Temperatur nur gering war, doch die relative Feuchtigkeit eine sehr hohe war. Dies hatte man freilich im Grunde erwarten können, da ja alle bis an das Inlandseis dringenden[S. 448] Winde vom Meere herkommen und die Luft, welche sie mit sich führen, allmählich, je weiter sie gelangen, mehr und mehr abkühlten. Infolgedessen müssen auch häufig Niederschläge stattfinden. Während der 40 Tage, die unsere Eiswanderung währte, hatten wir 4 Tage Regen, 1 Tag Hagel und 11 Tage Schnee. Im Innern fiel dieser Schnee meistens in Form von feinem Frostschnee oder von Eisnadeln, die fast täglich aus einer halb undurchsichtigen Luft herabregneten, durch welche man die Sonne allerdings häufig hindurchscheinen sah, und in der sich fast unaufhörlich Sonnenringe mit Nebensonnenringen bildeten.
Wenn wir nun diese beständigen Niederschläge mit dem früher erwähnten Verhältniß vergleichen, daß sich nämlich die Schneemenge nicht durch Schmelzen an der Oberfläche verringern kann, da muß es sich also entweder so verhalten, daß das grönländische Inlandseis beständig im Innern zunimmt oder auch sind hier andere Faktoren vorhanden, die zehrend auf die Eismassen einwirken und die Vermehrung aufheben.
Daß wir mit unserer jetzigen Kenntniß kein Recht haben, das Erstere anzunehmen, davon können wir uns gar bald überzeugen; denn wenn das Inlandseis im Innern stiege, müßte es sich ja auch im Grunde am Rande vermehren können; aus den Beobachtungen und Messungen, die bisher gemacht worden sind, geht dies aber nicht hervor. Dieselben erstrecken sich allerdings nicht durch einen Zeitraum, der weitgreifende Schlußfolgerungen gestattet, aber sie sind doch während mehrerer Jahre vorgenommen.
Was kann denn nun dazu beitragen, daß sich die Schneemenge nicht vermehrt?
Die Verdampfung der Oberfläche kann, wie wir schon gesehen haben, nur klein sein und ist nicht im stande, die Schneemenge in einem bemerkbaren Grade zu verringern.
Der Wind, der den Schnee aus dem Innern nach den Küsten zu als feines Schneetreiben wehen könnte, kann ebenfalls keinen großen Einfluß nach dieser Richtung hin haben. Freilich weht er in der Nähe des Eisrandes ziemlich ununterbrochen, im Innern scheint aber nur wenig Wind zu herrschen, und wenn er wirklich einmal weht, so geschieht dies keineswegs immer in derselben Richtung.
Auf der Oberfläche ist folglich nichts, was im stande ist, das Steigen des Schnees zu verhindern. Ein solches Steigen können wir ebenfalls getrost in den vielen Schneeschichten mit dazwischenliegenden dünnen Eiskrusten annehmen. Wir müssen unsere Gründe folglich in der Tiefe suchen.
Dringen wir tiefer ein, so stoßen wir auf einen Faktor, der in dieser Hinsicht von Bedeutung sein muß, nämlich auf den Druck. Man darf nämlich nicht vergessen, daß der Schnee und das Eis — das durch den Druck des ersteren hervorgebracht ist — eine theils plastische oder zähe[S. 449] halbflüssige Masse ist, die keine große Dickigkeit erreichen kann, da der Druck bewirkt, daß sie nach den Seiten hin entweicht und auf diese Weise Wandergletscher bildet, die je nach der Größe der Massen groß oder klein sind, wie wir das überall an unsern Hochgebirgen beobachten können.
Auf diese Weise also wird der Druck das grönländische Inlandseis, indem er im Innern steigt, zu einer ständigen Bewegung nach den Felswänden der Unterlage zu zwingen, durch die Thäler hindurch, welche es am leichtesten passiren kann, und nach den Küsten zu, wo es dann in Gestalt der bekannten mächtigen Wandergletscher in die Fjorde hinabgleitet und seine Eisberge abwirft, die von dem Meere fortgeführt werden. Auf diese Weise entsprechen gewissermaßen diese Wandergletscher oder Eisströme den Bächen anderer Länder, indem sie einen theilweisen Ablauf für die Niederschläge in dem innern Lande bilden; der Unterschied besteht nur darin, daß der Ablauf hier in fester, statt in flüssiger Form geschieht.
Mancher wird sich schwerlich eine Vorstellung davon machen können, daß Eis und Schnee derartig beweglich sind; stellt man sich aber Grönland statt dessen mit einer entsprechenden Schicht Pech, nassen Lehmes oder Gelées bedeckt, vor, so wird man wahrscheinlich sofort die Nothwendigkeit erkennen, daß diese Schicht früher oder später ins Meer hineingeschoben werden muß.
Hieraus kann man ersehen, daß das Inlandseis mit einer gewissen Menge von Niederschlägen, selbst wenn keine andern Faktoren vorhanden wären, doch eine bestimmte Höhe nicht überschreiten kann, indem die durch den Druck verursachte Bewegung den Zuwachs in den Schranken halten wird. Hat nun das grönländische Inlandseis diese Höhe erreicht?
Dies ist nicht wahrscheinlich; denn bevor es soweit kam, muß ein anderer Faktor sich gemeldet und das weitere Steigen verhindert haben. Dies ist das Schmelzen, das an der Unterfläche wesentlich durch die innere Wärme der Erde hervorgerufen wird.
Es ist eine Thatsache, die sich nicht länger bestreiten läßt, daß das Innere der Erde seine eigene Wärme hat, und daß die Temperatur steigt je tiefer man in die Erde eindringt. Aber ebenso sicher wie dies der Fall ist, ebenso sicher muß auch dasselbe Verhältniß in einem Schneegletscher herrschen; denn in nichts unterscheidet sich dieser von den gewöhnlichen geologischen Schichten außer darin, daß er beweglicher ist und daß er bei einer niedrigern Temperatur schmilzt als diese. Schnee und Eis sind schlechte Wärmeleiter, und wir müßten aus dem Grunde, wenn sie still lägen, erwarten, dort ein stärkeres Steigen der Temperatur zu finden als in andern geologischen Schichten. Nun kommt indessen möglicherweise noch das hinzu, daß die Schicht des Inlandseises so kürzlich gebildet ist und sich in einer so beständigen Bewegung nach dem Rande zu befindet, daß die innere Erdwärme keine Zeit gehabt hat, sie völlig zu durchdringen.
Es ist daher, so lange diese Sache nicht untersucht wird, ganz unmöglich[S. 450] zu berechnen, in welchem Grade die Temperatur nach dem Innern des Inlandseises zu steigt. Wenn wir indessen voraussetzen, daß das Steigen ungefähr in dem gewöhnlichen Verhältniß stattfindet und daß die Durchschnittstemperatur der Oberfläche in dem Innern des Landes zwischen −20 und −30 Grad[107] beträgt, so müßten wir also erwarten, in einer Tiefe von 700 bis 1000 m eine Temperatur von 0° zu finden, indem man bei Bohrungen ein durchschnittliches Steigen der Temperatur von 1° C. auf je 33 m finden zu können gemeint hat. Theils ist indessen diese letztere Annahme zu unbestimmt, theils sind, wie wir oben gesehen haben, die Verhältnisse in der Gletschermasse selber zu wenig bekannt, als daß man dieser oder irgend einer andern Schlußfolgerung den geringsten Werth beilegen könnte; nur so viel läßt sich scheinbar mit Bestimmtheit sagen, daß die Temperatur in einer gewissen Tiefe unter der Oberfläche des Schnees 0° betragen muß. Zu erinnern ist auch noch, daß der Schmelzpunkt des Eises durch Druck auf eine niedrigere Temperatur herabgebracht werden kann; es bedarf sicher eines starken Druckes, um den Schmelzpunkt um einen ganzen Grad zu verändern, aber trotzdem kann dies eine Rolle spielen.
In der Tiefe, wo die Temperatur auf 0° oder vielmehr auf den Schmelzpunkt des Eises gestiegen ist, sind also alle Bedingungen für das Schmelzen des Eises vorhanden. Nur einzig und allein infolge der inneren Wärme der Erde muß naturgemäß ein Schmelzen auf der Unterfläche des Eises vor sich gehen; je dicker die Eisschicht ist, desto dicker muß folglich auch die Schicht sein, in welcher die Temperatur auf dem Schmelzpunkt steht, und desto stärker muß das Schmelzen werden. Daraus ersieht man, daß eine Vermehrung der Massen auf der Oberfläche infolge der Niederschläge das Schmelzen in der Tiefe reguliren muß. Außer der innern Wärme kommt noch eine andere Wärmequelle hinzu. Durch die ganze Bewegung der Eismassen muß sich unter dem ungeheuren Druck eine heftige Reibung sowohl nach unten zu als auch zwischen den niedrigeren Schichten der Massen entwickeln. Diese Reibung erzeugt aber Wärme, und diese Wärme, — sie mag nun groß oder klein sein — muß nothwendigerweise das Ihre zum Schmelzen mit beitragen. Wir können also behaupten, daß eine Schnee- und Eismasse nur bis zu einer gewissen Höhe steigen kann, indem das Schmelzen auf der Unterfläche den Niederschlägen die Stange halten wird; diese Höhe wird sich nach der Menge des letzteren, sowie nach der Temperatur der Oberfläche richten.[108]
[S. 451]
Daß ein solches Schmelzen in der Tiefe des Inlandseises wirklich vor sich geht, davon habe ich schon im letzten Kapitel des Buches einen Beweis gegeben, den ich selbst beobachtet habe. Uebrigens ist es ein in Grönland ganz bekanntes Verhältniß, daß sowohl im Winter wie im Sommer dem Rande des Inlandseises Bäche entströmen. Daß das Schmelzen, das im Sommer auf der Oberfläche in der Nähe der Ränder vor sich geht, zu unbedeutend ist, um das Vorhandensein dieser Bäche zu erklären, das hat unsere Expedition hoffentlich zur Genüge nachgewiesen; da bleibt denn nichts anderes übrig als die Annahme, daß sich diese Bäche auf der Unterfläche des Inlandseises bilden. Die Wassermasse, die auf diese Weise das Meer erreicht, ist sicher bedeutend größer als diejenige, welche ihm in Form von Eisbergen zugeführt wird. Das Schmelzen in der Tiefe muß also in Grönland eine größere Rolle spielen als die Bewegung der Eismassen, welche den Niederschlägen die Stange halten. Sobald sich die letztere hebt, werden die Massen des Inlandseises im gleichen Verhältniß steigen; sobald sie nachläßt, wird das umgekehrte Verhältniß eintreten. Wie sich die Sache augenblicklich verhält, darüber können wir uns keine Ansicht bilden; nach den vorliegenden Beobachtungen kann, wie man gesehen hat, weder in der einen noch in der anderen Richtung irgend eine Veränderung vor sich gehen. Allerdings ist die Sage von dem Wachsen des Inlandseises sehr verbreitet unter den Eskimos, dies genügt jedoch nicht, um daraus wissenschaftliche Schlußfolgerungen zu ziehen.
Indem ich über die Nothwendigkeit nachdachte, daß eine so starke Abschmelzung, wie sie hier angedeutet worden ist, auf der Unterfläche eines jeden einigermaßen dicken Inlandseises vor sich gehen muß, bin ich zu dem Schluß gekommen, daß man sich dadurch die glacialen Erscheinungen erklären kann, für die man bis dahin noch keine genügende Begründung hat finden können. Ich will hier ganz besonders die sog. „Drumlins“ oder „lenticular hills“ und die „Aaser“ oder die sog. „Kames“ besprechen.
Die ersteren sind Bildungen, welche hauptsächlich in Amerika vorkommen. In Europa findet man sie namentlich in Irland und England. Wir haben sie möglicherweise auch in Norwegen; die eigenthümlichen Hügel, die man an mehreren Stellen findet (z. B. bei Orre), müssen meiner Ansicht nach als solche aufgefaßt werden.
„Drumlins“ sind niedrige, längliche und völlig regelmäßige, aus Kies und Steinen gebildete Hügel. Die Breite beträgt gewöhnlich die Hälfte oder zwei Drittel der Länge, welche ihrerseits zwischen 200 bis 5000 Fuß schwankt. Die Höhe schwankt zwischen 25 bis 200 Fuß, je nachdem die Ausdehnung groß oder klein ist. Sie liegen stets oben auf den sog. Grundmoränen, die u. a. in Amerika sehr verbreitet sind. Sie[S. 452] haben die Eigenthümlichkeit, daß sie dort, wo sie auftreten, sehr dicht liegen, die Längenachse läuft fast stets parallel mit der der Scheuerstreifen und folglich mit den Bewegungen des Gletschers.
Sie scheinen nicht aus einem Material zu bestehen, das in einem wesentlichen Grade vom Wasser befördert sein kann, sie gleichen dagegen im Bau den Grundmoränen. Sie haben keine Schichtenbildung, wenigstens ist diese äußerst unvollständig, und sie sind sehr kompakt oder möglicherweise stark zusammengepreßt. In ihrem Bau unterscheiden sie sich infolgedessen sehr von den „Aaser“, wie man später ersehen wird.
Daß diese Hügel auf irgend eine Weise durch die Gletscher der Eisperiode gebildet sein müssen, ist sicher, wie dies aber geschehen ist, darüber haben die Geologen sich vergebens die Köpfe zerbrochen. Man hat u. a. gemeint, daß es die Moräne oben auf dem Gletscher sei, die sich hier in größeren oder kleineren Unebenheiten gesammelt habe u. s. w. Erstens aber hat, wie wir oben sehen, keine solche Moräne auf der Oberfläche des Gletschers existirt, und zweitens ist es unverständlich, wie es möglich sein sollte, dies ganze Material zu transportiren und in die Unebenheiten (!) hineinzupacken.
Ich glaube, daß sich diese Hügel ganz einfach dadurch erklären lassen, daß der Gletscher ebensowenig auf der Unterfläche regelmäßig schmilzt, wie er es auf der Oberfläche thut. Ebenso wie im kleinen der Kryokonit sich nicht ganz gleichmäßig, sondern in Löcher herabschmilzt, so müssen sich auch nothwendigerweise bei dem Schmelzen auf der Unterfläche Vertiefungen oder vielmehr Aushöhlungen bilden, die sich mit Kies anfüllen. Diese Aushöhlungen werden sich mehr entwickeln, wenn sich der Gletscher über eine solche Grundmoräne hinbewegt, indem hier kein Mangel an Kies vorhanden ist, der infolge der Bewegung in seiner Vertiefung rundgeschliffen wird und der die Aushöhlung durch die bei der Reibung erzeugte Wärme vertiefen muß.
Daß die Aushöhlung eine sehr regelmäßige längliche Form erhält, und daß die Länge in derselben Richtung liegt, welche die Bewegung beschreibt, versteht sich von selbst. Diese Aushöhlungen können jedoch nur bis zu einem gewissen Grade vertieft werden, der von der Dicke und von dem Druck des Gletschers abhängt, sowie von der daraus erfolgenden Abschmelzung auf der Unterfläche, der Friktion etc. Es ist nämlich klar, daß das Eis ein gewisses Stück nach innen hinein so fest und der Kies so abgekühlt wird, daß die Abschleifung und Abschmelzung auf dem oberen Theil der Unterfläche der Aushöhlung das Gleichgewicht halten kann. Wenn sich der Gletscher zurückzieht, muß der Kies in diesen Unebenheiten in Gestalt der regelmäßigen Drumlins zurückbleiben. Infolge des starken Druckes der Gletschermassen, dem sie ausgesetzt waren, müssen sie nothwendigerweise stark zusammengepreßt und ganz dazu geeignet sein, dem Zahn der Zeit und des Regens so gut Widerstand zu leisten, wie dies der Fall ist.
[S. 453]
Die „Aaser“ bestehen bekanntlich aus ähnlichem Stein- und Kiesmaterial wie diese Hügel, auch liegen sie meistens auf den sog. Grundmoränen. Sie unterscheiden sich indessen von den bereits erwähnten Hügeln dadurch, daß ihr Material mehr verschlissen ist und der Einwirkung des Wassers mehr ausgesetzt gewesen zu sein scheint. Wir haben ferner einen bestimmten, schichtenartigen Bau, der ebenfalls darauf hinzudeuten scheint, daß das Wasser bei ihrer Bildung eine Rolle gespielt haben muß. Die „Aaser“ sind niedrige Bergrücken, die sich über lange Strecken hinziehen, in der Regel in paralleler Richtung mit den Scheuerstreifen oder mit der Bewegung des Eises. In Norwegen haben wir wenige Aaserbildungen, möglicherweise finden sich einige auf Jäderen; in Schweden dagegen giebt es deren viele. In Schottland, England und Irland sind sie häufig; in Amerika verbreiten sie sich über große Strecken.
Die Beobachtungen unserer Expedition vernichten mit einem Schlage alle Erklärungen, die es bis dahin über Aaser oder Bachbildungen auf dem Eise oder in dessen Tunneln gegeben hat; denn erstens fehlen, wie wir bereits gesehen haben, zum wesentlichen die Bäche, und zweitens fehlt das Material völlig, nämlich der Moränenschlamm und der Kies, womit die Rinnen der Bäche und Tunnel ausgefüllt werden sollten.
Meiner Ansicht nach unterliegt es keinem Zweifel, daß die „Aaser“ durch Bäche gebildet sind, und zwar nicht oben auf dem Eise, sondern unter demselben.
Alles Wasser, das durch das Schmelzen des Eises auf der Unterfläche erzeugt wird, muß sich einen Ablauf verschaffen, dies ist aber nur möglich, indem es sich einen Abzug unter dem Eise aushöhlt; selbstverständlich ist es daher nicht die untere Schicht, sondern die obere Schicht, also das Eis selber, an dem das Wasser, indem es durch diese Abzüge fließt, zehrt. Daß die Bäche im wesentlichen derselben Richtung folgen, welche die Bewegung des Eises beschreibt, ist selbstverständlich, da sie sonst gar bald in ihrem Lauf gehemmt würden. Da sich indessen diese Bewegung des Eises zum große Theil nach der Abschrägung der Unterlage und nach den Thälern richten muß, so werden folglich auch die Bäche mehr oder weniger den letzteren folgen, d. h. ihr Lauf wird zu einem gewissen Grade mit der Hauptrichtung der jetzigen Bäche zusammenfallen. Wenn nun ein Gletscher, der auf der Unterseite von solchen Bächen durchschnitten ist, sich über eine sogenannte Grundmoräne hinbewegt, so ist es klar, daß sein Kies sich in die Rinnen der Bachläufe hineinpressen wird, das Zehren des Bachwassers an dem Dache seines Eistunnels wird selbstverständlich noch größer werden, als es zu einer Zeit war, wo sich der Gletscher über festen Grund hinbewegte. Je mehr sich nun aber der Bach aufwärts in das Eis hineinfrißt, desto mehr Kies wird in den Bachtunnel eindringen, und der Bach wird sich nothgedrungen bald über einen Rücken von Kies hinbewegen,[S. 454] der gleich den oben besprochenen „Drumlins“ steigt, bis sich andere Kräfte melden und die weitere Entwickelung hemmen.
Auf der andern Seite ist es klar, daß ein Bach, der infolge eines starken hydraulischen Druckes von innen durch einen geschlossenen Kanal hindurchgezwungen wird, und zwar unter einem so kolossalen Druck, wie das darüberliegende Eis ihn ausübt, in hohem Grade die Fähigkeit besitzen muß, den Kies und die Steine der darunterliegenden Moräne mit sich fortzuführen. Kommt er indessen weiter an den Rand der Eisdecke heran, wo also das Eis selber dünner und infolgedessen der Druck von oben schwächer ist, so vermag er nicht mehr so große Mengen mit sich fortzuführen und muß daher beständig Kies und Steine ablagern, die, auf dem Boden des Bachbettes liegenbleibend, die Spitze des darunterliegenden Rückens bilden; hierdurch aber erhält dieser Rücken einen schichtenförmigen Bau und ein Material, das unter dem Einfluß und dem Transport des Wassers verschlissen ist.
Wenn dann der Gletscher einmal zurückweicht, bleiben diese Kiesrücken unter den Bächen als „Aaser“ zurück. Daß diese nicht allemal in derselben Richtung liegen wie die Thäler, sondern auch quer über dieselben hinweggehen können, ist ganz natürlich, denn der Bach muß, wie wir gesehen haben, im wesentlichen parallel mit der Bewegung des Eises gehen und wenn diese über Thäler hingeht, wird der Bach seinen Lauf natürlich an der einen Seite des Thalbodens hinab- und auf der andern Seite hinauf nehmen, wie dies jeder Bach oder jede Quelle mit unterirdischem Lauf thut. Der „Aas“ wird folglich seiner Zeit in derselben Richtung liegen, wenn nicht der Gletscher bei seinem Rückzug andere, lokalere Bewegungen einschlägt und den „Aas“ zerstört, was natürlich oft der Fall gewesen ist.
Ehe ich diese kurze Zusammenfassung von den wissenschaftlichen Beobachtungen der Expedition abschließe, will ich noch die Luftdrucks- und Windverhältnisse im Innern erwähnen.
Es scheint, als wenn über dem ganzen Innern durchgehends ein verhältnißmäßig hoher Luftdruck liegt, und als ob die Winde in der Nähe der Küste eine auffallende Neigung haben, vom Innern aus nach allen Richtungen dem Meere zuzustreben. Die Hochebene scheint die Bildung der barometrischen Maxima zu begünstigen und in der Regel wenig danach angethan zu sein, Luftdrucksminima oder Sturmcentren quer über das Land gehen zu lassen, doch geben unsere Beobachtungen mehrere Beispiele davon, daß das Innere von den Luftdrucksminima in der Baffinsbucht, der Davisstraße und der Dänemarksstraße beeinflußt werden kann. Wir hatten außerdem Gelegenheit zu beobachten, daß ein Luftdrucksminimum quer über dem Hochrücken gehen kann, indem ein Sturmcentrum am 8. September über uns hinweggeht (vergl. Kapitel XIX). Dies muß,[S. 455] wie Prof. Mohn mir mitgetheilt hat, ein sogenanntes sekundäres Luftdrucksminimum gewesen sein, das sich von einem Hauptminimum abgelöst hat, welches sich einige Tage vorher über der Baffinsbucht befand.
In den Tagen, als wir das Inlandseis verließen und auf das eisfreie Land an der Westküste hinabkamen, beobachteten wir einen vollständig föhnartigen, trocknen und warmen östlichen oder südöstlichen Wind. Dieser kam natürlich vom Inlandseise oder aus der über demselben liegenden oberen Luftschicht herab; daß er aber ganz von der Ostküste her über das Eis gekommen sein sollte, ist nach dem bereits Angeführten eine Unmöglichkeit. Es muß folglich ein feuchter Seewind gewesen sein, der als südwestlicher Wind weiter südwärts über das Inlandseis gekommen ist und der sich dann auf gewöhnliche Weise in einem Bogen über dasselbe hinbewegt hat und wieder als Wind von innen her aus den höheren Luftschichten zu uns gelangt oder über den Rand des Inlandseises herabgesunken ist. Hierin liegt möglicherweise auch die Erklärung für viele der bekannten warmen östlichen Winde an der Westküste Grönlands. Der dänische Meteorolog Adam Paulsen hat schon nachgewiesen, wie unwahrscheinlich es ist, daß diese Winde quer über das Inlandseis kommen sollten, so wie man das früher angenommen hat, aber er schiebt die Ursache ihrer Entstehung auf die lokalen Küstengebirge; darin hat er sicher auch größtentheils Recht, und die Küstengebirge spielen in diesem Falle dieselbe Rolle wie in andern Fällen das Inlandseis.
Dies ist alles, was ich für den Augenblick über die wissenschaftliche Ausbeute unserer Expedition berichten zu können glaube. Wie man begreifen wird, ist noch viel in Grönlands schneebedecktem Innern zu erforschen. Diese Expedition war die erste, die dies Innere durchquerte, und sie hat sozusagen nur Eines ausgerichtet, — sie hat gezeigt, von einer wie großen wissenschaftlichen Bedeutung es ist, das Innere gründlich zu erforschen. Auf unserer Wanderung mußten wir das Hauptgewicht darauf legen, vorwärts zu kommen und unser Leben zu fristen; an wissenschaftlichen Untersuchungen konnten wir nur das ausführen, was sich mit einem eiligen Marsche vereinigen ließ. Kommende Expeditionen aber werden sich an der Hand der von uns gemachten Erfahrungen bequemer einrichten und richtiger zu Werk gehen können; sie werden folglich eine wissenschaftliche Ausbeute mit heimbringen können, gegen welche die unsere nur verschwindend ist.
Möchten sie nicht lange auf sich warten lassen!

[97] Während diese Abhandlung im Druck war, hat der norwegische Geologe H. Reusch in einem Vortrag in Kristiania die von ihm gemachte Entdeckung mitgetheilt, daß sich in Finnmarken glaciale Scheuerstreifen von paläozoischen Schichten befinden; ob es Perm oder Silur ist, weiß man nicht genau.
[98] Ein anderes Verhältniß, das eine solche Annahme scheinbar stützen könnte, ist der Umstand, daß Neu-Seeland durch eine Verschiebung der Achse in einen höheren Himmelsstrich kommen und ein kälteres Klima erhalten würde. Dies fällt merkwürdigerweise mit dem Resultat zusammen, zu dem man gekommen ist, daß nämlich Neu-Seeland zwei Eisperioden gehabt hat, und zwar gleichzeitig mit Nordamerika und Europa, während dagegen die patagonische Eisperiode früher stattgefunden hat, ja sogar in der allerletzten Tertiärzeit (spät-pliocene Zeit), als der Nordpol möglicherweise näher an die asiatische Seite herangelegen hat, als dies jetzt der Fall ist (siehe darüber unten).
[99] Die Observationen weisen ein schwaches Wachsen der Polhöhe für das erste Quartal des Jahres 1889 nach und eine beginnende Abnahme in dem zweiten, die sich dann bis zum Januar d. J. fortsetzt und 0,5″–0,6″ beträgt. (Astron. Nachr. 1889, Bd. 124.)
[100] Der Italiener Fergola hat die zuverlässigen Breitenbestimmungen zusammengestellt, welche eine Veränderung der Polhöhe konstatiren, und kommt zu dem Resultat, daß die Veränderungen, berechnet auf 100 Jahre, sich belaufen auf: in Greenwich −2,4″, Washington −2,8″, Mailand −2,5″, Neapel −2,4″. (Atti de Societa di Napoli. Accad. d. science, Vol. 5, 1873.)
[101] In wie weit die Pflanzenversteinerungen miocen sind, müssen wir freilich dahingestellt sein lassen.
[102] Diese Untersuchungen werden in den nächsten Heften des Archivs für Mathematik und Naturwissenschaften (Bd. 14 u. 15) veröffentlicht werden.
[103] Die Moränenablagerung, die wir am 28. September (Bd. II., S. 165) sahen, hat hiermit nichts zu thun; es war eine gewöhnliche, zwischen zwei Eisströmen gebildete Mittelmoräne.
[104] Daß der Schnee hier durch sein Schmelzen nicht viel dazu beitragen kann, die Sommer verhältnißmäßig kalt zu machen und so bis zu einem gewissen Grad den Temperaturunterschied zwischen Sommer und Winter auszugleichen, so wie dies gewöhnlich der Fall ist, geht daraus hervor, daß das Schmelzen selbst im Hochsommer nur sehr gering ist.
[105] Wie bereits erwähnt, geht kein Schmelzprozeß vor sich, der die Schneemassen auf der Oberfläche verringern könnte. Dies Schmelzen kann folglich auch nicht zu einer Verringerung der Temperatur durch Bindung der Wärme beitragen, da die gebundene Wärme durch den Nachtfrost wieder abgegeben wird.
[106] Man könnte möglicherweise auf den Gedanken kommen, daß die Verdampfung der Schneefläche auch im wesentlichen Grade zu dem Herabsetzen der Temperatur beitragen müsse. Ich bin jedoch der Ansicht, daß das Verdampfen in der kalten Temperatur verschwindend sein muß, da die Luft über der Schneefläche, wie wir nachgewiesen haben, in der Regel sehr mit Feuchtigkeit gesättigt ist und da häufig Niederschläge stattfinden.
[107] Um die konstante Jahrestemperatur zu finden, braucht man gar nicht tief in die Schneeschicht einzudringen.
[108] Also auch aus diesem Grunde kann ein Inlandseis in der Nähe des Randes nicht so dick sein wie weiter nach Innen hinein, da die Temperatur der Oberfläche hier geringer ist. Dies Verhältniß wird jedoch durch die stärkeren Niederschläge am Rande ein wenig ausgeglichen.