
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer
Heimatschutz
Dresden
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Band XIII
Inhalt: Zur Steinkreuzforschung – Das Haus am Zirkelstein – Bäume und Menschen – Herrnhut – Hermann Löns – Ein Führer durchs Dresdner Volkskunstmuseum – Über Erhaltung wurmzerfressener Holzskulpturen – Der Meineid – Das Naturschutzgebiet »Pfaueninsel« bei Potsdam – Maßnahmen zum Schutz der Trappe (Otis tarda) – Der Hautfarn – Die ältesten Steindenkmäler Sachsens
Einzelpreis dieses Heftes 2 Goldmark
Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24
Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden
Bassenge & Fritzsche, Dresden
Dresden 1924
Die Herausgabe und der Versand dieses Heftes hat sich infolge des Umbaues unserer vollständig unzulänglich gewordenen Geschäftsräume verzögert. Wir bitten diese Verzögerung zu entschuldigen. Die Hefte 9/10 und 11/12 kommen noch in diesem Jahre zum Versand.
Da wir von 1925 ab unsere Mitteilungen im direkten Zeitungspostversand verschicken werden, können die Hefte unseren Mitgliedern nur noch in die Wohnungen zugestellt werden, deren Richtigkeit wir auf diesem Umschlag zu prüfen bitten.
Dringend möchten wir unsere Mitglieder bitten, die restlichen Mitgliedsbeiträge, die aus den einzufordernden Kontoauszügen ersichtlich sind, baldigst an uns abzuführen.
Auch unsere Bitte, weiterhin kräftig Mitglieder zu werben, wiederholen wir an dieser Stelle.
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Dresden-A., Schießgasse 24
[225]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
Abgeschlossen am 31. August 1924
Erster Nachtrag zu den zusammenhängenden Schilderungen in Mitteilungen Bd. IV/6, Bd. V/1 und Bd. VI/11/12
Von Dr. Kuhfahl, Dresden
Mit Aufnahmen des Verfassers
Not und Drangsal, Unsicherheit und Gewalttat verknüpft sich im Volksmunde seit Jahrhunderten mit den alten Steinkreuzen.
Sorge und Entbehrung, Zuchtlosigkeit und blutiger Parteizwist lastet heute wiederum auf dem vom Erbfeind geknechteten Vaterland und rückt manchmal das Gedenken an mittelalterliche Zustände mit ihren düsteren Sagen des Mordkreuzproblems vor unsere Augen.
Der frühere lebhafte Meinungsaustausch über Ursprung und Zweck der Steinkreuze ist fast völlig verstummt. Solch friedliche Forscherarbeit, wie sie der Dilettant vor dem Kriege nebenbei zur Erholung und Erbauung treiben konnte, stockt heutzutage schon vor ihrem unerschwinglichen Geldaufwand für Reisen, Photographien und Briefwechsel und erscheint auch mit ihrem unproduktiven Müh- und Zeitopfer als unverantwortlicher Luxus. Aber trotzalledem sollte man versuchen, die begonnenen Studien fortzusetzen, denn nie sind unscheinbare Zeugnisse grauer Vorzeit mehr gefährdet, als in jungstürmerischen Wirrnissen.
Als ich hier im Juniheft des Jahrgangs 1914 mit der Veröffentlichung eines abgeschlossenen Beitrags zur Steinkreuzkunde begann, hatte ich nach jahrelangen[226] Studien und Wanderfahrten etwa zweihundertdreißig vorhandene, sowie sechzig verschwundene alte Steinkreuze im Königreich Sachsen verzeichnet und mindestens ebensoviele in den Nachbargebieten gleichfalls persönlich besucht und festgestellt. Die Darstellung beschränkte sich auf die Steine in wirklicher Kreuzform und ließ die Steinplatten und Findlingsblöcke, die mit ähnlichen Einmeißelungen versehen sind, außer Betracht[1].
Aus mancherlei Umständen konnte ich schon damals mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß in jener Zahl zwar noch nicht alle vorhandenen Steinkreuze Sachsens restlos inbegriffen waren, daß aber doch wohl ein gewisses Maß von Vollständigkeit bei dieser sächsischen Sammlung erzielt und keine überraschende Entdeckung mehr zu erwarten sei. Diese Vermutung hat sich vollauf bestätigt.
In der Folgezeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre wurde von ortskundigen Helfern oder aufmerksamen Wanderern zwar hier und da noch ein verstecktes oder halbversunkenes Steinkreuz ans Tageslicht gezogen, insgesamt beschränkt sich die Zahl dieser neuen Funde aber nur auf 29 Stück. Selbst eine amtliche Umfrage, die im Jahre 1916 auf Anregung des Heimatschutzes durch die Amtshauptmannschaften angestellt wurde, förderte kaum noch ein halbes Dutzend unbekannter Stücke zu Tage. Dagegen zeigte sich das allgemeine Interesse an der Sache in einer reichen Folge von Zuschriften, die mir neben bereits bekannten Steinkreuzen auch alle möglichen andern alten Steine als Kreuze bezeichneten. Dies geschah z. B. mit dem ovalen Denkstein von 1817 beim Bahnhof Frankenberg und dem »Schäferkreuz« bei Limbach i. V. Seit etwa zwei Jahren ist aber auch die Quelle privater Mitteilungen ganz versiegt.
Ich gehe also wohl nicht fehl, wenn ich behaupte, daß sich heute auf sächsischem Staatsgebiet kaum noch ein altes Steinkreuz an sichtbarer Stelle in Dorf oder Stadt, Flur oder Wald befinden dürfte, das in meinen früheren und heutigen Listen noch nicht verzeichnet steht. Dagegen wird man nach den Vorgängen der letzten Jahrzehnte auch in Zukunft bei Aufgrabungen oder Mauerabbruch noch manch verschwundenes Stück wiederfinden können.
Die Frage ausgegrabener und vergrabener Steinkreuze verdient übrigens einmal besonderer Prüfung. Vor zehn Jahren wurde das Fischheimer Kreuz bei Rochlitz (Abb. 78) mitten im Acker in eine mühsam ausgeschachtete Grube geworfen, weil sich die Bauern stets gar so sehr davor gefürchtet hatten. Aus Schlesien berichtet Hellmich (Steinerne Zeugen, S. 6), daß ein ausgegrabenes Kreuz auf Bitten des Besitzers wieder verschüttet und ein anderes nicht am Zaune geduldet wurde; er folgert daraus, daß früher des öfteren solche alte Mäler aus Aberglauben verscharrt worden seien. Prüft man die Umstände nach, unter denen in Sachsen ganz zufällig bei Tiefbauarbeiten das eine der beiden Löbauer (Abb. 79) und das Röhrsdorfer Kreuz (Abb. 80) drei Meter unter der Oberfläche herausgeholt wurden, so gewinnt jene Vermutung sicher an Wahrscheinlichkeit, denn bis in solche Tiefen hat der Block trotz seiner Schwere sicherlich nicht von selbst versinken können.

Das Gesamtergebnis der sächsischen Forschungen nötigt aber auch immer wieder zu der Erkenntnis, daß das einzelne Stück mit seinen sagenhaften oder urkundlichen[227] Zusammenhängen keine entscheidende Bedeutung für die Klärung des Steinkreuzrätsels besitzt, und daß sich das Steinkreuzproblem unmöglich für ein engbegrenztes neuzeitliches Staatsgebiet lösen läßt. Nur durch weitere Sammeltätigkeit, die sich in räumlicher Beziehung über das ganze Verbreitungsgebiet der Steinkreuze in- und außerhalb Europas, sowie über alle auffindbaren urkundlichen Erwähnungen erstrecken muß, läßt sich einmal die Grundlage für eine zweifelsfreie Deutung der ganzen Sitte schaffen. Diese nahezu unbegrenzte Erweiterung der Aufgabe übersteigt aber den Verfügungsbereich des einzelnen Dilettanten; da trotzdem eine gewisse planmäßige Zusammenfassung aller der Kräfte nützlich erscheint, die an verschiedenen[230] Stellen für die Sache tätig sind, so habe ich 1919 in Anlehnung an das Denkmalarchiv des sächsischen Freistaates eine Zentrale für Steinkreuzforschung (Dresden-A., Breite Straße 7) ins Leben gerufen, die sich mit der Sammlung der gesamten Forschungsergebnisse befaßt, Auskünfte erteilt, für die Sammlung oder Erhaltung der alten Mäler zu wirken sucht und die Unterlagen für wissenschaftliche Behandlung der Frage zusammenträgt. Trotz der überaus ungünstigen Zeitverhältnisse ist es mir gelungen, diese Angelegenheit in Fluß zu bringen und an vielen Stellen das Interesse für jene seltsamen Erbstücke deutscher Vergangenheit zu wecken, um die sich die Wissenschaft bisher fast nicht gekümmert hat. Einen ausführlichen Bericht über den Stand der außersächsischen Forschung werde ich gelegentlich an anderer Stelle veröffentlichen.

Mit dieser weiteren Ausdehnung der Steinkreuzforschung, bei der ich bisher nahezu 3000 Standorte in verschiedenen Teilen Europas karteimäßig verzeichnen konnte und zahlreiches Nachrichtenmaterial aller Art zusammenbrachte, befestigte sich aber die in der ersten Schilderung angedeutete Überzeugung[2], daß zu den Steinen in wirklicher Kreuzesform auch die zahlreichen Steinplatten, Säulen oder Naturblöcke zu rechnen sind, die nicht nur ähnliche Zeichen und Inschriften, sowie einen ähnlichen Verwitterungsgrad der alten Steinmetzarbeit aufweisen, sondern häufig sogar mit den Kreuzen in Gruppen beieinanderstehen (vgl. z. B. Abb. 1, 2, 5, 6, Bd. II, Heft 6).

Wenn ich diese »Kreuzsteine«, die ich in meiner früheren Schilderung absichtlich nicht aufgenommen, sondern nur mit einigen Bilderbeispielen (vgl. Abb. 7 und 8) veranschaulicht und erwähnt hatte, auch heute nochmals übergehe, so bestimmen mich dazu wiederum nur äußerliche Gründe. Die Erfahrung hat nämlich gelehrt, daß die Erforschung und Aufzählung solch schlichter uralter Denkmale nur dann auf die nötige Genauigkeit Anspruch erheben kann, wenn sie ohne jede Ausnahme nach gleichen Gesichtspunkten und womöglich von derselben Person untersucht, vermessen und abgebildet werden. Weitaus mehr als die Hälfte aller Mitteilungen, die ich im Laufe der Jahre über angebliche Standorte, Formen und Inschriften von steinernen Kreuzen mündlich und schriftlich erhielt, oder sogar in älteren gedruckten Veröffentlichungen vorfand, stellten sich bei eigener Besichtigung als fehlerhaft, ungenau, ja manchmal sogar als freie Erfindung oder Verwechselung heraus. Infolgedessen nahm ich in mein früheres Verzeichnis nur selbstbesuchte und selbstphotographierte Standorte auf und unterschied diese auch außerhalb Sachsens auf der beigefügten Karte von 1914 schon durch die Zeichnung.
Wenn diese Unzuverlässigkeit der fremden Beobachtung sich bereits bei der ausgeprägten Kreuzgestalt geltend macht, so wäre sie um so mehr bei Steinen zu befürchten, die ohne bestimmte allgemeine Form und ohne genau erkennbare Merkmale draußen in der Natur stehen und die Verwechselung mit alten und neueren Denkzeichen, Grenzmarken, Rainsteinen usw. selbst für den Kenner oft recht nahelegen. Nicht immer hat nämlich eine behauene und herbeigefahrene Platte aus benachbarten Steinbrüchen als Werkstück für das Gedächtnismal gedient und noch weniger hält sich das eingemeißelte Bild oder die Jahreszahl und Inschrift[231] immer in regelrechten handwerklichen Formen, wie sie z. B. der schöne Kreuzstein mit dem Ordensritterkreuz am Kirchweg Königsbrück–Gräfenhain vor dem Steinbruch Jenichen aufweist. (Abb. 81.) Oft vielmehr ist, wie bei Gränze (Abb. 7 von 1914) nur ein roher Findlingsblock der Flur durch ein paar grobe eingehauene Striche hergerichtet worden; gelegentlich sparten sich die alten Denkmalstifter sogar das Herbeischaffen jedes Blockes, und versahen das anstehende Gestein an einer senkrechten Wand oder sonst auf einem auffälligen Felsgebilde mit irgendeinem Kennzeichen, das demselben Zwecke diente, wie anderwärts die Steinkreuze. Urkundliche Nachweise über den Grund der Einmeißelungen fehlen hier natürlich gleichfalls und somit erscheint ein wirklicher Beweis für den Zusammenhang solcher Stücke mit der Steinkreuzsymbolik im allgemeinen vollständig ausgeschlossen. Höchstens im Einzelfall läßt sich aus der Form der Abbildung, aus ihrem Alter und Verwitterungsgrad oder aus der räumlichen Vereinigung mit eigentlichen Steinkreuzen auf gleichen Ursprung schließen. Da ich bei früheren Kreuzfahrten auch schon auf diese Kreuzsteine mit geachtet und zahlreiches Material zusammengebracht habe, so werde ich vielleicht später für den sächsischen Bereich eine besondere Liste aufstellen können. Anderwärts, wo sorgfältig bearbeitete Platten, Steinsäulen und Radsteine fast ausschließlich an Stelle des Kreuzes vorkommen, wie in manchen Teilen Norddeutschlands, in Böhmen, in Mähren usw., wurden sie ohnehin schon zum einheitlichen Bestand gezählt und verzeichnet.

Dem heutigen ersten Nachtrag, den ich meiner Arbeit zur sächsischen Steinkreuzforschung folgen lasse, füge ich Listen über Nachträge, Veränderungen und Neuentdeckungen in gleicher Einteilung und Zählung bei, wie sie 1914 begonnen wurden. Auf verschiedene Anregungen hin habe ich auch ein alphabetisches Verzeichnis aller photographischen Abbildungen des vorliegenden und der früheren drei Hefte bearbeitet, um die Benutzung der Bildersammlung von hunderteins Nummern zu erleichtern. Während ich früher ausschließlich eigene photographische Aufnahmen der Größe 13 × 18 Zentimeter als Vorlagen liefern konnte, habe ich neuerdings bei entlegenen Fundorten auch einige fremde Bilder verwenden müssen. Den drei Urhebern sage ich auch hierdurch verbindlichsten Dank.

Das Interesse an den alten Steinkreuzen, das ich seit Jahren mit meinen Schilderungen zu wecken versuche, hat sich bis heutigen Tages nicht allein in vielen hunderten von persönlichen Anfragen und Zuschriften, sondern häufig auch durch die freiwillige Fürsorge für gefährdete Stücke geltend gemacht. So haben mancherorts heimatliebende Männer persönlich zu Hacke und Spaten gegriffen, um nach vorheriger Anfrage versunkene Steine zu heben und sachgemäß wieder aufzustellen. Das vielfach versetzte Steinkreuz mit der Armbrust am Bahnhof Weißig bei Dresden hat einen malerischen Platz unter den alten Linden auf der nördlichen Straßenseite erhalten. Das schwere Kreuz von Gorknitz bei Pirna, Nr. 66 (Abb. 55 und Abb. 83), das bis an die Arme versunken war, ist herausgeholt[3] und das Oberauer eiserne Kreuz Nr. 153 (Abb. 75 und 84) an gesicherterem Platz in höherer Gestalt wieder aufgestellt worden. Das Gröbaer ist aus dem Gutshof nach der Friedhofsmauer[235] gewandert, in Liebstadt wurden die beiden Kreuze wieder ordentlich befestigt (Abb. 101), in Mügeln auf dem Friedhof erhielt das Kreuz einen neuen Platz (Abb. 100), in Auerbach i. V. ließ der Bürgermeister die beiden vermauerten Stücke (Nr. 3) aus der Ufermauer des Göltzschbachs herausnehmen und zu den beiden andern nach dem Stadtpark bringen, das Crostwitzer Kreuz Nr. 34 erhielt einen anderen Platz (Abb. 85) und schließlich hat man im Herbst vorigen Jahres auch das Fischheimer Porphyrmal wieder zutage befördert, das 1911 in etwas tragikomischer Weise auf dem Acker begraben worden war (Abb. 78).

Einen besonderen Einblick in die Bedeutung der allgemeinen Volkserinnerung gewährt der Fund von Bockwen. Schon 1919 erhielt ich die Mitteilung, daß am Nordrand der Straße Bockwen–Reichenbach bei Meißen ein versunkenes Kreuz liege. Bei eigener Besichtigung fand ich aber nur einen Stein, der wenige Fingerbreit aus dem Boden herausragte; abgerundet und verwittert aussah, und nicht im geringsten auf eine besondere Gestaltung unter der Erde schließen ließ. Ein paar Jahre später wurde ich eingeladen, der Ausgrabung des »Kreuzes« beizuwohnen und tatsächlich kam aus dem gewachsenen Lehmboden nach mehrsonntäglicher harter Arbeit das stattliche alte Mal wieder zu Tage. (Abb. 86.) Jahrhunderte mögen vergangen sein, ehe der schwere Block auf der »Kreuzwiese« am Rande der alten Straße in den festen Grund einsinken konnte und sicherlich ist der Querbalken, über dem bereits wieder Erde und Rasendecke lagerte, auch schon vor vielen Jahrzehnten von der Oberfläche verschwunden gewesen. Trotzdem war die Kunde von dem Kreuz im Volksgedächtnis mit solcher Sicherheit erhalten geblieben, daß eine Gruppe jugendlicher Helfer planmäßig mit Schanzzeug von Dresden und Meißen auszog, um den versunkenen Stein zu heben.
Als Gegenstück hierzu und als Beispiel eines verächtlichen Bubenstreichs schlimmster Sorte sei das schöne Steinkreuz im Großen Garten zu Dresden erwähnt, das seit undenklichen Zeiten schräg über eine steinerne Walze gelehnt am Wege lag (Nr. 45, Abb. 22); im August 1920 ist es nächtlicherweile zerschlagen worden. Die staatliche Gartenverwaltung hat zwar die Trümmer sorgfältig mit Zement zusammengeflickt, das ganze Kreuz aber aus Besorgnis vor neuen Roheiten flach auf den Boden gelegt, so daß es jetzt einen höchst kümmerlichen Eindruck macht.

Zu den neuen Funden sei im allgemeinen bemerkt, daß keines der Stücke irgendwie aus dem Rahmen des früher festgestellten Bestandes herausfällt. In Form und Größe, Alter und Zeichnung, Standort und Gesteinsart begegnen uns auch hier die gewohnten Eigenschaften (vgl. Nr. 77, Abb. 4), insbesondere ist weder ein zweiter Radkreuzstein noch sonst ein künstlerisch verziertes (vgl. Nr. 131, Abb. 2) oder ein ungewöhnlich großes Stück (vgl. Nr. 88 des Verzeichnisses von 1914) dazugekommen.

Von Kreuzen, die mir früher entgangen waren, steht das eine am Friedhof zu Röhrsdorf bei Meißen im waldigen Talgehänge. (Abb. 80.) Es ist 1896 an der Kreuzung der Dorfstraße und des Neustadt-Klipphausener Weges drei Meter tief im Boden gefunden worden, als der Fleischer Lindner einen Abfluß für sein Schlachthaus anlegte. Ein anderes in Form des Antoniuskreuzes steht vor dem Gute Nr. 28 in Schrebitz bei Mügeln, Bezirk Leipzig. (Abb. 87.)
[240]

Zu den neugemeldeten Funden zählt ferner ein kleines Steinkreuz im Pfarrgarten zu Wehlen a. E., das vor etwa zwanzig Jahren an der alten abgebrochenen Kirche beim Umpflastern des Hofes aufgefunden worden ist und unbeachtet dort lehnte. (Abb. 88.) Gleichfalls persönlich konnte ich mich vom Vorhandensein eines Steines in Gestalt des eisernen Kreuzes am obersten Ende von Porschdorf bei Bad Schandau überzeugen (Abb. 89) und ebenso das im Acker ausgegrabene große Kreuz an der alten Dresdner Landstraße beim Elbtalwerk Pirna photographieren. Das letztere ist von sachverständiger Hand mit einem neuen Unterbau ausgestattet worden, da er abgebrochen und nicht mit zu finden war. (Abb. 90.) In Löbau fand sich bei Aufgrabungen an der alten Kittlitzer Landstraße in drei Meter Tiefe ein wohlerhaltenes Steinkreuz und erhielt vom Stadtrat einen Platz am Schnittpunkt der Ziegel- und Mücklichstraße. (Abb. 79.)

Ausführliche Meldungen erhielt ich vom »Beatenkreuz« im Thümmlitzwald bei Leisnig und konnte mich später selbst von seinem guten Erhaltungszustand überzeugen. (Abb. 91.)

Ein weiteres Waldkreuz, dessen Inschrift nur zum Teil lesbar erhalten ist, hatte sich bisher auf Forstabteilung 48 des Grillenburger Forstes unweit der großen Waldwiese der Entdeckung entzogen und wurde mir 1920 von der Forstverwaltung gemeldet. (Abb. 95 und 96.)

Auf eigentümliche Weise habe ich den Anstoß zur Entdeckung eines Kreuzes in Markranstädt gegeben. Beim planmäßigen Durchsuchen alter Karten und Bildersammlungen fand ich auf der Dresdner Stadtbibliothek in Wilhelm Dilichs »Federzeichnungen Kurfürstlicher und Meißnischer Ortschaften aus den Jahren 1626 bis 1629« Bd. III, Bl. 28 auf einer Ansicht von »Ranstädt« im Vordergrund außerhalb der Stadt ein unverkennbares Steinkreuz mit der Bemerkung: »Steinkreuz von Georg dem Bärtigen errichtet«. Nach der Lage von Kirche und Rathausgiebel ließ sich der Standort noch heute ziemlich genau bestimmen und so bat ich den Stadtrat um Nachforschungen. Während die Stadtakten und Kirchenbücher keine Auskunft bieten, fand sich das Steinkreuz selbst überraschenderweise noch wohlerhalten vor; es war lediglich bei einer Wegverbreiterung vom Feldweg nach Schkeitbar weggenommen und in den Vorgarten eines Anliegers gesetzt worden. Da die städtischen Bausachverständigen hierdurch auf solche Altertümer aufmerksam geworden waren, entdeckten sie bald darauf an anderer Stelle der Stadt noch ein zweites Kreuz.

Mit weniger Glück folgte ich einer ähnlichen literarischen Spur in Krimmitschau, wo eine ältere Generalstabskarte von 1880 östlich der Stadt am Weg nach Lauenhain die Einzeichnung »Das Wetterkreuz« trägt. Die Kirchenchronik enthält nichts darüber und auch die Suche am Ort 1919 war vergeblich.

In einer Provinzzeitung fand ich 1921 die Meldung, daß der unermüdliche Heimatforscher Professor Pfau im Rochlitzer Schloßmuseum zwei weitere Porphyrkreuze geborgen habe, die am eigenen Ort nicht mehr aufzustellen waren; auch im Hof des alten Franziskanerklosters zu Meißen a. E. wurde mir ein eingelagertes Kreuz von überraschender Größe und völlig unversehrter Erhaltung nachgewiesen. (Abb. 92.)
[246]
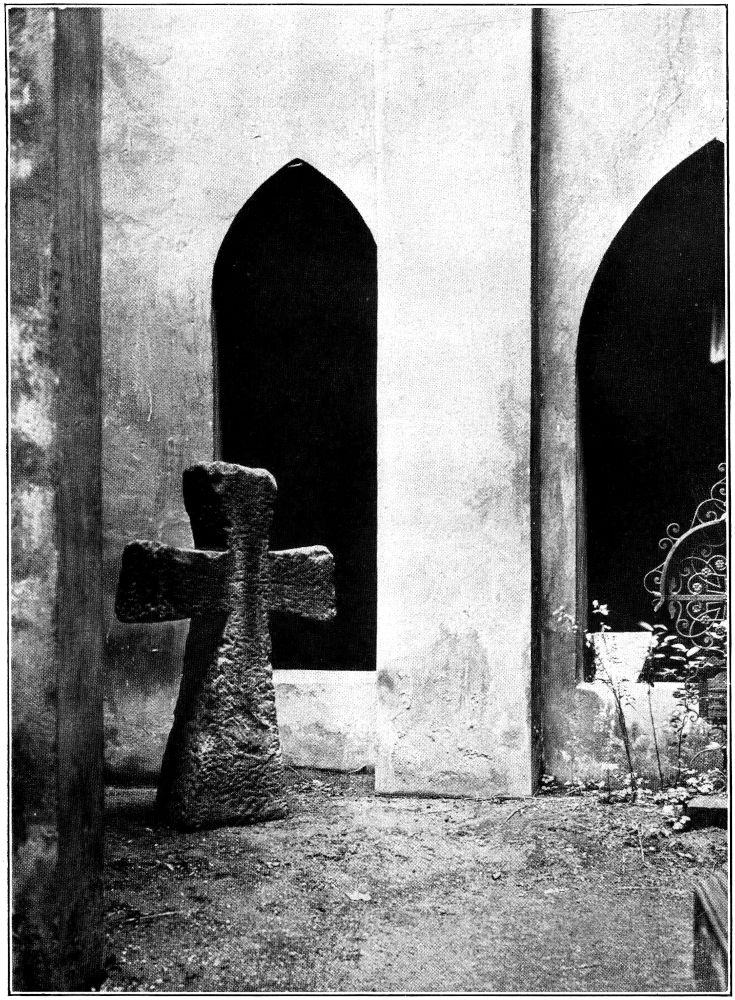
Im Vogtland, wo schon vor Jahrzehnten der verstorbene Steuerrat Trauer besonders eifrige Nachforschungen gehalten und der Vogtländische Anzeiger in Plauen wiederholt längere Beiträge zur Steinkreuzkunde veröffentlicht hatte, wurden seit 1914 noch verschiedene Steinkreuze an offener Straße, darunter in Gospersgrün, Kemnitzbachtal und Kürbitz neu festgestellt. (Abb. 98 und 99.) Das letztere, das an der Außenseite der Friedhofsmauer eingesetzt war (Abb. 97), ist übrigens im Jahre 1923 bedauerlicherweise bei Bauarbeiten völlig verschüttet worden. Ältere literarische Nachrichten sind dazu nirgends vorhanden und nur bei den zwei Gospersgrünern geht die Sage vom gegenseitigen Umbringen zweier Fleischerburschen. Bemerken möchte ich übrigens, daß das sogenannte Schäferkreuz bei Limbach i. V. und das Denkmal an der »Schwarzen Tafel« bei Reichenbach i. V. keine Kreuzesform besitzen und von mir deshalb nicht aufgenommen wurden.
Soweit es mir meine beengten persönlichen Verhältnisse erlaubten, habe ich auch diese neuen Funde – ähnlich wie alle zweihundertsechzig älteren Standorte – selbst besucht und photographiert. Nur bei einigen Stücken im Vogtland und bei Annaberg, von denen ich glaubhafte Kenntnis erhielt, bitte ich andere wanderfreudige Helfer um Nachprüfung und Ergänzung der heutigen Listen nach Gesteinart, Größe, Inschrift und genauem Standort. Anderseits habe ich andere Stücke, die mir ohne jede nähere Bezeichnung nur flüchtig genannt wurden, wie ein Kreuz »beim Harrachsfelsen« bei Braunsdorf und ein Kreuz »in Reuth« bei Plauen i. V., im Interesse der Genauigkeit noch gar nicht ins Verzeichnis aufgenommen, sondern bemühe mich erst, sicheres über ihr Vorhandensein und Aussehen zu erfahren. Die Heimatfreunde jener Gegenden ersuche ich also freundlichst um Unterstützung und Benachrichtigung durch Schrift und Bild.
An literarischen Funden ist für den sächsischen Bereich eine Reihe von Sühne-Urkunden nachzutragen, die Professor Dr. Meiche bei Besprechung meiner Arbeit von 1914 im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde, Bd. XL, Heft 1/2, S. 189 ff. abgedruckt hat. Darin wird unter anderem ein Totschlag auf dem Tharandter Walde erwähnt, bei dem Jocuff Fritzsch den Greger Gunter von Naundorf im Jahre 1492 erschlagen hat. Da Meiche die Urkunde und das verordnete Sühnekreuz am Tatort mit einem der vorhandenen Steinmäler in Verbindung zu bringen sucht, so sei bemerkt, daß »Angermanns Kreuz« auf Forstort 35 des Naundorfer Reviers überhaupt keine Inschriftspur, sondern einen doppelten Kreis und darüber die Zeichnung eines Spitzhammers trägt, dagegen hängt vielleicht das neuentdeckte verstümmelte Stück an der großen Grillenburger Waldlichtung auf Forstabteilung 48, das Meiche noch nicht kannte (Abb. 95 u. 96), mit jener Tat zusammen. Es ist auf der Südseite ganz mit leidlich lesbarer Schrift bedeckt, nur fehlen davon an den abgestoßenen Kanten des Querbalkens rechts und links stets mehrere Buchstaben. Bei verschiedenem Sonnenstand konnte ich am Standorte selbst und später vor allen Dingen durch genaue Betrachtung meines Negatives 13 × 18 Zentimeter, das erfahrungsgemäß eine bessere Entzifferung gewährt, als jede positive Papierkopie, folgendes Schriftbild zusammenstellen:
[247]
1|5|9|2|
GE EGIDII IST G
ITZSCH VON N
EIG⅁EM ALLHIER E
SSEN WORDEN
VASS VIGOTA
PAETZERPIE
IZSCH VND
HANS GVT
KEES HABEN
DIS CREVTZ
MAAL AVF
Die vier großen Zeilen, die durch Horizontallinien von den übrigen getrennt sind, haben sich beiderseits noch auf die stark verstümmelten Kreuzesarme hinauserstreckt, sind aber bis auf den dritten Buchstaben der dritten Zeile, der ein D oder ein verkehrtes G oder C darstellen soll, ganz tadellos erhalten. Dagegen erscheint die Inschrift am Kreuzfuß unter dem zweiten Horizontalstrich stärker verwittert. Wahrscheinlich ist das Kreuz jahrhundertelang, wie manches andere, bis zum Querbalken im Waldboden versunken und dem zerstörenden Einfluß der Feuchtigkeit dadurch am Unterteil stärker ausgesetzt gewesen. Seltsamerweise erscheinen aber innerhalb der zwei Querlinien unter und zwischen den deutlich dastehenden vier Zeilen noch Spuren einer nahezu verwischten Schrift von halber Buchstabengröße, so daß man vielleicht annehmen muß, eine ältere wortreichere Inschrift sei später durch eine größere überdeckt worden. Da die Jahreszahl 1592 zweifelsfrei lesbar ist, so kann also dieses Kreuz oder wenigstens seine jüngere Inschrift mit der Untat von 1492 nicht in Zusammenhang stehen, wiewohl der Name Fritsch, wenn auch mit verwechselter Rolle, hier wiederum vorkommt.
Gleichfalls Dr. Meiches Forschungen im Dresdner Hauptstaatsarchiv verdanke ich die Bemerkung, daß das Kreuz von Boritz (Nr. 16) schon 1540 urkundlich erwähnt wird. Bei der Kirche wurden nämlich »Zinsen vom Feld unter dem steinernen Kreutz« vereinnahmt[4].
Auch über einige verschwundene Kreuze ließen sich noch nachträgliche Feststellungen gewinnen. Wie mir der Bürgermeister Hackebeil von Gottleuba mitteilte, hat er zufällig in alten Akten vom Jahre 1500 gelesen, daß ein Steinkreuz am Hellendorfer Weg einem Bauer als Schleifstein verkauft worden sei. Das fünfte der Königsbrücker Kreuze, das bereits zu Beginn der Steinkreuzforschung um 1890 mit verzeichnet wurde, soll mündlicher Auskunft zufolge im Jahre 1908 beim Bau eines Schuppens am Krankenhaus mit vermauert worden sein.

Das verschwundene Riesaer Kreuz Nr. 54 endlich findet sich auf einer im Heimatmuseum Riesa aufbewahrten Zeichnung des Rektors Bamann von 1866[249] abgebildet; es stand an der Ecke der Poppitzer Straße auf dem Platze des heutigen Restaurants »Stadt Freiberg« und ist seit längerer Zeit verlorengegangen[5].
Mit diesen Bemerkungen sei die Reihe der tatsächlichen Aufzeichnungen geschlossen und im übrigen auf die anhängenden Verzeichnisse I a, b und II verwiesen, in denen ich die Ergänzungen zu meinen Listen von 1914 sowie neue Funde zusammengestellt habe.
An literarischen Arbeiten ist mir in letzten Jahren nur wenig Neues über den sächsischen Steinkreuzbestand oder über allgemeine Fragen des Steinkreuzproblems zu Gesicht gekommen. Zahlreicher dagegen waren Einzelforschungen aus anderen deutschen Gauen, so daß ich einige davon als vorbildlich mit im Literaturverzeichnis III erwähnen möchte, zumal sie natürlich auch über Zweck und Ursprung stets eine Reihe von allgemeinen Betrachtungen enthalten.
Einen Beitrag zur badischen Steinkreuzforschung aus der Feder von Max Walter, Ernsttal, brachten im vorigen Jahre die Heimatblätter »Vom Bodensee zum Main[6]«. Der Verfasser geht, ebenso wie ich, von der Ansicht aus, daß eine Klärung des Steinkreuzproblems erst möglich ist, wenn durch örtliche Vorarbeiten möglichst alle Fundstellen nach Zahl, Standort, Form, Gestein, Sage und Literatur festgestellt sein werden. Demgemäß behandelt er das Gebiet des hinteren Odenwalds, jener Dreiländerecke, die seit etwa hundert Jahren politisch zu Baden, Hessen und Bayern gehörte und vorher kurmainzisch war. Nicht weniger als dreiundsechzig vorhandene und fünfzehn verschwundene Steinkreuze lassen sich hier auf verhältnismäßig kleinem Raum feststellen. Auffällig erscheinen die Versuche zu künstlerischer Formgebung und die häufige Ausstattung dieser Steine mit figürlichen Zeichnungen und Inschriften, die zum Teil auf späte Entstehung bis ins achtzehnte Jahrhundert verweisen.

Bei den ausführlichen Deutungsversuchen lehnt Walter, genau wie ich es für Sachsen getan habe, die Annahme von Grenz- und Hoheitszeichen auch auf Grund der dortigen Befunde rundweg ab; ebenso erscheint die Frage von Gerichts-, Markt- und Wegweiserkreuzen unhaltbar. Das Schwergewicht wird auch hier auf den Zusammenhang mit blutiger Tat, mit dem Sühnegedanken, mit religiösem Ursprung und dem Zwecke des späteren Bildstocks oder Martels gelegt.
Über Mord- und Sühnekreuze in den Muldenkreisen Bitterfeld, Delitzsch usw. schreibt Emil Obst (Bitterfeld 1921) in einer selbstverlegten Broschüre. Neben fünfzig zahlreichen alten und neuen Denkmälern beschreibt er eigentlich nur fünf wirkliche alte Steinkreuze und druckt zur Einleitung drei interessante Bekenntnisse aus der Delitzscher Gerichtspflege von 1474 bis 1503, leider ohne Quellenangabe, ab. Die kleine Schrift bringt damit einige dankenswerte tatsächliche Ergänzungen zur Bestandsübersicht der preußischen Provinz Sachsen und sei deshalb unter Hinweis auf meine Karte von 1914 als Grenzgebiet erwähnt.

Etwas größeren Umfang besitzt eine gleichfalls im Selbstverlag 1923 erschienene Schrift des Liegnitzer Landmessers Max Hellmich über Steinerne Zeugen[252] mittelalterlichen Rechts in Schlesien (Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische). Er gibt an verschiedenen Stellen der Überzeugung Ausdruck, daß die alten Steinkreuze, die den Hauptraum der Broschüre einnehmen, zweifellos in Übereinstimmung mit den vielen bekannt gewordenen Urkunden als Sühnedenkmale zu betrachten seien. Der örtliche Sagenkranz oder die Einzelbezeichnungen, die dem gelegentlich widersprechen, erscheinen ihm genau so wenig beweiskräftig, wie verschiedene Inschriften neueren Ursprungs, aus denen der Charakter des Martels oder Unfalldenkmals hervorgeht.

In besonderen Abschnitten bespricht er die Standorte, die Größe und Gesteinsart, die Ausstattung, die Sagen und Überlieferungen, sowie die Urkunden, deren sechs neue Beispiele abgedruckt sind. Zwei Zusammenstellungen nach Landkreisen und alphabetischer Folge weisen den stattlichen Bestand von fünfhunderteinundvierzig schlesischen Steinkreuzen an vierhundertacht verschiedenen Orten, sowie dreiundvierzig[253] verschwundene Stücke nach. Ortsbeschreibung, Größenmaße und Gesteinsart vervollständigen die Listen, und dreizehn Tafeln mit einfachen Strichzeichnungen veranschaulichen das Aussehen und die Einkerbungen von vierhundertvierunddreißig dieser Steine.
Alles in allem verkörpert gerade diese Arbeit trotz ihres relativ geringen Umfanges eine Unsumme von Mühe und Sammeltätigkeit und bildet einen wertvollen abgeschlossenen Beitrag zu den deutschen provinzialen Forschungen.

Nur nebensächlich ist von Steinkreuzen und von einzelnen sächsischen Stücken in einem Werke des Prälaten Dr. Franz Přicryl »Denkmale der Heiligen Konstantin (Cyrill) und Methodius in Europa« die Rede[7]. Das deutsch geschriebene Buch ist nach verschiedener Richtung bemerkenswert und gründet sich auf dreißigjährige Reisen und Studien, die der geistliche Herr aus persönlichem Interesse unternommen hat. Es ist eigentlich ein echtes Heimatschutzwerk slawischen Inhalts mit allen Vorzügen und allen Schwächen einer fleißigen Dilettantenarbeit. Dagegen muß die[254] Darstellung hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Geltung mit Vorbehalt behandelt werden und erfordert eine besonders kritische Betrachtung, weil ihr Verfasser, als Diener der orthodoxen Kirche durch das Dogma des Glaubens von vornherein in seinem freien Urteil über die Geschehnisse stark beengt erscheint und mit seinen Schilderungen offensichtlich eine Verherrlichung slawischer Kulturanfänge verfolgt.

Die Frage der alten Steinkreuze, die uns hier an dem Buch allein interessiert, ist durchaus einseitig vom kirchlich-legendären Standpunkt aus behandelt. Wie fast alle übrigen Altertümer im slawischen Sprachgebiet, so bringt der Verfasser auch sämtliche Steinkreuze, die er auf seinen Reisen antraf oder sonstwie in Erfahrung brachte, ohne weiteres mit den beiden Slawenaposteln in Verbindung. Selbst der Name »Heilige Quelle, Heiliges Wasser, Heiliger See, Heiliger Hain«, der allerorten einmal wiederkehrt, genügt ihm als Beweis, daß Cyrill und Methodius dort die Heiden getauft und das Christentum verkündet haben. Weder hier noch bei Kirchen- und Klosterbauten aus älterer Zeit wird auch nur der geringste Versuch gemacht, einen geschichtlichen Nachweis irgendwelcher Art zu erbringen. Ohne weitere allgemeine[255] oder einzelne Begründung behandelt er infolgedessen auch jedes alte Steinkreuz als Zeugnis dafür, daß einer der Heiligen an der Stelle geweilt und gepredigt oder wenigstens auf Missionsreisen vorübergekommen sei. Bei dieser vorgefaßten Meinung erwähnt er nicht einmal die nächstliegende und offenkundige Tatsache, daß jene Kreuzsteine nur in gewissen Gegenden vom Volksmunde als Cyrill- und Methodiuskreuze bezeichnet werden.

Anderseits gibt er aber ebensowenig die erforderlichen Erklärungen dafür, daß genau die gleichen Steinkreuze weit über den geschilderten Wirkungskreis der Slawenapostel in ganz Europa von Spanien bis zum Kaukasus, von Norditalien[258] bis in den hohen Norden, ja vielleicht sogar auf brasilianischem Boden in Südamerika zu finden sind; er gibt auch keine Deutung für ihre Mannigfaltigkeit an Größe, Alter, Form, Inschrift und Waffenschmuck, die einen gemeinsamen kirchlichen Ursprung um 800 nach Christi völlig in Frage stellt. Das Vorhandensein von mehreren hundert deutscher und slawischer Urkunden aus dem zwölften bis siebzehnten Jahrhundert läßt dagegen mindestens für einen erheblichen Teil dieser vermeintlichen »Cyrill- und Methodiussteine« einen weit späteren und viel weltlicheren Ursprung vermuten.

Der orthodoxe Prälat Dr. Přicryl verfällt bei seiner Behandlung der Steinkreuzfrage also in denselben Fehler, wie der sächsische evangelische Pfarrer Helbig, der 1906 auf Grund einer engbegrenzten Kenntnis von etwa hundert sächsischen Steinkreuzen, die Theorie verfocht, sie als Grenzzeichen kirchlicher Hoheitsgebiete hinzustellen. Er schwieg sich bis heute über dieselben Fragen aus, an denen die slawische Heiligenlegende scheitert. Nachdem die Zahl der bekannten sächsischen Steinkreuze aber durch weitere Forschungen mehr als verdreifacht ist und noch viele Tausend gleichartiger Denkmäler in Europa verzeichnet worden sind, ist es mit der einst heißumstrittenen Grenzzeichentheorie von selber zu Ende gegangen. In ähnlicher Weise fällt also die Annahme Dr. Přicryls, daß seine fünfzig Kreuze in Mähren, Böhmen und Sachsen samt und sonders auf Cyrill und Methodius hinweisen sollen, auch in sich zusammen, falls sich der Verfasser nicht mit den übrigen europäischen und überseeischen Funden und mit den widersprechenden urkundlichen Belegen in wissenschaftlich einwandfreier Weise auseinandersetzt.

Daß die übrige Behandlung der Steinkreuzfunde bei so unsicherer Grundlage keinen allzugroßen geschichtlichen Wert beanspruchen kann, mag nach einigen Beispielen beurteilt werden, die ich aus bekannten sächsischen Gegenden wähle, die aber natürlich auch anderwärts zu ergänzen wären. So ist folgendes zu lesen, S. 118: »Nach den Denkmalen zu urteilen, begab sich das heilige Bruderpaar um den Cernoboh über Löbau nach Bautzen.« – S. 122: »Zwischen Flins bei Bautzen und dem Heiligen See (Baselitzer Teich) bei Kamenz fand ich zehn Steinkreuze, die von der liebevollen Aufnahme der heiligen Slawenapostel Zeugnis ablegen.« – S. 126: »Mit dem Steinkreuz in Arnsdorf und dem Steinkreuz vor Zittau ist die Rückreise der heiligen Slawenapostel nach Welejrad angedeutet.« – S. 130: »Steinkreuze bezeichnen den apostolischen Weg des heiligen Methodius von Lebus nach Dresden.« – Auf diese Weise würden sich auf der sächsischen Steinkreuzkarte, die meinen ersten Veröffentlichungen in Heft 6 von 1914 beilag, die verschiedensten Missionsreisen im Zickzackkurs einzeichnen lassen.
Auch hinter viele Einzelschilderungen von Steinkreuzen muß man bei näherer Prüfung ein großes Fragezeichen machen, denn neben erweislich unrichtigen Angaben wird manche Sage als geschichtliche Wahrheit aufgetischt, wenn sie sich dazu eignet, die »beiden Zierden der Menschheit« als Heidenbekehrer zu verherrlichen oder den Ruhm des Slawentums im allgemeinen zu mehren.
Nach alledem möchte ich mein Urteil über das Přicrylsche Buch, soweit es die Steinkreuzforschung betrifft, dahin zusammenfassen, daß es uns mit einigen[259] Dutzend neuer mährischer Standorte – ohne nähere Beschreibung der Kreuze – flüchtig bekannt macht, an der Lösung des Steinkreuzproblems aber genau in dem Maße irreführend und verwirrend beteiligt ist, wie seinerzeit die Helbigschen Aufsätze.
Wenn man diese literarischen Veröffentlichungen des letzten Jahrzehntes also nochmals überblickt, so läßt sich zwar erfreulicherweise eine wachsende Tätigkeit bei der örtlichen Aufsuchung der Steinkreuze feststellen, von nennenswerten Fortschritten bei der wissenschaftlichen Forschung und Deutung, ist mir aber nichts zur Kenntnis gekommen.
Für die allgemeinere volkstümliche Ausbreitung des Interesses an der alten germanischen Sitte, erschien es mir schließlich schon früher bemerkenswert, daß das Steinkreuz in der darstellenden Kunst und der Literatur vielfach als charakteristisches Begleitstück deutscher Landschaft in phantasievoller Weise erwähnt oder abgebildet wird. Zu den damals erwähnten Proben (vgl. Bd. VI, Heft 11, Seite 299 und Abb. 77 aus Kaulbachs Reineke Fuchs) ließe sich eine lange Reihe weiterer Beispiele bis herauf zu Liliencron und Löns anführen.
Wichtiger als die einzelne Aufzählung solch dichterischer oder künstlerischer Verwertung aus neuer Zeit, erscheint mir aber die dauernde Ergänzung der alten Urkundsverzeichnisse, soweit sie sächsische Ortschaften betreffen. Neben den von Meiche wiedergegebenen, aus Leipzig usw., seien deshalb zwei unbekannte aus dem westlichen Erzgebirge genannt, die 1487 in Zwickau und 1490 in Schneeberg das Setzen eines Steinkreuzes als Totschlagsühne verlangen und in Herzogs Chronik von Zwickau 1845, II. Teil, S. 149, sowie in Christian Meltzers Stadt- und Bergchronik von Schneeberg, 1716, S. 1166, abgedruckt sind. Im weiteren Verlauf der Forschung wird sich auch für solche Sühneverträge oder Wahrsprüche, die von mir bereits 1914 aufgezählt wurden, eine Fortsetzung der listenmäßigen Zusammenstellung nützlich erweisen, damit die urkundliche Seite der Sache zu den Funden an Ort und Stelle in bestimmte Beziehung gebracht werden kann. Wenn der Sühnegedanke wohl auch nicht der Ursprung und der alleinige Zweck der gesamten Steinkreuzsitte gewesen ist, so dürfte er doch fast ein halbes Jahrtausend lang und bis zum Ausgang der Sache am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts den Hauptgrund für die Errichtung der überwiegenden Mehrzahl abgegeben haben. Ich bitte also bei archivalischen Studien nebenbei auf solche Gerichtsurteile weltlicher oder geistlicher Stühle, auf Wahrsprüche städtischer oder fürstlicher Machthaber, Sühneverträge und Vergleichsurkunden aller Art zu achten und mich durch Quellenangabe und Auszüge freundlichst auch auf diese papiernen Fundstätten aufmerksam zu machen.
Damit schließe ich die textliche Darstellung meiner bisherigen Forschungen zur sächsischen Steinkreuzkunde; neben weiteren Nachträgen hoffe ich, meine nach Tausenden zählenden Steinkreuzfeststellungen im übrigen Europa auch einmal in schriftstellerischer Weise veröffentlichen zu können.
[260]
| Nr. | Standort | Maße | Gesteinsart Ergänzungen |
| 3 | Auerbach i. V.: Zwei Kreuze aus der Ufermauer herausgenommen und gleich den anderen beiden (Nr. 4) im Stadtpark 1921 aufgestellt. Beide standen auf oder neben der alten Göltzschbrücke, die 1883 abgebrochen wurde. | ||
| 34 | Crostwitz bei Kamenz: Am selben Platz im Dorfe beim zugeschütteten Teich 1922 wieder aufgestellt. | ||
| 45 | Großer Garten, Dresden: Im August 1920 böswilligerweise in Stücke zerschlagen. Mit Zement ausgebessert und flach auf den Boden gelegt. | ||
| 63 | Gorknitz bei Pirna: Ausgegraben und am selben Orte 1920 neu aufgestellt. Mitteilungen X, Heft 4/6, S. 85. | ||
| 70 | Gröbern bei Meißen: Aus der Scheunenmauer im Gutshofe herausgenommen und am Dorfplatz aufgestellt. | 78 : 56 : 15 | Sandstein |
| 128 | Liebstadt: Das stehende Kreuz war zerbrochen und wurde auf Stadtkosten 1919 neu aufgestellt. – Das liegende an der Wegweisersäule nach Bertelsdorf wurde gehoben und neu aufgestellt. | 88 : 48 : 23 | |
| 141 | Mügeln bei Oschatz: In der Südostecke des Friedhofes bei der Totengräberwohnung neu aufgestellt. | ||
| 153 | Oberau bei Meißen a. E.: Ausgegraben und am selben Orte neu aufgestellt. | ||
| 187a | Rochlitz: Im Museum. Drei Kreuze aus der Rochlitzer Gegend. | ||
| 222 | Weißig bei Dresden: Am Bahnhof weggenommen und nördlich der Straße unter alten Bäumen in der Wiese neu aufgestellt. | ||
| Nr. | Standort | Maße | Gesteinsart |
| 232 | Bockwen bei Meißen: An der Straße Bockwen–Reichenbach (alter Bischofsweg Meißen–Briesnitz–Stolpen). 1922 ausgegraben und neu aufgestellt. | 122 : 84 : 35 | Sandstein |
| 233 | Böhla bei Großenhain: Beim Birkenwald an der Straße nach Ortrand, etwa 800 m westlich von Böhla. Krummer Säbel. | 120 : 42 : 20 | Sandstein |
| 234 | Dippoldiswalder Haide: In Forstabteilung 54 mitten in jungem Bestand, etwa 180 m nördlich der Straße Malter–Wendischcarsdorf. Erhabenes symmetrisches Kreuz auf der Vorderseite. | 72 : 56 : 22 | Sandstein |
| 235 | Fischheim bei Wechselburg a. M.: Im Herbst 1923 wieder ausgegraben und am schmalen Fußweg, der vor der Steudtener Schänke von der Dorfstraße abzweigt und östlich an den Fischheimer Gütern entlang führt, neu aufgestellt. Messer auf der Vorderseite. | 64 : 55 : 19 | Porphyr |
| 236 | Fürstenwalde bei Lauenstein: Östlich der alten Teplitzer[261] Straße und 600 m südlich des Harthewaldes an einem Feldwege. Inschrift: 1622 G. S. und Bild einer Schere. »Leichenstein«. | 87 : 69 : 21 | Sandstein |
| 237 | Geyersdorf bei Annaberg: Ein Kreuz und ein Bruchstück am Dorfplatz neben der ehemaligen Schule. | [8] | |
| 238 | Gospersgrün bei Treuen i. V.: Zwei Kreuze am sogenannten oberen Teich beim Straßenkreuz. | 50 : 42 : 22 40 : 85 : 24 |
Granit Granit |
| 239 | Grillenburger Wald: Auf Forstabteilung 48 im Nordwestteil. Längere verwitterte Inschrift von 1592. | 98 : 57 : 2 | Sandstein |
| 240 | Haberfeldwald bei Lauenstein: Auf Forstabteilung 56 nahe der Grenze. Inschrift: E. T. 16... | 120 hoch | Gneis |
| 241 | Kemnitzbachtal bei Plauen i. V.: Auf der Bachbrücke im Zuge der Straße Geilsdorf–Staatsstraße Plauen–Hof bei Zöbern. Im Jahre 1915 nach der Frühjahrsüberschwemmung im Bach gefunden. Inschriften: 1862, 1870. | 54 : 58 : 20 | Granit |
| 242 | Kürbitz bei Plauen i. V.: In der Außenwand der Friedhofsmauer südwestlich der Kirche eingemauert. Zwei senkrechte Striche. 1923 beim Wegebau verschüttet. | 92 : 60 : ? | Granit |
| 243 | Limbach bei Reichenbach: Oberhalb der Pfarre. (Mitteilung der Straßenbaubehörde von 1916.) | [8] | |
| 244 | Löbau: Bei Ausschachtungen an der Kittlitzer Landstraße in 3 m Tiefe gefunden und am Schnittpunkt der Mücklichstraße mit der Ziegelstraße aufgestellt. Runde Aushöhlung in der Mitte des Kreuzes. | 105 : 85 : 28 | Sandstein |
| 245 | Markranstädt: Im Vorgarten an dem von der Lützener Straße abzweigenden Weg nach Schkeitbar. Spieß oder Schwert. | 105 : 54 : 16 | Sandstein |
| 246 | Markranstädt: An der Weggabel der Zwenkauer Straße und des Lausaner Wegs. Antoniuskreuz. | ||
| 247 | Meißen a. E.: Seit etwa dreißig Jahren aufgestellt im Hofe des Franziskaner-Klosters (Museum) am Heinrichplatz. Früher am Schweizerhaus beim Eingange des Rauhentales im Triebischtal. | 165 : 102 : 31 | Sandstein |
| 248 | Pirna a. E.: Westlich der Malzfabrik auf dem Gelände der alten Dresdner Landstraße 1922 im Acker ausgegraben. Unterteil ergänzt. Fünf achtfach geteilte Kreuze im Kreis. | 145 : 105 : 30 | Sandstein |
| 249 | Porschdorf bei Bad Schandau: Im obersten Ortsteil vor Haus 32. | 59 : 53 : 26 | Sandstein |
| 250 | Röhrsdorf bei Meißen: Vor dem nordöstlichen Friedhofspförtchen als Kriegerdenkmal aufgestellt. 1896 bei Aufgrabungen in 3 m Tiefe unter der Dorfstraße gefunden. | 87 : 56 : 21 | Sandstein |
| 251 | Schönau bei Borna, Bez. Leipzig: Bruchstück. Vorderseite Beil; Rückseite: Schwert ohne Griff. | 50 : 30 : 25 | Porphyr |
| 252 | [262]Schönau bei Bergen östlich Plauen: Im Dorfe. (Mitteilung der Straßenbaubehörde.) | [8] | |
| 253 | Schrebitz bei Mügeln, Bez. Leipzig: Antoniuskreuz. Vor dem Gute Nr. 63 am Gasthof. | 66 : 52 : 21 | Granit |
| 254 | Thümmlitzwald bei Leisnig: Im Forstort 29 einige Schritte nordwestlich vom Griesenweg. »Beatenkreuz«. | 72 : 63 : 24 | Sandstein |
| 255 | Stadt Wehlen a. E.: Um 1900 beim Umpflastern des Pfarrhofs neben der alten abgebrochenen Kirche gefunden. Im Pfarrgarten vorläufig aufgestellt. Inschrift 1750. | 70 : 39 : 12 | Sandstein |
| 256 | Wiesa bei Annaberg: In der Grundmauer des Hauses Nr. 65 auf der nach der Dorfstraße gelegenen Seite eingemauert. | [8] | |
| 257 | Zaulsdorf bei Oelsnitz i. V.: Beim Dorfe. (Mitteilung der Straßenbaubehörde von 1916.) | [8] | |
| Nr. | Ort | Zahl der Kreuze | Erwähnung |
| 19 | Falkenstein i. V. | – | Das Kreuz war mit der Zeichnung eines ungespannten Bogens und eines Pfeils versehen. (Mitteilung von Lehrer L. Viehweg in Bad Elster von 1919.) |
| 28 | Helmsdorf | – | Abgebildet in »Über Berg und Tal«, 1904, S. 300. |
| 33 | Königsbrück | 1 | Das fünfte der dortigen Kreuze (Nr. 109–111) ist 1908 beim Bau eines Schuppens am Krankenhaus mit in die Erde geworfen worden. |
| 68 | Falkenstein i. V. | 1 | Bis zum großen Brand der achtziger Jahre in einer engen Gasse nach Grünbach zu. Mitteilung von Fräulein E. v. Cotta. |
| 69 | Gottleuba, am Hellendorfer Weg | 1 | Nach einer Aktennotiz vom Jahre 1500 an einen Bauer als Schleifstein verkauft worden. |
| 70 | Kamenz | 1 | Vgl. Störzner: Was die Heimat erzählt. S. 252 und 285. |
| 71 | Nieder-Reinsberg b. Nossen | 1 | Beim Aufgang zum Schloß auf dem Mühlgrundstück in der Nähe des Mühlgrabens. Mitteilung von W. Krumbiegel, Klotzsche. |
| 72 | Schöneck i. V. | 3 | Bis 1882 auf einer Wiese vor der Stadt. Mitteilung von Fräulein E. v. Cotta. |
| 73 | Trieb bei Falkenstein i. V. | 1 | Früher an der Falkensteiner Straße. Beim Bau eines Bauernhauses als Mauerstein verwendet. Heimatschutzakten betr. Kulturdenkmale, S. 39. |
| 74 | Unterlauterbach | 1 | Beim Dungerschen Gute. Beim Straßenbau zerschlagen worden. Heimatschutzakten betr. Kulturdenkmale, S. 39. |
[263]
Charles Darwin, Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries visited during the voyage of H. M. S. Beagle: Round the world. London. Verlag John Murray 1860. Seite 26 enthält eine Notiz vom 19. April 1832 über einen Ausflug von Rio de Janeiro: »The road is often marked by crosses in the place of milestones, to signify where human blood has been spilled«.
Vogtländischer Anzeiger und Tageblatt vom 13. August 1916, S. 14. Beschreibung der Kreuze von Kürbitz und Kemnitzbachtal.
Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Alterstumskunde. XL, Heft 1/2, S. 189. Zur Steinkreuzforschung. Von Alfred Meiche. Besprechung der Arbeit von Dr. Kuhfahl, in Mitteilungen 1914 bis 1916, mit Angabe neuer Sühneurkunden usw.
Dresdner Anzeiger vom 20. April 1919. Dr. Kuhfahl: Zur Steinkreuzforschung. Ebenda vom 6. Mai 1914, Dr. Kuhfahl: Aus dem Sagenkreis der alten Steinkreuze. Ebenda vom 11. Mai 1924 mit illustrierter Beilage: Alte Steinkreuze im Dresdner Weichbild, von Dr. Kuhfahl.
Monatsschrift für Photographie, März 1919, Berlin. Dr. Kuhfahl. Photographische Steinkreuzforschung.
Emil Obst, Über Mord- und Sühnekreuze in den Muldenkreisen Bitterfeld und Delitzsch. 2. Auflage. Selbstverlag. Bitterfeld 1921.
Dr. Franz Přicryl, Denkmale der Heiligen Konstantin und Methodius in Europa. Wien 1920. Verlag von Heinrich Kirsch.
Max Walter, Ernsttal, Baden. Steinkreuze des hinteren Odenwalds in »Vom Bodensee zum Main«, Heimatblätter Nr. 25. 1923.
Wilhelm Lange, Über Steinkreuze in Touristische Mitteilungen aus beiden Hessen usw. 1909 Nr. 2 und 3, 1910 Nr. 5. (Besprechung hessischer Standorte.)
Gustav Metscher, Märkische Sühnekreuze in Deutsche Zeitung vom 23. Juli 1921.
Karl Zimmermann, Zur Steinkreuzforschung, in Mitteilungen des Nordböhmischen Vereins für Heimatforschung. Leipa 1919, Heft 2 bis 4, S. 80. (Besprechung der Dr. Kuhfahlschen Arbeit von 1914 bis 1915. Kleinere Nachrichten.)
E. Mogk, Zur Deutung der Steinkreuze in Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde. 1919, Heft 12.
R. Krieg, Die Steinkreuze im Harz. Zeitschrift »Der Harz«, September 1922, S. 113.
Rottler, Kreuzsteine und Steinkreuze im Bezirk des Landbauamts Bamberg in »Deutsche Gaue«. 1920, Heft 407 bis 410.
Max Hellwig, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechts in Schlesien (Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische). Liegnitz 1923, Selbstverlag. 8°, 34 S. 13 Bildertafeln.
Über Berg und Tal. 1924. Die alten Steinkreuze der Sächsischen Schweiz, von Dr. Kuhfahl.
Rund um den Geisingberg, Monatsbeilage des Boten vom Geising. Januar, Februar und März 1924. Mord- und Sühnekreuze, von A. Klengel, Meißen a. E. Allgemeine Schilderung der Steinkreuzsitte, sowie Einzelbeschreibung der Erzgebirgischen Standorte im Umkreis vom Geising.
nach Dr. Kuhfahl seit 1914
Abbildungen Nr. 1 bis 25 in Heft 6, Bd. IV, Nr. 26 bis 65 in Heft 1, Bd. V, Nr. 66 bis 77 in Heft 11, Bd. VI, Nr. 78 bis 101 im vorstehenden Heft
| 26 | Auerbach i. V. |
| 39 | Auligk bei Pegau |
| 34 | Basteiwald bei Rathen |
| 45 | Bautzen |
| 8 | Bautzen (Kreuzstein) |
| 69 | Beutha bei Hartenstein |
| 78 | Bockwen bei Meißen |
| 82 | Böhla bei Großenhain[264] |
| 14 | Boritz bei Riesa |
| 46 | Börnersdorf bei Lauenstein |
| 33 | Borsbergwald bei Pillnitz |
| 25a | Burk bei Bautzen |
| 59 | Burkhardswalde, siehe Sachsendorf |
| 5 | Chursdorf bei Penig |
| 62 | Claußnitz bei Burgstädt |
| 65 | Colditz |
| 52 | Colditzer Wald |
| 85 | Crostwitz bei Kamenz |
| 21 | Demitz bei Bischofswerda |
| 93 | Dippoldiswalder Haide |
| 37 | Dohna bei Pirna |
| 22 | Dresden, Großer Garten |
| 32 | Eichgraben bei Zittau |
| 78 | Fischheim bei Wechselburg a. M. |
| 43 | Frauenhain bei Großenhain |
| 42 | Gatzen bei Pegau |
| 74 | Geising |
| 56 | Glashütte |
| 55 u. 83 | Gorknitz bei Pirna |
| 98 | Gospersgrün bei Plauen i. V.[10] |
| 53 | Gottleuba |
| 81 | Gräfenhain bei Königsbrück (Kreuzstein) |
| 7 | Gränze bei Kamenz (Kreuzstein) |
| 95, 96 | Grillenburger Wald |
| 72 | Gröbern bei Meißen |
| 28 | Großcotta bei Pirna |
| 22 | Großer Garten, Dresden |
| 9 u. 10 | Großraschütz bei Großenhain |
| 4 | Großröhrsdorf bei Pirna |
| 20 | Grünstädtel bei Schwarzenberg |
| 11 | Hausdorf bei Kamenz |
| 65a | Heidenholz bei Börnersdorf |
| 17 | Hertigswalde bei Sebnitz |
| 19 | Höckendorf bei Königsbrück |
| 25 | Jahnshain bei Penig |
| 76 | Jauernick Bez. Görlitz[9] (außerhalb Sachsens) |
| 40 | Kamenz |
| 99 | Kemnitzbachtal bei Plauen i. V.[10] |
| 68 | Klaffenbach bei Chemnitz |
| 47 | Kleinwolmsdorf bei Radeberg |
| 66 | Knatewitz bei Oschatz |
| 64 | Königsbrück |
| 58 | Kreckwitz bei Bautzen |
| 97 | Kürbitz bei Plauen i. V.[11] |
| 16 | Langenhennersdorf bei Pirna |
| 71 | Leppersdorf bei Radeberg |
| 101 | Liebstadt |
| 79 | Löbau |
| 15 | Lommatzsch |
| 2 | Luga bei Bautzen |
| 67 | Mannewitz bei Pirna |
| 92 | Meißen a. E. |
| 100 | Mügeln bei Oschatz |
| 35 | Nauleis bei Großenhain |
| 27 u. 49 | Neukirch bei Königsbrück |
| 24 | Niederschlottwitz bei Dippoldiswalde |
| 75 u. 84 | Oberau bei Meißen |
| 12 | Oberfrauendorf bei Dippoldiswalde |
| 38 | Oberseifersdorf bei Zittau |
| 51 | Oehna bei Bautzen |
| 23 | Ölsen bei Pirna |
| 36 u. 66 | Ölzschau bei Bad Lausigk |
| 1 | Oschatz |
| 31 | Oßling bei Kamenz |
| 3 | Oybin |
| 90 | Pirna a. E. |
| 89 | Porschdorf bei Bad Schandau |
| 54 | Radibor bei Bautzen |
| 48 | Ralbitz bei Kamenz |
| 94 | Rathendorf bei Penig |
| 30 | Reinholdshain bei Dippoldiswalde |
| 80 | Röhrsdorf bei Meißen a. E. |
| 18 | Rosenthal bei Königstein |
| 59 | Sachsendorf bei Wurzen (Burkhardswalde) |
| 63 | Schmerlitz bei Kamenz |
| 13 | Schönau bei Borna |
| 29 | Schönfeld bei Pillnitz |
| 87 | Schrebitz bei Mügeln |
| 61 | Schwand bei Plauen |
| 57 | Seifersdorf bei Radeberg |
| 50 | Thoßfell bei Plauen i. V. |
| 91 | Thümmlitzwald bei Leisnig |
| 6 | Waltersdorf bei Liebstadt |
| 88 | Stadt Wehlen |
| 44 | Weifa bei Niederneukirch |
| 70 | Zittau |
| 41 | Zschoppelshain bei Mittweida |
Fußnoten:
[1] Vgl. Mitteilungen Bd. IV, Heft 6, S. 202.
[2] Mitteilungen Bd. IV, Heft 6, S. 202.
[3] Vgl. Mitteilungen X 4/6 S. 85.
[4] Dresdner Lokalvisitation samt derselben Instruktion 10599/1539 Blatt 134 b.
[5] Vgl. auch Mitteilung des Vereins für Sächsische Volkskunde 1899. Heft 12, Seite 11.
[6] Nr. 25/1923, Verlag von C. F. Müller, Karlsruhe.
[7] Verlag von Heinrich Kirsch, vorm. Mechitharisten-Buchhandlung, Wien 1920.
[8] Genauere Angaben und Photographien erbeten.
[9] Aufnahme von Rittergutsbesitzer von Craushaar auf Jauernick.
[10] Aufnahme von Curt Sippel, Plauen i. V.
[11] Aufnahme von Werner Rosenmüller, Hamburg.
[265]
Von Dr. Kurt Schumann, Dresden
Mit Bildern von Walter Möbius
Die Verse sind nicht von Schiller oder von Mörike, sie sind überhaupt nicht dichterisch wertvoll; die Reime sind nicht neu und die Stimmung ist etwas sentimental, aber gut sind sie doch, denn sie spiegeln die Liebe einfacher Menschen zu einem Werk, das sie in gemeinsamer Arbeit geschaffen und dessen sie sich in gemeinsamer Freude freuen.
Als die Bewegung der Naturfreunde seit Beginn dieses Jahrhunderts lebhaft aufblühte, mußte es natürlich ihre erste Sorge sein, für die zumeist minderbemittelten Mitglieder Übernachtungsgelegenheit für Wanderungen und Heime zu schaffen. So erklärt es sich, daß jetzt weit über hundert Naturfreundehäuser in allen Teilen der Welt vorhanden sind. Von diesen liegt die Mehrzahl in unsern deutschen Mittelgebirgen, im Schwarzwald wie im Taunus, im fränkischen Jura wie im Teutoburger Walde, im Erzgebirge wie in der Sächsischen Schweiz. Erst kürzlich wurden hier dem Reichsfiskus am Königstein einige Pulverhäuser abgemietet, die teils als Jugendherberge, teils als Naturfreundehaus dienen. Sie bieten Unterkunftsmöglichkeit für fünfhundert Wanderer und wenn sie auch, da nicht zu dem jetzigen Zweck erbaut, kleine Mängel inbezug auf Einrichtung und Aussehen aufweisen, so helfen sie doch gerade in dieser Gegend einem sehr brennend gewordenen Bedürfnis ab.

Ganz andrer Art ist das »Haus am Zirkelstein«. Schon seine Lage unterscheidet es vorteilhaft von den eben genannten Unterkunftshäusern. Während sie nahe den Brennpunkten des Touristenverkehrs an nicht gerade übermäßig landschaftlich bedeutsamer Stelle sich finden, liegt das Zirkelsteinhaus in dem Teil der Sächsischen Schweiz, der glücklicherweise noch nicht überlaufen ist, obwohl gerade hier eine Fülle schöner Landschaften aneinanderstoßen. Im Osten begrenzen die beiden Zschirnsteine, die wie zwei Adlerflügel auseinanderstreben, die Ebenheit, auf der Wolfsberg, Kaiserkrone und Zirkelstein liegen. Der nach Süden schweifende Blick fällt in den gewaltigen Elbkañon bei Niedergrund, den man am besten von den etwa eine Viertelstunde von der Hütte entfernten Sandsteinklötzen überblickt, die die Mündung des romantischen Gelobtbachtals flankieren. Die Ostaussicht gehört zum Schönsten, was man überhaupt in einem deutschen Mittelgebirge sehen kann. Da steigt zur Linken des der Hütte gerade gegenüber mündenden Kamnitztals das mächtige buchengeschmückte Basaltmassiv des Großen Winterbergs auf, an den sich im Norden die hier mehr wuchtig als grotesk wirkenden Schrammsteine, im Süden die Silber- und Flügelwände am Gabrielensteig anschließen. Im Süden aber[266] erheben sich die ganz anders gearteten Gipfel der böhmischen Basalt- und Klingsteinvulkane, deren heitere Formenwelt den italienkranken Ludwig Richter von seiner Sehnsucht nach den Albaner Bergen zu heilen vermochte.

Infolge dieser glücklichen Lage kann die Hütte wochenlang als Stützpunkt für die verschiedensten Wanderungen dienen. Aber sie ermöglicht es auch, das Haus jedesmal auf einem anderen und andersgearteten Wege zu erreichen. Selbst der Aufstieg von der nur zwanzig Minuten entfernten Bahnstation Schöna bietet eine Fülle von prächtigen Eindrücken. Nach wenigen Schritten von der zum Dorf Schöna führenden Straße abbiegend steigen wir in einer Schlucht aufwärts, von der immer neue Blicke sich öffnen auf die Klamm des Kamnitzbaches, das in ihr liegende Herrnskretschen und den Elbspiegel. Am Ende der Schlucht bringt uns ein scharfer Geländeknick an den Hang eines diluvialen Elbtals, bis endlich bei einem neuen Wechsel der Neigung der Blick auf den Zirkelstein und die Hütte mit ihrem hellen Sandsteinunterbau, der warmen Holzverschalung und dem roten Ziegeldach fällt. Aber nicht minder reizvoll ist der Weg von der Station Schmilka über das Waldhufendorf Schöna an der Kaiserkrone vorüber und durch die Schönaer Felder um den Zirkelstein herum, dessen Besteigung sich trotz seiner geringen Höhe ebenso lohnt wie der seiner dreizackigen Nachbarin. Noch schöner ist’s, wenn man die Hütte als Ziel einer Tageswanderung auf den Tagesplan setzen kann. Wer die belebten Gegenden nicht missen möchte, wandert von Königstein über Gohrisch und die dahinter gelegene Felsenregion (Papststein, Gohrisch, Kleinhennersdorfer Stein) nach dem hübschen Dörfchen, nach dem der letztere genannt ist, besucht von hier[267] aus die idyllische Liethenmühle oder den aus der Mode gekommenen Kohlbornstein und erreicht dann Schöna über den Wolfsberg oder das langhingezogene und trotzdem durchaus nicht langweilige Reinhardsdorf. Ich bin im letzten Winter diesen Weg auch einmal mit Schneeschuhen gefahren und dabei auf meine Rechnung gekommen, zumal er eine Reihe für bescheidene Gemüter sehr reizvoller Abfahrten einschließt. Wie schön ist ferner der Weg durchs Krippental oder über die Lasensteine zur Rölligmühle und von dort über den Kleinen nach dem Großen Zschirnstein, dem höchsten Berge der eigentlichen Sächsischen Schweiz, dessen Aussicht schon Schiffner 1840 mit folgenden Worten rühmt: »Im Norden ist die Aussicht durch den Berg selbst unterbrochen, übrigens aber ein Panorama vom höchsten Reichtum und wahrer Großartigkeit, so daß es, abgesehen von der hier mangelnden Elbe, jenem des Winterbergs mindestens gleichsteht. Insbesondere stellt das Niederland sich hier deutlicher, der sichtbare Teil Böhmens schöner dar, und das Riesengebirge zeigt hier mehr Höhen als dort, unter welche jedoch nur der Irrtum auch die Schneekoppe gebracht hat.« Recht niedlich und glücklicherweise auch für andere noch nicht von den üblen Zeitgenossen entdeckte Aussichtspunkte passend ist der Satz, den er seiner Panoramabeschreibung hinzufügt: »Obwohl nun der Berg bequem zu besteigen ist, so geschieht dies seitens der Schweizreisenden sehr selten, weil es diesem Panorama nicht nur an Wasser, sondern auch an Bier und Schnaps fehlt.« Materialisten seien trotzdem darauf aufmerksam gemacht, daß bei meiner letzten Klassenwanderung nach dem Naturfreundehaus meine Wandergefährten (ich selbst bin auf diesem Gebiet etwas unbegabt) so viele Maronenpilze auf dem Zschirnsteinplateau[268] fanden, daß wir uns abends in der Hütte ein opulentes Mahl bereiten konnten, bei dem alle satt wurden, und wir außerdem noch einen Rucksack voll mit nach Dresden brachten. – Selbst auf die Gefahr hin, daß ich einen oder den andern Leser das nächste Mal auf einem meiner Lieblingsspaziergänge treffe, will ich hier noch auf zwei schöne Wege hinweisen, die in Verbindung mit den Anmarschwegen zum Zirkelstein bequem mitzunehmen sind. Der eine ist der Rundgang um den Kleinen Zirkelstein, der nicht nur wieder eine ganz entzückende Aussicht besonders nach dem Erzgebirge zu bietet, sondern vor allem die Verwitterungserscheinungen des Sandsteins in unübertrefflicher Weise zeigt. Die Zerfressenheit der Wände durch Alaunausblühungen mag mit dazu beitragen, daß man hier im Spätwinter Eisgebilde schauen kann, wie man sie in solcher Schönheit nur an einzelnen Stellen im Polenztalgebiet wiederfindet. Der andre schöne Zugangsweg ist der Grenzweg von Rosenthal nach Schöna. Wer das Bedürfnis hat, einmal stundenlang auf einsamen Waldwegen zu wandern, auf denen er höchstens hier und da einen stillen Teich oder ein klares an bemooster Felswand hinfließendes Wässerlein trifft, dem ist dieser Weg aufs wärmste zu empfehlen. Allerdings kann die Einsamkeit auch ihre Nachteile haben. Wenigstens hätten wir sonst etwas darum gegeben, wenn nach dem Schneefall am Ende des alten Jahrs auch nur ein Skiläufer vor uns diese Strecke schon gefahren wäre. Dann hätten wir nicht von zwei bis gegen sieben Uhr Schneepflug spielen und die schönsten Abfahrten tränenden Auges unsre Bretter hinabschieben müssen.

Doch die Zugangswege zur Hütte haben uns recht weit von ihr weg geführt. Wir kehren also zum Zirkelstein und dem an seinem Fuße sich ausbreitenden auch[269] den Naturfreunden gehörigen Wald zurück, der an drei Seiten das Haus umgibt. Durch die Eingangspforte treten wir zunächst in einen Vorraum ein, der zum Waschen und für die Kleider dient. Von dort gelangen wir in den geräumigen Vorsaal, von dem aus es links in die Küche geht, wo der Hüttenwart und seine bessere Hälfte ihres Amtes warten, obwohl ihnen das, wenn gleichzeitig ein Dutzend andre Parteien sich um den mit allerhand Töpfen besetzten Herd drängen, nicht immer leicht gemacht wird. Trotzdem ist’s auf der Wandbank hinter dem großen Tisch außerordentlich gemütlich. Das wissen andre Leute leider auch, und so bleibt meist nichts weiter übrig, als uns in das kleine Zimmer zurückzuziehen, das ihm gegenüberliegt und mit schönen Steindrucken und einer ausgezeichneten Bücherei geschmückt ist. Das Muster eines ländlichen Festsaals stellt der große Raum dar, der das Haus nach Osten zu abschließt. Mit kräftigen Farben und lustigen Sprüchen sind die Balken und Wandverkleidungen bedeckt, ohne irgendwie in altdeutschen Stil zu verfallen. Der schönste Schmuck des Saals ist aber zweifellos der Ofen, ein gemütvolles Ungetüm, zu dem man schwer seinesgleichen finden dürfte. Aus diesem Saal treten wir hinaus auf eine von Quadersteinen eingefaßte Plattform, wo sich an Ferien- und Sonntagabenden ein fröhliches Leben bei Gesang und Gitarrenklang abspielt. Wer aber die Jugend bei Tanz und Spiel sehen will, der muß auf die große Wiese am Westrand des Wäldchens gehen, die statt der üblichen Ballsaaldekoration die beiden Zschirnsteine und die untergehende Sonne als nie veraltenden Bühnenschmuck besitzt. Im ersten Stock liegen die Einzelzimmer und zwei Schlafsäle, in denen man vom Bett aus den Sonnenaufgang zwischen Kaltenberg und Rosenberg bewundern kann. Mehr ist von einer Sommerfrische wirklich[270] nicht zu verlangen. Da auch der gesamte Boden noch voll Betten steht, ist es möglich, bis an zweihundert Menschen in diesem schönen Hause, das auch elektrisches Licht und Wasserleitung besitzt, unterzubringen.

Wenn man bedenkt, daß der größte Teil des Geschaffenen durch den Idealismus einiger weniger zum Teil in schwierigen Kriegszeiten entstand, in denen man oft Material und Werkzeug von Schandau bis hierher tragen und in dem notdürftig überdachten Keller übernachten mußte, so wird man das Haus mit noch ganz anderen Augen ansehen. Als Heimatschützler aber wollen wir uns freuen, daß trotz diesen Schwierigkeiten hier ein Bau entstanden ist, der in die umgebende Landschaft paßt wie selten einer. Auf vielen Fahrten in einem mehr als zwanzigjährigen Wanderleben habe ich kaum ein Haus gefunden, das den Ansprüchen, die man an ein Wander- und Erholungsheim stellen muß, so entspricht wie das Dresdner Naturfreundehaus. Um so befremdender wirkt es darum, wenn man immer wieder bekannte Wandrer und Wanderführer findet, die sonst in der Sächsischen Schweiz und ihren Herbergen aufs beste Bescheid wissen, die diese Musterhütte nicht kennen. Vielleicht regen diese Zeilen manchen dazu an, diese Unterlassungssünde wieder gut zu machen. Den Naturfreunden aber, die zu Ferien- und Feiertagszeiten hier Freude und Erholung suchen, möge immer Verwirklichung des verheißungsvollen Worts erblühen, mit dem das am Anfang zitierte »Hüttenlied« schließt:
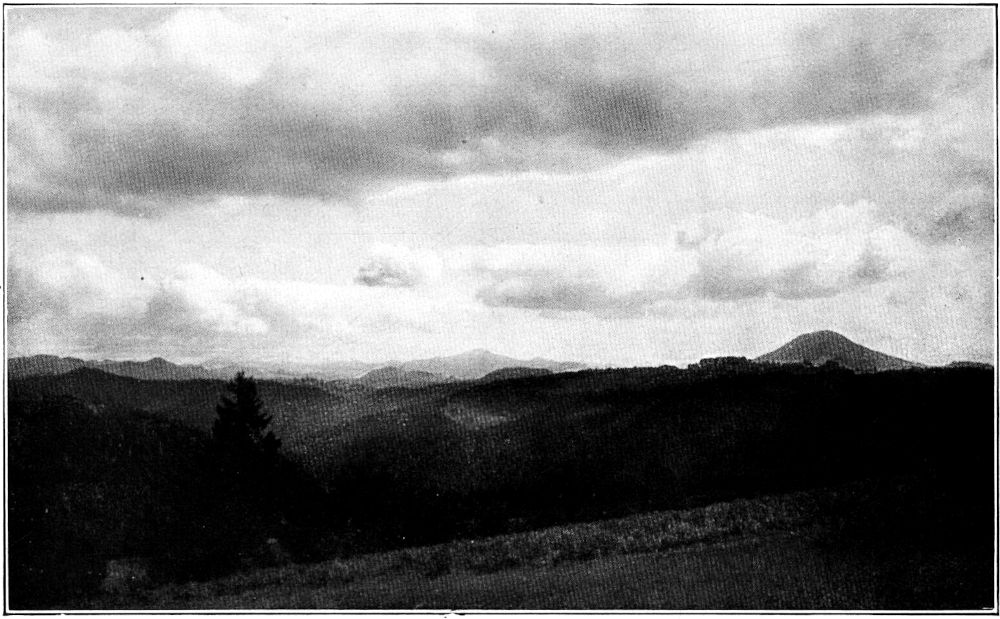
[271]
Erziehungs- und auch Heimatschutzgedanken von Th. Leuschner, Dresden-Loschwitz
Ich liebe die Bäume. Ich habe sie schon immer geliebt. Ob sie dichtgeschart einer neben dem andern im Wald große Landflächen bergauf und bergab mit ihrem satten Dunkel bekleiden – ob ein großer, mit seinen Ästen weitausgreifender Baum auf einem langen Bergesrücken wie ein Wahrzeichen steht, auf Stadt und Land gleich einem Herrscher herabschaut und die Wanderer zu weiter Rundschau herauflockt – ob sie in langer Reihe links und rechts an der Landstraße stehen, ihr weithin sichtbar das Geleite geben und sie von oben herab mit ihren zusammenstoßenden Kronen beschatten – ob die beiden Pappeln wie zwei Wächter hüben und drüben vor der Hofeinfahrt stehen und über den First des Bauernhauses auf die Felder hinausschauen – ob sie in den langen Reihen des Obstgartens regelmäßig ausgerichtet einer neben und hinter dem andern stehen.
Ich liebe die Bäume: ob sie im Winter kahl und schwarz dastehen, daß sie sich bis in ihre feinsten Zweige hinauf von dem grauen Himmel wie ein vielgestaltiges Gewebe abheben – ob sie sich im Lenz mit ihrem ersten helleuchtenden Grün leise schmücken, als wenn sie den Winterschlaf abgeschüttelt hätten – mag dann im Sommer die Sonne in die vielen tausend Spiegelchen des Blätterdaches scheinen – und mag dann der Herbst sie aufleuchten lassen in Gelb und Braun und Rot wie ein Scheidegruß, ehe Sturm und Reif den Kehraus machen.
Ich liebe den Baum: ob die Pappel wie ein Ausrufezeichen in der Landschaft hoch und schlank hinaufwächst und dem leichten Winde gehorchend hin- und herschwankt – ob nun die Eiche am Wegrand ihre gewaltige Laubkrone unbeweglich starr aufbaut, getragen von den dicken knorrigen Ästen, und andern Pflanzenwesen unter ihr Licht und Luft nimmt.
Ich liebe die Bäume. Nur wegen der reichen Form ihrer Erscheinung? Ich fragte mich, ich prüfte mich: es muß noch etwas mehr, etwas andres als diese Äußerlichkeit sein, was mir den Baum so lieb und wert macht. Nicht gleich fand ich eine Lösung. Da fügte es die Zeit. Von einer andern Seite kam ich her und fand, was mir Befriedigung gab. Ich kam vom Menschen her: die Gedanken über den jungen Menschen, über das reifende Kind führten mich zum wachsenden und gewordenen Baum. Ich fand zwischen beiden Wesensverwandtes und Ähnlichkeit.
Das Kind wächst nach einem inneren Gesetz heran und wird zu dem, wozu es werden kann und muß. Die Natur hat dem jungen Menschen allerhand Anlagen, stille Kräfte gegeben, mit der Fähigkeit und dem Streben, sich zu entfalten und in Erscheinung sich auszureifen. Manchmal hat die Natur in einen Menschen eine Anlage niedergelegt wie ein Geschenk, das sie nur selten hier und da von sich loslöst: mitten aus Armut und Niedrigkeit geht gleich einem Licht ein Künstler, ein Denker, ein Erfinder, ein Führer der Menschheit auf: aus sich heraus geworden, allen Widerständen und Hemmungen zum Trotz, als ein Eigner aus Eigenem dastehend. Oft sind die Anlagen ein Niederschlag der Umgebung, eine Mitgabe von Vater und Mutter, eine Selbstverständlichkeit von Familienüberlieferung und -eigentümlichkeit.[272] Das Kind atmet den Geist des Vaterhauses ein, und mit ihm wächst es heran zu einem Menschen, der in den Spuren der Eltern mehr oder weniger weiter geht.
Zu diesem Aussichherauswachsen tritt von außen heran die Erziehung, die Einwirkung durch Persönlichkeiten, die in sittlicher und geistiger Hinsicht dazu berufen sind. Die Erziehung kann darum kein Abrichten, kein zwangmäßiges Einwirken nach einem vorgedachten Plane sein, kein Gestalten und Bilden zu einem von außen her an das Kind herangebrachten Zweck. Erziehung kann nur den Sinn einer Hilfe haben, indem sie Hindernisse beiseite räumt, den Weg bereitet, indem der Erzieher mit ihm geht und es schützt vor Irrtum und Umweg.
Mitten in diese Gedankengänge schaute mir zum Fenster herein von weither die Babisnauer Pappel. Wie manchmal habe ich unter deinem Schatten gelegen und in deine Zweige hinaufgesonnen! Du bist so ein Eigner aus Eigenem, so groß und gewaltig, so breit und rund, so fest und gesund, so frei und selbständig stehst du auf schöner Höhe! Und du, meine liebe Pappel, du Stolz meines Gartens, kommst auch zu mir in meine Gedanken. Als ich dich vor zwanzig Jahren pflanzte, reichte ich mit der Hand an deine Spitze, jetzt ragst du hoch hinaus mit deinen schlanken beweglichen Gerten über das Dach des Hauses. Aus dir ist geworden, was du im Kleinen schon warst und versprachst.
Und nun habe ich es gefunden. Auch ihr Bäume seid Wesen für sich, von Anfang bis zum Ende hin. Auch in euch ist ein Ziel gesetzt von Anfang an. Auch ihr seid belebte, zielstrebige, wollende und müssende Natur. Auch euch hat die Natur eine besondere Anlage mitgegeben und Kräfte, die in dieser Richtung weiter sich entfalten, bis ihr das seid, was in euch ist. Und das werdet ihr ohne viel Erziehung, ohne viel Zutun von außen her. Der Naturfreund pflanzte euch ins Erdreich, dorthin, wo er euch haben wollte. Er gab euch Licht und Luft, er trug euch Wasser an die Wurzel. Und dann überließ er euch eurem Werden. So wie ihr wurdet im Sonnenschein und im Regen, wie ihr Sturm und Ungewitter, Frost und Trockenheit trotztet: er hatte seine Freude daran. So seid ihr mir nun nicht bloß lieb und wert geworden durch euer vielgestaltiges und wechselndes Äußeres – ihr sprecht zu mir aus tiefem verinnerlichtem Sinn, als wenn auch ihr beseelt wäret, als wenn auch in euch ein unsichtbarer Geist nach Verkörperung sich gestaltete.
Doch was soll das hier? Der Ring schließt sich für mich auch hier im Heimatschutz. Ihr Menschen müßt auch diesen Sinn für den Baum erleben. Dann werdet ihr nicht so herzlos einem schönen Baum vor seiner Zeit mit Axt und Säge das Ende bereiten. Ihr werdet ihn schützen und zu erhalten suchen, wie es der nachdenkliche Jukundus im »Verlorenen Lachen« jenem alten stattlichen Eichbaum auf aussichtsreicher Höhe angetan hat. Dann werdet ihr nicht mehr so gedankenlos einem Baum Äste, Zweige und Blüten nehmen, dann werdet ihr ganz anders in seinem Schatten ruhen und den Platz an seinem Stamm in schöner Ordnung zurücklassen. So gut wir einem lieben oder großen Menschen zugetan sind, ihn ehren und uns mit ihm freuen: so wollen wir auch den Baum als ein Stück im tiefern Sinn belebter Natur achten und ehren.
So sind wir auch von dieser Seite her zum Heimatschutz gekommen.
[273]
Ein Stimmungsbild von Susanne Hausdorf
Nichts Historisches mit Daten und Zahlen und Begebenheiten. Etwas von dem eigenartigen Reize dieses wunderlichen kleinen Städtchens möchte ich wiedergeben, das den fremden Besucher seltsam anheimelt, wie ein altes frommes Bildchen aus Großmutters Album. Gewiß, es gibt hübschere kleine Städte, idyllischer, äußerlich reizvoller, mit uralten Bauweisen und romantischen Resten einstiger Ritterherrlichkeit; Städtchen, die an Spitzweg, Schwind, Ludwig Richter gemahnen, aber das eine, ganz Besondere, das hat eben nur Herrnhut. – Ist es die rührende Schlichtheit der Bewohner, die feine, stille Art, wie sie ihr Tagewerk erledigen, ihre Feste feiern, die ganze Gemeinde eine große Familie, in Leid und Freude miteinander verbunden? Ein Hauch von Güte und Vornehmheit umfängt uns unter diesen Leuten und den modernen Großstadtmenschen überkommt ein nachdenkliches Verwundern und dann eine mehr oder weniger tiefe Beschämung. Denn – Hand aufs Herz – zuerst hat er prickelnde Spottlust verspürt über all das »Rückständige«, das ihm dort begegnete. Auf dem kaum fußbreiten »Trottoir« kamen ihm Leute entgegen, die er linkisch und altmodisch fand und belustigt musterte. Aber da sah er unbekümmerte Freundlichkeit und fast kindlich anmutende Arglosigkeit in Gruß und Gebärde. Und weiter, durch offene Fenster blickte er in saubere Zimmer mit blanken alten Möbeln und vielen schneeweißen Häkeldeckchen. Und immer stand da auch ein Blumenstrauß und immer lag da irgendwo auf Tisch oder Fensterplatz[274] das Buch des Hauses: die Bibel. Und von den »altmodischen« Menschen, denen die reine Herzensgüte aus den Augen blickt, von den blanken Stuben mit Häkeldeckchen und Bibel und Blumenstrauß geht ein feiner Zauber aus, der den Spötter von vorhin restlos gefangennimmt. – Die lieben schlichten Häuser! So ein richtiges Herrnhuter Häuschen hat eine spiegelnd geputzte Messingklinke an der Haustür, eine gute alte Schelle dahinter, die chronisch heiser ist und einen kühlen dämmrigen Hausflur, mit weißem Sand bestreut. Eine knarrende hölzerne Treppe führt ins Obergeschoß, manchmal ist sie aus Stein, blütenweiß getont. Hinter dem Hause das Gärtchen, ein liebes verträumtes Hausgärtlein mit einer lebenden Hecke darum; Malven blühen darin und mancherlei Nützliches. – Und dann ist der »Herrschaftsgarten« da, das Schmuckstück des Ortes, für alle zugänglich, von jedermann geschont und respektiert. Wo in der weiten Welt blühen die Rosen schöner, leuchten die Nelken stärker? Ich wüßte mir kein friedlicheres Plätzchen als im Herrnhuter Herrschaftsgarten, an sonnigen Sommertagen! Ein Duften ist da, ein köstliches Gemisch von Rosen, Nelken, Reseden, Wicken und Buchsbaum; und dazwischen duften noch viele längst vergessene Blümlein und Kräuter, die es anderswo gar nicht mehr gibt, so pietätvoll-altväterisch, so gepflegt und anheimelnd wie das ganze Herrnhut selbst. Weiße Bänke unter Linden und Kastanien. Blätterrauschen, Bienensummen, dann und wann behutsame Schritte auf den Kieswegen, Kinderstimmen, irgendwoher die Klänge eines Chorals. Eine Uhr schlägt, tief, versonnen; Schwälblein schwatzen am Hausgiebel irgendwo, alles verhalten, geruhsam, von Frieden durchtränkt.

Der Gottesacker: Eine schmale Lindenallee führt hinauf. Ja und dann steht man verwundert wie in einer großen Buchenlaube und sieht, daß das hier keine Gräber sind, wie wir sie kennen auf unseren Friedhöfen, mit teueren und billigen Grabsteinen, prachtvoll geschmückten Erbgrüften neben verwahrlosten Rasenhügeln. Nein, hier liegen sie alle gleich, die stillen Schläfer und man hat das Gefühl, daß sie wirklich friedlich ruhen unter den schmucklosen Steinplatten. Was sollten hier prunkvolle Monumente und kunstvolles Schmiedewerk, hier, wo Äußerlichkeit nichts, tiefste Innerlichkeit alles gilt! Nur eine schmale Platte mit Namen, Geburts- und Todestag und einem Spruch darunter, kaum handhoch über dem Erdboden. Aber einem jeden Sarg gab die ganze Gemeinde das Geleit, wie sie auch der Taufe und der Trauung jedes einzelnen Mitgliedes beiwohnt und es gibt wohl keinen bedeutsamen Festtag, an dem sie sich nicht zu innigem Gedenken um die Gräber ihrer Verstorbenen versammelt.
Die Kirche? Ja, die übliche Kirche mit Turm und Portal sucht man vergebens. Inmitten des Ortes, von den Häusern und Häuschen umgeben wie eine gute Mutter von ihrer Kinderschar, liegt es, das Gotteshaus. Weiß, schmucklos, mit winzigem Türmchen, das man gar nicht als Kirchturm anerkennen kann. Drinnen in dem einfachen hellen Saal haben sie alle ihren bestimmten Platz: die Alten, die Jungen, die Jüngsten; hüben die Frauen, drüben die Männer. Weiß die Wände, die Emporen, die Orgel; auf weißem sandbestreutem Fußboden die weißen Bänke. Vor den hohen Fenstern, die das Licht ungebrochen hereinlassen, ein dunkel verhangenes Pult, ein besonderer Stuhl dahinter. Hier spricht der Prediger zu seiner[275] Gemeinde. Und er spricht wirklich. Nichts, was Auge und Ohr ablenkt in Farbe und Ausdruck, reines tiefdurchdachtes Gotteswort wird hier gegeben. Hier begreift man mit einemmal diese Menschen in ihrer rührenden Anspruchslosigkeit, ihrer Weltfremdheit, ihrer Treue an ihren Toten.
Krieg und Revolution haben auch Herrnhut ihre Spuren aufgedrängt. Aber das stört nicht weiter; so wenig, wie die paar modernen Stadthäuser zwischen den ehrwürdigen grauen Häuschen. Autos rasen über das holprige Pflaster der Staatsstraße in der Richtung Löbau–Zittau zu, es gibt sogar Sommergäste in Herrnhut, was tut’s? Einer stillen unberührten Insel gleich liegt es ruhig im »brausenden Strom der Zeit« und wer von seinem heilsamen Frieden kostete, der denkt sein mit Heimweh.
Ein Lebensbild
Vortrag im Landesverein Sächsischer Heimatschutz am 12. Oktober 1923 im Vereinshaus
Von Kurt Siegel
Ein wunderlicher Tag geht über die alte Erde. Es schimmert in allen Farben und Stimmungen. Grau im Nebel und grämlich im Regen schleicht er dahin, andächtig und still wandelt er ohne einen Lufthauch – mit wildem Lärmen und Heulen saust er im Winde daher, bis zuletzt alles gegen die Nachmittagsdämmerung hin im sanften Regengeriesel einzuschlummern scheint.
Das ist die heimatliche, heimelige Schummerstunde, wo im Sinnen und Träumen und Dämmern Gestalten kommen, von draußen und drinnen, Gestalten lebendig werden, die einem lieb geworden im Laufe der Jahre – und die Gestalten grüßen aus goldenem Eiland und erinnern an Zeiten, da man selbst noch glücklicher war. Der Heidebusch aber vor mir auf meinem Schreibtische duftet mir heute besonders entgegen und läßt mich träumen von einem, der auch gewesen, mit dessen Werken und Wirken ich mich oft in stillen Stunden beschäftigte. Und die Gedanken flechten sich zu Bildern, und leibhaft ersteht vor meinem geistigen Auge Hermann Löns, dieser moderne Klassiker der Naturschilderung, dieser im geistigsten Sinne urdeutsche Mann. Und meine Gedanken tragen mich mit ihm hinaus in seine Heide, in seine Dörfer und Wälder, hinauf auf die Berge. Ich bin in der schönen, reinsten und heiligsten Natur, ich bin bei dem Besten und Echtesten, was das Leben der suchenden Seele bietet. Durch ihn redet auch heute wieder die Natur zu mir, durch ihn sprechen die Tiere, die Wälder rauschen und die Quellen lächeln. Und Menschen wandeln dazwischen von starker Echtheit und Kraft, von harter Lebenstreue und bitterer Daseinswahrheit, von milder Süße und träumerischer Schönheit, wie sie nur Sinn und Seele eines echten Dichters hegen und hergeben können.
Und was diese stille Stunde in mir geweckt und was ich aus seinen Werken gelesen, das will ich hier noch einmal – in kurzen Zügen – entrollen, will doch auch der Landesverein Sächsischer Heimatschutz diesem edlen Mann in den Herzen seiner Mitglieder ein bleibendes Denkmal setzen.
[276]
Man muß einen Dichter erleben, sonst hat man nichts von ihm.
Hermann Löns, der Dichter, verdient es ganz besonders, ein Erlebnis zu sein. Nur so gewinnt man das richtige Verständnis von ihm. Und das ist ja der Zweck meiner kurzen Worte und des heutigen ganzen Abends. Liebe zu ihm und seinen Werken soll erweckt werden und die Würdigung, die er verdient.
Das aber soll gleich vorweg deutlich ausgesprochen werden: Hermann Löns ist kein »Jagdschriftsteller«, als der er so gern abgezeichnet wird, er ist auch kein »Heimatschriftsteller« oder ein »Heidedichter«, sondern er ist einfach ein Mensch und ein Dichter, wie wir nicht viele gehabt haben und nicht viele haben.
Ein Dichter nimmt das ganze Leben wie eine Dichtung, und jede seiner Dichtungen nimmt er wie das ganze Leben. Darin liegt sein Glück und sein Unglück. Wer ihm das nachfühlen kann, der ist ebenso glücklich oder unglücklich.
Alle die Verwirrungen und Irrungen, an denen das Leben Löns oft krankte, liegen in der tiefsten Seele seiner Dichternatur begründet, und wer hier beschreiben, erzählen und kennen lernen will, der muß gründlich und lange in diese Tiefen hinabtauchen und den Grund klären.
Löns gehört zu denen, denen die Dichtung und die ungeheure Tiefe ihrer Empfindung und Einbildungskraft glühende Male in die Seele brannte, und wo Brandwunden waren, da bleiben Narben, und manche Feuerwunden des Herzens heilen niemals. Wenn er gefehlt hat, so trugen Verwirrung, Verirrung und Krankheit die Schuld daran.
Hermann Löns hat selbst das Beste über sich, sein Werden und Schaffen geschrieben. Das steht im ersten Heft des deutschen Literaturblattes »Eckart« im vierten Jahrgang von 1909.
Löns ist am 29. August 1866 in Kulm an der Weichsel geboren; seine Eltern waren Westfalen. Sein Vater war Gymnasialoberlehrer; seine Mutter Klara geb. Kramer stammte aus Paderborn. Als Hermann ein Jahr alt war, wurde sein Vater nach Deutsch-Krone versetzt, wo die Familie Löns siebzehn Jahre blieb. Seine erste Kindheitserinnerung, die für seinen Sinn recht bezeichnend ist, war, daß er in einem blauen Kittel auf einem gepflasterten Hofe saß und grün und rot gefärbte Blattkäfer in eine Pillenschachtel sammelte. »Mit fünf Jahren lockte mich eine tote Maus mehr als ein Stück Kuchen.« Immer größer wurde seine Liebe zur Natur, vereint mit einem Hange zum Alleinsein; er war auch deshalb meist einsam, weil er sich in dem fremden Lande als Westfale nicht einheimisch fühlen konnte. Meist ganz für sich durchstreifte er Heide, Wälder und Moore und erlebte dabei allerlei Abenteuer:
»Beim Besuch einer Seeschwalbensiedlung, die sich auf einer Insel im Klotzowmoor befand, ertrank ich beinahe. Acht Tage nachher biß mich eine Kreuzotter.«
»Teils durch meinen Vater, teils durch das Leben auf Gütern und Förstereien, auf denen ich meist die Ferien verbrachte, wurde ich Fischer und Jäger, doch war mir schon damals ein unbekannter Fisch, ein seltener Vogel, eine regelwidrig gefärbte Eichkatze von größerem Werte denn ein gutes Geweih oder eine ganze Tasche voller[277] Hühner. – Ich schoß auf meinen ersten Hirsch wie nach der Scheibe, aber als ich in den Sägemühler Fichten eine Schwarzdrossel als Brutvogel fand, flog mir das Herz. Schon damals war ich der Heide angeschworen. Ich konnte vor Freude über die Pracht des maigrünen Buchenwaldes nasse Augen bekommen, aber die Heiden, Kiefernwälder, Moore und Brüche lockten mich doch mehr. Ähnlich ging es mir mit den Menschen; auch bei ihnen lockte mich das Ursprüngliche!«
Seine ursprüngliche Urwüchsigkeit, die er in seinem ganzen Leben und Denken nicht verloren hat, zeigte sich auch in seinem Verkehr: »Ich war ein Freund der Hütejungen, Fischerknechte, Waldarbeiter; meine sehr zivilisierten Mitschüler, die mit achtzehn Jahren Zigaretten rauchten und Fensterpromenaden machten, langweilten mich.« Als Hermann achtzehn Jahre alt war, wurde sein Vater in die Heimat, nach Münster versetzt. Eine Woche Aufenthalt in Berlin machte auf den Jüngling keinen besonderen Eindruck; er erinnerte sich nur noch an das, was er im Zoologischen Garten und im Aquarium sah. Er erwachte gewissermaßen erst, als er jenseits der Elbe die ersten Rabenkrähen erblickte und später bei Paderborn wirkliche, lebendige Salamander fing.
In Paderborn, der Heimatstadt seiner Mutter, entdeckte er seinen Sinn für Geschichte und deutsche Vergangenheit.
»Bisher hatte ich mich ganz als Einzelwesen gefühlt, nun empfand ich Stammesbewußtsein. Stärker wurde es, als ich nach Münster kam, und es waren kaum zwei Jahre vergangen, da war ich bewußt das, was ich unbewußt immer gewesen: Niedersachse.
Ein Heißhunger nach tieferer Bildung kam über mich. Zum ersten Male in meinem Leben arbeitete ich zäh und zielbewußt für die Schule und konnte, als ich eben das Gymnasium verlassen hatte, einige kleine Arbeiten in zoologischen Fachblättern herausgeben, die heute noch in gewisser Weise ihren Wert haben.«
In Münster, Greifswald und Göttingen studierte Löns Medizin und Naturwissenschaften und er war ein recht fröhlicher Student, der sich überall gut durchzusetzen wußte und, wenn es nötig war, eine sehr gute Klinge schlug. Das erwachende deutsche Schrifttum erweckte seine lebhafte Teilnahme; Arzt mochte er nicht werden, die zoologische Laufbahn war gänzlich aussichtslos; so kam es, daß Löns »mit beiden Beinen in das Zeitungsfach sprang.«
Schließlich, nach mancherlei Reisen, die ihn teilweise auch in das Ausland führten, wurde er in Hannover Redakteur und begnügte sich vorläufig damit, auf diesem Gebiet sehr vielseitig und hervorragend zu wirken.
»Wenn ich das Heftchen sah, in das ich als Bursch meine Verse geschrieben hatte, überkam mich ein aus Spott und Mitleid gemischtes Gefühl. Jahrelang kam ich kaum zu mir selbst. Ich führte ein ganz äußerliches Leben, das sich in der Hauptsache zwischen der Zeitung und der Jagd abspielte.«
Die Jagd, worunter er, wie jeder richtige Jäger, den stillen, innigen Verkehr mit der Natur versteht, ließ ihn immer wieder zur Besinnung auf sich selbst, zur inneren Einkehr kommen, und sie erweckte auch wieder den Dichter in ihm, und was der Wind, der über die Heide ging, ihm erzählte, das gewann Gestalt, und so entstand, fast unbewußt, sein »Braunes Buch«, dessen unaussprechlicher Zauber[278] noch immer unerreicht ist, diese »Heidbilder«, die uns im Kleinen die Größe und Herrlichkeit des Alls zeigen.
Darum ist auch so wenig von ihm über das zu sagen, was man gewöhnlich »Entwicklung« nennt. Seine Entwicklung und sein Leben sind in seinen Büchern zu lesen, denn seine eigenen Dichterwerke sind ja auch Selbstbekenntnisse. Gerade bei Löns hat das Unbewußte eine hervorragende Bedeutung, so daß der Ausspruch Schopenhauers: »Ein großer Dichter ist ein Mensch, der wachend tun kann, was wir alle im Traum,« gerade auf ihn paßt. So wuchsen auch seine Gedichte und Balladen aus einem innerlichen Drange heraus, wie er selbst bekennt: »Alles, was in Dichtungen, sei es Vers, sei es Prosa, gut ist, steht außerhalb meines äußeren Wollens.« Die Balladenstoffe, die er gesammelt hat, lassen ihn nicht los, bis er sie in eine poetische Form gebracht hat und in seinem »Blauen Buche« herausgibt. Und neben diesen beiden entsteht sein »Goldenes Buch« mit sechzig kurzen, goldenen Liedern. Menschenseele und Natur eng verbunden klingen und singen hier, und eine unendliche Schönheit und Tiefe und Leidenschaft ist darin zu finden.
1911 kam dann eine wundersame Volksliedersammlung heraus: »Der kleine Rosengarten«, 110 Volkslieder. Er weiß es selbst nicht, wie es kam und woher sie erklungen sind. In ihnen findet man alles, was man sucht in trüben und heiteren Stunden. Sie sind so echt, daß sie alle im Wunderhorn stehen könnten und so sangbar, daß sich viele Tondichter schon mit mehr oder weniger Glück daran versucht haben.
Jeder, der Sinn für eine gemütvolle und innige Vereinigung von Dichtung und Liedkunst hat, greife zu diesen schlichten, lebenswahren Liedern, die auch dann noch leben werden, wenn das Volk längst vergessen haben wird, wer sie zuerst gesungen. –
Zuletzt wohnte Löns, nachdem er sich 1911 und 1912 in der Schweiz, in Wiesbaden, in Holland und in einigen norddeutschen Heideorten aufgehalten hatte, in Hannover, und hier in dem alten hannoverschen Lande, dessen herbe Natur, dessen Geschichte und Menschen es Löns angetan hatten, wurde er zum begeisterten, unvergeßlichen Sänger der Lüneburger Heide. Was er, der Jäger, Forscher, Dichter uns an Naturschilderungen aus der Heide bietet, ist so köstlich, so tief dichterisch erschaut und erfühlt, daß wir beim Lesen oft den Atem anhalten und für Minuten das Buch sinken lassen müssen.
Auch, was uns Löns an Jagdbüchern geschenkt hat, steht hoch über allen ähnlichen Stoffen. Sie sind eigener und ganz anderer Art. Die künstlerische Behandlung des Stoffes ist auf eine solche Höhe gebracht, daß schließlich das Gegenständliche – das Wild und seine Erlegung – zum Vorwand wird, um dem draußen Belauschten, Ersonnenen den Rahmen zu geben. Und wie weiß Löns die Landschaft uns nahe zu bringen, wie wundervoll zeichnet er uns das Bild des Moors, der Heide, wie werden die Farben des Jahres und die Stimmungen des Tages, das Wechselspiel von Luft und Licht, Wind und Wolken lebendig! Er zwingt zum Nacherleben. All die tausend Wunder der Schöpfung erfaßt er liebevoll, ihm entgehen nicht die Fährten des Wildes im Heidesande, er sieht den heimlich erbitterten Kampf der Pflanzen um Licht und Luft, die Falterwelt ist ihm vertraut und das[279] Heer der Hautflügler, er kennt Glück und Leid des Schlängleins, das seinen Weg kreuzt. Keine Stimme draußen, sei’s die eines Vogels oder andern Getiers, die er nicht deuten könnte, kein Geschöpf, das er nicht liebte.
Ein reicher Schatz seines Schaffens ist uns aus dieser Zeit geworden: »Mümmelmann« mit seinem herzerfrischenden Humor. Sorglos, arglos lernt man bei den reizenden Tier- und Jagdnovellen lachen. Wahrhaft künstlerisch nach Form und Inhalt geben diese Novellen etwas ganz Neues, Eigenartiges, voll von poetischer Schönheit und zarter Empfindung. »Auf der Wildbahn« ist ein Buch reich an mannigfaltigen Stimmungen. Tiefe, ureigene Erlebnisse gibt der Dichter hier wieder, wie in den »Heidbildern« die toten Dinge in der Natur Leben erhalten. So steckt in diesen und anderen seiner Werke ein Stück Ewigkeitswert, der noch unsere Kinder und Enkel erquicken und befriedigen wird. Überhaupt müßten die vier Bücher: »Das braune Buch«, »Mümmelmann«, »Aus Wald und Heide« und »Was da kreucht und fleucht« in Millionen von Stücken unter der Jugend verbreitet werden. Es gibt keinen Ersatz dafür und nichts Gleichwertiges.
Und weil Löns so unerbittlich und naturnotwendig »draußen« wurzelt, so macht er auch in seinen Romanen die Natur zur Trägerin der Stimmung. Derb und kraftvoll, zart und lieblich weiß schon sein erster Roman: »Der letzte Hansbur«, dieser Bauernroman aus der Lüneburger Heide von Anfang bis zum Schluß zu fesseln.
In seinem anderen Romane: »Da hinten in der Heide« steht vor jedem Abschnitte der Name eines Vogels, das ist ein äußeres Zeichen für die eigenartige Poesie, die in diesem Buche ruht. Auch hier schildert er die Menschen in der Heide, und die Liebe zur Heimat findet und weckt ein lebendiges Echo.
Sein bestes, wertvollstes Buch aber ist der »Wehrwolf«, ein Buch, von dem man nicht wieder loskommt, ein Kriegslied, auch für die jetzige harte, hohe, grausame, stolze Zeit, wie es schöner nicht gesungen werden kann. Jeder Satz gräbt sich ein in Geist und Gemüt, und von diesen Menschen voller Kraft und Leben kann man sein Empfinden und Denken nicht wieder trennen, sie müssen durch das ganze Leben begleiten. Wie ein gewaltiges Tonwerk braust diese Bauernchronik aus dem Dreißigjährigen Kriege dahin, es liegt die Geschichte eines ganzen Volkes darin, wie es sich mit eiserner Kraft, mit aufgezwungener Härte und eingepreßter Grausamkeit geradezu hindurchwürgt und hindurcharbeitet durch die wilde Zeit. Das Werk paßt für alle Zeiten, für alle Völker, es hat Ewigkeitsgedanken und Ewigkeitswerte. Aber gerade für uns ist alles groß, schwer, heilig und erhebend, was darin zu lesen ist, und mit erschauerndem Herzen übertragen wir manches auf unsre Tage. – Und wie er dieses umstellte, umdrohte Volk der Heidebauern, das sich in Not und Untergang behauptet, als das deutsche Volk empfand, so daß er selbst sagte: »Mein Kriegslied von 1914 habe ich 1910 geschrieben im Wehrwolf«, so verdichtete sich ihm diese Liebe zu seinem Volk in einer unvergeßlichen Gestalt im »Zweiten Gesicht«, seinem letzten Erzählbuche. Wer Hermann Löns ganz kennen lernen will, muß diese Dichtung lesen; er selbst und vieles aus seinem Leben ist in diesem Bekenntnisbuche verborgen. Der, dessen Seele so reich, dessen Herz – trotz eines durchstürmten Lebens – so rein geblieben war, hat es nicht verstanden, das Glück an sich zu fesseln. Auch dann, als er sich schon wirtschaftlich freier regen konnte, ward dem herben Manne[280] keine Ruhe geschenkt – innere Unrast, leidenschaftliches Gequältsein folterten durch Jahre den, der andern soviel Sonne und Wärme geben konnte.
Vom Leben enttäuscht und todmüde flüchtet er sich in seine Heide, da ist es das Volkskind Annemieken, das ihn tröstet und stärkt, Annemieken, das Backen hat, rot wie Rosen, Augen blau wie Bachblumen und Haar, das aussieht wie Haferstroh im Schnee. »In ihr küßt er sein Volk, ließ er sein Bewußtsein untergehen, wärmte er sein altes Herz an ewig jungem Leben.«
Weidwund schleppte sich Hermann Löns durch die letzten Jahre, nur die treue Büchse war ihm geblieben. So holte er sich Kraft immer und immer wieder auf seinen einsamen Gängen und Pirschfahrten im unwegsamen Moor, im menschenleeren Wildland.
Wer Löns aber im Kreise seiner geliebten »Heidjer« im Dorfkruge traf, wo er mit tausend Schnurren alle in Atem hielt, würde nie geglaubt haben, daß diesem hartgewöhnten, helläugigen Manne der Tod am Herzen saß, wie er uns ja auch in seinem Buche: »Der zweckmäßige Meyer« als ein echter Humorist entgegentritt, in diesen scheinbar harmlosen Geschichten, in denen aber doch so viel geistige Überlegenheit steckt, aus denen der richtige Leser so viel Lebenswahrheit, wahre Vornehmheit und reiche Anregung zu echter Bildung herausholen kann. Wir lesen da von den Liebesliedern der Vögel, und daß auch der Spatz Liebeslieder singt, von dem Vogel Wupp, dem Mauersegler, der in den Städten lebt, wo es keine Natur gibt. Wir erfreuen uns an dem köstlichen Teckel Bettermann und seinen Lebensweisheiten: »Sage mir, wie jemand riecht und ich will dir sagen, was er wert ist.« Und wie in seinen Büchern war er auch in Wirklichkeit ein wundervoller Erzähler, der, wenn er einmal alles Herzeleid vergaß, die Dörfler in der Heideschenke ebenso wie die Freunde in der Großstadt zu fesseln vermochte. Wenn Löns sprach, hing alles – vornehm und gering, Männlein und Weiblein – an seinen Lippen, und die Stunden schwanden im Nu dahin. Löns wurde viel geliebt, denn er war von Herzen liebenswürdig.
Und doch hörten auch die, die ihm fernstanden, aus seinen letzten Arbeiten mehr und mehr den müden, hoffnungslosen Ton heraus. So war der Ausbruch des Weltkrieges wie eine Erlösung für ihn. Schulter an Schulter mit seinem Volke, für »sein Volk, das einzige, das er auf der Welt noch liebte«, zu kämpfen, todestrotzig, in entfesselter Kraft, das war Erfüllung, das war die Vollendung seines Lebens und Dichtens. Keinen Augenblick zögerte der fast Fünfzigjährige, der ungediente Landstürmer, in die Reihen der Kämpfenden einzutreten, und bald finden wir ihn bei der 4. Kompanie des 73. Infanterie-Regiments vor Reims stehen. Von hier aus sind noch Postkarten bekannt geworden, in denen er strahlend vor Glück von dem wild-schönen Leben im Schützengraben seinen Freunden schreibt. Löns war ja auch wie geschaffen zu solchem Leben; seine scharfen Augen, seine seit Kindestagen geübte Schießfertigkeit, seine ganze harte Natur und sein Vertrautsein mit »draußen« schufen ihn geradezu zum Idealkrieger. Er wußte nicht, was Furcht ist und hohnlachte stets jeder Gefahr ins Gesicht.
Und auch im Schützengraben konnte Angst und nervenstörende Spannung nicht aufkommen, wo Löns mit unerschütterlichem Gleichmute und Humor Stimmung[281] schuf. Alle fühlten sich geborgen in seiner Nähe. Und weil er allen so viel bedeutete, weil man den Dichter-Forscher dem Vaterland erhalten wollte, wendete man ohne sein Wissen Gefahren möglichst von ihm ab. Löns bat und bettelte, an größeren Operationen teilnehmen zu dürfen, bis es schließlich nicht mehr möglich war, ihm nicht den Willen zu lassen.
So kam der 26. September 1914 heran, an dem seiner Kompagnie Sturmangriff befohlen war. Löns war glückselig; ein verwundeter Mitkämpfer erzählte später, daß er ihn nie so ausgelassen gesehen hätte, als an diesem Morgen. Um fünf Uhr ging der Sturm los. Löns mit einem Kameraden voraus ohne Deckung über weite Stoppeln dem Feind entgegen. Da prasselt auch schon feindliches Infanteriefeuer in die Reihen, und ehe die Kompagnie eine kurze Strecke vorwärtsgekommen war, brach Löns an einem Herzschuß zusammen. »Ich habe eins gekriegt,« das war sein Letztes.
So, wie er sich’s gewünscht durch Jahre, so hat er den Tod gefunden. Mitten aus dem starken Leben heraus, mitten aus seinem Liede. »Kurz war der Knall und schnell war sein Tod« – so hatte er einst in seinem »Braunen Buche« das Ende eines von ihm erlegten Rehbockes geschildert – »wohl dem, dem solch Ende beschieden wird: aus der Sonne hinaus den Sprung in die Nacht hinein!« So ist er über die dunkle Schwelle geschritten und eingegangen in das Land ewiger Schönheit und ewigen Friedens, nach dem er sich so lange gesehnt hat.
Wir aber wollen dankbar sein, daß wir einen deutschen Dichter, einen mannhaften Mann haben, wie Hermann Löns. Kraft brauchen wir, reine deutsche Kraft und Gesundheit in Leben und Dichtung. Gesunde Dichter brauchen wir, die festwurzeln im deutschen Land und in seiner herben, treuen Natur, die feststehen im echten Volkstum, aber dennoch auch in weite himmelblaue Ferne schweifen und nach den höchsten Sternen greifen.
Und so einer war Hermann Löns. Er lernt uns wieder deutsch denken, deutsch fühlen, und hat uns gezeigt, welch ungeheuren Reichtum unser deutsches Vaterland an literarisch würdigen Stoffen besitzt, und die Heimat, die deutsche Heimat ist endlich wieder einmal durch ihn so ganz in den Mittelpunkt gerückt.
Und darum wollen wir trachten, daß sein Werk und der Geist seines Schaffens unter uns lebendig bleibt zum Segen für uns und die deutsche Heimat.
Meine Worte aber mögen ausklingen mit dem Gedichte, das er selbst zu seinen liebsten gezählt hat: »Abendsprache«, von dem so manches wahr geworden ist.
Anmerkung: Die gesamten Werke von Hermann Löns sind in acht geschmackvoll gebundenen Bänden vereint. Gesamtpreis 80 M. Bezug durch unsre Geschäftsstelle Dresden-A., Schießgasse 24. Ratenzahlung möglich.
Das Landesmuseum für Sächsische Volkskunst in Dresden – elf Jahre nächstens alt – hat eine harte Jugend gehabt. Der es leitet, mußte sparen an allem, was zur eigentlich notwendigen Regie gehört. Also hatte es bis heute auch keinen »Führer«.
Gewiß: kurz nach seiner Eröffnung erschienen, sparsam auf vier schmale Seiten gedruckt, einige »Notizen« über die schöne Sammlung. Aber was sie von dem Museumsbestand meldeten, war bald durch viele neue Eingänge überholt. Auch Näheres, Wissenswertes erfuhr man nicht. Es blieb ein Behelf.
Nun aber haben wir einen Führer. So wie ihn sich die Freunde des Museums immer erträumten und wie er nicht anders hätte gestaltet werden dürfen: volkstümlich, warmherzig bei aller wissenschaftlichen Weisheit, ein Buch, das man auch zu Hause gern wieder in die Hände nimmt.
Oskar Seyffert hat es verfaßt. Kein anderer hätte es gekonnt, so gekonnt wie er, der all die bunten fröhlichen Bauern- und Bürgerstuben im Jägerhof von einst einrichtete und der dann selber so oft Führer dort gewesen ist: immer bereit, den Gästen Schönheit und Merkwürdigkeiten seiner Sammlung zu zeigen und zu erläutern. Was er in diesem Buch gibt, bleibt frei von allem führermäßigen Schema. Da ist keine nummerweise Aufzeichnung, kein nüchternes Katalogisieren. Deshalb nicht, sagt Hofrat Seyffert in seinem Vorwort, weil so bei einer Neuaufstellung im Museum das Büchlein unbrauchbar würde. Deshalb nicht, wäre zu ergänzen, weil diese Sammlung, die ganz gefühlsmäßig, mit dem Herzen erfaßt sein will, einfach kein Registrieren verträgt. Feinster Reiz der lieben alten Dinge würde verwehen, wenn man ihnen eine Nummer anheftete.
Also schildert Hofrat Seyffert sein Museum, anschaulich und liebevoll, Raum für Raum. Man spürt aus jedem Wort: dem, der dies schrieb, sind all die verjährten Bilder und Möbel, die hier gezeigten Kunstfertigkeiten alter und neuer Tage lieb wie etwas Lebendes, und so vertraut möchte er auch den Besucher mit ihnen machen. Ein Stück Volkshistorie steckt in jeder dieser Schilderungen. Man hört von den frohen und ernsten sächsischen Bauernsitten, die sich dann in der »Kunst ohne Kunst«, dem handwerksmäßig schlichten bäuerlichen Kunstgewerbe, ausgewirkt haben. Auch verborgene Feinheit, die dem flüchtigen Beschauer entgehen würde, ist hier hervorgeholt und ans Licht gestellt. Die treuherzigen oder lustigen Bett- und[283] Ofensprüche wurden mit vermerkt, die guten Ermahnungen vergilbter Stammbuchblätter sorgsam aufgeschrieben. Und meist – das ist am schönsten – halten ein paar herzliche Zeilen die jeweilige Stimmung des Raumes fest.
Es sollte von vornherein kein Führer sein im gewöhnlichen Sinne. Sollte belehren, anregen, Heimatfreude wecken bei allen, die das kleine Buch aufschlagen. Darum sind zwischen den einzelnen Schilderungen und als Einstimmungen dazu allgemeine Betrachtungen rein historischer, kunstgewerblicher Art zu lesen. Darum auch wurden dem Buch prächtige photographische Darstellungen von heimatlicher Landschaft, heimatlichem Gewerbe beigegeben. Es ist der Leitfaden für den Lehrer, der mit seinen Jungen und Mädeln das Museum aufsucht und die dort gewonnenen Eindrücke im Unterricht vertiefen möchte. Aber es ist noch mehr, hat noch besonderen, rein persönlichen Wert. Der Verfasser, dessen Lebenswerk das Landesmuseum darstellt, bekennt es in seinem Vorwort, daß so der kleine Führer ein Kommentar zu seinem Leben geworden sei. Und wir alle, die wir uns um Oskar Seyffert scharen, wissen davon: wie jedes Stück in dieser Sammlung für ihn Erinnerung ist, Erlebnis. Und daß an manchem eine Träne hängt.
Der neue Führer »Das Landesmuseum für Sächsische Volkskunst,« im Verlag des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz in Dresden erschienen und vom Maler W. Trier, Berlin, mit einem lustigen bunten Titelblatt beschenkt, wird vielen eine Freude sein.
Gertraud Enderlein.
Vom Landeskonservator Dr. Bachmann
Dem Fachmanne, der das Land bereist um Kunstdenkmäler zu betreuen, wird oft auf die Frage nach dem Verbleib dieses oder jenes Kunstwerkes, das ehedem vorhanden war der bündige Bescheid: »das haben die Würmer zerfressen, da haben wir’s verbrannt«.
Die Werkstätten des Landesamtes für Denkmalpflege in Dresden kämpfen seit nunmehr zwei Jahrzehnten gegen den Holzwurm, diesen Hauptfeind und Schädling alter Holzskulpturen an. Langwierige Versuche haben dann endlich zu sicheren Ergebnissen geführt und heute können wir sagen, daß wir in der Lage sind, jedes noch so wurmzerfressene Holzbildwerk zu erhalten und so zu konservieren, daß menschlichem Ermessen nach ein in unseren Werkstätten imprägniertes Stück gar nicht mehr oder höchstens erst nach langen Jahren vom Wurme wieder angegriffen wird.

Der Holzwurm ist ein heimlicher Geselle, der seine Arbeit zwar verschwiegen, dafür um so gründlicher betreibt. Die dem Beschauer allein zugewendeten, meist schön bemalten und vergoldeten Teile eines Altars, eines Familienepitaphs oder eines Ölgemäldes auf Holzgrund lassen stets nur ganz vereinzelte Bohrlöcher erkennen, aus denen das charakteristische feine, gelbe Mehl herausrinnt, dagegen weisen Standflächen an Fußböden oder Wänden, Stellen, die selten oder nie dem Tageslicht zugekehrt werden zahllose Durchbohrungen auf. So erscheint manch schönes Stück, das lange auf einer Stelle steht, oder ruhig an den Wänden hängt untadelhaft im Stand,[286] bis es eines Tages ganz unvermittelt zusammenbricht. Nimmt man dann Teile solcher Bildwerke zur Hand, so kann man beobachten, was allein schon das leichte Gewicht verrät, daß das Holzwerk bis auf eine ganz dünne deckende Kruste durchweg in Wurmmehl verwandelt ist. Bruchflächen lassen statt der Holzfasern eine pfefferkuchenartige Struktur erkennen, die feinstes Holzmehl ausfüllt. Ein Kind kann jetzt die starken Holzteile, etwa die Säulen eines großen Altaraufbaues mit einer Hand zusammendrücken, und der Laie ist dann schnell mit dem Urteil bei der Hand: rettungslos verloren! Hier setzt nun die Tätigkeit des Konservators ein. Wir haben Stücke in die Werkstatt übernommen, die auch nach Meinung von Fachleuten, von Architekten und Bildhauern nicht mehr zu erhalten waren und haben sie doch noch retten können. Zwei Beispiele nur mögen hier angeführt werden. Ein holzgeschnitztes Wappenepitaph aus einer Dorfkirche bei Meißen, das bis auf die äußerste, papierdünne Haut völlig leergefressen war, wurde zunächst, da es aus lauter Einzelbruchstücken bestand auf eine feste Holzplatte montiert, die nun sozusagen als Arbeitstisch diente. Der Holzbildhauer ergänzte die wenigen fehlenden Glieder, dann folgte das Durchtränken mit Imprägnierungsflüssigkeit und schließlich legte der Restaurator an den nun völlig neu gefertigten Körper letzte Hand an. Kreidegrund, Farben und Vergoldung werden von der Schutzflüssigkeit in keiner Weise angegriffen, nur durch vorübergehenden stechenden Geruch und durch größeres Gewicht der fertigen Teile verrät sich der Eingriff. War es vorher unmöglich dem zermürbten Körper mit irgendwelchen Werkzeugen zu Leibe zu gehen, so läßt sich nunmehr das neu gestärkte Holz nach Belieben mit Schnitzmesser, Säge usw. behandeln. Abbildung 1 gibt den geretteten Kunstgegenstand nach seiner Auffrischung wieder, demnächst soll er wieder am alten Platz in seiner Kirche angebracht werden.

In Freiberg, in der neuen Jakobikirche befindet sich ein mächtiger, holzgeschnitzter Altaraufsatz, der im Jahre 1610 von Kurfürst Christian II. von Sachsen und seiner Gemahlin gestiftet wurde, und der von der Meisterhand des Freiberger Bildschnitzers Bernhard Dittrich geschaffen wurde. Das prachtvolle, überaus reich dekorierte Stück war bei der Übernahme aus der alten in die neue Kirche so aufgestellt worden, daß seine Rückseite dicht an der Apsiswand anlag, ein Fehler, der sich bitter rächen sollte. Der Holzwurm wütete nämlich ungestört und derart in dem Holzwerke, daß bei Hinzuziehung des Landesamtes im Jahre 1921 an einen Abtransport des Altars in die Werkstätten nach Dresden nicht mehr gedacht werden konnte, es wäre nur eine Ladung Wurmmehl dort eingetroffen. So mußte mit größter Vorsicht das große Kunstwerk an Ort und Stelle auseinandergenommen und auf dem Altarplatz selbst imprägniert werden. Die überaus schwierige und nicht ungefährliche Arbeit ist gut gelungen, und das wertvolle Schnitzwerk steht, wie Abbildung 2 erkennen läßt, in alter Schönheit wieder an Ort und Stelle, nur mit dem Unterschied, daß zwischen Altaraufsatz und Wand nunmehr ein größerer Zwischenraum verblieb.
Welch große Gefahren so ein vom Wurmfraß befallenes Stück für seine ganze Nachbarschaft bedeuten kann, wird in Laienkreisen noch vielfach unterschätzt und allgemein zu wenig beachtet. Ein vom Holzwurm angefallener Stuhl kann eine ganze Kircheninneneinrichtung verseuchen, eine gleichfalls derart infizierte kleine Holzfigur ein ganzes Museum anstecken. Hausmittel, wie Petroleum und dergleichen können[287] zwar den Wurm und den Käfer abtöten, richten aber gar nichts aus gegen die sehr widerstandsfähigen Eierablagerungen. Zeigen sich an einem gefährdeten Objekt an einzelnen Stellen immer wieder Wurmmehlhäufchen und rieselt bei leichtem Klopfen stets wieder Holzmehl aus den Bohrlöchern so ist energisches Eingreifen unbedingt geboten. Nur zwei Beispiele wurden hier aus der Praxis des Landesamtes angeführt, aber weit über Sachsens Grenzen hinaus wird heute schon das von den Dresdner Werkstätten für Denkmalpflege ausprobierte Verfahren mit bestem Erfolg angewendet.
Ein Bild aus dem Jahre 1848 von Curt Balasus, Leipzig
[289]
Von Kurt Hueck, Berlin
An einer besonders breiten Stelle der Havel zwischen Spandau und Potsdam, kurz unterhalb des Wannsees, liegt die jetzt zu Groß-Berlin gehörige Pfaueninsel, die durch eine Anordnung der zuständigen preußischen Minister, des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, am 28. Februar 1924 zum Naturschutzgebiet erklärt worden ist[12]. Bei einer größten Länge von anderthalb Kilometer beträgt die durchschnittliche Breite etwa sechshundert Meter. Die Insel ist ringsherum von einem breiten Schilfgürtel umgeben, der besonders im Süden, wo die Strömung geringer ist, eine außerordentliche Üppigkeit erlangt. Nicht weit von der Westspitze steht inmitten von parkartigen Anlagen ein Schloß im Ruinenstil, das Friedrich Wilhelm II. erbauen ließ. Der größere östliche Teil der Insel hat seinen ursprünglichen Charakter noch fast bewahrt.
Sowohl die landschaftlichen Reize der Pfaueninsel wie die geschichtlichen Erinnerungen, die sich an sie knüpfen, haben bewirkt, daß sie seit vielen Jahren von den Berlinern stark besucht wird. Besonders an schönen Sommersonntagen geht die Zahl der Naturfreunde und Ausflügler, die hier Erholung suchen, in die Tausende. Darunter befinden sich natürlich auch Elemente, denen jede Rücksicht auf die heimatliche Tier- und Pflanzenwelt fremd ist, und so haben die Anlagen der Pfaueninsel unter der Unbesonnenheit und den Räubereien dieser Art von Naturfreunden schwer zu leiden gehabt. Die oben erwähnte Anordnung, die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Potsdam und die Stadt Berlin 1924, Seite dreizehn, veröffentlicht ist, soll diesen unerfreulichen Zuständen ein Ende bereiten. Die auf Grund dieser Anordnung erlassene Polizeiverordnung des Polizeipräsidenten von Berlin verbietet auf der Pfaueninsel das Roden von Bäumen oder Abschneiden von Sträuchern und Pflanzen, besonders auch das Pflücken von Blumen oder Laubzweigen der Bäume und Sträucher. Auf die Nutzung von Bäumen, Sträuchern und Pflanzen durch die Nutzungsberechtigten findet dieses Verbot keine Anwendung. Es ist ferner untersagt, innerhalb des Naturschutzgebietes frei lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu fangen oder zu töten. Insbesondere ist es verboten, Eier und Nester wegzunehmen oder Insekten in ihren verschiedenen[291] Entwicklungsstadien zu sammeln; auch die Ufergewässer innerhalb des Schilfgürtels dürfen nicht mehr befahren werden. Zu wissenschaftlichen Zwecken kann die Krongutsverwaltung, der die Insel untersteht, im Einvernehmen mit der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen einzelne Personen von der Beachtung der in Betracht kommenden Vorschriften der Polizeiverordnung befreien. Mit Hilfe dieser Bestimmungen wird es möglich sein, den Übergriffen roher Besucher energischer als bisher entgegenzutreten.

Die erste Nachricht, die wir von der Pfaueninsel haben, ist, daß der Große Kurfürst ein Kaninchengehege auf ihr errichten ließ. Später, im Jahre 1685, machte er den »Kaninchenwerder« dem Alchimisten Kunckel zum Geschenk. Kunckel war gerade aus kursächsischen Diensten mit den bekannten Worten: »Kann Kunckel Gold machen, so bedarf er kein Geld; kann er solches nicht machen, warum sollte man ihm Geld geben?« entlassen worden, als ihm von Friedrich Wilhelm auf der Insel ein neues Laboratorium errichtet wurde. Diese Anlagen standen dicht am nordöstlichen Ufer. Es war aber nicht mehr der Stein der Weisen, den Kunckel hier zu finden hoffte; aus rotem Rubinglas, damals noch einem sehr wertvollen Schatz, sollten Kristallgläser für die kurfürstlichen Kellereien hergestellt werden. Niemand außer dem Kurfürsten durfte die Insel betreten, und es war Vorsorge getroffen, daß auch der große Alchimist und seine Gehilfen nicht ans Land zu gehen brauchten. Es wurde ihnen gestattet, frei zu brauen, zu backen und Branntwein zu brennen, sogar eine Mühle wurde ihnen auf dem Kaninchenwerder errichtet. Da Kunckel seinem neuen Herrn nie versprochen hatte, Gold zu machen, sondern im[292] wesentlichen beauftragt war, Gläser herzustellen, so blieb sein Verhältnis zum Großen Kurfürsten ungetrübt. Die wissenschaftlichen Erfolge seiner kostspieligen Tätigkeit sind nur gering, und 1688 verließ er die Insel wieder, um in schwedische Dienste zu treten. Er ist also nur drei Jahre auf dem Werder geblieben.

Ein volles Jahrhundert blieb jetzt die Insel unbeachtet liegen im Schutze ihres ausgedehnten Schilfgürtels, der damals noch viel breiter war als heute. Dieses fast undurchdringliche Röhricht mit seinen Scharen von Wasserhühnern und Enten lockte Ende des achtzehnten Jahrhunderts Friedrich Wilhelm II., der ein leidenschaftlicher Jagdliebhaber war, herbei. Dabei mag er auch die Insel selbst betreten und so die Bekanntschaft mit diesem schönen Fleck Erde gemacht haben; sicher ist, daß er in seinen späteren Jahren häufig mit den Damen des Hofes von Potsdam herübergekommen ist. Unter den reich mit Gold gestickten orientalischen Zelten, die ihm von einem türkischen Fürsten zum Geschenk gemacht worden waren, hat es damals oft genug frohe Feste auf dem einsamen Kaninchenwerder gegeben. In diesen Jahren gewann die Gräfin von Lichtenau (Frau Rietz) einen großen Einfluß auf die Ausgestaltung der Insel. Der Plan zu dem Schlößchen, das sich an der Westspitze erhebt, wird ihr zugeschrieben. Es ist eine künstliche Ruine mit zwei Türmen, die oben durch eine eiserne Brücke miteinander verbunden sind. Auf einer Reise nach Italien soll die Gräfin ein derartiges verfallenes Schloß gesehen haben. Noch ehe der Bau beendet war, starb Friedrich Wilhelm II. Sein Nachfolger führte den Plan zu Ende.
[293]

Nach den Stürmen der französischen Herrschaft verweilte Friedrich Wilhelm III. gern und häufig auf der Insel. Er kaufte sie vom Potsdamer Waisenhaus, in dessen Besitz sie inzwischen gekommen war, und scheute auch sonst keine Kosten, um ihre Schönheit zu vermehren. 1821 kaufte er in Berlin eine gewaltige, aus dreitausend Stöcken bestehende Rosensammlung aus dem Nachlaß des Dr. Böhm, die in mehreren Zillen nach der Insel verfrachtet wurde. Sieben Jahre später, 1828, legte er dort eine Menagerie an; gleichzeitig ließ er eine Anzahl Pfauen auf die Insel bringen. Von jetzt ab bürgerte sich der Name Pfaueninsel ein, der die alte Bezeichnung Kaninchenwerder bald verdrängte. Zu den Pfauen kamen Fasanen und andere fremdländische Hühnervögel. Die Menagerie enthielt Bären, Löwen, Alligatoren sowie Schafe und Ziegen aus Asien. Dem großen Gartenkünstler Lenné, dem die Gegend auch sonst noch viel verdankt, gebührt das Verdienst, die Anlagen um die Käfige herum den Lebensgewohnheiten und der Heimat der Tiere angepaßt zu haben. Auch die Gegend in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses wurde von Lenné in einen Park nach englischem Muster umgewandelt. In Paris wurde die Foulchironsche Palmensammlung gekauft und ebenfalls auf die Insel geschafft. Schadow errichtete dazu im Jahre 1830 ein geschmackvolles Palmenhaus, das auf indischen Säulen ruhte. Damals ließ Friedrich Wilhelm III. auch zum Gedächtnis an die früh verstorbene Königin Luise eine schlichte Säulenhalle in dem östlichen Teil der Insel erbauen. An die frohen Stunden, die der Hof hier verlebte, erinnert noch heute die russische Rutschbahn unweit des Schlosses. Die Pfaueninsel war auf der Höhe ihres Rufs. Mit Recht konnte Kopisch schreiben: »Eine Fahrt nach der Pfaueninsel galt den Berlinern als das schönste Familienfest des Jahres, und die[294] Jugend fühlte sich überaus glücklich, die munteren Sprünge der Affen, die drollige Plumpheit der Bären, das seltsame Hüpfen der Känguruhs hier zu sehen. Die tropischen Gewächse wurden mit manchem Ach! des Entzückens bewundert. Man träumte, in Indien zu sein, und sah mit einer Mischung von Lust und Grauen die südliche Tierwelt, Alligatoren und Schlangen, ja das wunderbare Chamäleon, das opalisierend oft alle Farben der blühenden Umgebung wieder zu spiegeln schien.«

Mit dem Jahre 1840, dem Todesjahr Friedrich Wilhelms III., verblaßte der Ruhm der Pfaueninsel. Die Menagerie kam nach Berlin, wo sie den Grundstock des neuen Berliner Zoologischen Gartens bildete, und die kostbare Rosensammlung wurde nach Sanssouci gebracht. So verlor die Pfaueninsel ihre damals wichtigsten Anziehungspunkte. Aus der weiteren Geschichte der Insel ist zu berichten, daß der Prinz von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm I., in den unruhigen Märztagen 1848 einige Zeit auf der Insel zubrachte. Erwähnenswert ist ferner die Vorführung, die die große französische Tragödin Rachel am 15. Juli 1852 vor Friedrich Wilhelm IV. und Nikolaus gab. Es war eine Szene aus Athalie. Ein kleines Standbild der Rachel erinnert noch heute an dieses Ereignis. 1880 brannte das Palmenhaus bis auf die Grundmauern ab. Aber die herrlichen Parkanlagen blieben unversehrt und erfuhren dauernde Fürsorge; und auch die letzten Reste der urwüchsigen Natur der Insel sind erhalten und jetzt vor rücksichtsloser Ausbeutung und Zerstörung gesichert.
Welch ungeheurer Reichtum vor allem an niederen Tieren sich noch heutigentags auf der Insel findet, ist durch die Untersuchungen des Zoologen Dr. Stichel bekannt geworden. Er hat gezeigt, daß die Pfaueninsel eine ganze Anzahl von Tieren aufzuweisen hat, die sonst in der Mark Brandenburg nur vereinzelt oder selten[295] beobachtet worden sind. Nicht weniger als hundertzwanzig Wanzenarten hat er auf der Insel feststellen können. Die übrigen Gruppen der Insekten sind ähnlich, wenn auch nicht ganz so zahlreich vertreten. Die Ringelnatter, die bei Berlin wegen der unsinnigen Verfolgungen, die sie zu erleiden hat, schon äußerst selten geworden und daher kürzlich unter Schutz gestellt worden ist, wird auf der Insel noch regelmäßig angetroffen. Mannigfaltig ist auch die Vogelwelt der Insel, die besonders Dr. Helfer beobachtet hat. Von den Singvögeln seien erwähnt: Nachtigall, Haus- und Gartenrotschwanz, Schwarz- und Singdrossel, Zaunkönig, Drossel-, Teich-, Sumpf- und Schilfrohrsänger, fünf Meisenarten, Kleiber, Hausbaumläufer, Mönchsgrasmücke, Buch- und Grünfink, Rohrammer, Haussperling, Kernbeißer, Star, Dohle, Nebel- und Saatkrähe, Rauchschwalbe, Trauer- und Grauer Fliegenfänger, ferner Grünspecht, Großer Buntspecht, Pirol, Eichelhäher, Rotrückiger Würger und Kuckuck. Die Raubvögel sind vertreten durch Turmfalk, Mäusebussard, Schwarzen und Roten Milan. Auf dem Wasser und zwischen dem Schilf tummeln sich Bläßhuhn, Haubentaucher, Tafelente, Schellente, Stockente, Kleine Rohrdommel und Lachmöwe; früher kamen dazu auch der Höckerschwan (halbwild auf der Havel gehalten) und der Gänsesäger.

Selbst die Kleinlebewelt der Havel ist reich an Arten wie an Individuen, was in der zum Teil sehr geringen Strömungsgeschwindigkeit der Havel sowie in der Zufuhr mineralisierter Abwässer (von Berlin) begründet ist. Das reiche Plankton kommt wieder anderen Tieren zugute; Moostierchen und Süßwasserschwämme wachsen hier zu so großen Kolonien heran, wie sie bei Berlin selten gefunden werden. Die Untersuchung Dr. Stichels ist es auch gewesen, die den ersten Anstoß zur[296] Schaffung dieses Naturschutzgebietes gegeben hat. Die Ergebnisse veranlaßten vor fast zwei Jahren eine Reihe von Hochschullehrern, bei der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen den Schutz des Gebietes anzuregen. Der auffallende Reichtum an Arten wird in erster Linie durch die große Zahl der Biocönosen (Lebensgemeinschaften) verursacht, die sich bei der großen Verschiedenheit der Entwicklungsbedingungen herausgebildet haben. Man braucht nur daran zu denken, daß die Insel stellenweise bis mehr als zwanzig Meter über die Havel herausragt, daß sie sowohl steile, stark besonnte Abhänge wie schattigen Laubwald und helle, trockene Wiesen hat, um eine Vorstellung von der Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen zu bekommen.
Diese Mannigfaltigkeit spricht sich auch in der natürlichen Pflanzenwelt aus, doch sei hier zunächst auf die angepflanzten Gehölze eingegangen. Es ist ganz erstaunlich, welche Fülle von wertvollen und zum Teil äußerst seltenen Bäumen und Sträuchern als Ziergehölze auf die Insel verpflanzt worden ist. Leider verbietet es der Raum, sie alle in einer langen Liste mit Namen anzuführen, und so mögen nur die wichtigsten von ihnen genannt sein. Erwähnenswert ist vor allen Dingen eine ganz prächtige, alte Zirbelkiefer (Pinus cembra), die schon von weitem durch ihre volle, dunkelgrüne Krone auffällt, und die wohl die schönste ihrer Art im norddeutschen Flachland ist. Sie steht allein auf einer weiten Rasenfläche und hat sich deshalb nach allen Seiten hin regelmäßig entwickeln können. Eine entfernte Verwandte von ihr, die Weymouthskiefer (Pinus strobus), erreicht eine ähnliche Größe. Dicht dabei stehen riesige Exemplare vom Mammutbaum (Sequoia gigantea), von der Zeder und von Ginkgo biloba. Zu erwähnen sind an dieser Stelle auch einige Eiben, die zu Hecken zurecht geschnitten sind, und die zusammen mit über mannshohen Büschen vom Buchsbaum auf den weiten Grasflächen stehen. Von den Laubbäumen des Parks verdienen Tulpenbäume (Liriodendron tulipifera) und die Flügelnuß (Pterocarya) besondere Beachtung. Ein weiterer Zierstrauch, Ptelea trifoliata, der in Nordamerika heimisch ist, verwildert sogar und breitet sich von Jahr zu Jahr mehr aus.
Unter diesen oft von weither geholten Bäumen breitet sich besonders im Frühjahr ein dichter Blütenteppich aus. In günstigen Jahren erscheinen schon im Februar die weißen Becher des großen Schneeglöckchens (Leucojum vernum), hierauf kommen die weißen und lila Blüten des Lerchensporns (Corydallis cava), die wieder von der weißen und der gelben Anemone (Anemone nemorosa und A. ranunculoides) abgelöst werden. Dann ist auch für Allium paradoxum die rechte Zeit. Dieser Lauch, der in den Kaukasusländern und in Sibirien wild vorkommt, hat sich am Südufer der Insel, wohin er verpflanzt worden ist, ganz erstaunlich vermehrt, so daß er sich an heißen Tagen durch seinen Geruch recht unangenehm bemerkbar macht. Seine Blüten sind oft sehr verkümmert und zurückgebildet, dafür kommt es aber in den Blütenständen zu einer reichlichen Ausbildung von Brutzwiebeln, durch die sich die Pflanze auf vegetativem Wege vermehrt. Sie rollen die Abhänge hinunter ins Wasser und verbreiten so, da sie schwimmen können, den Lauch weit die Havel abwärts. Andere Pflanzen, die einem beim Rundgang durch den Park auffallen, sind Milchstern (Ornithogalum umbellatum und nutans), Haselwurz (Asarum europaeum), Wintergrün (Vinca minor), Salomonssiegel (Polygonatum multiflorum)[297] und Türkenbund (Lilium martagon). Diese Arten sind zwar sämtlich angepflanzt, sie erhalten sich aber jetzt in einem halbwilden Zustand und sind völlig eingebürgert. Hierher gehört auch die kleine Selaginella apus auf einem Beet unmittelbar hinter dem Fährhause, ein zierliches, unscheinbares Pflänzchen mit niederliegendem Stengel, das in Nordamerika einheimisch ist. Mit Vinca minor zusammen überzieht der Efeu (Hedera helix) große Strecken des Bodens, stellenweise klettert er auch an den Baumstämmen empor.
Trotz aller dieser Anpflanzungen hat ein großer Teil der Pfaueninsel, die ganze östliche Hälfte, noch viel von seinem ursprünglichen Charakter aufzuweisen. Hier bilden besonders die großen, gewaltigen Eichen den schönsten Schmuck des Naturschutzgebietes, schon von weitem erkennt man sie, wenn man sich der Insel nähert. Sie gehören zu den prächtigsten der Berliner Umgebung und haben sicher sämtlich ein Alter von mehreren hundert Jahren erreicht. Ja, die mächtigste von ihnen, die Königs-Eiche, ist sogar auf eintausend Jahre geschätzt worden. Am Ostufer breiten sich sonnige und trockene Wiesen aus, die die natürliche Vegetation derartiger Standorte gut bewahrt haben. Frühlingssegge (Carex verna), Heinsimse (Luzula pilosa), gelbe Fingerkräuter (Potentilla rubens und P. Tabernaemontani), der knollige Steinbrech (Saxifraga granulata) und das kleine Hungerblümchen (Erophila verna) zeigen ihre Blüten im Frühjahr, später werden sie durch die klebrige Pechnelke (Viscaria viscosa) und einen Ehrenpreis (Veronica prostrata) verdrängt.
An feuchteren Stellen, nach dem Ufer hin, wechselt die Flora erheblich, doch zeigt diese Zone kaum etwas Bemerkenswertes. Sie wird beherrscht von der Sumpfdotterblume (Caltha palustris), dem Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis), dem Baldrian (Valeriana dioica) und den leuchtend lila-purpurnen Blüten vom Knabenkraut (Orchis latifolia). Noch mehr nach dem Wasser zu wird die Pflanzenwelt wieder artenreicher. Zwischen den Schilfbeständen kommt der große Hahnenfuß (Ranunculus lingua), die Brunnenkresse (Nasturtium amphibium), Schwarzwurz (Symphytum officinale) und anders vor. Hier sind auch an mehreren Stellen die schwimmenden, fast kreisrunden Blätter und gelben Blüten einer sonst recht seltenen Pflanze zu finden: der Seekanne (Limnanthemum nymphaeoides).
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ist es aus ästhetischen Gründen wie auch für die wissenschaftliche Forschung und den Unterricht von hohem Wert, daß die Pfaueninsel mit ihren Schätzen unangetastet erhalten wird.
Naturschutzgebiet Pfaueninsel
Auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli 1920 (G.S. S. 437), betreffend Abänderung des § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 (G.S. S. 230) in Verbindung mit § 136 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. S. 195) wird die im Stadtbezirk Berlin gelegene Pfaueninsel bei Potsdam zum Naturschutzgebiet erklärt.
Diese Anordnung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Potsdam und die Stadt Berlin in Kraft. U. IV 7873.
Berlin, den 28. Februar 1924.
Die Preuß. Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.
Amtsbl. Stck. 13 vom 29. März 1924, S. 111.
[298]
Der Polizeipräsident von Berlin hat für das Naturschutzgebiet Pfaueninsel mit Zustimmung des Magistrats von Berlin folgende Polizeiverordnung erlassen:
§ 1. Innerhalb des Naturschutzgebietes ist das Roden von Bäumen und das Ausgraben, Ausreißen, Abreißen oder Abschneiden von Sträuchern und Pflanzen, besonders auch das Pflücken von Blumen sowie Blüten oder Laubzweigen der Bäume und Sträucher verboten. Auf die Nutzung von Bäumen, Sträuchern und Pflanzen durch die Nutzungsberechtigten findet dieses Verbot keine Anwendung.
§ 2. Es ist untersagt, innerhalb des Naturschutzgebietes frei lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten. Auch ist verboten, Eier, Nester und sonstige Brutstätten von Vögeln wegzunehmen oder sie zu beschädigen. Insbesondere ist untersagt, Insekten in ihren verschiedenen Entwicklungszuständen zu töten oder sie einzutragen. Auf die notwendigen Maßnahmen der Verfügungsberechtigten gegen Kulturschädlinge sowie auf die Abwehr blutsaugender oder sonst lästiger Insekten bezieht sich dieses Verbot nicht.
§ 3. Das Befahren der Ufergewässer innerhalb des Schilfgürtels, das Baden, Angeln und Fischen sowie das Anlegen außerhalb der Fähranlegestelle ist allen Unbefugten verboten; ebenso ist das unbefugte Einfahren in den an der Westseite der Nordspitze der Insel gelegenen »Parschenkessel« verboten.
§ 4. Den Besuchern ist das Betreten des Landes außerhalb der vorhandenen Wege sowie das Lagern auf der Insel untersagt; unter freiem Himmel darf kein Feuer gemacht oder abgekocht werden.
Hunde dürfen von den Besuchern auf die Insel nicht mitgebracht werden.
§ 5. Das Wegwerfen von Papier und anderen Abfällen sowie jede sonstige Verunreinigung des Geländes oder der baulichen Anlagen, der Bänke oder Bildwerke, insbesondere durch Beschreiben mit Namen, ist untersagt.
§ 6. Jedes Lärmen und Schreien sowie das Abschießen von Feuerwaffen ist verboten.
§ 7. Zu wissenschaftlichen Zwecken kann die Krongutsverwaltung (Berlin C 2, Schloß) im Einvernehmen mit der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen (Berlin-Schöneberg, Grunewaldstraße 6–7) einzelne Personen von der Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3 und 4 dieser Polizeiverordnung befreien. Hierüber sind Ausweise auszustellen, die in der Regel für ein Kalenderjahr Gültigkeit haben und jederzeit widerruflich sind.
§ 8. Den Anordnungen der auf der Insel anwesenden und sich durch schriftliche Ermächtigung ausweisenden Personen ist Folge zu leisten.
§ 9. Übertretungen dieser Verordnung und der auf Grund derselben ergehenden Anordnungen werden, soweit nicht weitergehende Strafbestimmungen, insbesondere des § 368 Ziffer 3 und 4 R. St. G. B. Platz greifen, nach Maßgabe des § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes bestraft.
§ 10. Die Polizeiverordnung des Amtsvorstehers der Pfaueninsel vom 11. Mai 1914 wird hiermit aufgehoben.
§ 11. Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Potsdam und die Stadt Berlin in Kraft. (J. Nr. Allgem. 18 II e 24.)
Berlin, den 11. März 1924.
Der Polizeipräsident.
Amtsblatt für den Reg.-Bez. Potsdam und die Stadt Berlin. Stck. 13 vom 29. März 1924, S. 117.
Fußnote:
[12] S. Anhang zu diesen Zeilen.
Von stud. med. Ernst Mayer, Dresden
Es waren früher in Sachsen sieben Brutgegenden der Trappe bekannt, die sich bei der Vorliebe der Trappe für ebenes oder etwas hügeliges Gelände, im[299] Norden des Landes befinden. Drei Gegenden sind bei Leipzig, zwei bei Riesa, eine bei Wurzen und eine bei Großenhain.

1. Das Vorkommen bei Markranstädt. Dort wird die Trappe gegenwärtig zuweilen noch immer in ziemlich ansehnlichen Verbänden gesichtet, dürfte aber nur noch ganz vereinzelt Brutvogel sein. Es werden folgende Orte als Beobachtungsstellen genannt: Altengroitzsch, Brösen, Groitzsch (diese drei Orte liegen südlicher, würden also ein gesondertes Brutgebiet darstellen, wenn nicht alle Beobachtungen zur Strichzeit gemacht worden wären. Seit langen Jahren (1892) ist dort nichts mehr beobachtet worden), Knautnaundorf, Rehbach, Albersdorf, Neuhof, Knauthain, Knautkleeberg, Großzschocher, Groß- und Klein-Militz, Lausen, Schönau, Rückmarsdorf, Gundorf und Schleußig.
2. Das Vorkommen von Seehausen, Hohenheida, und Podelwitz-Lindental. Die Trappe ist etwa seit siebzig Jahren dort nicht mehr regelmäßiger Brutvogel. 1912 wurden bei Podelwitz Eier gefunden.
3. Das Vorkommen bei Taucha. Es werden folgende Orte genannt: Stünz, Mölkau, Schönefeld, Abtnaundorf, Mockau, Heiterer Blick, Sommerfeld, Thekla, Taucha, Plösitz, Panitzsch, Gerichshain, Beucha, Sehlis, Döbitz, Gottscheina, Pehritzsch, Gordemitz, Weltewitz.
[300]
Schon vor 1900 konnten zwischen Taucha und Leipzig Trappen brütend nicht mehr nachgewiesen werden. Länger haben sie sich nordöstlich von Taucha gehalten. In der Nähe des Ortes Pehritzsch brütet vielleicht jetzt noch dann und wann ein Paar. Von einem regelmäßigen Brüten kann aber nicht gesprochen werden. 1923 und 1924 sollen wieder Gelege aufgefunden worden sein.
4. Das Vorkommen bei Wurzen. Nördlich von Wurzen (Nischwitz, Thallwitz) hat die Trappe früher gebrütet. Von einem gegenwärtigen Vorkommen ist nichts bekannt.

5. Das Vorkommen bei Mautitz. Genannt werden die Orte: Weida, Mautitz, Ganzig, Bornitz, Borna, Canitz. Der Brutplatz lag zwischen Mautitz und Borna. Die Trappen sind seit etwa fünfundzwanzig Jahren ausgestorben. (Nach Aussagen alter Bauern.)
6. Das Vorkommen von Sahlassan. Die Trappen brüteten auf der Höhe 121 zwischen Sahlassan, Paußnitz und Görzig und sind dort vor fünfzehn bis zwanzig Jahren ausgerottet worden. Von dort und vielleicht Mautitz her sind Streichende geschossen worden bei: Terpitz, Schönnewitz, Reußen, Rügeln, Zaußwitz, Clanzschwitz, Leckwitz, Laas und Cavertitz.
[301]
7. Das Vorkommen bei Roda. Während der Brutzeit halten sich die Trappen zwischen Weißig, Roda, Colmnitz, Bauda, Wildenhain auf.
Zur Strichzeit werden sie auch bei Zschaiten, Glaubitz, Marksiedlitz, Peritz, Streumen, Wülknitz, Koselitz und Zabeltitz geschossen. Im Jahre 1923 hielten sich mindestens fünfundzwanzig Stück zu Beginn der Brutzeit im Gelände auf.
1924 konnte ich mit Sicherheit nur elf Stück feststellen. Die große Unruhe der Tiere und ihr andauerndes Umherfliegen erschwerte die Zählung sehr. Eine andere Exkursion zählte zweiundzwanzig Vögel. Doch ist bei dem ständigen Platzwechsel eine Doppelzählung leicht möglich. Hoffentlich sind es aber doch zweiundzwanzig.
Sie werden von den verschiedenen Autoren ganz verschieden beurteilt. Darüber sind sich aber alle einig, daß der Mensch daran schuld ist.
Indirekt: 1. Übergang von der Dreifelderwirtschaft zu einer intensiven Feldbewirtschaftung. Da dieser Übergang aber hauptsächlich einige Jahrzehnte vor dem starken Rückgang der Trappe stattfand, dürfte dieser Grund nicht sehr stark in die Wage fallen.
2. Zunahme der Besiedlungsdichte und des Verkehrs. Dieser Grund dürfte eine wesentliche Rolle gespielt haben bei der Vernichtung der Trappen bei Leipzig. An einigen Stellen, wo früher die Trappe brütete, breiten sich heute Vorstädte aus. Auch die Anlage von Industrieanlagen (Schürfen nach Braunkohlen, Eisenbahn usw.) hat hier verheerend gewirkt.
3. Durch unbeabsichtigte Störungen der brütenden Vögel infolge landwirtschaftlicher Maßnahmen.
Hauptsächlich aber:
4. Durch Abschuß. Zur Brutzeit sind die Trappen nicht sehr leicht zu erreichen. Um so mehr aber im Herbst und Winter, wo sie umherstreichen, vor allem, wenn sie durch einen harten Winter geschwächt, ihre sonstige Scheu verlieren. So meint Präparator Große, daß der Trappenbestand zwischen Taucha und Leipzig dadurch vernichtet worden sei, daß in dem harten Nachwinter 1895 von dem sechzehn Stück starken Bestand nicht weniger als vierzehn Stück abgeschossen wurden. Auf den Abschuß dürfte auch das Verschwinden der beiden Riesaer Trappenvorkommnisse zurückzuführen sein. Es ist auch Gefahr, daß das letzte sächsische Vorkommen bei Großenhain durch den Herbstabschuß vernichtet wird. Bei den unter II, 7 genannten Orten werden fast jeden Herbst einige Exemplare geschossen.
Gegen die indirekt durch den Menschen hervorgerufene Verminderung der Trappe können wir keine Maßnahmen treffen. Wir schützen die Trappe aus ideellen Gründen. Sie ist der größte sächsische Landvogel und ein Charaktertier der[302] Kultursteppe. Sie ist Kulturfolger und Kulturflüchter zugleich, je nachdem, was man unter Kultur versteht. Wer auch die materielle Seite berücksichtigen will, sei darauf hingewiesen, daß das, was die Trappe an Schaden verursacht, durch »Zertrappen« der Saat usw. sicher aufgewogen wird durch den Nutzen, den sie durch Vertilgung von – für die Landwirtschaft schädlichen – Insekten bringt. An Maßnahmen sind zu treffen:
1. Die Trappe wird zum Naturdenkmal erklärt, ihre Jagdbarkeit aufgehoben.
2. Mit Geld- bzw. Haftstrafe wird Fangen, Töten und absichtliches Ausnehmen und Zerstören der Gelege bestraft.
3. Innerhalb des Brutgebietes ist die ländliche Bevölkerung durch einen (Lichtbilder-)Vortrag auf die hohe Bedeutung des Trappenvorkommens hinzuweisen.
Schrifttum: Rich. Schlegel: Der frühere und gegenwärtige Bestand des Großtrappen bei Leipzig, Journal für Ornithologie 1923.
Von Regierungschemiker Dr. Walther Friese, Stadt Wehlen
Eine der seltensten, aber wohl auch interessantesten Pflanzen, die nur noch in wenigen Exemplaren im Gebiet der Sächsischen Schweiz und sonst nirgends in Deutschland mehr vorkommt, ist Hymenophyllum tunbridgense Smith, der englische Hautfarn.
Die Schrifttumangaben über diese der Familie der Hymenophyllaceen angehörenden Kryptogame sind äußerst spärlich, alle Botaniker älterer und neuerer Zeit bezeichnen sie als sehr selten und nennen als Standort den Uttewalder Grund hinter dem Felsentor bei Wehlen. So schreibt Hippe: »Ist früher an mehreren Stellen des Uttewalder Grundes gefunden worden, zuletzt am 3. Oktober 1875 in der Nähe des Felsentors.«
Garke, Wünsche, Coßmann, Schmeil-Fitschen, Börner und andere führen ebenfalls nur diesen Standort an. Möglich ist es, daß diese Fundstelle von allen diesen Forschern aus der gleichen Quelle übernommen und abgedruckt worden ist, denn es erscheint äußerst zweifelhaft, daß alle die genannten Bearbeiter von Floren die in der Tat sehr seltene Pflanze selbst gesammelt, ja nicht einmal in frischem Zustande gesehen haben.
Häufiger als bei uns scheint sie nur noch in Luxemburg, und zwar im Tale der Ernz, um Echternach, bei Berdorf und Befort vorzukommen (s. Garke: Flora von Deutschland, Wünsche-Abromeit: Flora von Deutschland, Börner: Volksflora und Coßmann: Flora von Deutschland).
Die Familie der Hymenophyllaceen ist hauptsächlich in den tropischen Bergwäldern und in südlichen extratropischen Gebieten verbreitet; im Ganzen kennt man etwa einhundertsechzig Arten aus dieser Familie. Auf Europa entfallen davon[304] nur Trichomanes radicans, Hymenophyllum Wilsoni und Hymenophyllum tunbridgense.

Wie so viele andere Farne findet sich Hymenophyllum tunbridgense fossil bereits im Carbon (s. Prantl-Pax: Lehrbuch der Botanik, S. 255).
Was den Standort im Uttewalder Grund bei Wehlen betrifft, so ist mir nur noch eine einzige Stelle hinter dem Felsentor bekannt, glücklicherweise dermaßen unzugänglich, daß eine Ausrottung des dort nur noch in einigen spärlichen Exemplaren anzutreffenden Pflänzchens nicht wohl zu befürchten ist. Im Jahre 1905 fand ich bachaufwärts noch eine zweite Stelle mit einigen schönen Exemplaren; leider wurde diese Fundstelle bereits im folgenden Jahre durch einen Wolkenbruch völlig zerstört, der einen Felsabsturz auslöste, mit dem die kärglichen Reste des Farns zu Tal gerissen und für immer vernichtet wurden. Jedenfalls trifft die oben angeführte Bemerkung Hippes nicht zu, nach der man anzunehmen gezwungen ist, daß im Uttewalder Grunde kein Fundort mehr vorhanden sei.
Glücklicherweise ist es dem sehr verdienten, leider vor zwei Jahren verstorbenen Geologen Professor Dr. O. Beyer vergönnt gewesen, noch einen weiteren Standort des Hymenophyllum tunbridgense, und zwar im Basteigebiet zu entdecken. Auch dieser ist mir bekannt, aus begreiflichen Gründen muß ich jedoch davon absehen, ihn näher zu bezeichnen.
Getrocknete Exemplare von den Standorten aus dem Uttewalder Grunde habe ich seinerzeit Herrn Dr. Fr. Massute, Dresden, gegeben, der diese, wie auch solche von dem verstorbenen Professor Dr. Schorler gesammelte seinem Herbarium einverleibt hat.
Die Blattwedel des Hymenophyllum sind äußerst zart und die Stengel sehr dünn, nicht viel stärker als ein Roßhaar, schwarzglänzend und rund.
Das Hymenophyllum tunbridgense, das auch Linné bekannt war, muß unbedingt als ein Eiszeitrelikt angesehen werden[13].
Hoffen wir, daß die wenigen noch heute vorhandenen Fundstellen noch recht lange erhalten bleiben. Eine Zerstörung durch Naturereignisse, wie der einen im Uttewalder Grunde, erscheint durch ihre günstige Lage als ausgeschlossen. Allerdings gegen Mutwillen und Vandalismus gewisser Wanderer läßt sich nur schwer ankämpfen. Hat aber die Pflanze bereits viele Jahrtausende überdauert, dann ist wohl auch anzunehmen, daß sie uns noch weiterhin erhalten bleibt.
Fußnote:
[13] Ich möchte diese Pflanze mit ihrem atlantischen Vorkommen nicht als Eiszeitrelikt bezeichnen; mir scheint es vielmehr ein Relikt aus wärmerer Periode, der die Eiszeit an geschützter Stelle überdauert hat, vielleicht ein Tertiär-Relikt. – Drude hält Hymenophyllum tunbridgense für »einen Überrest der Interglazialzeit«. Ein ähnliches interessantes Farnvorkommen, nämlich von der mittelmeerländischen Notochlaeno Marantae an der Südostgrenze des Böhmerwaldes wird von Professor v. Beck angeführt, der dieselbe »als Relikt einer schon vor der Glazialzeit bestandenen Flora« betrachtet.
Dr. Naumann.
[305]
Von Otto Eduard Schmidt, Dresden-A., Blochmannstr. 7
Lange Jahre beschäftigt mich schon die Frage, seit welcher Zeit im Gebiet unseres Sachsenlandes Steine im Dienst einer religiösen Vorstellung oder einer anderen Idee künstlerisch behauen worden sind. Die nur auf die Herstellung von Waffen oder Geräten abzielenden Steinarbeiten aus der sogenannten Steinzeit und der ihr folgenden Epoche kommen hier natürlich nicht in Frage. Denn die Beile, Hämmer, Äxte, Pfeil- und Lanzenspitzen, Messer, Mahlsteine offenbaren ja kein eigentlich künstlerisches Schaffen, soweit sie nicht, wie manche französische und schweizerische Fundstücke dieser Art, mit eingeritzten Tierbildern verziert sind.
Als ältesten künstlerisch behandelten Stein konnte ich bisher den in der Gegend von Pegau gefundenen, jetzt im Museum des sächsischen Altertumsvereins verwahrten großen Stein ansehen, den ich zuerst im Jahre 1914 in dem Buche »Kunst und Kirche« besprochen und veröffentlicht habe (S. 21 und Tafel 1). Ich halte ihn für ein an hervorragender Stelle angebrachtes Monument, das die unter König Heinrich etwa um 920 von der Saale an die Weiße Elster vorgerückte deutsch-slawische Grenze bezeichnen sollte. »Der Pegauer Stein zeigt auf der einen Breitseite einen roßführenden deutschen Jüngling, ein Hinweis auf die durch König Heinrich geschaffene Volksreiterei; auf den Schmalseiten sehen wir einen Schleuderer mit der Tartsche, der seinen tödlichen Stein soeben auf einen an der gegenüberliegenden Wange dargestellten Drachen, das Symbol des Heidentums, abgeschnellt hat; die Vorderseite aber zeigt die Grenzlinie, vor der links ein deutscher und rechts ein slawischer Reiter sein Roß pariert« (s. Abbildung 1). Zum Vergleiche kann man immerhin den um etwa zwei Jahrhunderte älteren, also um das Jahr 700 gemeißelten Reiterstein von Hornhausen im Kreise Oschersleben heranziehen, der ein Glanzstück des Provinzialmuseums für Vorgeschichte zu Halle bildet (s. die Abbildung auf S. 61 des von Hahne verfaßten Katalogs dieses Museums).
Ein mindestens ebenso hohes Alter wie der Pegauer Stein können die wenigen echten slawischen Götzenbilder für sich in Anspruch nehmen, die uns ein glücklicher Zufall erhalten hat. Vor allem der in Zadel bei Meißen im Innern des Kirchturms eingemauerte Steinkopf, den ich zuerst im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte XXXII, S. 350 veröffentlicht und besprochen habe (s. Abbildung 2). Dieses Götterbild, ein Ungeheuer mit breitem Kopf, glotzenden Augen, weitgeöffnetem Mund und fletschenden Zähnen, ist vor allem geeignet, Furcht und Entsetzen einzuflößen.

Nicht allzuviel jünger als der Pegauer Stein sind die ältesten christlichen Steindenkmäler unseres Landes. Das jetzt im Museum des Sächsischen Altertumsvereins in Dresden aufgehobene Bogenfeld von der Kirche zu Elstertrebnitz bei Pegau (s. Abbildung 3) zeigt in der Mitte die bartlose, aus einem Sockel hervorwachsende Büste des Heilands. Mit der zum Schwur erhobenen Rechten verspricht er dem seitwärts stehenden Priester das Himmelreich. Dieser steht zwischen einer kreisrunden, narzissenartigen Blüte und einer Lilie und hält zum Zeichen seiner Reinheit eine Lilie in der Hand. Mit der Linken hebt Christus die Heilige[307] Schrift empor (ΑΩ), zu ihr erhebt ein neben einem Kruzifix stehender neubekehrter Slawe betend die Hände. Er ist durch die begleitende Gans als slawischer Bauer gekennzeichnet. So bewahrt uns dieser Stein eine wertvolle Erinnerung an die Bekehrung der Elsterslawen zum Christentum, und damit ist die Zeit seiner Entstehung gegeben: er gehört in das Zeitalter des Wiprecht von Groitzsch und seiner Gemahlin Judith, also ums Jahr 1100.

Soeben erfährt die kleine Zahl der ältesten künstlerisch behauenen Steine Sachsens dadurch eine ungeahnte Vermehrung, daß ein auf sächsischem Boden gefundener Stein zu ihnen tritt, der vielleicht noch älter ist als die genannten: der Stein aus dem Torfmoor von Kühnhaide. Er ist nicht eben jetzt neu gefunden worden, sondern schon vor sechsundvierzig Jahren, aber er ist doch wie ein neuer Fund, weil er inzwischen wieder fast ein halbes Jahrhundert lang verschollen war. Er ist nämlich – doch ich will lieber, um allen bei der Neuauffindung Beteiligten gerecht zu werden, den Sachverhalt der Reihe nach erzählen, wie er sich zugetragen hat. Im Frühjahr 1924 schrieb der als Waffenforscher bekannte Besitzer des Schlosses Pfaffroda, Dr. Diener von Schönberg, erst an den Landesverein Sächsischer Heimatschutz, später (4. August 1924) auch an den Direktor des Museums für Völkerkunde, Prof. Dr. Jacobi, ein Herr Weigelt in Olbernhau habe ihm mitgeteilt, im Jahre 1880 sei in der Nähe von Kühnhaide, wo Weigelt damals wohnte, in einem Torfmoor, wo sonst überhaupt keinerlei Steine vorkommen, ein Stein ausgegraben worden, der der Annahme nach von den vorchristlichen Bewohnern[308] der dortigen Gegend stamme. Der Stein sei etwa fünfzig Zentimeter hoch, vierzig Zentimeter breit und fünfundzwanzig Zentimeter stark gewesen, nach oben hin ungefähr eine Dreiecksform zeigend. Auf der Vorderseite sei, ziemlich plump und mit primitiven Werkzeugen ausgeführt, aber nicht ohne Geschicklichkeit dargestellt, ein Kopf eingemeißelt gewesen mit einem Teil der Brust, und unter dieser Darstellung eine Reihe von Schriftzeichen, die man damals nicht zu deuten verstand. In der unteren Fläche hätte sich ein Loch befunden, als ob der Stein auf einem andern aufgesessen habe. Der Stein sei damals eine Zeitlang im Gasthof von Karl Martin in Kühnhaide ausgestellt gewesen. Dort habe ihn Lehrer Thaermann aus Lauta bei Marienberg entdeckt, gekauft und, wie damals auch in den Dresdner Nachrichten gestanden haben soll, in ein Wiener Altertums-Museum verkauft. Es möchten Nachforschungen in Wien angestellt werden und womöglich eine Photographie des Steines beschafft werden.
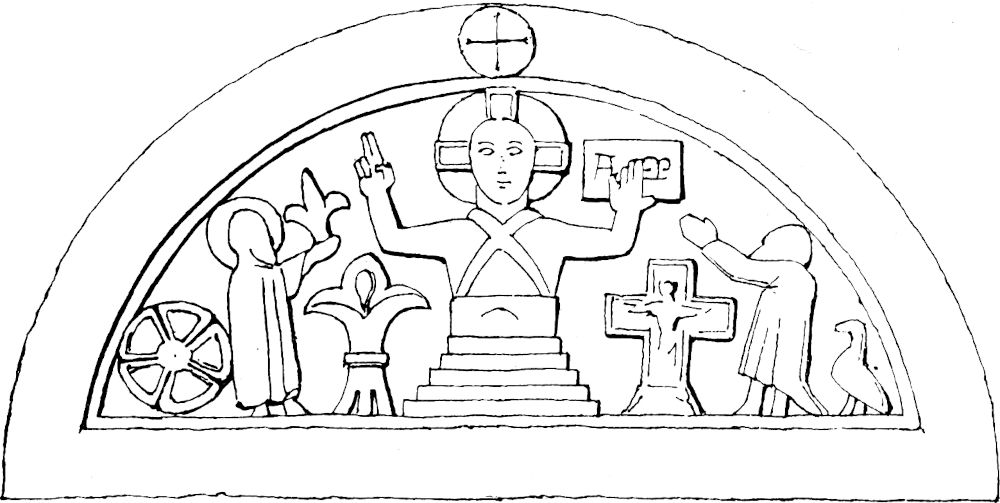
Der Landesverein schickte den Brief Dr. Dieners von Schönberg an mich mit dem Ersuchen, Nachforschungen über den Stein anzustellen. Meine Erkundigungen waren zunächst erfolglos, bis ich im August in die staatliche Sammlung für Vorgeschichte kam und von Dr. Bierbaum, den ich über den Stein befragte, erfuhr, er befinde sich im Obergeschoß des Zwingerpavillons, der die vorgeschichtliche Sammlung beherberge, in der Ecke zwischen der Wand und einem Schrank, er sei auch schon Herrn Dr. Diener von Schönberg beschrieben und von dessen Gewährsmann Weigelt als eben der Kühnhaider Stein erkannt worden, den er vor mehr als vierzig Jahren gesehen habe. So war denn der Verkauf des Steines nach Wien glücklicherweise eine bloße Legende ohne jeden tatsächlichen Hintergrund. Der Stein hatte die ganze Zeit unbeachtet in seinem Versteck gestanden; nur einmal, sehr bald nach der Auffindung, hatte ihn Hofrat Dr. Geinitz in der Dresdner »Isis« gezeigt und darüber in den Sitzungsberichten der Isis zu Dresden, 1878 S. 146, folgendes mitgeteilt: »Von dem Vorsitzenden (Hofrat Dr. Geinitz) wird hierauf ein Steinbild vorgelegt, das sich als wahres Vollmondgesicht eines Mannes mit[309] eigentümlichen Runen oder Schriftzeichen zusammen auf einem Gneißblocke befindet, welcher vor kurzem etwa sechs Fuß tief unter der Erdoberfläche in einem Torfstich bei Kühnhaide unweit Marienberg im Erzgebirge entdeckt worden ist. Da dieser sechzig Zentimeter hohe und vierzig Zentimeter breite, etwa zehn Zentimeter dicke Gneißblock in den Besitz des K. Mineralogisch-Geologischen Museums übergegangen ist, so behält sich der Vortragende vor, später weitere Mitteilungen darüber zu geben. Zunächst hat sich nur die Echtheit des Fundes feststellen lassen, von welchem die erste Nachricht durch Herrn Student Hans Schaarschmidt hierher gelangt ist und von welchem auch Herr Hugo Thaermann in Lauta bei Marienberg später Kenntnis erhielt. Der Letztere hat darüber bereits im »Erzgebirgischen Nachrichts- und Anzeigeblatt«, 1878, Nr. 83, unter dem Namen »das Kühnhaidaer Götzenbild« eine eigentümliche Kritik veröffentlicht, außerdem aber den Transport nach Dresden vermittelt.« Hofrat Geinitz ist offenbar nicht dazu gekommen, sich erneut mit dem Kühnhaider Stein zu beschäftigen, und so blieb er verschollen, nicht einmal eine Abbildung ist davon in die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb erbat ich mir von der Direktion der vorgeschichtlichen Sammlung die Erlaubnis, den Stein genauer zu untersuchen, photographieren zu lassen und das Ergebnis publizieren zu dürfen. Die hier wiedergegebenen Aufnahmen (Abbildung 4 und 5) sind auf Veranlassung des Heimatschutzes von Herrn Georg Schäfer hergestellt worden. Das vorläufige Ergebnis meiner Untersuchung, bei der ich von den Herren Professor Dr. Jacobi, Dr. Bierbaum, Dr. Pinther, Dr. Wünsche und von Herrn Direktorialassistenten an der staatlichen Skulpturensammlung Dr. Müller freundlichst unterstützt wurde, ist folgendes:

Der Kühnhaider Stein ist ein Block des körnigen, roten Eruptiv-Gneises, wie er in der Gegend von Kühnhaide fast überall angetroffen wird. Man wird also mit der Möglichkeit zu rechnen haben, daß das Bildwerk unweit der Fundstelle entstanden sein kann. Das auf unserer Abbildung nicht sichtbare, in der Mitte der unteren Schmalfläche befindliche Zapfenloch macht es wahrscheinlich, daß der dreieckige Stein entweder auf einem Postament aufsaß oder mit einer anderen Steinplatte verbunden war, die die Fortsetzung des Körpers enthielt, dessen Kopf auf dem erhaltenen Block dargestellt ist. Ich ziehe zunächst die erste Ansicht vor, da die ganze rohe Gestalt des Blockes nicht dafür spricht, daß der Verfertiger des Steinbildes mehrere solcher Blöcke zusammengesetzt habe. Der eingemeißelte bartlose Kopf ist mit sehr einfachen Mitteln in den Gneis vertieft, aber doch schon mit Anwendung eines Steinmeißels. Zu beachten ist auch, daß der Bildner den Versuch gemacht hat, die Pupille in der Mitte des Auges durch eine Vertiefung anzudeuten. Trotz der Schlichtheit der Arbeit zeigt der Kopf, vielleicht ist es Zufall, einen gewissen Ausdruck der Müdigkeit oder der Milde. Schon aus diesem Grunde wird man kein slawisches Götterbild in dem Kopfe finden können. Alles, was wir von der Darstellung slawischer Götter wissen, widerspricht diesem Bilde. Hier ist nichts Drohendes, nichts Schreckendes, wie bei dem Zadeler Stein. Über dem Kopf findet sich ein System vielleicht korrespondierender vertiefter Linien, durch einzelne kleine Bruchflächen unterbrochen, die ebensogut Reste einer Bekrönung des Kopfes wie Schriftzeichen darstellen können. Ebensolche Schriftzeichen finden sich auf der Rückseite des Blocks. Es wird von diesen beiden Stellen in diesen Tagen mit weicher[310] Papiermasse ein Abklatsch gemacht werden, der die Bestimmung der Zeichen erleichtern wird. Aber soviel läßt sich heute schon sagen, daß diese Schriftzeichen entweder germanische Runen oder griechische Buchstaben darstellen. Vor kurzem ist bei Asch in Böhmen ein kleinerer Sandstein gefunden worden, der Runenzeichen trägt. »Die Museumsverwaltung in Asch stellte fest, daß es sich hier um ein echtes Fundstück aus germanischer Vorzeit handelt. Die in den Stein tief eingeschnittenen Runenzeichen sind die Buchstaben G und A des gemeingermanischen Runenalphabets.[311] In dem Fund erblickt man einen Beweis für die geschichtliche Annahme, daß vor mehr als fünfzehnhundert Jahren in der Gegend von Asch, Elster und im Erzgebirge Germanen ansässig gewesen sind, die über das Fichtelgebirge herüber den andrängenden Slawen entgegengezogen waren (Dresdner Anzeiger 1924, 24. Sept.).« Ich habe mich bereits mit der Museumsverwaltung in Asch in Verbindung gesetzt, um ein Bild dieses Fundes zum Vergleich zu erlangen.

[312]
Sollten sich die Schriftzeichen auf dem Kühnhaider Stein als Runen erweisen, so könnte man wohl annehmen, daß das Bild ein germanisches Heiligtum war, das bei einer Wanderung über das Gebirge im Moore verloren oder versenkt wurde, oder daß es, wie der Hornhausener Reiterstein, das Gedächtnis an das Grab eines auf der Heerfahrt umgekommenen Fürsten oder Helden festhalten sollte. Die Wahl des am Fundort vorhandenen, sonst für ein Bildwerk wenig geeigneten Gneises und die offenbar flüchtige Art der Arbeit würden dafür sprechen.
Sollten sich die Schriftzeichen als griechische erweisen, so würde man in dem Kopfe einen ganz alten schlichten Typus des Bildes Christi erkennen dürfen, einen Vorläufer des ebenfalls kreisrunden, bartlosen Christuskopfes von Elstertrebnitz (s. Abbildung 3). Die ersten Schriftzeichen auf der Rückseite des Steines lassen sich allenfalls als ΧΡ (= Christos) deuten, und gerade diese beiden Buchstaben sind ja auch ein sehr altes, schon auf den Feldzeichen (labarum) Konstantins des Großen vorkommendes Symbol des christlichen Kultus. In diesem Fall eröffnet sich eine ganze Reihe von Deutungsmöglichkeiten. Vielleicht hängt dieses Steinbild irgendwie mit dem Kriegszuge zusammen, auf dem Bischof Arno von Würzburg am 13. Juli 892 gegen die heidnischen Slawen in der Nähe des Flusses Chemnitz fiel, oder die Tätigkeit der Slawenapostel Methodios († 885) und Kyrillos hat auch einen Missionszug über das Erzgebirge zu den Elbslawen veranlaßt, bei dem dieses steinerne Kultbild für ein augenblickliches Bedürfnis geschaffen und dann verloren wurde, oder es bezeichnete den Weg, auf dem die böhmische Prinzessin Judith als Braut Wiprechts von Groitzsch über das Gebirge kam. So umschweben unser Kühnhaider Steinbild eine ganze Reihe ungelöster Rätselfragen, und es könnte Befremden erregen, daß ich, ohne die Untersuchung zu Ende geführt und ohne mich selbst für eine der Möglichkeiten entschieden zu haben, schon heute diesen Aufsatz in so unfertiger Gestalt herausgebe. Aber gerade dadurch hoffe ich um so mehr Teilnahme für den rätselvollen Stein zu erwecken und Nachrichten darüber zu erhalten, ob etwa jemand von einem ähnlichen Fund auf sächsischem oder Sachsen benachbartem Boden gehört hat. Vor allem bitte ich die kleineren Museen des Landes und alle Privatsammler, die ein ähnliches Fundstück im Besitz haben sollten, mir gütigst davon Mitteilung zu machen. Denn in jedem Fall eröffnet der Kühnhaider Stein ein weites Gesichtsfeld in eine ferne Vergangenheit unseres Landes und auf Anfänge einer Kultur, von der wir noch keine festumrissene Vorstellung haben.
Nachtrag. Als dieser Aufsatz schon gesetzt war, fand sich in einem Schranke der staatlichen vorgeschichtlichen Sammlung eine Bleistiftzeichnung der Vorder- und der Rückseite des Kühnhaider Steines in der Viertelgröße des Originals und zwei danach hergestellte Lichtdruckabzüge, deren Veröffentlichungsort ich noch nicht ermitteln konnte.
Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden
Führer
durchs
Landesmuseum für
Sächsische Volkskunst
von
Hofrat Professor Seyffert
90 Seiten
mit 18 Abbildungen und 1 bunten Titelblatt
Soeben erschienen
Preis 2 M.
(25 Pfg. Postgeld und Verpackung)
Zu beziehen durch:
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Dresden-A., Schießgasse 24
Besucht
das Landesmuseum für
Sächsische Volkskunst
Dresden-N., Asterstraße 1
(beim Zirkus)

Geöffnet:
Wochentags von 9–2 Uhr,
Mittwochs und Sonnabends auch noch
nachmittags von 4–6 Uhr
Sonn- und Festtags von 11–1 Uhr
Vereine, die von Hofrat Professor Seyffert geführt werden
wollen, werden gebeten, rechtzeitig Mitteilung mit Angabe
der Besucherzahl an das Museum gelangen zu lassen.
Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Unterschiedliche Schreibweisen bei Namen wurden beibehalten. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 296: wollen → rollen
Sie rollen die Abhänge hinunter ins Wasser