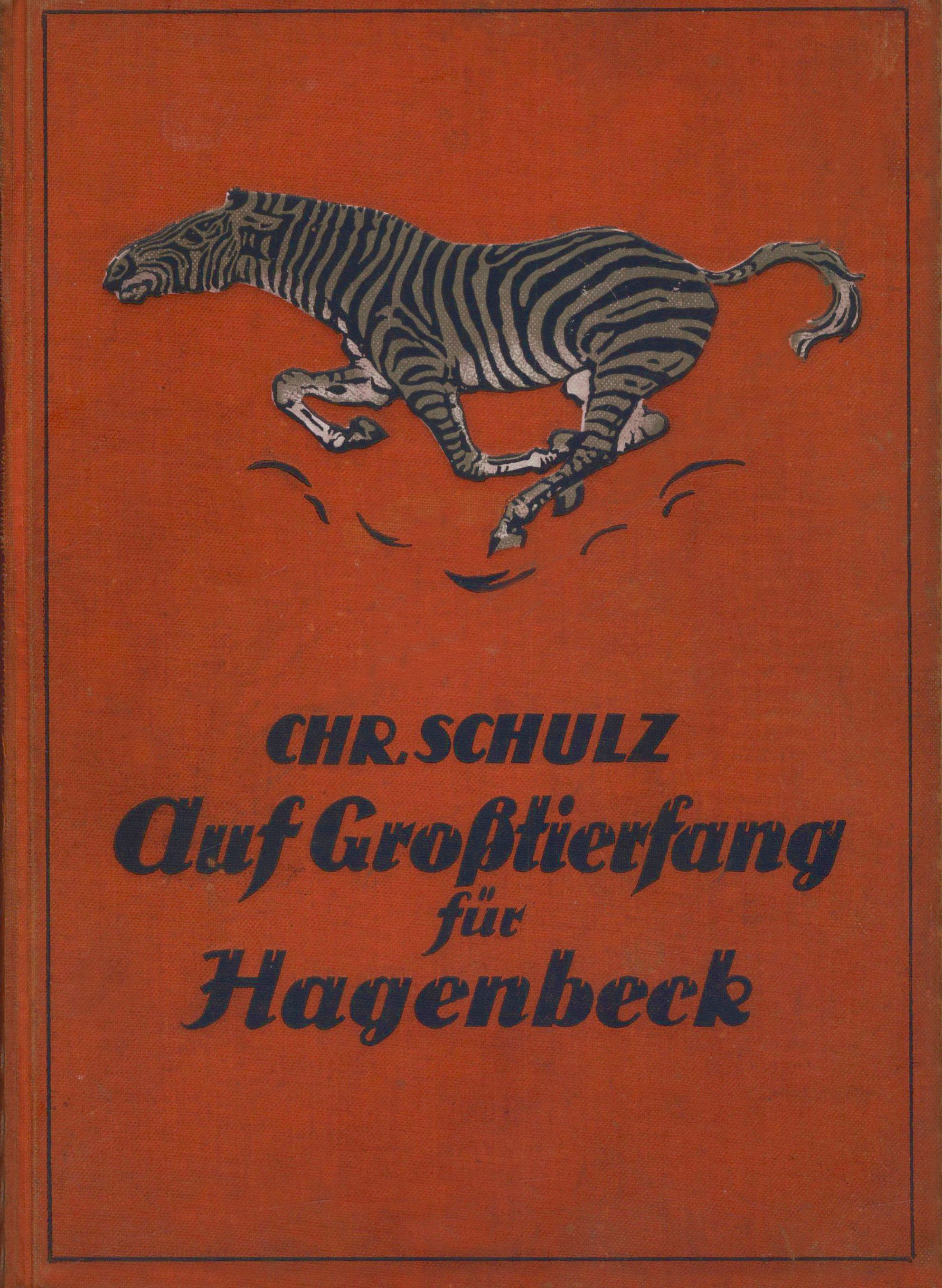
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1926 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
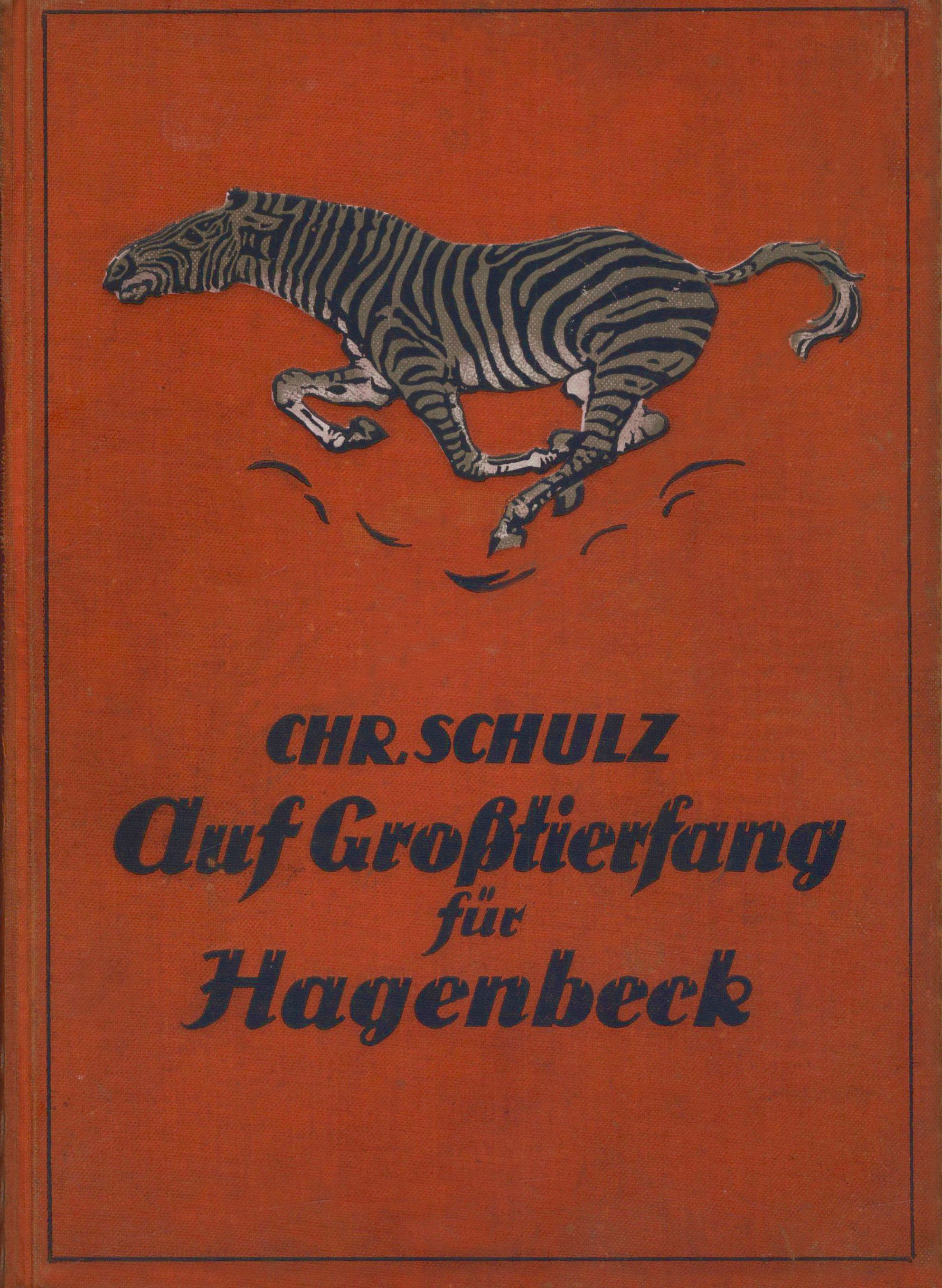
Auf Großtierfang für Hagenbeck
Selbsterlebtes aus afrikanischer Wildnis
von
Chr. Schulz
Mit über 80 Illustrationen
nach Original-Aufnahmen
Fünfte Auflage

Verlag Deutsche Buchwerkstätten, G. m. b. H., Leipzig
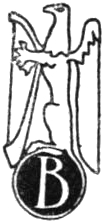
Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig
Frau Kommerzienrat Carl Hagenbeck
in herzlicher Verehrung
gewidmet
[S. 7]
|
Seite
|
||
|
Zur Einführung
|
||
|
I. Kapitel.
|
Für Carl Hagenbecks Tierpark in Ost-Afrika
|
|
|
II. Kapitel.
|
Jagd- und Fangzug am Rufidji
|
|
|
III. Kapitel.
|
Giraffenfang im Meru-Gebiet
|
|
|
IV. Kapitel.
|
Quer durch die englische Masaisteppe und das englische
Wild-Reservat
|
|
|
V. Kapitel.
|
Auf unserer Tier- und Straußenzuchtfarm
|
|
|
VI. Kapitel.
|
Fang von wilden Straußen, Zebras, Antilopen und
Raubtieren
|
Alle Rechte vorbehalten
Amerikanisches Copyright 1926 by Verlag Deutsche Buchwerkstätten G. m. b. H., Leipzig
[S. 9]
Das vorliegende Buch stellt in seiner Art eine Neuerscheinung auf dem bereits so reichhaltigen Gebiete der über ostafrikanisches Wild und seine Jagd vorhandenen Literatur dar. In ihm wird nicht die Jagd mit der Büchse behandelt, sondern wir lernen die Leiden und Freuden eines Tierfängers, sein Leben in der Steppe und auf dem Tiertransport, sowie die Art und Weise kennen, wie er es fertig bringt, mitten in der Wildnis die Tiere zu fangen, die wir als Zierde unserer zoologischen Gärten bewundern. Die Methoden des Tierfanges sind dem großen Publikum durchweg unbekannt, was wohl in erster Linie darauf zurückzuführen ist, daß wir über diesen speziellen Gegenstand nur eine äußerst dürftige Literatur besitzen. Kein Wunder! Wer monatelang sein Leben im dichten Urwald oder in weiten Steppen verbringt, hat durchweg eine begreifliche Abscheu vor der engen Schreibstube. So haben nur wenige Tierfänger dürftige Notizen über ihre Erlebnisse veröffentlicht. Sehr bedauerlich, denn gerade diese mit Natur und Wild in stetem und innigem Kontakte stehenden Männer hätten uns vieles Interessante mitteilen können, das über den Rahmen gewöhnlicher Jagdgeschichten hinausgeht und dem Wissenschaftler oft wertvolles Material in biologischer oder zoogeographischer Hinsicht hätte liefern können.
Um so mehr ist das Erscheinen des vorliegenden Buches zu begrüßen. Der Verfasser, Herr Christoph Schulz, war lange Jahre[S. 10] mit großem Erfolg als Vertreter der Firma Hagenbeck-Stellingen in West- und später in Ostafrika tätig. Dort habe ich ihn vor Jahren in Aruscha kennengelernt, und das Schicksal führte uns später in Malta, in englischer Kriegsgefangenschaft, wieder zusammen. Hier übergab er mir eines Tages das Manuskript seiner „Ostafrikanischen Erinnerungen“ mit der Bitte, dasselbe einer Durchsicht zu unterziehen. Ich kam diesem Wunsche um so lieber nach, als mir die Gebiete, in denen Herr Schulz tätig war, zum großen Teil aus eigner Anschauung, teils von früheren Jagdzügen, teils aus der Kriegszeit her bekannt sind. Mit hohem Interesse habe ich die mir übergebenen Blätter gelesen und den Verfasser auf seinen Fangzügen auf Nashorn und Flußpferd, Giraffe und Zebra begleitet. Vor dem geistigen Auge des ehemaligen „Afrikaners“ tauchen sie wieder auf, die weiten, von Tausenden von Gnus belebten Steppen am Manyara-See, die majestätischen Bergriesen des Kilimandjaro und Meru und die gelben, träge sich dahinwälzenden Fluten des Rufidji mit seinen Sandbänken, seinen Flußpferden und Krokodilen. Von tiefer Sehnsucht nach jenen herrlichen Jagdgründen wird das Herz erfüllt. Aber auch wer Ostafrika nicht kennt, kommt bei der Lektüre des vorliegenden Buches auf seine Kosten, da aus jeder Zeile die dem Weidmann so sympathische Liebe zum Wild und zur Natur spricht, in schlichtem Stile, aber dennoch warm und gemütvoll.
Hinweisen will ich noch darauf, daß uns der Verfasser mancherlei Beobachtungen mitteilt, die neu oder doch noch wenig bekannt und auch ihrerseits geeignet sind, das Material zur Kenntnis der afrikanischen Tierwelt, ihrer Verbreitung und ihren Lebensbedingungen zu vermehren.
Malta, November 1919
Eduard Elven, Zoologe
[S. 11]
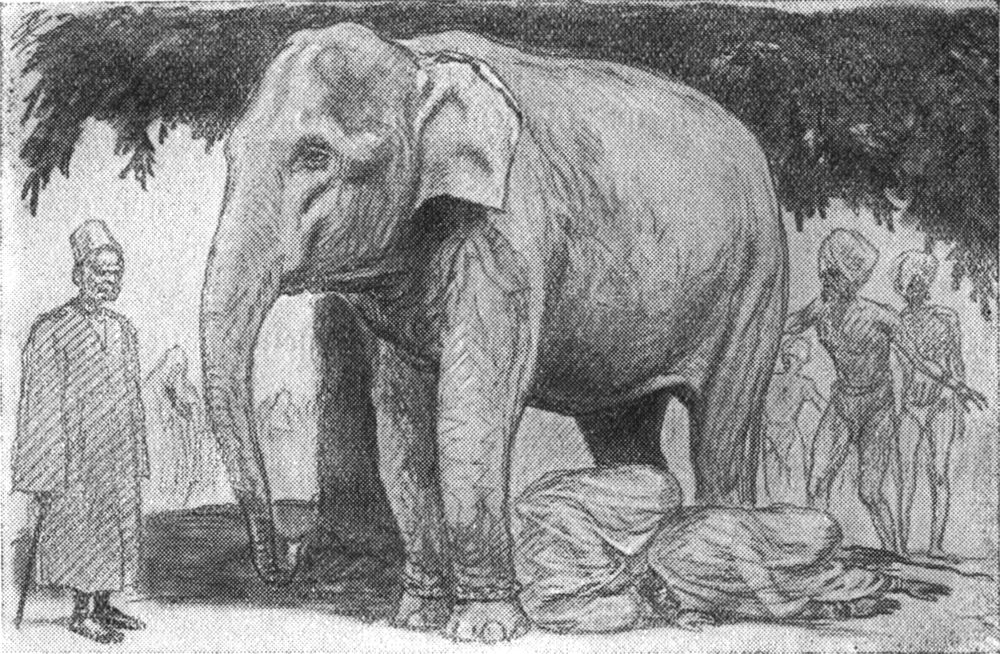
„Bliev gesund, mien Jung, un bring mi ’n por lüttje Nashörner mit, denn mokst mi ’ne groote Freud!“ Mit diesen halb ernsten, halb scherzenden Worten und mit einem kräftigen Händedruck verabschiedete mich der biedere alte Herr Hagenbeck zu meiner ersten Reise nach Ostafrika. Ich war erst kürzlich mit einem Transport von wilden Tieren in Hamburg eingetroffen und hatte den Stellinger Tierpark wiederum um eine Anzahl Vertreter der westafrikanischen Fauna bereichert. Das der Wissenschaft bisher nur aus den dürftigen Berichten Mortons und den wenigen von Büttikofer nach Europa gebrachten Häuten und Skeletten kaum bekannte Zwerg-Flußpferd (Choeropsis), dem ich schon lange auf der Spur war, befand sich zu meinem lebhaften Bedauern nicht darunter.[S. 12] Im Hinterland der Republik Liberia war ich auf die Fährte des sozusagen unbekannten Tieres gestoßen, und ich hatte all meinen Ehrgeiz daran gesetzt, um in den Besitz dieses pygmäenhaften Vetters des gewaltigen Hippopotamus zu gelangen, da wurde ich dicht vor dem Ziel plötzlich von einem hartnäckigen Sumpffieber befallen. So mußte ich wohl oder übel von meiner Pionierarbeit ablassen und sah mich zur Wiederherstellung meiner Gesundheit gezwungen, in die Heimat zurückzukehren. Daselbst hatte ich mich bald wieder erholt, frische Lebenskraft beseelte mich und begann mich zu neuer Tätigkeit anzuspornen. Nun sollte ich auf dem kürzesten Wege über Italien nach Ostafrika reisen, um auch aus diesem Gebiet verschiedene Wildarten für die weltbekannte Firma zu beschaffen. Mein Chef wußte wohl, wie schwer es ist, Nashörner, diese bislang so selten in die zoologischen Gärten gelangten Dickhäuter, einzufangen.
Auf der Durchreise besuchte ich in Rom den nach dem Stellinger Muster angelegten Tierpark, der, obwohl noch unvollendet, an Größe und an Schönheit alle meine Erwartungen übertraf.
In Neapel schiffte ich mich auf dem Dampfer „Kronprinz“ der Deutschen Ostafrikalinie ein. Die Reise führte durch das Mittelmeer, den Suezkanal, das Rote Meer und den Indischen Ozean. Nach 19tägiger Fahrt legten wir in Kilindini-Mombasa in Britisch-Ostafrika an. Es ist dies der Haupthafen der englischen Kolonie und er hat einen lebhaften Schiffsverkehr.
In halbstündiger Fahrt bringen kleine überdachte Trolleys, von Negern geschoben, den Reisenden samt Gepäck nach Mombasa, der eigentlichen Stadt. Die Fahrt durch das prächtige Grün ist für den, der 19 Tage auf der großen Wasserwüste verbracht hat, ein wahrer Hochgenuß, und besonders zur Blütezeit, wenn der herrliche Duft die Luft erfüllt, wirkt das Ganze geradezu berauschend.
Mombasa macht im Europäerviertel, wo moderne Hotels, Post[S. 13] und Telegraphengebäude, Schulen, Kirchen und Geschäftshäuser stehen, den Eindruck einer europäischen Stadt. Ruinen einer Burg aus dem 15. Jahrhundert sind die letzten Spuren früherer portugiesischer Herrschaft, und hohe arabische Steinhäuser künden von der ebenfalls entschwundenen Macht der Araber. Zwar flattert über dem Kastell noch immer die rote Flagge des Sultans von Sansibar, aber sie ist nur ein Zeichen der diplomatischen Courtoisie Großbritanniens. Zwei schmale saubere und gutgehaltene Straßen führen durch das Geschäftsviertel und berühren das Auge des Europäers angenehm; dagegen zeigen die von Indern und Negern bewohnten Viertel mit ihren engen, unebenen, schmutzigen, jegliche Hygiene entbehrenden Gassen so recht das Gegenteil.
Fast alle größeren Geschäftshäuser sind in den Händen von Europäern oder Indern, nur die kleinen Kaufläden sowie der Markt werden ausschließlich von Indern, Arabern und Suaheli-Negern betrieben. Ein buntes orientalisches Farbenspiel tritt uns hier auf dem Markt von Mombasa vor Augen. Die verschiedenartigsten Menschenrassen tummeln sich da zwischen den mannigfaltigsten Naturprodukten des In- und Auslandes. Berge von Maniokknollen, Bataten, Zuckerrohr, Kokosnüssen, Ananas, Orangen, Zitronen, riesigen Mangofrüchten usw. liegen neben den vom Hochland kommenden europäischen Gemüsen; Hühner, Tauben, Enten, frisches Rind- und Hammelfleisch werden neben allen möglichen Gewürzen Indiens und Arabiens verkauft.
Inmitten von all dem erheben sich notdürftig eingerichtete Geschäftsbuden. Hier hat ein indischer Barbier, der die Negerköpfe blank schabt, seinen primitiven Laden errichtet, dort steht ein arabisches Café neben dem Verkaufstisch, hinter dem ein Suaheli Fische feilbietet. Ein unbeschreibliches Durcheinander von Düften schwebt über dem Ganzen, die Nase des Europäers beleidigend, wohingegen sein Auge durch ein Bild von Farbentönen entzückt wird, wie es kaum die kühnste Malerphantasie sich träumen ließe.
[S. 14]
So ohne weiteres konnte ich allerdings nicht auf Fang ausziehen, sondern mußte mir zunächst von den Behörden die notwendigen Papiere, Jagderlaubnis usw. verschaffen und mich mit den Landesverhältnissen vertraut machen, was mir auch in kurzer Zeit gelang. Unerwartet schnell sollte der sehnliche Wunsch des alten Herrn Hagenbeck in Erfüllung gehen. Erst kürzlich war ein Ansiedler aus dem deutschen Gebiet mit zwei jungen Nashörnern in Voi an der Ugandabahn eingetroffen und hatte in der Nähe der Station sein Lager aufgeschlagen. Auf diese Nachricht hin beschloß ich sofort mit dem nächsten Zuge dorthin zu reisen, um die beiden Dickhäuter für den Stellinger Tierpark zu erwerben.
Die Fahrt auf der Ugandabahn bietet dem Reisenden viele abwechslungsreiche Bilder. Der Zug rollt zunächst durch einen herrlichen Palmenwald, der sich wie ein Gürtel die Küste entlang hinzieht. Eingeborenendörfer, deren Hütten im Schatten dunkelgrüner Mangobäume liegen, tauchen auf. Krausköpfige, nackte Negerkinder werden durch das Heranbrausen der Lokomotive aus ihren Spielen aufgeschreckt und laufen schreiend und winkend dem Zuge nach. Vereinzelt sieht man hier und da einige Ziegen grasen. Rinder bekommt man selten zu Gesicht, denn in diesem Landstrich herrscht die Tsetse-Plage, welche eine Großviehzucht unmöglich macht.
Die Station Machakos ist erreicht. Hier ist dem Passagier die letzte Gelegenheit geboten, sich mit Ananas, Bananen, Orangen und anderen Früchten für die Weiterreise durch die Steppe zu versorgen. Der Palmengürtel liegt nun hinter uns, das Landschaftsbild hat den Charakter der typischen Parklandschaft angenommen. Hier und da stehen einige mächtige Affenbrotbäume (Boabab) und dazwischen vereinzelt große Schirmakazien. Unangenehm macht sich der vom Zuge aufgewirbelte rote Staub bemerkbar, der durch die feinsten Ritzen der Türen und Fenster eindringt. Gegen das grelle Sonnenlicht werden graublaue Schutzfenster[S. 15] heruntergelassen. Nach etwa sechsstündiger Fahrt erreichen wir die Dornbuschsteppe. Sie ist charakterisiert durch dichten, fast undurchdringlichen Dornbusch, verwachsen mit Sansivieren und hohen Euphorbienarten. Gegen sieben Uhr abends ist die Station Voi erreicht.
Am nächsten Morgen in aller Frühe begab ich mich zum Lager des Ansiedlers. Wie jauchzte mir das Herz vor Freude, als ich im provisorisch hergerichteten Kral zwei prächtige Dickhäuter vor mir sah. Es war ein Pärchen etwa zweijähriger Doppelnashörner, und beide schon stark entwickelte Exemplare. Als Tierfänger konnte ich mich leicht in die Erzählung des Ansiedlers hineindenken; manche Strapazen und Gefahren hatte er zu überstehen gehabt, bis er die beiden Dickhäuter glücklich im Kral hatte. Gehört doch schon die Jagd auf Nashörner zu den gefährlichsten ihresgleichen; wieviel mehr steht das Leben des Jägers auf dem Spiel, wenn er diese kampfbereiten Tiere lebend in seine Gewalt bringen will. Sehr oft gerät der Tierfänger beim Fang in schwierige und lebensgefährliche Situationen. Auch ich habe in dieser Hinsicht manche kritische Episode erlebt, wie der Leser aus folgenden Kapiteln ersehen wird.
Wir wurden bald handelseinig, und so konnte ich nach Hamburg telegraphieren: „Schon im Besitz zweier Nashörner.“ Wenige Stunden später lief die Antwort ein: „Gratuliere, Hagenbeck!“ Da auf der Ugandabahn wöchentlich nur zwei Züge verkehrten, so nützte ich meinen Aufenthalt in Voi zu einigen Streifzügen in die Ebene aus, um die Tierwelt zu beobachten. Vorherrschend war in jenem Gelände die Dornbuschsteppe, aus der sich einige hohe Berge erhoben. Überall konnte ich ein reiches Tierleben feststellen; verschiedene Antilopenarten, Giraffen, Nashörner, Löwen und Leoparden, Wildschweine, Affen und eine Menge Vogelarten halten sich in der Steppe auf. Zahlreiche Wildwechsel und Fährten führten zum Voifluß, an den das Wild zur Tränke zog.
[S. 16]
Der Transport der beiden Nashörner zur Küste bot keine besonderen Schwierigkeiten, da die Eisenbahn zur Beförderung der Tiere in Anspruch genommen werden konnte. Nicht immer so leicht wie hier gestaltet sich ein Tiertransport durch das wegelose Innere. Da muß mitunter in unwirtlichen Gegenden erst Schritt für Schritt der Weg gebahnt werden, über den sich die Karawane mühselig hinschlängelt. Solche Tierfang-Expeditionen verschlingen große Geldsummen, ohne daß sich dabei der Tierfänger dem Luxus mancher modernen Sportsjäger und Afrikareisenden hingibt; Extravaganzen sind für ihn von vornherein ausgeschaltet. Hier heißt es das Wild in der Natur zu beobachten und zu studieren, die Tiere lebend und unverletzt in seine Gewalt zu bringen, in Augenblicken der Gefahr entschlossen zu handeln und oft als erster mit Lebensgefahr für andere einzuspringen. Doch nicht genug damit: der Tierfänger soll seine Beute auch gesund und wohlbehalten zur Küste und von da in zivilisierte Länder bringen. Um dieses bewerkstelligen zu können, muß er reichliche Erfahrung in seinem Fache gesammelt haben. Die Pflege und Aufzucht exotischer Tiere ist eine Wissenschaft für sich, die nur ein ausgezeichneter Tierfreund sich anzueignen vermag. Jedes Tier muß individuell behandelt werden, soll dasselbe, das von einem Rudel oder Muttertier abgesprengt wurde, nicht zugrunde gehen. Auch steckt den meisten Tieren die ausgestandene Angst vom Einfangen noch in den Gliedern, und das Neue ihrer Umgebung versetzt sie zuweilen in einen solchen Zustand der Erregung, daß sie am Herzschlag tot zusammenbrechen. Allem diesem wird ein geschickter Tierfänger Rechnung tragen und seinen Pfleglingen alle Liebe und Sorgfalt angedeihen lassen. Eine Karawane wird auch stets eine Anzahl von Milchkühen, Ziegen sowie Milchvorräte mit sich führen, damit die Tier-„Babies“ genügend Nahrung bekommen. Ist aber eine wasserarme Gegend zu durchqueren, so muß reichlicher Wasservorrat auf den Lasttieren oder auf den[S. 17] Köpfen der Träger mitgeschleppt werden; dabei hat der Karawanenleiter auch sein Päckchen Sorge zu tragen, damit es den Tieren, aber noch mehr den Menschen an nichts gebricht. Die Anhänglichkeit vieler Tiere an Menschen, die ihr Vertrauen gewonnen haben, sowie ihr Gedächtnis für gute Behandlung ist mitunter ganz erstaunlich. Dies sind die Freuden des Karawanenleiters, die ihm über alle Sorgen und Strapazen hinweghelfen.
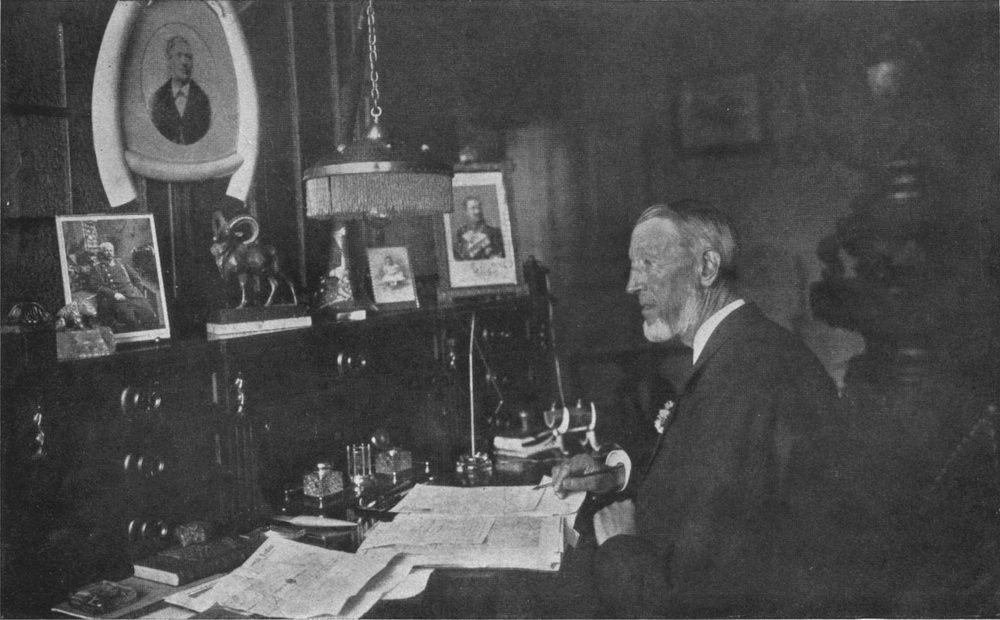
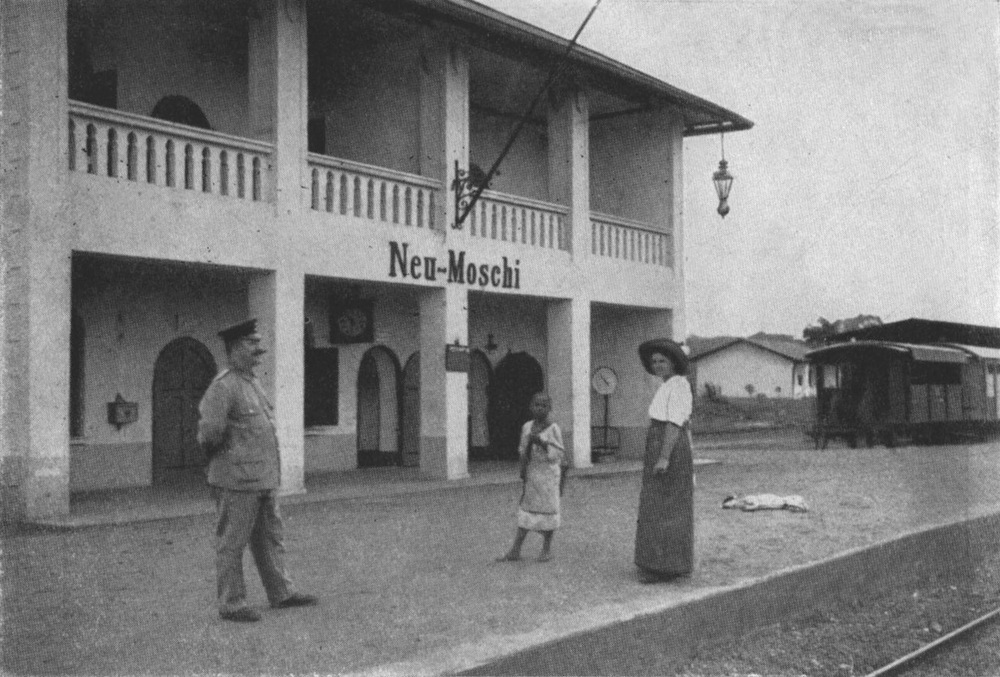
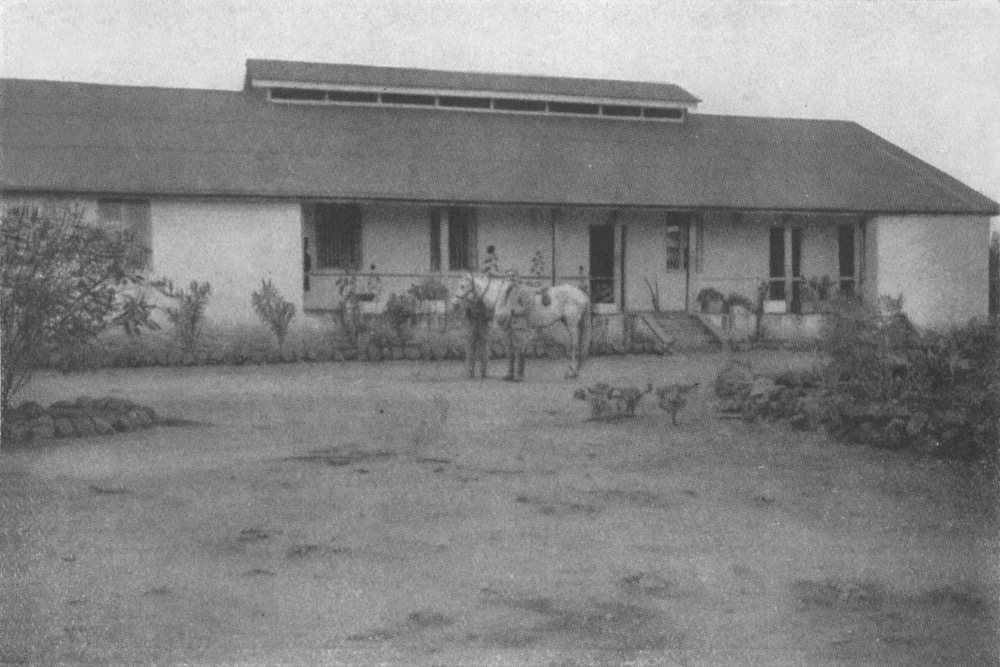
Die beiden Nashörner, Bob und Marianne, brachte ich mit ihren Wärtern, zwei Masais, zur Küste. Dies war bei der Anhänglichkeit der Dickhäuter an ihre zwei schwarzen „Nurses“ äußerst einfach. Bis zur Bahnstation liefen Bob und Marianne wie Hunde ihren Wärtern nach. Sie folgten ihnen auch willig über die Rampe in den Bahnwagen, und fort ging die Reise nach Mombasa. Ein in der Nähe der Stadt liegender Platz mit wilder Vegetation war wie geschaffen zum Aufenthalt meiner beiden Nashörner. Der Besitzer dieses Platzes, ein liebenswürdiger Österreicher, der hier ein Hotel baute, stellte ihn mir gerne zur Verfügung und zeigte selbst das lebhafteste Interesse für meine Pfleglinge. Für die Bewohner von Mombasa war die Ankunft der beiden Nashörner ein außergewöhnliches Ereignis; alt und jung lief herbei, um die beiden Dickhäuter anzustaunen. Natürlich bekam ich von den Eingeborenen sofort den Namen „Bwana Kifaru“, die Suaheliworte heißen auf deutsch: Herr Nashorn. Die Schwarzen haben nämlich die eigentümlichen Gewohnheiten, jeden Europäer nach irgendeinem ihnen auffallenden Merkmale zu benennen und die europäischen Namen ganz zu ignorieren.
So anhänglich und sanft Bob und Marianne gegen ihre Wärter und auch bald gegen mich waren, so abweisend und grob konnten sie gegen allzu zudringliche und neugierige Besucher werden, und einige der letzteren machten trotz gutgemeinter Annäherungsversuche unangenehme Erfahrungen. Einer der ersten hierunter war der Eigentümer des Platzes selbst. Er pflegte, sooft er den[S. 18] Bau seines Hotels besichtigte, bei den Tieren vorzusprechen und ihnen Leckerbissen zu reichen. Eines Tages wollte er Bob kraulen, aber das Nashorn verstand die Handbewegung falsch und senkte prustend das Horn gegen ihn. Der Herr suchte sein Heil in schleunigster Flucht. Von Bob verfolgt, rettete er sich auf einen aufgeschütteten Sandhaufen, dessen lockeres Material dem schweren Nashorn glücklicherweise nicht erlaubte nachzukommen. Auch Marianne stürzte herbei und unterstützte ihren Gefährten, den Herrn auf dem Sandhaufen zu bewachen. Erst das Eintreffen des Wärters machte der tragikomischen Szene ein Ende. Willig folgten die Tiere dem Masai und ließen von ihrem erschreckten Opfer ab.
Da ich die beiden Nashörner gut untergebracht hatte und in angemessener Pflege wußte, konnte ich ohne Sorge mich nach weiteren Tieren umsehen. Zunächst reiste ich mit dem Dampfschiff von Mombasa nach Tanga in Deutsch-Ostafrika, weil mir von dort verkäufliche Tiere gemeldet wurden. Der Wechsel aus einer englischen in eine deutsche Kolonie ist sofort fühlbar. Während z. B. auf englischem Gebiet an der Ugandabahn aufwärts weite Strecken noch unbebaute Steppen sind und erst über 300 Meilen von der Küste entfernt bei der Hauptstadt Nairobi Farmbetrieb beginnt, sieht man auf deutschem Boden, wie Arbeitslust und Methode schon von der Küste an die Natur zur Produktion zwingt. Gleich bei Tanga fährt die Bahn durch Kokospflanzungen, bald aber wechseln diese mit Kautschukplantagen ab, welche aus prächtigen Bäumen bestehen, so daß man glauben könnte, durch einen wohlgepflegten deutschen Laubwald zu fahren. Dann folgen wieder meilenweit Sisal-Pflanzungen usw., kurz, wo man hinsieht, trifft man auf verständige Ordnung und methodische Arbeit. Auch fällt dem Besucher bei der Ankunft in Tanga, wenn er vorher das englische Mombasa besucht hat, das gesetzte und ruhige Benehmen der Bevölkerung wohltuend auf gegen das unverschämte lärmende und streitsüchtige Gebaren der Eingeborenen in Mombasa. Tanga[S. 19] ist ein sehr hübsch gelegenes Städtchen mit breiten baumbepflanzten Straßen und prächtigen Gebäuden, villenartigen Wohnhäusern, guten deutschen Hotels; ein vorzüglich eingerichtetes Hospital, Post- und Telegraphenamt nebst stattlichem Bezirksgebäude, verschiedene christliche Kirchen und Schulen, Banken und Geschäftshäuser geben Zeugnis von dem Aufblühen der Stadt. Die schwarzen Beamten der Post sprechen deutsch nebst Suaheli, der Landessprache. Der Dampfertag ist immer ein Festtag für die Bewohner der Stadt und wird abends durch ein Konzert der Negerschülerkapelle auf dem Bismarckplatz gefeiert. Alles kommt zu diesen Konzerten, um bei einem Glase Bier heimatlichen Weisen zu lauschen.
Von Tanga aus unternahm ich einige Streifzüge in das Usambaragebirge und an den Panganifluß. Hier konnte ich einen rechten Einblick gewinnen, welchen Schatz an Wild unsere Kolonie besitzt. Wohl wenige Länder der Erde haben einen derart reichhaltigen und verschiedenartigen Wildbestand aufzuweisen. In dem sich längs des Flusses hinziehenden Buschgelände tummeln sich die flinken und drolligen Meerkatzen. Diese meist auf Bäumen lebende Affenart ist dem Pflanzer bei weitem nicht so unsympathisch, wie die so schädlichen Paviane, welche in den Feldern durch Herausreißen und Vernichten der Kulturen große Verheerungen anrichten. Ein anderes dem Pflanzer verhaßtes Tier ist das Flußschwein. Diese Schweineart richtet ebenfalls in den Mais- und Maniokfeldern ungeheuren Schaden an. Nicht genug, daß sie sich vollfressen, zerwühlen und verwüsten sie alles, was ihnen in den Weg kommt. Der Pflanzer geht diesen Schädlingen zuleibe, wo er nur kann. Löwe und Leopard sind die einzigen Tiere, die unter den Schwarzkitteln aufzuräumen verstehen, weshalb die beiden sonst so gefürchteten Raubtiere vielfach den Schutz des Ansiedlers genießen.
An Großwild konnte ich einen prächtigen Kaffernbüffel aus dem Schumewalde, Bubalus caffer rufuensis Zukowsky, erstehen.[S. 20] Das kraftstrotzende schwarzbraune Tier, mitten in einer Rinderherde äsend, repräsentierte mit seinem starken Gehörn, dunkeln Lichtern, zottiger Decke und langbehaarten Ohrrändern so recht die Stärke und das bösartige Aussehen seiner Sippe. Der Büffel wurde nebst anderem afrikanischen Wild zur Küste transportiert. Ich bestieg in Tanga wieder das Schiff, und nach 24stündiger Fahrt über Sansibar ankerte der Dampfer in Daressalam.
Daressalam, die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, der Sitz des Gouverneurs, ist nicht nur die schönste Stadt der Kolonie, sondern hat auch den besten Hafen der ganzen Ostküste. Von Norden kommend, nähert sich das Schiff dem weißen Strande der Küste. Zwei vorgelagerte Inseln heben sich deutlich vom Hintergrunde ab. Palmengruppen und weiße Gebäude beleben das Bild. Das Schiff fährt links an den besagten Inseln vorbei und läuft durch eine ungefähr 150 Meter breite Einfahrt in den Hafen. Ein herrliches Panorama entfaltet sich plötzlich: prachtvolle Kirchen, Regierungsgebäude, Villen und andere Baulichkeiten der Europäer schimmern mit ihren weißen Mauern und roten Dächern durch den grünen Gürtel der Kokospalmen.
Der Eindruck am Lande entspricht dem Bilde, welches man vom Schiffe aus sieht. Saubere, breite, mit Akazienbäumen bepflanzte Straßen führen durch die Stadt. Denkmäler erinnern an die Verdienste unserer Helden in Kolonie und Heimat. Überall herrscht reges und geselliges Leben. Durch die Straßen flitzen flinke Rikschas, die man sonst nur im fernen Osten sieht, jene leichten zweirädrigen, von Farbigen gezogenen Wagen. Hotels, Klubs, Geschäftshäuser, eine Brauerei, eine Eisfabrik und sonstige Betriebe sorgen für die Bedürfnisse der Europäer. Auch im Eingeborenen- und Inderviertel herrscht trotz der bunten Abwechslung Ordnung und Reinlichkeit. In der Umgebung der Stadt wechseln Palmenhaine mit saftigen Rasenflächen und gut gepflegten Pflanzungen ab. Die Stadt befindet sich im vollen Aufblühen.[S. 21] Handel und Verkehr haben sich in den letzten Jahren über Erwarten gut entwickelt.
Allerdings finden wir hier an der Küste nicht die gleich günstigen klimatischen Verhältnisse, wie solche im Innern auf den Hochländern im Norden herrschen. Der Europäer kann aber auch hier bei entsprechender Tätigkeit (schwere körperliche Arbeit ist hier selbstverständlich für den Weißen ausgeschlossen) lange Jahre leben, ohne an seiner Gesundheit Schaden zu erleiden, sofern er nur die wenigen leicht zu befolgenden sanitären Vorsichtsmaßregeln beachtet (Chinin-Prophylaxis, Mäßigkeit im Alkoholgenuß usw.). Selbst die früher so gefürchtete Malaria hat infolge des heutigen hohen Standes der modernen Tropenhygiene fast alle ihre Schrecken verloren. Man kann ruhig sagen, daß die gewöhnlich auftretenden Tropenkrankheiten, von denen auf die Dauer wohl kein Kolonist gänzlich verschont bleibt, bei weitem nicht so gefährlich sind, wie man meistens anzunehmen pflegt.
Hier in Daressalam begünstigte mich das Glück. Unser Stellinger Tierpark besaß zwar einige indische Elefanten, hatte aber noch keinen afrikanischen aufzuweisen. Ein solches Tier konnte ich hier auf sonderbare Weise erwerben. „Jumbo“, ein etwa anderthalbjähriger Elefant, war mit Beschlag belegt und stand in Obhut des Polizeiwachtmeisters Fritz. Um den Hals trug der Dickhäuter nolens volens ein schwarz-weiß-rotes Band mit dem bekannten Siegel, welches der Gerichtsvollzieher an gepfändete Sachen anzulegen pflegt.
Auf der Boma (Bezirksamt), woselbst er untergebracht war, wurde Jumbo als Wasserpumper abgerichtet. Freilich war er so schlau, gleich aufzuhören, wenn er genügend Wasser für sein eigenes Ich heraufbefördert hatte. Das vollkommen zahme Tier wurde auch zu allerhand anderen Diensten, z. B. als Plakatträger, verwendet. Auf seinen Gängen durch die Stadt plünderte er oft genug die Marktkörbe der Neger, was jedesmal ein großes[S. 22] Hallo gab; als echter Afrikaner hatte Jumbo ebenfalls eine besondere Vorliebe für Pombe (Bier der Eingeborenen), aber auch für europäisches Bier. Deswegen trieb er sich am liebsten vor den Hotels herum, um dort die Bierreste auszutrinken. Er nahm es auch gar nicht so genau, gelegentlich seinen Rüssel über den Kopf eines ahnungslosen Gastes hinweg in dessen frisch gefülltes Bierglas hineinzustecken; ehe sich’s nun der erschreckte Gast versah, war sein Glas bis auf den Boden leer. Obwohl Jumbo unter polizeilicher Aufsicht stand, brachte es diese doch nicht so weit, ihrem Schutzbefohlenen den Unterschied von Mein und Dein beizubringen. So ohne weiteres konnte ich allerdings nicht in den Besitz des Elefanten gelangen; erst nach Hinterlegung der festgesetzten Summe und durch die unermüdliche Unterstützung eines Rechtsanwaltes war es mir möglich, Jumbo bei dem bald folgenden Abtransport der erworbenen Tiere noch mitnehmen zu können. Inzwischen war ich noch im Morogoro-Gebiet tätig gewesen und konnte dem schon recht ansehnlichen Transport noch eine Anzahl Buschböcke, Hyänenhunde und andere Tiere hinzufügen. Das Einsetzen der Regenzeit machte einen erfolgreichen Fangzug vorläufig unmöglich. Dazu lief noch von der britischen Regierung ein Verkaufsangebot für einen indischen Elefanten ein, weshalb ich mich wieder in das englische Gebiet begab. Dieser Elefant war vor einem Jahre von der Kolonialregierung als Lasttier in das Ugandagebiet importiert worden. Der Versuch hatte aber den Erwartungen nicht entsprochen, und so konnte ich das Prachtexemplar erwerben.
Zwischen dem indischen Elefanten (Elephas indicus L.) und dem afrikanischen (Loxodonta africana Blbch.) besteht ein großer Unterschied. Der afrikanische Elefant hat bedeutend größere Ohren als der indische. Die Stirn des afrikanischen Elefanten ist flach, während sie beim indischen gewölbt ist. Die Stoßzähne des Afrikaners sind stärker entwickelt als die des Inders. Beim ersteren tragen[S. 23] beide Geschlechter Elfenbein, während bei dem letzteren solches den Kühen fehlt, bei den Bullen häufig auch nicht vorhanden ist. Die Rückenhöhe des afrikanischen Elefanten ist bedeutend höher als die des indischen.
Die Behörde sandte mir laut Vereinbarung den indischen Elefanten „Futki“ mit seinem Mahut (indischen Wärter) nach Mombasa. Dieser Riese war entschieden das verwöhnteste und kostspieligste Tier unter meinen Schützlingen. Außer 20 Pfund Reis pro Tag verschlang er noch große Mengen von Zuckerrohr und Bananenstauden und brauchte täglich sein Bad. Tagsüber bestreuen sich die Elefanten mit Erde und Sand, um sich gegen die Fliegen zu schützen. Zusammen mit der Hautfeuchtigkeit bilden diese Erde- und Sandteilchen allmählich eine richtige Borke auf der Haut, die durch Wasser und kräftiges Scheuern wieder abgerieben wird. So wurde Futki täglich in Mombasa an einen Brunnen in der Nähe des deutschen Konsulats geführt, dort kniete er nieder: einige Schwarze schöpften Wasser aus dem Brunnen und schütteten es über den Koloß, während der Wärter auf ihm stehend die Haut mit einem Besen richtig abschruppte. Ich hatte für Futki einen günstigen Platz bekommen, und zwar in allernächster Nähe des Aufenthaltsortes meiner Nashörner. Ein mächtiger Mangobaum stand da, an den das große Tier angebunden wurde und wo es Schutz vor der brennenden Sonne fand. Natürlich war der Platz beständig von Gaffern umlagert, besonders von den Indern der niederen Klasse. Nach einem alten indischen Glauben gibt das Durchkriechen unter dem Leib eines Elefanten dem Weibe Fruchtbarkeit. Viele Inder brachten deshalb schleunigst ihre vermummten Weiber herbei und ließen sie unter den Elefanten durchkriechen, so daß beständig ein Unglück zu befürchten war; auch die Elefantenlosung wurde säuberlich von den Indern weggeholt. Wahrscheinlich war auch hier irgendein religiöser Grund mit im Spiel.
[S. 24]
Einige Wochen später konnte ich den beiden Nashörnern „Bob“ und „Marianne“ noch einen Stammesgenossen zugesellen, dem sein natürlicher Suaheliname „Kifaru“ (Nashorn) beigelegt wurde. Es war ein junger Bulle und ein wenig kleiner als Marianne. Seine Unterkunft verursachte eine interessante Szene. Der Neuankömmling wurde von Bob und Marianne mit lautem Gepruste begrüßt und zunächst mit einem Angriff beehrt. Nachdem einige tüchtige Rippenstöße als gegenseitige Begrüßung ausgewechselt waren, befreundeten sich die Tiere rasch, und schon am Abend schliefen sie in friedlicher Eintracht nebeneinander.
Es war erstaunlich, wie flink und gelenkig sich die drei Tiere trotz ihres schweren und plumpen Körpers beim Spiele zeigten. Stundenlang ergötzten sich die Besucher an ihrem Treiben. Zu den ständigen Besuchern zählte auch ein Pater aus der benachbarten Missionsstation. Der Hochwürdige trat eines Morgens, als die Wärter nicht zugegen waren, in das Gehege der Nashörner ein, um seine Lieblinge zu besuchen. Auf einmal wandten sich Bob und Marianne schnaubend gegen den verdutzten Herrn, dem nichts anderes übrigblieb, als mit hochgeschürzter Soutane Reißaus zu nehmen. Das Komische des Auftrittes erhöhte sich noch, als der Pater auf dem Wege der Flucht an einem Ehepaar vorbeilief, auf welches nun die beiden Nashörner zustürzten. Der zärtliche Ehemann ergriff mit seinen langen Beinen schleunigst die Flucht und ließ seine Lady stehen, die nichts weiter tun konnte, als ihren grellen Sonnenschirm als Schutz vor sich zu halten. Die herbeieilenden Wärter erschienen gerade noch zu rechter Zeit, konnten die Tiere beruhigen und die Dame aus ihrer peinlichen Lage befreien.

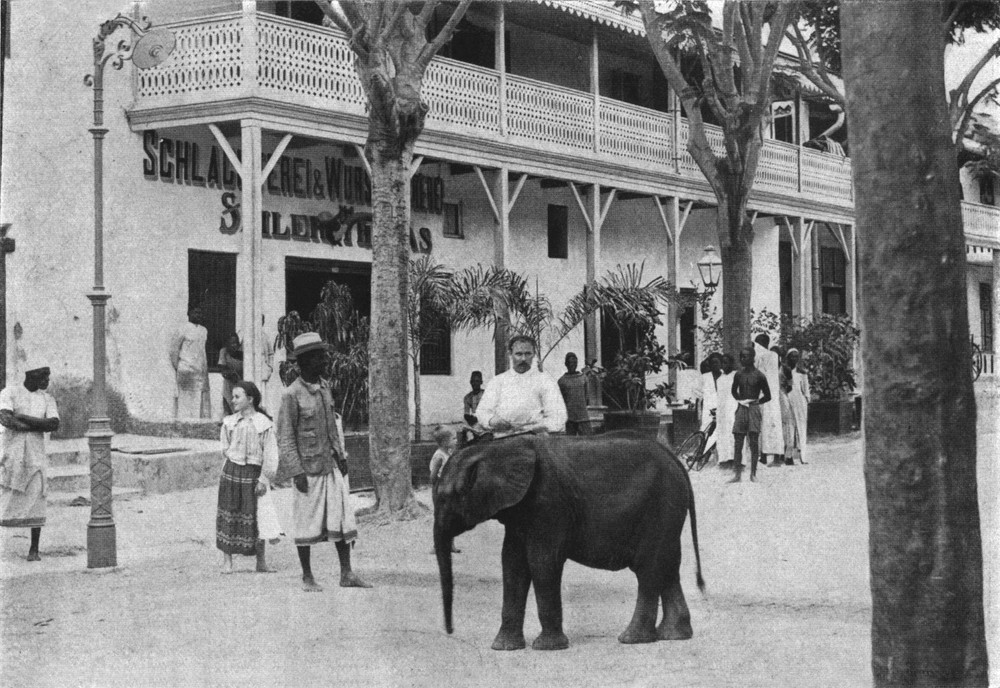
Es war nun die höchste Zeit geworden, die vielen verschiedenen Transportkästen für die Reise nach Hamburg herzustellen. Große Mengen von Nahrungsmitteln aus dem Tier- und Pflanzenreiche mußten für die verschiedenen Tiere beschafft werden. Alles[S. 25] dieses erforderte große Umsicht und war mit vielen Unkosten, Mühe und Arbeit verbunden.
Nach Eintreffen des Überseedampfers „Herzog“ bewegte sich die ganze Karawane nach Kilindini, woselbst die Tiere in ihren bereitgehaltenen Transportkästen auf das Schiff verladen wurden; nur der indische Elefant Futki konnte in seiner Riesenkiste nicht transportiert werden. Er wurde an den Kai geführt und mit einem angelegten Bauchgurt durch einen Kran auf den Leichter hinabgelassen. Der Leichter wurde längsseit des Dampfers bugsiert und auf gleiche Weise wurde hier der große Dickhäuter mittels Schiffswinden an Bord befördert, wo sein Transportkasten bereit stand. Während des ganzen Verschiffungsvorganges saß der indische Wärter auf dem Nacken des Elefanten, um das Tier zu beruhigen. Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln ließ sich der Riese die Schwebefahrt nicht ohne energischen Widerstand gefallen. Besonders beim Übernehmen auf den Dampfer, als ihn einige Male die Kranketten unsanft berührten, und er mit dem Kopf gegen die Bordwand stieß, geriet er in Wut und begann ein ohrenbetäubendes Trompeten. Das aufgeregte Tier schlug mit dem Rüssel und mit den Beinen um sich, und es bedurfte der ganzen Geschicklichkeit des Mahuts, ihn einigermaßen zu beruhigen. An Bord wurde dem Elefanten der Bauchgurt abgenommen, worauf er mit großer Mühe in seinen Transportkasten gebracht wurde. An völlige Bewegungsfreiheit gewöhnt, begann der Dickhäuter, sobald der Kasten geschlossen war, mit all seinen ungeheuren Kräften sein Gefängnis zu sprengen. Trotzdem er an Vorder- und Hinterbeinen gefesselt war, und trotz der starken Konstruktion des Kastens, gelang es ihm, seinen Käfig teilweise zu zertrümmern, so daß uns nichts anderes übrigblieb, als das aufgeregte Tier zu befreien und ihm einen isolierten Platz an Deck zu suchen, wo seiner erwachten Zerstörungswut jeder Gegenstand fehlte. Endlich konnte ich aufatmen, denn während des ganzen Verladungsvorganges[S. 26] war ich in beständiger Furcht, daß jemand aus den umdrängenden schaulustigen Fahrgästen von dem erregten Tier verletzt werden könnte.
Jetzt kamen noch die Nashörner zur Verladung. Auch diese waren sehr aufgeregt und gebärdeten sich wie toll in ihren Kästen. Um die Tiere etwas zu beruhigen, wollte ich die beiden schwarzen Wärter bis zur Abfahrt des Dampfers mit an Bord nehmen. Dies stellte sich aber als das schwerste Stück Arbeit der ganzen Verschiffung heraus. Waren die beiden aus dem Innern stammenden Wilden schon von maßlosem Staunen erfüllt, als sie das erstemal das unendliche Meer und die darauf schwimmenden Riesenschiffe sahen, so wollten sie um keinen Preis ein solches Zauberschiff besteigen. Es bedurfte meiner ganzen Überredungskunst und Autorität, um die wie Kinder vor Furcht weinenden Männer ins Boot und auf den Dampfer zu bringen. Vielen Spaß machte uns allen das Benehmen der beiden Masais an Bord. Furcht, Neugierde und Erstaunen wechselten in ihrem lebhaften Mienenspiel. Alles für sie Unbegreifliche, besonders die elektrische Beleuchtung und das einfache Ein- und Ausschalten derselben jagte ihnen eine abergläubische Furcht ein. Nachdem die beiden Schwarzen zum letztenmal ihre Pfleglinge, die Nashörner, gefüttert und beruhigt hatten, entließ ich sie reich beschenkt in ihre Heimat.
Es ist schon schwer auszudrücken, welche Sorgen einem Transportbegleiter auferlegt werden, wenn er die der Wildnis entrissenen Tiere gesund nach Europa bringen will. Ganz abgesehen davon, daß die meisten derselben an ein ihnen fremdes Futter gewöhnt werden müssen, hat das Wild in den nur wenig Raum gewährenden Transportkisten und unter den klimatischen Einflüssen schwer zu leiden. Das Rollen des Schiffes übt auch auf die meisten Tiere seine Wirkung aus. Sie werden seekrank und können durch Nahrungsverweigerung leicht eingehen. Gerade deshalb,[S. 27] weil an den Tieren beim Transport nicht die richtige Sorgfalt und verständnisvolle Pflege angewendet worden ist, sind so manche Exemplare nicht lebend nach Europa gekommen. Auch ich hatte meine liebe Not mit der Aufwartung aller meiner Pfleglinge, bei welcher mir der mitgenommene Mahut und einige Leute eifrigst zur Hand gingen. Manchmal hieß es entschlossen zuzugreifen, um Unheil vorzubeugen. Der Postdampfer „Herzog“ war wirklich wie in eine Arche Noah verwandelt. Außer den Elefanten und Nashörnern waren viele Kästen mit Antilopen, darunter eine prächtige Elenantilope, Busch-, Ried- und Sumpfböcke, ein Kaffernbüffel, Affen, Krokodile, Schlangen, Strauße und Vögel aller Art teils an Deck und teils in den Schiffsräumen untergebracht. Am meisten Sorge machte mir ein Colobusaffe. Diese Affenart ist wegen ihrer Empfindlichkeit gegen Nahrungswechsel äußerst schwierig zu transportieren. Das Tier gelangte aber wohl und gesund in Hamburg an.
Die kritischsten Stunden waren für mich dann, wenn wir einen Hafen anliefen. Der Verkehr und Tumult an Deck, sowie das Rasseln der Winden und Ketten beim Ein- und Ausladen der Frachtgüter versetzte die Tiere stets in große Aufregung. Ich war daher froh, wenn wir wieder auf See waren und die Tiere dann sich allmählich beruhigt hatten. An kleinen Zwischenfällen, teils ernster, teils heiterer Art, sollte es auch auf dieser Fahrt nicht fehlen.
Es gab eine komische Szene, als unsere beiden Elefanten sich beim Morgenspaziergang an Deck einander begegneten. Da der große indische Elefant ein sehr gutmütiges Weibchen war und Jumbo ein junger Bulle, so war keine Feindseligkeit zwischen beiden Tieren zu befürchten. Jumbo näherte sich dem großen Elefantenweibchen und beschnüffelte es, wollte sich aber weiter nicht mit der indischen Gefährtin abgeben. Futki aber schien von der mangelnden Galanterie des jungen Herrn nicht erbaut zu[S. 28] sein, sondern wünschte offenbar nähere Bekanntschaft zu machen; als ihm Jumbo daher die Kehrseite zudrehte, packte Futki ihn mit dem Rüssel am Hinterbein, worauf Jumbo vor Schreck in ein jämmerliches Trompeten ausbrach. Darauf brummte Futki verächtlich und ließ den kleinen Afrikaner laufen. Derselbe nahm Reißaus und wollte nichts mehr von der großen Dame wissen.
Jumbo war auf dem Vorderdeck untergebracht. Die Schiffsmannschaft mußte, um in ihre Räume zu gelangen, jedesmal an ihm vorübergehen. Der Elefant streckte jedem Vorübergehenden zutraulich den Rüssel entgegen, denn er wußte aus Erfahrung, daß jedermann ihm etwas zu geben pflegte. Er wurde auch hier von den Matrosen mit Zuckerstücken, Brot und Früchten reichlich versehen. Eines Tages aber warf ihm ein boshafter Araber ein Stückchen Eis in den aufgesperrten Schlund. Da die kolbenförmige Zunge des Elefanten es ihm unmöglich macht, einen Gegenstand, der einmal zwischen die vorgestreckte Zunge und den Schlund geraten ist, wieder auszuspeien, so mußte Jumbo den Eisbrocken verschlucken und erschrak mächtig durch das unbekannte, vom Eisstückchen erzeugte Kältegefühl. Er merkte sich aber den Missetäter, und eines Morgens, als wir Jumbo etwas herumlaufen ließen, kam ihm gerade der bewußte Araber mit einem Teekessel in den Weg. Jumbo entriß ihm denselben und goß sich ohne weiteres den Inhalt in den Rachen. Der zu heiße Trank verbrannte ihm aber das Maul, und wütend schleuderte er den Teekessel zu Boden. Da er an eine neue Tücke des Arabers glaubte, stürzte er sich wütend auf denselben, und nur dem Umstand, daß der Mann sich blitzschnell auf eine in der Nähe befindliche Treppe flüchten konnte, verdankte er seine Rettung vor dem Rüssel Jumbos. Dieser Vorfall veranlaßte mich, den Elefanten auf dem Achterdeck unterzubringen, damit er nicht ganz verdorben würde und kein weiterer Unfall vorkäme. So gutmütig die klugen Tiere sind, so bösartig können sie durch stetes Necken und Quälen werden.[S. 29] Dabei haben sie ein ganz außerordentliches Gedächtnis sowohl für gute als auch für schlechte Behandlung. Ein anderes Mal hatte ich nach einem recht anstrengenden Tage mich gerade zu Bett begeben, als der Steward mich mit den Worten heraustrommelte: „Kommen Sie schnell, Jumbo ist los und läuft an Deck herum!“ Auf einen solchen Fall vorbereitet, griff ich aus dem Zuckerpaket eine Handvoll Zuckerstücke und brachte ohne Mühe Jumbo, der in den Speisesaal eingedrungen war, auf seinen Platz zurück. Mit Hilfe einiger Leute der Schiffsmannschaft baute ich nun rasch eine Art Kral, um dem Tiere ein wenig Bewegungsfreiheit zu lassen, es aber am Herumlaufen zu hindern. Wir schleppten die schweren Transportkisten der Nashörner, des Büffels usw. heran und stellten sie um Jumbo herum auf, im Glauben, daß sie mit ihrem lebenden Inhalt schwer genug seien, um den Elefant als Zaun zu dienen. Gerade war ich wieder am Einschlafen, als ich zum zweitenmal geweckt wurde. „Jumbo ist wieder los!“ Wieder ging’s an Deck, wo mir Jumbo freudig entgegengrunzte und mir mit Hilfe des zu erwartenden Zuckers wieder gehorsam an seinen Platz folgte. Diesmal wurde er aber mit Tauen gefesselt. Bei diesem Ausbruch hatte Jumbo den ersten Schiffsingenieur, der in tiefem Schlafe in seiner Kabine lag, zu Tode erschreckt. Bei seiner Entdeckungsreise war der Elefant nämlich an dessen Kabine vorbeigekommen und hatte seinen Rüssel durch das offene Fenster hineingestreckt und im Dunkeln herumgetastet. Der Ingenieur, einen warmen Luftzug über seinem Gesicht fühlend, hatte instinktiv die Hand erhoben und war in Berührung mit dem Rüssel gekommen. Blitzschnell kam ihm der Gedanke, eine der Riesenschlangen befinde sich in seiner Kabine, und voller Schrecken fuhr er aus seinem Bett. Jumbo aber war durch die Berührung mit seiner Hand selbst erschreckt und trompetend abgezogen, während dem Ingenieur klar wurde, mit wem er es zu tun hatte.
Da in der Freiheit die Elefanten nachts äsen, so ist es erklärlich,[S. 30] daß sie besonders gern während der Nacht Unfug anstellen. Auch Futki trieb manchmal Allotria. Eines Nachts fiel ihm ein, die zum Schutze gegen die Sonne aufgespannten Segeltücher zu zerreißen; ein anderes Mal machte er sich an einer Winde zu schaffen. Er ergriff einen Hebel und bog die Stange krumm, als wenn sie Draht gewesen wäre. Der Schiffsschmied hatte eine Stunde Arbeit, um sie wieder auszurichten. Das ging aber Futki gegen den Strich, er ergriff die Stange zum zweitenmal und brach sie mit einem kräftigen Ruck in der Mitte entzwei. Es blieb nichts anderes übrig, als ihn beständig zu überwachen und ihn von Zeit zu Zeit spazieren zu führen. Dies geschah zur Freude der Passagiere, die den Riesen mit allerlei Leckerbissen bedachten. Besonders hatten die Kinder eines mitreisenden Oberstabsarztes mit Futki Freundschaft geschlossen, so daß ich bei der Gutmütigkeit des Tieres dem sehnlichen Wunsch der Mädchen, auf dem Elefanten spazieren zu reiten, nachkommen konnte.
Die drei Nashörner waren durch die lange Seefahrt oft sehr erregt, so daß ich sie nur selbst füttern konnte. In ihrer ärgerlichen Stimmung boxten sie mir manchmal den Futternapf aus den Händen, so daß die kostbare Milch über den Boden floß. Dies bereitete allerdings den zusehenden Passagieren ein großes Vergnügen, bekam aber mir und meinen Kleidern weniger gut.
Je mehr wir uns der nordischen Heimat näherten, desto kühler wurde es, und die an die afrikanische Wärme gewöhnten Tiere mußten gegen das rauhe Klima geschützt werden. Da war es nun ein schwieriges Problem, in dem beschränkten Raum des Schiffes geschützte Stellen für alle Tiere zu finden. Wir hatten unsere liebe Not, aber dank des freundlichen Entgegenkommens von Kapitän und Offizieren wurde Rat geschaffen. Am empfindlichsten gegen die Kühle zeigte sich der indische Elefant. Wir mußten ihn daher im Zwischendeck unterbringen. Da es auf den Seiten zu niedrig für die Höhe Futkis war, so richteten wir ihm einen Platz auf[S. 31] der Ladeluke her, deren Deckbretter mit Segeltuch überzogen wurden. Während der Nacht zerriß der Elefant dieses Segeltuch in Fetzen und begann die einzelnen Planken der Ladeluke aufzuheben und in den Raum zu werfen. Als mich der erschreckte Mahut morgens um vier Uhr herbeigeholt hatte, stand Futki nur noch auf drei Beinen auf den übriggebliebenen Planken, mit dem vierten pendelte er in der Luft. Jeder Fehltritt hätte das Tier in die drohende Tiefe befördert. Schleunigst ließ ich den ersten Offizier in Kenntnis setzen, und erst nach mehrstündiger Arbeit gelang es wieder, alles in Ordnung zu bringen. Ich blieb zur Beobachtung in der Nähe, und als der Elefant wiederum am Rande seines Standplatzes nach einem Segeltuchzipfel suchte, um sein Zerstörungswerk fortzusetzen, erhielt er einen kräftigen Schlag auf sein Greiforgan. Nachdem ich nun wußte, wo er anfing, ließ ich den ganzen Rand seines Standplatzes von dem Mahut mit der Losung des Elefanten belegen. Das half prompt, denn sobald das Greiforgan, das zugleich ein sehr empfindliches Riechorgan ist, die Losung berührte, fuhr es mit Abscheu zurück. Nach mehreren gleichen Erfahrungen in allen Richtungen gab das Tier endlich die Zerstörungsversuche auf.
Nach 28tägiger Seereise liefen wir in die Elbmündung ein. Ich hatte den Verlust nicht eines einzigen Tieres zu beklagen. Alle waren wohl und gesund. Dies meldete ich telegraphisch von Cuxhaven aus meiner Firma, damit sie alle Vorbereitungen zum Abtransport treffen konnte. Inzwischen ließ ich alle Transportkästen an Bord bereitstellen, jedoch verspätete sich unsere Ankunft in Hamburg, und ehe der Dampfer am Amerikakai festlag, war es bereits dunkel geworden. Der alte Herr Hagenbeck, der schon längst unsere Ankunft erwartet hatte, kam sofort an Bord und begrüßte mich aufs herzlichste. Er gab seiner Freude über den schönen Transport dadurch Ausdruck, daß er mir wiederholt die Hand drückte, und seine schlichten Worte: „Bis doch en ganzen[S. 32] fixen Kerl!“ waren mir lieber als alle anderen Anerkennungen, die mir gezollt wurden.
Das Ausladen der Tiere konnte wegen der vorgerückten Stunde nicht mehr vor sich gehen. Der Nachtkühle wegen mußten sie wieder an ihre geschützten Plätze gebracht werden. Dabei wäre uns beinahe der indische Elefant verunglückt. Beim Herablassen in den Laderaum versäumte der die Winde bedienende Mann die kleine Übersetzung der Bremse einzuschalten. Als nun beim Ausschalten der Zahnräder die Last abgelassen werden sollte, war die Bremswirkung nicht stark genug, und das gewaltige Tier sauste mit großer Geschwindigkeit in die Tiefe. Hätte es nicht instinktiv seinen Kopf und seinen Rüssel eingezogen, so wäre ihm letzterer von der scharfen Kante der Ladeluke glatt abgeschnitten worden. Es war wirklich ein Glück zu nennen, daß der Elefant unverletzt ankam und nur durch das starke Aufprallen auf seine Beine heftig erschreckt wurde, was zur Folge hatte, daß er die ganze Nacht sehr aufgeregt blieb und von Bauchgurt und Kran nichts mehr wissen wollte. Am nächsten Morgen begann das mühevolle Ausladen. Waren die Tiere schon durch die Veränderung ihrer Plätze gestört worden, so wurden sie noch mehr erregt und gereizt durch die fremde Umgebung und die unzähligen Zuschauer, die sich unaufhörlich herandrängten und uns die Arbeit erschwerten. Namentlich bis wir Jumbo und Futki glücklich aus dem Schiffe hatten, wurde mancher Schweißtropfen vergossen. Futki war von den vorher gemachten Erfahrungen über Bauchgurt und Winde derart erbost, daß es lebensgefährlich wurde, ihm nochmals damit zu kommen. Durch unsere Geduld und Geschicklichkeit gelang auch dieses Kunststück, und bald bewegte sich eine große Karawane von Transportkästen nach Stellingen.


Die nächsten Tage machte ich noch die zugewiesenen Wärter mit den Eigentümlichkeiten der einzelnen Tierarten in bezug auf Futter, Gewohnheiten und Charakter vertraut. Nur bei genauer[S. 33] Kenntnis dieser Dinge ist es möglich, Erkrankungen zu verhüten, die meist durch zu raschen Futterwechsel hervorgerufen werden.
Als ich zum ersten Male in das Gehege der Nashörner trat, senkte Kifaru zur Begrüßung prustend den Kopf. Mein äußerlich veränderter Mensch schien ihm nicht zu gefallen, und erst als er meine Stimme hörte, erkannte er mich als seinen Freund. Am meisten war ich überrascht über den Feinschmecker Futki; ich fand ihn inmitten seiner indischen Kameraden große Mengen von Steckrüben und Schwarzbrot vertilgen, ein Futter, das er auf dem Schiffe beharrlich und stolz verschmäht hatte. Offenbar hatte das gute Beispiel seiner Kameraden und ihre Gesellschaft seinen Sinn gemildert. Jumbo, der Afrikaner, zeigte sich jedoch unverträglich und wurde isoliert, auch gewöhnte er sich nur langsam an die neue Umgebung und das neue Futter. Es sei noch erwähnt, daß Jumbo der erste aus Deutsch-Ostafrika importierte Elefant war, der nach Deutschland gelangte.
Liebe alte Bekannte sah ich wieder, auch meinem berühmt gewordenen westafrikanischen Schimpansen „Moritz“ stattete ich einen Besuch ab. Ich dachte kaum, daß er mich nach so langer Abwesenheit wiedererkennen würde. Doch wie ich ihn beim Namen rief, flog er mir grunzend an den Hals. Lange sollte ich jedoch nicht in der Heimat weilen. Mit unwiderstehlicher Gewalt zog es mich zurück zum schwarzen Kontinent, um in den Urwäldern und Steppen Ostafrikas große Tierfangzüge zu unternehmen, die ich im folgenden schildern werde.
[S. 34]

Ehe man in einem Gebiet wie Deutsch-Ostafrika auf Jagd und Fang auszieht, muß man sich zunächst einmal über die dort herrschenden, von den europäischen gänzlich verschiedenen Landes-, Lebens- und Verkehrsverhältnisse klar sein. Hier spielen zum Erfolge einer Jagd ganz andere Faktoren mit als in Europa. In den zivilisierten Ländern zieht man ganz einfach mit Jagdschein, Büchse, Patronen, Jagdhund, Jagdtasche usw. los, fährt womöglich mit der Bahn, bequemen Jagdwagen oder Automobilen an Ort und Stelle, fährt abends nach Hause zurück oder bleibt schlimmstenfalls in einem Dorfe über Nacht, ohne Sorgen um Unterkunft, Nahrung und Sicherheit des Lebens. Nicht so in der afrikanischen Wildnis! Hier gibt es Steppengebiete, die wohl nie vom Fuße eines Europäers betreten wurden. Hunderte von Quadratkilometern sind gänzlich unbewohnt, denn bei höchstens[S. 35] 8 Millionen Einwohnern hat Deutsch-Ostafrika die doppelte Bodenfläche Deutschlands. Hier gibt es viele Meilen weit keinen Weg und keinen Steg, keine Eisenbahn, keine Post und keinen Telegraphen. In ganz Deutsch-Ostafrika gibt es bis jetzt nur zwei Bahnlinien mit einigen 100 Kilometern und ohne Abzweigungen im Betriebe, die von Tanga nach Moschi und an den Kilimandjaro führende Usambarabahn im Norden und die Mittellandbahn, welche die Verbindung zwischen Daressalam und dem Tanganikasee vermittelt. So heißt es denn marschieren! Man muß zu einer solchen Expedition Trägerkarawanen ausrüsten. Auf dem Marsche trifft man bald auf undurchdringlichen Urwald, bald auf dornige Buschsteppe, bald auf endlose Grasflächen, und plötzlich steht man dann wieder vor tiefen Tälern ohne Abstieg, oder steile Gebirgsrücken versperren den Weg. Da kann man keinen Bauer oder Wanderer nach Weg oder Richtung fragen, denn stunden-, ja tagelang trifft man keinen Menschen. Man ist allein und nur auf Kompaß und Karte angewiesen. Weite Strecken gibt es noch, die auf der Karte als weiße Flecken und unbekanntes Gebiet verzeichnet sind, weil die Gegenden von berufenen Forschern noch nicht betreten und infolgedessen auch noch nicht kartographiert worden sind.
Einen Jagdzug von mehreren Wochen in die afrikanische Wildnis zu unternehmen, heißt unter diesen Umständen zuerst einmal tief in den Geldbeutel greifen und eine gehörige Summe für das Unternehmen vorsehen, dann eine vollständige Karawane organisieren und für jedes Bedürfnis sich bis auf das Letzte und Kleinste zu versorgen. Ist man erst einmal mitten in der Wildnis, so ist die Möglichkeit, Vergessenes noch zu besorgen oder Verbrauchtes zu ersetzen, stets mit großem Zeitverlust verbunden. Nur wer selbst solche Jagdreisen mitgemacht hat, kennt die Schwierigkeiten, die sich bei einem derartigen Marsche bieten. Glücklich ist wohl der, welcher als Regierungsbeamter mit Polizeisoldaten oder Askaris[S. 36] reist und wenigstens sicher sein kann, auch im Innern Träger zu erhalten. Anders ist es jedoch bei dem Privatmanne, der ganz vom guten Willen der Dorfältesten und deren Stammesgenossen abhängt. Damit bin ich nun bei der Hauptschwierigkeit eines Jagdunternehmens in Ostafrika angelangt, nämlich bei der Trägerfrage.
Daß man in wegelosen Gegenden keinen Wagen zum Transport verwenden kann, ist ohne weiteres einleuchtend. Die Verwendung von Packtieren ist in einigen Landstrichen allerdings möglich, in den meisten jedoch deshalb nicht angängig, weil fast überall in den unter 1000 Metern Meereshöhe gelegenen Regionen die Tsetse-Fliege (Glossina morsitans) vorkommt und dort weder Zwei- noch Einhufer gehalten werden können, da der Stich dieser Fliege fast jedes Haustier infiziert und tödlich wirkt. Bis jetzt ist es der Wissenschaft noch nicht gelungen, ein sicheres Mittel gegen diese Landplage zu finden, und so können nur auf den Hochplateaus und in einigen wenigen anderen tsetsefreien Gegenden Rinder, Pferde und andere Haustiere gehalten werden.
Zur Fortschaffung von Lasten, Waren und Gepäck von der Küste nach dem Innern bleibt daher, abgesehen von den beiden genannten Bahnlinien, nur der Eingeborene als Träger übrig. Man muß sich also Neger vertragsmäßig dingen, um mit Gepäck ins Innere des Landes reisen zu können. Jeder Träger trägt im Maximum etwa 30 Kilogramm. Das Gepäck ist also in diesem Gewicht entsprechende Lasten zu zerlegen. Schwerere Gegenstände, die nicht auseinandergenommen werden können, müssen mit Tragstangen von zwei oder mehreren Trägern geschleppt werden. Da aber auch die Nahrung der Leute, Reis, Hirse oder Maismehl mitgeführt werden muß, und man pro Kopf und Tag etwa ein Kilo davon rechnen muß, so ist es klar, daß ein Marsch um so kostspieliger und schwieriger wird, je mehr Gepäck man mitnimmt und je weiter man sich von bewohnten Gegenden entfernt.
[S. 37]
In Daressalam stellte ich nun meine Ausrüstung für die Reise nach dem Rufidji zusammen. Ich warb Träger an und besorgte den nötigen Proviant. Die Konserven werden für den Karawanentransport in Ostafrika in kleinen verschließbaren Kisten verpackt. Hierzu verwendet man mit Vorliebe die leeren Petroleumkisten, die sich zu diesem Zwecke vorzüglich eignen, da sie sehr leicht und handlich sind. Ein Träger wird immer eher zu einer vollgepackten Petroleumkiste greifen als zu einer größeren Last, selbst wenn letztere viel leichter ist. Sachen, die sich nicht in Kisten verpacken lassen, werden mit Sackleinwand und wasserdichtem Stoff umwickelt und dann mit Kokosstricken umschnürt.
Während meiner Reisevorbereitungen machte ich die Bekanntschaft eines Herrn, der als Leiter einer großen Baumwollplantage im Rufidji-Gebiet tätig war. Derselbe schlug mir vor, gemeinsam zu reisen, was ich auch annahm. Außerdem hatte ich mir bereits für meine Zwecke einen landeskundigen, mit den Eingeborenen und der Gegend am Rufidji vertrauten Mann, Herrn Petersen, gesichert, der mich im Utete-Bezirk erwartete.
Gemeinsam mit dem erwähnten Herrn brach ich eines Nachmittags von Daressalam auf. Die Karawane bestand aus 40 Trägern. Im Gänsemarsch ging es vorwärts, und bald hatten wir die Stadt hinter uns. Der Weg war gut und führte durch Palmenhaine und niedriges Buschwerk. Trotz der kühlen Seebrise herrschte doch eine drückende Hitze, so daß unsere Kakihemden bald durchgeschwitzt waren. Um die Träger an die Lasten und die Marschordnung zu gewöhnen, legten wir an diesem Tage nur wenige Kilometer zurück, dann hieß es: „Halt.“ Unter Kokospalmen wurden die Zelte aufgeschlagen, Brennholz herangeschleppt, „poscho“ (Tagesration der Neger) ausgegeben; bald prasselten lustige Feuer, auf denen sich die Schwarzen ihr Essen zubereiteten. Erfrischt nach einem Bade und eingenommener Mahlzeit setzten wir uns vor unsere Zelte und genossen noch für kurze Zeit den Anblick[S. 38] des prächtigen nächtlichen Tropenhimmels. Es war inzwischen stockfinster geworden. Eine Unmenge von Glühwürmchen begannen ihre Reigen und boten unseren Augen ein wundervolles Schauspiel. Die Zikaden verübten ihr lautes Konzert. Die verschiedensten Arten von Insekten wurden von dem Licht unserer Lampen angezogen, aber auch die Moskitos fingen an lästig zu werden. Die Wachen wurden aufgestellt und ihnen eingeschärft, die Wachtfeuer zu unterhalten und uns am Morgen rechtzeitig zu wecken. Bald lag alles im tiefen Schlaf.
In aller Frühe, gegen 3 Uhr, weckte mich der Koch: „Bwana kahawa tajari“ — Herr, der Kaffee ist fertig —. Schnell ging es hoch. Die Leute waren schon dabei, ihre Lasten zusammenzuschnüren, und nach Verlauf einer halben Stunde war die Karawane schon wieder auf dem Marsche, weil wir die Morgenkühle ausnutzen wollten. Es war noch dunkel, und nur einzelne Vogellockrufe zeigten an, daß sich der Morgen näherte. Ehe man sich versieht, ist’s heller Tag, denn die Dämmerung in den Tropen ist nur sehr kurz. Jetzt wird es in den Büschen und Bäumen lebendig. Bunte Vögel aller Art fliegen unter lauter Entfaltung ihrer Stimme umher; Webervögel, die ganze Baumkronen mit ihren kunstvollen Hängenestern bebaut haben, sind schon fleißig bei der Arbeit. Plötzlich ertönt ein lautes, langgezogenes „fai—fa“. Unwillkürlich bleibt man stehen und glaubt, irgendein Mensch habe gepfiffen, bis man inne wird, daß es eine Vogelstimme ist. Dann hört man wieder den Ruf einer Taubenart — tüh — tüh — tüh — usw. immer schneller und im Tone tiefer fallend. Sogar der Ruf des Kuckucks ertönt, man fühlt sich unwillkürlich in einen deutschen Frühlingsmorgen versetzt. Doch bald wird man eines anderen belehrt. Die Sonne steigt immer höher und höher, denn jetzt ist es hier Hochsommer, und glühend heiß sendet die Sonne ihre Strahlen auf uns nieder. Mittlerweile ist es 9 Uhr geworden, wir haben unseren ersten Rastplatz erreicht und lagern unter[S. 39] schattigen Bäumen. Die Temperatur steigt beständig und macht gar bald ihren erschlaffenden Einfluß auf Mensch und Tier geltend. Sogar die Vogelwelt hat ihr Konzert eingestellt. Ein jeder sucht sich ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen, denn um 3 Uhr soll weiter marschiert werden. Nach der Rast begann der Weitermarsch, und als wir schließlich unser Nachtlager bezogen, hatten wir eine Tagesleistung von 40 Kilometern hinter uns.
Am zweiten Tage erreichten wir ein Negerdorf, wo wir vom Dorfältesten mit frischen Kokosnüssen bewirtet wurden, wie es allgemein üblich ist. In Europa kennt man nur die reife Kokosnuß, die nur selten etwas Kokosmilch enthält. Aber wer nach stundenlangem Marsche in tropischer Hitze eine frische Kokosnuß zur Labung erhält, weiß erst den Wert dieser Frucht zu schätzen. Das Innere der unreifen grünen Frucht ist noch mit dem flüssigen Kernsaft angefüllt, und gerade dieser Saft bietet den herrlichen, kühlen Trank mit dem teils herben, teils süßlichen Geschmack. Eine frisch geköpfte Kokosnuß enthält bis zu einem halben Liter Milchsaft; derselbe ist völlig keimfrei und also das Unschädlichste für einen Europäer, das er zu sich nehmen kann. Fügt man gar eine Dosis Whisky oder Kognak bei, so hat man einen wahren Göttertrank, der dem Magen vorzüglich bekommt.
Bei unserer Ankunft im Negerdorfe hatte der Dorfälteste unter mächtigen, schattigen Mangobäumen als Sitzgelegenheit eine „kitanda“ — Bettstelle — für die hohen Gäste herbeischleppen lassen, und ich wollte mich gerade darauf niederlassen, als mich mein Begleiter noch rechtzeitig beim Ärmel erwischte und mich von meinem Vorhaben abhielt. Warum er dies tat, sollte ich sofort erfahren. Er hieb mit einem Stocke mehrere Male auf die „kitanda“, wobei ein wahrer Regen von Wanzen niederging.
Nachdem wir einige Stunden Rast gehalten hatten, begaben wir uns auf die Pirsch, um ein Stück Wild zu erlegen. Die hier so häufig vorkommenden Rappen-Antilopen bekamen wir zwar[S. 40] oft zu Gesicht, leider aber nicht zum Schuß. Die Rappen-Antilope — Hippotragus niger Harris — ist eine große, gedrungen gebaute, dunkelbraun bis schwarz gefärbte Antilopenart. Beide Geschlechter tragen große, säbelförmig nach hinten gedrückte Hörner, die beim Männchen stärker sind als beim Weibchen. Die Tiere leben in Rudeln in dem lichten Baumsteppengürtel, der sich von der Küste an etwa 100 Kilometer weit ins Innere erstreckt.
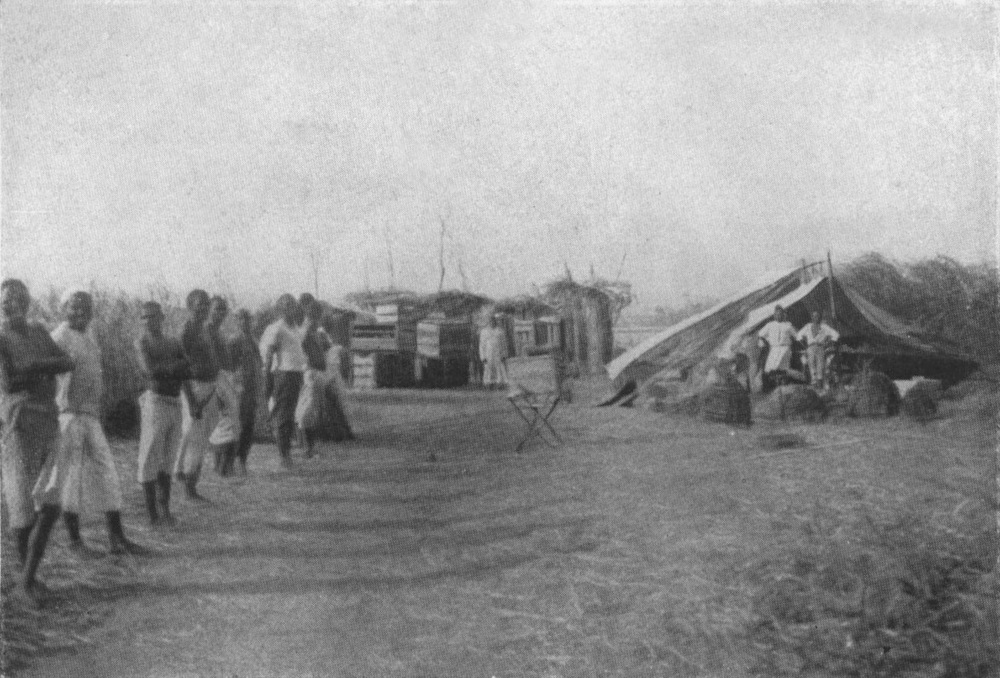
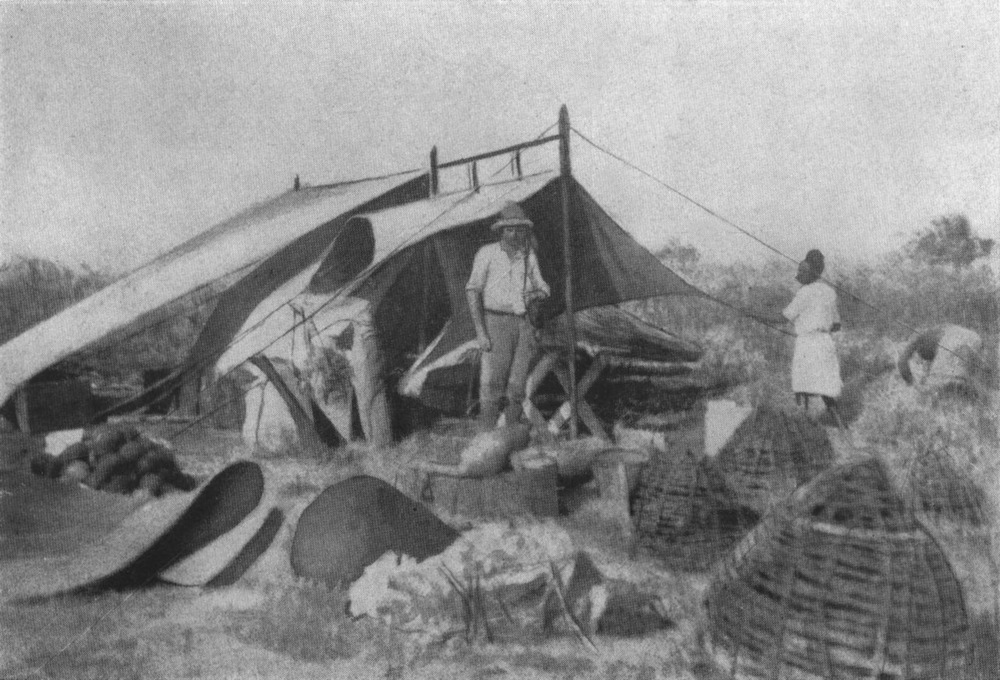

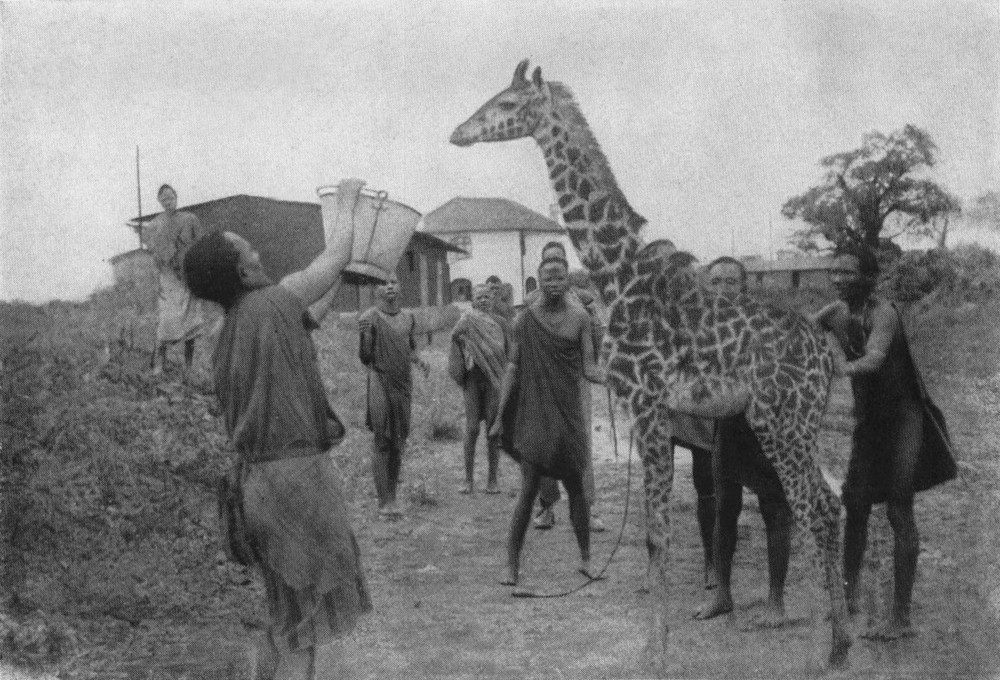
Am nächsten Nachmittag ging ich der Karawane voraus, eine dieser Rappen-Antilopenfährten verfolgend, und stieß dabei auf eine Herde Paviane — Papio cynocephalus L. —, von denen ich einige abschoß. Im Begriffe, zur Karawane zurückzukehren, bemerkte ich, daß ich durch das Kreuz- und Querlaufen in der Buschsteppe die Richtung verloren hatte. Ich stand nun ohne Karte und ziemlich ratlos da; es begann zu dunkeln und meine Lage wurde unangenehm. Glücklicherweise hatten einige Schwarze die Schüsse gehört und waren in der Hoffnung, ich habe ein Stück Wild erlegt, auf die Suche nach mir gegangen. Sie trafen mich und wir kehrten zur Karawane zurück, welche in einem naheliegenden Dorfe bereits Lager geschlagen hatte. Ermüdet von der Jagd, pries ich mich glücklich, daß es gute deutsche Konserven gab, und tat mich an einer Dose Frankfurter Wurst und einer Flasche Rotwein gütlich. Während wir noch aßen, erschien ein Bote mit einem Briefe für meinen Begleiter, der ihm die Nachricht brachte, daß einer seiner europäischen Angestellten heftig erkrankt sei, und ihn bat, möglichst rasch auf der Pflanzung zu erscheinen. So beschlossen wir sofort aufzubrechen und die Nacht durchzumarschieren, um gegen Morgen auf der Pflanzung einzutreffen. Den Trägern, die aus der Gegend der Plantage stammten, war es sehr recht, früher nach Hause zu kommen, und ich hatte, trotz meiner Müdigkeit, auch nichts dagegen, Zeit zu gewinnen. Wie gewöhnlich, marschierte ich der Karawane voraus und stieß plötzlich im Dämmerlicht auf frische Löwenfährten. Gerade bückte ich mich, um[S. 41] dieselben näher zu prüfen, als neben mir im Busch ein Löwe in großen Sätzen davonsauste. Ehe ich mich vom Schreck erholt hatte, war das Tier verschwunden. Ich erwartete die Karawane und teilte meinem Begleiter das Geschehene mit. Er bestätigte mir das Vorkommen von Löwen in dieser Gegend und war überzeugt, daß ich vorhin einen solchen verjagt hätte. So war ich ohne mein Zutun dem ersten afrikanischen Löwen in Freiheit begegnet. Unsere Neger hatten ebenfalls die Fährten schon bemerkt und waren voller Furcht, da es vorkommt, daß Löwen eine Karawane vorbeiziehen lassen, um sich auf die Nachzügler zu stürzen. Dagegen fühlen sich die Träger sicher, wenn ein Europäer mit der Büchse neben ihnen marschiert. Wir zündeten daher zwei Sturmlaternen an; mein Gefährte nahm mit seinem Gewehr die Spitze des Zuges und ich die Nachhut. Beim Weitermarschieren hörten wir das Gebrüll mehrerer Löwen in der nächtlichen Stille, und dies hatte zur Folge, daß die furchtsamen Träger beieinander blieben und feste vorwärts marschierten, so daß wir um 2 Uhr nachts auf der Plantage meines Begleiters eintrafen, wo wir uns todmüde der wohlverdienten Ruhe hingaben. Wir hatten von Montag nachmittag bis Sonntag vormittag einen Marschrekord von über 200 Kilometern aufgestellt. Am Morgen zeigte mir der Pflanzungsleiter seine Baumwollplantage und lud mich ein, einen Ruhetag zu machen; aber es drängte mich, zu Herrn Petersen zu gelangen, dessen Standquartier ich von hier aus in wenigen Marschstunden erreichen konnte. So verließ ich denn die Pflanzung „Panganya“ und setzte über den hier 500 Meter breiten Rufidji. Ein Einbaum, das ist ein Boot aus einem einzigen Baumstamm hergestellt, brachte das Gepäck und die Träger hinüber.
Der Rufidji mündet in einem dicht mit Mangrovenwald bewachsenen Delta gegenüber der Insel Mafia in den Indischen Ozean und ist der größte Fluß Deutsch-Ostafrikas. Seine Nebenflüsse bringen ihm alles Wasser von etwa ein Viertel der Oberfläche[S. 42] des Landes zu, so daß er die Gebiete Uhehe, Ubena, Usangu, Mahenge, einen großen Teil des Wagoni-Plateaus, Ussagara, Ujansi und Ukimbu entwässert. Wenn daher zur Regenzeit sein mächtiger Nebenfluß, der Kilomberu-Ulanga, der sein Wasser zum größten Teil aus den den feuchten Südostwinden am meisten ausgesetzten Ostabhängen des Randgebirges empfängt, seine Fluten heranwälzt, dann schwillt der Rufidji an und tritt weit über seine Ufer. Stellenweise wird er nun zum mächtigen See und gleicht dem Nil Ägyptens, monatelang große Gebiete überschwemmend; nur die höchsten Termitenhügel ragen dann gleich kleinen Inseln über die Wasserfläche empor und dienen oft Wasserböcken und anderem Wild als letzte Zuflucht, wenn sie von den Fluten überrascht werden.
In der Trockenzeit ist natürlich der Fluß viel niedriger; aber in den überschwemmt gewesenen Gebieten bleiben größere und kleinere Tümpel sowie seenartige Becken übrig, die zum Teil durch kleine Kanäle oder Gräben mit dem Flusse in Verbindung stehen; vorzügliche Laichplätze für die Fische und beliebte Tränkstellen für allerlei Wild.
Leider ist der Fluß nur auf 24 Kilometer Tallänge, von seiner Mündung aufwärts gerechnet, schiffbar, sodann stößt man auf die mächtigen Panganifälle und eine Reihe größerer und kleinerer Stromschnellen, die sich auf etwa 100 Kilometer Länge flußaufwärts hin erstrecken. So wird kaum jemals eine gute und billige Wasserstraße hergestellt werden können. Da der Strom eine große Menge Erde und Sand führt, so bilden sich häufig wechselnde Sandbänke, so daß zur Trockenzeit nur kleinere Heckraddampfer mit geringem Tiefgang auf dem Unterlauf verkehren können. Der ganze Fluß ist von Flußpferden belebt und infolge seines Fischreichtums von vielen Krokodilen bevölkert. Bei unserem Übersetzen waren die Eingeborenen ziemlich ängstlich, da, wie sie erzählten, vor kurzem erst ein Flußpferd ein Boot angegriffen und[S. 43] zertrümmert habe, wobei ein Insasse ertrunken sei. Jedoch gelangten wir ohne Unfall hinüber. Herr Petersen hatte sein Jagdlager an einem Bache errichtet. Der Weg dorthin führte durch Dörfer und Baumwollpflanzungen der Eingeborenen, und wir erreichten es erst nach einem dreistündigen Marsch. Petersen selbst war nicht zu Hause, aber ein zurückgelassener Brief benachrichtigte mich, daß er in einigen Tagen zurückkehren werde. Ich benutzte die Zeit, die Wildfauna zu beobachten und machte verschiedene Streifzüge. Enten, Gänse, Wasserhühner, Strandläufer, Reiher, Scharen von Pelikanen bedeckten das Wasser und die Sandbänke. An Großwild waren vorhanden: Elefanten, Flußpferde, Büffel, Rappenantilopen, Gnus, Kuhantilopen, Schwarzfersenantilopen, Warzenschweine, Buschböcke und Wasserböcke (Cobus ellipsiprymnus Ogilby). Der Wasserbock ist eine hirschgroße Antilope von dunkelbrauner Farbe mit weißen Streifen an den Hüften. Das Männchen trägt 80 Zentimeter lange, von den Wurzeln an zunächst nach hinten, später nach vorn gebogene Hörner. Von weitem gesehen erinnert diese Antilope, namentlich das Weibchen, außerordentlich an das heimische Rotwild. Für Küchenzwecke erlegte ich eine Schwarzfersenantilope oder Impala aepyceros suara Matsch. Diese mittelgroße Antilopenart ist hellbraun gefärbt und hat am Hinterlauf an Stelle der fehlenden Afterzehen schwarze Stellen. Die Männchen tragen lange leierartig geschwungene Hörner. Die hauptsächlich in lichter Buschsteppe rudelweise lebenden Tiere fallen dem Beobachter durch ihre oft über 2 Meter hoch ausgeführten Fluchten auf.
Nach zwei Tagen kehrte Herr Petersen zurück und wir trafen unsere Vorbereitungen zu einem großen Fangzug. Zu diesem Zwecke hatte Herr Petersen an einem Gewässer, dem Lukongo-See, bei der Ortschaft Utete eine zweite Jagdhütte aus Ästen, Flechtwerk und Lehm nach Art der dortigen Negerhütten errichtet und mit Palmwedeln bedeckt. Wir ließen uns vom Dorfältesten[S. 44] (Jumben) 20 Neger zur Verfügung stellen und zogen in vierstündigem Marsche nach Utete. Als wir den See erreichten, bot sich uns ein überraschender Anblick: Hunderte von Negern waren an einer Seite des Sees versammelt, damit beschäftigt, unglaubliche Massen von Fischen korbweise aus dem See herauszufischen, während ihre Weiber und Kinder die Fische langsam am Feuer rösteten. In flachen Schüsseln ließen sie die Eingeweide der Fische aus, um das darin enthaltene Fett zu gewinnen und füllten dies in mitgebrachte Kalebassen (Flaschenkürbisse). Der Lukongosee bildet eine der eben erwähnten Wassertaschen des Rufidjis, von dem der eine Abfluß während des niedrigen Wasserstandes trocken lag und so für die Fische einen geschützten Laichplatz darstellte. Zu bestimmten Zeiten des Jahres sind daher in solchen Wassertaschen unglaubliche Mengen von Fischen vorhanden, und da die Eingeborenen dies wissen, so kommen sie mit Weibern und Kindern von weither, um sich Vorräte von getrockneten Fischen und Fischfett zu bereiten. Aber auch die fischfressenden Vögel machten sich diesen Umstand zunutze, und Tag und Nacht hörten wir das Geschrei der vielen Schreiadler, Milane u. a. m. In dieses Konzert mischte sich des Abends das unheimliche Gelächter der Hyänen, sowie das Kläffen der Schakale. Die ganze Umgegend des Sees ist zu dieser Zeit verpestet von dem Geruch der Fische und der faulenden Abfälle.
Diese Negeransammlung kam uns für unsere Jagdzwecke sehr gelegen, denn wir konnten ohne Mühe 200 Mann als Treiber und Arbeiter mieten. Die Leute begleiteten uns um so lieber, als sie wußten, daß sie Gelegenheit bekamen, auch öfters Dörrfleisch zu bereiten, da wir ihnen von Zeit zu Zeit einige Stück Wild abschossen. Zunächst bauten wir für die zu fangenden Tiere Krale. Ein solcher Kral wird in der Art errichtet, daß man auf einem freien Platz ringsum die Erde etwas aufwirft und einen festen Zaun mit eingesteckten Ästen, Lianen und Dorngestrüpp[S. 45] macht. Fanggruben wurden ausgehoben und mit dünnen Ästen und Laubwerk verblendet. Um Tiere wie Antilopen lebend in unsere Gewalt zu bringen, hatten wir von den Eingeborenen große Netze aus Kokosfasern entliehen. Die zwei Meter hohen Netze wurden aneinandergeknöpft und morgens lange vor Sonnenaufgang in einem weiten Halbkreis aufgestellt. In einem großen, dem Netzbogen entgegengesetzten Halbkreise fingen nun unsere Treiber an, die Tiere mit Händeklatschen zu erschrecken und gegen die Netze zu treiben. Nach kurzer Zeit stürmten einige Wasserböcke gegen die Netzwand, die sie in ihrer Aufregung natürlich nicht sahen, und verfingen sich mit ihren Läufen und Hörnern in dem Hindernis. Sobald ein Tier sich verwickelt hatte, sprangen wir zu, fesselten es und brachten es auf Tragbahren in den nächsten Kral. Es war eine wildbewegte Jagd, gar mancher Stoß oder Schlag traf den einen oder anderen; die gefangenen Tiere stießen und schlugen wie rasend um sich, aber größere Unfälle ereigneten sich nicht; bis Mittag hatten wir bereits 11 Wasserböcke in unserer Gewalt. Nach kurzer Mittagsruhe erbeuteten wir noch 4 Wasserböcke, worunter sich ein alter befand, dessen Hinterschenkel durch eine Bleikugel vollständig vereitert war, weshalb er den Schwarzen als Nahrung geopfert wurde. Ich untersuchte die Wunde und fand die Bleikugel, die sich als deutsches Militärgeschoß Modell 71 erwies. Unser ausgezeichneter Jagderfolg gab Zeugnis von dem ungeheueren Wildreichtum dieser Gegend. Wir jagten bald auf der einen, bald auf der anderen Seite des Sees. Günstig für den Fang war der Umstand, daß der See ringsum von Busch- und Baumsteppe umgeben war. Um den langen Weg um den See herum abzukürzen, benutzten wir öfters einen Einbaum. Der riesige Reichtum an Fischen hatte natürlich auch eine Unmenge Krokodile angezogen. Als wir einmal um die Mittagszeit in brennender Sonnenhitze mit dem Einbaum über den See fuhren, konnte ich während der Fahrt nicht weniger als 27 Krokodile auf der[S. 46] kurzen Strecke zählen. Glücklicherweise waren die Tiere so vollgefressen und träge, daß sie kaum von uns Notiz nahmen und nur die nächsten beim Herannahen des Bootes untertauchten. So harmlos sind diese Panzerechsen nicht immer, namentlich nicht, wenn sie hungrig sind. Herr Petersen erzählte mir, daß erst kürzlich ein Herr auf dem Rufidji ein böses Abenteuer mit einem solchen Tiere erlebt habe. Er fuhr mit einem schmalen Boot ziemlich rasch mit der Strömung; vorn an der Spitze befand sich ein Schwarzer, der mit einem kurzen Ruder paddelte; in der Mitte saß der Europäer und am hinteren Ende einige Neger. Plötzlich tauchte ein Krokodil seitlich auf und schnappte nach dem vordersten Manne. Das Tier hatte nicht mit der Schnelligkeit des Bootes gerechnet; es stieß an die Bootswand an und wurde beiseite geschleudert, und so kamen alle mit dem Schrecken davon.
Zunächst mußten wir nun die gefangenen Wasserböcke jeden einzeln in einen Kral bringen, denn die Tiere sind kurz nach dem Fang derartig aufgeregt, daß sie, sobald man mehrere zusammen läßt, sich gegenseitig anrennen und verletzen. Es galt ferner, der gefangenen Beute Futter und Trank zu verabreichen. Gras mußte geschnitten werden, primitive Holztröge als Trinkgefäße wurden ausgehauen, die Kralzäune ausgebessert und überwacht, kurz, es gab Arbeit in Hülle und Fülle. Auch mußten jeden Tag sämtliche Fanggruben nachgesehen werden.
Durch Zufall hatten sich darin zwei Gnus gefangen. Die Gnus (Connochaetes), von den holländischen Ansiedlern am Kap auch als „Wildebeest“ bezeichnet, bilden eine der zahlreichen Gattungen in der großen Familie der Antilopen. Die gedrungen gebauten Tiere haben die Größe eines jungen Rindes. Beide Geschlechter tragen Hörner, die in ihrem Aussehen an diejenigen der Büffel erinnern. Eigenartig sind der langbehaarte Schwanz und die pferdeartige Mähne. Mir waren bisher von dieser Gattung in Deutsch-Ostafrika nur zwei Arten bekannt, nämlich das Streifengnu[S. 47] (C. taurinus Burch.) und das Weißbartgnu (C. albojubatus Thos.). Das erstere findet sich in zumeist stärkeren Rudeln im Süden der Kolonie, das letztere schweift in oft riesigen Herden durch die Masaisteppe, bis zum Athi-River in Britisch-Ostafrika, der die Nordgrenze seines Verbreitungsbezirkes darstellt. Während nun die Decken der beiden genannten Arten einen blaugrauen Farbenton aufweisen, fiel mir bei meinen Gefangenen, zwei ausgewachsenen Bullen, auf, daß die Grundfarbe ihres Haarkleides mehr ins Bräunliche überging. Charakteristisch war ferner ein etwa fingerbreiter weißer Streifen, der sich quer über das Nasenbein hinzog und der sich von dem tiefschwarzen Vorderkopf besonders scharf abhob. Somit hatte ich berechtigten Grund zu der Annahme, daß es sich hier um eine neue, das heißt wissenschaftlich bisher für Deutsch-Ostafrika noch nicht nachgewiesene und beschriebene Spezies handle. Und mit dieser Vermutung sollte ich auch Recht behalten, denn als die Tiere später im Stellinger Park von Fachmännern untersucht wurden, wurden sie als Rufidji-Johnstongnu (Connochaetes johnstoni rufijianus) identifiziert, welche Art bis dahin nur in Britisch-Nyassaland bekannt war. Das Rufidji-Johnstongnu unterscheidet sich durch mehrere, sehr bezeichnende Merkmale von seinen südlichen Vettern. Der Leser wird es mir nachfühlen können, daß ich heute noch Genugtuung und Freude über diesen Fang empfinde, der es mir ermöglichte, auch meinerseits ein Scherflein zur Erweiterung unserer Kenntnisse der Zoographie des tropischen Afrikas beizutragen.
In kurzer Zeit hatten sich in den oben erwähnten Fanggruben zwei Flußpferde (Hippopotamus amphibius L.), die von den Eingeborenen „Kiboko“ genannt werden, gefangen. Die Fanggruben für diese Tiere legt man am besten auf ihren Wechseln selbst an, wenn man wirklich Erfolg haben will. Sie müssen für diese mißtrauischen Geschöpfe ganz unauffällig angelegt sein, und zwar nicht nur für ihre Augen, sondern auch für ihren feinen Geruchssinn.[S. 48] Bei der geringsten Veränderung des Weges scheut das Tier zurück und schlägt eine andere Richtung ein. Bei der Anlage meiner Fanggruben machte ich mir außer diesem auch noch folgende Erfahrung zunutze: Das Flußpferd hat eine außergewöhnliche Art, seine Losung abzugeben; es stellt sich dabei so, daß es rückwärts gegen einen Busch steht, und während es den Darm entleert, schlägt es in rasender Bewegung mit dem kurzen Schwanzstummel hin und her, so daß die Losung über den ganzen Busch und die nächste Umgebung geschleudert wird. Hierbei hatte ich bemerkt, daß die Tiere mit Vorliebe an ein und denselben Plätzen mehrmals ihre Losung abgeben. Infolgedessen legte ich die Fanggruben stets da an, wo neben dem Wechsel ein solcher Busch stand, denn durch den Geruch der eigenen Losung war es dem Tiere nicht möglich, eine fremde Witterung zu bemerken.
Nachdem wir also die zwei ersten Flußpferde, ziemlich ausgewachsene Exemplare, in den Fanggruben hatten, trat die wichtige Frage auf, wie diese gefährlichen und schweren Tiere ohne jede Hebevorrichtung in den vorher hergerichteten Tierkral an den See zu bringen seien. Den Flußpferd-Kral hatten wir sehr praktisch am See selbst angelegt, indem wir ein Stück Wasser nebst dem dazugehörigen Seerand durch fest eingerammte Palisaden eingefriedet hatten, um somit den Tieren möglichst ihre natürlichen Lebensbedingungen zu lassen. Es hieß also, wie gesagt, die Kolosse schnell aus den Fanggruben heraus- und in den vorbereiteten Kral hineinzubringen.
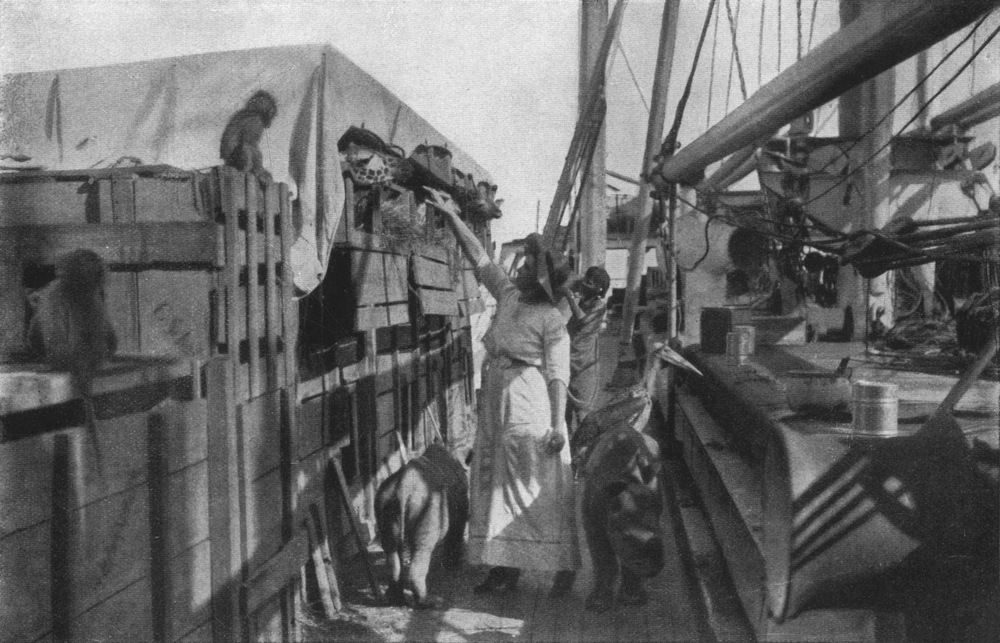

Ich habe in Europa am Biertisch öfters Ingenieuren das Rätsel aufgegeben: „Wie bekommen Sie ein etwa 2000 Pfund schweres Flußpferd aus einer 2½ Meter tiefen Grube ohne Hebewerkzeuge, ohne Stricke und ohne daß die Leute das Tier anfassen, heraus?“ Da habe ich von den meisten die Antwort bekommen, das gehe nicht und sei unmöglich. Es ist aber doch möglich und genau so einfach wie das Ei des Kolumbus. Man braucht nur[S. 49] Leute, Beil und Buschmesser, das sonstige Material liefert die Wildnis. Zuerst fällt man in der Nähe der Fangstelle Bäume und läßt aus deren Ästen etwa 2½ Meter lange Pfähle zurichten. Die geraden und langen Pfähle benutzt man zum Bau eines Kastens, mit den krummen und dem Buschwerk umgibt man die Grube mit einem starken Zaun, in welchem, dem Kopfe des Tieres gegenüber, eine Öffnung freigelassen wird. Nach Fertigstellung des Transportkastens, dessen einzelne Teile durch Rindenbast fest miteinander verbunden sind, wird derselbe mit seiner Öffnung vor das erwähnte Loch in der Umzäunung gestellt und durch einige Pfähle und Baststricke festgehalten, damit er beim Hineinschlüpfen des Flußpferdes nicht verschoben wird und kein Unglück passieren kann. Nunmehr kommt die Hauptsache: Man läßt von den Schwarzen Erde in die Fanggrube werfen. Das Tier, durch die herabfallenden Schollen getroffen, schüttelt und bewegt sich und stampft dabei die hineingeworfene lockere Masse fest. Nach und nach füllt sich die Grube an, das Hippo kommt immer höher und höher, sieht die Öffnung und stürmt in den Transportkasten hinein. Im selben Augenblick werden schon vorher bereitgehaltene Stangen durch die Rückseite des Kastens gesteckt und das Tier sitzt gefangen und wehrlos in demselben. Auf diese Art und Weise brachten wir auch die eben genannten Dickhäuter in unsere Gewalt. Soweit war alles gut, aber bis zum Flußpferdkral waren 4 Kilometer zurückzulegen. Da wir aber weder Wagen noch Hebezeuge, noch sonstige Transportmittel hatten, blieb nichts anderes übrig, als die schweren Lasten mit langen, unter dem Kasten durchgelegten Stangen durch die Muskelkraft unserer 200 Neger zu befördern. Es bedurfte vieler Stunden, mancher Schweißtropfen und etlicher Kreuzdonnerwetter, bis wir unsere Beute an Ort und Stelle hatten. Einmal im Krale, der ihren Bedürfnissen gemäß angelegt war, gewöhnten sich die Tiere bald ein und schienen sich bei der Leichtigkeit, mit der sie auch Futter,[S. 50] nämlich Gras, Hirse usw. an Ort und Stelle fanden, ganz wohl zu fühlen. Vielfach wird in Büchern behauptet, daß die Flußpferde nur in der Nähe des Wassers äsen. Ich habe jedoch des öfteren Flußpferde viele Kilometer weit von jeder Wasserstelle entfernt äsend angetroffen; allerdings führten von diesen Plätzen tief ausgetretene und stets wieder benutzte Wechsel zu den Tränken hin.
Das Fangergebnis von wenigen Wochen in diesem Revier war folgendes: 2 Flußpferde, 15 Wasserböcke, 2 Johnston-Gnus, 1 Kuhantilopenbulle, 20 Schwarzfersenantilopen und mehr Paviane als uns lieb waren. Alle diese Tiere hatten wir natürlich nicht an einem und demselben Platze gefangen, sondern in verschiedenen Gegenden erbeutet. Auch an der ersten Jagdhütte Petersens hatten wir Krale angelegt und die Tiere auf die beiden Lagerplätze bei Utete und bei Jaroilo verteilt.
Bei dem fabelhaften Wildreichtum dieses wohlgewählten Fangplatzes hatte ich in kurzer Zeit die Tiere, die ich dort hatte fangen wollen, beieinander und konnte sie in den zweckentsprechenden Kralen verläßlichen Leuten zur Pflege übergeben. Es hieß nun, sich die nötigen Bretter, Werkzeuge und Nägel zu besorgen, um regelrechte Transportkästen für die Europareise herzustellen. Dies ist mitten in der Wildnis eine schwierige Sache, da weder Bahnen noch Straßen das Herbeischaffen der Sachen erleichtern. Da Herr Petersen eine Reise nach Mohoro zu machen hatte, so begleitete ich ihn, in der Hoffnung, vielleicht dort zu finden, was ich brauchte.
Auf dem Rufidji verkehrt zweimal im Monat der kleine Regierungsdampfer „Tormondo“, und zwar auf der Strecke von Salale an der Küste bis in die Nähe der großen Pangani-Fälle. Daher richteten wir es so ein, daß wir ihn zu unserer Reise wenigstens ein Stück weit bis Kilindi benutzen konnten. Auf dieser kurzen Fahrt hatte ich die Gelegenheit, den Fluß und die hier auftretende Tierwelt zu beobachten. Der ganze Rufidji ist von[S. 51] Flußpferden belebt, und an den hochgelegenen Uferstrecken sieht man deutlich, wie ihre Wechsel in tiefen Rinnen bis zum Flusse führen. Die Tiefe dieser Rinnen ist dadurch bedingt, daß sie täglich von den schweren Dickhäutern benutzt werden. Kann man sich unbemerkt vor Sonnenuntergang an eine Gruppe von Flußpferden heranschleichen, wenn sie eben das Wasser verlassen haben, so erlebt man ein hübsches Schauspiel: Die Tiere sind sehr mißtrauisch, sie sichern stets beim Heraustreten aus dem Wasser und verlassen nur ganz langsam und vorsichtig das nasse Element. Fällt nur ein Schreckschuß, so machen sie schleunigst kehrt und flüchten wieder so rasch wie möglich in das Wasser zurück. Urkomisch ist es dann zu sehen, wie die Kolosse, die schon oben an der Rinne angelangt sind, laufend und rutschend auf der schiefen Ebene plumpsend in das Wasser sausen, wo sie minutenlang untertauchen. Ihre Nüstern sind zu diesem Zwecke verschließbar wie eine Ventilklappe. Tauchen sie dann wieder auf, so stoßen sie den lang angehaltenen Atem mit starkem Drucke aus, so daß das Wasser hoch aufspritzt. Während des Tages liegen die Tiere meistens träge im Wasser, nur die Schädeldecke, Ohren und Nasenlöcher ragen über die Oberfläche heraus. Man sieht keine Bewegung, als hier und da ein schnelles Kreisen der kurzen Ohren. Bisweilen, namentlich in den oben erwähnten Tümpeln, findet man ganze Herden bei munterem Spiel. Dabei bringen sich die Tiere mit ihren schrecklichen Hauern oft große Verwundungen bei, wie manchmal an den Wunden der gefangenen und erlegten Stücke festzustellen ist. Zur Brunstzeit, wenn die mächtigen Bullen untereinander kämpfen, muß es wohl gefährliche Wunden absetzen. Aus den mächtigen Hauern werden von den Indern wunderschöne Schnitzarbeiten gemacht. Es ist Elfenbein, aber mit einer sehr harten Glasur überzogen. Für einen guten Schützen ist es keine Kunst, an einem Tümpel von sicherem Versteck aus beliebig viel Exemplare zu erlegen, aber kein weidgerechter Jäger wird sich[S. 52] dieses zweifelhafte Vergnügen machen, sondern höchstens sogenannte Aasjäger, deren es leider auch gibt.
Oft habe ich die Strecke Panganya-Utete in einem Einbaum zurückgelegt. Unterwegs tauchten häufig in allernächster Nähe Flußpferde auf. Waren wir dicht genug herangekommen, so verschwanden sie wieder unter Wasser. Mitunter fuhr das kleine Fahrzeug direkt darüber hinweg. Die Neger zeigten darüber nur wenig Angst. Allem Anschein nach sind Tiere und Menschen hier sehr miteinander vertraut. Für mich war es natürlich kein angenehmes Gefühl, in solch einem wackeligen Boot über die riesigen Dickhäuter hinzufahren.
Daß die Flußpferde mitunter recht bösartig und angriffslustig werden können, habe ich selbst einigemal erlebt. In Kilwa hatte ich seinerzeit 6 Flußpferde, die sich in einem Gehege mit Bassin befanden. Ich war damit beschäftigt, die Dickhäuter mit List in ihre Transportkästen zu locken, was mir auch bei 4 Stück nach einigen Tagen gelang. Die beiden anderen Tiere, besonders aber das eine von ihnen, ein starker Bulle, machte mir andauernd Schwierigkeiten. Acht Nächte hatte ich schon bei großer Moskitoplage auf den Kästen zugebracht. Der Bulle war so schlau, daß er nur so weit in den Kasten hineinging, um das Futter ergreifen zu können, dasselbe dann herauszerrte und draußen verzehrte. Ich kam also nie dazu, die Falltür herunterzulassen. Die Zeit drängte, denn der Dampfer, welcher den Transport mitnehmen sollte, war in den nächsten Tagen fällig. Da besuchte mich, vom Rufidji kommend, Herr Petersen. Er meinte, es sei am besten, er ginge in den Kral, um das Tier aus dem Wasser zu treiben, vielleicht laufe es dann in den Kasten. Gesagt, getan! Ich hielt die Schiebetür hoch und mein Freund begab sich in den Kral. Kaum war er in der Mitte angelangt, als das Tier aus dem Wasser mit offenem Rachen auf ihn zustürzte. Natürlich ergriff Herr Petersen schleunigst die Flucht und lief auf meinen Kasten[S. 53] zu. Ich ließ die Schiebetür fallen, und meinem Zugreifen gelang es, den Bedrohten noch mit knapper Not in Sicherheit zu bringen. Jetzt war das Tier natürlich so aufgeregt, daß ich mich schon mit dem Gedanken trug, es für den nächsten Transport zurückzulassen, aber in der Nacht hatte einer meiner Boys meinen Posten für einige Minuten eingenommen und in dieser kurzen Zeit den wilden Satan gefangen. Im allgemeinen überläßt man solche Arbeit Negern nicht, denn ein zu frühes Herunterlassen der Falltür kann das Tier schwer verletzen und dessen Verlust herbeiführen.
Einen zweiten ähnlichen Vorfall erlebte ich in Stellingen beim Ausladen der Flußpferde. Ein 1,17 Meter hoher Bulle wollte durchaus nicht aus dem Transportkäfig. Wir halfen natürlich etwas nach. Einer der Wärter, der die Schiebetür zum Bassin öffnen wollte, kletterte rittlings auf der Mittelwand des Kastens entlang. Das Flußpferd, welches auf der gegenüberliegenden Seite an der Wand stand, bemerkte dies, stürzte mit offenem Rachen auf den Mann zu und schnappte nach dessen Bein, indem es förmlich an der Wand hochsprang. Der Wächter konnte sich nur durch das schnelle Hochziehen des Beines vor einem schweren Unfall retten. Auch Herr Petersen erzählte mir von einem Unglücksfall, bei welchem ein wütendes Flußpferd einen Neger glatt durchgebissen habe.
Bei Kilindi verließen wir den Dampfer und hatten noch drei Stunden bis Mohoro zu marschieren. Auf diesem Wege kamen wir durch zwei Negerdörfer, wo uns merkwürdige Baumhütten auffielen. Auf jedem stärkeren Baum befand sich etwa 2–3 Meter über dem Boden eine Art Plattform aus Ästen und Zweigen hergestellt und ringsum von Wänden aus Flechtwerk umgeben. Wir sahen, daß die Neger ihre Ziegen und Schafe die Nacht über hier unterbrachten, um sie gegen Löwen und andere Raubtiere zu sichern. In Mohoro konnte ich von einem Europäer einen zweirädrigen Transportkarren ausleihen. Dieser Mann erzählte[S. 54] mir ebenfalls, daß in der ganzen Umgebung große Löwenplage herrsche und ihm erst kürzlich aus einem Kral zwei Ziegen von Löwen geraubt worden seien. Leider fand ich in Mohoro das für meine Transportkästen nötige Material nicht, konnte aber von hier aus in Daressalam alles telegraphisch bestellen, mit der Weisung, sämtliche Sachen mit dem Hauptdampfer nach Salale zu schicken, von wo sie der zurückkehrende kleine Flußdampfer bis oberhalb Utete herauf transportieren konnte. Herr Petersen und ich konnten die 14 Tage bis zur Rückkehr des Dampfers nicht nutzlos verlieren und kehrten daher in dreitägigem Marsche direkt nach Utete zurück. Zugtiere waren für meinen Karren nicht zu haben; so mußten eben meine Träger herhalten, die sich bei der ihnen ungewohnten Arbeit möglichst ungeschickt anstellten, so daß ich meine liebe Not hatte und der Marsch in dem wegelosen Gelände stark verzögert wurde. Wie ich schon vorher erwähnt, herrschte in der ganzen Gegend Löwenplage, und wir trafen auf dem Wege zwei von ihren Bewohnern gänzlich verlassene Negerdörfer. Anstatt ihr Dorf zu befestigen, hatten die Eingeborenen vorgezogen, in eine andere Gegend zu ziehen. Am dritten Tage kamen wir durch eine Landschaft, wo überaus viele Mangobäume in voller Reife standen. Die Früchte und Zweige dieses Baumes bilden eine Lieblingsnahrung der Elefanten, von deren Anwesenheit viele niedergebrochene Äste und verstümmelte Bäume Zeugnis ablegten. Der Elefant trägt zur weiteren Verbreitung des Mangobaumes bei, weil die Keimkraft der verschluckten Fruchtkerne durch die Verdauungssäfte des Riesen nicht beeinträchtigt wird.
Mit der Losung kommen die Kerne zur Erde, werden oft von den Tieren selbst in den Boden getreten, und an allen Stellen, wo dies geschieht, fangen in der Regenzeit die Kerne an zu keimen, so daß allenthalben Mangobäume hervorwachsen. Fast überall, wo die nötigsten Lebensbedingungen da sind, findet man in unserer[S. 55] Kolonie den Mangobaum, dessen Frucht eine große Rolle in der Volksernährung spielt.
Erst spät am Abend des dritten Tages langten wir in Utete an. Leider waren während unserer Abwesenheit durch die Nachlässigkeit einiger Wächter mehrere der gefangenen Tiere eingegangen. Wir schafften energisch Ordnung und eilten nach dem zweiten Tierlager in Jaroilo, etwa 5–6 Stunden von Utete entfernt. Der Weg dahin führte an mehreren Tümpeln vorbei, in welchen überall Flußpferde vorkamen. In einem größeren Gewässer konnte ich bis 60 Stück zählen, deren Spiel ich, im Busche gedeckt, während unserer ganzen Rastzeit beobachten konnte. Will man ein Exemplar erlegen, so muß es durch Genick- oder Kopfschuß geschehen, was für einen geübten Jäger vom festen Lande aus kein Kunststück ist. Sitzt der Schuß richtig, so sinkt das verendete Stück sofort unter, um erst nach geraumer Zeit durch den Auftrieb der Zersetzungsgase wieder an der Oberfläche zu erscheinen. Nun gibt es ein großes Fest für die Neger, eifrig überwachen sie die Wasserfläche, und sobald das tote Tier auftaucht, stürzen sie hinein und ziehen den Kadaver ans Land, wo nun das Zerlegen beginnt. Was von dem Fleisch nicht gleich verzehrt werden kann, wird durch Räuchern oder Trocknen konserviert, das Fett wird ausgebraten und in Kalebassen (Kürbisschalen) gefüllt. Sowohl Fleisch wie Fett sind auch für einen Europäergaumen genießbar. Ich begnügte mich mit der Erlegung eines starken Bullen, von welchem ich den Schädel mit seinen gewaltigen Hauern sowie die schwere Schwarte als Trophäe behielt. Das Wildbret überließ ich unseren Negern, die denn auch mit aller Gründlichkeit daran gingen, sich den leckeren Braten zu Gemüte zu führen. Was dann noch übrigblieb, räumten Aasgeier und Marabus auf. Interessant war es immer, das kluge Gebaren der Marabus zu beobachten. In würdevoller Ruhe stehen diese Philosophen abseits der schreienden und sich um die Beute streitenden[S. 56] Aasgeiergesellschaft. So oft nun ein Fleischfetzen beiseite fliegt, stelzt der nächste der großen Kropfstörche rasch hinzu, faßt den Brocken, wirft ihn hoch und fängt ihn mit seinem Schnabel wieder auf, um das Stück im Kropf verschwinden zu lassen.
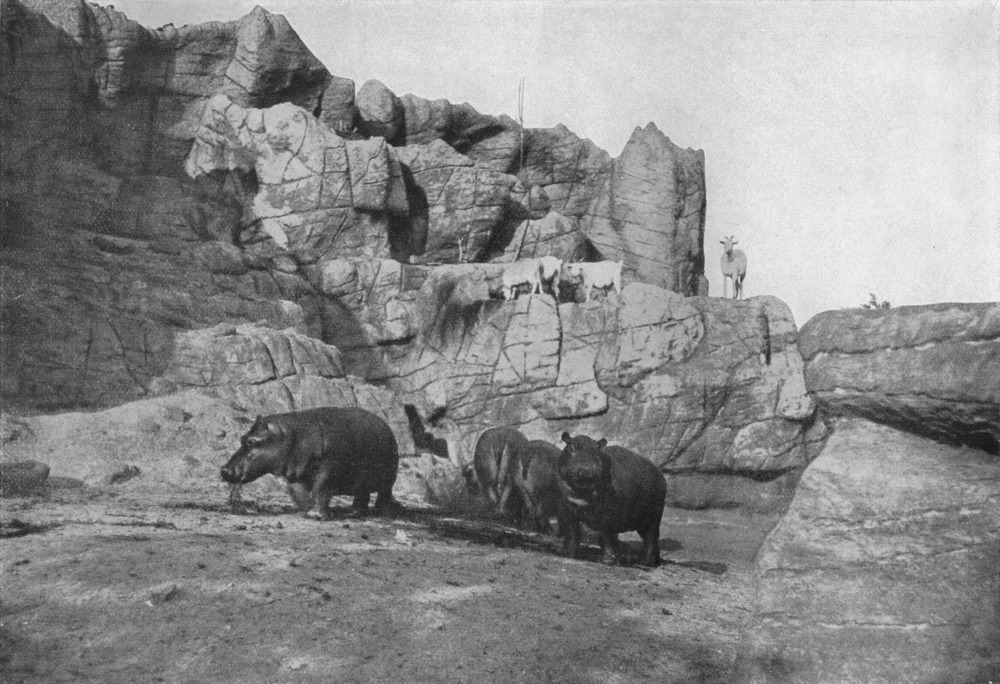


Am Lagerplatz in Jaroilo stellten wir ebenfalls die etwas gelockerte Ordnung wieder her und ruhten uns von den Strapazen der letzten Tage aus. Die hungrigen Schwarzen baten um Wild, und wir gedachten am nächsten Morgen, dem ersten Weihnachtsfeiertage, einen Festbraten zu schießen. Trotz der vielen Ratten, die in der Jagdhütte auf den Mattendecken unserer Moskitonetze die ganze Nacht herumtanzten, schliefen wir fest und ungestört. Der Feiertag zeigte am Morgen ein trübes Gesicht; es regnete, so daß wir keine rechte Lust hatten, bei der Nässe auf die Jagd zu ziehen. Als jedoch der Regen nachließ, meinte Herr Petersen, wir müßten Fleisch haben, in der Nähe der Hütte wäre Wild genug und wir hätten höchstens eine Stunde zu gehen. Er war seiner Sache so sicher, daß er mir sogar abriet, die Büchse mitzunehmen; er selbst versah sich mit seiner 9,3-Büchse, während ich nur eine leichte Vogelflinte mitnahm. Wider Erwarten hatten wir nach einer Stunde Marsch weder einen der sonst so häufigen Wasserböcke, noch anderes Wild angetroffen, und als wir in eine Lichtung kamen, in der ein Tümpel lag, beschlossen wir uns zu trennen und das Wasser rechts und links zu umgehen. Als wir uns wieder trafen, war unsere Verwunderung groß, denn weder mein Gefährte noch ich hatte ein Stück Wild zu Gesicht bekommen, nicht einmal einen Vogel hatte ich angetroffen. Nun schlug Herr Petersen vor, in einem großen Bogen zurückzukehren, an einem anderen Tümpel sei sicherlich Wild zu finden, wenigstens doch ein Wasserbock oder eine Schwarzfersenantilope. Wir waren noch keine 20 Schritte in der angeschlagenen Richtung gegangen, als einer der uns begleitenden Neger uns leise anrief und lautlos auf einen dunklen Punkt unter einem[S. 57] Baume deutete. Infolge des Nebels konnten wir nur erkennen, daß dort ein Stück Großwild stand. Herr Petersen glaubte ein Johnston-Gnu vor sich zu haben, legte an und schoß. Das Tier zeichnete stark, sprang gleich wieder auf und flüchtete. Wir eilten an den Anschuß, wo die Fährte auf einen mächtigen Büffel deutete. Herr Petersen frohlockte und meinte, es könne nur ein alter Einzelgänger sein, der außer einem prachtvollen Braten in seinem Schädel und Gehörn eine wundervolle Jagdtrophäe abgäbe. Wir verfolgten die Fährte, und ich war der festen Überzeugung, daß dies gefahrlos sei, denn mein Kamerad hatte sich stets als ein erfahrener Jäger und sicherer Schütze gezeigt. Endlich sichteten wir den Bullen in 150 Meter Entfernung, aber sobald er uns eräugte, schlug er einen Haken in dem Moment, wo Petersen die Büchse zum zweiten Schuß anlegte. Der Büffel verschwand im Busch. Wir gingen ihm nach in der Meinung, daß das schwerkranke Stück sich in der Nähe ins Wundbett legen würde. Ich war etwa 100 Meter vorausgelaufen und sah mich um, als plötzlich der Büffel, der unbemerkt hinter dem Busch zurückgekommen war, in wütendem Angriff mich seitlich annahm und, ehe ich die geringste Bewegung machen konnte, überrannte, so daß mir sekundenlang die Sinne vergingen. Glücklicherweise hatte das angeschweißte Tier sich im Anlauf verrechnet und mich nur gestreift. Als ich wieder zur Besinnung kam, lag ich unter dem stillstehenden Büffel zwischen dessen Hinter- und Vorderläufen, — eine keineswegs beneidenswerte Situation. In einem raschen Sprung suchte ich in den Busch zu entkommen. Sofort drehte sich mein Gegner um und drückte mich mit seinem Hinterteil in den Busch hinein, wo ich mit den Händen einen kleinen Baum erreichen konnte und im instinktiven Selbsterhaltungstrieb hinaufkletterte. Der Baum war höchstens armdick, und seine kleine Krone, deren Zweige ich herabbiegen konnte, verbarg mich nur unvollkommen; ich hing an dem Baume wie an einer Turnstange und hatte keinen Ast[S. 58] als Stütze. Herr Petersen mochte etwa 40–50 Schritte hinter mir geblieben sein; ich hatte ihm, als ich plötzlich den Büffel erblickte, zugerufen: „Hier ist er, schieße!“ Ob er nun, als ich vom Büffel überrannt wurde und auf Sekunden die Besinnung verlor, schoß oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich fand nur später in seinem Gewehr eine leere Patronenhülse, ein Zeichen, daß er nicht repetiert hatte. Sei es, daß Petersen in der Aufregung diesen für einen erfahrenen Jäger unverzeihlichen Fehler begangen hat, sei es, daß er beim Angriff des wütenden Tieres auf die kurze Entfernung keine Zeit mehr dazu fand, ist ebenfalls unaufgeklärt geblieben, da wir später den schwerkranken Büffel nicht mehr finden konnten. In dem Augenblick, wo ich auf den Baum kletterte, sah der Bulle, als er sich drehte, Petersen und stürzte sich in rasender Wut auf ihn. Die Szene, der ich nun von meinem Zufluchtsorte aus wehrlos und hilflos zuschauen mußte, ist das Schrecklichste und Schauderhafteste, was wohl einem beherzten Manne zu sehen beschieden sein kann. Der Büffel warf Petersen nieder und suchte ihn auf seine Hörner zu bringen, indem er ihn am Boden hin und her schob, den ganzen Platz aufwühlend. In wenigen Sekunden hingen dem Ärmsten die Kleiderfetzen vom Leibe. Glücklicherweise schien er die Besinnung verloren zu haben, denn ich hörte nichts als das laute Schnaufen des Büffels. Endlich ließ dieser von dem anscheinend leblosen Körper ab und blieb etwa in 20 Meter Entfernung von mir stehen. Es war tatsächlich ein alter Einzelgänger mit einem prachtvollen Kopf und kapitalen Gehörn. Nun dachte ich: „Jetzt kommt die Reihe an dich,“ doch der Büffel nahm mich in meinem Versteck nicht wahr. Eine merkwürdige psychologische Tatsache, die mir allerdings erst später auffiel, war die, daß ich, obwohl ich den sichern Tod vor Augen sah, keinerlei Furcht empfand, sondern nur eine grenzenlose Wut, ohne Waffe zu sein und meinen Freund nicht rächen zu können. Unsere beiden schwarzen Gewehrträger waren natürlich spurlos[S. 59] verschwunden, was meinen Ingrimm noch erhöhte. Ich konnte aber nichts machen, als mich ganz stille zu verhalten, um die Aufmerksamkeit der Bestie nicht auf mich zu lenken; denn, wenn der Büffel mich bemerkt und den Baum auch nur gestreift hätte, wäre ich heruntergefallen und ihm wehrlos preisgegeben gewesen. Während letzterer schnaufend hartnäckig mir gegenüber stehen blieb und mir von der Anstrengung des Festhaltens am Baum die Glieder anfingen einzuschlafen, überlegte ich, was zu tun sei. Hinter mir, etwa 10 Meter entfernt, befand sich ein hoher bewachsener Termitenhügel, und hinter diesem ein großer Baum. „Kannst du den Hügel erreichen, ohne daß dich der Büffel bemerkt, so bist du gerettet!“ So überlegte ich. Wie ich freilich allein von da in der mir unbekannten Gegend mich zu unserem Lager zurückfinden sollte, von wo wir morgens im Nebel weggegangen waren, wußte ich nicht. Die Sonne brannte mir unbarmherzig auf den bloßen Schädel und die von dem Büffel getroffenen Stellen meines Körpers schwollen an und schmerzten; ich merkte, daß ich es nicht mehr lange in der schrecklichen Lage aushalten könne. Da sah ich plötzlich Petersen, der ganz nackt und wie tot dalag, sich aufrichten und sich gegen einen Baum schleppen, wo er niederkauerte. Mit schwacher Stimme rief er: „Schulz, schieß’ ihn tot!“ Der Arme wußte nicht mehr, daß ich gänzlich ohne Waffe selbst hilflos dem Büffel preisgegeben war. Welche Verzweiflung mein Herz durchwühlte bei dem Flehen meines todwunden Freundes, können Worte nicht schildern. Gerade wollte ich ihm zurufen, er solle sich ruhig verhalten, als der Bulle ihn wiederum erblickte und mit neuer Wut auf ihn zustürzte. Er schleuderte ihn seitlich vom Baume weg und mit einer blitzschnellen Drehung nahm er ihn auf die Hörner, warf ihn hoch und fing ihn dicht an meinem Baume mit dem Kopfe wieder auf. Das Krachen der zerbrechenden Knochen ging mir durch Mark und Bein. Es war zum wahnsinnig werden; ich klammerte mich an[S. 60] den einen Trost, daß der Arme nicht mehr leiden könne, sondern tot sein müsse. Der Büffel warf den toten Körper ein zweites Mal im hohen Bogen durch die Luft in einen Busch abseits meines Baumes und ließ seine Wut von neuem an ihm aus. Diesen Augenblick benutzte ich, glitt rasch vom Baume herab und lief hinter dem Busch nach dem erwähnten Termitenhügel, wobei ich über einen lang im hohen Grase liegenden Schwarzen stolperte, der sich lautlos und zitternd in demselben versteckt hatte. Mein erstes Wort war: „Schnell, such’ die Gewehre!“ Doch der Neger weigerte sich, vor Furcht zitternd, sie zu holen, während er mir die Termiten von den Kleidern ablas, die ich in meiner Aufregung gar nicht bemerkt hatte. Ich erkletterte den Termitenhügel und hielt Umschau. Der Büffel war nicht mehr zu sehen und schien sich entfernt zu haben. Jetzt kroch ich auf allen Vieren zu der Unfallstätte zurück, um selbst die Gewehre zu holen, die dort liegen mußten. Nach kurzem Suchen fand ich sowohl mein Gewehr als auch die Büchse Petersens und einen Speer nebeneinander auf dem Boden liegend. Sofort ergriff ich die Büchse und repetierte, wobei, wie schon oben bemerkt, eine leere Patrone herausfiel. Es waren noch zwei Patronen im Magazin, so daß ich zu der Ansicht kam, daß, wie gesagt, Petersen entweder keine Zeit mehr gefunden hatte zu schießen, oder aus Furcht, mich selbst zu treffen, in dem kritischen Moment nicht geschossen hatte. Ich kehrte auf den Termitenhügel zurück in der Hoffnung, den Büffel noch zu schießen, aber weit und breit regte sich nichts. Der Bulle hatte seine Wut erschöpft und war offenbar in das Wundbett gewechselt, denn ich hatte deutlich gesehen, daß er stark aus der Hüfte schweißte. Nun befahl ich dem ganz verstörten Schwarzen, seinen Kameraden herbeizurufen, was er durch Nachahmen eines Vogellockrufes tat. Einen der Neger schickte ich sofort nach dem Lager zurück, um meine eigene Büchse und Leute mit einer „Kitanda“ (Negerbettstelle) als Tragbahre für den Leichnam Petersens herbeizuholen.[S. 61] Inzwischen hielt ich auf dem Termitenhügel traurig die Totenwache und vertrieb die bereits in Scharen herankreisenden Aasgeier durch einen Schuß. Nie im Leben werde ich diesen traurigsten aller Weihnachtstage vergessen. Endlich kamen die Schwarzen mit der Tragbahre an und wir machten uns auf die Suche nach dem Leichnam. Als Petersens Diener beim Zurückbiegen eines Busches plötzlich die Leiche seines Herrn erblickte, verzerrte sich sein Gesicht vor Entsetzen. Der teilweise zerfetzte Körper bot einen fürchterlichen Anblick. Wir legten die Überreste meines armen Kameraden auf die Tragbahre, bedeckten sie mit Zweigen und langsam bewegte sich der traurige Zug nach dem Lager zurück. Sofort verfaßte ich einen Bericht an die deutsche Regierung und sandte ihn durch Eilboten nach Mohoro. Überallhin hatten die Neger bereits durch Trommelschlag das Unglück in die nächsten Dörfer gemeldet, und die Eingeborenen strömten massenhaft im weißen Kanzu, ihrem Feierkleide, zur Leichenfeier herbei. Wegen der tropischen Hitze mußten wir den Toten rasch begraben, denn es trat schon nach wenigen Stunden Verwesung ein. Ich wusch die Leiche und wickelte sie in Bettlaken ein. In der Nähe der Jagdhütte ließ ich ein tiefes Grab ausheben, in welches wir meinen armen Freund zur ewigen Ruhe betteten. Da kein Sarg vorhanden war, deckten wir einige Strohmatten über die Leiche und schaufelten die Erde wieder auf, während die Schwarzen nach ihrer Sitte in einer mir unverständlichen Weise sangen und tanzten. Das Grab ließ ich mit Dorngebüsch einzäunen zum Schutz gegen Schändung durch Hyänen und Schakale. Später ließ ich von Utete Steine holen und baute eine Pyramide mit einem schlichten Holzkreuz über der Ruhestätte auf. Ringsherum pflanzte ich Mangobäume und beauftragte den Dorfältesten des nächsten Dorfes mit der Beaufsichtigung des Grabes.
Von den an Beinen, Brust und Hals erlittenen Quetschungen durch den Büffel fühlte ich mich zerschlagen, dazu kam die Nachwirkung[S. 62] der seelischen Erregungen, so daß ich in einen Zustand völliger körperlicher und moralischer Erschöpfung verfiel. Mein Zustand war begreiflich, saß ich doch hilflos und allein, meines Gefährten beraubt, in der afrikanischen Wildnis, selbst kaum einige Worte der Eingeborenensprache kennend und meilenweit von jedem Europäer entfernt. Das Pflichtgefühl allein half mir über alles hinweg. Ich mußte und wollte den begonnenen Fangzug beenden. So raffte ich mich denn auf und machte mich an die Arbeit. An verschiedenen Orten warteten die gefangenen Tiere auf den Abtransport nach Europa. Der Dampfer, der sie nach Salale bringen sollte, war für den 17. Januar fällig, und ich mußte das Problem lösen, ohne Petersens Hilfe die ganze Arbeit des Kistenbauens und des Transportes aus den Tierlagern nach dem Flusse mit meinen wenigen Suaheliworten in der kurz bemessenen Zeit allein zuwege bringen. Hätte ich diesen Flußdampfer verpaßt, so hätte mein Tiertransport auch den Europadampfer nicht mehr erreicht und wäre während der drohenden Regenzeit überhaupt nicht mehr zum Abtransport gekommen. Das ganze Unternehmen wäre verloren gewesen, weil die Plätze, wo unsere Tierkrale lagen, zur Regenzeit vom Rufidji überschwemmt werden. So raffte ich meine letzte Energie auf und machte mich ans Werk.
Zunächst besuchte ich die Tierkrale, lehrte die Neger, wie sie die Tiere pflegen müssen und ging auch an den zweiten Platz bei Utete, um die dortigen Tierkrale zu revidieren und die inzwischen durch den Flußdampfer herbeigebrachten Materialien für die Transportkästen vom Flußufer nach dem Lagerplatze schaffen zu lassen. Ich fand einen jungen Neger, der ein weniges von der Schreinerei verstand, ließ auf den Köpfen der Träger alles nach dem Lager schleppen, und hier wirkten wir tagelang von morgens bis abends mit Säge und Hammer, bis alles Material verarbeitet war. Dabei stellte sich heraus, daß ich bei weitem nicht genügend Holz hatte, um Transportkästen für alle Tiere zu bauen. Ich half[S. 63] mir damit, daß ich für die kleinen Tiere hohe Körbe aus Lianen flechten ließ und nur den Boden derselben aus Brettern herstellte. Diese Körbe dienten bis zum Abtransport der Tiere den Wächtern, welche die Feuer gegen Raubgesindel unterhalten mußten, als Nachtlager, da sie sich in ihnen selbst vor Löwen sicher fühlten. Kaum war die Arbeit fertig, als mir die Wächter des Flußpferdkrales von Utete meldeten, daß der Fluß bereits bedenklich steige und daß sie fürchteten, die Flußpferde möchten über die Einfriedigung entkommen. Sofort brach ich nach dorthin auf. Die Nacht überraschte uns, und nicht nur den Schwarzen, sondern auch meinen erregten Nerven wurde es unheimlich in der von Großwild und Löwen belebten Gegend. In stockdunkler Nacht kamen wir an der dem Lager gegenüberliegenden Seite des kleinen Sees an, von wo aus der Flußpferdkral mit einem Einbaum zu erreichen war. Dröhnend schallte der zum Überholen verabredete Schuß über die Seefläche. In demselben Augenblick stürzten dicht neben uns zwei starke Flußpferde, die am Ufer geäst hatten, ins hochaufspritzende Wasser, uns einen gehörigen Schreck einjagend. Es dauerte lange, bis das Boot herüberkam, und als der Fährmann von den zwei aufgestörten Dickhäutern hörte, die sich in den See geflüchtet hatten, bekam er Angst und weigerte sich zurückzufahren; aber ich wollte hinüber und er mußte sich fügen. Die Überfahrt ging denn auch ganz glatt vonstatten. Es stellte sich heraus, daß die schwarzen Wärter übertrieben hatten, und ich sah, daß die Einfriedigung der Flußpferde ganz gut noch einige Zeit selbst bei weiterem Steigen des Sees zum Festhalten der Hippos genügte, so daß ich beruhigt zum ersten Tierlager zurückkehren konnte. Der erste Europäer, der mir wieder zu Gesicht kam, war ein Regierungsbeamter, Herr H., der, in amtlichen Geschäften auf einer Plantage weilend, von dem Tode Petersens gehört hatte und nun kam, um den Tatbestand aufzunehmen, wodurch mir eine große Last vom Herzen fiel. Herr H.[S. 64] übernahm auch die Regelung der Hinterlassenschaft und ließ Petersens Effekten abtransportieren. Einige Tage später traf Herr Regierungsrat Graß, der bei einem Jagdausflug ebenfalls von dem Unglücksfall gehört hatte, bei mir ein. Ich schilderte ihm meine Lage und er überließ mir in liebenswürdiger Weise zwei Polizisten (Askaris). Es waren gute und treue Leute, die mir sehr zustatten kamen und die Schwarzen in gehörigem Respekt hielten. Komisch war anzusehen, wie sie mit Wasser und Glasstückchen ihre Kopfhaare abrasierten. Herr Regierungsrat G. und ich hätten gerne den Unglücksplatz aufgesucht, um nach dem Verbleib des Büffels zu forschen. Es war mir aber unmöglich, die Stelle wiederzufinden, und die Schwarzen weigerten sich in abergläubischer Furcht, den Ort zu zeigen und ihn zu betreten. Herr Regierungsrat Graß schoß ein kapitales Gnu und zog dann weiter, nachdem er den beiden Askaris eingeschärft hatte, jedem meiner Befehle nachzukommen. Mit Hilfe der handfesten Unterstützung dieser beiden Askari ging alles wie am Schnürchen. Ich brachte alle meine Tiere in die Kästen und ließ sie mit den nötigen Instruktionen für Pflege und Fütterung in den Händen der schwarzen Wärter, diese wieder unter Aufsicht eines Askaris zurück. Hierauf eilte ich nach dem zweiten Lagerplatz bei Utete und bereitete auch dort alles zum Abtransport vor. Nun war die Frage, wie ich die zum Teil sehr schweren Kisten bis zu der etwa eine Stunde entfernten Anlegestelle des Dampfers bekäme. Die kleineren Kisten wurden samt ihrem lebenden Inhalt auf Tragstangen und auf den Schultern der Neger zum Einladeplatz an das Flußufer gebracht. Die Beförderung der schweren Flußpferdkasten dagegen hätte ungeheure Mühe gekostet, da der Weg über felsiges Gelände ging. Ich fand eine bequemere Route. Der See hatte einen kleinen Abflußgraben nach dem Rufidji zu, der aber mit Rohrbinsen und hohen Papyrusstauden verwachsen und während der Trockenzeit nicht befahrbar war. Jetzt aber, wo das Wasser stieg, dachte ich mir, daß die Boote[S. 65] der Eingeborenen nach dem Abhauen des Schilfes durchkommen könnten. Flugs nahm ich einen Einbaum, fuhr vom Flußpferdkral gerade über den See in den Abfluß hinein und ließ von den Schwarzen mit den Buschmessern einen Weg bahnen. Als wir uns nach zwei Tagen glücklich durchgearbeitet hatten und an einer Stelle, wo der Abfluß sich gehörig verbreitert hatte, zum Flusse durchstießen, wollte ich sehen, ob wir leicht an das Flußufer herankommen könnten, und ließ die beiden jungen Schwarzen, die den Einbaum paddelten, in die Strömung hineinfahren. Diese war aber so stark, daß die Ruderer die Herrschaft über das Boot verloren und wir mitten in ein Rudel spielender Flußpferde hineintrieben. Hätten wir eines der Tiere angerannt, so wäre es uns wohl schlecht ergangen. Schließlich gelang es unseren gemeinschaftlichen Anstrengungen, aus der Strömung und der gefährlichen Nähe der Dickhäuter herauszukommen und die gesuchte Sandbank, die Anlegestelle für den Dampfer, zu erreichen. Somit hatte sich meine Idee, die Flußpferde auf dem Wasserwege zum Einladeplatz des Dampfers zu bringen, als ausführbar erwiesen, und wir machten uns sofort ans Werk, dieselbe in die Praxis umzusetzen. Natürlich mußte zuerst die Schilfwildnis mit dem Buschmesser auf der ganzen Länge des Abflusses in einen breiten Weg gelichtet werden; sodann wurden drei Einbäume zusammengebunden und die Flußpferdkästen auf ihnen durch die schmale Wasserstraße des Seeabflusses bis zu der Sandbank am Rufidji gebracht. An einem Sonnabendnachmittag hatten wir endlich alle Tierkästen auf der Sandbank gelandet, und sie verblieben hier unter der Aufsicht der Wärter und eines Askaris.
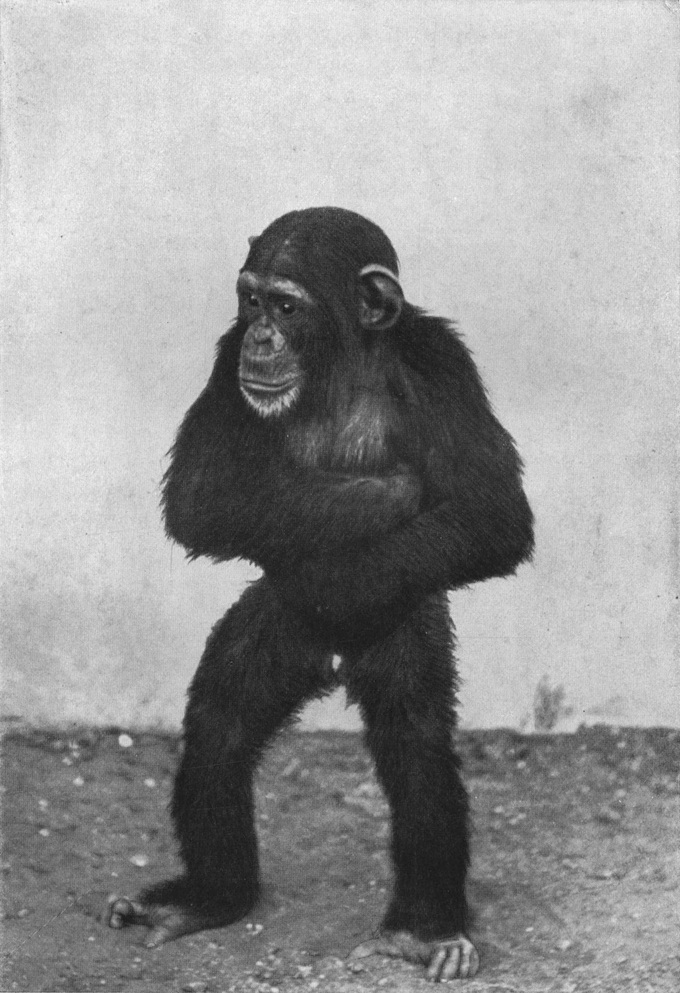
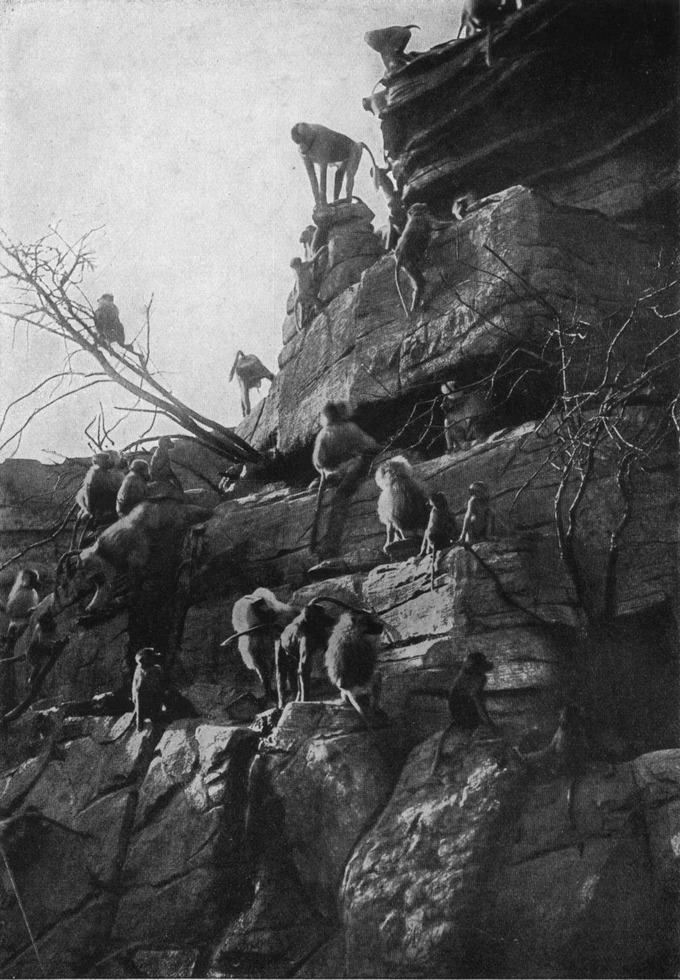
Die Wärter hatten während der Nacht sich zum Schlafen oben auf die schweren Flußpferdkästen gelegt. Am nächsten Morgen revidierte ich die Leute und sah zu meinem Erstaunen, daß die Sandbank eine Menge frischer Flußpferdfährten aufwies. Erschrocken darüber und in der Meinung, daß vielleicht die Gefangenen[S. 66] ausgerückt seien, lief ich schnell zu den Kästen, fand aber meine beiden Dickhäuter ruhig schlafend vor. Die Schwarzen erzählten, daß in der Nacht einige Flußpferde auf das laute Grunzen der eingesperrten Dickhäuter hin auf die Sandbank und ganz dicht an die Kästen herangekommen seien, diese beschnuppert hätten und unter Grunzen abgezogen seien. Diese Besuche wiederholten sich auch in den folgenden Nächten.
Nun kehrte ich zu der leeren Jagdhütte zurück und machte unterwegs eine prächtige Jagdbeute. Ich schoß einen Edelreiher (Herodias alba L.), dessen Schmuckfedern die außergewöhnliche Länge von 48 Zentimeter hatten und später der vielbeneidete Hutschmuck meiner Frau wurden.
Auffallend war, daß mit dem Steigen des Wassers alle Fische aus dem See verschwanden, und somit verzogen sich auch die fischfangenden Neger mit ihren Familien. Die ganze Zeit hatte das Wasser einen derartigen Fischgeschmack, daß es für mich fast ungenießbar war und ich mir von den in der Nähe befindlichen heißen Quellen Trinkwasser holen ließ. Am Sonntagmorgen hatte ich alles zum Aufbruch hergerichtet, um an das obere Tierlager zurückzukehren und auch dort die Kästen zum zweiten Anlegeplatz des Dampfers zu bringen, als mein Diener einen Europäer meldete. Ich lud ihn ein mit mir zu frühstücken, wobei er mir erzählte, er sei auf der Elefantenjagd und bei der Verfolgung eines starken Bullen auf meine Jagdhütte gestoßen. Ich konnte aus den wenige Meter hinter meiner Hütte vorbeigehenden frischen Spuren ersehen, daß der Elefant tatsächlich in der Nacht kaum vier Schritte hinter meiner Hütte haltgemacht hatte und dann vorbeigewechselt war. Der Jäger war so ermüdet, daß er die Verfolgung aufgab und nach seinem Zeltlager im nächsten Dorfe zurückkehren wollte. Dasselbe lag auf meinem Wege, und er lud mich zu einem Nachmittagskaffee ein. Wir besahen noch zusammen meinen Tiertransport und fuhren über den See und durch den[S. 67] angelegten Wasserweg. Nachdem der Herr die Tiere bewundert hatte, verabschiedeten wir uns und ich trat am Nachmittage meinen Marsch nach dem vier Stunden entfernt gelegenen Tierlager an, wo ich alles unter der treuen Aufsicht des Askaris in Ordnung fand.
Bei meiner Ankunft an Petersens altem Standlager hatte ich mehrere Male bei den Dorfältesten der umliegenden Ortschaften den Wunsch geäußert, einige Exemplare der dort häufig vorkommenden Hundsaffen (Papio cynocephalus L.) lebend zu bekommen. Nichts konnte den Schwarzen willkommener sein, als mir diesen Wunsch zu erfüllen. War ihnen doch damit nicht nur die Gelegenheit geboten, die frechsten Diebe ihrer Hirsepflanzungen zu bestrafen, sondern es winkte ihnen noch der Vorteil, für das unverschämte Gesindel bare Münze zu bekommen. Als ich nun diesmal am oberen Tierlager anlangte, mußte ich trotz meiner traurigen Stimmung herzlich lachen über den komischen Anblick, der mich da erwartete. Überall standen Körbe mit grunzenden und schreienden, sich wie toll gebärdenden Pavianen. Die Neger hatten sie in Netzen gefangen und einzeln oder zu mehreren in hohen Stabkörben herbeigebracht. Gerade kam wieder eine Karawane mit diesen Unholden an. Sie wurden in ihren Käfigen mit Tragstangen herbeigeschleppt. Da diese Käfige weder solide noch praktisch waren, so mußte ich alle Affen umquartieren; dabei entwischte uns mindestens ein Dutzend, die aber beim Lager blieben, weil sie da reichlich Futter fanden. Sie schwatzten unaufhörlich mit ihren gefangenen Kameraden, so daß der Lärm und der Unfug, den die ausgebrochenen Biester machten, unerträglich wurde. Außerdem kam zu meinem Entsetzen immer neue Zufuhr, und bald hatte ich über 100 Stück beisammen. Etwa 80 davon bevölkerten später den Affenfelsen des Stellinger Tierparkes. Nachdem die Affen alle untergebracht waren, ging am nächsten Tage frühmorgens der Abtransport dieses Tierlagers nach dem Rufidji[S. 68] los, wo der Dampfer nach Übereinkunft an einem bestimmten Platze anlegen sollte. Trotz der großen Anzahl von aufgebotenen Trägern wurde es nachts drei Uhr, bis das letzte Stück an Ort und Stelle war. Wir hatten als Weg zum Fluß einen Flußpferdwechsel benutzt und die schweren Tiere auf dem entliehenen Karren hinuntergebracht. Bevor ich den Unglücksplatz verließ, besuchte ich das Grab meines armen Freundes Petersen, durchlebte in Gedanken nochmals die schrecklichen Augenblicke und nahm stillen Abschied von ihm.
Die letzte Karrenladung bestand aus meinen persönlichen Effekten; ich folgte zu Fuße nach. Dabei wurde mir klar, wie mühselig der Transport der Tiere mit diesem Karren bei dem fürchterlich schlechten Wege gewesen sein muß und warum meine Leute so lange Zeit dazu gebraucht hatten: Zur Regenzeit, wenn der Boden weich ist, treten die schweren Flußpferde tiefe Löcher in den Boden, so daß der Weg sehr holperig und uneben wird. Der vor mir fahrende Karren schwankte beständig hin und her und drohte mehr als einmal umzukippen.
Am Flusse ließ ich mein Zelt unter einem Mangobaum aufschlagen, und meine Schwarzen besorgten das nötige Futter für die Tiere, wie Mais, Kürbisse, Süßkartoffeln, Hirse, Mangos und Bananen. Ich erhielt alles aus den nächsten Dörfern gegen Bezahlung prompt geliefert. Da an dieser Stelle der Fluß ein ziemlich hohes Ufer hat, ließ ich zum Einschiffen eine schiefe Ebene nach dem Wasser bauen. Während dieser Arbeit bemerkte ich eine von den Zweigen des Mangobaumes herabhängende, in herrlichem Grün schillernde Schlange. Sie glitt vom Zweige auf den Boden, und mit raschem Griff konnte ich sie am Genick fassen und in eine leere Blechdose stecken. In Hamburg erfuhr ich später, daß sie zur giftigsten ihrer Sippe gehörte. Als der Dampfer mit seinen beiden Leichtern am Einladeplatz anlegte, ging die Verladung infolge der vorhandenen schiefen Ebene ziemlich rasch[S. 69] vonstatten, da wir bis spät in die Nacht hinein bei hellem Mondschein arbeiten konnten. Am nächsten Morgen fuhren wir an die zweite Einladestelle bei Utete, wo die Flußpferde und die anderen Tiere an Bord genommen wurden. Beim Überzählen der Tiere fehlte ein Wasserbock, der nach der Aussage eines Schwarzen eingegangen war. Wohl oder übel mußte ich so tun, als ob ich an dieses Märchen glaube. Ich war aber fest davon überzeugt, daß meine getreuen Neger den Bock während meiner Abwesenheit in ihren Magen hatten verschwinden lassen. Der zur Aufsicht zurückgelassene Askari dürfte dabei sein schwarzes Gewissen durch Teilnahme an dem Mahle beruhigt haben. In aller Frühe des nächsten Tages fuhr der Flußdampfer mit seinen beiden zu Menagerien umgewandelten Leichtern ab. Wir hatten an Bord: 2 Flußpferde, 15 Wasserböcke, 2 Johnston-Gnus, Schwarzfersenantilopen, mehrere Zwergantilopen, verschiedene Vogelarten, etwa 100 Hundsaffen und einige Kisten mit Jagdtrophäen. Langsam fuhr der Dampfer mit den schwerbeladenen Leichtern flußabwärts, den Windungen folgend und sorgsam die zahlreichen Sandbänke meidend. Letztere waren belebt von vielen Krokodilen, zum Teil riesigen Tieren. Sie rutschten bei Annäherung des Dampfers langsam in die Flut. Eine Menge Reiher und fischender Vögel belebten ebenfalls die Ufer und die Sandbänke und ließen sich wenig stören. Auch an Gruppen friedlich dahintreibender Flußpferde kamen wir vorbei. Die vordersten tauchten vor dem Dampfer unter und kamen nach kurzer Zeit hinter dem Rade wieder zum Vorschein. Einen hübschen Anblick gewährten die Kühe mit ihren Jungen auf dem Rücken. Wenn das Junge im Wasser müde geworden ist, klettert es zum Ausruhen auf den Rücken der Alten. Es war für mich eine wahre Erholung, einmal in Ruhe alle meine Tiere auf einem Platz vereinigt zu haben und, von keiner Sorge gelenkt, den Tierfreund auf der Flußfahrt zu seinem Recht kommen zu lassen.
In Kilindi mußte der Dampfer auf die Post warten und auch[S. 70] Holz als Brennmaterial aufnehmen. Es war drei Uhr nachmittags, und ich benutzte ein Fahrrad, um nach dem drei Stunden entfernten Mohoro zu fahren, woselbst ich meiner Firma telegraphisch meldete, daß der Tiertransport glücklich unterwegs sei. Bei dem schlechten Wege und bei der brütenden Hitze brauchte ich 1½ Stunde bis zu genannter Ortschaft. Die weiße Bevölkerung bestand nur aus fünf Köpfen; auch befand sich dort ein Indier, der in seiner „Duka“ (Laden) außer europäischen Konserven auch deutsches Flaschenbier führte. Sein Laden, oder besser gesagt, seine Hütte, wurde von den wenigen Deutschen mit dem bezeichnenden Namen „Zum schmierigen Löffel“ benannt. Unter einem großen prächtigen Mangobaume vor der Hütte, dem Stammtisch der Europäer, ließen wir es uns beim Glase Bier wohl sein. Das Gespräch drehte sich hauptsächlich um die Löwenplage. Erst vor wenigen Tagen, während die Herren ihren gewohnten Abendschoppen unter diesem Mangobaum einnahmen, lief ein Löwe an ihnen vorbei in das Dorf hinein. Das Tier wurde noch in derselben Nacht in einer von dem Dorfältesten gestellten Falle gefangen und von den alarmierten Europäern bei Fackellicht getötet. Infolge der Warnung dieser Herren trat ich den Rückweg zum Dampfer nicht in der finsteren Nacht an, sondern wartete den Mondaufgang ab. Der Weg, den ich nach Kilindi per Rad zurückfuhr, war zum größten Teil auf beiden Seiten mit mannshohem Schilf und Gestrüpp bewachsen. Nur langsam kam ich vorwärts; der an und für sich nur spärliches Licht spendende abnehmende Mond wurde dazu noch öfters durch Wolken verdunkelt. Es mochte gegen vier Uhr morgens gewesen sein — den halben Weg hatte ich bereits hinter mir —, als ich seitwärts im Schilf ein Rascheln hörte, welches immer näher kam. Ich war der Meinung, eines der hier so häufig vorkommenden Wildschweine verursache das Geräusch. Um das Tier zu verscheuchen, läutete ich heftig mit der Radklingel, indem ich vorsichtigerweise[S. 71] meine Fahrt verlangsamte. Plötzlich sprang aus dem Schilf, nur wenig Schritte vor mir, ein großer Leopard auf. Ich schrie das Tier an; es war dadurch wohl ebenso erschrocken wie ich selbst. Einen Augenblick blieb das Raubtier vor mir stehen und verschwand dann in wilder Flucht ins Gestrüpp. Mir waren infolge der unverhofften Begegnung vor Schreck die Haare zu Berge gestiegen, denn ich war vollkommen unbewaffnet. Hätte ich nicht mein Fahrtempo verlangsamt, so wäre ich wohl mit dem Leoparden direkt zusammengestoßen und hätte dabei sicherlich den kürzeren gezogen.
An Bord angelangt, erzählte ich dem Schiffsführer von meiner Begegnung. Er spottete über die übertriebene Gefährlichkeit dieser Katzen und behauptete, in dieser wildreichen Gegend sei für den Menschen überhaupt keine Gefahr vorhanden, namentlich nicht für den Europäer. Er habe gerade diesen Weg nach Mohoro schon dutzende Male ohne jeden Unfall zu Fuß gemacht. Kaum einen Monat später wurde eben derselbe Herr auf dem gleichen Wege von Löwen angefallen und getötet.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach Übernahme der Post weiter. Der Fluß wurde immer breiter und links und rechts begannen die Mangrovenwälder, und die feuchttropische Hitze wurde fast unerträglich. Wir erreichten noch am Nachmittage Salale, gingen mitten im Flusse vor Anker und erwarteten dort die Ankunft des großen Ozeandampfers.
Der Fluß ist an dieser Stelle über einen Kilometer breit und führt Brackwasser. Infolgedessen hatte ich große Schwierigkeiten, das für meine Tiere notwendige Süßwasser zu bekommen. Ich mußte es von einem Brunnen vom Lande herholen lassen. In Salale wohnte der Förster Dankert nebst Familie, der die Aufsicht über die Mangrovenwälder führte. Er hatte bereits von dem Unglück gehört, wußte aber nicht, wer von uns beiden das Leben verloren hatte und beglückwünschte mich zu meiner Rettung.
[S. 72]
Als der große Dampfer eintraf, fuhr der Flußdampfer längsseits an ihn heran. Die Transportkisten wurden nun auf den Ozeanriesen gebracht und weiter ging es nach der Insel Mafia. Ich hörte, daß dort ein junges Flußpferd zu kaufen sei und fuhr mit dem Zollboote an Land, um das Tier zu besichtigen. Leider war der Eigentümer verreist. Das Tier gefiel mir außerordentlich und ich sandte einen Boten mit Kaufangebot dem Besitzer nach. Da ich entschlossen war, das Flußpferd zu kaufen, kehrte ich auf den großen Dampfer zurück und bat den ersten Offizier, mir vom Schiffszimmermann, einem Inder, eine Transportkiste machen zu lassen. Ich gab dem Manne die Maße und erklärte ihm die Konstruktion des Kastens mit Hilfe einer Kreidezeichnung und feuerte außerdem seinen Eifer durch ein entsprechendes Trinkgeld an. Nach wenigen Stunden erhielt ich denn auch die Meldung, die Arbeit sei getan. Aber was mußte ich sehen! Der schlaue Inder hatte nicht bedacht, daß seine Werkstätte nur mit einer schmalen Tür versehen war und daß daher die Notwendigkeit vorlag, die einzeln fertiggestellten Teile des Käfigs draußen zusammenzusetzen. So erblickte ich denn einen prachtvollen Transportkasten, der leider nur den Fehler hatte, nicht durch den engen Ausgang geschafft werden zu können, während der braune Zimmermann mit einem verlegenen Grinsen neben seinem Meisterwerke stand. Hier konnte man wirklich einmal sehen: Langes Haar, kurzer Sinn! Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Kiste in zwei Teile zu zerschneiden und sie am Lande wieder zusammenzusetzen. Hier aber machte uns der Wärter des Nilpferdes Schwierigkeiten. Er wollte nicht zugeben, daß das Tier in den Kasten gebracht werde. Erst durch meine Versicherung, daß die Antwort des Besitzers in kurzer Zeit eintreffen müsse und mit Nachhilfe einiger Rupien versuchte ich den Schwarzen umzustimmen. Widerspenstiger als der getreue Diener erwies sich jedoch das muntere junge Flußpferd. Trotz aller List und Mühe[S. 73] wollte uns der Einfang nicht gelingen; es wurde Nacht und die Zeit drängte. Endlich riß mir die Geduld und ich sprang über die Umzäunung in den Kral, um mit Gewalt meinen Willen durchzusetzen. Bei der herrschenden Dunkelheit geriet ich ins schlammige Wasserbassin; aber das erschreckte Hippo flüchtete nach dem Ausgang und schlüpfte hierbei glücklich in den Kasten, so daß ich schnell hinzueilen und die Schiebetür herunterlassen konnte. Ich hätte das Tier gern sofort abtransportiert, aber ich mußte erst die Antwort auf mein Kaufangebot abwarten. Wohl oder übel blieb mir nichts anderes übrig, als in meinen durchnäßten und schlammbedeckten Kleidern, von lästigen Moskitos umschwärmt, zu warten. Erst um zwei Uhr nachts traf der Bote mit der bejahenden Antwort ein und ich konnte die Kiste nach dem Zollamt bringen, um dort die nötigen Formalitäten zu erledigen. Inzwischen war aber einer jener starken Gewitterstürme, wie solche in ihrer elementarsten Gewalt häufig in den Tropen vorkommen, losgebrochen, und wir hatten harte Arbeit, den schweren Kasten auf einem Boote zum Dampfer zu bringen. Bei dem starken Gegenwind dauerte es über zwei Stunden, bis wir den Dickhäuter an Bord hatten.
In Kilwa-Kiwindji erwarteten mich weitere sechs Flußpferde in Kästen. Es war der 27. Januar, und an Land hatte ich Gelegenheit, vor der Weiterreise noch Kaisers Geburtstag im Kreise lieber Landsleute mitzufeiern. Nach zweitägiger Fahrt legten wir in Daressalam an, woselbst ich einen von der Firma Hagenbeck gesandten Kollegen vorfand, der diesmal den Tiertransport nach Hamburg bringen sollte. In Daressalam hatte ich 32 Strauße in Pflege gegeben, wovon leider während meiner Abwesenheit mehrere eingegangen waren. Sie waren für Deutsch-Südwest bestimmt und sollten über Hamburg dorthin gebracht werden. Als wir die Vögel in die bestellten Transportkästen bringen wollten, sah ich zu meinem Schrecken, daß letztere nicht nach meinen Angaben[S. 74] konstruiert und aus viel zu leichtem Holz gebaut waren, somit für eine Europareise nicht genügten. Es blieb nichts übrig, als in Hast Zimmerleute zu nehmen und alle Kisten umzubauen. Nachdem dies geschehen war und ich die Tiere glücklich im Zollamt hatte, erklärte mir der Zollvorsteher, daß das Verladen der Strauße auf den Dampfer ohne besondere Erlaubnis des Gouverneurs nicht gestattet werden könne. Trotzdem ich diese wichtige Erlaubnis besaß und die für die Ausführung der Strauße geforderte Summe von 9000 Mark ordnungsgemäß hinterlegt hatte, verweigerte mir der Vorsteher die Verladung. Die Zeit drängte und das Versäumen der Abfahrt des Dampfers hätte mir großen Schaden verursacht. Es blieb also nichts anderes übrig, als schnell eine Rikscha zu nehmen und, wie ich war, in schneller Fahrt zum Regierungsgebäude zu fahren. Der Gouverneur, Freiherr von Rechenberg, war abwesend; ich mußte also warten. Gegen ½9 Uhr abends hörte ich, daß Exzellenz anwesend, aber gerade beim Abendessen sei. In meiner Not ließ ich mich trotzdem melden. In liebenswürdiger Weise ließ mich Seine Exzellenz rufen und schrieb mir eigenhändig ein paar Zeilen an den Zollamtsvorsteher. Mit diesem kostbaren Briefe eilte ich zum Zollamte zurück und nun ging alles flott vonstatten. Um sechs Uhr morgens konnte ich meine Strauße einladen, und bald fuhr der Dampfer über Sansibar nach Tanga, wo wiederum Tiere unserem Transport zugefügt wurden. In Mombasa übernahmen wir noch das telegraphisch bestellte Futter für unsere Menagerie. Trotzdem es beschämend für uns Deutsche ist, möchte ich doch nicht verfehlen, hier die Erklärung zu geben, warum ich das Futter in Mombasa und nicht in Tanga oder Daressalam einkaufte. Das Futter für meine Tiere, wie Luzerne, Hafer, Heu, Zuckerrohr usw. kommt aus dem Innern. Auf den englischen Bahnen kostet dasselbe aber an Transportkosten nur ein Drittel dessen, was die deutschen Bahnen verlangen; das machte bei den großen Mengen, die ich brauchte, einen für meine Tasche fühlbaren Unterschied aus. Es ist ganz natürlich, daß man dort kauft, wo die Ware bei derselben Güte um vieles billiger ist. Nachdem nun auch die Magenfrage meiner Schützlinge in befriedigender Weise gelöst war, konnte ich meine Arbeit als beendet ansehen. Ich übergab also den Transport der Obhut meines Kollegen, der ihn auch glücklich nach Hamburg brachte, während ich selbst mich nach dem Norden der Kolonie begab, wo neue Aufgaben meiner harrten.
[S. 76]
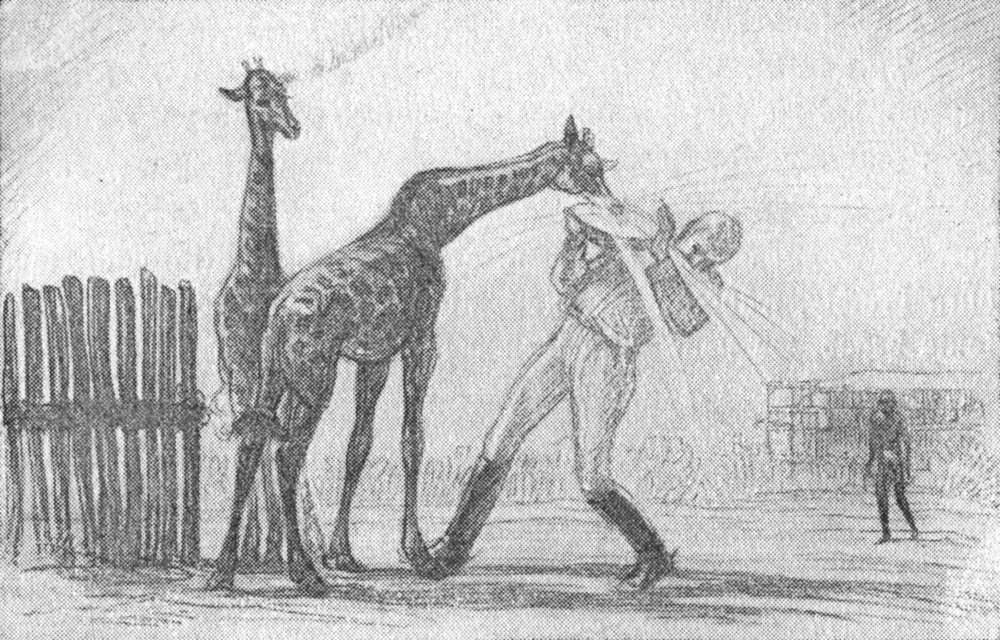
Der Dampfer „König“ hatte in Mombasa noch einige Tiere an Bord genommen und fuhr nun mit meinem großen Rufidji-Transport unter Aufsicht meines Kollegen nach Hamburg ab. Erleichtert atmete ich auf. Alle Tiere waren wohl und gesund an Bord untergebracht und befanden sich unter guter Obhut. Ich begab mich in mein Hotel zurück und legte mir meinen bereits ausgearbeiteten, neuen Plan nochmals zurecht, um sobald als möglich an die Ausführung desselben gehen zu können.
Lange schon war in mir der Gedanke gereift, einen großen Giraffen-Fangzug im Norden unserer Kolonie zu unternehmen. Bisher war die ostafrikanische Giraffe noch nie lebend nach Europa importiert worden. Die damals in den zoologischen Gärten vertretenen Giraffen stammten ausschließlich aus dem Sudan. Die Sudan-Giraffe weist mit ihren fahlgelben, gradlinigen Flecken[S. 77] auf hellem Untergrunde bei weitem nicht die frische Farbentönung auf wie die ostafrikanische Giraffe mit ihren kaffeebraunen, weinblattartigen Fleckenzeichnungen auf hellgrauem Grunde. Deutlich treten bei diesem schönen Tier der buntgefleckte Kopf, die weißgrauen Ohren und die gesprenkelten Beine hervor, während ihre sudanesische Schwester mehr monoton gefärbt ist. Ohne mich hervorzuheben, erfüllt es mich mit Stolz, als Ergebnis dieses Fangzuges die ersten Exemplare der ostafrikanischen Giraffe, und zwar der in der Masai-Steppe vorkommenden Art (Giraffa tippelskirchi Mtsch.) lebend nach Europa gebracht zu haben. Zum Fang selbst hatte ich mir das Meru-Gebiet, ein Dorado der Giraffen, ausersehen. Bemerken möchte ich noch, daß die in der Küstenregion lebende Giraffe (Giraffa schillingsi Mtsch.) nach Prof. Matschie eine besondere Spezies darstellt.
Zunächst begab ich mich mit der britischen Ugandabahn nach Voi, um von hier aus über eine etwa 70 englische Meilen weite wasserlose Strecke an die Grenze und in das deutsche Meru-Gebiet zu gelangen. Da zu jener Zeit die deutsche Usambarabahn noch nicht bis in diese Gegend vorgebaut war, so wurden alle Waren, die für das deutsche Kilimandjaro- und Meru-Gebiet bestimmt waren, in Mombasa ausgeschifft und mit der englischen Ugandabahn nach Voi befördert. Von dort mußten sie mit Eselfuhrwerken quer durch die Steppe transportiert werden. Die bequemen und sicheren Ochsenfuhrwerke der Buren konnten dazu nicht benutzt werden, weil auf dieser Strecke Tsetse-Gefahr herrschte. Esel sind zwar auch nicht sicher vor der Tsetse-Infektion, aber weit weniger empfindlich als Ochsen und Pferde. Ein Inder war auf die gute Idee verfallen, mit einem Lastauto die Beförderung von Gütern durch dieses Gebiet zu unternehmen. Ich machte mir dies zunutze und sicherte mir bei dem Chauffeur, einem Deutschen, gegen Geld und gute Worte einen Platz neben dem Führersitz. Der Wagen war angefüllt mit indischen Kaufleuten, Banjanen,[S. 78] Fundis (Handwerker), deren Familien und ihren Waren. Bequem hatten es diese Passagiere gerade nicht; Männer, Frauen und Kinder saßen auf und neben den Gepäckstücken wie Heringe zusammengepreßt. Das Auto fuhr frühmorgens um sechs Uhr ab, und bis zum Voi-Fluß ging alles ohne Unfall. Aber dort auf dem weichen Boden genügten die Kräfte des Benzinkastens nicht mehr, wir mußten absteigen und durch Schieben und Ziehen die fehlenden Pferdekräfte ersetzen, um die steile Böschung zu überwinden. In holperiger Fahrt ging es wieder weiter bis in die Nähe von Bura, wo die erste Haltestelle sein sollte. Kurz vor Bura, wo sumpfiges Gelände vorherrschte, war eine Art Damm aus Sand aufgeschüttet, auf dem das Auto dahinfuhr. Unter der Last des schwerbepackten Wagens gab der Damm auf der einen Seite nach, und ehe wir uns versahen, schlug der Karren um und die ganze Reisegesellschaft mit sämtlichem Gepäck lag im Sande. Glücklicherweise war kein Unglück geschehen, und trotz des erlebten Schreckens mußte ich herzlich lachen über den Anblick, wie die Inder und ihre vermummten jammernden Weiber und Kinder unter den Gepäckstücken hervorkrochen. Nun galt es, unser Fahrzeug wieder aufzurichten; dazu reichten aber unsere Kräfte nicht aus. Es wurden einige Inder in das nahe Dorf geschickt, um Schwarze zu Hilfe zu rufen. Wenn es schon für verständige Europäer nichts Leichtes ist, ein mehrere Tonnen schweres, umgestürztes Auto ohne Hebezeug wieder auf die Räder zu bringen, so war dies mit den ungeschickten Negern erst recht ein schweres Werk. Bewunderungswert war die Kaltblütigkeit unseres Chauffeurs; als sein Fuhrwerk auf dem Rücken lag, hatte er nur die lakonischen Worte: „So, da liegt er, ich mach’s auch so“; sprach’s und ließ den Worten die Tat folgen. Da ich ungeduldig war, vorwärtszukommen, machte ich mich allein mit den Indern und herbeigeeilten Negern daran, das Auto wieder aufzurichten. Mit Hilfe von Ästen und Baumstämmen gelang es nach vieler[S. 79] Mühe, den Wagen wieder in seine natürliche Stellung zu bringen. Er war so solide gebaut, daß der Chauffeur zu unserer Freude feststellen konnte, daß gar kein Schade geschehen war.
In Bura nahmen wir genügend Wasser auf, da wir jetzt die wasserlose und unbewohnte Serengeti-Steppe zu durchqueren hatten. Die Fahrt ging, alten Fahrrinnen folgend, durch das sanft ansteigende wellenförmige Gelände. Abwechselnd durchfuhren wir Dorn- und Buschsteppe, Einöden und weite Grasflächen. Unbarmherzig brannte die tropische Sonne auf das kleine, nur wenig Schutz bietende Segeldach des Autos herab. Der aufwirbelnde Staub, der Benzingeruch, dazu die schreckliche Hitze machten die Fahrt zur Last. Durch das herankommende Auto aufgeschreckt, sauste das Wild in hohen Fluchten über die Steppe.
In diesem Gebiete, das sehr wildreich ist und welches von der britischen Regierung zum Wildreservat erhoben wurde, fiel mir die häufig in Herden auftretende Kuhantilope, hier Kongoni genannt, besonders auf. Diese Antilope (Bubalis cokei Gthr.) hat die Größe eines kleinen Rindes, besitzt einen außergewöhnlich langen Kopf mit merkwürdig doppeltgekrümmten Hörnern und einen nach hinten zu abfallenden Rücken. Der Oberkörper ist hellbraun gefärbt, während die Unterseite hell hervorleuchtet. Für mich waren es interessante und abwechslungsreiche Bilder, diese Kongonis in ihren eigenartigen, hohen Sprüngen über die weiten Flächen flüchten zu sehen. Auch andere Wildarten kamen fortwährend zum Vorschein, um bald wieder zu verschwinden. Unter dem ihnen eigentümlichen Gekreische stoben ganze Ketten von Perlhühnern und Frankolinen vor unserem Auto in die Höhe. Gegen Abend hatten wir bereits eine höherliegende Region erreicht. Nach Einnahme eines einfachen Mahles und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen gegen vierbeinige Räuber hüllten wir uns in unsere Decken und verbrachten die in dieser Höhenlage schon kalte Nacht unter freiem Himmel.
[S. 80]
Am nächsten Morgen wurde ich bei Anbruch der Dämmerung durch ein prachtvolles Naturschauspiel überrascht. Alles war noch in Dunkel gehüllt, da sah ich in weiter Ferne die beiden schneebedeckten Gipfel des Kilimandjaro, den Kibo und Mawenzi, unter den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne aufleuchten. Wie gebannt stand ich und genoß das herrliche Bild. Allmählich wurde es heller und die Umrisse des imposanten Bergriesen wurden immer deutlicher sichtbar. Weithin schimmerten die beiden Gipfel, welche hoch über eine Wolkenschicht hinausragten. Zum ersten Male sah ich den Giganten der afrikanischen Berge und das Herz jauchzte mir vor Seligkeit über die überwältigende und zauberhafte Pracht, welche mir dieser Anblick bot. Dort drüben lag also das deutsche Gebiet, und mit Freuden begrüßte ich den König der deutsch-ostafrikanischen Bergwelt, der am vergangenen Tage noch durch einen Dunstschleier verdeckt gewesen war.

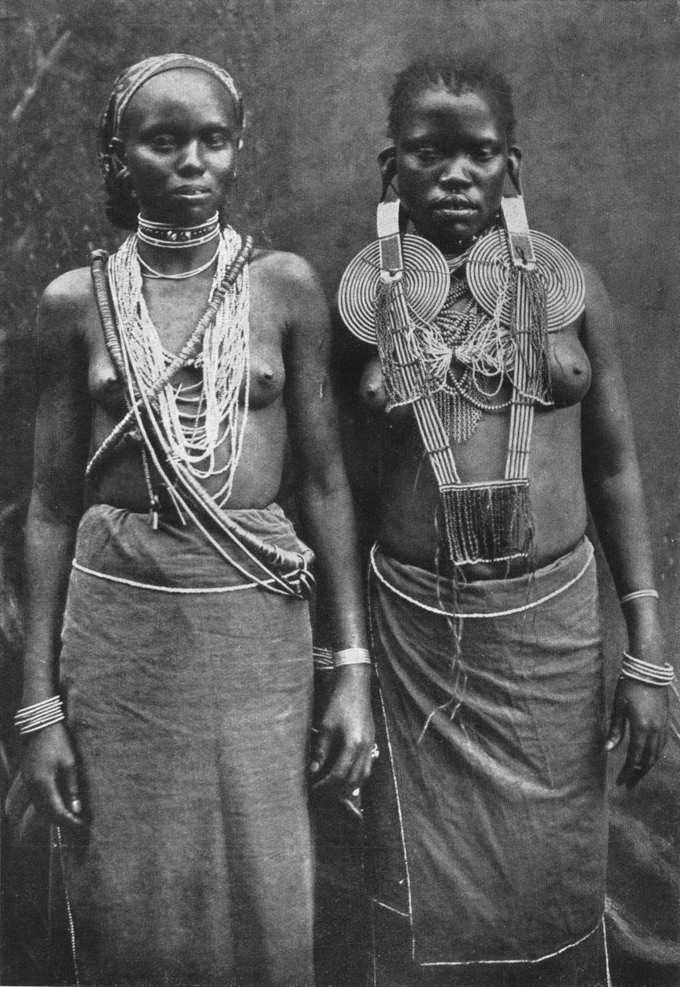
Nach Einnahme eines frugalen Frühstücks setzten wir die Fahrt fort. Die warmen Sonnenstrahlen taten unseren durchfrorenen Gliedern recht wohl. In schlangenförmigen Windungen näherten wir uns immer mehr und mehr dem Kilimandjaro und somit der deutschen Grenze. Endlich, am Nachmittag, erreichten wir die britische Grenzstation Taveta, das Endziel unserer Autofahrt. Hier mietete ich für den Weitertransport meines Gepäcks einige Eselkarren und ließ sie unter Aufsicht meiner Schwarzen weiterfahren. Ich selbst fuhr auf meinem mitgebrachten Fahrrad bis zu einer in der Nähe des Himoflusses liegenden Ansiedlung voraus, wo ich in einer aus Baumstämmen und Lehm errichteten Hütte, dem „Hotel zum blauen Affen“, übernachtete. Hier trafen auch mehrere Buren aus Aruscha mit ihren eigenartigen Ochsenwagen ein. Sie besorgten den Frachtverkehr von Buiko, der damaligen Endstation der Usambarabahn, nach Aruscha. Die Buren sind groß in der Kunst, ihre Ochsen mit Wort und Peitsche zu leiten. An einen ihrer sogenannten „Treckwagen“ sind mindestens vierzehn oder[S. 81] mehr Ochsen gespannt. Jeder Ochse hat seinen Namen und kennt ihn ganz genau. Der Führer trägt eine ungeheuer lange, aus Giraffenhaut gefertigte Peitsche und ruft jedes lässige Tier an, diese Aufmunterung jeweils mit einem wohlgezielten Peitschenhieb unterstreichend. Einer dieser Buren hatte sich derartig heiser geschrien, daß er kein lautes Wort mehr hervorbringen konnte, und ich hatte Gelegenheit, ein merkwürdiges Hausmittel gegen Heiserkeit angewendet zu sehen. Der Bur verschluckte nämlich einige Löffel Petroleum mit Zucker und versicherte mir, daß diese den Frachtfahrern allgemein bekannte Medizin absolut sicher wirke. Das Hausmittel half auch wirklich. Hier in der Wildnis, wo auf weite Strecken weder Arzt noch Apotheke zu finden sind, ist es gut, wenn der Reisende oder Ansiedler einige medizinische Kenntnisse mitbringt und ebenso über eine kleine, richtig zusammengestellte Hausapotheke verfügt.
Die Eselkarren, welche mein Gepäck weiterführten, trafen gegen Morgen ein und letzteres wurde von einem Buren gegen Erlegung von 10 Mark pro 100 Pfund zur Weiterbeförderung nach Aruscha übernommen. Dieser hohe Frachtsatz ist bedingt durch die schlechten Straßenverhältnisse und weiterhin durch das Risiko des Zugtierverlustes infolge des Vorkommens der Tsetse-Fliege. Mir selbst ging das Ochsenfuhrwerk zu langsam, weshalb ich trotz der schlechten Wege bis Moschi, dem Sitze eines Bezirksamtes, wiederum das Stahlroß benutzte.
Unterwegs schon bemerkte ich, wie sich das Landschaftsbild zusehends veränderte. Drüben auf dem englischen Gebiet noch die dürre Grassteppe und hier üppige Vegetation! Überall traten Pflanzungen und Niederlassungen auf, besonders am Fuße des Kilimandjaros reihte sich eine Ansiedlung an die andere. Die dem Bergriesen vorgelagerte Hochebene gehört zu den fruchtbarsten und gesundesten der Erde. Bis zu 1500 Meter, den erloschenen Vulkan-Giganten hinauf, erstrecken sich ganze Wälder von Bananen,[S. 82] der Hauptnahrung der dort ansässigen Wadjagga-Neger. Die höher gelegenen Urwälder und ebenso die nachfolgende Bambuszone bieten einer großen Anzahl von Elefanten, Büffeln, Elenantilopen, Buschschweinen, Leoparden, Servalen und vielen anderen Tierarten sicheren Aufenthalt und reichliche Nahrung. Die buntgefiederte Vogelwelt ist außerordentlich reich vertreten, gleichfalls die in vielen prächtigen Arten vorkommenden Insekten, kurzum, wir fanden hier ein wahres Tierparadies, einen richtigen Naturpark, wie ihn die Regierung nicht besser zum Wildreservat bestimmen konnte.
In Moschi angekommen, stieg ich im Hotel von Dr. Förster ab und machte dem Bezirksamtmann meine Aufwartung. Auch traf ich einen Herrn, der gleichfalls den etwa 100 Kilometer langen Weg von Moschi nach Aruscha zu Rade zurücklegen wollte. So hatte ich angenehme Gesellschaft, und wir fuhren gemeinsam am nächsten Tage ab.
Auf dem anfangs wunderschönen, wenngleich etwas ansteigenden Wege kamen wir bei dem herrlichen, kühlen Wetter rüstig vorwärts. Wir passierten den Kikafu-Fluß, das Dorf Boma Nja-ngombe und machten am Sanja-Fluß kurze Rast. Unterwegs begegneten wir großen Schaf-, Ziegen- und Rinderherden, die von Masai-Hirten gehütet wurden; auch zahlreiche wilde Strauße sowie Herden von Zebras und Antilopen sahen wir äsend über die üppige Grassteppe ziehen. Nach und nach wurde der von den schweren Burenwagen zerfahrene Weg für uns immer schwieriger. Stellenweise machte die verwitterte Lavamasse, in welche wir bis zu den Knöcheln wie in Mehl einsanken, das Fahren mit dem Rad gänzlich unmöglich. Der aufwirbelnde aschenartige Staub bildete auf der schweißigen Haut eine graue Kruste und erschwerte uns auch das Atmen und Sehen. Wir näherten uns dem Meru-Berge. Nachmittags erreichten wir den Maji ya Tchai (suah. = Teewasser). Einige dort mit Transportwagen rastende[S. 83] Buren bewirteten uns mit einer Tasse Kaffee. Nach kurzem Aufenthalt ging es weiter zum Flusse Nduruma. Wir mußten dabei allerdings wiederum unsere Stahlrosse schleppen und konnten nur kurze Strecken fahren. Von hier waren nur noch etwa 25 Kilometer bis zu unserem Ziel (Aruscha) zurückzulegen. Es bot sich die günstige Gelegenheit, uns am Flusse von der Aschenkruste zu befreien und uns durch ein Bad zu erfrischen. Eben damit fertig, hörte ich Pferdegetrappel und plötzlich meinen Namen rufen. Von Moschi aus war nämlich meine Ankunft telegraphisch nach Aruscha gemeldet worden. So war nun die anstrengende Radtour glücklich zu Ende, da mir ein Wirt aus Aruscha mit zwei Maultieren entgegengeritten war. Nach einer guten Stärkung, die sich in der Satteltasche vorfand, ritten wir im scharfen Trabe Aruscha zu und trafen daselbst am Abend ein.
Am nächsten Tage hatte ich einen Fieberanfall. Offenbar hatte ich mich auf meinem Jagdzug am Rufidji mit Malaria infiziert und bei meiner Radtour mich überanstrengt. Ich sollte einige Tage das Bett hüten, mochte aber nicht stilliegen, und so raffte ich mich auf, um die Vorbereitungen zum Giraffenfangzug zu treffen. Der Ritt zu einer etwa 10 Kilometer entfernt liegenden Burenfarm griff mich derart an, daß ich Schwindelanfälle bekam und, an meinem Ziele angekommen, die Besinnung verlor. Die guten Farmersleute brachten mich zu Bett und pflegten mich in rührender Weise 21 Tage lang, bis ich wieder ganz hergestellt war. Durch frische Milch, bekömmliche Nahrung und die herrliche Luft gelangte ich bald wieder zu Kräften. Jetzt galt es das Versäumte nachzuholen. Vor allen Dingen hieß es nun, die Expedition zusammenzustellen. Die erwähnte Farm wurde der Ausgangspunkt für den Giraffenfangzug. Auf ihr wollte ich die gefangenen Tiere zähmen und futterfest machen, denn ein frisch gefangenes Exemplar besteht selten die Seereise nach Europa. Zu diesem Zwecke wurden einige Gehege und Schutzdächer für die einzufangenden[S. 84] Tiere errichtet. Der ganze Fangzug war auf etwa sechs Wochen berechnet.
Was es heißt, eine solche Tierfangexpedition auszurüsten und zusammenzustellen, wird sich wohl mancher Leser kaum vorstellen können. Vor allen Dingen braucht man tüchtige und zuverlässige Leute sowie gute und schnelle Pferde. Wagen, Gespanne, Milchkühe und Ziegen für die einzufangenden jungen Tiere, Fanggeräte, Ausrüstung, Zelte, Proviant, Waffen und vieles andere mehr muß angeschafft werden, und alles dies ist mit großen Geldopfern verknüpft, ja mitunter sogar in manchen Gegenden überhaupt nicht zu beschaffen. Unter Mitwirkung meines Wirtes und dessen geländekundigen Freundes, welche beide am Fangzug teilnehmen wollten, konnte ich meine Vorbereitungen in kurzer Zeit vollenden.
Als Fanggebiet war die Gegend zwischen dem Meru-Berg und der ostafrikanischen Bruchstufe ausersehen. Die Entfernung zwischen ihnen beträgt etwa 100 Kilometer. Das Gelände weist mehrere isoliert stehende Bergkegel, wie z. B. Kitumbin und Mondul (Rascha-Rascha) auf. Vorherrschend in diesem Gebiet ist die typische Gras- und Buschsteppe, in der eingesprengt sich ausgedehnte Parklandschaften befinden. Diese Parklandschaften mit ihren großen Mimosenbeständen sind die Aufenthaltsplätze der Giraffen.
An einem Nachmittage setzte sich der ganze Troß, die nordöstliche Richtung einschlagend, in Bewegung. Wir bestiegen unsere Pferde und ritten der Karawane nach. Etwa 20 Kilometer von unserem Ausgangspunkt entfernt bezogen wir an einer Wasserstelle das erste Lager. Wir befanden uns in einer Höhenlage von etwa 1400 Metern, und die Nachtkühle machte sich deshalb stark bemerkbar. Der Unterschied der Temperatur zwischen der hiesigen Gegend und der am früher beschriebenen Rufidji-Fluß im Süden ist ein ganz gewaltiger. Hier das schöne kühle und moskitofreie[S. 85] Gelände, dort unten am Fluß die dumpfe, feucht-heiße Luft mit der schrecklichen Moskitoplage.
Am anderen Morgen in aller Frühe begann der Weitermarsch. Diesmal ritten wir der Karawane voraus. Ein wahrer Hochgenuß ist es, im taufrischen Morgen in die freie, unabsehbare Steppe hineinzureiten. Das Herz geht einem auf, wenn man nach den ersten Sonnenstrahlen von den hundertfältigen Stimmen der erwachenden Natur begrüßt wird. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich die unendliche Gras- und Buschsteppe, belebt von vielen Vogelarten. Dicht vor uns auf dem Grasboden laufen große Ketten von Perlhühnern und rebhuhnfarbigen Frankolinen, hin und wieder sieht man einzeln oder auch zu mehreren die großen sowie die kleinen Trappen (Otis kori Burch. und Otis melanogaster Rüpp.) herumstolzieren. Kibitze steigen laut kreischend in die Höhe, um bald wieder in die Steppe einzufallen, auch der langbeinige Sekretär oder Schlangengeier (Serpentarius serpentarius Miller) ist schon eifrigst auf der Nahrungssuche. Öfters sieht man auch den kahlköpfigen Marabu stolz einherschreiten. Viele Singvögel lassen ihr Lied und Gezwitscher in den Morgen hinein ertönen. Auf dem Boden nach Würmern suchend oder auch in den Akazien sitzend, fallen besonders die Silberglanz-Stare durch ihr prächtiges Gefieder ins Auge. Witwenvögel, deren Männchen im schwarzen Hochzeitskleide prangen, flattern in kurzem, wellenförmigem Fluge über das hohe Steppengras. Weißwangige, graue Mausvögel klettern im Geäste der Bäume. Noch viel anderes gefiedertes Volk erfreut das Herz des Naturfreundes durch seine Stimmen, Farbenpracht und anmutigen Bewegungen. Die gesamte Vogelwelt nimmt von uns Reitern kaum Notiz und zeigt fast keine Scheu.
Die ganze Steppe ist kreuz und quer von vielen Wildwechseln durchfurcht, und man wird unwillkürlich in den Glauben versetzt, große Rinder-, Schaf- oder Ziegenherden hätten das Gelände[S. 86] durchzogen. Manche Wechsel sind ganz tief ausgetreten. Die vielen Oryx-, Elenantilopen- und Gnufährten verraten uns schon den großen Wildreichtum dieser Gegend; auch die dreizehigen Nashornfährten finden sich vor, und an den verbissenen Büschen sieht man, daß erst vergangene Nacht so ein Dickhäuter hier geäst hat. Nun zeigt sich das erste Wild. Wir reiten an großen Zebraherden vorüber, die uns alle den Kopf zudrehen und uns anäugen, ohne jedoch die Flucht zu ergreifen. Kleine Rudel von Thomsongazellen stellen sich uns spitz gegenüber und äugen nach uns herüber, während sie ihren Wedel fortwährend in possierlicher Weise hin und her bewegen. Da sehe ich am Boden einen länglichen, großen Tritt, die erste Giraffenfährte! Bald sehen wir mehrere, und wir haben unser Tätigkeitsgebiet erreicht. Ich war wieder in meinem Element und die herrliche Natur ließ mir nach überstandener schwerer Krankheit das Leben doppelt schön erscheinen.
In der Nähe eines großen Wassertümpels errichteten wir am Nachmittage unser Standlager und bauten in diesem Tierparadies einige Krale für die zu erwartende Beute. Vor allen Dingen hieß es nun zuerst die vor uns liegende Gegend zu erkunden, denn es gab in dem flachen Gelände viele versteckt liegende weitklaffende Erdrisse und steilwandige Schluchten, die dem jagenden Reiter, der das Gebiet nicht kennt, leicht verhängnisvoll werden konnten. Ein Sturz von Roß und Reiter in eine Tiefe von 15 Meter wäre wohl mit dem Tode gleichbedeutend. Indem wir an diesen Schluchten entlangritten, orientierten wir uns genau über deren Lage. Bei einem derartigen Erkundungsritt sichteten wir das erstemal ein Rudel von 11 Giraffen. Die Tiere waren aus der Parklandschaft herausgekommen und wechselten an dem Walde entlang. Es waren alles ausgewachsene Stücke, und ich genoß den herrlichen Anblick, die Riesen der Steppe nur auf wenige hundert Meter entfernt in ihrem wiegenden Paßgang vorbeiziehen zu[S. 87] sehen. Durch kleine Tritte im Sand wurde ich auf das Vorhandensein von Jungtieren aufmerksam, und ich war davon überzeugt, daß in dem vor uns liegenden Buschgelände auch Rudel mit solchen vorhanden sein mußten.
Nachdem wir alles vorbereitet und uns gut orientiert hatten, wählten wir einen Hügelrücken, von wo wir eine vorzügliche Übersicht über die ganze Gegend besaßen, zum Ansitz. Die Pferde wurden in Deckung hinter dem Hügel bereitgehalten. Mit scharfen Gläsern beobachteten wir den Buschwald. Die langhalsigen Tiere sind in einem baumbewachsenen Gelände mit bloßem Auge äußerst schwer auszumachen, besonders wenn die Sonne im Zenit steht und das Wild sich im Schatten der Bäume befindet. In der heißen Tageszeit, etwa von 9 bis 3 Uhr, stehen oder liegen die Giraffen gewöhnlich im Schatten hoher Akazien. Dies ist die günstigste Beobachtungszeit. Stundenlang kann man mitunter sitzen, bis eine Giraffe den Kopf über den Baumkronen bewegt, wodurch man erst auf den Standplatz des Rudels aufmerksam gemacht wird. Zum Fang selbst ist aber die beste Zeit frühmorgens oder nachmittags, weil die Tiere um diese Zeit ihre Standplätze wechseln und durch freies Gelände ziehen.
Nun haben wir ein Rudel mit Kälbern gesichtet und es beginnen die spannendsten Momente. Schnell geht es an die Pferde, das Sattelzeug wird nachgesehen und so leicht als möglich bekleidet aufgesessen. Hinter Bäumen und Büschen stets in Deckung bleibend, geht es immer in abgekürztem, leisem Trab so nahe als möglich an die Tiere heran. Wir befinden uns 200 Meter von dem Rudel, und das zu fangende Jungtier ist schon genau auszumachen. Deutlich sehen wir es neben seiner Mutter an einem Busche äsen. Die Spannung steigert sich, jeder Nerv ist angespannt. Noch wenige Meter weiter herangekommen, da eräugen uns die Giraffen und die ganze Gesellschaft wendet sich zur wilden Flucht. Jetzt gibt es kein Halten mehr, die Pferde bekommen die Sporen,[S. 88] alles ist vergessen und die Gedanken und Augen sind einzig und allein auf die junge Giraffe gerichtet. Mitten in das Rudel sprengen wir hinein und versuchen das neben der Mutter flüchtende Junge von seinen Gefährten abzutrennen. Links und rechts sausen wir an den großen Tieren, über Hindernisse hinwegsetzend, vorbei und bald haben wir das Jungtier in ein offenes Gelände gedrückt; das Rudel flüchtet weiter und die Fangschlinge saust über den Kopf der jungen Giraffe. Sobald die Schlinge sitzt, versucht man mit dem Pferde vor die noch immer in voller Flucht sich befindliche Giraffe zu kommen und somit das Tier zum Stehen zu bringen. Schnell sind wir vom Pferde gesprungen, der zweite Reiter ist inzwischen auch herangekommen, und noch ein weiterer Fangstrick wird dem Tier über den Kopf geworfen. Die Giraffe zeigt sich jetzt zunächst völlig verdutzt, merkt aber bald ihre Lage, und unter lautem Blöken vollführt sie die tollsten Sprünge und versucht sich zu befreien. Sie schlägt mit Vorder- und Hinterläufen nach uns, und es heißt äußerst vorsichtig sein, daß man von den ersteren nicht auf den Kopf getroffen wird. Es ist mir vorgekommen, daß halsstarrige junge Bullen direkt auf mich losgingen und mit den Vorderläufen nach mir schlugen. Einmal wurde mir der Tropenhelm glatt durchgeschlagen. Vorsichtshalber habe ich mir später immer den Korkhelm mit Gras ausgefüllt. Die junge Giraffe darf nur mit sanfter Gewalt behandelt werden. Ein unvorsichtiger Ruck kann dem Tier leicht den langen Hals ausrenken oder gar brechen. Eine Giraffe muß innerhalb 3–4 Minuten gefangen sein, da sie sonst zu Tode gehetzt wird. Daß hierzu ausgezeichnete schnelle Pferde die erste Bedingung sind, braucht wohl kaum erst erwähnt zu werden. Die Giraffe ist ein überaus schnelles Tier und vermag auf der Flucht 8–900 Meter in der Minute zurückzulegen.
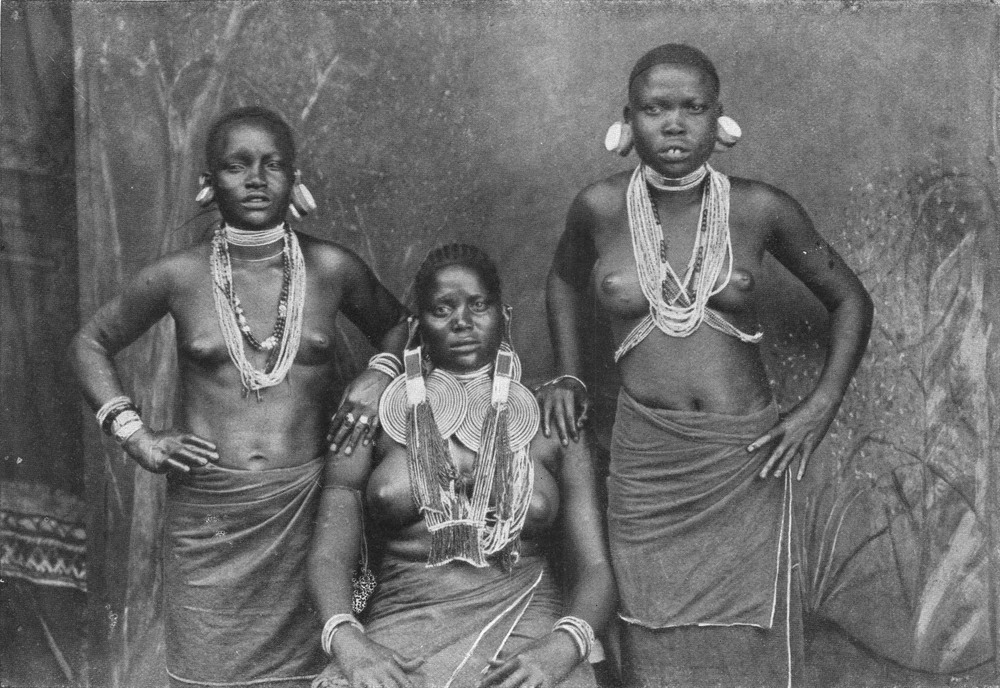
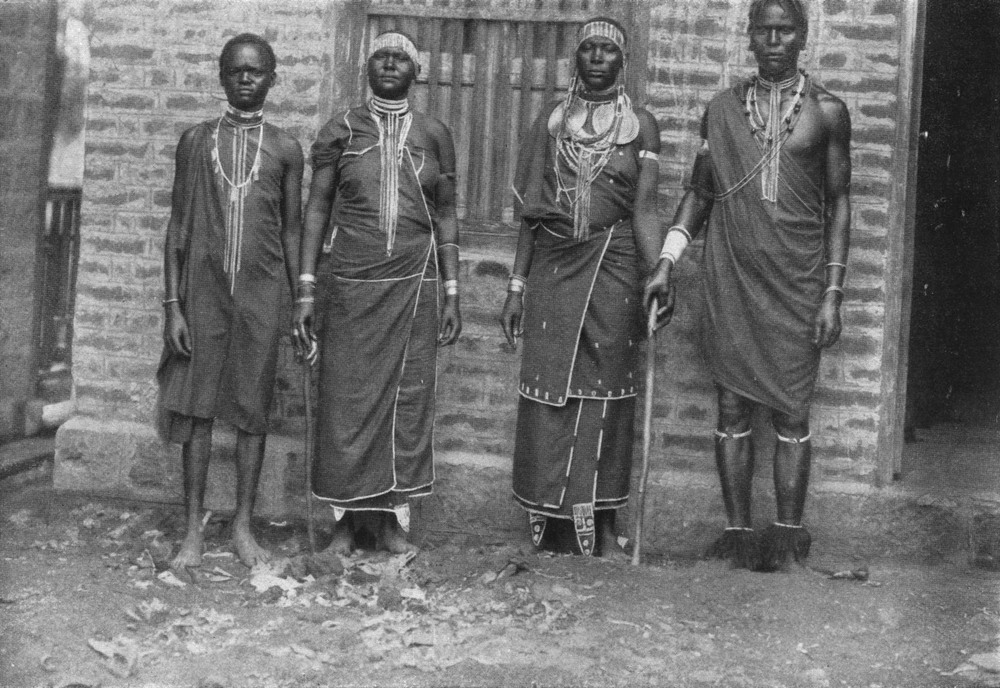
Inzwischen ist weitere Hilfe herbeigeeilt und wir versuchen allmählich unseren Gefangenen nach dem Standlager zu führen.[S. 89] Hierbei stößt man mitunter auf große Schwierigkeiten, denn die Tiere sind häufig so störrisch, daß es unmöglich ist, sie von Ort und Stelle zu bringen. In derartigen Fällen wird das Tier gefesselt, auf einen Wagen geladen und zum Lager gefahren. Dabei kommt es aber allerdings auch vor, daß man sich mit einem gefangenen widerspenstigen Tier meilenweit vom Standlager entfernt befindet und von der Nacht überrascht wird. Der nachfolgende Wagen hat unsere Fährten verloren und kann uns infolge der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr auffinden. Dann heißt es eben, das Tier die ganze Nacht über abwechselnd festzuhalten, während der eine oder andere für einige Stunden, den Sattel als Kopfkissen benutzend, sich auf den Steppenboden hinstreckt. Das sind Nächte, welche man erlebt haben muß und die zu den Freuden und Leiden des Tierfängers gehören. Manchmal aber gelang es uns, die gefangenen Giraffen ohne große Schwierigkeiten ins Lager zu führen. Der Charakter der Tiere ist eben gerade so verschieden wie beim Menschen. Das gleiche konnte ich auch im Lager beobachten, einige nahmen sofort die ihnen dargebotene Milch willig an, während andere tagelang jede Nahrung eigensinnig verweigerten. Welche Tricks man öfters anwenden muß, um die Tiere zur Aufnahme von Speise und Trank zu bewegen, ist schwer zu beschreiben.
[S. 91]
Ein mir bekannter Herr war im Besitz einer jungen Giraffe. Dieser, unkundig wie er das etwa 2½ Meter hohe Tier zum Saugen bringen konnte — Gummilutscher hatte er nicht zur Hand —, war ratlos. Da kam er auf die Idee, die Giraffe an Ziegen saugen zu lassen. Zu diesem Zwecke errichtete er in einem Akazienbaume eine Stellage, in welche er die Ziege hinaufbefördern ließ, damit das langhalsige Geschöpf bequem an das Euter kommen konnte. Er brachte das Tier auch wirklich zum Saugen, trotzdem ging dasselbe aber bald ein. Die von mir gefangenen Giraffen habe ich nie an einem Gummilutscher saugen lassen. Es ist vorgekommen, daß eine junge Elenantilope das Sauginstrument verschluckt hatte und später in Hamburg daran einging, wie die nachträgliche Sektion erwies. Alle meine Tiere lehrte ich aus Schüsseln trinken. Dies ist eine recht mühselige Arbeit, und wahre Geduldsproben hatte ich dabei zu bestehen. Vorsichtig mit hochgehobenen Milchschüsseln nähert man sich dem Kopf der Giraffe. Endlich riecht sie die Milch und steckt natürlich das Maul so tief hinein, daß die Flüssigkeit in die Nasenlöcher dringt und das Tier sprudelnd und prustend den Inhalt über den Kopf und das Gesicht des Schüsselträgers ergießt. Das junge Tier kann noch nicht selbständig trinken und vollführt mit dem Kopf, ähnlich den Rinderkälbern, die saugenden und stoßenden Bewegungen. Man darf keine Mühe scheuen und es sich nicht verdrießen lassen, die Versuche immer wieder zu erneuern, will man seinen Pflegling am Leben erhalten. Alle Stunden muß wieder von vorne angefangen werden. Nach und nach werden die Versuche endlich von Erfolg gekrönt sein. Natürlich wird der zu entwöhnende Säugling dabei immer noch seinem Pfleger einige Sprudel Milch über den Kopf und das Gesicht schleudern. Aus Dankbarkeit wird einem auch manchmal die Giraffe mit ihrer langen, schleimigen Zunge über das Gesicht fahren. Auch ist es mir vorgekommen, daß, während ich die Schüssel hochhielt und ein Tier tränkte, die schon getränkten Stücke zudringlich herankamen und eines mich sogar mit seinen großen feuchten Lippen am Ohr packte und dort zu saugen versuchte. Sind die Giraffen einmal an die Milchschüssel gewöhnt, so wissen sie gar bald, wann ihre Futterzeit da ist. Hören sie nur die Schüsseln klappern, so stehen sie auch schon bereit und jede drängt sich vor, um die erste zu sein. Reinlichkeit, Mäßigkeit und Pünktlichkeit bilden die drei Hauptfaktoren bei der Aufzucht dieser sehr empfindlichen Geschöpfe. Eine Überfütterung ist leicht geschehen und das Tier kann davon schwer erkranken. Nicht bekömmliches Futter kann seinen Tod herbeiführen.
Alle diese Bedingungen können nur von gewissenhaften Leuten durchgeführt werden, und vor allen Dingen ist eine große Tierliebe erforderlich. Nur durch Güte und mit Ruhe gewöhnt man diese Sprößlinge der Wildnis an sich. Wenn man dabei einmal einen Schlag oder einen Tritt abbekommt, so darf man keinesfalls etwa mit der Nilpferdpeitsche dem Tiere gegenübertreten und es strafen oder es roh behandeln. Leute, die so handeln, sind nicht zum Tierfang und zur Zähmung zu gebrauchen. Große Beihilfe in der Pflege der Tiere fand ich in meiner Frau, die während meiner Abwesenheit die Pfleglinge treu versorgte und keine Mühe und Arbeit scheute. Ihr habe ich es zum großen Teil zu verdanken, daß ich so große Erfolge bei der Aufzucht der Tiere hatte und es mir deshalb vergönnt war, die ersten deutsch-ostafrikanischen Giraffen, Oryx- und Elenantilopen, Erdferkel und viele andere Vertreter der dortigen Fauna mehr, lebend und gesund nach Deutschland zu bringen.
Der Giraffenfang, wie ich ihn eben geschildert habe, verläuft natürlich nicht immer so glatt und programmäßig. An Reiter und Pferd werden große Anforderungen gestellt. Die Schnelligkeit der Pferde genügt noch nicht allein. Dieselben müssen auch mit dem Wilde vertraut sein und den Geruch der Giraffen vertragen können. Manche Pferde sind absolut nicht an Giraffen heranzubringen. Gewandtheit und Geistesgegenwart dürfen den Reiter bei einem derartigen tollkühnen Ritt keinen Augenblick verlassen, denn der Boden bietet dort viele Hindernisse. Umgestürzte Bäume, Büsche mit Schlinggewächsen, Dornen, Erdferkellöcher, Baue der Steppenschliefer (Heterohyrax mossambicus Ptrs.) und dergleichen mehr können das Pferd leicht zum Sturz bringen. Auf meinen Jagden bin ich selbst im vollen Galopp viermal mit dem Pferde koppheister gegangen, ohne glücklicherweise ernstlichen Schaden zu nehmen. Hinter einer Giraffe im hohen Grase herjagend, stürzte einmal einer meiner Begleiter kaum fünf Meter[S. 92] vor mir. Sein Pferd war mit den Vorderbeinen in ein Erdferkelloch geraten, überschlug sich, und Pferd und Reiter kollerten am Boden. Ehe ich mein Pferd abwenden konnte, sprang es in gewaltigem Satze über beide hinweg. Der Gestürzte blieb wie tot am Boden liegen. Nach einigen Minuten brachte ich ihn wieder zur Besinnung. Zum Glück konnte ich feststellen, daß er ohne schwere Verletzungen davongekommen war. Anstatt eine Giraffe hieß es nun sein scheugewordenes Pferd einfangen. Nach vierzehntägiger Pflege war mein Begleiter wieder so weit hergestellt, daß der Fang von neuem beginnen konnte. Ein anderes Mal war ich selbst der Leidtragende. Ich jagte mit dem Pferde hinter einem jungen Gnu. Den Lasso schon zum Wurf bereithaltend, flüchtete plötzlich das Tier über eine Steppenschlieferkolonie. Mein Pferd setzte über mehrere Löcher hinweg, brach aber mit beiden Vorderbeinen auf einmal in den Boden ein, so daß es regelrecht auf den Kopf zu stehen kam und sich überschlug. Hierbei wurde ich im Bogen aus dem Sattel geschleudert. Glücklicherweise schlug das Pferd nach der anderen Seite um. Der Sturz lief noch soweit gut ab; außer schweren Knieabschürfungen kam ich mit dem Bruche des rechten Mittelhandknochens davon. Wieder ein anderes Mal passierte es, daß Roß und Reiter in eine alte, von Eingeborenen angelegte Nashorngrube gerieten und beide so festgeklemmt saßen, daß sie buchstäblich ausgegraben werden mußten. Nicht allein Bodenhindernisse bereiten Schwierigkeiten, sondern auch Bäume mit herabhängenden Ästen können den Reiter leicht vom Pferde streifen; auch die mit Hackedorn und Sansivieren bestandenen Gelände erschweren den Fang ganz außerordentlich.
Ist man in ein Giraffenrudel hineingeritten, so heißt es sich sehr vorsehen, um von den gigantischen Tieren nicht überrannt zu werden. Zu Pferde sitzend kommt man sich neben einer ausgewachsenen Giraffe wie ein Zwerg vor. Bei einem Ritt in ein Rudel passierte es mir einmal, daß ich an die Seite eines alten[S. 93] 18 Fuß hohen Bullen kam, der neben mir dahinstürmte. Ich versuchte an dem Riesen vorbeizukommen, da bog der Bulle plötzlich seitwärts aus und streifte mich mit seinem langen Hals beinahe vom Pferde; nur durch ein schnelles Ducken und indem ich mich an Sattel und Mähne festhielt, blieb ich oben. Dazu erhielt mein Pferd von dem Vorderlauf der großen Giraffe einen Schlag auf die Hinterhand, daß es beinahe zusammenbrach.
Ich kann mich zu den wenigen Europäern rechnen, die es unternommen haben, Giraffen zu Pferde einzufangen. Wohl nur wenige Tierfänger werden auch in der Zukunft solche Fangzüge ausführen können, denn in den meisten anderen Gegenden, wo Giraffen zahlreich vorkommen, herrscht die Tsetse-Plage, die eine Jagd mit Pferden unmöglich macht.
Aus diesen kurzen Schilderungen wird der Leser ersehen, daß beim Fang lebender Tiere ganz andere Faktoren in Frage kommen als bei der Jagd mit der Büchse, für welche ich, soweit Giraffen dabei in Frage kommen, überhaupt nicht viel übrig habe. Ich halte es für keine große Tat, eine Giraffe aus purer Mordlust zu erlegen, und ich habe es auch nie übers Herz gebracht, meine Büchse auf dieses vornehme und harmlose Wild zu richten, obwohl ich jahrelang den großen Jagdschein besaß und somit das Recht hatte, jährlich zwei dieser Tiere abzuschießen. Für mich gibt es keinen größeren Genuß, als das Wild in der Freiheit zu beobachten, junge Tiere lebend und unversehrt in meinen Besitz zu bekommen, sie zu pflegen und aufzuziehen, damit sie in den zoologischen Gärten der Wissenschaft und der Förderung der Volksbildung solange als möglich erhalten bleiben können. Leider sind die Giraffen in den meisten zoologischen Gärten in so enge Gehege eingepfercht, daß der Beschauer ihre eigenartigen, natürlichen Bewegungen wohl kaum zu Gesicht bekommt. Die Folge davon ist, daß die Tiere mangels Bewegungsfreiheit verkommen. Wer in Ostafrika auf unserer Tierzuchtfarm die Giraffen[S. 94] in den großen ausgedehnten Gehegen bei ihren Spielen und Sprüngen bewundern konnte, dem werden diese Bilder unvergeßlich in der Erinnerung bleiben. Wohl manchem Direktor eines zoologischen Gartens würden vor Schreck, die wertvollen Tiere könnten bei ihrem tollen Spiel Hals und Beine brechen, die Haare zu Berge gestanden sein.
Einen unvergeßlichen Anblick gewährt es, ein Giraffenrudel durch die freie Steppe mit donnerndem Gepolter über den von der Sonne hartgebrannten Boden flüchten zu sehen. In mehreren meterweiten Sätzen, dabei den langen Hals wellenförmig auf und nieder senkend, sausen die Riesen dahin. Durchqueren sie ein niedriges Buschgelände, so wird man unwillkürlich an Boote erinnert, die auf wellenbewegter See auf und nieder schaukeln.
Viele Abbildungen, die mir zu Gesicht gekommen sind, zeigen die flüchtende Giraffe mit ausgestrecktem Wedel. Dies ist grundfalsch. Ich habe stets beobachtet und genau festgestellt, daß die sich zur Flucht wendende Giraffe zuerst ihren, unten mit einer langen schwarzen Haarquaste versehenen Wedel fest seitwärts auf ihre Hinterkeule legt und denselben während ihrer Flucht dort festhält. Nie habe ich bemerkt, daß eine Giraffe auf der Flucht mit dem Schwanze peitschend um sich schlägt, wie zum Beispiel die Gnus es tun. Oft bin ich beim Fange minutenlang neben flüchtenden Giraffen geritten, und immer hatten die Tiere, und selbst ihre Jungen, den Wedel fest auf den Oberschenkel gepreßt.
In vorliegendem Abschnitt sind einigemal Erdferkellöcher erwähnt worden. Diese für den Reiter so gefährlichen Löcher werden von einem Tiere bewohnt, dem sogenannten Erdferkel (Orycteropus wertheri Mtsch.) — siehe Bild —, das trotz seines Namens absolut nichts mit einem Ferkel zu tun hat, sondern zur Ordnung der zahnarmen Tiere (Edentaten) gehört. Das mausgrau gefärbte Erdferkel ist dünn behaart, besitzt große löffelartige Ohren, einen starken langen Schwanz und erreicht ein Gewicht bis zu 200 Pfund.[S. 95] In der rüsselartigen langen Schnauze befindet sich eine wurmartige, weit hervorstreckbare Zunge. Das Erdferkel ist ausschließlich ein Nachttier und Höhlenbewohner. Die außerordentlich stark bekrallten Vorderfüße ermöglichen es dem Tiere, sich schnell in die Erde zu vergraben und auch in die fast steinharten Termitenhaufen einzudringen, deren Bewohner seine Hauptnahrung bilden. Mit der langen schleimigen Zunge leckt es in den zertrümmerten Bauen der Termiten herum, wobei die Insekten an der Zunge kleben bleiben. Eigentümlich an dem Tiere ist auch sein charakteristischer Mäusegeruch. Es vermag sich nur mit den krallenbewachsenen Vorderbeinen zu verteidigen, ist aber sonst ein sehr harmloses Tier. Zu beißen vermag es überhaupt nicht, da es keine Zähne, sondern nur einen Schmelz besitzt. Die Schnauze kann es nur ganz wenig öffnen. Tagsüber ruht das Tier tief in seinem Bau versteckt und kommt erst nach Einbruch der Dunkelheit zum Vorschein. Es ist aus seinem Bau sehr schwer herauszugraben, da es sich, will man seiner habhaft werden, immer tiefer einbuddelt. Jedoch gelang es mir, einen Vertreter dieser Spezies in meinen Besitz zu bekommen und es lebend und wohlbehalten nach Europa zu bringen. Die Pflege und Wartung ist nicht so schwierig, da das Tier Milch, rohe Eier und feingeschabtes Fleisch gern aufnimmt. Zur Wohnung muß es einen Kasten mit zwei Abteilungen bekommen, von denen eine, seiner nächtlichen Lebensweise entsprechend, vollkommen dunkel gehalten sein muß. In der Mittelwand befindet sich in halber Höhe ein großes Loch, das dem Bewohner ermöglicht, in die Futterabteilung zu gelangen. Pünktlichkeit und Sauberkeit müssen am Platze sein; das Futter wird abends und morgens dem Tiere vorgesetzt und darf auf keinen Fall so lange stehen, daß es säuert. Daß das Erdferkel so selten in unsere zoologischen Gärten gelangt, liegt wohl zum größten Teil an der Unkenntnis in der Futterpflege.
Genau dieselbe Pflege und Behandlung erfordern die zu derselben[S. 96] Ordnung gehörenden Schuppentiere (Manis temmincki Smuts). Auch diese habe ich mit der gleichen Futtermethode gesund und wohlbehalten nach Europa gebracht.
Schon nach wenigen Tagen waren wir im Besitze zweier junger, kräftiger Giraffen, die bereits eine Höhe von drei Metern aufwiesen. Wir verlegten jetzt unser Standlager etwa 30 Kilometer näher der Bruchstufe zu. Nachdem wir unsere Beobachtungsposten auf erhöhten Hügeln eingenommen hatten, begann für uns die Arbeit von neuem. In dieser Gegend stellte ich das besonders häufige Auftreten der Giraffengazelle (Lithocranius walleri Brooke) fest. Durch das Glas sah ich oft Rudel von 5–8 Stück an einem Busche äsen. Hierbei stellen sich die Tiere in possierlicher Weise auf die Hinterläufe, um mit dem langen ausgestreckten Hals die hochsitzenden Blätter zu erreichen. Die Giraffengazelle ist eine mittelgroße, sehr schlank gebaute Antilope. Nur die Männchen tragen Hörner, welche stark geringelt und leierförmig gewunden sind. Die Tiere kommen vorzüglich in der dornbewachsenen Steppe vor. Sie sind äußerst flink und gewandt und deshalb nicht mit dem Pferde einzufangen. Später, im Jahre 1914, gelangte ich im Somalilande doch in den Besitz einiger Giraffengazellen. Leider verhinderte mich der Ausbruch des Krieges, dieselben nach Europa zu bringen. Der Stellinger Tierpark kann sich rühmen, die so seltenen Gazellen schon im Besitz gehabt zu haben.


Nachdem wir das Standlager noch einige Male verlegt hatten, stellten wir den weiteren Fang von Tieren ein. Wir waren bereits im Besitze von acht Giraffen, und ich konnte mit dem Resultat wohl zufrieden sein. Natürlich konnte das anstrengende Jagen nicht täglich ausgeführt werden, die Pferde mußten ab und zu ihre Ruhetage haben und auch die Witterungsverhältnisse machten uns mitunter einen Strich durch die Rechnung. Namentlich möchte ich der hier so häufig mit großer Stärke auftretenden heftigen Gewitterstürme Erwähnung tun. Besonders eine Nacht wird mir[S. 97] nicht aus der Erinnerung kommen. Wir hatten eine frisch gefangene Giraffe in unser provisorisch hergerichtetes Lager eingebracht, als bei Einbruch der Dunkelheit ein furchtbares Gewitter losbrach. Es folgte Schlag auf Schlag, die ganze Gegend schien von den zuckenden Blitzen wie in ein Flammenmeer gehüllt. Um das junge Tier zu schützen, holte ich es schnell entschlossen aus dem noch ungedeckten Kral, fesselte es und legte es unter das Sonnensegel vor dem Zelt. Ich mußte mit einigen Schwarzen die ganze Nacht hindurch den Kopf der Giraffe festhalten, damit das geängstigte und zitternde Tier, welches sich natürlich zu befreien versuchte und mit dem langen Hals hin und her schlug, sich nicht verletzte. Das furchtbare Gewitter in Begleitung von wolkenbruchartigen, kalten Regengüssen hielt an und wollte nicht weichen. Mit Sehnsucht erwartete ich den Anbruch des Morgens, denn meine beiden weißen Begleiter lagen im Innern des Zeltes krank darnieder. Der eine hatte einen schweren Fieberanfall, während der andere an einer Vergiftung litt, die er sich dadurch zugezogen hatte, daß er unwissenderweise Zitronensäure in seine verzinnte Wasserflasche gegossen und davon getrunken hatte. Endlich ließ das Unwetter nach und der langersehnte Morgen brach an. Der in der Nähe des Lagers befindliche Wassertümpel hatte sich in der Nacht in einen kleinen See verwandelt und überall tummelten sich Sporengänse und Wildenten auf seiner Oberfläche.
Ein andermal wurden wir in der Nähe des Merus von einem heftigen Gewittersturm mit starken Hagelböen überrascht. Wir befanden uns in freiem Gelände. Nirgends auf der weiten Fläche war Schutz zu finden und nur mit großer Mühe vermochten wir die ängstlichen Pferde zu halten. In wenigen Minuten war, so weit das Auge reichen konnte, alles weiß mit Hagel bedeckt. Nach einer Stunde aber war die Winterlandschaft verschwunden und die Sonne schien wieder warm auf uns durchfrorene Reiter herab.
[S. 98]
Die Ruhetage der Pferde verbrachten wir mit der Jagd. Gewöhnlich pirschten wir auf einige Stunden in der Umgebung des Lagers umher. Bei einem solchen Pirschgang sahen wir uns plötzlich einem kapitalen Nashornbullen gegenüber. Derselbe machte Miene, uns anzunehmen, und es gab kein Ausweichen mehr. Ein wohlgezielter Kopfschuß ließ ihn auf der Stelle verenden. Die herbeigeeilten Schwarzen zerwirkten die unerwartete Beute und das Wildbret wurde ins Lager gebracht. Ich begnügte mich mit den Hörnern als Jagdtrophäe, aber auch eine Suppe aus Nashornfleisch verschmähte ich nicht. Ein solches Gericht aus würfelförmig geschnittenen Fleischstückchen wird ohne Wasserzugabe mit Zwiebel, Pfeffer und Salz gedämpft. Genossen wird nur die Brühe, die ich vorzüglich fand. Die ausgedämpften Fleischstücke sind zu zähe. Dagegen schmeckt das Fleisch der am Feuer gerösteten Rippen ausgezeichnet.
Nun erwartete mich eine weitere mühselige Arbeit. Die Tiere mußten aus den zerstreut liegenden Kralen geholt werden, um sie alle auf der Farm, dem Ausgangspunkt der Expedition, vorläufig unterzubringen. Zu diesem Zwecke begab ich mich mit einigen Schwarzen zu dem am weitesten abgelegenen Kral bei Engaruka an der Bruchstufe, um die beiden dort befindlichen Giraffen abzuholen. Die Tiere befanden sich daselbst unter der Aufsicht einiger Masais. In Engaruka angekommen, konnte ich wieder einmal deutlich sehen, was es heißt, gefangenes Wild unter der Obhut von Schwarzen zurückgelassen. Obwohl sechs Kühe genügend Milch lieferten, so sahen die Tiere recht mager und heruntergekommen aus, desto wohlgemästeter aber waren ihre schwarzen Wärter. Anstatt die Milch den Giraffen zu geben, hatten sie es für besser befunden, sie selbst zu trinken. Die Masais sind zwar tüchtige Viehzüchter und große Haustierfreunde, für Wild aber haben sie gar kein Interesse. Ich machte mich daran, den Giraffen Halfter anzulegen, was begreiflicherweise die scheuen und ängstlichen Tiere[S. 99] sehr erregte. Sie schlugen dabei mit ihren Vorder- und Hinterläufen derart um sich, daß es gar manchen Schlag und Tritt absetzte.
Es ist keineswegs leicht, gehalfterte Giraffen zu führen, da sie bald hartnäckig stehen bleiben, bald langsam trotten und manchmal zum rasenden Galopp ansetzen oder gar kehrtmachen und zurücklaufen. Man hat dabei seine Mühe und Not, in der wegelosen Steppe die Richtung einzuhalten. Für die kurze Strecke von 10 Kilometer brauchten wir einen ganzen Tag. Die folgende Nacht mußten wir wohl oder übel unter freiem Himmel verbringen und die Tiere an den Leitseilen festhalten.
Bei Anbruch des Morgens ereignete sich noch ein heiterer Zwischenfall. Ein Teil meiner Leute hatte sich todmüde um das Lagerfeuer am Boden zur Ruhe hingestreckt. Ich hielt mit den übrigen Schwarzen die Giraffen, welche in kurzer Entfernung vom Lager ästen, an den Leitseilen fest. Plötzlich ertönte aus dem Lager der Ruf: „Simba! Simba!“ (Löwe! Löwe!). Noch nie habe ich schlafende Neger so schnell hochkommen sehen wie an diesem Morgen. Ich sah im Dämmerlicht in der Richtung, wo die Schwarzen hindeuteten, weiter nichts als meinen Hund, der um uns herumstreifte und jetzt wieder in gerader Richtung auf das Lager zulief. Der Hund sah allerdings in den aufsteigenden Bodendünsten bedeutend größer aus, wie er in Wirklichkeit war, und konnte deshalb von einem schlaftrunkenen Neger leicht für einen Löwen gehalten werden. Unter allgemeiner Heiterkeit fing der vermeintliche Löwe an zu bellen und die Sache war aufgeklärt.
Die Morgenkühle ausnützend, zogen wir weiter und erreichten das Lager am Nachmittage. Den beiden Giraffen ließ ich ganz besondere Pflege angedeihen, und zu meiner Freude erholten sie sich bald.
Nachdem wir nach und nach alle gefangenen Tiere zusammengeholt hatten, konnte der Abmarsch zur etwa 60 Kilometer entfernt[S. 100] liegenden Farm beginnen. Auf dem Marsche konnte ich zwei der sonst selten zu Gesicht kommenden Honigdachse (Mellivora sagulata Hollister) beobachten. Ich war vom Pferde gestiegen und suchte einen Lagerplatz für die nachkommende Karawane. Da hörte ich in allernächster Nähe ein eigentümliches Geknurre und sah, wie sich zwei afrikanische Vettern unseres heimischen Grimmbartes balgten. Anscheinend befanden sie sich in der Ranzzeit. Es war höchst interessant, diese auf den Rücken hellgrauen, an den Seiten mit weißen Längsstreifen versehenen Tiere bei ihrem Spiele zu beobachten. Indessen kam mein Begleiter heran und ich machte ihn auf die beiden Dachse aufmerksam. Kaum hatte er die Tiere erblickt, da rief er mir laut zu: „Passen Sie auf, die beißen!“ und sprang auf sein Pferd. Durch dieses laute Rufen wurden die Dachse auf mich aufmerksam und tatsächlich kam der eine auf mich zu. Ich merkte nun, daß die Sache ernst wurde und gab einen Schuß mit Vollmantel auf ihn ab. Die Kugel durchschlug die eine Vorderpranke und die Brust, trotzdem kam er noch einmal auf mich zu, so daß ich ihm noch einen Schuß geben mußte. Inzwischen war der andere herangekommen und machte gleichfalls Miene, mich anzunehmen; auch dieser erhielt einen Schuß, der gleichfalls glatt durchging, jedoch keine tödliche Wirkung hatte. Zum Glück waren inzwischen zwei meiner Hunde herangelaufen, die sich so lange mit den zählebigen Gesellen herumbalgten, bis meine Schwarzen kamen und sie mit Knüppeln totschlugen. Die Buren behaupten, daß jeder Dachs den Jäger ohne weiteres annehme und ihn an der Ferse zu fassen suche, um die Sehnen durchzubeißen. Daher hatte auch mein Begleiter sein Heil in der Flucht aufs Pferd gesucht.
Nach achttägigem Marsch durch die Steppe trafen wir endlich mit all den Tieren wohlbehalten auf der Farm wieder ein. Während der fast zweimonatigen Abwesenheit hatten wir 8 Giraffen, einige junge Zebras, Oryx- und Elenantilopen und verschiedene[S. 101] andere Tiere gefangen. Ich konnte mit dem Ergebnis des Fangzuges wohl zufrieden sein. Wie der Leser aus diesem Resultat ersieht, sind die Giraffen lange nicht so selten, wie häufig in den Büchern geschrieben und auch sonst wohl behauptet wird, zumal ich doch nur ein verhältnismäßig kleines Gelände durchstreifte. Viele Giraffenrudel kamen mir zu Gesicht, die ohne Begleitung von Jungen waren, denn die Giraffen sind Tiere, die nicht an eine bestimmte Paarungszeit gebunden sind und infolgedessen auch keine bestimmte Setzzeit haben.
Die gefangenen Tiere sollten sich von dem überstandenen Marsche erholen, daher ließ ich sie frei in ihren geräumigen Gehegen herumlaufen. Viele meiner Leute, die mich auf dem Fangzug begleitet hatten, wollten in ihre Dörfer zurückkehren und ich mußte sie entlassen. Die neu angeworbenen Wärter waren leider noch nicht mit dem Wilde vertraut und zeigten sogar Furcht vor den Giraffen. Es bedurfte geraumer Zeit, bis diese Neulinge angelernt waren und mit ihren Pflegebefohlenen umgehen konnten.
Als die Tiere sich genügend erholt hatten, gedachte ich den Transport zunächst nach der etwa 150 Kilometer entfernten Station Kahe an der Usambarabahn zu bewerkstelligen, aber heftige Regengüsse verzögerten meine Absicht mehrmals. Die Anzeichen der Regenzeit hatten sich in diesem Jahre etwas verfrüht eingestellt. Trotzdem hoffte ich, den Tiertransport noch bis zur Küste zu bringen. Nun sollte ich aber auch einmal erfahren, daß das Glück wandelbar ist, und wenn mir bisher vieles geglückt war, so mißlang mir diesmal alles. Ich hatte Pech, schwarzes Pech! Welchen Aufwand von Energie, Muskel- und Nervenkraft, welchen Kapitalwert und welches Risiko ein solcher Transport bedingt, wurde mir hier wieder einmal richtig klar.
Als nach den ersten Regentagen trockenes Wetter eintrat, hielt ich den Zeitpunkt für den Aufbruch gekommen, da oft im Anfang der Regenzeit die Niederschläge aussetzen und mehrere Tage lang[S. 102] schönes Wetter ist. Alles war bereit und wir konnten rasch abziehen. Die Giraffen, die auf der Farm durch die gute Pflege und durch die verhältnismäßig große Bewegungsfreiheit wieder verwöhnt geworden waren, stellten sich so bockbeinig wie möglich an und wollten nichts von gezwungener Führung wissen. Wir vermochten sie kaum aus den Kralen herauszubringen. Als aber die erste Giraffe glücklich bis zum Tor gebracht war und das offene Gelände vor sich sah, da stürmte sie unaufhaltsam darauf los und die anderen folgten nach. Ich selbst führte mit mehreren Negern und einem Ansiedler das stärkste Tier voraus; jede Giraffe wurde links und rechts an Stricken geführt, deren stärkste an einer Koppel am Halsansatz befestigt waren. Wollte man eine ungezähmte Giraffe nur vermittels eines Kopfhalfters führen, so würde gar leicht durch einen ungeschickten Ruck der Hals verrenkt werden. Trotz seiner Länge hat nämlich der Hals der Giraffe nur sieben Wirbel, wie dies bei allen Säugetieren, mit Ausnahme der Faultiere, der Fall ist. Man kann sich daher denken, wie lang ein solcher Halswirbel sein muß und wie leicht durch einen verkehrten Ruck ein Ausspringen eines Gelenkes oder eine Verzerrung der Halssehnen verursacht werden kann. Als nun, wie gesagt, als erstes das von mir geführte stärkste Tier zum Laufe ansetzte, fielen die Neger durch den Ruck zu Boden, ließen natürlich ihre Seile los und mein Begleiter und ich wurden unwiderstehlich mit fortgerissen, aber wir hielten fest. Während des rasenden Laufes strauchelte mein Gefährte an einem Wassergraben, fiel und ließ nun ebenfalls los. So wurde ich allein weitergeschleift, bis das Tier endlich erschöpft stehen blieb und mein Begleiter mir wieder zur Seite war. Als ich rückwärts blickte, sah ich, daß sich die anderen sieben Giraffen nach allen Richtungen hin in der Steppe zerstreut hatten. Da sie aber kleiner und schwächer waren als die meinige, so hatten die Schwarzen sie festhalten können. Wir bugsierten die widerspenstigen Tiere langsam wieder auf den Weg.[S. 103] Hier trotteten sie bald vorwärts, bald liefen sie zurück oder brachen rechts und links in den Bruch aus, so daß wir von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr kaum acht Kilometer von den 150 zurückzulegenden absolviert hatten. Ich tröstete mich damit, daß der erste Tag einer Safari bekanntlich immer der schlimmste ist, da Tier und Mensch sich an den Marsch gewöhnen müssen, und so machte ich in Aruscha halt. Für die Ernährung der jungen Giraffen waren zehn Milchkühe mitgenommen worden, die der Karawane vorausgeschickt waren und unterwegs überall weideten. Wie in vielen Gegenden lassen sich die afrikanischen Milchkühe nicht melken, ohne daß ihre Kälber daneben stehen. Auch muß die Milch erst von dem Kalbe ausgesaugt werden, bevor man melken kann. Während wir uns damit abplagten, hatten die Neger nicht richtig aufgepaßt und die Kälber hatten ihren Müttern alle Milch ausgesogen. Als wir nun in Aruscha lagerten, waren die Euter leer und ich hatte keine Nahrung für meine armen Tiere. Was tun? Reine Milch zu bekommen war unmöglich, denn die in der Umgegend wohnenden Schwarzen halten die Milchgefäße nicht rein, so daß die Milch sofort säuert und deshalb den empfindlichen Giraffen nicht gereicht werden durfte. Schließlich gelang es mir, von ansässigen Europäern einige wenige Liter zu erhalten, aber bei weitem nicht genug für meine Giraffen. Da hieß es eben Milch pantschen! Ich nahm Maismehl und kochte mit Wasser und Milch eine richtige Suppe, die auch begierig von den müden und hungrigen Tieren genommen wurde. In einem Gehege beim Bezirksamt konnte ich die Tiere einstellen und endlich an mich selbst denken, nachdem ich den ganzen Tag, ohne einen Bissen zu mir zu nehmen, in beständiger Sorge und Aufregung verbracht hatte. Gerade war ich eingeschlafen, als der Regen in Strömen losbrach und meine letzte Hoffnung zunichte machte. Den folgenden Tag regnete es unaufhörlich, und auf telegraphische Anfrage in Moschi kam die Meldung, daß überall der Regen eingesetzt habe und die Flußfurten[S. 104] unpassierbar seien. So blieb mir nichts übrig, als schleunigst meine Tiere zur Farm zurückzubringen, wenn ich noch etwas von ihnen retten wollte, denn vier der wertvollen Giraffen waren durch die Witterungsunbilden und die Kälte bereits eingegangen. Am Nachmittage, als das Wetter sich etwas aufklärte, traten wir mißmutig den Rückweg nach der Farm an. Am Abend aber hatten wir nur wenige Kilometer zurückgelegt, da wir durch einen meiner großen Ochsenkarren, der eine ganze Menagerie trug (Nashorn, Warzenschweine, Affen, Vögel usw.), aufgehalten wurden. Auf dem grundlosen Weg war das schwere Fuhrwerk an einer Stelle bis zu den Achsen eingesunken, und die vorhandenen Kräfte genügten nicht, ihn wieder flott zu machen. Der Polizeiwachtmeister von Aruscha erbarmte sich meiner und kam mit 50 Soldaten und Sträflingen zur Hilfeleistung heran. Wir mußten den Wagen ausgraben und durch unterlegte Knüppel wieder flott machen. So konnten wir die Farm nicht mehr erreichen und mußten die Nacht wachend im Freien verbringen und die Tiere an Stricken festhalten. Um mein Unglück voll zu machen, setzte zur Zeit des Mondaufganges abermals heftiger Regen ein. Die Giraffen hatten sich niedergetan und wurden mit allen verfügbaren Decken vor dem Regen geschützt, während wir versuchten, ein Lagerfeuer zu unterhalten und uns bis zum Morgengrauen etwas zu wärmen. Erst um 10 Uhr morgens konnten wir die Tiere auf der Farm wieder unterbringen. Schweren Herzens telegraphierte ich das Mißgeschick nach Hamburg und erhielt Order, den Abtransport aufzugeben und günstigere Zeit abzuwarten.
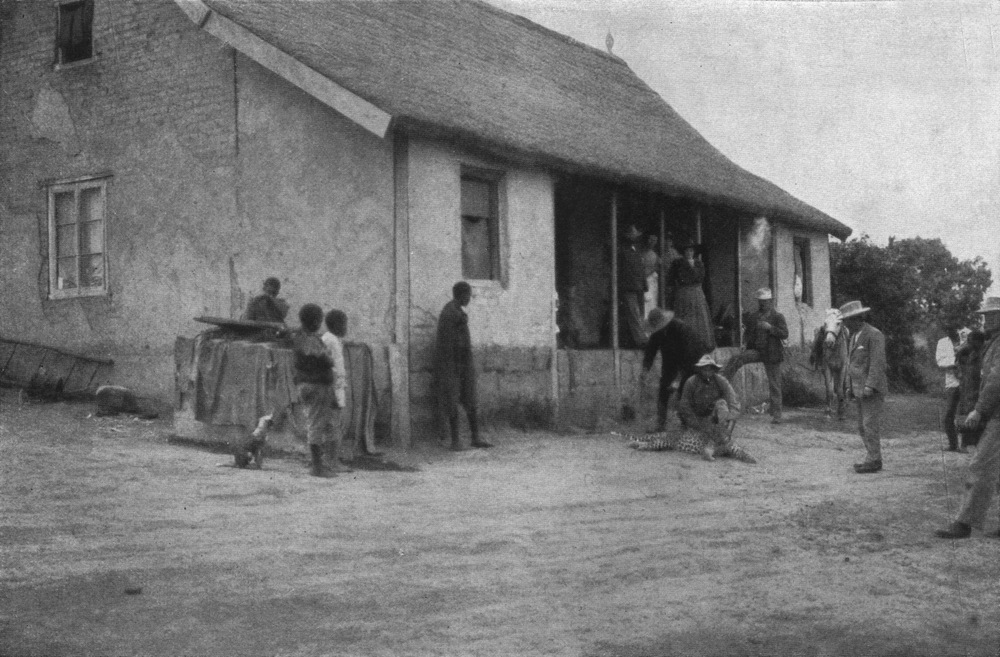

Die Regenzeit hatte nun mit aller Heftigkeit eingesetzt, und vor zwei Monaten war keine Aussicht auf besseres Wetter vorhanden. Obwohl die fruchtbringende Regenperiode von den Ansiedlern mit Freuden begrüßt wird, so hat sie doch auch ihre Nachteile. Die tage- und wochenlang anhaltenden starken Regengüsse weichen den Steppenboden derart auf, daß ein Verkehr mit Wagen in den[S. 105] wegelosen Gegenden unmöglich gemacht wird. Die kleinen Gebirgsbäche verwandeln sich in kurzer Zeit in unpassierbare Ströme. Die reißenden Wasserfluten führen häufig Buschwerk, entwurzelte Urwaldriesen usw. mit sich, die das Wasserbett in den Schluchten und Tälern leicht verstopfen. Ungemein schnell stauen sich dann die Wassermassen, und wehe dem Ansiedler oder Reisenden, der mit seinem Fuhrwerk zwischen zwei solche Flüsse gerät. Wochenlang kann er dadurch von der Außenwelt abgesperrt werden, und Tier und Mensch haben unter den kalten Regengüssen schwer zu leiden. Dazu treten um diese Zeit häufig Viehseuchen, wie Küstenfieber, Pferdesterbe usw. auf, die ganze Viehbestände oft in wenigen Tagen dahinraffen. Besonders die Pferdesterbe wird sehr gefürchtet, da man bis heute noch dieser Seuche machtlos gegenübersteht. Mir raffte diese Krankheit in einem Jahre vier meiner wertvollsten Reitpferde dahin.
So waren durch die Ungunst der Verhältnisse viele Mühe und große Geldopfer umsonst aufgewendet worden. Der Tierbestand war arg zusammengeschmolzen, da außer den erwähnten vier Giraffen auch noch andere Tiere eingegangen waren. Dem Rest ließ ich die beste Pflege angedeihen, aber es vergingen noch einige Monate, ehe ich daran gehen konnte, den Abtransport zur Küste in Angriff zu nehmen.
[S. 106]

Zwischen den Stationen Voi und Nairobi der Ugandabahn dehnt sich ein gewaltiger Steppenkomplex aus, den die englische Regierung zur Freistätte für das Wild erklärt hat. Jede Ausübung der Jagd ist in diesem Gebiete auf das strengste untersagt, und die Folge davon ist, daß man hier auf einen Wildreichtum stößt, wie er sich sonst heute kaum noch irgendwo in Afrika vorfindet. Der Reisende kann aus dem Fenster des durch die Steppe dahinbrausenden Zuges ungezählte Mengen der verschiedenartigsten Antilopen beobachten; außerdem bekommt er Giraffen, Warzenschweine und Strauße und, wenn ihm das Glück besonders hold ist, ein Nashorn oder einen Löwen zu Gesicht. Ansiedelungen von Europäern und Negern sind in dem Wildreservat nicht geduldet, nur mehrere Horden der hamitischen Masais, die absolut keine Jäger sind, haben dort Wohnsitze und Weideplätze[S. 107] für ihre Herden angewiesen erhalten. Friedlich äst das Wild inmitten der Rinder- und Ziegenherden der Masais, wohl wissend, daß ihm von seiten der Hirten keine Gefahr droht. Der Europäer, der aus einem wissenschaftlichen oder sonstigen Grunde diese Gegend betreten will, braucht hierfür die Erlaubnis des Gouverneurs von Britisch-Ostafrika, die aber nur selten erteilt wird. Um so dankbarer bin ich einem guten Geschick, das es mir vergönnte, zweimal jenes Wilddorado zu durchqueren.
Die frühzeitig und gleich so heftig eintretende Regenzeit hatte mir in Aruscha einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Einen beträchtlichen Teil meiner Tiere hatte ich durch die anhaltenden kalten Regengüsse verloren, und der Transport zur Küste war aussichtslos geworden. Um nun einerseits hier nicht monatelang untätig zu sein und andererseits den Verlust einigermaßen wieder auszugleichen, beschloß ich, mich zu Fuß durch das Wildreservat nach Nairobi in Britisch-Ostafrika zu begeben. Dort konnte ich meinem Berufe nachgehen und hatte die größte Aussicht, noch vor Sommer einen Tiertransport nach Hamburg zustande zu bringen.
Mit nur neun Trägern trat ich die Reise durch die etwa 400 Kilometer wegelose Strecke von Aruscha nach Nairobi an. Keiner meiner Leute kannte den Weg, nur Kompaß und einige Bergspitzen dienten als Wegweiser. Der einzig günstige Vorteil der Reise war der, daß wir überall Wasser fanden, denn in dieser Zeit waren auch hier Regenschauer niedergegangen. Mehrere Tage waren wir bereits unterwegs, der Longido- und der Erok-Berg lagen hinter uns, und somit hatten wir die englische Grenze überschritten. Je weiter wir aber in der unbekannten Gegend vordrangen, desto unruhiger und ängstlicher wurden meine Träger; auch war es ausgeschlossen, ein Stück Wild für sie zu erlegen, weil wir uns schon längst im Wildreservat befanden und ich auch kein Gewehr mit mir führte. Das Wild, welches hier von[S. 108] niemandem gestört wird und den Europäer mit seinen Feuerwaffen nicht kennt, ließ uns ganz nahe herankommen, ohne große Scheu vor uns zu zeigen. Der Wildreichtum grenzt geradezu ans Fabelhafte. Stundenlang marschierten wir oft durch große Wildherden. An einem Tage sichtete ich sieben Nashörner. Zwei kämpfende Kuhantilopen-Bullen konnte ich aus 20 Schritt Entfernung minutenlang beobachten, ehe sie uns bemerkten und flüchtig wurden. Leider war mein photographischer Apparat nicht zur Hand, um diese interessante Szene aufzunehmen.
Beim Durchwaten eines Tümpels sah ich eine handgroße, braunbehaarte Spinne. Das Tier interessierte mich, ich fing es ein und brachte es in einer Blechbüchse unter. Es war die größte Vogelspinne, die mir je zu Gesicht gekommen ist. Diese Spinnenart (Mygale spec.) ist äußerst räuberisch und soll sogar Mäuse, Eidechsen und kleine Vögel überwältigen. Ihr Biß ist giftig und kann auch beim Menschen Krankheitserscheinungen, bei Kindern oder schwächlichen Personen sogar den Tod herbeiführen. Dieses Tier brachte ich wohlbehalten nach Hamburg, und zwei Jahre später fand ich es noch lebend im Stellinger Insektenhaus vor.
Acht Tage waren wir in nördlicher Richtung vorgedrungen, ohne einen Menschen zu sehen. Viele Kilometer waren wir schon über Berg und Tal, abwechselnd durch Busch- und Grassteppe gezogen. Da, endlich, am neunten Tage, bemerkte ich die ersten Rinderfährten, und erleichtert atmete ich auf. Meine Schwarzen hatten schon Andeutungen gemacht, mich und meine Sachen im Stich zu lassen und auszurücken. Sie hatten sich eingebildet, ich würde Nairobi niemals erreichen und wir würden über kurz oder lang in der Steppe umkommen. Dazu konnten sie nicht begreifen, daß ich ohne Gewehr reiste und kein Wild für sie schoß. Nur meinem energischen Einschreiten war es gelungen, die Leute von ihrem Vorhaben abzuhalten. Den Rinderfährten folgend, hörten[S. 109] wir nach einiger Zeit das eintönige Läuten der Glocken der Masairinder. Bald darauf kamen wir zur Herde und einige Hirten zeigten uns den in der Nähe liegenden Kral. Die Mienen meiner Träger begannen sich nun langsam aufzuheitern. Vorsichtshalber hatte ich meine Leute instruiert, nicht zu sagen, wer ich sei und wohin ich gehe, denn ich wollte auf alle Fälle verhüten, daß die Masais erführen, daß ich allein reiste und nur mit einem Revolver bewaffnet war. Ich stellte mein Erscheinen so hin, als seien wir der Vortrupp einer großen Karawane. Nach langem Hin- und Herreden konnte ich für meine fleischhungrigen Träger ein Schaf erstehen. Milch brachten sie in Hülle und Fülle. Die Eingeborenen haben als echte Wilde die Gewohnheit, nur einmal des Tages zu essen, dies aber gründlich zu besorgen. Ein Träger hatte so viel Milch zu sich genommen, daß sein Bauch wie ein vollgefüllter Sack angeschwollen war. Aber es war auch für einen Wilden zu viel, und plötzlich rächte sich die Natur: in weitem Bogen kam die Milch in Käseform wieder zum Vorschein. Während meinen übrigen Trägern, die dem Waruscha-Stamm angehörten, die Mastkur bekam, konnte der genannte Nyamwesi, an Milchnahrung nicht gewöhnt, dieselbe nicht vertragen. Vielleicht hatte auch der üble Geschmack, den die aufbewahrte Milch überall bei den Masais hat, das Erbrechen verursacht. In den wasserarmen Gegenden spülen nämlich die Masais die Gefäße mit Kuhurin aus und räuchern dieselben auch noch aus.
Ein Masaikral ist gewöhnlich ovalförmig aus Dornenverhauen gebaut. Auf den beiden Endseiten befinden sich die Ein- und Ausgänge, die nachts gleichfalls mit Dornen verbarrikadiert werden. An den Längsseiten im Innern sind die Hütten erbaut, welche aus Buschwerk, Lehm und Kuhdung errichtet werden. In den Hütten wohnen nicht nur die Leute, sondern in einer Nebenabteilung werden auch die jungen Kälber und Lämmer untergebracht, während die Viehherde selbst nachts den freien Raum[S. 110] in der Mitte des Krales innehat. Oft leben mehr als 100 Personen in einem solchen Gehege. Nirgends sieht man in der Umgebung eine Spur von Ackerbau; nur höchstens einige Flaschenkürbisse, die den Masais als Wasser- oder Milchbehälter dienen, ranken außerhalb des Krales an dem Dornverhau empor. Hühner, Eier, ebenso auch Fische sind für den Masai ekelerregende Sachen.
Unter den Elmoran und den jungen Mädchen befanden sich schöne Gestalten mit intelligenten Gesichtszügen. Ein hervortretender Charakterzug dieses Volkes ist sein unbändiger Stolz. Hochmütig schreitet der Elmoran mit Schild und Speer bewaffnet einher. Furchtlos tritt er mit dieser Waffe dem Löwen gegenüber, dem schlimmsten Feinde seiner Viehherden. Er ist ein freier Mann und fühlt sich als Beherrscher der freien Steppe. Jede Arbeit, außer der Beaufsichtigung von Vieh, ist bei ihm verpönt und sieht er als erniedrigend an. Die Anlage von Kralen und alle anderen Arbeiten werden einzig und allein von den Weibern ausgeführt. Die Bekleidung der Männer ist äußerst einfach gehalten. Sie besteht aus einem Stück Baumwollstoff oder aus einem Fell, das Brust und Bauch bedeckt. Auf der einen Schulter wird der Lappen oder das Fell zusammengeknotet, während die andere bloß bleibt. Die Weiber hingegen bekleiden sich mit einem enthaarten Fell, das bis zu den Waden reicht und mit einem bunten Gurt über den Hüften zusammengehalten wird. Häufig sind die Säume dieses Kleidungsstückes mit farbigen Glasperlen besetzt. An den Füßen tragen beide Geschlechter aus Rinderfellen verfertigte, primitive Sandalen. Die Beine der Frauen sind von den Knöcheln bis zu den Knien mit spiralförmig gewundenem, starkem Kupfer- oder Messingdraht geschmückt. In gleicher Weise sind Unter- und Oberarme mit diesem schweren Schmuck umwunden. Als junge Mädchen schon legen sie diesen Zierat an, und man sieht deshalb bei älteren Frauen oft verkümmerte Armknochen, deren Wachstum durch diese beengende Einschnürung[S. 111] gehemmt wurde. Um den Hals tragen sie ebenfalls scheibenartig geringelte Kupferdrähte, die einen beträchtlichen Umfang haben und ein tellerartiges Aussehen aufweisen. Der Ohrschmuck besteht aus kleinen eisernen Ketten, die oft in solcher Anzahl getragen werden, daß sie infolge ihrer Schwere mit einem kleinen Riemen über dem Kopf zusammengehalten werden müssen, um das Ausreißen der Ohrläppchen zu verhüten. Geht ein Trupp solcher Weiber zusammen, so verursacht das Rauschen ihrer lederartigen Kleidung und das Rasseln und Klappern des metallenen Schmuckes ein Geräusch, das sich anhört, als wenn eine Anzahl Kürassiere daherkäme. Die Männer durchbohren mit einem spitzen Stock schon im Knabenalter die Ohrläppchen. Das Loch wird durch Einsetzen von immer dickeren Holzpflöcken nach und nach vergrößert. Ist das Loch ausgeheilt, so versucht der Masai dasselbe durch Anhängen von Gewichten immer noch mehr zu erweitern. Ich habe Männer gesehen, die es darin so weit gebracht hatten, daß sie große, hölzerne Ringe, ja sogar leere Milchdosen als Schmuck in ihren Ohrläppchen trugen.
Das Reinlichkeitsgefühl ist unter den Masais wenig entwickelt. Daß ein Masai sich wäscht oder badet, habe ich nie gesehen. Zum Schutz gegen das Ungeziefer reiben sie sich den ganzen Körper mit einem Gemisch von Butter, Hammeltalg und roter Erde ein, sogar ihr dürftiges Kleidungsstück wird damit eingeschmiert, so daß der Masai, von den Sonnenstrahlen beschienen, wie eine Ölsardine glänzt. Bezüglich der Haartracht besteht bei ihnen das umgekehrte Verhältnis wie bei uns Europäern. Das weibliche Geschlecht trägt den Kopf kahl rasiert, während die Männer große Sorgfalt auf ihre Frisur legen. Die Haare werden so kunstvoll geflochten, daß sie an der Stirn in drei hörnerartigen kleinen Zöpfen hervorstehen, dagegen sind die Haare des Hinterkopfes in einen einzigen Zopf zusammengeflochten. Derselbe wird, um ein glattes und gerades Aussehen zu bekommen, durch Holzstäbchen[S. 112] versteift und mit Rindenbast und Dornen umwickelt. Diese mühselig hergestellte Frisur wird selten gelöst und beständig mit der oben beschriebenen Fett- und Erdemischung eingerieben. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit bedeckt der Masai seinen Kopf mit einer eigenartigen Kappe. Ein Schaf- oder Kälbermagen wird aufgeschnitten, des Inhaltes entleert, umgestülpt und noch frisch über den Kopf gezogen. Durch die Einwirkung der Sonne schrumpft die Kappe zusammen und nimmt die Kopfform an. In neuerer Zeit ist bei den Masais auch der Regenschirm in die Mode gekommen, und man sieht selten einen Mann ohne Schirm, den er aber nie benutzt. Er trägt ihn, da er in der einen Hand den Speer und mit der anderen den Schild hält, an einem Band wie ein Gewehr über den Rücken. Ferner fehlt bei keinem Manne die aus Hornspitzen verfertigte Schnupftabakdose, welche er an Kettchen von Eisen oder schmalen Riemen um den Hals trägt. Der Masai ist ein starker Schnupfer; rauchen habe ich ihn weniger gesehen. Der Masai-Schnupftabak ist äußerst stark und riecht ganz verdächtig, als ob er mit getrocknetem Ziegendünger vermischt wäre.
In der Nähe eines Masaikrals ist es vor Fliegen kaum auszuhalten. Wie ein Bienenschwarm stürzten sie auf mich los. Schwer haben die Leute unter diesen Insekten zu leiden. Ständig schlugen sie mit einem Wedel hin und her, um die Plagegeister von ihren Augen fernzuhalten. Die Säuglinge, welche von ihren Müttern in einer Umhüllung auf dem Rücken getragen werden und nur mit dem Kopfe hervorlugen, hatten das Gesicht und besonders die Augenränder über und über mit Fliegen bedeckt. Ebenfalls waren die hölzernen Eßgeschirre und Milchkalebassen wie mit Fliegen übersät. Diese Fliegenplage ist wohl der Hauptgrund, daß die Masais viel unter Augenkrankheiten zu leiden haben. Um einigermaßen vor den Quälgeistern Ruhe zu haben, zog ich es vor, mehrere hundert Meter vom Krale entfernt das Lager[S. 113] aufzuschlagen. Meine Leute waren bald dabei, ihren Hammel am Feuer zu rösten. Der Kralhäuptling kam in Begleitung der Ältesten herbei, um das übliche Geschenk abzuholen, und nach Erhalten desselben zog er gleich ab; einen Dank darf man von solchen Leuten nicht erwarten.
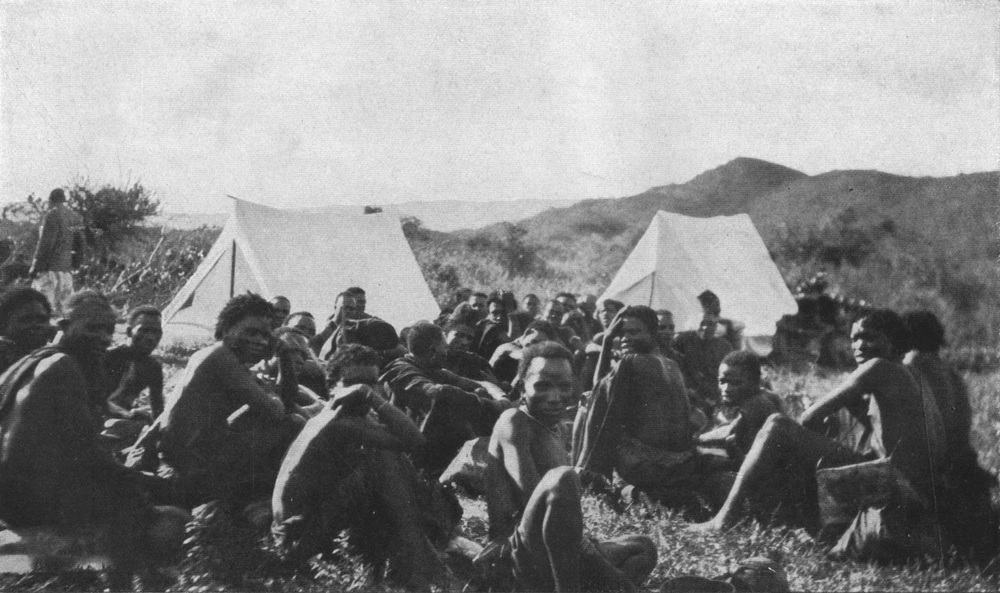

Am nächsten Morgen setzte ich unsere kleine Karawane in aller Frühe wieder in Bewegung. Wir kamen an einem verlassenen Masaikral vorüber. Die Neugierde trieb mich, das Innere desselben zu besichtigen. Ich kroch in eine Hütte, um die Einrichtung in Augenschein zu nehmen. Kaum befand ich mich darinnen, als auch schon Tausende von Flöhen mich überfielen. Schleunigst zog ich mich wieder zurück und sah draußen beim Tageslicht, daß mein gelber Kakianzug derartig mit den „braunen Dragonern“ bedeckt war, daß ich sie schichtenweise abstreifen konnte.
Am Nachmittage passierten wir eine Schlucht und stießen auf einen großen klaren Wassertümpel. Freudig begrüßte ich die sich mir bietende Badegelegenheit. Die Rast benutzte ich auch, meine Zehen durch einen geschickten Neger von den vielen Sandflöhen befreien zu lassen, die sich allmählich bei mir eingenistet hatten. Diese Sandflöhe (Sarcopsylla penetrans L.), welche ursprünglich von Brasilien aus an die afrikanische Westküste verschleppt wurden und sich von dort innerhalb weniger Jahre fast über den ganzen schwarzen Kontinent verbreitet haben, bohren sich mit Vorliebe unter die Fußnägel ein, um hier ihre Eier abzulegen. Letztere entwickeln sich schnell und verursachen ein heftiges Jucken. Die Eingeborenen verstehen es ausgezeichnet, die erbsengroßen Gewächse mit langen spitzen Dornen unter den Nägeln hervorzuholen. Versäumt man diese Reinigung, so treten bösartige Entzündungen auf. Es ist gar nichts Seltenes, daß Eingeborene durch dieses Ungeziefer ganze Zehen eingebüßt haben.
Wir begegneten nun oft kleinen Trupps von jungen Masaikriegern, die in vollem Kriegsschmuck waren und die zerstreut[S. 114] liegenden Masaikrale besuchten. Überall wurden sie willkommen geheißen und aufs beste bewirtet. Ich glaube, daß die Ehemänner diesem Besuch doch mit etwas gemischten Gefühlen entgegensehen, obwohl es eine alte geheiligte Masaisitte ist, daß den Elmoran als Gästen nicht nur die Hütte, sondern auch die Insassinnen zur Verfügung stehen müssen. Solange der vor der Hütte aufgepflanzte Speer eines Elmoran im Boden steckt, sind alle Rechte, auch die ehelichen, dem Gaste übertragen und der Hausherr darf die Hütte nicht betreten.
Ich erkundigte mich bei den zuletzt angetroffenen Elmoran, wieviel Tagemärsche wir noch von Nairobi entfernt seien. Sie gaben mir die Auskunft, daß wir am nächsten Tage die Kapiti-Ebene erreichen würden, rieten aber ab, diese große, nur mit kurzem Gras bewachsene Fläche zu durchqueren. Daselbst wäre weder Holz zum Lagerfeuer, noch Dornen zum Verhau als Schutz gegen die vielen Raubtiere zu finden, und der Durchmarsch würde mindestens zwei Tage in Anspruch nehmen. Mir blieb nichts übrig, als die Kapiti-Ebene zu umgehen oder nach Osten abzubiegen, um auf die Ugandabahn zu stoßen. Ich entschloß mich zu letzterem, denn einige Masais behaupteten, daß ich in einem Tage den Schienenstrang erreichen würde. So marschierten wir angestrengt den ganzen Tag hindurch und trafen gegen Abend nochmals auf große Rinderherden und einen Masaikral. Die Hirten waren wenig freundlich und zeigten uns nur ungern ihre Wasserstelle. Ich beschloß daher, auf meiner Hut zu sein, machte vorsichtigerweise in etwa einem Kilometer Entfernung vor dem Krale halt und ließ meine neun Träger nach kurzem Imbiß sich zur Ruhe niederlegen, während ich selbst Nachtwache hielt. Gegen 1 Uhr nachts ging der Mond auf, ich weckte meine Leute und lautlos marschierten wir ab. Trotzdem wir ringsum Löwengebrüll hörten, strebten wir mit Macht vorwärts, um die Bahnlinie zu finden. Endlich vernahm ich beim Überschreiten einer Bodenwelle in der Ferne den[S. 115] ersten Lokomotivpfiff. Diese schon lange nicht gehörte Stimme der Kultur verscheuchte in mir augenblicklich jedes Gefühl der Unsicherheit, und die angespannten Nerven beruhigten sich. Freilich wurde ich nach wenigen Schritten noch einmal kräftig an die Steppe erinnert. Durch das Heranbrausen der Lokomotive war ein in die Nähe der Bahnlinie gekommenes Giraffenrudel aufgescheucht worden und sauste in wilder Flucht auf uns zu, ohne uns im schwachen Mondlicht zu bemerken. Wir konnten uns aber noch rechtzeitig hinter einigen, hier wieder vorkommenden Bäumen decken, und so flüchtete das riesige Wild ganz hart an uns vorbei. Ich hatte das Glück, gerade in der Nähe der Station Kiu (Durst) durchgestoßen zu sein, und fand einen Weg zum Stationsgebäude, wo wir gegen 4 Uhr morgens, durchfroren, durchnäßt vom Tau des Grases und todmüde anlangten.
Jede Station der englischen Ugandabahn besitzt eine Wellblechhütte, die als Rasthaus dem Reisenden zur Verfügung steht. Das vorgefundene Rasthaus war leer, so daß ich es beziehen und einige Stunden Schlaf nachholen konnte. Auf der Station erfuhr ich, daß ein Mister Grey, Bruder des englischen Ministers, zur Löwenjagd anwesend sei und einige junge Löwen gefangen habe. Ich suchte ihn auf und sah mir die Tiere an; es waren aber Weibchen und der geforderte Preis sehr hoch, so daß ich auf den Ankauf verzichtete. Herr Grey betrieb die Löwenjagd als Sport und fiel später seiner Leidenschaft zum Opfer. Dem kühnen Löwenjäger wurde in Nairobi ein Denkmal gesetzt.
Nach Einnahme meines Frühstücks ließ ich gegen 8 Uhr mein Gepäck auf dem Bahnsteig zurechtlegen und löste die Fahrkarten nach Nairobi. Als aber der Zug heranbrauste und ich einsteigen wollte, waren meine Wilden in größtem Schrecken vor der heranziehenden Lokomotive ausgerissen, hatten sich zitternd hinter dem Stationsgebäude versteckt und weigerten sich, den Zug zu besteigen. Allein konnte ich nicht abfahren, da ich für meine Träger[S. 116] verantwortlich war. Ich donnerte meine Kerle gehörig an, aber sie erklärten mir rundweg, sie wollten lieber die 40 Meilen bis nach Nairobi zu Fuß marschieren, als ihre Knochen solch einem eisernen Feuerwagen anvertrauen. Ich konnte nichts anderes machen, als sie beim Wort nehmen und sofort aufbrechen, um die 22 englische Meilen entfernt liegende nächste Station Kapiti-Plains noch am selben Tage zu erreichen. Anfangs ging es bei dem kühlen Wetter auf dem neben dem Schienenstrang laufenden Fußweg rüstig vorwärts. Nach wenigen Stunden war der Weg zu Ende und wir befanden uns in der wildreichen Kapiti-Ebene, die hier von der Bahn durchschnitten wird. Meine Leute hatten an dem scharfen Bahnschotter bald ihre Sandalen zerrissen und die Füße zerschunden. Mehrere Züge fuhren an uns vorüber, aus deren Wagen die schwarzen Fahrgäste ihre zu Fuß marschierenden Landsleute gehörig verspotteten. Da meine Träger nun sahen, daß ihre Stammesgenossen furchtlos und bequem im Wagen hockten, und als wir erst spät abends die nächste Station Kapiti-Plains erreichten, war ihnen das Verständnis für die Vorteile der Eisenbahnbeförderung wohl zum Bewußtsein gekommen. Am nächsten Tage bestiegen sie willig, wenn auch noch immer ängstlich, und mit tatkräftiger Nachhilfe des Eisenbahnpersonals, den nach Nairobi gehenden Zug. Ich überwachte mißtrauisch ihre Verladung, und erst als der Zugführer hinter dem letzten Kerl das Abteil abgesperrt hatte, schwang ich mich auf die Plattform meines I. Klasse-Wagens. Hier machte ich es mir bequem, denn im Innenraum waren viele Passagiere. Während der Fahrt kam ein Gentleman auf die Plattform heraus und sagte mir in hochtrabendem Tone: „Dieser Wagen ist besetzt.“ Dem unhöflichen Patron, der noch ein ganz grüner Afrikaner zu sein schien, erklärte ich, daß ich trotz meiner einfachen Jagdkleidung genau so wie er Fahrgast der ersten Klasse sei. Meine Worte ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, und der Herr zog sich zurück. Kurz nach diesem[S. 117] Zwischenfall erblickte ich von meinem luftigen Sitze auf der Plattform unweit des Schienenstranges einen Löwen. Beim Näherkommen bot sich ein für 9 Uhr morgens jedenfalls höchst seltener Anblick. Neben dem Geleise lag ein zerrissenes Zebra und dicht dabei stand eine Löwin. Ich rief die Reisegesellschaft aus dem Wagen heraus und zeigte ihnen das seltene Bild. Beim Herannahen des Zuges schreckte die Räuberin auf und machte einige Fluchten seitwärts, blieb dann aber stehen, mißtrauisch nach uns äugend und ohne zu fliehen; ein sicheres Zeichen, daß hier auch das Wild sich schon an das neue Verkehrsmittel gewöhnt hatte. Der vorher so hochnäsige Lord und die Damen waren auf einmal wie umgewandelt, nahmen an meinem Jagdanzug keinen Anstoß mehr und luden mich ein, im Wagen Platz zu nehmen. Gegen Mittag erreichten wir Nairobi. Seit meinem Aufbruch von Aruscha waren 11 Tage verflossen.
Nairobi liegt 540 Meilen von der Küste entfernt, ist Sitz der Regierung und Hauptstadt von Britisch-Ostafrika. War Nairobi vor zirka 15 Jahren nur eine Ansammlung von wenigen Wellblechhütten, so besteht heute die Stadt fast ganz aus schönen massiven Steingebäuden. Große Molkereien, Mühlen und Schlachthäuser sind angelegt und zeugen von dem wirtschaftlichen Aufblühen der Stadt.
Ich hatte Glück gehabt, und bald hatte ich einen hübschen Tiertransport zusammengestellt, welcher Zebras, Büffel, Elenantilopen, Thomsongazellen, Busch- und Warzenschweine, Kongonis, ein Nashorn, verschiedene kleine Raubtiere, ferner Geier, Kraniche, Kronenkraniche, Reiherarten, grüne Papageien, Webervögel usw. aufwies.
In meinem Hotel waren zufällig deutsche Landsleute, bekannte Sportsmänner, und eine deutsche Schriftstellerin, Frau S., anwesend. Wir erzählten uns gegenseitig unsere Jagderlebnisse, wobei ein Herr mir mitteilte, daß er kürzlich auf einer Büffeljagd ebenfalls[S. 118] seinen Boy durch einen wütenden Bullen verloren habe. Trotz aller dieser Unglücksfälle lassen sich echte Jäger und Sportsleute nicht von dieser gefahr-, aber darum so reizvollen Jagd auf Großwild abhalten.
Merkwürdig ist es, daß, obwohl es auf deutschem Gebiete ganz genau dieselben Jagdgelegenheiten gibt, deutsche Jagdgesellschaften fast immer auf englischem Gebiete jagen. Nach meinen langjährigen Erfahrungen ist der Reichtum an Groß- und Raubwild auf deutschem Gebiete weitaus größer als auf englischem. Auch stellen sich die Kosten eines Jagdunternehmens auf deutschem Gebiete billiger. Wenn trotzdem die meisten der aus Europa kommenden Großwildjäger ihre Schritte nach Britisch-Ostafrika lenken, so liegt dies an der äußerst geschickten Reklame, die von englischen Jagdunternehmern oder sonstigen Interessenten für ihre Kolonie eifrigst betrieben wird.
Ein Telegramm aus Mombasa benachrichtigte mich, daß der Überseedampfer nach Europa in acht Tagen fällig sei. Schleunigst ging es an die Herstellung der Transportkästen. Mit Hilfe einer Schar Schwarzer wurde alles für den Abtransport hergerichtet und sämtliche Tiere in ihre Behälter untergebracht. Die meiste Arbeit machten uns diesmal die Zebras, und eines derselben wurde beim Überführen in die Transportkiste wild, riß sich los und stürzte sich auf den führenden Neger, der laut schreiend in den Stall flüchtete. Da das Zebra ihm auch dorthin nachrannte, kletterte er in seiner Angst auf die Krippe. Aber das bissige Tier hob sich auf die Hinterläufe und schnappte wütend nach den Beinen des zappelnden Schwarzen, so daß er wider Willen einen richtigen Negertanz auf dem kaum eine Hand breiten oberen Balken der Krippe aufführte. Mit einem Lasso brachte ich den Wüterich zur Vernunft und konnte ihn endlich in seinen Kasten verstauen.
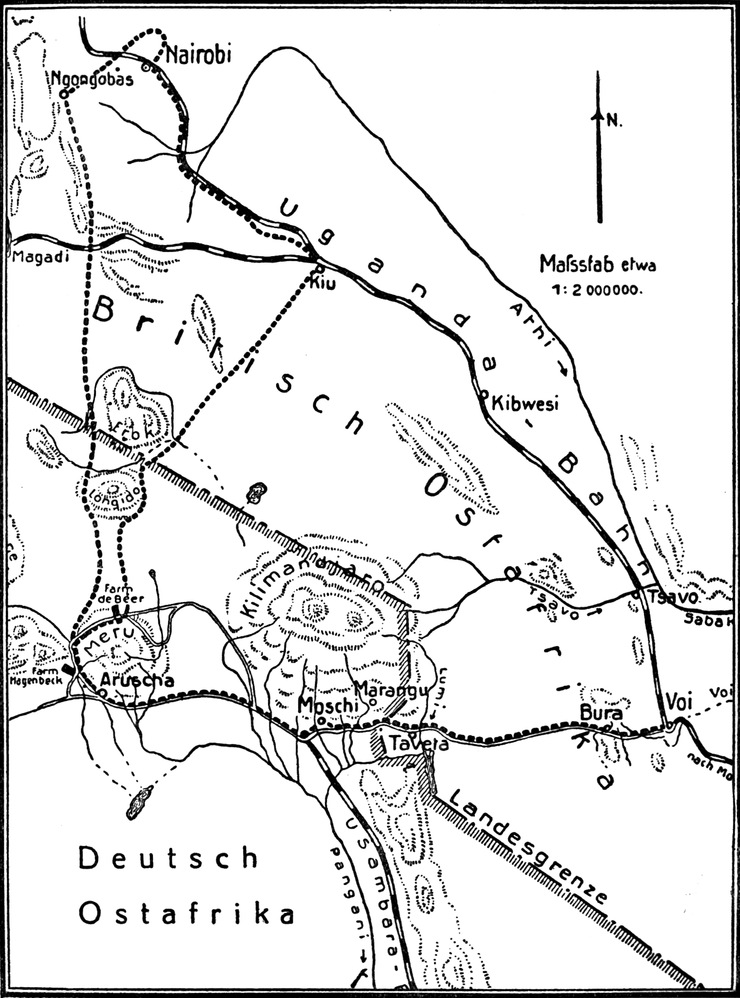
Mein Transport war derartig angewachsen, daß ich einen Extrazug zur Beförderung nach Mombasa nehmen mußte. Auf der[S. 120] Fahrt passierten wir auch die berüchtigte Station „Simba“ (Löwe), die ihren Namen wegen der bei Anlegung der Bahnlinie herrschenden Löwenplage erhalten hat. Löwen hatten beim Bahnbau verschiedene Arbeiter aus ihren Hütten herausgeholt, und der Stationsvorsteher getraute sich in der ersten Zeit überhaupt nicht mehr aus dem Stationshaus heraus. Nach 26stündiger Fahrt erreichten wir Mombasa. Diese Reise war für mich eine der anstrengendsten, denn mein Zug bestand aus neun offenen Wagen, und nicht nur Staub und Sand regneten auf die Tierkästen nieder, sondern auch Funken und glühende Holzstücke aus der mit Holz geheizten Lokomotive. Daher war jeder Wagen von zwei Negern mit Wasserbehältern besetzt, um der Feuersgefahr zu begegnen. Ich mußte aber auf jeder Station heraus und die Runde machen, um nachzusehen, ob alles auf seinem Posten sei und die Schwarzen nicht schliefen. Einer der Wächter schlief einmal so tief, daß ein Funke bereits sein Gewand angesengt hatte, ohne daß er es merkte. So lebte ich während der Fahrt in ständiger Sorge, daß Feuer ausbrechen und meinen Transport beschädigen könnte. In Mombasa erhielt ich noch einen kräftigen Zuwachs an Tieren aus deutschem Gebiete, darunter ein junges 45 Zentimeter hohes Flußpferd vom Viktoria Nyanza (See).
Alle Tiere wurden an Bord gebracht, und ich nahm vier Kikuyu, Stammesverwandte der Masai, mit Erlaubnis der englischen Regierung als Wärter der Tiere mit. Nach 28tägiger Fahrt trafen wir gerade einen Tag vor Pfingsten in Hamburg ein, so daß die Pfingstbesucher des Stellinger Tierparkes die Freude hatten, im Tierparadiese die neuen afrikanischen Ankömmlinge zu bewundern, die sich nach der langen Kastenhaft fröhlich im großen Gehege tummelten.
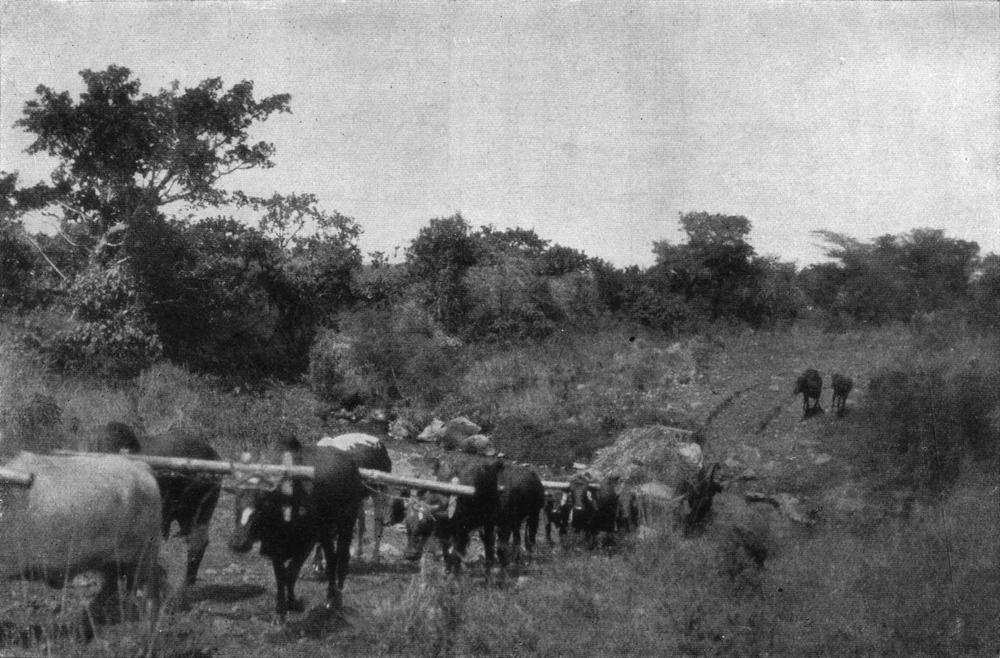
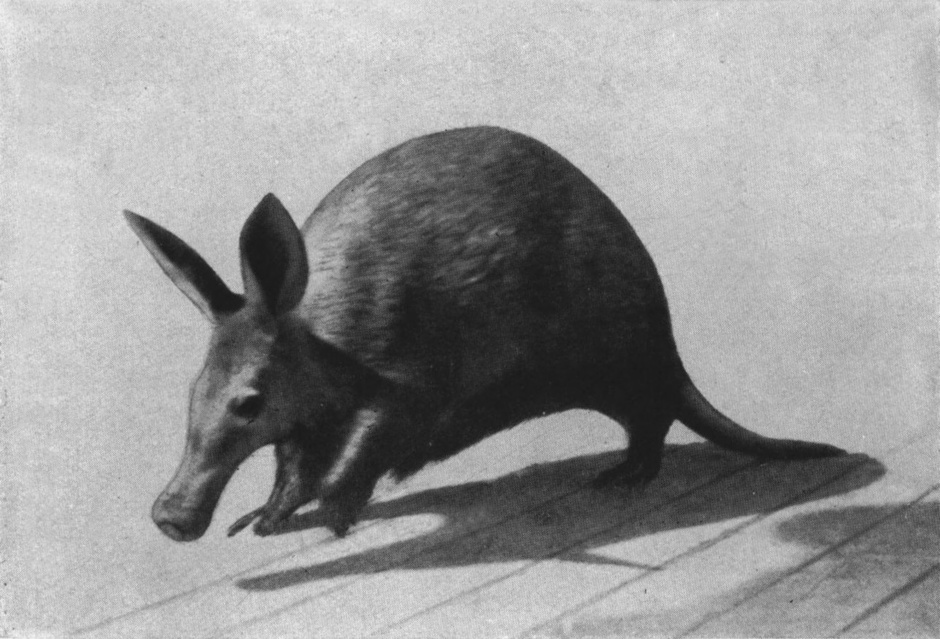
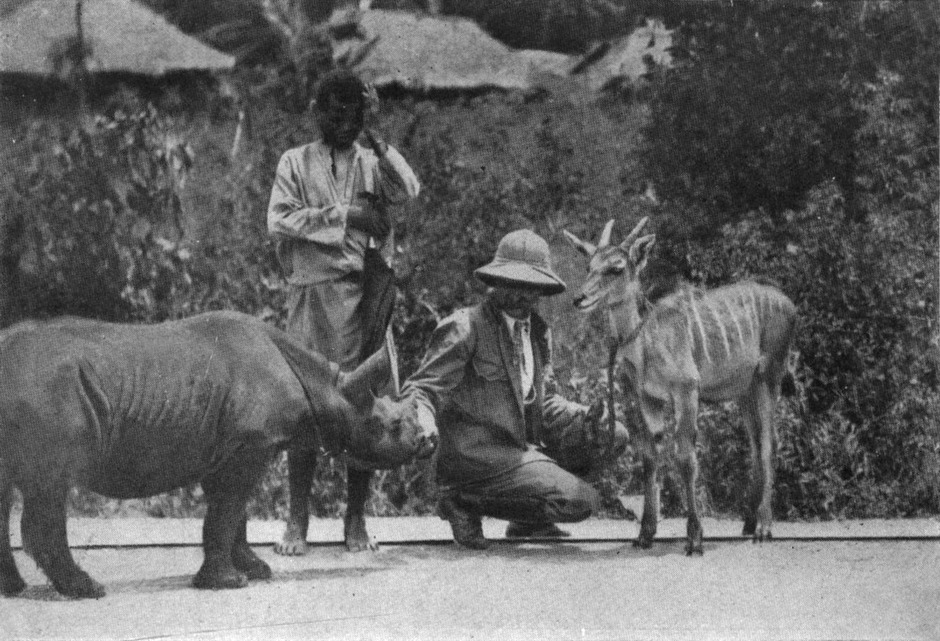
[S. 121]
Ein Jahr später durchquerte ich nochmals die Masaisteppe und das Kikuyuland, und zwar in entgegengesetzter Richtung. Ich befand mich wiederum in Nairobi und hatte den Abtransport einer Tierkarawane beaufsichtigt. Gleichzeitig benutzte ich die Gelegenheit, daselbst verschiedene Einkäufe für meine geplante Tierzuchtfarm zu machen, auch benötigte ich einige gute Reitpferde für den Tierfang, die ich im deutschen Gebiete nicht bekommen konnte. Um einerseits die wertvollen Pferde bei einem Transport über die Küstenroute nicht der Tsetse-Gefahr auszusetzen und andererseits mein Ziel schneller zu erreichen, beschloß ich, von Nairobi aus die Strecke über Land, die Masaisteppe, zu nehmen. Als bekannter Tierfänger erhielt ich vom englischen Gouverneur die bisher wenigen Europäern erteilte Erlaubnis, durch das Wildreservat reisen zu dürfen. Es wurde mir gestattet, meine Waffen mitzunehmen, aber ich mußte mich durch Abgabe meines Ehrenwortes und Hinterlegung von 1000 Rupien als Garantie verpflichten, in genanntem Gebiete nichts zu erlegen.
Vor meiner Abreise machte ich die Bekanntschaft des Distriktkommissars vom englischen Masaireservat. Der Herr lud mich in freundlicher Weise ein, sein von der Stadt nur 13 Meilen entferntes Haus als ersten Rast- und Halteplatz zu benutzen, was ich dankend annahm. Mein ansehnliches Gepäck benötigte 30 Träger. Nachdem die Lasten verteilt waren und jeder sich seinen Teil zusammengeschnürt und seine Tagesration empfangen hatte, setzte sich die Karawane in Bewegung. Alle waren heiter gestimmt, und mit ihrem eintönigen Gesang suchten sich die Leute das Marschieren zu erleichtern. Mehrere Stunden waren wir bereits unterwegs, da zogen drohende Gewitterwolken am Horizonte herauf, und es dauerte auch nicht lange, da hatte das herrliche Wetter ein jähes Ende gefunden. Strömender Regen, gefolgt von Blitz und Donner, prasselte auf uns herab. Wäre ich nach Nairobi zurückgekehrt, so hätte ich am nächsten Tage bestimmt[S. 122] keinen Träger mehr vorgefunden, also hieß es „vorwärts unter allen Umständen“. Wir marschierten bis zum sinkenden Tageslicht, ohne das zum Halteplatz bestimmte Haus des Distriktkommissars gefunden zu haben. Auf der Suche danach ritt ich voraus und traf glücklicherweise auf zwei Masais, die aber bei meinem Auftauchen die Flucht ergriffen. Ich jagte ihnen nach und zwang sie, mir den Weg zu dem gesuchten Hause zu weisen. In stockfinsterer Nacht und bei strömendem Regen kam ich, bis auf die Haut durchnäßt und über und über mit Erde bespritzt, endlich dort an. Die Wachtposten erklärten mir, daß ihr Herr noch nicht aus Nairobi zurückgekehrt sei. Offenbar hatte er es vorgezogen, bei dem schlechten Wetter dort zurückzubleiben. Ich wollte in meinem durchaus nicht salonfähigen Anzuge die Dame des Hauses nicht belästigen, aber schon hatte sie von meiner Ankunft gehört und nötigte mich in freundlicher Weise einzutreten; an derlei Überraschungen sei sie als geborene Südafrikanerin gewöhnt und entschuldige alles; auch gab sie Befehl, meine Pferde unterzubringen. Ich bekam ein Zimmer, und ein heißer Whisky durchwärmte bald meine vor Kälte klappernden Glieder. Nach Einnahme eines vorzüglichen Abendbrotes begab ich mich zur Ruhe. An Schlaf war wenig zu denken, denn der Regen prasselte unaufhörlich die ganze Nacht hernieder, dazu störte mich noch das schauerliche Gelächter der um das Haus streifenden Hyänen. Zwei dieser Bestien hatten sich in derselben Nacht in den von Askaris aufgestellten Fallen gefangen.
Im Laufe des nächsten Vormittags traf der Hausherr ein. Er hatte schon gefürchtet, daß ich die Station verfehlt hätte, und lud mich ein, bei ihm einige Tage als Gast zu verweilen. Ich hatte aber Eile und wollte das sich aufklärende Wetter zum Vorwärtskommen benutzen. Meine Träger waren inzwischen eingetroffen, und der liebenswürdige Beamte ließ es sich nicht nehmen, mir zwei Masais als Führer mitzugeben.
[S. 123]
Diesmal umging ich die Kapiti-Plains und schlug die Richtung auf den Natronsee ein. Am selben Abend noch erreichten wir einen großen Masaikral, wo der oberste Häuptling dieses Stammes residierte. Hunderte von Elmorani mit blitzenden Speeren und buntbemalten Schilden, prächtige, braune Gestalten, hüteten die großen, nach Tausenden zählenden Rinder-, Schaf- und Ziegenherden, alles Eigentum ihres Stammoberhauptes. Der Masaihäuptling kam sofort in mein Lager; er habe Leibschmerzen, versicherte er mir mit listigem Augenblinzeln und verlangte Medizin. Ich gab ihm die gewünschte „Dawa“ (Medizin), nämlich einen gehörigen Schluck Genever, worauf ihm merkwürdigerweise sofort besser wurde. Das Verbot, den Eingeborenen Alkohol zu geben, war somit in medizinisch einwandfreier Weise umgangen worden.
Mit Interesse betrachtete ich einige Stunden das Tun und Treiben der Masais sowie der großen Viehherden. Ich konnte keine einheitliche Rasse herausfinden, denn es waren Buckelrinder, Watusirinder, Zeburinder und alle möglichen Kreuzungen vorhanden, wohl ein Beweis von vielen Viehräubereien. Bei ihren Viehdiebstählen gehen diese Steppensöhne mit aller ihnen zu Gebote stehenden List, Gewandtheit und Verschlagenheit zu Werke, und nur höchst selten bekommt der Leidtragende seine Rinder wieder zu Gesicht. Handelt es sich um einen Raub von nur wenigen Stücken, so ergreift jeder Masai ein Rind am Schwanz, und durch Biegen und Drehen desselben treibt er dasselbe zum rasenden Lauf an, wobei er selbst mitgerissen wird. Viele Kilometer werden so in der Dunkelheit der Nacht zurückgelegt, bis die Beute in Sicherheit ist. Für den Masai sind seine Rinder sein Reichtum, sein ein und alles, um das sich sein ganzes Denken und Handeln dreht. Er sucht seine Herden immer mehr zu vergrößern, und nur höchst selten wird ein Tier von ihm verkauft; dagegen tauscht er gern alte Ochsen gegen junge Färsen um.[S. 124] Geld spielt bei ihm keine Rolle, da er den Wert desselben noch nicht kennt. Sein früher viel stärkerer Herdenbestand ist in den letzten Jahren durch Viehseuchen stark zurückgegangen, und der ganze Bestand wird heute auf eine Million Rinder geschätzt.
Auf dem Weitermarsch überraschte uns zwei Tage später in einem baumlosen Gelände abermals ein heftiges Gewitter. Weit und breit war weder Busch noch Baum, nur ein paar Granitblöcke boten uns geringen Schutz. Mein aufgeschlagenes Zelt hielt dem Sturme nicht stand; ein plötzlich eintretender Wirbelwind zerriß es und die Fetzen flogen in die Luft. Die erschreckten Pferde waren kaum zu halten. Alles geriet in Unordnung, dazu prasselte der kalte Regen in dichten Strömen auf uns herab. Erst spät abends, als das Unwetter nachließ, hatte der Koch endlich mit Hilfe einer Flasche Petroleum Feuer anzünden und uns noch einen Tee bereiten können. Als Notbehelf wurde aus Türen und Fenstern, die für mein Haus auf der Farm in Aruscha bestimmt waren, über mein Bett ein Schutzdach errichtet. Damit mußte ich auch für die weiteren Tage vorlieb nehmen, denn von dem Zelte waren nur noch wenige Fetzen übriggeblieben. So wurden unsere physischen und moralischen Kräfte auf eine harte Probe gestellt. Der Leser, der vielleicht in einem behaglichen Heim diese Zeilen zu Gesicht bekommt, kann sich wohl schwer eine Vorstellung davon machen. Beim Weitermarsch am nächsten Morgen wurden die nassen Decken und Kleider über die Pferde gehängt und so von der Sonne, die wieder warm auf uns herabschien, getrocknet. Wir hatten bereits die Kapiti-Plains umgangen, befanden uns aber noch immer im englischen Masaireservate. Die beiden Führer, welche die Gegend sehr gut kannten, verfehlten nicht, bei jedem Masaikral anzuhalten, und durch ihre Vermittlung war es nicht schwer, uns mit Milch, Honig, Hammel, Ziegen usw. zu verproviantieren. Überall an den Kralen war zu sehen, wie auch hier Sturm und Regen gehaust hatten. Alles war aufgeweicht,[S. 125] und Tiere und Menschen wateten in dem fußhohen dampfenden Düngerbrei. Weiber und Kinder waren eifrigst dabei, ihre defekt gewordenen Hütten auszubessern und mit Lehm und Kuhdung zu überschmieren.
Unangenehm ist es, nachts in der Nähe eines solchen Krales zu lagern, denn in seiner Umgebung halten sich außergewöhnlich viel Hyänen und Schakale auf. Der Masai hat die Gewohnheit, Knochen und Tierkadaver einfach unmittelbar vor seinen Kral zu werfen, ja sogar seine toten Stammesgenossen werden pietätlos dorthin gelegt. Es ist deshalb kein Wunder, daß sich daselbst das Raubgesindel massenweise aufhält, mit den Kadavern aufräumt und mitunter recht frech wird. Einen solchen Fall sollte ich selbst erleben: Wir hatten unser Lager so gebaut, daß die Pferde in der Mitte desselben an einen Baum angebunden waren. Meine primitive Bettstelle war so aufgestellt, daß ich die Pferde immer im Auge behalten konnte. Die Hyänen heulten, wie allabendlich, um unser Lager herum. Auf einmal entstand ein großer Tumult, die Pferde sprangen auf, zerrten wie besessen an ihren Halftern und schlugen aus. Ein ganzes Rudel Hyänen, etwa zehn Stück, machte einen regelrechten Angriff auf meine Reittiere. Ich schoß mit dem Revolver dazwischen und meine Schwarzen rissen das brennende Holz aus dem Lagerfeuer und warfen nach den Bestien, die daraufhin heulend abzogen.
Nach viertägigem Marsch lag das Masaireservat hinter uns, und wir nahmen unsere Richtung auf den Erok-Berg. Aus der Ferne leuchtete bereits der schneebedeckte Kilimandjaro vom deutschen Gebiete herüber. Oft war der eingeschlagene Weg durch die starken Regengüsse streckenweise in bodenlosen Sumpf verwandelt, so daß wir mehrere Male in solche Moraste hineingerieten und stellenweise stundenlange Umwege machen mußten.
In der mit hohem Gras bewachsenen Steppe hatten meine Pferde viel unter der Zeckenplage zu leiden. Beinahe auf jedem Grashalme[S. 126] saßen etliche dieser Blutsauger. Mit den Hinterbeinen am Halm sich festhaltend, angeln sie mit den Vorderbeinen in der Luft herum. Streift man einen solchen Grashalm, so hat sich das Insekt auch schon im Augenblick an einem festgesetzt. Meine Pferde waren an den Köpfen und an den Weichteilen mit Zecken wie übersät. Wie bei den Stechfliegen, so sind es auch bei den Zecken nur die Weibchen, welche Blut saugen. Hat sich einmal eine Zecke in der Haut festgebissen, so saugt sie sich in mehreren Stunden so voll Blut, daß sie den mehrfachen Umfang an Körpergröße zunimmt, worauf sie wieder von selber abfällt. Will man aber ein solches Insekt mit Gewalt entfernen, so bleibt mindestens der Kopf in der Haut stecken oder man reißt meistens ein Stück Haut mit heraus, wodurch dann häufig bösartige Wunden verursacht werden.
Am Abend des neunten Marschtages schlug ich im Vorgelände des Erok, oberhalb einer kleinen Schlucht, mein Lager auf. Diese Gegend war bislang vom Regen noch ziemlich verschont geblieben. Die Träger hätten es lieber gesehen, wenn das Lager in der Talsohle selbst errichtet worden wäre, da sie guten Schutz gegen die kalten Nachtwinde bot. Aber ihre diesbezüglichen Bitten trafen bei mir auf taube Ohren. Ich hatte hierfür meine guten Gründe. Solche Schluchten füllen sich nämlich bei plötzlich eintretendem Regen in unglaublich kurzer Zeit mit den von den Bergen hinabflutenden Wassermassen an. Meine Vorsicht bezüglich der Wahl des Lagerplatzes war denn auch diesmal nicht unnötig gewesen. In der Nacht gingen mächtige Gewitterregen nieder, und am nächsten Morgen war die Talsohle in einen reißenden Strom verwandelt. Es dauerte mehrere Stunden, bis sich die Wasser verlaufen hatten und wir die auf unserer Route liegende Schlucht durchqueren konnten.
Am gleichen Tage noch erreichten wir das deutsche Gebiet, woselbst ich nun von meinem Jagdrechte Gebrauch machen konnte.[S. 127] Das zahlreich auftretende Wild bot mir Gelegenheit, den Fleischhunger meiner Kikuyu-Träger in Gestalt einer Grantgazelle und einer Kuhantilope zu stillen. Deutlich bemerkte ich hier Elefantenfährten. Eine große Herde dieser Dickhäuter war vom Longido- nach dem Erok-Berg, d. h. vom deutschen aufs englische Gebiet hinübergewechselt. Für sie existieren keine politischen Grenzen. Bei Durchquerung einer Baumsteppe stieß ich auf einen einzelnen kapitalen Giraffenbullen. Der Riese ließ mich bis auf 40 Schritt herankommen, ehe er flüchtig wurde.
Am elften Tage erreichten wir die südliche Wasserstelle am Longido-Berg, und nach weiterem neunstündigem Marsch die erste Burenansiedlung Oldonje-Sambu. Die Karawane blieb, da die Nacht schon anbrach, hier zurück mit dem Befehl, am nächsten Tage nachzukommen. Ich selbst ritt noch die letzten vier Stunden bis zu meiner Farm durch. Meine Frau, noch nicht mit den afrikanischen Verhältnissen vertraut, befand sich in großer Sorge um mich, da man ihr erzählt hatte, daß die Strecke von Nairobi nach Aruscha zu Pferde in 5–6 Tagen zurückgelegt werden könne. Niemand hatte allerdings ahnen können, daß ich trotz der Regenzeit mit einer Trägerkarawane marschieren würde. Die Träger trafen am nächsten Tage auch pünktlich ein, und nach einigen Rasttagen schickte ich sie mit der Bahn über Tanga-Mombasa in ihre Heimat zurück.
So hatte ich zum zweiten Male das englische Wildreservat und die Masaisteppe glücklich durchquert und dieses schöne Hochland mit seinem noch wenig bekannten Nomadenvolke und seinem ungeheuren Wildreichtum kennengelernt. Die Strapazen und Unannehmlichkeiten der Reise waren bald vergessen, aber die Eindrücke des so vielen Interessanten werden mir stets und immer in Erinnerung bleiben.
[S. 128]
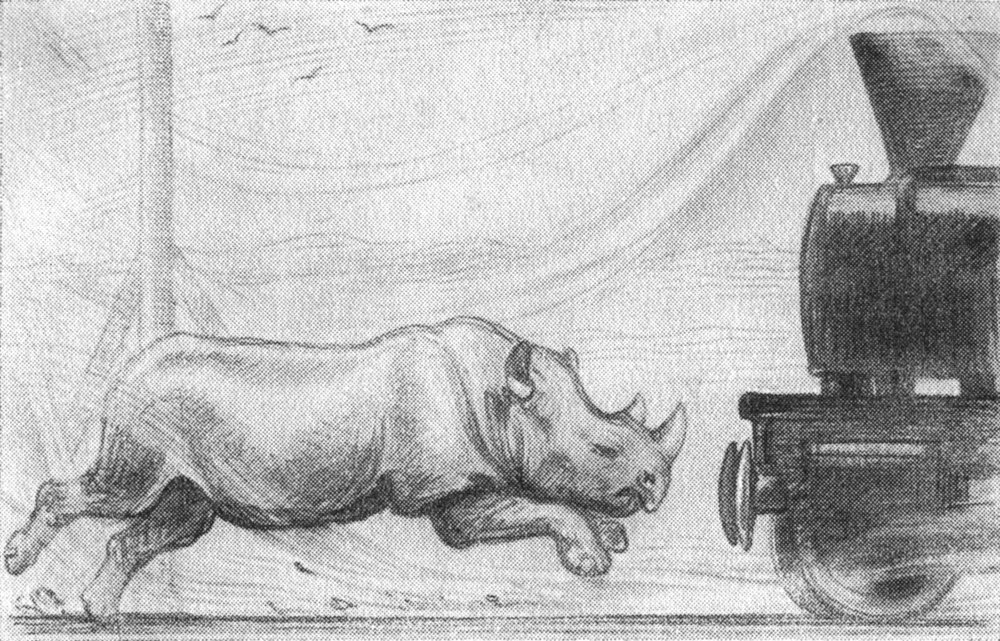
Auf der noch im Bau begriffenen Endstation Neu-Moschi der Usambarabahn war man dabei, Haustiere, allerlei Ackergeräte, Werkzeuge, Kisten und Kasten auf Ochsenwagen zu verladen. Der Ansässige merkte sofort, daß es sich um die Erfordernisse zur Gründung einer neuen Ansiedlung handelte, die ins Innere geschafft werden sollten. So war es auch. Längst schon hatte ich die Notwendigkeit erkannt, die eingefangenen Jungtiere eine Zeitlang aufzuziehen, sie an entsprechende Nahrung und an den Menschen zu gewöhnen, um sie dadurch für die große Seereise sowie für die zoologischen Gärten widerstandsfähiger zu machen. Gleichzeitig mit diesem Unternehmen sollte eine Zuchtfarm für Strauße und europäisches Rassevieh verbunden werden. Bei allen meinen Reisen in Deutsch- und Britisch-Ostafrika hatte ich auf[S. 129] den vielen Farmen, die ich besuchte, auch der Haustierzucht ein aufmerksames Auge geschenkt. Ich fand, daß die Farmer in Britisch-Ostafrika, die von ihren Regierungsstationen gute Zuchttiere erhielten, bedeutend weiter in der Viehzucht vorgeschritten waren als unsere Ansiedler. Die Zuchtversuche in Deutsch-Ostafrika lagen in den Händen der einzelnen Farmer und waren noch nicht über das Anfangsstadium der Entwicklung hinausgekommen. Tierzuchtversuche in großem Maßstabe zu betreiben, geht aber bei den wertvollen und kostspieligen importierten Rasseexemplaren über die Kräfte des einzelnen hinaus. Dazu herrschen in bezug auf die Einfuhr ausländischer Tiere in unserer Kolonie infolge der vielen Haustierkrankheiten, die teils in Afrika heimisch sind, wie Rinderpest und Küstenfieber, Pferdesterbe usw., teils von ausländischen Haustieren eingeschleppt werden, strenge Vorschriften. Es müssen alle einzuführenden Tiere in den Hafenstädten Daressalam, Tanga usw. eine Quarantäne von vier Wochen durchmachen, ehe sie freigegeben werden.
Gerade diese Quarantäne in den heißen und ungesunden Küstenstädten ist aber völlig verkehrt. Einige deutsche Farmer haben mit schweren Kosten Haustiere aus ihrer Heimat kommen lassen, die in Tanga und Daressalam in Quarantäne blieben. Natürlich waren diese Tiere völlig gesund und ärztlich geprüft in Hamburg verladen worden, aber durch die lange Seefahrt und noch mehr in der vierwöchigen Quarantäne im tropischen Klima unserer afrikanischen Hafenstädte in ihrer Gesundheit geschädigt worden. Meines Wissens sind die Tiere dann meistens in kürzester Zeit eingegangen. Welcher Verlust an Zeit und Geld für die Farmer!
Um diesem Übelstande gründlich abzuhelfen, müßte daher die Quarantänestation in das Hochland verlegt werden. Dort könnten dann die Tiere in einem abgegrenzten Gebiete ohne Schaden die strengste Quarantäne bestehen, denn es herrschen in den Hochländern Afrikas ähnliche klimatische Bedingungen wie in der Heimat,[S. 130] was für die zukünftige Verwendung der Tiere maßgebend ist. Die Hauptaufgabe wäre, eine kräftige, widerstandsfähige Milchkuh zu schaffen, denn die einheimischen Rinderrassen geben sehr wenig Milch, ohne Kraftfutter nur 1–2 Liter täglich. Ferner sollten die Farmer bei Ersparung aller Importunkosten und des großen Zeitverlustes geeignete Zuchttiere, wie Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Schweine sowie Geflügel jederzeit aus der Kolonie selbst beziehen können.
Alle diese Umstände gaben mir den Gedanken ein, meine Ideen und meinen Plan Herrn Hagenbeck vorzutragen, der nicht nur in Deutschland große Haustierzuchten betreibt, sondern auch nach allen Ländern der Welt Rassetiere exportiert. Herr Hagenbeck interessierte sich aufs lebhafteste für das Unternehmen und sagte mir seine Beteiligung zu. Nach eingehender Besprechung einigten wir uns zu einem gemeinschaftlichen Betrieb einer Tier- und Haustierzuchtfarm in Deutsch-Ostafrika.
Als günstigsten Platz zur Errichtung dieser Tierzuchtfarm hatte ich das Gebiet am Meru erkannt. An den Abhängen dieses Berges, etwa 1400 Meter über dem Meeresspiegel, liegt ein nach Westen zu sich wellenförmig hinziehendes Gelände, durch welches sich ein kleiner Gebirgsfluß hinschlängelt. „Engare ol Mtonje“ ist sein Name, d. h. „Wasser der Geier“. Eine Sage ist mit diesem Namen verknüpft. Hier an diesem Wasser spielte sich einst ein blutiger Kampf zwischen den Masais und dem Wameru-Stamme ab, aus dem die Masais siegreich hervorgingen. Viele Hunderte von Kriegern wurden niedergemetzelt, und die Geier versammelten sich auf dieser Kampfstätte in solchen ungeheuren Massen, daß die Gefallenen von ihnen alle aufgezehrt wurden. Lange Zeit hindurch sollen große Geieransammlungen sich dort gehalten haben, weshalb das Gewässer diesen Namen zum Andenken an jene Schreckenstage bewahrt hat.
An dieser Stelle wollte ich das Unternehmen ins Leben rufen[S. 131] und mir eine neue Heimat gründen. Meine Frau, als gute Tierfreundin, hatte sich schon längst bereit erklärt, mir in die afrikanische Wildnis zu folgen und mit mir die harten Pionierarbeiten zu teilen. Mit Zustimmung der Kolonialregierung hatte ich bereits ein Gelände von 2000 Hektar belegt. Die ganze Gegend ist absolut tsetsefrei, infolgedessen wird daselbst von den Ansiedlern und Eingeborenen große Viehzucht betrieben. Der jungfräuliche, mit üppigem, immergrünem Graswuchs bestandene Lavaboden ist äußerst ertragreich, und das Klima bekommt dem Europäer gut.
Im November 1911 reisten wir von Deutschland unter Mitnahme eines deutschen Assistenten ab. Gleichzeitig nahmen wir schon einen Teil der Zuchttiere mit, während der Rest nach Fertigstellung der erforderlichen Einrichtungen später nachkommen sollte. Auch die notwendigsten landwirtschaftlichen Maschinen, Ackergeräte, Werkzeuge, Drahtgeflechte für Tiergehege usw. waren bereits verladen. Hoffnungsfreudig traten wir die Seereise an, und nach einer prächtigen Fahrt liefen wir wohlbehalten in Tanga ein. Tiere und Sachen wurden hier an Land geschafft. Ich selbst reiste mit meiner Frau nach Daressalam weiter, um dort bei der Regierung meine Angelegenheiten betreffs der Tierzuchtfarm zu erledigen. Als dies geschehen war, mußten wir noch 14 Tage dort verweilen, ehe sich eine Gelegenheit zur Rückreise bot. Gerade am heiligen Abend trafen wir wieder in Tanga ein. Schon an Bord des Dampfers hatte eine fröhliche Weihnachtsstimmung geherrscht, die sich abends am Lande noch steigerte, als die alten Weihnachtslieder unter dem lichterglänzenden Tannenbaum erklangen. Was? — Tannenbäume in Ostafrika? ruft vielleicht so mancher ungläubig aus. Und doch hat es damit seine Richtigkeit, liebe Leser. Wohlverwahrt in den Kühlräumen des Ozeanriesen kommen die Kinder des deutschen Waldes herüber zum Palmengestade, dem heißen jungen Sonnenlande den Weihnachtsgruß der alten schneebedeckten Heimat zu überbringen.
[S. 132]
Nach den Feiertagen wurden die Zuchttiere und die mitgebrachten Sachen nach Neu-Moschi verladen und unter Aufsicht meines Assistenten vorausgeschickt. Mit dem nächsten Zuge reisten auch meine Frau und ich in das Innere. Trotz der tropischen Hitze ist es ein Genuß, die interessanten Landschaftsbilder während der Fahrt vorbeigleiten zu sehen. Wie durch einen grünen Tunnel fährt der Zug unter Kokospalmen dahin. Dazwischen liegen die Felder der Eingeborenen, auf welchen Mais-, Bananen-, Mohogo-, Süßkartoffelpflanzungen angelegt waren. Bald wechseln Kautschuk- und Sisal-Pflanzungen in bunter Folge miteinander ab. In gleichem Abstande stehen die Reihen der Gummibäume sowie die der Sisalagaven voneinander entfernt, und wie lange Strahlen scheinen die einzelnen Reihen am Zuge vorüberzuhuschen. Überall Ordnung, Leben und Arbeit. In den geschlossenen Beständen der dichtbelaubten Kautschukbäume, durch deren Kronen nur wenig Sonnenstrahlen durchdringen, sieht man geschäftig Neger den weißen Saft aus den Stämmen zapfen und den erstarrten Kautschuk in Ballen rollen. In den jungen Anlagen wird gereinigt, das heißt, mit breiten Hacken wird das üppig wuchernde Gras und Unkraut entfernt. In den Sisalpflanzungen schneiden die Arbeiter mit langen Messern die reifen Blätter, welche, zu Bündeln geschnürt, auf Feldbahnwagen der Fabrik zur Aufbereitung zugeführt werden. Die Wege sind meistens mit schattigen Mango- oder Eisenholzbäumen bepflanzt. Auf einer Anhöhe, aus dem Grün heraus, leuchtet hell und freundlich das Wohnhaus des Pflanzers. Vom Bahnhof Ngomein aus sieht man die blauen Berge Ost-Usambaras herüberwinken, zu deren Füßen die nächste Station, Muheza, in dem fruchtbaren und reichbevölkerten Bondeland liegt. Jedem Durchreisenden muß es hier auffallen, in welch großen Mengen Früchte an den Zug gebracht werden; goldgelbe Apfelsinen, Mandarinen, herrlich duftende Ananas, schwere Trauben von gelben, roten und grünen Bananen, Papayen, Melonen,[S. 133] Kürbisse, dicke Bündel Zuckerrohr u. a. m. liegen hier aufgestapelt und werden zum Verkauf angeboten. Schaulustig drängt sich die eingeborene Bevölkerung an den Zug heran, um Freunde oder Bekannte zu begrüßen oder wohl selbst auf der so beliebten „ngari ya snoschi“ (Eisenbahn) eine Strecke zu fahren. Ein buntes Leben und Treiben! Die Weiber in ihren farbig bedruckten Tüchern, mit goldglänzenden, langen Ketten um den Hals, machen einen sauberen Eindruck. Auch manche Schöne ist darunter, sie wiegt sich anmutig in den Hüften und würde wohl von vielen unserer Modedamen um ihre Figur und natürliche Grazie beneidet werden. Die Männer tragen meistens lange Kanzu oder baumwollene Hemden und um die Hüften das buntgesäumte Lendentuch, dazu die typische weiße Suahelimütze oder einen roten Fez. Träger, die Lasten zur Station bringen oder solche holen, kauern, nur mit einem Lendentuch bekleidet, um das Stationsgebäude herum. Um den Kopf haben sie turbanartig ihre Schlafdecke gewunden. Ein umgehängter Topf, ein Messer und eine Kürbisflasche vervollständigen ihre Reiseausrüstung. Ein Pfiff, und unser Zug setzt sich unter Tücherschwenken und Trillern der Weiber wieder in Bewegung. Weiter geht es durch üppige Felder und Pflanzungen, und näher an die Bahn treten die bewaldeten Berge Usambaras heran, in die bei der Station Tengeni eine Schmalspurbahn hinauf nach Sigi, nahe dem schönen Amani, abzweigt. Weiter eilt unser Zug, um bei Mauri den Pangani zweimal zu kreuzen, und nach sechsstündiger Fahrt ist die Station Mombo erreicht, wo das Mittagsmahl eingenommen wird.
Gegen Abend kamen wir in Buiko an. Hier blieb der Zug liegen, da damals der Nachtverkehr noch nicht eingerichtet war. Wir begaben uns in das dortige kleine Hotel, wo fröhliche Stimmung bis spät in die Nacht hinein herrschte. Die Temperatur war schon merklich gefallen. Nach erquickendem Schlafe und Einnahme des Frühstücks setzten wir am nächsten Morgen die Weiterreise[S. 134] fort. Nur wenige europäische Fahrgäste befanden sich noch in dem Zuge, der größte Teil war in Mombo ausgestiegen, um von dort nach Wilhelmstal oder in das Usambaragebirge zu gelangen. Das Landschaftsbild hat sich allmählich vollständig geändert. Zur Rechten steigen die steilen und kahlen Berge des Paregebirges auf, während sich zur Linken durch savannenartige Steppe der Pangani hindurchschlängelt. Auf den Gräsern und Sträuchern der sonnenbestrahlten Steppe glitzern wie Diamanten die Tauperlchen des Morgens. Ab und zu erblickt man einige Antilopen und Strauße. In der Buschsteppe hausen, dem Auge verborgen, Nashörner, Giraffen und viel anderes Wild. Jedoch kann der Reisende, ähnlich wie an der Ugandabahn, Wasser- und Riedböcke, Kongonis und sonstige Vertreter der afrikanischen Fauna vom Zuge aus beobachten, da das Wild sich auch hier bereits an den Bahnverkehr gewöhnt hat. Die hiesige Gegend ist von der Regierung zum Wildreservat erklärt worden. An Bedeutung steht dasselbe allerdings dem großen englischen Reservate an der Ugandabahn weit nach. Es soll mitunter vorkommen, daß sich Giraffen auf das Geleise legen und sich nur durch schrille Pfiffe der Lokomotive des langsam fahrenden Zuges unwillig aus ihrer Ruhe stören lassen. Ein Lokomotivführer erzählte mir, daß sogar einmal ein Nashorn den Kampf gegen die Lokomotive aufnehmen wollte. Das Tier rannte gegen die Maschine an, wurde von ihr zur Seite geschleudert und sah, nachdem es einige Purzelbäume geschlagen hatte, ganz erstaunt seinem dampfenden und feuerspeienden Gegner nach. Man braucht diese Erzählung durchaus nicht in das Reich der Fabel zu verbannen, zumal wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Nashörner Geschöpfe von äußerst cholerischem Temperament sind. Häufig hatte ich selbst auf meinen Streifzügen Gelegenheit gehabt, die Launen dieser unberechenbaren Tiere kennenzulernen. Öfters sieht man auf Nashornwechseln herausgedrehte Bäume und Büsche, sogar aus ihrer Lage gebrachte[S. 135] mächtige Steine, an denen das Nashorn mit seinem Horn, sei es nun aus Übermut oder aus Wut, sein Mütchen gekühlt hat. Es würde zu weit führen, wollte ich alle derartige Einzelheiten beschreiben.
Gegen Mittag erreichten wir die Endstation Neu-Moschi. Wir befinden uns hier wohl an einem der schönsten und interessantesten Punkte Afrikas. Von einer üppigen tropischen Vegetation umgeben, blickt man hinauf in die ewige Schnee- und Eisregion des Kilimandjaros. Leider standen zu dieser prachtvollen Natur die Unterkunfts- und Verpflegungsverhältnisse, welche wir hier vorfanden, in keinem Verhältnisse. Das damalige „Grand-Hotel“ war eine schmierige Lehmbude mit einigen Abteilungen, teils mit, teils ohne Wellblechbedachung. Der Eigentümer war ein Grieche, und ebenso armselig wie seine Behausung war seine Küche. Jedenfalls war der Ort im damaligen Zustand so recht geeignet, meiner Frau alle Illusionen über Afrika auf das richtige Maß herabzusetzen. So primitiv auch alles war, mußte doch jeder, der keine eignen Zelte und Träger mitführte, froh sein, bei der Ankunft in Neu-Moschi in besagter Lehmbude Unterkunft zu finden.
Einige Tage später trafen die für uns und unser Gepäck bestimmten Ochsenfuhrwerke aus Aruscha ein. Wir hatten jetzt den letzten, aber auch den schlimmsten Abschnitt unserer Reise vor uns. Neunzig Kilometer waren noch zurückzulegen. Die Fahrt auf einem Ochsenwagen über Berge, durch Schluchten und Flußbetten ist gerade kein sonderliches Vergnügen, besonders nicht für eine Frau, die frisch aus Europa kommt. Die mannshohen Räder gehen oft über meterhohe Felsbrocken, so daß der nicht verstaute Inhalt des Wagens bald nach links, bald nach rechts geworfen wird. Zu diesem nicht verstauten Inhalt gehört selbstverständlich auch der Passagier. Ferner wirkten gerade jetzt in der trockenen Jahreszeit die Hitze und der von 30 Ochsen aufgewirbelte Staub, der den Wagen in eine dicke Staubwolke hüllte, fast unerträglich.
[S. 136]
Am Sanga-Flusse rastend, wollte ich meinen von Deutschland mitgebrachten Zuchtgänsen das schon lange entbehrte Bad gönnen. Wir ließen die Vögel aus ihrem Käfig heraus und freuten uns herzlich, wie sie sich lebhaft in den klaren Fluten tummelten. Plötzlich tauchte ein Krokodil auf, erfaßte eine Gans und war im nächsten Momente mit seinem Raub verschwunden. Schnell liefen wir mit den Gewehren hinzu und ich sah im klaren Wasser an der steilen Uferwand deutlich einen weißen Flecken auf dem etwa zwei Meter tiefen Grunde. Ich zielte dorthin, wo ich den Kopf des Krokodils vermutete. Kaum war der Schuß gefallen, als die Gans wieder auf der Oberfläche erschien, allerdings mehr tot als lebendig. Da sie nicht mehr zu retten war, wurde sie sofort in einen Braten umgewandelt. Froh war ich, daß das Krokodil nicht meinen einzigen Gänserich erwischt hatte, da sonst die ganze Gänsezucht in Frage gestellt worden wäre. Die hier verbreitete Ansicht, daß im oberen Sanga-Fluß keine Krokodile vorkämen, war somit aufs schlagendste widerlegt.
Der Kühle halber reisten wir nachts und brauchten so unsere Tiere nicht der Tageshitze auszusetzen. Wir hatten den Domberg bereits hinter uns, und ich hatte Zeit und Gelegenheit, einiges Wild für unsere Küche zu erlegen. Ein Riedbock war das erste afrikanische Wildbret, das meine Frau zu kosten bekam.

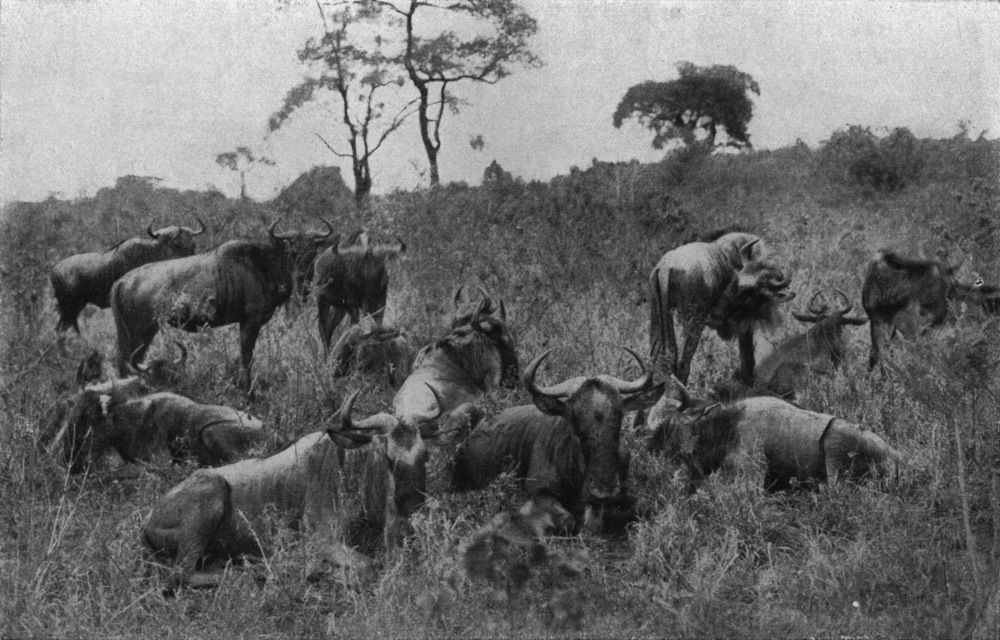
Nach sechstägiger Fahrt langten wir an unserem Ziele an. Vorläufig wohnten wir in Zelten. Für die mitgebrachten Tiere mußten provisorische kleine Gehege mit Schutzdächern errichtet werden. Es gab Arbeit in Hülle und Fülle. Für das Wellblechwohnhaus war ein Platz auf einem Hügelrücken ausersehen. Die großen Laufgehege für die Strauße wurden ausgemessen und eingefriedigt. Schwarze Arbeiter waren damit beschäftigt, Bambus und Holz aus dem nahen Urwalde zu holen oder Bausteine heranzubringen, um zu behauen. Fundis (Handwerker) bauten provisorische Stallungen für die Tiere und Hütten für die Schwarzen. Andere Arbeiter[S. 137] rodeten das zu Kulturzwecken gewählte Land, und bald zog der ochsenbespannte Pflug zum ersten Male seine Furchen durch den jungfräulichen Boden. Wassergräben wurden gezogen, Luzerne- und Maisfelder angelegt, Kartoffeln und Gemüse gepflanzt, und in wenigen Wochen prangte alles in üppigem Grün. Reges Leben herrschte überall, und mit zäher Energie und Ausdauer wurde jedes Fleckchen Erde verteidigt, denn die Natur sucht jedes Stückchen abgerungenes und unter Kultur gebrachtes Land fortwährend wieder an sich zu reißen.
Trotz der Abgeschlossenheit von der Außenwelt und der harten Pionierarbeit fühlte sich meine Frau doch bald heimisch, und mit Freude sahen wir das angefangene Werk aufblühen. Ein erhabenes Gefühl überkam uns, wenn wir von unserem noch primitiven Haus aus bei untergehender Sonne unsere Farm überblickten. Von den letzten Strahlen der Abendsonne beleuchtet, liegt der 4630 Meter hohe Merukegel in all seiner majestätischen Pracht vor uns. Deutlich kann man noch mit dem Glase die Urwaldregion von den höher liegenden Zedern- und Bambuswäldern unterscheiden. Aus den ganz unten liegenden Bananenhainen steigt der Rauch aus einigen Negeransiedlungen empor. Im Westen, nur wenige Stunden von uns entfernt, ragt der dunkel bewaldete Gebirgsstock des Rascha-Rascha empor; in scharfen Linien hebt er sich vom Horizonte ab. Nach Süden zu liegt die große offene Masaisteppe vor uns, aus der in weiter Ferne einige Höhenrücken emporsteigen. Die am Meru-Berge wohnenden Waruscha ziehen mit ihren Viehherden, von der Weide kommend, nach den im Urwald liegenden Behausungen. Eine feierliche Abendstimmung liegt über allem; der rote Sonnenball taucht allmählich am Horizonte unter, und nach einer kurzen Dämmerung senkt sich die Nacht herab. Es wird merklich kühl, und die Grillen und Frösche beginnen ihr nächtliches Konzert.
Für die Entbehrungen, die man mit in Kauf nehmen muß,[S. 138] wird hier der Naturfreund aufs reichlichste entschädigt. Täglich gab es Neues und Interessantes zu beobachten. Die Vogelwelt zeigte fast gar keine Scheu vor uns. Goldgrün schillernde Nektariniden (Honigsauger) kamen dicht an das Haus heran, um aus den Blumenkelchen den süßen Saft zu saugen; unzählige, buntgefärbte Bienenfresser haben ihre Brutplätze in den Uferböschungen des Flusses. In einem Baume dicht am Hause hatte eine Kolonie Webervögel Hunderte von Nestern gebaut und waren eifrigst dabei, ihre Nachzucht zu pflegen. Bachstelzen, Schwalben und Störche erinnern uns an die deutsche Heimat. Zwischen den Pferden und Rindern stolzieren Trappen und Schlangengeier herum, und man kann bis auf wenige Meter an sie herangehen; denn sie wissen, hier wird ihnen nichts zuleide getan. Scharenweise treiben sich am Gewässer unter lautem Gekreische die Kiebitze herum. Natürlich fehlen auch die gefiederten Räuber nicht. Ständig umkreisen Sperber, Habichte, Milane und weißnackige Raben unseren Hühnerhof, aber ohne Erfolg, denn der Kückenhof ist mit Drahtgeflecht überdacht. Große Scharen buntgefärbter Körnerfresser verheeren die Weizenfelder. Zur Reifezeit müssen fortwährend Feldwachen tätig sein, um die Vögel zu verscheuchen. In den reifenden Kulturen stellen sich aber auch bald vierbeinige ungebetene Gäste ein. Ein Paar Stachelschweine kamen regelmäßig nachts in den Kartoffelacker. Obwohl ein großes Kartoffelfeld vorhanden war, suchten sie sich gerade die beiden Reihen aus, wo ich eine bestimmte, importierte Sorte gepflanzt hatte. Alles Fallenstellen war vergeblich; beinahe hatten sie mir schon die wertvolle Aussaat vernichtet, als ich als letztes Mittel den Selbstschuß versuchte. Gleich in der ersten Nacht brachte sich ein Stachelschwein selbst zur Strecke und wurde von meinen Wanyamwesi-Negern am nächsten Morgen gebraten und verspeist. In der darauffolgenden Nacht fiel abermals ein Schuß, und ich freute mich schon, daß ich am nächsten Morgen den zweiten Übeltäter[S. 139] finden würde; aber zu meinem Erstaunen sah ich, daß ein Schakal das Pech gehabt hatte, sich in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Höchstwahrscheinlich hatte er sich durch den Schweiß des erlegten Stachelschweines anlocken lassen, wobei er mit seinem Fange die Abzugsleine berührt und so den tödlichen Schuß ausgelöst hatte. Die am Fluß hausenden Wildschweine hatten auch bald die Maisfelder ausgefunden und richteten an dem beinahe reifen Mais großen Schaden an. Diesen Tieren steht man fast machtlos gegenüber. Gute Hunde und Wächter mit Blechtrommeln sind wohl noch die besten Abwehrmaßregeln. Gegen kleineres Raubzeug, das es hauptsächlich auf das Geflügel abgesehen hatte, wie Ichneumons (Pharaonsratte), Bandiltisse, Schakale usw. bewährten sich die Kastenfallen ausgezeichnet. Sogar zwei Dachse hatten sich einmal darin verirrt. Die Abteilungen für das Kleingetier begannen sich allmählich zu füllen. Dazu brachten die Schwarzen aus dem nahen Urwald braune Meerkatzen, die hier am Meruberg sehr zahlreich auftreten, sowie Erdhörnchen, Stachelschweine, Igel, silberglänzende Wurzelratten und viele Vögel.
In den Volieren vollführte die buntgefiederte Vogelwelt ein nicht gerade angenehmes Konzert. Klangvolle Stimmen und liebliches Gezwitscher wurden durch Gekrächze, Gekreisch, Geschrei und alle möglichen anderen Tierstimmen übertönt. Vögel von prachtvollster Farbentönung bis zum einfachen Grau flatterten, kletterten und liefen in den Käfigen bunt durcheinander, darunter grüne Turakos, weißnackige Raben, Glanzstare, kleine und große Waldtauben, Webervögel aller Arten, dazwischen der rote Feuerweber, graue Mausvögel, Witwenvögel, große Hornraben, Ibisse, Sporengänse, Frankoline und viele andere mehr.
Kleine erfolgreiche Tierfangzüge in unmittelbarer Umgebung der Farm lieferten auch bald Bewohner für die Großtiergehege. Giraffen, Zebras, Oryxantilopen, Ried- und Buschböcke, alte und junge Strauße bevölkerten nach und nach die eingegatterten Flächen.[S. 140] Hinter dem Hause, in einem buschigen Gelände, hatten mehrere Rudel Riedböcke ihren Standplatz. Einer dieser Böcke hatte herausgefunden, daß in unserem Gehege eine zahme Ricke gehalten wurde. Fast jede Nacht kam er an das Gitter und suchte durch laute Pfiffe das Weibchen an sich zu locken. Ich ließ das völlig zahme Weibchen, das mit der Flasche aufgezogen worden war, zuweilen auch außerhalb des Geheges äsen, und eines schönen Tages war es mit seinem Kavalier auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
An dem angelegten Rieselgraben hatte ein Nashorn eine neue Tränkestelle gefunden. Seiner Fährte folgend, fand ich einige Kilometer vom Hause entfernt in einem dichten Busch mehrere dieser Dickhäuter vor. Ich ließ die Tiere in Ruhe, in der Hoffnung, daß sie mir fangbare Junge liefern würden. Die Rhinozerosse haben sich auch wenig um uns bekümmert, und 1914 waren sie noch alle vorhanden.
Vor dem Hause dehnten sich die 1½ Kilometer langen und 100 Meter breiten Laufkrale der Strauße aus, die bereits von 30 Stück dieser Riesenvögel bevölkert waren, welche ich schon früher von einem Farmer übernommen hatte. Sie waren ganz zahm und zutraulich. Wenn die Arbeiterglocke ertönte, kamen die Strauße in vollem Laufe herangerannt, denn sie wußten ganz genau, daß dies gleichzeitig ihr Signal zum Füttern war. Jeder Strauß erhielt pro Tag (abgesehen von der Nahrung, die er sich tagsüber auf der Weide suchte) als Zugabe noch einige Pfund Kraftfutter, wie Mais, Getreide usw.
Eine Straußenzucht rentabel zu betreiben, ist durchaus keine leichte Sache. Der Strauß wird nur seiner Federn wegen gezüchtet, die einen hohen Handelswert besitzen. Die schwarzen und weißen Federn stammen von den Hähnen, wohingegen die Hennen graue Federn liefern. Verwertet werden in erster Linie die an Flügeln und Stoß sitzenden großen Schmuckfedern. Die Federn[S. 141] der wilden Strauße stehen an Schönheit und Güte weit hinter denen ihrer zahmen, hochgezüchteten Verwandten zurück.
Am erfolgreichsten ist die Straußenzucht bis jetzt in Südafrika betrieben worden, jedoch bin ich der Ansicht, daß im Laufe der Jahre bei richtiger Zuchtwahl der an und für sich schöne und große ostafrikanische Strauß (Struthio masaicus Neumann) sich zu einem konkurrenzfähigen Federlieferanten heranziehen läßt. Unkenntnis in der Aufzucht und Behandlung der Vögel haben wohl dazu beigetragen, daß viele ostafrikanische Farmer der angefangenen Straußenzucht wieder überdrüssig wurden. Es würde weit über den Rahmen dieses Buches hinausgehen, wenn ich hier eine längere Abhandlung über den rationellen Betrieb einer Straußenfarm schreiben wollte. Es liegt über dieses Thema bereits eine gute und ziemlich umfangreiche Literatur vor, so daß ich mich darauf beschränken kann, einige maßgebende Gesichtspunkte hervorzuholen.
Der Strauß bedarf zu seinem Wohlergehen großer geräumiger Gehege, auf denen er dieselbe Nahrung findet, wie sie ihm die freie Steppe bietet, also vor allen Dingen genügend Grünfutter. Sodann muß der Boden reichlich kleine Steinchen enthalten, die der große Vogel zur Förderung seiner Verdauung gern aufnimmt, wovon man sich bei der Sektion eines Straußenmagens immer wieder überzeugen kann. Auch sonstige Fremdkörper, wie z. B. kleingehackte Knochen oder Muscheln, werden von den Vögeln gern verschluckt. Sehr wichtig ist es ferner, daß die Strauße in ihren Laufkralen Gelegenheit zu Sandbädern haben, die zur Erhaltung ihrer Gesundheit unbedingt erforderlich sind. Auch sonst muß man auf letztere ein wachsames Auge haben und den Tieren öfters Medikamente verabfolgen, da sie häufig von Schmarotzern, namentlich von Eingeweidewürmern geplagt werden. Gegen Nässe sind sowohl die ausgewachsenen Strauße als auch die Kücken außerordentlich empfindlich. Bei drohendem Gewitterregen, welche[S. 142] hier ganz plötzlich auftreten, hatte meine Frau, die mir die Sorge für das Federvieh abgenommen hatte, stets alle Hände voll zu tun, um die Tiere schleunigst unter Dach und Fach zu bringen. Über die Fütterung habe ich schon oben gesprochen, möchte aber noch ergänzend bemerken, daß neben dem erwähnten Kraftfutter vor allem Luzerne eine wichtige Rolle bei der Ernährung spielt, welche Futterpflanze namentlich für die gedeihliche Entwicklung der Kücken unentbehrlich ist. Für Straußenzüchter ist also die Anlage großer Luzernefelder eine conditio sine qua non. Die Gesamtfuttermenge, welche man einem ausgewachsenen Strauß täglich verabreichen muß, kommt der Tagesration eines Pferdes gleich. Wie man hieraus ersieht, läßt sich der Betrieb ohne ein genügendes Anlagekapital nicht durchführen.
Im vierten Jahre erreicht der Strauß die Geschlechtsreife. Rückt die Paarungszeit heran, so werden die für die Nachzucht bestimmten Vögel in besonderen Abteilungen untergebracht, und zwar gesellt man einem Hahn 2–3 Hennen zu. Bei ersterem verfärben sich Hals und Ständer in ein schönes hellfarbiges Rot, und dumpf rollend und dröhnend läßt er seinen weithin hörbaren Balzruf ertönen. Die Hennen legen die Eier in ein gemeinschaftliches Nest. Das Brutgeschäft wird von beiden Geschlechtern ausgeführt. Nach etwa sechs Wochen schlüpfen die Kücken aus. Ihre Aufzucht ist keine leichte Sache. Sie bedürfen sorgfältigster Pflege und Aufsicht, sind aber sehr zutraulich und bereiten ihrem Züchter viele Freude. Stundenlang kann man zusehen, wie die hühnergroßen, schwarzgelb gefärbten Tierchen in ihrem stacheligen Kleid im Luzernefeld die Blätter abzupfen. Schnell wachsen die jungen Vögel heran, und nach etwa sechs Monaten sind sie schon imstande, die ersten Federn zu liefern, die aber nur einen geringen Handelswert besitzen.
Über die Federnernte, das Endziel der ganzen Bemühungen, ist kurz folgendes zu bemerken: Bei guter Pflege und Fütterung[S. 143] können die Federn alle sechs Monate geschnitten werden. Zu diesem Zwecke werden die Strauße in ein kleines Gehege getrieben, dort einzeln herausgegriffen und bekommen dann einen Strumpf oder Kapuze über den Kopf gezogen, die ihnen die Augen verdeckt. Sodann wird der Vogel in ein dreieckiges Gestell geschoben und festgehalten; die Flügel hängen über das Gestell hinaus, und die reifen Federn, welche man an den harten, trockenen Spulen erkennt, werden mit einer Schere abgeschnitten. Nach 4 bis 6 Wochen muß sich der Strauß diese Prozedur nochmals gefallen lassen, und jetzt werden ihm die vertrockneten Spulen, soweit er sie noch nicht selbst herausgepickt hat, mit einer Zange entfernt, damit die nachwachsenden neuen Federn nicht verkrüppeln. Hierbei muß man äußerst vorsichtig zu Werke gehen, und das Herausziehen der Spulen ist sofort zu unterlassen, sobald sich noch ein Bluttröpfchen an der Spitze der Kiele zeigt. Gerade Unkenntnis in der Ausübung des Federschnitts kann den Strauß für eine weitere Federproduktion vollständig wertlos machen. Schließlich möchte ich noch bemerken, daß die zur Nachzucht bestimmten Vögel einige Monate vor der Brutzeit ihrer langen Flügelfedern nicht mehr beraubt werden dürfen, da sie ohne dieselben das Brutgeschäft nur noch schlecht ausführen können.
Nach und nach waren weitere europäische Zuchttiere eingetroffen, und zwar: Schweine, Pferde, Esel zur Maultierzucht sowie zwei Bullen und zwei Kühe der bekannten Zebukreuzung von der kaiserlichen Domäne Cadinen. Füllen, Kälber und junge Esel freundeten sich derart mit Gnus und Elenantilopen an, daß sie gemeinsam auf die Weide getrieben werden konnten. Es gab sehr interessante Bilder, die afrikanischen und europäischen Haustiere friedlich neben dem eingefangenen Wilde weiden zu sehen oder sie in ihren munteren tollen Sprüngen und Spielen zu beobachten.
Durch den ständigen Umgang mit dem Menschen gewöhnen sich die Tiere bald an diesen, verlieren ihre Furcht und Scheu und[S. 144] werden sogar anhänglich. Die Grundbedingung hierfür ist eine ruhige, liebevolle Behandlung, durch welche der Pfleger sich in erstaunlich kurzer Zeit die Zuneigung der Tiere erwirbt, die ihn bald von anderen Personen zu unterscheiden wissen. Ein Füllen und eine junge Elenantilope, die unzertrennlich Freundschaft geschlossen hatten, verfehlten nie, morgens und abends an die Tür des Wohnhauses heranzukommen, um sich einen Leckerbissen abzuholen. Die jungen Nashörner waren natürlich bedeutend frecher; sie kamen ungeniert in das Haus, und wehe, wenn meine Frau nicht da war, um ihnen ein Stück Zucker zu verabfolgen. Stühle und Tische wurden einfach umgestoßen, und dabei ging einmal unsere einzige Tischlampe in Brüche. Meine Hunde waren mit allen Tieren vertraut und ließen sie ruhig gewähren.
Eine solche Aufzucht ist mit einer Kinderstube zu vergleichen. Große Sorgfalt, Umsicht und Verständnis sind erforderlich, um den Tieren ihre Freiheit zu ersetzen und sie am Leben zu erhalten. Jedes Stück muß individuell nach seinem Charakter und seinem Futterbedürfnis behandelt werden. Soviel wie möglich werden vorerst den Tieren ihre bisherigen Lebensbedingungen gelassen, um sie nach und nach an ein anderes Futter zu gewöhnen, das man auch auf die Reise mitnehmen kann. Nur auf diese Art und Weise ist es möglich, gesundes und lebenskräftiges Material für die zoologischen Gärten heranzuziehen.
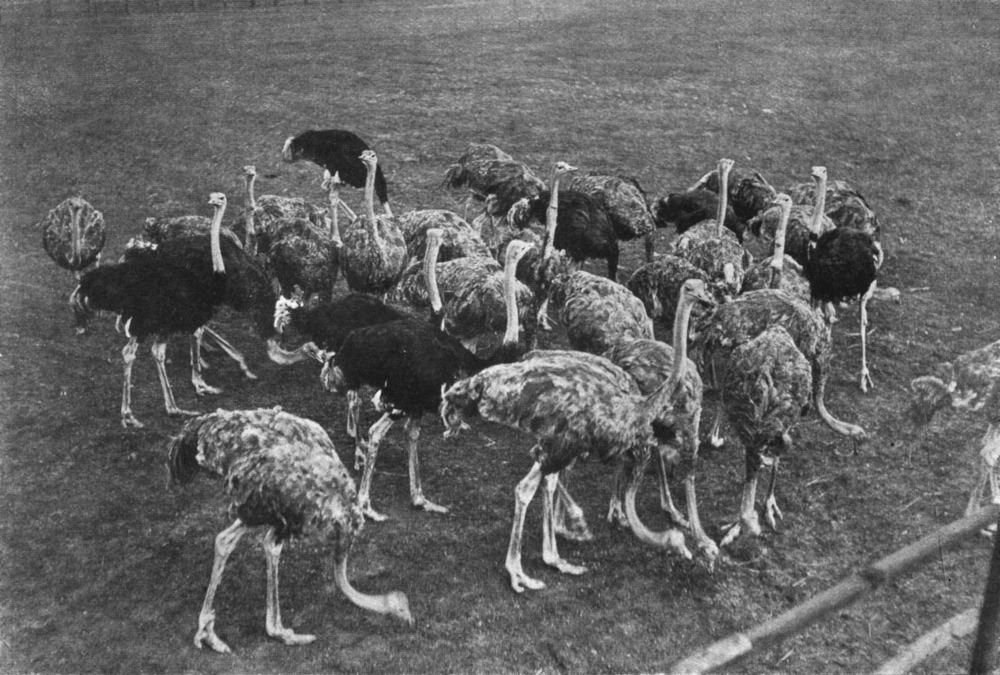

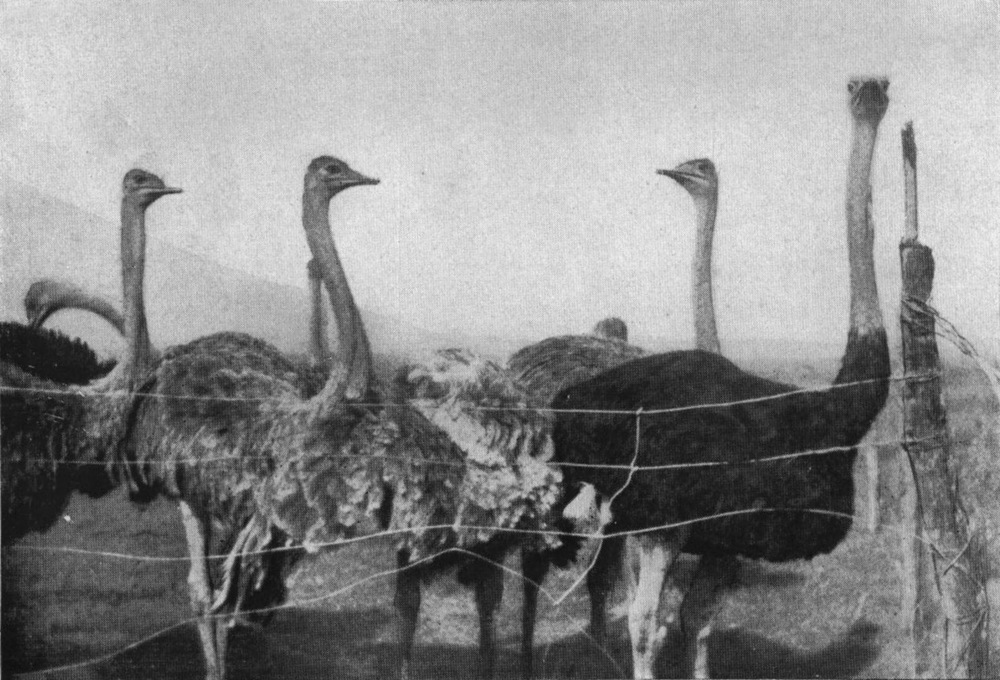
Trotz der harten Arbeiten und Entbehrungen der ersten Monate verminderte sich unsere Begeisterung für das herrliche Stück Erde nicht. Der fruchtbare Lavaboden brachte reiche Erträgnisse. Ohne Dünger gediehen alle europäischen Gemüse, wie Kartoffeln, verschiedene Kohlarten, Salate, Karotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Kürbisse, Tomaten, Rhabarber, Erdbeeren, Bohnen und Erbsen aufs prächtigste und in solcher Fülle, daß ich den Bedarf für uns und den Tierbestand aus den Erträgnissen der eignen Kulturen reichlich decken konnte. Ferner wurden Fruchtbäume, wie[S. 145] Pfirsiche, Baumtomaten, Feigen, Apfelsinen, Zitronen, Mandeln, Kapstachelbeeren, Äpfel- und Pflaumenbäume, Weinstöcke und Bananenstauden angepflanzt. Die Gehege und Wege ließ ich mit schattenspendenden Bäumen, wie Gerbakazien, Eisenholzbäumen, Eukalyptus u. a. m. bepflanzen. Die Gebäude wuchsen aus dem Boden, und zu Pfingsten siedelten wir vom Zeltlager in unser Wellblechwohnhaus über.
Nach und nach hatte ich mir einen Stamm schwarzer Arbeiter herangezogen. Am brauchbarsten für Land- und Farmarbeiten erwiesen sich die Wasukumaleute, dagegen fand ich unter den Wameru ganz intelligente Menschen, die sich für den Umgang mit den Tieren gut eigneten, trotzdem sie sonst unzuverlässig und faul sind.
Alle Arbeiten liefen unter guter Aufsicht in geregeltem Gange weiter, und ich schmiedete kühne Pläne, in wenigen Jahren eine Musterzuchtfarm auszubauen und unseren Kolonisten gutes Zuchtvieh an Ort und Stelle zu liefern. Mittlerweile rückte die Trockenzeit heran und so konnte ich auch wieder an größere Tierfangzüge denken.
[S. 146]

Zu dem eisernen Bestand eines jeden zoologischen Gartens gehört außer den „großen Kanonen“ wie Raubtiere, Dickhäuter, Wildrinder usw. auch eine Anzahl der afrikanischen Wildpferde, der Zebras. Vor ihren Gehegen kann man stets eine größere Ansammlung der Gartenbesucher antreffen, die sich an der eleganten Gestalt und den graziösen Bewegungen dieser gestreiften Equiden erfreuen. Eine möglichst vollständige Musterkollektion der verschiedenen Arten der Gattung „Zebra“, wie sie beispielsweise der Berliner Garten aufweist, bietet dem denkenden und sich fortbildenden Naturfreund das schönste vergleichende Anschauungsmaterial, das er nur finden kann. Hier und da, z. B. im Stellinger Tierpark, werden Zebras auch zu einer kleinen Rundfahrt vor[S. 147] einen leichten Wagen gespannt, ein Entzücken für jedes Kinderherz. Auch von Wandermenagerien und Zirkussen werden die hübschen Tigerpferde gern begehrt. Kein Wunder, daß daher im Tierhandel nach diesem Artikel stets eine lebhafte Nachfrage herrscht. Für mich, der ich in der Heimat der Tiere meinen Wohnsitz hatte, war also die Aufgabe klar vorgezeichnet: Es galt eine entsprechende Anzahl Zebras zu fangen und nach Deutschland zu schicken, um so den Bestand meiner Firma stets auf der erforderlichen Höhe zu halten.
Die zur Familie der pferdeartigen Tiere (Equiden) gehörige Gattung „Zebra“ (Hippotigris) ist in vielen Arten fast über das ganze tropische und subtropische afrikanische Steppengebiet verbreitet. Ich kann natürlich nicht auf eine Beschreibung der sämtlichen Spezies eingehen, sondern begnüge mich damit, auf einige der häufiger vorkommenden Arten kurz hinzuweisen.
Somaliland, Abessynien und der nördliche Teil von Britisch-Ostafrika sind die Heimat des Grevy-Zebras (Hippotigris grevyi Oustalet). Diese Form ist der größte Vertreter der ganzen Gattung, besitzt eine außerordentlich dichtgestreifte Decke und zeigt in ihrem Aussehen, wie die südafrikanische Form (H. zebra L.) einen gewissen Eselcharakter, während alle übrigen Arten sich mehr dem Habitus der eigentlichen Pferde nähern. In Südafrika finden wir Chapmans Tigerpferd (H. chapmani Layard), dessen Verbreitungsgebiet sich nördlich bis zum Sambesi erstreckt. Doch wird sein Vorkommen auch in der Gegend des Nyassasees vermutet. Sollte sich dies bestätigen, so wäre genanntes Zebra auch für die Fauna Deutsch-Ostafrikas, wenn auch nur für ein kleines Gebiet, in Anspruch zu nehmen. Sicher nachgewiesen sind in unserer Kolonie bis jetzt drei Spezies der Gattung Hippotigris, nämlich Böhms Zebra (H. böhmi Mtsch.), Grants Zebra (H. granti de Winton) und das Muansazebra (H. muansae Mtsch.). Diese drei Formen ähneln sich in ihrem Aussehen außerordentlich und weisen[S. 148] nur geringe Unterschiede auf. Die Grundfarbe der Tiere ist weiß, zwischen Schulter und Hüften finden sich durchschnittlich sieben breite schwarzbraune Querbinden, die Beine sind bis ungefähr zu den Hufen herab ebenfalls gestreift. Im ausgewachsenen Zustande übertrifft Böhms Zebra seine Verwandten etwas an Größe. Ein kurzes Beispiel möge genügen, um den Unterschied in der Körpergröße zu illustrieren: Die Schädellänge von Böhms Zebra ist stets größer als 50 Zentimeter, während sie bei Grants Zebra nur knapp an diese Zahl heranreicht. Bezüglich des Verbreitungsgebietes der beiden Arten ist zu bemerken, daß wir Böhms Zebra im Süden und in der Mitte der Kolonie antreffen, hier vorzugsweise in der Mkattasteppe. Ferner kommt es im südlichen Teile der Masaisteppe vor, sowie in den Landschaften, die sich nördlich des Pangani von der Küste zum Kilimandjaro hinziehen. Grants Zebra ist ein Bewohner der nördlichen Masaisteppe. Hierbei ist allerdings zu bemerken, daß die Grenzen der Verbreitungsgebiete dieser beiden Spezies noch nicht mit völliger Sicherheit und Genauigkeit festgestellt sind. In den Steppen westlich des Meru, in denen ich meine Fangzüge zu unternehmen gedachte, hatte ich jedenfalls nur mit dem Vorkommen von Grants Zebra zu rechnen.[1] Über die Art und Weise, wie ich die Tiere in meine Gewalt brachte, mögen die folgenden Zeilen ein Bild geben.
[1] Im Südosten des Viktoriasees kommt die aus den Sammlungen Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg zuerst bekannt gewordene Spezies H. muansae vor.
Ich machte mehrere Streifritte in die Steppe und lernte hierbei in der am Südwestabhang des Meru liegenden Burenansiedlung Oldonje-Sambu einen sehr zuverlässigen Buren, Herrn Adrian de Beer, kennen, der mir mit seiner Familie bei den weiteren Fangzügen sehr gute Dienste leistete. Seine Farm bot mir die letzte und günstigste Wasserstelle. Ich ließ daher in der Nähe seines Wassergrabens, den er für seine Haustiere angelegt hatte,[S. 149] einen kleinen Kral errichten, um daselbst die gefangenen Tiere unterzubringen.
Die etwas tiefer gelegene Steppe ist von Tausenden von Zebras belebt, und in der Trockenzeit haben diese Tiere ihre Tränke an den angelegten Gräben, die von den Quellen des Meruberges ständig gespeist werden.
Zunächst erkundeten wir das Gelände, beobachteten die Zebras und stellten somit die besten Fangplätze fest. Bei einem solchen Ritt sahen wir bei untergehender Sonne drei kapitale Löwen in einer Entfernung von 400 Meter auf einem Hügel vor uns auftauchen. Zuerst äugten die drei Katzen uns an; ich rief meinem Gewehrträger zu, rasch das Gewehr zu bringen, aber mein Schuß ging fehl und die Bestien verschwanden in weiten Fluchten im Gebüsch der Steppe. So hatte meine Frau, die mitgeritten war, unverhofft zum ersten Male den König der Wildnis in freier Steppe gesehen. In den folgenden Tagen ging der Zebrafang mittelst Lasso los.
Die hierzu verwendeten Lassos haben nicht die Länge der in den amerikanischen Steppen bei der Jagd auf wilde Pferde verwendeten; sie werden auch nicht geworfen wie diese. Man befestigt sie auf langen dünnen und leicht zerbrechlichen Fangstöcken in der Weise, daß Schlinge und Laufring sich an der Spitze des Stockes befinden. Guter Reiter und schnelles Pferd sind unerläßliche Bedingungen für das Gelingen des Fanges, denn die Zebras sind, wie alle Steppentiere, schnelle und ausdauernde Läufer. Nur muß der Reiter, wie beim Giraffenfang, möglichst nahe an die Herde heranreiten, wobei er sich hinter dem Hals des Pferdes versteckt, denn vor dem Pferde selbst scheuen die Zebras weniger. Sobald sie aber den Reiter wittern, ergreifen sie die Flucht. In diesem Moment heißt es ohne Besinnung vorwärts. Das Pferd erhält die Sporen und saust in voller Karriere mitten in die Herde hinein, in die Nähe der ausgesuchten Jungen. 5 bis[S. 150] 6 Monate alte Fohlen sind die beste Beute. Man darf sie aber keinen Augenblick aus den Augen lassen, was leichter gesagt als getan ist, denn wenn die Herde Zebras im Galopp die Flucht ergreift und durch die trockene Steppe saust, so erhebt sich von ihren Hufen eine Staubwolke, daß man kaum die Augen aufhalten kann und über und über mit Erde beworfen wird. Man muß bis dicht an das ausgewählte Tier heranreiten und ihm mit dem Fangstock den Lasso über den Kopf werfen. Ist dies geglückt, so springt man rasch vom Pferde und hält den Lasso fest, bis Hilfe kommt. Bis dahin vollführt aber das gefangene Tigerpferd einen wahren Höllentanz um den Jäger herum. Es bockt, schlägt, beißt und sucht auf alle Art die Fangschlinge abzustreifen, und es bedarf der ganzen Kraft eines Mannes, das starke Tier zu halten. Inzwischen kommen die Neger heran, und nun geht es an das Ergreifen der Beute. Der Lasso wird eingeholt, das Tier bei den Ohren gefaßt und so lange festgehalten, bis ihm ein vorher sorgfältig geprüfter Halfter angelegt ist. Sodann wird das Zebra ganz kurz am Halfter von zwei Mann geführt, da es beim geringsten Spielraum seine Zähne unerbittlich, wo es kann, einschlägt. Das gefangene Tier muß sehr sorgsam behandelt werden; wie bei den Giraffen, so kommt es auch bei den Zebras vor, daß sie sich in derartige Aufregung hineinarbeiten, daß sie plötzlich, vom Herzschlag getroffen, tot zusammenfallen. Das gefangene Zebra wird mit sanfter, aber unwiderstehlicher Gewalt nach dem hergerichteten Tierkral geführt, wo es losgelassen wird. Im Kral tollt es natürlich von neuem los, kann aber nirgends ausbrechen und beruhigt sich dann allmählich. Gleich am ersten Tage konnten wir ein hübsches Exemplar fangen und hatten innerhalb zwei Wochen acht Stück im Kral. Es ist mir öfters passiert, daß beim Durchreiten einer Herde ganz junge Zebrafüllen zurückblieben und unter lautem Gebell sich direkt unseren Pferden näherten. Eines davon suchte sogar bei meinem Pferde zu saugen. Diese, für mich allerdings[S. 151] wertlosen jungen Tiere, sehen in ihrem wolligen, weißbraun gestreiften Fell allerliebst aus; leider sind sie sehr empfindlich und schwer aufzuziehen, denn die Muttermilch, die das Tier in den Tagen benötigt, ist durch andere Milch nicht zu ersetzen. Wir hatten immer große Mühe, derartige Zudringlinge loszuwerden, da sie den Pferden glatt nachlaufen. Nach geraumer Zeit findet sich die Mutter gewöhnlich wieder ein und sucht das Junge durch bellenähnliches Wiehern an sich zu locken.
In Oldonje-Sambu suchten mich die Herren Jansa und Schumann auf. Sie hatten in mehreren Gegenden Großwild gejagt und kinematographische Aufnahmen gemacht, mit letzteren jedoch bis jetzt wenig Erfolg gehabt. Beide Herren blieben einige Tage in unserem Lager zu Gast. Herr Jansa reiste nach Europa zurück; Herr Schumann machte mir, als er hörte, daß ich nach Beendigung des Zebrafanges auf Nashornfang gehen wollte, den Vorschlag, ihn als Begleiter mitzunehmen und gemeinsam kinematographische Wildaufnahmen zu machen. Diesen Vorschlag nahm ich an. Den Verlauf dieses Unternehmens werde ich später schildern. An dieser Stelle aber möchte ich noch die Erbeutung von Zebras im Fangkral beschreiben, obwohl ich sie erst ein Jahr später ausführte.
Zum besseren Verständnis muß ich auf die Topographie des Fangplatzes etwas näher eingehen. Bei Oldonje-Sambu zog sich, vom Westabhang des Meru kommend, eine Schlucht herab, deren Ausgang sich in der sanft absteigenden Grassteppe verlor. Zur Trockenzeit ohne Wasser, wurde sie während der Regenzeit von einem in der Steppe verrinnenden Gießbach durchflossen. Die Ränder der Schlucht waren, steil aufsteigend, 5–6 Meter hoch; die durchschnittliche Breite derselben etwa 30–40 Meter. Diese Schlucht war nur an zwei Stellen passierbar, die etwa 1½ Kilometer voneinander entfernt waren. Ich hatte nun folgendes beobachtet: Eine große Herde Zebras, die ihren Standplatz tagsüber in der südlich der Schlucht gelegenen Steppe hatte, wechselte des[S. 152] Nachts durch den oberen Durchgang zu dem früher erwähnten Wassergraben hin und nahm ihren Rückwechsel durch die niedriger gelegene Passage. Auf diesen Umstand gründete ich meinen Plan, die Tiere, oder wenigstens einen Teil derselben, in meine Gewalt zu bekommen. In einem großen Halbkreise legte ich zwischen Wassergraben und Schlucht kilometerlange Draht- und Dornverhaue an und versperrte den Ausgangswechsel sowie die Schlucht selbst oberhalb und unterhalb der Ausgänge mit Baumstämmen und Dornen. Somit war zwischen dem Südrand der Schlucht und den angelegten Umzäunungen ein riesiger Fangkral entstanden.
Die Hauptsache war nun, den des Nachts zur Tränke kommenden Tieren den Rückzug abzuschneiden und sie in den Fangkral hineinzudrücken. Hiernach mußte der Zugang sofort mit größter Geistesgegenwart schnellstens durch bereitliegendes Material, wie Dornbüsche usw., versperrt werden, denn ich wußte wohl, daß die Zebras, sobald sie auf die Verhaue gestoßen seien, erschrecken und mit voller Wucht auf den Eingang zurückstürmen würden. Die Vorbereitungen erforderten natürlich viel Arbeit, aber endlich war alles fix und fertig; sogar an zwei in der Nähe liegenden Wasserplätzen waren auf Hunderte von Metern Pfähle mit flatternden Jagdlappen und Papierfetzen errichtet worden, weil die Zebras gleich anderem Wild vor diesen harmlosen Gegenständen scheuen und somit auf unseren Kral gelenkt wurden.
Viele Nächte lang lauerten wir auf das ersehnte Wild, leider immer vergeblich; es war wirklich kein Vergnügen, in windiger, kalter Nacht stundenlang im Grase zu kauern. Endlich löste sich das Rätsel: Ein neidischer Bur hatte auf seiner Farm mit dem Pfluge eine Abflußrinne von seiner Wasserstelle kilometerlang in die Steppe hineingezogen. Hierdurch waren natürlich die Zebras von unserem Fangkral abgelenkt worden. Es galt nun, die Tiere von ihrem Tränkeplatz zu vertreiben, und ich beschloß deshalb, an demselben einige Nächte Wache zu halten.
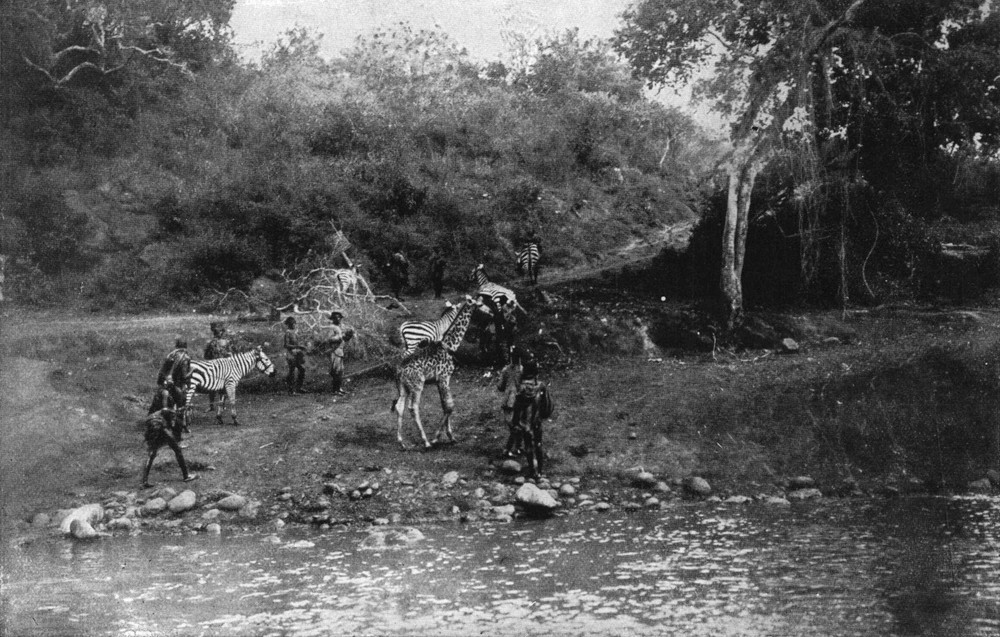
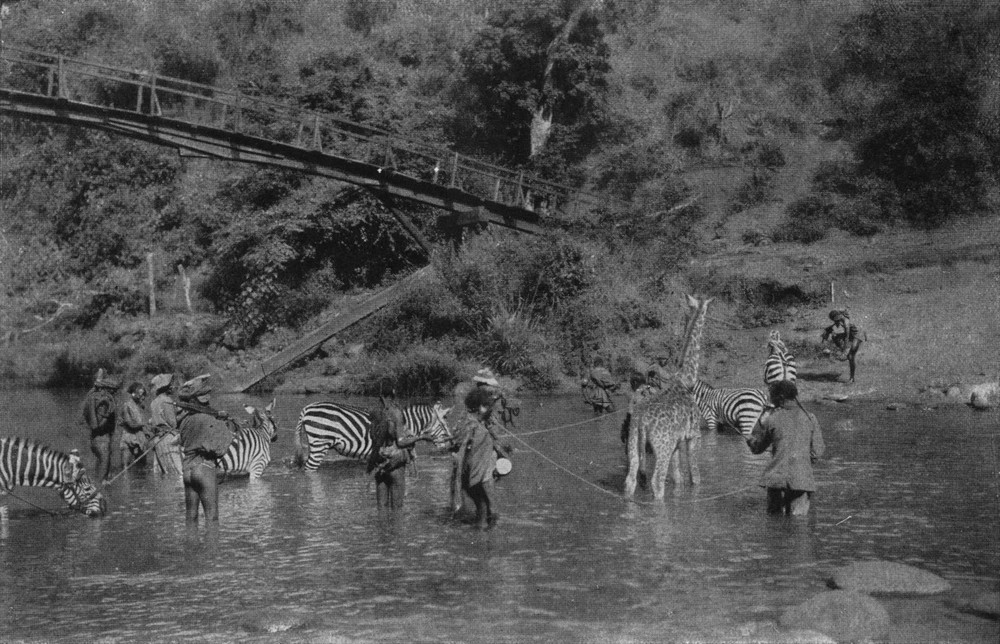
[S. 153]
Schon gegen Abend sahen wir in der baumlosen Steppe große Herden Zebras auf die Tränkestellen zu äsen. Bei Einbruch der Dunkelheit ging ich mit meinem Assistenten, Herrn Pallenberg, nur mit Gewehr und verblendeter Laterne versehen, an den obengenannten Wassergraben. Stundenlang saßen wir und warteten. Der kalte Nordwind strich vom schneebedeckten Meruberg über die Grasebene herab. Wir hüllten uns dichter in unsere Mäntel, denn die Kühle machte sich recht unangenehm bemerkbar.
Es war gegen Mitternacht, und der Schlaf drohte uns zu übermannen, als wir dicht neben uns das Heulen einer Hyäne hörten. Dieselbe kam zum Graben, tränkte sich und war bald wieder in der Finsternis verschwunden. Kurze Zeit darauf vernahmen wir plötzlich in allernächster Nähe das Schnauben von einem Zebra. Langsam kamen mehrere, und ich konnte bald merken, daß eine große Herde herannahte. Laut donnerte der erste Schreckschuß durch die nächtliche Stille. Nun erhob sich von allen Seiten ein unheimliches Getöse, als ob die Hölle losgebrochen wäre. Eine zweite große Herde war hinter uns, oberhalb des Wassergrabens, an der Tränke gewesen und stürmte jetzt in wilder Flucht auf uns zu. Um von den Tieren nicht überrannt und zertrampelt zu werden, feuerte ich schnell noch einige Schüsse ab und Herr Pallenberg ergriff die Laterne und hielt sie hoch. Hunderte von Zebras sausten dicht an uns vorüber, einen Staub aufwirbelnd, daß man kaum die Augen offen halten konnte.
In Erwartung auf Erfolg rannten wir so schnell, als es in der stockdunklen Nacht möglich war, unserem Krale zu, und richtig vernahmen wir das Getrampel der Zebras in demselben. In größter Eile machten wir den Eingang dicht, und beim Morgengrauen sahen wir zu unserer größten Freude zehn prächtige Zebras im Sackkral. Die Tiere rannten wie toll umher und sprangen gegen die Wände an, um ihre Freiheit wieder zu erlangen. Ein alter Hengst war so schlau, daß er hinkniete, den Kopf durch eine[S. 154] schwache Stelle durchzwängte und mit voller Kraft den Zaun hochhob und sich so die Freiheit wieder verschaffte. Ehe ich dahin gelangen konnte, um die Tiere zurückzutreiben, waren acht weitere seinem Beispiele gefolgt, so daß nur noch ein einziges Tier übrigblieb.
Ich ließ alle Kralwände verstärken und aufs sorgfältigste dicht machen. Für kurze Zeit waren nun die Tiere verscheucht, und nur der Durst konnte sie zwingen, wiederzukommen; denn ein Zebra kann wohl 48 Stunden, aber nicht länger des Wassers entbehren.
So lag ich mit meinem Assistenten Truppel noch manche Nacht auf Wache, bis endlich eines Morgens, noch vor Anbruch der Dämmerung, eine Zebraherde in unseren Kral wechselte. Ich ließ erst etwas Zeit verstreichen, feuerte dann den Signalschuß ab und lief dem Eingange zu. Dem Getrampel nach zu urteilen, schien es erfreulicherweise eine große Herde zu sein. Nachdem der Eingang schleunigst dicht gemacht und bewacht worden war, konnten wir 60 Stück beim Mondenschein zählen. Ein unbeschreiblich wildes Bild boten die in ihrer Angst herumtollenden Tiere, von einer Wand der Schlucht zur anderen rennend, dann wieder in rasendem Galopp herumlaufend. Sand und Erde wirbelten von ihren Hufen in die Luft; bald war die ganze Umgebung von einem grauen Staubschleier überzogen. Alles wäre glücklich abgegangen, und die Tiere wären allmählich zur Ruhe gekommen, wenn nicht die Hunde einer naheliegenden Burenfarm rebellisch geworden wären. Diese hatten ihre Riemen, mit denen sie festgebunden waren, durchgebissen und stürzten dann mitten in die Herde hinein. Jetzt gab es keinen Halt mehr; die aufgeregten Zebras rannten wie toll umher. Auf einmal stürmte die ganze Herde wie auf Kommando in geschlossener Kolonne auf den Eingang zu, brach ungeachtet meiner Schreckschüsse die Einfriedigung nieder und setzte über alles hinweg. Ich konnte mich noch mit knapper Not vor ihren[S. 155] Hufen hinter einen Felsen retten. 15 Nachzügler kehrten vor den Schreckschüssen um, und da meine Leute rasch herbeieilten und den Eingang wieder dicht machten, konnten wir die 15 Zebras für uns retten. Wir trieben sie in das untere Ende der Schlucht, wo sich der Eingang zu einem kleinen Kral befand, der ihnen vorläufig als Aufenthaltsort diente. (Siehe Skizze.) Nun mußten sie anfänglich scharf bewacht werden und vor allem Wasser bekommen. Ich ließ von meinen Schwarzen mit Wasser gefüllte Eimer herbeischleppen und in den Kral hineinbringen. Dann versteckte ich mich in der Nähe, um zu sehen, ob die Zebras auch aus den künstlichen Wasserbehältern trinken würden. Sobald die Neger sich zurückgezogen hatten und die Zebras das Wasser witterten, kamen sie, vom Durst getrieben, scheu und vorsichtig heran; endlich wagte es ein Tier, das Maul einem Eimer zu nähern. Doch durch das Metall oder aus irgendeinem anderen Grunde erschreckt, fuhr es in die Höhe und lief davon; die anderen eilten ihm im wilden Galopp im Kreise herum nach; die Eimer flogen um und alles Wasser wurde verschüttet. Es blieb nichts übrig, als von der nächstliegenden Wasserstelle eine kleine Rinne zu ziehen und den gefangenen Tieren das Wasser auf dem Boden heranzuführen, worauf sie endlich ihren Durst löschen konnten und ruhiger wurden. Nachts wurden rings um den Kral Wachen aufgestellt und große Feuer unterhalten, da sonst die Löwen unseren Fangkral zu ihrem Futterkral gemacht hätten.
Einige Zeit später wurden diese 15 Zebras mit dem Lasso eingefangen und auf meine Tierzuchtfarm gebracht. Zehn von ihnen kamen später wohlbehalten nach Hamburg und bildeten eine Zierde des Stellinger Tierparkes.
Während der kleinen Regenzeit, die dieses Jahr (1911) nur sehr kurz war, verblieben wir auf unserer immer mehr aufblühenden Tierzuchtfarm. Aber allzu lange sollte die Ruhe, die wir hier genossen, nicht dauern, da ich noch möglichst bald die Gelegenheit[S. 156] wahrnehmen wollte, meine Tierkarawane, deren Abtransport im Frühjahr erfolgen sollte, durch den Fang von jungen Giraffen und Oryxantilopen zu vervollständigen. Ferner ging jetzt die Brutzeit der Strauße zu Ende, und so hatte ich gleichzeitig die beste Aussicht, eine Anzahl junger Vögel für meine Straußenzucht einzufangen.
Ich ging daher daran, anschließend an den Zebrafang in Oldonje-Sambu mehrere kleinere Krale herrichten zu lassen, um das neu eingefangene Jungwild hierselbst bis zum Abtransport unterzubringen und zu zähmen. Eine tatkräftige Hilfe fand ich hierbei wieder in meinem schon früher erwähnten Freund, Herrn Adrian de Beer und seiner Familie.
Zu den diesmaligen Fangzügen hatte ich die weit ausgedehnte Steppe zwischen dem Meru-, Longido- und Kitumbin-Berge im Norden unserer Kolonie ausersehen. Diese vielfach von Schluchten und Bodenwellen durchzogene Hochebene ist hauptsächlich mit Gras bestanden, doch finden sich auch hier und da Parklandschaften eingesprengt, Haine aus hohen, schattigen Mimosen oder Schirmakazien, in denen sich mit Vorliebe die Giraffenrudel aufhalten. Überhaupt ist diese Gegend ein wahres Dorado der afrikanischen Steppenfauna. Das hier herrschende Tierleben grenzt fast ans Fabelhafte. Auf kaum einige hundert Meter Entfernung sieht man große Herden von schwarz-weiß gestreiften Zebras, die, sobald sie den Jäger erblicken, im Galopp durch die Steppen sausen, eine mächtige Staubwolke hinter sich lassend. Immer wieder tauchen große Rudel von Kongonis, Gnus, Elen- und Oryxantilopen auf, und man wird unwillkürlich in den Glauben versetzt, man befände sich in Europa auf einer großen Koppel zwischen friedlich weidenden Haustierherden. Plötzlich ertönt der dumpfe dröhnende Balzruf des Straußenhahnes über die Steppe, ein Ton, der vom Neuling mit dem fernen Brüllen eines Löwen leicht verwechselt wird. Sporadisch erblickt man Warzenschweine,[S. 157] Hundsaffen, Schakale oder anderes Raubwild, unvergeßliche Anblicke für jeden Naturfreund.
In einem solchen Revier konnte ich mir für meinen Fangzug gute Resultate versprechen, zumal das Gelände eine ausgiebige Verwendung von Jagdpferden gestattete. Ich hatte mir hierfür gute südafrikanische Halbblutpferde gekauft und keinen schlechten Griff damit getan, denn der Erfolg hängt sehr von der Leistung der Pferde ab. Wer es nicht selbst erlebt hat, kann sich keine Vorstellung machen, welches Hochgefühl derjenige empfindet, der im taufrischen Morgen auf feurigem Renner hinter flüchtigen Oryxantilopen oder Zebras dahinfliegt. Reiterlust — Jägerlust! Im roten Rock mit der Meute hinter dem Schwarzkittel zu reiten, ist gewiß herrlich; aber schöner ist es doch, in der afrikanischen Steppe den Löwen zu hetzen, wenn auch das Jagdgewand nur aus schlichtem Kaki besteht.
Angenehm begünstigt wird man hier auch durch die klimatischen Verhältnisse. Durch ihre Höhenlagen und kühlen Nachtwinde sind diese Gegenden ohne Moskitos und daher fieberfrei, und die Temperatur übersteigt nur sehr selten diejenige eines normalen Sommers in Deutschland.
Nachdem ich alle Vorbereitungen getroffen hatte, zog ich in Begleitung meiner Frau, meines Burenfreundes und meines Assistenten Truppel mit zwei Burenwagen hinaus in unser Fangrevier; über die Art und Weise des Reisens mit solchen Wagen werde ich mich weiter unten des näheren verbreiten. An geeigneten Stellen schlugen wir unser Lager auf und machten von denselben aus täglich weite Streifzüge. Der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten, und von Tag zu Tag konnten wir unseren Tierkralen immer mehr neue Insassen zuführen. Manche interessante Episode wurde auf diesen Fangzügen erlebt. Da ich aber den Leser mit Einzelheiten nicht ermüden möchte, sehe ich von einer sich in Einzelheiten erschöpfenden Schilderung ab und begnüge[S. 158] mich damit, einen Überblick über meine Fangmethoden zu geben. Es sei in folgendem zunächst die Erbeutung der wilden Strauße geschildert, bei welcher zwei Fangarten in Betracht kommen:
a) Man sucht das Gelege auf, das sich in der Steppe einfach auf dem Boden im kurzen Grase befindet. Hierbei flüchten die Hennen und man umgibt die Nester mit einem kleinen Zaun aus Zweigen auf etwa 10 Meter Durchmesser in 30 Zentimeter Höhe. Über diesen Zaun kehrt das Elternpaar ohne Schwierigkeiten zum Brüten zurück. Nun revidiert man alle paar Tage, ob die Jungen ausgeschlüpft sind oder nicht. Der Zaun verhindert, daß die jungen Strauße gleich in den ersten Tagen mit den Eltern davonlaufen. Bei richtigem Aufpassen kann man dann, wenn die Jungen ein paar Tage alt sind, sie ohne Mühe wegnehmen. Bei der geringen Intelligenz des Straußes ist es nicht zu verwundern, daß er bei seiner Höhe und bei seinen langen Ständern nicht merkt, daß der niedrige Zaun die Jungen am Weglaufen hindert; er könnte sonst bei seinem Gewicht und seinen kräftigen Beinen mit Leichtigkeit die schwache Einfriedigung niedertreten.
b) Sind die jungen Strauße aber schon mit den alten auf Wanderschaft, und schon so groß wie ein ausgewachsenes Huhn, so können sie bereits sehr rasch laufen. Nun sieht man von weitem die kleinen Strauße überhaupt nicht, da sie richtige Schutzfarben haben, indem sie genau die Steppenfarben gelb und braun durch ihre abwechselnd gelb und schwarz gefärbten Federkiele nachahmen, an denen sich erst nach und nach die braunen Fahnen entwickeln. Oft sieht man ein Straußenpaar in der Ferne und kann sofort an seinem Benehmen erkennen, ob es Junge bei sich führt. Sobald nämlich die Vögel eine Gefahr merken, locken sie die Jungen herbei, wobei sie mit gespreizten Flügeln seltsame Tanzbewegungen ausführen. Dies ist für den erfahrenen Fänger das sicherste Zeichen, daß das Paar Junge bei sich hat. Wenn er von weitem mit bloßem Auge oder mit dem Glase diese tanzenden Bewegungen[S. 159] sieht, muß er zur Fangjagd ansetzen. Nun beginnt zu Pferde ein scharfer Galopp hinter den Straußen her. Zuerst laufen die Jungen wacker mit, sind sie jedoch schon etwa so groß wie ein Truthahn, so hat die Jagd keinen Zweck, da es nur mit ausgezeichneten Pferden und unter völliger Erschöpfung derselben möglich wäre, die jungen Vögel zu fangen. Sind aber die jungen Strauße noch klein, so suchen sie sich durch plötzliches Niederstrecken in das gelbe Gras zu verstecken und bleiben regungslos liegen. Ihre ausgezeichnete Schutzfarbe macht es dem Jäger, der durch das Reiten und Jagen erregt ist, fast unmöglich, die Tiere von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Hat man aber sicher gesehen, daß die Vögel sich niedergelegt haben, so springt man rasch vom Pferde, ergreift einen, bindet ihm die Beine zusammen und läßt ihn liegen; so kann man oft mehrere ergreifen, während die anderen davonlaufen. Ein Gesperre zählt oft bis zu 30 Kücken. Ist das Pferd noch frisch, so wiederholt sich der Vorgang mehrere Male. Dann heißt es aber auf den Spuren zurückkehren und die gebundenen Jungen suchen, wenn die nachfolgenden Schwarzen sie noch nicht gefunden haben. Manchmal steht man direkt neben dem gebundenen Tier und kann es trotz angestrengten Suchens nicht finden, da es sich laut- und regungslos verhält, wenn es den Verfolger bemerkt. In diesem Falle muß man den jungen Straußen insofern nachahmen, als man sich selbst regungslos hinstellt. Nach einigen Minuten hebt der junge Vogel den Kopf, läßt ein rollendes Piepen ertönen und bewegt sich, so daß man ihn endlich bemerkt und aufnehmen kann. Ist das Gelände mit einigen Büschen versehen, so daß es dem Jäger möglich ist, sich darin zu verstecken, so kann er, wenn er sich ganz ruhig verhält, bemerken, daß nach einiger Zeit die alten Strauße zurückkehren, um die Jungen zusammenzulocken.
Zum Straußenfang gehört ein besonderer Erlaubnisschein der Kolonialregierung, der nur zum Zwecke der Straußenzucht erteilt[S. 160] wird. Die Hauptfeinde des Straußes sind, soweit ich feststellen konnte, Hyänen und Schakale, die sowohl die Gelege zerstören als auch die Jungen regelrecht jagen. Beim Straußenfang bemerkte ich einmal vier Schakale, die am hellen Tage jungen Straußen nachstellten und erst beim Herannahen unserer Pferde von ihrer Absicht abließen. Während unseres Jagdzuges in Oldonje-Sambu fingen wir im ganzen 28 Strauße.
Die eingefangenen Kücken werden so schnell wie möglich zur Zuchtfarm gebracht und dort mit Luzerne und Körnerfrüchten gefüttert. Man beauftragt hiermit immer denselben Wärter, so daß die Strauße sich an ihn gewöhnen. Nach einigen Tagen kann man ihn mit den jungen Straußen auf die Weide schicken, wobei er die Tiere beständig lockt und füttert. Bald sind die Vögel zahm, so daß sie von der Weide willig wieder ihrem Wärter nach Hause folgen. Bei guter Pflege wachsen die Strauße sehr rasch, und nach sechs Monaten kann man von ihnen schon die ersten Federn nehmen.
Das Gelände bei Oldonje-Sambu war auch zum Fang von Oryxantilopen gut geeignet. Stellenweise trifft man weite Flächen, auf denen weder Baum noch Strauch steht, sondern welche einen vollkommen reinen Grassteppencharakter besitzen. So beschaffene Terrains werden aber gerade von den genannten Antilopen als Äsungsplätze bevorzugt.

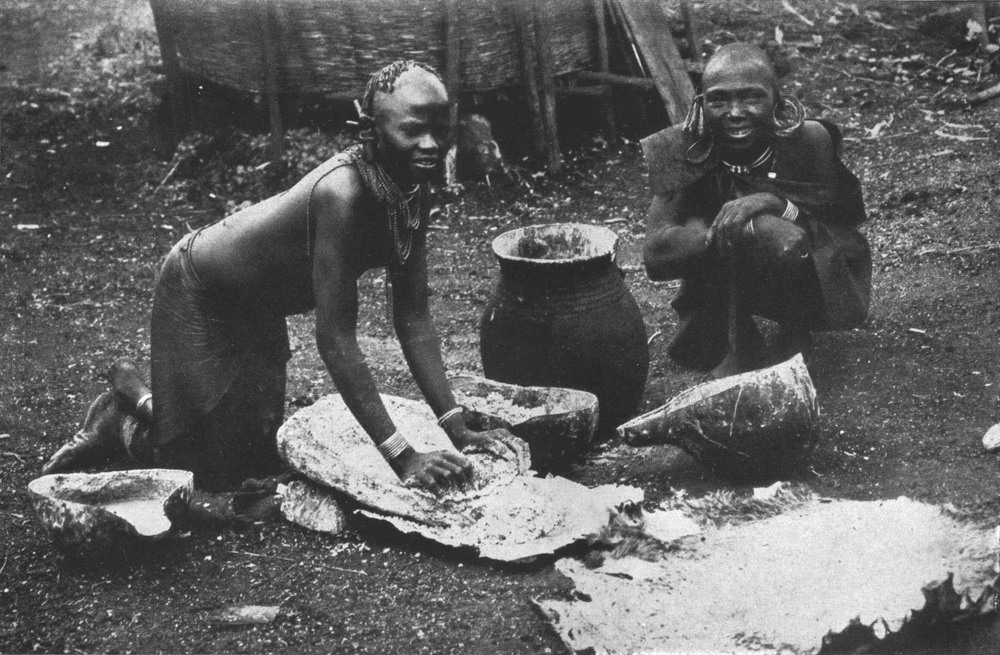
Die Oryxantilope oder Spießbock Deutsch-Ostafrikas (Oryx callotis Thos.) ist eine große, mit Ausnahme des weißen Bauches bräunlich gefärbte Antilope. An den Ohren befinden sich lange Haarpinsel. Beide Geschlechter tragen lange, meist gerade oder nur schwach nach hinten gekrümmte Hörner, die bei den Weibchen eine längere, aber dünnere, bei den Männchen aber eine kürzere, gedrungene Form aufweisen. In diesen Hörnern besitzen die Tiere furchtbare Waffen, die sie gegebenenfalls auch recht geschickt zu gebrauchen verstehen. Der Jäger, der sich einer angeschweißten Oryxantilope[S. 161] nähert, um ihr den Fangschuß zu geben, muß stets darauf gefaßt sein, daß ihn das kranke Tier plötzlich annimmt, um ihn mit seinen langen Spießen zu forkeln. Die Gattung Oryx ist ziemlich verbreitet. Nahe Verwandte der in Ostafrika lebenden Art (callotis) finden sich in Süd- und Südwestafrika, im Somaliland und in Arabien.
Wie bei den meisten größeren Vertretern der wild lebenden Tierwelt kommen auch bei den Oryxantilopen für den Fang nur die Jungen in Betracht. Drei bis vier Wochen nach der Setzzeit bietet sich die günstigste Gelegenheit, die Kälber einzufangen. Man verfährt hierbei gerade wie beim Zebrafang, um sich zu Pferde an das Wild heranzupirschen und die Jungen von der Herde abzusprengen. Ist man an die letzten herangekommen, so ist es äußerst schwer, ihnen wegen der schon ziemlich langen Hörner einen Lasso überzuwerfen. Ist dies aber geglückt, so hat man es hier mit dem widerspenstigsten Ziegenbock der Steppe zu tun. Die jungen Oryx gebärden sich wie toll und rennen mit gesenkten Hörnern gegen jeden an, der sich ihnen nähert. Die komischsten Szenen erlebt man bei diesem Fang. Beim Verfolgen eines jungen Oryx flüchtete dieses durch die Krone eines umgestürzten Mimosenbaumes, und mein Begleiter, der das Pferd nicht mehr ablenken konnte, sauste hinter ihm drein. Pferd und Reiter kamen durch die brechenden Dornzweige hindurch, während die schon ziemlich große Oryx in der Baumkrone hängen blieb.
Auch bei der Fütterung und Zähmung sind die Spießböcke die widerspenstigsten und undankbarsten Zöglinge und stellen die Geduld des Pflegers auf die stärksten Proben. Keine andere Antilopenart ist von so unzugänglichem Charakter.
Es ist eine äußerst anstrengende Arbeit, bis man dem beständig blökenden und bockenden Tiere Halfter und Fesseln angelegt hat. Im Laufe des Jagdzuges glückte es uns, zehn Stück Oryx zu fangen. So unangenehm und ermüdend der Oryxfang selber ist,[S. 162] so wunderbar schön ist der Anblick einer flüchtenden und dann seitwärts abbiegenden großen Herde dieser Antilopen, deren über einen Meter lange Hörner bei der Flucht bei langgestrecktem Halse wie auf dem Rücken zu liegen scheinen. Ein unauslöschlicher Eindruck verbleibt jedem, der dies gesehen hat und durch die flüchtende Herde mit dem Pferde gesprengt ist.
Beim Oryx-, Giraffen- und Zebrafang gilt genau das, was ich beim Elefantenfang von den Jagdhunden geschildert habe, auch für die Jagdpferde. Wie man auch die mutigsten Jagdhunde an das unbekannte Wild gewöhnen muß, ehe man sie mit Erfolg verwenden kann, so müssen ebenso die Jagdpferde die zu jagenden Tiere zuerst kennenlernen und an sie gewöhnt werden, da jedes Pferd vor einem ihm fremden Tiere eine instinktive Abscheu hat. Ist aber das zur Jagd zu verwendende Pferd richtig angeleitet, so lernt es bald seinen Herrn und dessen Absicht verstehen und hilft ihm, ja es gerät selbst in den höchsten Jagdeifer, sobald es verstanden hat, worum es sich handelt. Es ist mir vorgekommen, daß mein Jagdpferd so eifrig beim Zebrafang mitwirkte, daß es nach dem erreichten Zebra direkt biß. Beim Fang von Oryx, die die Gewohnheit haben, wenn sie verfolgt werden, in scharfen Winkeln mitten im Lauf abzubiegen, machte mein Pferd diese Wendungen so schnell von selbst mit, daß ich die größte Mühe hatte, hierbei nicht aus dem Sattel zu fliegen.
Dem Pferde am widerlichsten scheint das Warzenschwein zu sein. Diese Tiere leben in der Steppe in Erdlöchern, welche die Bachen mit ihren Frischlingen oft am hellen Tage verlassen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Das Warzenschwein (Phacochoerus aeliani massaicus Lönnberg) ist etwa so groß wie unser Wildschwein und ein Allesfresser mit sehr starkem Gewaff, welches aus zwei scharfen Gewehren und zwei sehr stark entwickelten, weit aus dem Gebreche seitwärts hervorragenden Hadesern besteht; zweifellos ist es in seinem Äußern eines der häßlichsten[S. 163] der heute existierenden Tiere. Hat man eine Bache mit ihren Frischlingen gesichtet, so geht es in vollem Galopp hinter ihr drein. Einen komischen Anblick gewährt dabei die Alte mit ihrem beim Lauf steil nach oben gerichteten Bürzel. Die Sau sucht sofort eines der Erdlöcher zu erreichen und verschwindet dort mit ihren Jungen. Es heißt daher, eines oder mehrere Junge abzusprengen und zu verfolgen. Ist das junge Warzenschwein genügend ermüdet, so macht es kehrt und nimmt den Reiter an. Nun springt man schnell vom Pferde und sucht den Frischling zu ergreifen. Am besten packt man ihn beim Hinterlauf, während er mit aller Macht mit seinem langen Schädel und den schon scharfen kurzen Waffen um sich haut. Auch versucht er mit den scharfen Schalen seiner Füße angestrengt sich zu befreien, so daß wir oft mit zerfetzten Kleidern zurückkamen. Hierbei quieken diese widerlichen Tiere ohrenzerreißend, was auf die Nerven der bestdressierten Jagdpferde so wirkt, daß sie oft ausreißen, wenn man sie nicht festhalten kann. Vorteilhaft ist es, beim Warzenschweinfang leere Säcke mitzunehmen, um nun die gefangenen Tiere hineinzustecken.
In der Gefangenschaft werden diese urkomisch anzusehenden jungen Warzenschweine sehr zutraulich und bald gänzlich zahm.
Hieran anschließend möchte ich noch in Kürze des Fanges von Raubzeug Erwähnung tun. Die Großkatzen, Löwen, Leoparden und Geparden, fängt man in eigens hierzu konstruierten Kastenfallen, um sie unverletzt in seine Gewalt zu bekommen, denn nur völlig unversehrte Exemplare haben für den Tierhandel einen Wert. Am besten ist es, ganz junge Tiere zu fangen, da diese sich in ganz kurzer Zeit zähmen lassen und auch nur geringe Fang-, Futter- und Transportkosten verursachen. Beschränkt man sich auf den Fang junger Großkatzen, so kommt die Verwendung schwerer Kastenfallen, deren Transport in die Steppe und Aufstellung an geeigneten Plätzen immer eine sehr zeitraubende Arbeit ist, in Wegfall. Man schlägt vielmehr hierbei folgenden Weg ein:[S. 164] Durch Eingeborene wird das Revier abgespürt und es werden die Schlupfwinkel, in welchen sich die Alten mit ihrem Nachwuchs aufhalten, festgestellt. Ist dies geschehen, so sucht man sich der Jungen in einer Zeit zu bemächtigen, in welcher das Muttertier vom Lager abwesend ist. Trifft man die Alte aber in ihrem Schlupfwinkel an, so ist es natürlich notwendig, dieselbe zuerst zu erlegen, ehe man die Jungen mitnehmen kann.
Auf eine ganz andere, und zwar sehr einfache Art verfährt man bei dem Fang von Hyänen. Die hierbei anzuwendende Methode fußt auf der Tatsache, daß die Sprungfähigkeit dieser Raubtiere infolge ihrer verhältnismäßig kurzen Hinterbeine eine sehr beschränkte ist, was sich der Fänger folgendermaßen zunutze macht: Man läßt einen etwa 1,50 Meter tiefen und 1 Meter breiten Graben mit senkrechten Wänden ausheben, der kreisförmig ein Stück des Steppenbodens umschließt, das gleichsam wie eine Insel in seiner Mitte emporragt. Um den äußeren Grabenrand wird aus Buschzweigen ein kleiner Zaun von etwa 50 Zentimeter Höhe errichtet, der den Hyänen die Aussicht auf den Graben verdeckt. In der Mitte der Insel bringt man einen Köder an, der entweder aus Fleisch oder auch aus einer lebenden Ziege bestehen kann. In der Nacht kommen die Hyänen, vom Aasgeruch oder vom Meckern der angebundenen Ziege angelockt, herbei, setzen über den Zaun und stürzen in den Graben. In der Meinung, daß sie aus demselben herauslaufen können, rennen sie immerzu, ohne zu merken, daß sie sich beständig im Kreise herumbewegen. Es ist vorgekommen, daß ich manchmal in einer Nacht mehrere dieser Tiere in einer solchen Falle fing, bisweilen sogar mehr, als mir lieb war. Die Hyänen aus dem Graben herauszubringen, ist sehr einfach. Ein Kasten mit hochgezogener Schiebetür wird hinabgelassen, in blinder Wut stürzt sich das Raubtier hinein, die Falltür schließt sich, und nun wird der Fangkasten mit Inhalt wieder hochgehißt. Durch eine zwischen den Brettern befindliche Ritze[S. 165] wird das Tier in Augenschein genommen, und von dieser Besichtigung hängt das weitere Schicksal der Hyäne ab. Ist es ein altes, für Menageriezwecke unbrauchbares Exemplar, so schenkt man ihm gewöhnlich wieder die Freiheit, denn die Decke der Hyäne hat wenig Wert, und hier in der freien unbewohnten Steppe verursachen sie den Menschen keinen Schaden. Ist das gefangene Tier aber jung und kräftig, so wird es in einen Transportkasten gebracht. Transportkästen für Hyänen müssen immer mit Eisenblech ausgeschlagen sein, denn eine Hyäne ist imstande, eine zwei Zoll dicke Bretterwand in verhältnismäßig kurzer Zeit durchzubeißen.
Auf die oben für den Hyänenfang beschriebene Art fängt man auch Schakale; da aber Schakale auch sehr leicht in Kastenfallen gehen, die für andere Tierarten, wie Ichneumons, Ginster- und Zibetkatzen usw. aufgestellt sind, so ist es nicht nötig, für den Schakalfang allein derartige Fanggräben anzulegen.
Mit dem Einfangen der Tiere ist es aber nicht allein getan. Kam man todmüde und ermattet von den anstrengenden Ritten nach Oldonje-Sambu, so begann hier erst die eigentliche Arbeit, denn jede Tierart mußte in besonderen Gehegen oder Kästen gehalten werden. Schutzdächer gegen Sonne und Regen waren zu errichten und den jungen Tieren täglich mehrere Male ihre Milch oder ihr sonstiges Futter zu verabreichen. Welche Aufmerksamkeit, peinliche Sorgfalt, Sauberkeit und große Erfahrung, und vor allem, welches Maß an Tierliebe eine solche Tier-Kinderstube verlangt, um die Tiere an ihre Gefangenschaft und den Umgang mit Menschen sowie an das veränderte Futter zu gewöhnen, kann man sich schwer vorstellen, wenn man es nicht selbst mitgemacht hat. Die Beschaffung des Grünfutters, die Verabreichung der Milch, die Pünktlichkeit in der Einhaltung der Futterzeiten erfordern die beständige, scharfe Aufsicht eines Europäers. Niemals darf man die Arbeit den Schwarzen allein überlassen. Da ich nun auf Fangzügen oft mehrere Tage vom Lager abwesend[S. 166] sein mußte, so übernahm meine Frau, unterstützt von Frau de Beer, die Aufsicht. Das war für mich eine große Entlastung.
Aber trotz der anstrengenden Arbeit und des vielen Ärgers mit Negern und Tieren, sind uns die Tage von Oldonje-Sambu unvergeßlich geblieben. Die Sonn- und Festtage in Gesellschaft der patriarchalischen Burenfamilie, sowie des trefflichen deutschen Lehrers, Herrn Kaufmann, beim unvermeidlichen Nationalgetränk der Buren, stark mit Milch und Zucker versetztem Kaffee, gehören zu unseren schönsten afrikanischen Erinnerungen.
Bis Ende Januar hatten wir genügend Tiere gefangen und so weit gezähmt, daß sie mit dem Frühjahrstransport nach Stellingen abgehen konnten, den ich diesmal selbst leiten wollte.
Ich möchte aber nicht verfehlen, hier noch zu schildern, wie man zu einer bequemen Jagd mit Burenwagen in die Steppe zieht. Eine solche Fahrt machte ich mit meiner Frau und der mir befreundeten Burenfamilie von Oldonje-Sambu aus. Als Vorbereitung fing im Burenhaus ein großes Backen und Braten an. Einige Schafe wurden geschlachtet, um als Fleischvorrat für die ersten Tage mitgenommen zu werden. Vorkehrungen wie zu einer Auswanderung wurden getroffen: der riesige Burenwagen hergerichtet, die Segelplane ausgespannt, Betten, Stühle, Tische, Küchengerät aller Art, eine große Fleischhackmaschine und ansehnliche Mengen von Salz, Gewürz und Mundvorräten auf den Wagen geladen, dessen hinterer, von der Plane überdeckter Teil immer als Schlafplatz dient. Hier richteten sich die Frauen häuslich ein. Acht Paar Ochsen, von einem Buren geleitet, genügten, in dem flachen Gelände der Steppe den schweren Wagen zu ziehen. Wir Männer ritten voraus, hinter dem Wagen folgten einige meiner Träger in fröhlicher Stimmung, denn sie hatten keine Last zu tragen und freuten sich auf die fleischreichen Tage, die nun kommen sollten. Wir fuhren etwa sechs Stunden durch die wildreiche Steppe. An einer Wasserstelle unter Akazienbäumen[S. 167] machten wir halt. Die Ochsen wurden ausgespannt und weideten, von Schwarzen beaufsichtigt, mit den an den Vorderfüßen gefesselten Pferden zusammen neben dem Lager. Ganz in unserer Nähe konnten wir zwei kapitale Oryxantilopen erlegen. Sie wurden aus der Decke geschlagen, zerwirkt, ein Teil des Wildbrets in etwa zwei Finger dicke und 30 Zentimeter lange Streifen geschnitten, mit Salz bestreut und zum Durchsalzen wieder in die frischen Decken eingeschlagen. Zum Schutze vor Hyänen wurden diese mit Fleisch gefüllten Häute über Nacht an den Akazienbäumen aufgehängt. Ein anderer Teil des Wildbrets wurde mit mitgebrachtem frischem Hammelfleisch durch die Fleischhackmaschine getrieben, mit reichlichem Gewürz vermengt und in die sorgfältig gereinigten Dünndärme der Oryx gefüllt. So entsteht eine Steppenwurst. Den Rest des Wildes vertilgten unsere Schwarzen gründlich. Die Würste sowie die gesalzenen Fleischriemen werden auf ausgespannte Stricke zum Trocknen an der Luft aufgehängt. Frisch gebraten schmeckt die Steppenwurst ausgezeichnet. Das getrocknete Fleisch ist unter dem Namen „Biltong“ bekannt, eine bei den Buren geschätzte Konserve. Die Decken des Wildes verarbeitet der Bure entweder zu Riemen oder er gerbt sie zu Leder. Die an Stelle der Stricke bei den Buren verwendeten Riemen werden aus ungegerbten frischen oder wieder aufgeweichten Decken des Wildes zugeschnitten. Um möglichst lange Riemen zu bekommen, wird das Fell vom äußersten Rande nach innen zu spiralförmig geschnitten. Durch ein besonderes Verfahren versteht es der Bure, diese ungegerbten Riemen dauernd weich und geschmeidig zu halten.
Wir lagerten an dieser Wasserstelle mehrere Tage und machten mit unseren Pferden herrliche Ritte nach allen Richtungen. Hier konnte ich wiederum die schon früher erwähnte Tatsache feststellen, daß ein berittener Jäger vom Wilde viel weniger beobachtet wird als ein Jäger zu Fuß. Offenbar halten die Tiere die Pferde von weitem für Zebras und werden dadurch nicht beunruhigt. Deshalb[S. 168] ist es für den berittenen Jäger ein leichtes, seine Kugel anzubringen und ein angeschweißtes Tier zu verfolgen.
Somit ist die Jagd mit Burenwagen und Pferden verhältnismäßig mühelos und bequem. Ich kann daher jüngeren Huberti, die hier in den Hochländern dem Weidwerk obliegen wollen, diese Art des Jagens nicht genug empfehlen, denn einerseits ist diese Methode nicht besonders anstrengend und kostet auch nicht mehr als das Reisen mit Trägerkarawanen; andererseits gewährt sie viel größere Bequemlichkeit und die Möglichkeit, große Strecken zu durchstreifen. Wir sahen während unserer Ritte unglaubliche Mengen von Wild. So konnten wir eines Tages in nächster Nähe 68 Giraffen zählen, die ruhig an uns vorbeiwechselten. Es war dies ein sonderbarer Anblick, jedoch hatte diese Herde leider keine Jungen bei sich, so daß von einem Fang gar keine Rede sein konnte. Immerhin bot sich mir aber sonst doch Gelegenheit, meinem Beruf nachzugehen, und so brachte ich von unserem achttägigen Ausflug mit dem Ochsenwagen drei junge Spießböcke und zwei Zebras nach Oldonje-Sambu zurück.
Zu dieser Jahreszeit war das Wild selbst hier so zahlreich, daß öfters des Nachts die Zebras dicht bis an unsere Zelte kamen. Infolgedessen fehlten auch Löwen nicht. Eines Morgens lag eine zerrissene, hochtragende Zebrastute nur 600 Meter von unserem Tierkral entfernt. Der Löwe hatte das Gescheide gefressen, und das ungeborene Junge lag unberührt neben dem Kadaver. Das zerrissene Zebra vergifteten wir mit Arsenik, und am nächsten Morgen hatten wir zwei tote Löwen daneben liegen. Obwohl das Vergiften der Räuber nicht weidmännisch ist, so mußten wir doch diesmal aus einfacher Notwehr zu diesem Mittel greifen, um die Pferde und das gefangene Wild zu schützen.
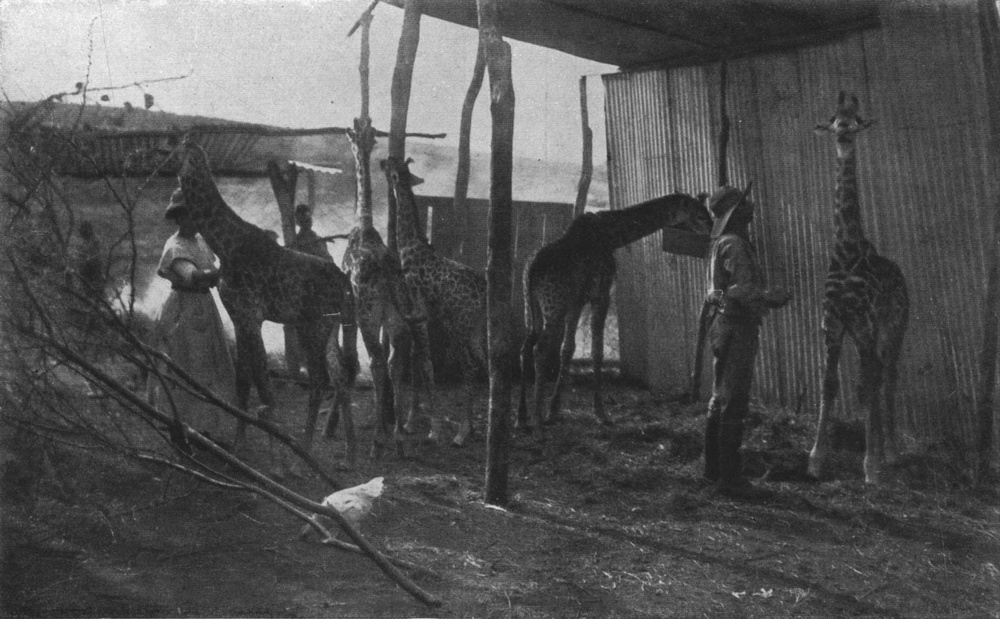
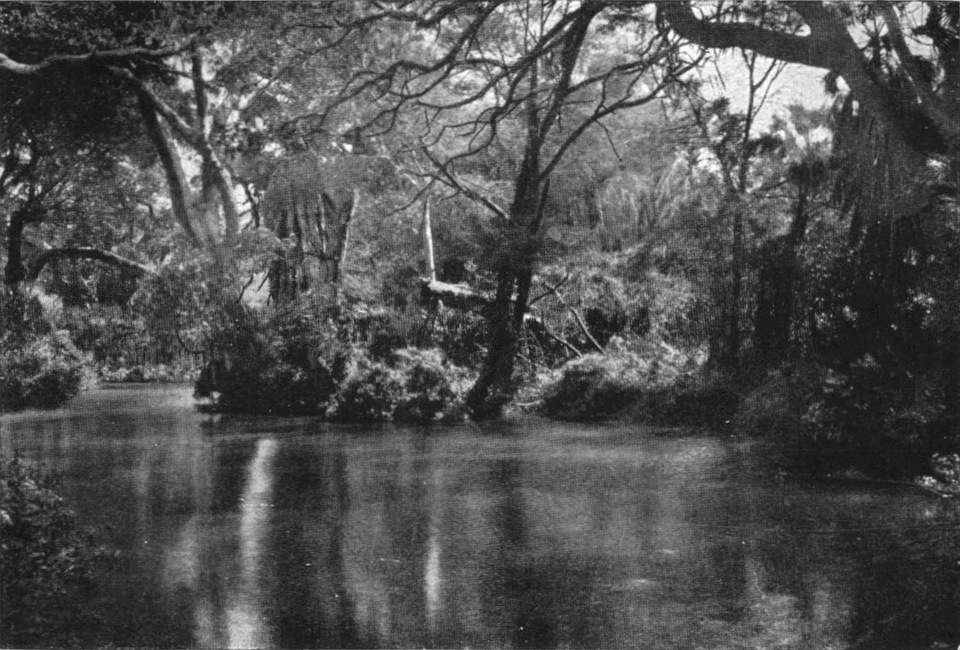
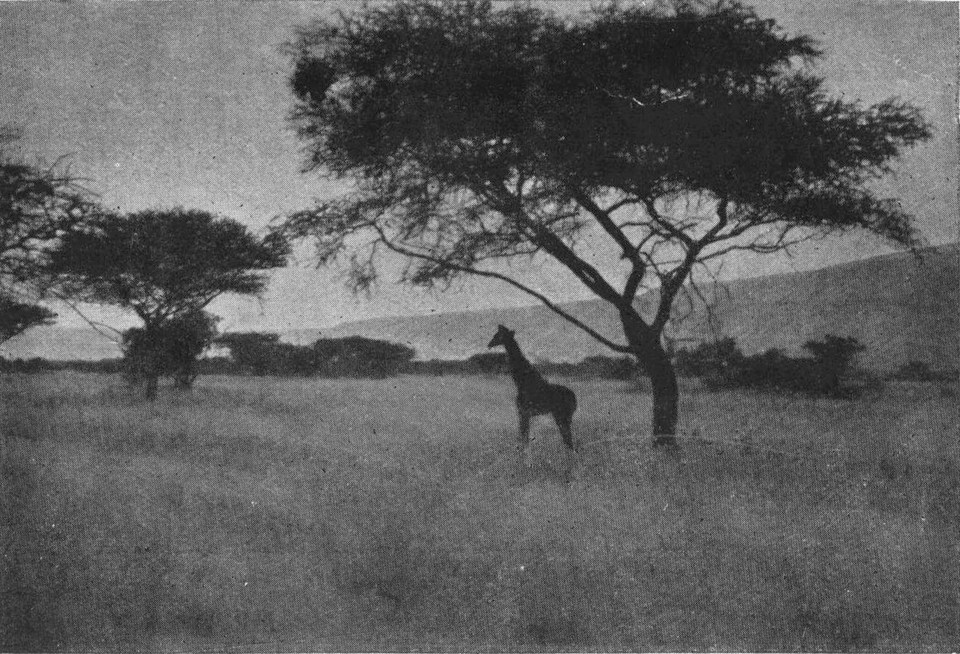
Die nächsten Wochen galten den Vorbereitungen zum Abtransport der neu eingefangenen Tiere nach der etwa 100 Kilometer entfernten Bahnstation „Neu-Moschi“. Der Transport bestand aus[S. 169] 4 Giraffen, 2 Nashörnern, 21 Gnus, 2 Elenantilopen, 10 Zebras, 9 Oryx, 6 Warzenschweinen, 1 Erdferkel, 10 Geparden, mehreren Schakalen, Hyänen und 2 jungen Löwen, dazu noch Affen, Vögel, Schlangen, Käfer usw. usw.
Es ist durchaus keine leichte und einfache Sache, eine solche Tierkarawane auf einer durch einsame Steppen führenden Straße nach ihrem Verladeplatz zu dirigieren. Der Transport von Raubtieren, Warzenschweinen, Affen, Vögeln und sonstigem Kleingetier ist noch am einfachsten, da diese Tiere in Kästen verstaut und auf dem Ochsenwagen oder auf den Köpfen der Neger weiterbefördert werden. Anders verhält es sich mit den großen Pflanzenfressern, die gewissermaßen mit ihren Wärtern in Reih und Glied mitmarschieren müssen. Sie sind es, welche die Aufmerksamkeit des Transportleiters und seiner Leute am stärksten in Anspruch nehmen und seine Geduld manchmal auf eine harte Probe stellen, da sie öfters durch ihre Mucken und Launen den Weitermarsch um beträchtliche Zeit verzögern. Jede Tierart muß während des Marsches in anderer Weise geleitet oder getrieben werden. So geschah es auch bei dem diesmaligen Transport. Die größten Tiere, wie Giraffen, Zebras usw., mußten am Halfter geführt werden und sich zuerst an diese Halfter gewöhnen. Da die Gnus und Elenantilopen mit Eseln täglich auf die Weide gegangen waren, hatten sie sich so an diese Esel gewöhnt, daß sie frei mit ihnen getrieben werden konnten. Am wenigsten Mühe machten uns jedoch die Nashörner. Sie folgten der Karawane wie Hunde.
Ein unliebsamer Unfall passierte mir mit den Gnus und ihren Wärtern. Beim Abmarsch ließ ich zu Zuchtzwecken acht zweijährige Gnus auf der Farm zurück, welche durch den Abtransport ihrer Gefährten in äußerste Aufregung gebracht worden waren. Deshalb befahl ich meinen Schwarzen, die Tiere bis zu ihrer völligen Beruhigung nicht auf die Weide zu treiben, sondern ihnen über den Kralzaun hinweg das Futter zu verabreichen,[S. 170] zumal sie schon einen Wärter angegriffen hatten. Kaum war ich mit meiner großen Tierkarawane zwei Tage unterwegs, als mir ein Bote nachkam mit der Nachricht, daß die zurückgebliebenen Gnus einen Schwarzen getötet hätten. Die Wärter hatten natürlich meinen Befehl, die Gnus nicht auf die Weide zu treiben, nicht befolgt. Sie hatten sie aus dem Kral herausgelassen, und bei dieser Gelegenheit wurde ein fremder Neger, der sich irgendwie das Mißfallen der noch immer aufgeregten Tiere zugezogen hatte, getötet. Selbst konnte ich nicht zurückkehren, beauftragte aber meinen Verwalter, die Sache bei der Regierung zur Anzeige zu bringen und zu regeln. Später, nach meiner Rückkehr von Europa, stellte sich bei den Verhandlungen heraus, daß ich von sechs Elternpaaren belangt worden war, die alle behaupteten, der von meinen Gnus getötete Mann sei ihr Sohn gewesen. Einige stellten sogar eine Forderung von 200 Rindern als Schadenersatz. Ich überließ es dem Gericht, die schwierige Frage zu lösen und zahlte, obwohl mir keinerlei Schuld an dem Unfall beigemessen werden konnte, eine mäßige, vom Richter festgesetzte Summe, welche die zur Schau getragene elterliche Trauer in grinsende Freude umwandelte.
Doch ich kehre zur Schilderung meines Transportes zurück. Langsam nur ging der Marsch meiner Tierkarawane vonstatten. Ich hatte diesmal folgende Route gewählt: Von Aruscha über Oldonje-Sambu — Engare ya Nyuki —, nördlich um den Meru herum und dann zwischen diesem und dem Kilimandjaro hindurch zum Kikafu, und von da über Weru-Weru nach der Station Neu-Moschi.
Auch diesmal wurden wir durch zeitraubende, unliebsame Zwischenfälle, wie Regengüsse, Ausbrechen der Tiere usw. öfters aufgehalten. So mußte ich beispielsweise in der freien Steppe an einer Stelle, wo sich um diese Zeit große Herden Gnus und Zebras als Standwild aufhielten, meiner Karawane vorauseilen[S. 171] und durch einige Schreckschüsse das Wild vertreiben. Diese Maßnahme war notwendig, damit sich bei meinen Zebras und Gnus, die sich gerade mit menschlicher Gesellschaft und der damit verbundenen Ordnung vertraut gemacht hatten, beim Anblick ihrer wilden Stammesbrüder das unterdrückte Freiheitsgefühl nicht wieder regte und sie zur Flucht verleitete.
Was für merkwürdige Überraschungen einem auf einem Marsch durch die Wildnis passieren können, beweist folgende kleine Episode: Wir lagerten eines Nachts in nächster Nähe einer Schlucht und, angestrengt durch die Strapazen des Marsches, gaben wir uns der wohlverdienten Ruhe hin. Plötzlich hörten wir um Mitternacht das klagende Miauen eines jungen Nashorns. Im Glauben, eines meiner Nashörner habe sich vom Lager entfernt, rief ich meinen Wärtern zu, Obacht auf diese Tiere zu geben. Nach einiger Zeit erhielt ich ihre schlaftrunkene Antwort, daß beide Nashörner neben ihnen seien und schliefen. Das Klagen eines Nashornes hörte jedoch nicht auf; jetzt sprang ich von meinem Lager auf, um mich selbst von der Richtigkeit der Antwort meiner Schwarzen zu überzeugen. Mit einer Laterne versehen, trat ich in der stockdunklen Nacht vor das Zelt und fand die beiden Dickhäuter ruhig neben ihren Wärtern schlafen. Plötzlich vernahm ich unten in der Schlucht, kaum 20 Meter von mir entfernt, ein Gepolter. Ich merkte sofort, daß ein ausgewachsenes Nashorn flüchtig wurde. Bei Tagesgrauen wurde meine Annahme durch die deutlich sichtbaren Fährten bestätigt. Aber welche Überraschung war es für mich, als ich neben den großen Fährten auch noch diejenigen eines jungen Nashornes fand. Deutlich konnte ich feststellen, daß das Muttertier die Schlucht hinauf zur Tränke gewechselt war. Hierbei hatte sich das Junge verlaufen und die klagenden Rufe ausgestoßen. Wäre es Mondschein gewesen, so hätte ich hier vielleicht auf leichte Art und Weise den Nashornbestand meines Transportes um eines vermehren können, während ich für den[S. 172] Fang der beiden gezähmten Tiere vor einiger Zeit beinahe fünf Monate bedurfte.
An einem anderen Tage hatten wir 25 Kilometer zurückzulegen, um das nächste Wasser zu erreichen, was mit großen Schwierigkeiten verknüpft war. Auch diesmal lag das Vorwärtskommen nur an den Giraffen. Sie blieben sehr oft stehen und wollten einfach nicht mehr weiter. Da man aber bei diesen Tieren keine Gewalt anwenden darf, so mußten wir warten, bis sie von selbst weitergingen. Hierdurch erlitt natürlich die Karawane eine große Verzögerung. Um nun nicht den ganzen Transport in der Steppe ohne Wasser lagern zu lassen, schickte ich alle anderen Tiere bis zum nächsten Wasserplatz voraus, damit die Krale und das Lager noch vor Dunkelwerden aufgeschlagen werden konnten. Ich selbst folgte mit den Giraffen langsam nach, konnte aber den Kral nicht mehr am Abend erreichen und mußte in der Steppe lagern. Glücklicherweise befand sich in der Nähe buschiges Gelände mit einigen Bäumen, so daß wir ein provisorisches Gehege für die Giraffen bauen konnten. Wir selbst streckten uns ohne Zelt am Boden nieder, um am nächsten Morgen den Weitermarsch fortzusetzen. Spät in der Nacht kam noch einer meiner Leute von der Karawane zurück und brachte uns einige Decken. In aller Frühe wurde ich auf eine sonderbare Weise geweckt. Die Giraffen waren wieder frisch und munter, hatten die schwache Einfriedigung durchbrochen und stolperten über uns hinweg. Wir ergriffen schnell die Leitseile der Tiere, und in einigen Stunden hatten wir den Vortrupp erreicht.
Das Wetter schien umzuschlagen. Da wir in einem ebenen Gelände lagerten, so machten wir uns schleunigst daran, die Tierkrale sowie die Zelte auf die in der Nähe liegenden geringen Erhöhungen aufzubauen. Gerade waren wir damit fertig und hatten alles untergebracht, als schon ein furchtbares Gewitter losbrach, gefolgt von dem üblichen tropischen wolkenbruchartigen Regen. Nach einigen Stunden ragten unsere Lagerplätze wie Inseln aus[S. 173] einem See hervor. Nach dreitägigem Aufenthalt war der Boden wieder etwas ausgetrocknet, und der unterbrochene Weitermarsch konnte wieder fortgesetzt werden.
Ein anderes Ereignis war folgendes: Am Kikafu, am Fuße des Kilimandjaros, der von den niedergegangenen Regengüssen schon sehr angeschwollen war und nur eine passierbare Furt, aber keine Brücke hatte, hatten wir die größte Mühe, Wagen und Tiere an das andere Ufer zu bringen, doch ging alles glücklich vonstatten. Dagegen hatte ein Bur, der uns dort mit seinem schwer mit Petroleum beladenen Wagen begegnete, weniger Glück. Als der Burenwagen auf dem der steilen Böschung folgenden Weg zur Furt hinabfuhr, glitten bei einer Wegbiegung die gebremsten Räder auf dem lehmigen, vom Regen aufgeweichten Boden ab, der schwere Wagen rutschte über den Weg hinaus, überschlug sich und sauste mitsamt der Ladung und den Zugochsen in den Fluß. Der Bur konnte noch von Glück sagen, uns hier getroffen zu haben. Wir machten sofort halt und halfen ihm seinen Wagen wieder aus dem Flusse herausziehen. Allerdings waren einige Kisten Petroleum verschwunden, die von der Strömung weggerissen worden waren. Die Ochsen dagegen waren unverletzt geblieben.
Aber auch uns sollte hier noch ein kleines Mißgeschick widerfahren. Wir hatten unser Lager an einem der Negerpfade aufgeschlagen. Die Tiere waren in schnell hergerichteten Kralen untergebracht worden, und wir dachten weiter an nichts Böses. Natürlich hatte der ungewohnte Anblick einer solchen Karawane einige Neger angelockt, welche die Tiere betrachteten und ihre Bemerkungen darüber machten. Wie wir ja zu Hause in jedem Tiergarten beobachten können, hat stets ein Teil des verehrlichen Publikums die Neigung, die Tiere zu necken. So auch hier. Einer der Schwarzen trat dicht an die Giraffen heran und spannte mit einer plötzlichen Bewegung seinen Schirm auf. Sofort gerieten die Giraffen in einen panischen Schrecken, durchbrachen die Umzäunung und[S. 174] verschwanden in eiliger Flucht in eine in der Nähe gelegene Kautschukpflanzung. Mit unserer Ruhe war’s nun vorbei. Zuerst wurde von unseren Leuten dem schwarzen Mitbruder, der das ganze Unheil verschuldet hatte, eine ordentliche Lektion erteilt, bei welcher auch der Schirm in die Brüche ging; sodann machten wir uns daran, die Ausreißer wieder einzufangen, was uns auch nach einigen Stunden gelang.
Eine weitere interessante Szene erlebten wir beim Überschreiten des Weru-Weru. Über denselben führte bereits eine schöne Eisenbrücke mit Holzboden. Sobald aber unsere Gnus diesen ihnen unbekannten Holzboden betraten, wurden sie durch das Klappern ihrer eigenen Hufe und derjenigen der Esel so erschreckt, daß sie in großen Sprüngen die Brücke entlangliefen. Nur ein alter Bulle blieb unschlüssig vor der Brücke stehen und verlieh seinem Unbehagen und Mißtrauen vor diesem ungewohnten Wege durch lautes Blöken Ausdruck. Kaum hörten dies die anderen Gnus, als sie im Galopp über die Brücke zurückeilten. Es dauerte lange Zeit, bis wir die Tiere glücklich zum zweiten Male über die Brücke bringen konnten.
In einem großen Schuppen und einem Lagerraum des Kilimandjaro-Hotels in Neu-Moschi, dicht bei der Station, fand ich Unterkunft für meine Schützlinge. Wir waren froh, daß wir sie unter Dach und Fach hatten, denn während der Nacht prasselte ein starker Regen herab. Aber nun konnte ich endlich einmal ohne Sorgen eine Nacht in einem wirklichen Bette schlafen.
Frühmorgens bei Sonnenaufgang war ich munter und stand auf der Veranda des Hotels, in der vom Regen erfrischten Landschaft bei klarster Luft das wunderbare Panorama des Kilimandjaro bewundernd. Die schneebedeckte Kibo-Kuppe ragte im hellsten Sonnenlicht durch einen Wolkenschleier hindurch, einen herrlichen Anblick gewährend. Tief versunken in das Betrachten dieser wunderbaren Landschaft, wurde ich plötzlich durch ein Krachen und Splittern[S. 175] unter mir in die Wirklichkeit zurückgerufen. Hier befand sich der sogenannte Lagerraum, in dem die Gnus untergebracht waren. Zur Vorsorge hatte ich die Fenster von innen mit einigen Latten vernageln lassen, damit die Tiere die Scheiben nicht beschädigen konnten. Das eindringende Morgenlicht hatte auch die Gnus lebendig gemacht und zur Freiheit gelockt. Hierbei gerieten zwei Bullen in Kampf, und da die Tiere nur die Fenster als Ausweg sahen, sprang eines in mächtigem Satz auf das Fenster los, Latten, Scheiben und Fensterkreuz durchbrechend, und sauste ins Freie; ihm nach, schneller, als ich es erzählen kann, folgten die anderen 21 Stück. In toller Flucht rasten sie dahin bis zum Platz vor dem Bahnhofsgebäude und fingen dort ruhig zu äsen an. Zuerst war ich vor Schrecken gelähmt und glaubte sie für mich verloren. Als ich sie aber in der Ferne friedlich äsen sah, schickte ich rasch die Schwarzen mit den Eseln zu ihnen, und so ließen sie sich am Abend wieder in den Stall zurückbringen. Bis zur Abfahrt nach Tanga ließ ich die Tiere jeden Tag zur Weide führen, dasselbe machte ich auch mit den Nashörnern.
Hier in Moschi mußte ich einen längeren Aufenthalt nehmen, denn es galt jetzt für die größeren Tiere die zur Bahnfahrt zur Küste und später zur Dampferfahrt nach Hamburg notwendigen Transportkästen zu machen. So einfach auch dem Beschauer ein solcher aus mehr oder minder starken Brettern erbauter Transportkasten erscheint, so gehört doch viel Erfahrung und Beobachtungsgabe dazu, ihn richtig zu konstruieren. Selbst ein einziger falsch geschlagener Nagel kann den Insassen verletzen und den Verlust desselben verursachen. Unrichtig angenagelte Latten werden oft den gehörnten Antilopen zum Verhängnis, weil den Tieren leicht ihre zwischen die Latten geratenen Hörner abbrechen. Ein brauchbarer Transportkasten soll, wie gesagt, den unumgänglichen Raum für eine gewisse Bewegungsfreiheit des Tieres, das oft mehrere Wochen darin verbleiben muß, besitzen. Der Kasten muß gut zu lüften[S. 176] und bequem zu reinigen sein, außerdem dem Wärter die Möglichkeit bieten, das Tier leicht zu füttern und zu tränken. Ferner soll er jedem Ausbruch des Tieres widerstehen und auch fest genug sein, um beim Ein- und Ausladen die unvermeidlichen Stöße auszuhalten; endlich muß er mit Schiebetüren versehen sein, um das Herein- und Herausschaffen der Tiere möglichst leicht zu machen. Dazu kommen oft noch ganz ungeahnte Faktoren beim Transport in Betracht. Als ich z. B. Giraffen von Moschi nach Tanga transportierte, mußte ich den Umstand bedenken, daß die Bahn über eine niedrige, oben geschlossene Brücke fährt, weswegen ich die Giraffenkästen so einrichten mußte, daß die obere Hälfte in die untere verschiebbar war, wodurch die Giraffen gezwungen waren, während der Durchfahrt ihre langen Hälse in wagerechte Stellung zu bringen.
Begreiflich ist, daß die Tiere aus ihrer Gefangenschaft heraus möchten und alles anstellen, um dem engen Behälter zu entfliehen. Je höher entwickelt die Intelligenz des Tieres ist, desto komplizierter muß die Schließvorrichtung gemacht werden. Affen und Elefanten sind unter allen Tieren die schlimmsten Ausbrecher. Mein berühmt gewordener Schimpanse „Moritz“ wußte sogar aus einem Schlüsselbund den einzigen zu seiner Tür passenden Schlüssel herauszufinden und war imstande, sich die Tür selbst aufzuschließen.
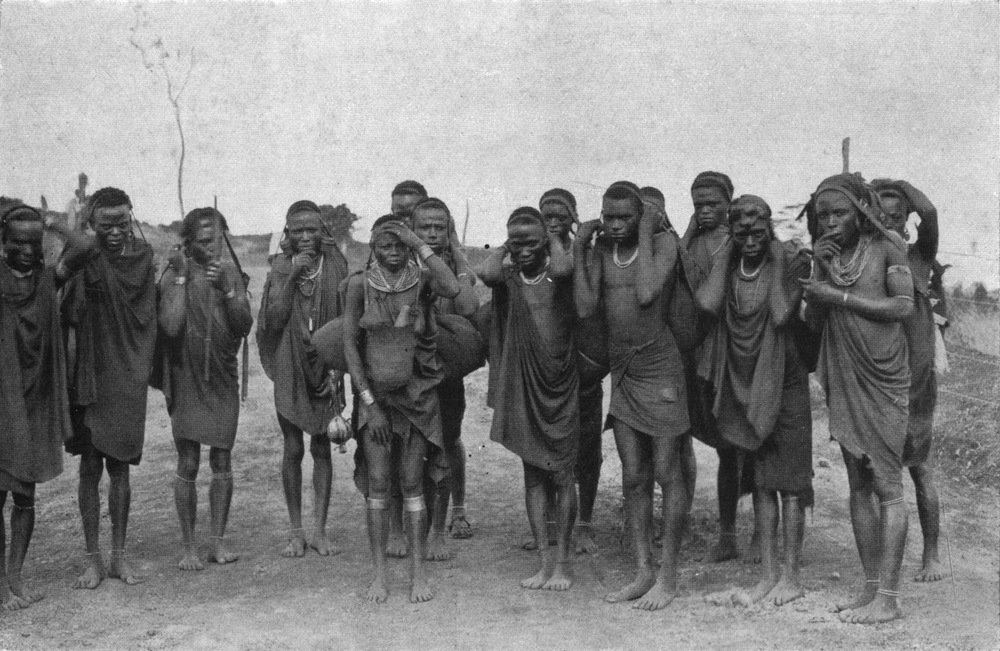


Für den kleinen Ort Moschi war die Anwesenheit einer so großen Tierkarawane natürlich ein Ereignis, und sowohl die weiße wie auch die schwarze Einwohnerschaft schenkte meinen Pflegebefohlenen reges Interesse, oft mehr, als mir lieb war. So manche kleine Episode mit allzu zutraulichen Beschauern und Neugierigen hatten mich stets fürchten lassen, daß irgendwelche Unfälle vorkommen könnten. Eines Tages kam z. B. gerade an der Stelle, wo die Nashörner „Liesel“ und „Lola“ ästen, eine Trägerkarawane aus dem Innern mit ihren Lasten auf dem Kopfe ahnungslos daher. Der durchtriebene schwarze Wärter gedachte sich mit den aus[S. 177] dem Innern kommenden Landsleuten einen guten Spaß zu machen. Er lockte die beiden Nashörner und lief vor ihnen her, als ob er von ihnen verfolgt würde, laut schreiend durch die Karawane hindurch. Kaum sahen die Träger die auf sie zukommenden Nashörner, als sie blitzschnell ihre Lasten wegwarfen und in voller Flucht in die Büsche verschwanden. Wir konnten von der Veranda des Hotels aus die Szene sehen und mußten über die wilde Flucht der schwarzen Träger herzlich lachen. Hier war die Sache nur komisch, öfters aber waren Liesel und Lola ungemütlich; das erfuhren mehrere Europäer, die den Tieren Leckerbissen reichen wollten und allzuoft zum Dank für ihre Liebenswürdigkeit mit kräftigen Stößen belohnt wurden.
Wer die so plump aussehenden Nashörner in den Tiergärten sieht und sie für unbeholfen und wenig intelligent hält, irrt sich gewaltig. Über die Behendigkeit der jungen Nashörner hat der Leser genügend beim Nashornfang erfahren; aber auch die alten Nashörner sind rasch und gewandt, ihr Lauf im freien Gelände ist außerordentlich leicht und elastisch. Ebenso können sie trotz des schweren Körpers sich blitzschnell drehen und wenden. Auch ihre geistigen Fähigkeiten sind nicht geringer als die der anderen Vertreter ihrer Sippe mit Ausnahme des Elefanten, der ja bekanntlich zu den intelligentesten Tieren gehört. Überhaupt ist es unrichtig, die wilden Tiere nur nach den in den zoologischen Gärten gemachten Beobachtungen zu beurteilen. Genau wie der Mensch in der Gefangenschaft ein anderes Wesen hat als in der Freiheit und seiner selbstgewählten Umgebung, so ist es auch mit den Tieren; sie ändern in der Gefangenschaft ihren Charakter und sind nicht mehr dieselben wie in freier Wildnis. Dies konnte ich in den wenigen Wochen hier in Neu-Moschi wieder so recht deutlich beobachten, als die Tiere, nachdem die Ankunft des Europa-Dampfers in Tanga gemeldet war, in ihre Transportkästen gebracht worden waren. Selbst unsere zahmsten Tiere wollten in den[S. 178] ersten Tagen ihrer engeren Gefangenschaft von ihrem eignen Herrn nichts mehr wissen.
Bevor ich nun meine Erlebnisse auf dem Weitertransport erzähle, gestatte mir der freundliche Leser vorerst noch ein wenig über das Thema: „Nashörner“ zu plaudern. Sind es doch gerade diese soviel verstaunten und geschmähten Dickhäuter, denen ich stets mein besonderes Interesse zugewendet hatte und denen ich auch meinen afrikanischen Spitznamen „Bwana Kifaru“ verdanke. Meine beiden jungen Nashörner verlangten schon aus dem einen Grunde eine besonders sorgfältige Behandlung, weil sie, gerade so wie ihre in Freiheit lebenden Artgenossen, sehr von Zecken zu leiden hatten, welche sich hauptsächlich an den Weichteilen festsetzten. So mußten denn zwei Neger täglich diese lästigen Plagegeister von den Nashörnern ablesen. Letzteren war dieser Liebesdienst hochwillkommen. Man brauchte die Tiere nur ein wenig am Bauche oder an der Seite zu scheuern, so legten sie sich nieder und streckten die Beine hoch, um so ihren Wärtern die Arbeit zu erleichtern. In der Wildnis haben die Rhinozerosse die Gewohnheit, sich ihrer Quälgeister in der Weise zu entledigen, daß sie durch dichtes Gebüsch laufen, um so das Ungeziefer abzustreifen. Auch suchen sie sich vielfach dadurch von den Zecken zu befreien, daß sie sich mit dem Bauche an großen Steinen scheuern, die dann wie mit einer Blutkruste überzogen aussehen. Durch dieses Verfahren zieht sich das Nashorn vielfach wunde Stellen zu, die von Fliegen und Bremsen zur Eiablage benutzt werden. An allen erlegten Nashörnern konnte ich solche Wunden sowie Narben feststellen, ja bei einem Exemplar war der ganze Bauch sozusagen eine einzige, über und über mit schmarotzenden Insekten bedeckte Wunde. Von solchen in den wundgescheuerten Stellen sich entwickelnden Maden sowie auch von den Zecken wird das Nashorn vielfach von einem weißen, starähnlichen Vogel, dem Madenhacker (Buphaga africana L.), befreit, den man manchmal in mehreren Exemplaren auf dem gewaltigen Dickhäuter[S. 179] antreffen kann. Wir haben es also mit einem typischen Fall von Symbiose, oder, um mich konkreter auszudrücken, von Mutualismus zu tun, d. h. dem zeitweiligen, auf gegenseitigem Nutzen basierenden Zusammenleben zweier verschiedener Tierarten. Das Rhinozeros wird durch den Madenhacker von seinen Quälgeistern befreit, während der Vogel auf seinem großen Gefährten stets eine wohlgedeckte Tafel vorfindet. Da nun in der einschlägigen Literatur (Jagd- und Reiseberichte) sehr oft auf dieses Zusammenleben von Diceros und Buphaga hingewiesen wird, so entsteht beim Leser leicht der Eindruck, daß der Mutualismus zwischen beiden genannten Arten als eine regelmäßige Erscheinung aufzufassen sei. Hierzu möchte ich das Wort ergreifen, da ich auf Grund langjähriger Beobachtungen zu der Ansicht gekommen bin, daß diese Auffassung nicht stichhaltig ist. Zunächst kenne ich in Ostafrika manche Gegenden, in denen das Nashorn häufig anzutreffen ist, während der Madenhacker gänzlich fehlt. In diesem Falle scheidet also eine Vergesellschaftung der beiden Tiere von selbst aus. Anderswo tritt nach meinen Beobachtungen das Nashorn häufig, der Vogel selten auf. So waren von etwa 20 Nashörnern, die ich während einer Zeit von vier Monaten im Iraku-Bezirk antraf, nur zwei bis drei von Madenhackern begleitet.
Vielfach wird auch darauf hingewiesen, daß das Nashorn von dem Zusammenleben mit dem Madenhacker insofern noch einen weiteren Nutzen zöge, als es durch das Benehmen der Vögel vor drohender Gefahr gewarnt würde. Hierzu sei folgendes bemerkt: das Nashorn windet zwar ausgezeichnet, äugt aber dafür desto schlechter, mit anderen Worten, es ist ein ausgesprochenes „Nasentier“. Nähert sich ihm nun ein Feind unter dem Winde, und als ernsthafter Gegner kann für ein ausgewachsenes Exemplar im allgemeinen wohl nur der jagende Mensch in Frage kommen, so ist es letzterem leicht möglich, auf ziemlich kurze Distanz an den Dickhäuter heranzukommen. Befinden sich aber Madenhacker auf[S. 180] demselben, so werden die Vögel als „Augentiere“, namentlich wenn das Terrain wenig Deckung bietet, das Herannahen eines Feindes schon verhältnismäßig frühzeitig wahrnehmen. Sie pflegen dann unter lautem Geschrei davonzufliegen, und hierdurch wird dem Nashorn klar, daß in seiner Umgebung etwas nicht in Ordnung ist. Solche Fälle sind von einwandfreien Zeugen mehrfach beobachtet worden. Ob man sie aber als feste Regel aufstellen kann, ist mir auf Grund einer Episode, die ich gelegentlich einer kinematographischen Aufnahme in der Nähe des Manyara-Sees erlebte, denn doch zweifelhaft geworden. Hier pirschten mein Assistent und ich uns mit dem Apparat an ein ruhendes Nashorn, auf dem mehrere Madenhacker an der Arbeit waren, bis auf etwa 20 Meter Abstand heran. Der Apparat wurde aufgestellt und in Tätigkeit gesetzt. Als ich einige Meter Film abgekurbelt hatte, wurde das Rhino unruhig und kam langsam auf uns zu, wohingegen die Madenhacker von unserer Anwesenheit zunächst keine Notiz nahmen, sondern ruhig auf dem Dickhäuter verblieben. Erst als dieser auf etwa neun Meter herangekommen war und nun prustend seitwärts an uns vorbeiraste, flogen die Vögel mit lautem Gekreisch davon. Da der ganze Vorfall kinematographisch festgehalten worden ist, so bin ich in der Lage, ihn Interessenten jederzeit wieder vorzuführen. Schließlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß man die Madenhacker auch häufig als Begleiter von Giraffen und Antilopen antrifft und daß sie sich auch mit Vorliebe in den Viehkralen der Masais aufhalten, wo sie dann natürlich jede Scheu vor dem Menschen abgelegt haben.
Nach dieser Abschweifung in das Gebiet der Biologie bitte ich den Leser, wieder nach Moschi zu kommen und mich auf der Weiterreise zu begleiten.
In einem Extrazuge ging meine Tierkarawane nach Tanga ab; als Wärter fungierten zehn Masais, die ich für die Reise nach Europa mitnahm. In Tanga war alles vorbereitet, so daß[S. 181] die Einschiffung mit Ausnahme eines tragikomischen Vorfalles glatt vonstatten ging. Ein gewichtiger Neger, der die Tierkästen an die Krankette anzuhaken hatte, sprang, ahnungslos über den Inhalt der Kisten, von Bord des Schiffes auf den Leichter, und zwar direkt auf die Decke eines Gnukastens. Die Decke brach durch und der Schwarze saß auf den Hörnern eines starken Gnubullen; rascher wie er hineingekommen war, hatte ihn der Nyumbu (Gnu) wieder aus dem Kasten hinausbefördert. Die Sache sah sehr gefährlich aus und ich befürchtete schwere Verletzungen des Mannes; aber mit einigen Hautabschürfungen war die Sache abgetan.
Gerade hatte ich die Tiere auf dem Dampfer wohl untergebracht und gedachte an die Freude, die Herr Hagenbeck sen. diesmal an dem schönen Tiertransport und den wundervollen Kinoaufnahmen haben würde, als ich das Telegramm mit der Nachricht seines Ablebens erhielt. Nun war meine ganze Freude in tiefe Trauer umgeschlagen, denn ich hatte den außergewöhnlichen Mann, der mir stets ein freundlicher Lehrmeister gewesen war, lieb gewonnen wie einen Vater. Auch ließ er es sich nie nehmen, mit seinen beiden Söhnen bei Eintreffen der Tiertransporte in Hamburg das betreffende Schiff zu erwarten, um mich noch an Bord willkommen zu heißen. Und wie wert ich ihm war, erfuhr ich erst später. Er hatte ausdrücklich die letztwillige Verfügung getroffen, daß ich vor allen anderen das erste Telegramm mit der Todesnachricht erhalten solle. Während der ganzen 22 Monate, die ich diesmal in Deutsch-Ostafrika ununterbrochen verbracht hatte, waren wir in stetem schriftlichen Verkehr gewesen. Es war rührend, wie er, trotzdem er schon schwer leidend war, mit dem größten Interesse alle meine Jagdzüge verfolgte, überall, nicht allein das geschäftliche Interesse, sondern auch rein menschliche Teilnahme zeigte.
Während der ganzen Reise waren wir von herrlichem Wetter begünstigt. Kapitän und Offiziere, sowie die Besatzung unterstützten uns nach bestem Können. Für die Raubtiere hatte ich einige[S. 182] Ochsen an Bord, welche von unseren Masais geschlachtet wurden. Jedesmal, wenn ein Ochse geschlachtet wurde, war es für die schwarzen Herren ein großes Fest. Die Hauptsache dabei war für sie natürlich der Genuß des warmen Blutes.
Das Schlachten der Ochsen vollführen sie mit einer, ich möchte beinahe sagen bewundernswerten Eleganz. Der Ochse wird mit einem Speer genickt. Hierauf wird das Fell an der Wamme aufgeschnitten und gelöst, und zwar so weit, daß es sich zu einer Schale ausziehen läßt, die von einem von ihnen gehalten wird. Dann erst wird die Ader angeschnitten, und die oben erwähnte Schale füllt sich mit Blut. Nun folgt der Hauptakt: Jeder Masai, einer nach dem anderen, säuft dieses warme, rauchende Blut direkt aus der Hautfalte heraus. Dann erst wird das Tier enthäutet und zerteilt. Ein besonderer Leckerbissen für die Masais sind die Markknochen, die entweder am Feuer geröstet oder auch roh ohne jede Zutat von Salz ausgesogen werden. Für die Schiffsbesatzung war dies Schauspiel immer ziemlich ekelerregend, aber interessant.
Welche unglaublichen Mengen so ein Masaineger verdauen kann, beweist die Tatsache, daß einmal zwei Mann eine ganze Ziege von 28 Pfund in einer Mahlzeit verdrückten. Und dabei aßen sie nicht nur das Fleisch, sondern auch Herz, Leber, Milz usw. alles am Feuer gebraten.
Mit Ausnahme des Verlustes einiger kleinerer Tiere kamen wir im Mai mit dem ganzen Tiertransport wohlbehalten in Hamburg an und wurden von den Herren H. und L. Hagenbeck, den jetzigen Inhabern der Firma, empfangen. Alles stand in voller Blüte, und der Stellinger Tierpark mit seinen prachtvollen Gehegen bot ein wunderbares Bild, dessen Mannigfaltigkeit durch Einreihung unserer Neuankömmlinge aus der afrikanischen Steppe noch erhöht wurde.
Gar mancher meiner Leser wird den Stellinger Tierpark schon besucht haben, und wohl allen wird er mehr oder minder durch Beschreibung[S. 183] und Illustrationen bekannt geworden sein. Dies von dem großen Tierfreund Carl Hagenbeck unter tätiger Mitarbeit seiner beiden Söhne geschaffene „Tierparadies“ hat bereits für die Neuanlage von zoologischen Gärten — ich erinnere an München und Rom — als Vorbild gedient. Die hier vertretene Methode, die darauf ausgeht, den gefangenen Tieren gewissermaßen ein Stück ihrer verlorenen Heimat wieder künstlich zu ersetzen, hat auch auf dem Gebiete der Tierhaltung bahnbrechend und vorbildlich gewirkt. Alle die vielen Anziehungspunkte, die der Garten bietet, aufzuzählen, ist hier nicht der Platz. Ich erwähne nur außer dem reichhaltigen und gutgepflegten Tierbestand das ständige Kommen und Gehen neuer Tiertransporte, die große im Hauptrestaurant befindliche Geweih- und Gehörnsammlung, die von Herrn Joseph Pallenberg ausgeführten Rekonstruktionen von Dinosauriern, die Vorführung von Tierdressuren, Vertretern exotischer Völker und Kinoaufnahmen aus Urwald und Steppe, Wüste und Eismeer. Ein solches Unternehmen mußte in jeder Hinsicht sich einen Weltruf erringen, und es ist kein Wunder, daß die jährliche Besucherzahl des Gartens bis über eine Million gestiegen ist. Daß die Anlage zu einem Anziehungspunkt für Künstler und Wissenschaftler werden mußte, ist ja wohl zu verstehen; aber auch sonst haben ihr hervorragende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Gesellschaftskreisen und Berufen stets ein reges Interesse dargebracht. Auch der deutsche Kaiser, der ja als großer Tier- und Jagdfreund bekannt war, kam alljährlich gelegentlich der Kieler Woche mit Gefolge nach Stellingen. Bei seinem Besuche im Jahre 1913 wurde mir die Ehre zuteil, durch Herrn Heinrich Hagenbeck Sr. Majestät vorgestellt zu werden. Der Kaiser zog mich in ein halbstündiges Gespräch, das sich hauptsächlich um Wild und Jagd in Ostafrika, aber auch um die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kolonie drehte. Besonderes Interesse zeigte Se. Majestät für die beiden jungen Nashörner „Liesel“[S. 184] und „Lola“ sowie für die von mir mitgebrachten zehn Masais, die in vollem Kriegsschmuck ihre heimischen Waffentänze zur Vorführung brachten.
An diesen Tag, an dem ich unserem früheren Herrscher Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, denke ich stets mit Stolz zurück, aber auch mit Wehmut. Wie hat sich seit wenigen Jahren alles geändert! Der einst so mächtige Imperator lebt in fremdem Lande in der Verbannung und die deutsche Fahne weht nicht mehr über unserem lieben Ostafrika. Wie lange hat es gedauert, bis das deutsche Volk einsehen lernte, welchen Schatz es in dieser Kolonie besessen hat. Die Erkenntnis ist zu spät gekommen. Das Kapitel Weltgeschichte, das von den Tagen eines Peters und Wissmann bis zu denen eines Lettow-Vorbeck unter afrikanischer Tropensonne geschrieben wurde, trägt für uns die Überschrift:
„Ein verlorenes Paradies!“
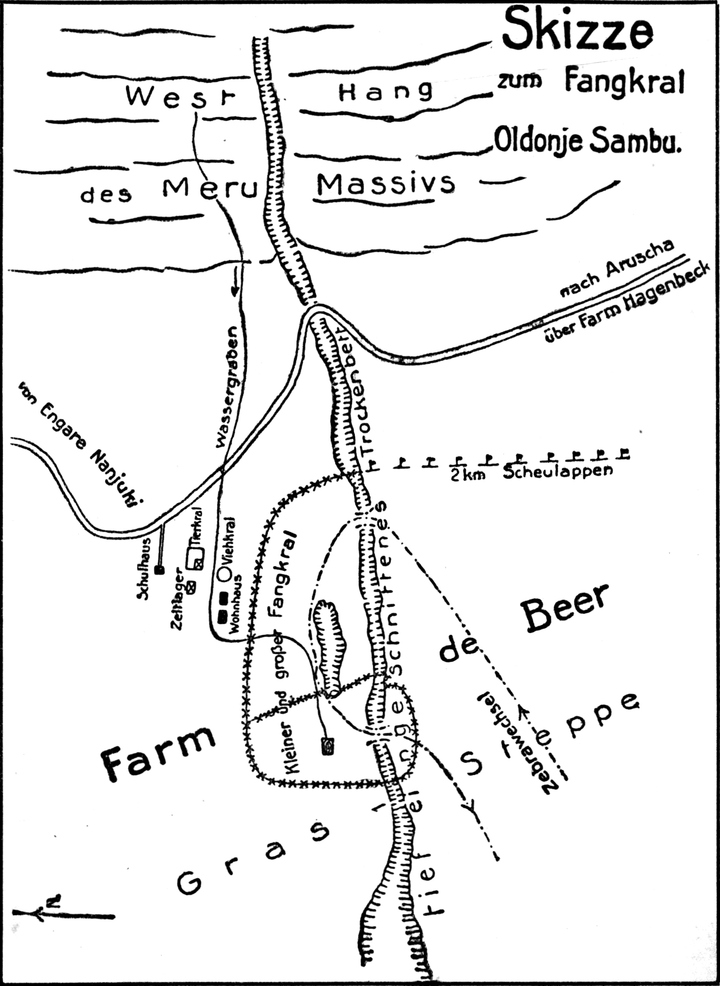
Verlag Deutsche Buchwerkstätten G.m.b.H., Leipzig
Das neueste Werk des bekannten Afrikaforschers
Hans Schomburgk
Mein Afrika
Erlebtes und Erlauschtes aus dem Innern Afrikas
Stattlicher Band in Ganzleinen,
280 Seiten mit 56 Original-Aufnahmen des Verfassers,
sowie einer Anzahl Strichzeichnungen, buntem
wirkungsvollem Schutzumschlag,
holzfreies Papier M. 9.—
„Mein Afrika“ ist ein Volksbuch. Ein Buch für junge Menschen, ein Buch für Erwachsene.
Frankfurter Zeitung, Frankfurt.
Dieses Buch müssen Sie lesen
Das neueste Werk des bekannten Reiseschriftstellers
Victor Ottmann
Vom Wilden Westen
zum Korallenmeer
Erlebnisse eines Überseedeutschen
Schöner Großoktavband in Ganzleinen mit farbigem Schutzumschlag, 216 Seiten mit 10 gezeichneten Vollbildtafeln von Künstlerhand in Tiefdruck, holzfreies Papier M.6.50
Ein stattliches Buch. Ein Buch, das jung und alt in gleicher Weise erfreuen wird.
8 Uhr Abendblatt, Berlin.
Spannend vom ersten bis zum letzten Wort
Zu beziehen durch jede Buchhandlung