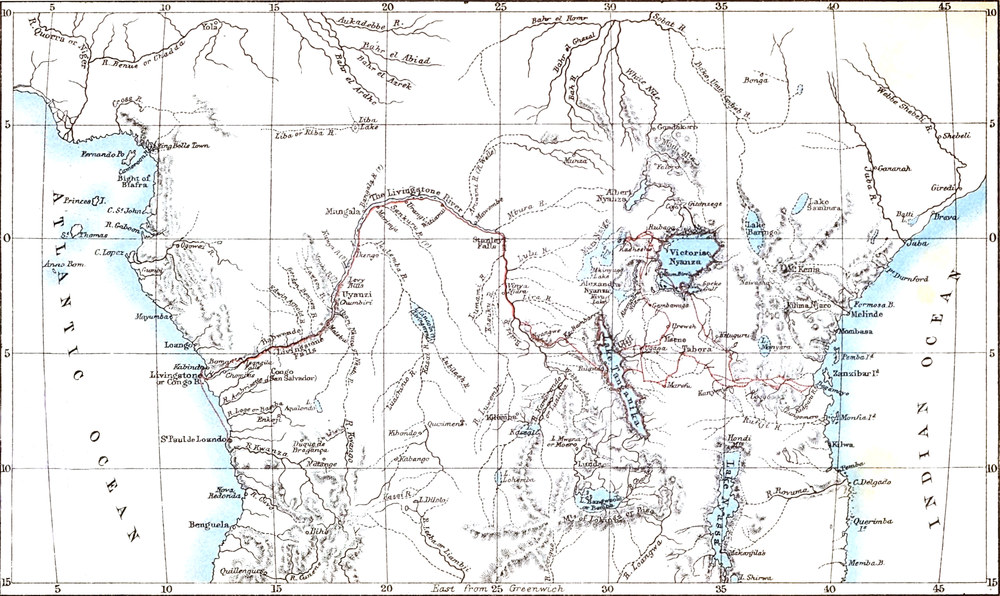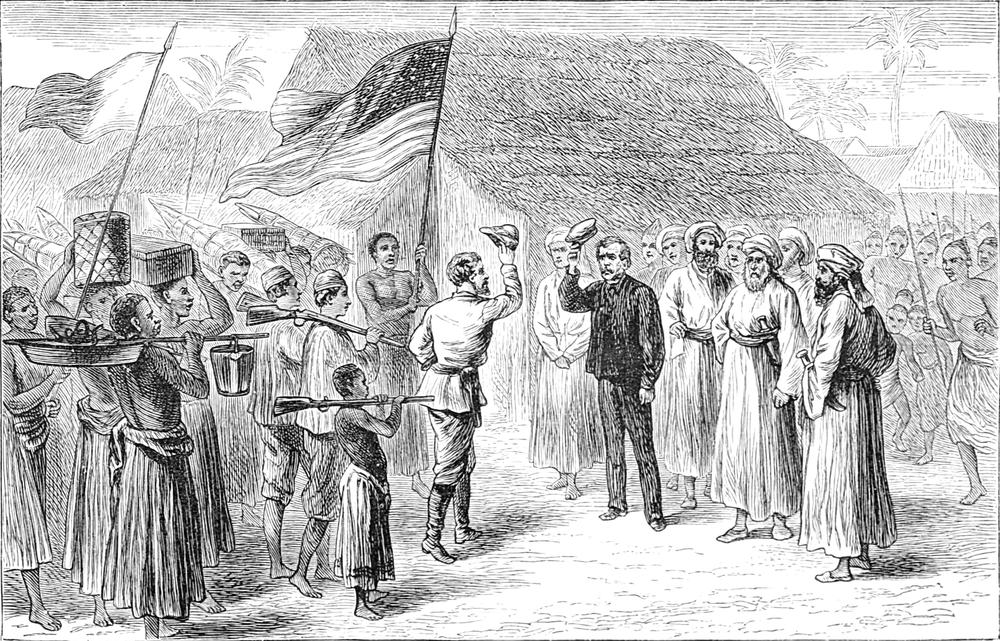
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1879 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Fußnoten wurden am Ende des betreffenden Kapitels zusammengefasst.
WIE ICH LIVINGSTONE FAND.
ZWEITER BAND.
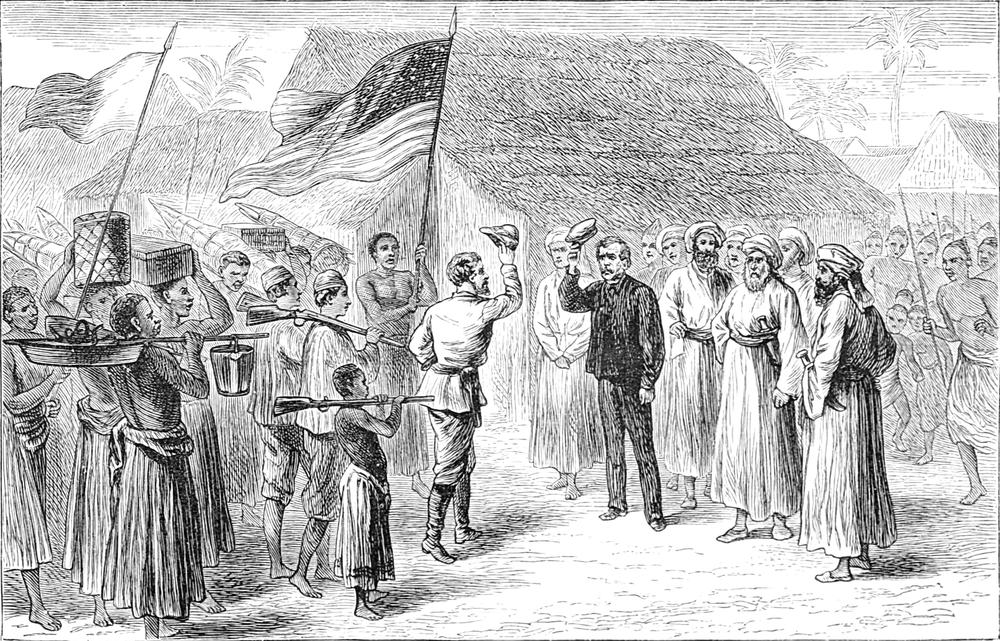
REISEN,
ABENTEUER UND ENTDECKUNGEN
IN
CENTRAL-AFRIKA.
VON
HENRY M. STANLEY.
AUTORISIRTE DEUTSCHE AUSGABE.
IN ZWEI BÄNDEN.
MIT ABBILDUNGEN IN HOLZSCHNITT UND EINER KARTE.
ZWEITER BAND.

LEIPZIG:
F. A. BROCKHAUS.
1879.
[S. v]
|
ELFTES KAPITEL.
|
|
|
Durch Ukawendi, Uvinza und
Uhha nach Udschidschi.
|
|
|
Seite
|
|
|
Abreise aus Mrera. — Lager in den Dschungels. —
Ich versinke bis an den Hals in den Schlamm des Rungwa. — Der
Mpokwa-Fluss. — Erster Blick in die Heimat des Löwen. — Eine Schar
Affen. — Abenteuer mit einem riesigen wilden Eber. — Ein Löwe verfolgt
mich. — Ein Tag voll grosser Sorgen. — Erlegung eines Büffels. — Ein
Leopard. — Büffeljagd. — Drohende Hungersnoth. — Welled Nzogera’s
Wohnsitz. — Reichliche Lebensmittel. — Ein Esel versinkt im Morast. —
Gesandtschaft an den Häuptling Kiala. — Siebenstündige Unterredung. —
An den Ufern des Malagarazi. — Unser Esel Simba wird von einem
Krokodil gepackt und fortgeschleppt. — Nachrichten von Livingstone. —
Aufenthalt in Kawanga. — Streitigkeiten über den Tribut. —
Unverschämte Forderungen. — Wir setzen über die Flüsse Pombwe und
Kanengi. — Mitternächtlicher Marsch durch die Dschungels. — Ein
unsinniges Weib verräth uns fast durch ihr Geschrei. — Das Donnern des
Tanganika. — An den Ufern des Rugufu. — Niamtaga. — Der Tanganika!
Hurrah! Entfaltet die Fahnen! — Susi, Dr. Livingstone’s Diener,
begrüsst uns: „Guten Morgen, mein Herr!“ — „Vermuthlich Dr.
Livingstone?“ „Ja!“ — Unterhaltung mit dem Doctor. — Gute Nacht.
|
|
|
ZWÖLFTES KAPITEL.
|
|
|
Umgang mit Livingstone in Udschidschi.
|
|
|
[S. vi]
DREIZEHNTES KAPITEL.
|
|
|
Unsere Fahrt auf dem
Tanganika.
|
|
|
Unser Fahrzeug ein schwanker Nachen. — Sehr
grosser hundeähnlicher Affe. — Die Fischer des Tanganika. — Fluss und
Dorf Zassi. — Sondirungen des Sees. — Die Insel Nyabigma. — Störung
beim Abendessen. — Feindseligkeit der Eingeborenen. — Krieg zwischen
Mukamba und Warumaschanya. — Ein Mgwana behauptet, der Rusizi fliesse
aus dem See. — Ich werde vom Fieber aufs Lager geworfen und vom Doctor
gepflegt. — Mukamba widerspricht dem Bericht des Mgwana. — Massen von
Krokodilen. — Ruhinga’s Kunde. — Das Ende des Sees und die Mündung des
Rusizi. — Die Frage, ob der Rusizi in den See oder aus demselben
fliesst, ist auf immer gelöst. — Der Doctor glaubt noch immer an einen
Abfluss des Sees. — Burton’s und Speke’s weitester Punkt. — Zeichen
von Unruhe in Mruta’s Dorfe. — Die New York-Herald-Inseln. — Cap
Luvumba. — Ein Gefecht in Vorbereitung. — Der Sultan wird beruhigt. —
Eine tragikomische Scene. — Rückkehr nach Udschidschi.
|
|
|
VIERZEHNTES KAPITEL.
|
|
|
Geographische und ethnographische Bemerkungen.
|
|
|
FUNFZEHNTES KAPITEL.
|
|
|
Unsere Reise von Udschidschi
nach Unyanyembé.
|
|
|
Plaudereien mit Livingstone über die Ereignisse
unseres „Pickenicks“. — Der Doctor will durchaus nicht in seine Heimat
zurückkehren, ehe er seine Aufgabe gelöst. — Er tadelt Dr. Kirk, dass
ihm dieser Sklaven zugeschickt, denen er befohlen, Livingstone nach
Hause zu bringen. — Er bekommt seine gezogenen Enfield-Gewehre wieder.
— Er entschliesst sich, mich nach Unyanyembé zu begleiten. — Ein
Anfall von remittirendem Fieber. — Unser Christfest. — Abreise von
Udschidschi. — Unsere Reise auf dem Tanganika. — Ankunft am Liutsché
und Fahrt über denselben. — Fahrt über den Malagarazi. — Im Tanganika
existirt keine Strömung. — Ankunft in Urimba. — Zebrajagd. — Das Thal
des Loadscheri. — Erlegung einer Büffelkuh. — Zusammentreffen mit
einem Elefanten. — Erzählungen Reisender. — Rothbärtige Affen. —
Anblick von Magdala. — Das Thal Imrera. — Der Doctor ist fussleidend.
— Heerden von Wild in der Mpokwa-Ebene. — Erlegung zweier Zebras. —
[S. vii]
Eine Heerde Giraffen. — Eine Giraffe wird verwundet. — Ibrahim’s
Sklave Ulimengo läuft fort. — Breite von Mpokwa. — Umschmelzen von
Zink-Feldflaschen zu Kugeln. — Mit diesen wird eine Giraffe erlegt. —
Aufbruch nach Misonghi. — Der Doctor wird entsetzlich zerstochen von
wilden Bienen. — Mirambo ist durch Hunger vernichtet. — Shaw’s Tod. —
Ereignisse aus dem Leben und Tod Robert Livingstone’s. — Ein Löwe im
Grase. — Drei Löwen. — Ankunft in Ugunda. — Einfangen des Deserteurs
Hamdallah. — Ankunft in Unyanyembé.
|
|
|
SECHZEHNTES KAPITEL.
|
|
|
Die Heimreise.
|
|
|
Livingstone’s Vorräthe werden aufgemacht. — Sie
erweisen sich als eine Täuschung. — Asmani wird als schuldig erfunden.
— Weisse Ameisen haben den Branntwein ausgetrunken und die Flaschen
wieder zugekorkt! — Die Güter werden Livingstone übergeben. — Er
schreibt Briefe nach Hause. — Sein Brief an James G. Bennett. — Gesang
der Eingeborenen. — Der letzte Abend mit Livingstone. — Sein Tagebuch
wird versiegelt. — Unsere endliche Abreise. — Lebewohl! — Halt in
Tura. — Briefe vom Doctor. — Ankunft in Kiwyeh. — Ueberall erschallen
Schlachthörner der Wagogo. — Vollständiges Kampfkostüm. — Ein falscher
Alarm. — Der Häuptling Khonze leistet unserm Weiterziehen Widerstand.
— Vorbereitung zum Kampf. — Ein Mnyamwezi wird an der Kehle gepackt
und der Frieden wiederhergestellt. — Ankunft in Kanyenyi. — Besuch des
Sultans. — Das Dorf Mapanga. — Plötzliches Zusammenlaufen bewaffneter
Eingeborenen. — Vierzig Speere gegen vierzig Flinten. — Tribut wird
verlangt und bezahlt. — Leucole’s Bericht über Farquhar’s Tod. — Das
Thal des Mukondokwa. — Durch die Masikazeit verursachte Noth. —
Furchtbare Fluten. — Kampf gegen Moskito-Schwärme. — Des Doctors
Depeschen-Kasten in Gefahr. — Er wird mit Seilen durch den Fluss
gezogen. — Ankunft in Simbamwenni. — Die Stadtmauer ist
fortgeschwemmt. — Furchtbarer Sturm. — Zerstörung von hundert Dörfern.
— Die Msunva-Dschungels. — Schrecken derselben. — „Heiss Wasser“
Ameisen. — Nachrichten aus Zanzibar. — Ankunft in Bagamoyo. —
Zusammenkunft mit der Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung
Livingstone’s.
|
|
|
[S. viii]
SIEBZEHNTES KAPITEL.
|
|
|
Ende der Expedition.
|
|
|
Anhang.
|
|
|
Wörterverzeichniss.
|
|
|
Register.
|
|
|
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN.
|
|
|
Ansicht aus Uvinza
|
|
|
Dorf in Uzavira. — Einheimische Töpferwaaren
|
|
|
Unser Haus in Udschidschi
|
|
|
Am Tanganika-See
|
|
|
Susi, der Diener Livingstone’s
|
|
|
Kühe aus Udschidschi und Unyamwezi, Pariahund,
fettschwänziges Schaf
|
|
|
Fische aus dem Tanganika
|
|
|
Ein Götzenbild
|
|
|
Dolche und Speerspitzen
|
|
|
Unser Lager in Urimba
|
|
|
Ein Halteplatz
|
|
|
Unamapokera
|
|
|
Andenken
|
|
|
SEPARATBILDER.
|
|
|
Zusammentreffen mit Dr. Livingstone (Titelbild).
|
|
|
Eberjagd
|
|
|
Halt in Magala in Urundi
|
|
|
An der Mündung des Rusuzi
|
|
|
Verschiedene Gerätschaften
|
|
|
Dr. Livingstone mit seinem Tagebuch beschäftigt
|
|
|
Fahrt auf dem Tanganika-See
|
|
|
Erlegung eines Büffels
|
|
|
Eine Ueberraschung
|
|
|
Ein Löwe im Gras
|
|
|
Mein Haus in Kwihara in Unyanyembé
|
|
|
Die Wagogo zum Krieg ausziehend
|
|
|
Ein drohender Kampf
|
|
|
„Nimm dich in Acht!“
|
|
[S. 1]
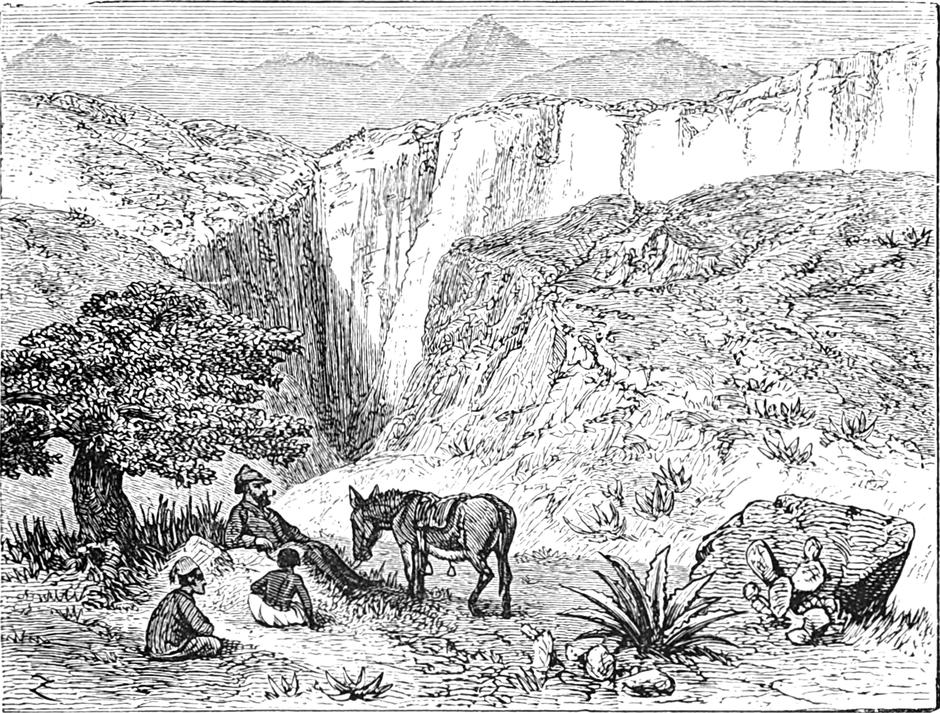
Abreise aus Mrera. — Lager in den Dschungels. — Ich versinke bis an den Hals in den Schlamm des Rungwa. — Der Mpokwa-Fluss. — Erster Blick in die Heimat des Löwen. — Eine Schar Affen. — Abenteuer mit einem riesigen wilden Eber. — Ein Löwe verfolgt mich. — Ein Tag voll grosser Sorgen. — Erlegung eines Büffels. — Ein Leopard. — Büffeljagd. — Drohende Hungersnoth. — Welled Nzogera’s Wohnsitz. — Reichliche Lebensmittel. — Ein Esel versinkt im Morast. — Gesandtschaft an den Häuptling Kiala. — Siebenstündige Unterredung. — An den Ufern des Malagarazi. — Unser Esel Simba wird von einem Krokodil gepackt und fortgeschleppt. — Nachrichten von Livingstone. — Aufenthalt in Kawanga. — Streitigkeiten über den Tribut. — Unverschämte Forderungen. — Wir setzen über die Flüsse Pombwe und Kanengi. — Mitternächtlicher Marsch durch die Dschungels. — Ein unsinniges Weib verräth uns fast durch ihr Geschrei. — Das Donnern des Tanganika. — An den Ufern des Rugufu. — Niamtaga. — Der Tanganika! Hurrah! Entfaltet die Fahnen! — Susi, Dr. Livingstone’s Diener, begrüsst uns: „Guten Morgen, mein Herr!“ — „Vermuthlich Dr. Livingstone?“ „Ja!“ — Unterhaltung mit dem Doctor. — Gute Nacht.
[S. 2]
|
UKONONGO.
|
UVINZA.
|
St.
|
M.
|
||
|
Von Mrera nach
|
St.
|
M.
|
Welled Nzogera
|
1
|
30
|
|
Mtoni
|
4
|
30
|
Lager im Walde
|
4
|
15
|
|
Misonghi
|
4
|
30
|
Siala am Malagarazi
|
2
|
45
|
|
Mtoni
|
6
|
—
|
Ihata-Insel im Malagarazi
|
1
|
30
|
|
Mpokwa in Utanda
|
4
|
45
|
Katalambula
|
1
|
45
|
|
Mtoni
|
3
|
—
|
|||
|
UHHA.
|
|||||
|
UKAWENDI.
|
Kawanga in Uhha
|
5
|
30
|
||
|
Mtambu-Fluss
|
4
|
30
|
Lukomo
|
1
|
—
|
|
Imrera
|
4
|
20
|
Kahirigi
|
4
|
—
|
|
Rusawa-Berge
|
2
|
30
|
Rusugi-Fluss
|
5
|
—
|
|
Mtoni
|
4
|
—
|
See Musunya
|
4
|
—
|
|
Mtoni
|
5
|
—
|
Rugufu-Fluss
|
4
|
30
|
|
Lager im Walde
|
6
|
—
|
Sunuzzi-Fluss
|
3
|
—
|
|
Lager im Walde
|
5
|
30
|
Niamtaga Ukaranga
|
9
|
30
|
|
UDSCHIDSCHI.
|
|||||
|
Hafen von Udschidschi
|
6
|
—
|
|||
Am 17. October sagten wir Mrera Lebewohl, um unsern Weg nach Nordwesten fortzusetzen. Ich stand jetzt mit allen meinen Leuten auf freundschaftlichem Fusse; alles Streiten hatte lange aufgehört. Bombay und ich hatten unsern Zank vergessen; vielmehr waren der Kirangozi und ich bereit, uns zu umarmen, auf so cordialem Fuss standen wir zueinander. Das Vertrauen ist in alle Herzen zurückgekehrt, denn jetzt konnten wir ja wie Mabruk-Unyanyembé sagte, „die Fische des Tanganika riechen“. Weit hinter uns lag Unyanyembé mit aller seiner Unruhe. Wir konnten uns über den furchtbaren Mirambo und seine frevelhaften Banden lustig machen, und nach und nach werden wir wol auch den furchtsamen Propheten, Scheikh, den Sohn Nasib’s, der uns stets schreckliche Ereignisse in Aussicht stellte, auslachen können. Als wir in einer Reihe wie Indianer durch das jenseits der Wiesen von Mrera liegende junge Walddickicht zogen, lachten wir fröhlich und waren stolz auf unsere Grossthaten. Ja, wir waren an jenem Morgen wirklich tapfer!
Als wir aus dem Dickicht traten, kamen wir in einen offenen Wald, dessen zahlreiche Ameisenhügel wie Sanddünen aussahen. Ich denke, diese Ameisenhaufen sind während einer besonders nassen Jahreszeit aufgebaut worden, wo die waldbedeckte Ebene wol unter Wasser steht. Ich[S. 3] habe die Ameisen zu tausenden am Bau ihrer Hügel in andern Districten, die von Ueberschwemmungen litten, beschäftigt gesehen. Welch wunderbares System von Zellen erbauen doch diese winzigen Insekten! Ein vollständiges Labyrinth, Zelle in Zelle, Kammer in Kammer, Halle in Halle! Welche Talente als Ingenieure und bedeutende Architekten legen sie an den Tag! Wie musterhaft ist die Stadt, die sinnreich zu ihrer Sicherheit und Bequemlichkeit angelegt ist!
Nach einem Marsch von kaum einer Stunde kamen wir aus dem Walde heraus und begrüssten den Anblick eines klaren, murmelnden Baches, der rasch nach Nordwesten floss, den wir mit dem Vergnügen ansahen, das nur Leute nachempfinden können, die lange Zeit an dem schlechtesten Trinkwasser, das man in Salzebenen, Mbugas, Pfützen und Wasserlöchern findet, gelitten haben. Auf der andern Seite dieses Baches erhebt sich ein rauher, steil abfallender Gebirgszug, von dessen Gipfel unsere Augen sich an malerischen, belebten Landschaften weiden! Sie bilden für unsere an dem Anblick tiefer Wälder, hoher Baumstämme und buschiger Laubkronen übersättigten Augen ein ungewöhnliches Fest. Jetzt haben wir Dutzende von Kegeln über die weite Ebene zerstreut vor uns, welche sich über Süd-Ukonongo in das Gebiet der Wafipa erstreckt und bis an die Rikwa-Ebene reicht. Die weit ausgedehnte Aussicht, die sich plötzlich vor uns eröffnet, ist sehr mannichfaltig. Ausser Bergkegeln und hochstrebenden, einzelstehenden Bergen mit flachen Gipfeln sehen wir die Wasserscheide des Rungwa-Flusses, der sich südlich von uns in den Tanganika ergiesst, und die des Malagarazi-Flusses, den der Tanganika etwa einen Grad nördlich von unserm jetzigen Standpunkt aufnimmt. Ein einzelner länglicher, dem geographischen Breitengrade folgender Bergrücken trennt die Wasserscheide des Rungwa und Malagarazi voneinander, und etwa 20 engl. Meilen westlich von diesem Höhenzuge erhebt sich ein anderer, welcher sich von Norden nach Süden hinzieht.
An diesem Tage lagerten wir in den an einer engen Schlucht mit Moorboden liegenden Dschungels, durch deren Schlammmassen das Wasser des Rungwa langsam nach Süden, der Rikwa-Ebene zu sickert. Dies war aber nur eine[S. 4] der vielen Schluchten, von denen einige mehrere hundert Fuss, andere nur wenige Schritt breit sind, und deren Gründe gefährliche von dichten hohen Binsen und Papyrus überwachsene Sümpfe bilden. Auf der Oberfläche dieser grossen Kothabgründe sieht man Hunderte von dünnen Streifen schlammigen, ockerfarbigen Wassers, in denen kleine Thierchen wimmeln. Allmählich, einige Meilen südlich vom Fusse des Höhenzugs (den ich Kasera nenne) nach dem Lande, das er durchschneidet, kommen diese verschiedenen Wasserläufe zusammen und münden in dem weiten, marschigen, schlammigen „Fluss“ Usense, welcher hier schräg in südöstlicher Richtung ablenkt. Hierauf wird er, nachdem er den Inhalt der Wasserläufe aus Norden und Nordwesten in seinen breitern Kanal aufgenommen hat, bald zu einem Bache von einiger Breite und Bedeutung und trifft mit einem von Osten, aus der Gegend von Urori kommenden Flusse zusammen, mit dem er gemeinschaftlich die Rikwa-Ebene durchfliesst und sich etwa 60 engl. Meilen, in gerader Linie, weiter westlich in den Tanganika-See ergiesst. Der Rungwa-Fluss wird, wie man mir sagt, als eine Grenzlinie zwischen dem nördlich gelegenen Lande Usowa und dem südlichen Ufipa betrachtet.
Kaum hatten wir den Bau unserer Lagerumzäunung vollendet, als einige unserer Leute eine kleine Anzahl Eingeborner anriefen, die sich auf unser Lager zu bewegten, und an deren Spitze ein Mann war, den wir nach Kleidung und Kopfputz als aus Zanzibar kommend erkannten. Nachdem wir die gewöhnlichen Begrüssungen ausgetauscht, sagte man mir, dass diese Leute eine Gesandtschaft von Simba (dem Löwen) sei, der über Kasera in Süd-Unyamwezi herrscht. Simba sollte der Sohn von Mkasiwa, König von Unyanyembé, sein und führte Krieg mit den Wazavira, vor denen man mich gewarnt hatte. Er hatte so viel von meiner Grösse gehört, dass er es bedauerte, dass ich meinen Weg nicht nach Ukawendi nähme, damit er Gelegenheit erhalte, mich zu sehen und sich mit mir zu befreunden. Anstatt mich persönlich zu besuchen, hatte Simba mir diese Gesandtschaft nachgeschickt in der Hoffnung, dass ich ihm ein Zeichen meiner Freundschaft in Gestalt von Tuch geben werde.[S. 5] Obwol ich durch dieses Verlangen etwas überrascht wurde, so war es doch gewiss politisch, diesen mächtigen Häuptling mir zum Freunde zu machen, um auf meinem Rückwege nicht etwa mit ihm aneinander zu gerathen.
Da ich also um des Friedens willen durchaus ein Geschenk machen musste, so war es nöthig, dass ich meine Friedensliebe durch etwas vorzügliches an den Tag legte. Der Gesandte nahm daher Simba, dem Löwen von Kasera, zwei prächtige Tücher und noch zwei Doti Merikani und Kaniki von mir mit, und wenn ich dem Botschafter trauen durfte, so hatte ich mir nun Simba auf immer zum Freunde gemacht.
Am 18. October brachen wir das Lager zur gewöhnlichen Zeit ab und setzten unsern Marsch nordwestlich auf einem Wege fort, welcher sich längs des Fusses der Kasera-Berge im Zickzack hinzog und uns allerhand Beschwerden brachte. Wir überschritten wenigstens ein Dutzend Sumpfschluchten, deren tiefer Koth und vieles Wasser uns grosse Angst verursachten. Ich sank bis an den Hals in tiefe, von Elefanten ausgetretene Löcher wahrhaft stygischen Schlammes und musste durch die weichen durchsickerten Bette der Rungwa-Quellen mit nassen, von Koth und Schlamm beschmutzten Kleidern hindurch. Der Anstand verbot es mir, mich zu entkleiden und nackt durch den Binsenmoor zu waten; auch hätte die heisse Sonne meinen Körper mit Blasen bedeckt. Ausserdem waren diese Moräste zu häufig, um mit An- und Auskleiden Zeit zu verlieren, und da ein Jeder meiner Leute mit einer gehörigen Last versehen war, so wäre es grausam gewesen, sie dazu zu zwingen, mich hinüberzutragen. Es blieb also nichts übrig, als belastet wie ich war mit meinen Kleidern und meiner Ausrüstung in diese verschiedenen sumpfigen Wasserläufe weiter hineinzumarschiren und mir all den philosophischen Stoicismus zu bewahren, den meine Natur für solche Fälle aufzubieten hat. Zum mindesten gesagt war dieser Marsch aber höchst ungemüthlich.
Alsbald kamen wir in das Gebiet der gefürchteten Wazavira, doch liess sich kein Feind sehen. Simba hatte in seinem Kriege den nördlichen Theil von Uzavira rein ausgeplündert, und wir sahen dort nichts schlimmeres als das[S. 6] verwüstete Land, das einst, wenn man nach der Zahl der verbrannten Hütten und Reste zerstörter Dörfer urtheilen darf, sehr bevölkert gewesen sein muss. Auf den Feldern sprosste üppig junges Gebüsch und sie wurden rasch die Heimat der wilden Bewohner des Waldes. In einem der verlassenen und zerstörten Dörfer fand ich ein durchaus nicht unangenehmes Quartier für die Expedition. In der Umgegend von Misonghi, des verlassenen Dorfes, das wir bewohnten, schoss ich drei Paar Perlhühner und einer meiner Jäger, Ulimengo, erlegte eine Antilope, welche „Mbawala“ heisst und gegen deren Fleisch einige der Wanyamwezi einen abergläubischen Widerwillen haben. Ich halte diese Gattung Antilopen, die ungefähr 3½ Fuss hoch ist, rothes Fell, langen Kopf und kurze Hörner hat, für die von Speke in Uganda entdeckte „Nzoe“-Antilope, deren lateinischer Name nach Dr. Sclater „Tragelaphus Spekii“ ist. Sie hat einen kurzen, buschigen Schwanz und langes Haar den Rücken entlang.
Ein langer Marsch von sechs Stunden Dauer, in einer Richtung von West zu Nord, der uns durch einen Wald führte, wo die schwarze Antilope zu sehen und der auch sonst noch reich an Jagdthieren war, brachte uns an einen Bach, der am Fusse eines hohen Bergkegels vorbeifliesst, zu dessen Abhängen ein ganzer Wald von Federbambus blühte.
Am 20. verliessen wir unser Lager, das zwischen dem Bache und dem eben erwähnten Bergkegel lag, und gingen über einen niedrigen Bergrücken, der von dem Fusse des Hügelkegels sich hinabzieht. Hier wurden wir von einem andern malerischen Anblick begrüsst, von Kegeln nämlich und Bergabdachungen, welche sich nach allen Richtungen erhoben. Ein Marsch von fast fünf Stunden durch dieses malerische Land brachte uns an den Mpokwa-Fluss, einen Nebenfluss des Rungwa, und an ein vor kurzem von den Wazavira verlassenes Dorf. Die Hütten desselben waren fast alle unversehrt, genau so wie sie von ihren früheren Bewohnern verlassen worden. In den Gärten fand man noch essbare Gemüsepflanzen, die uns, nachdem wir uns so lange von Fleisch genährt, sehr gelegen kamen. Auf den Zweigen der Bäume ruhten noch die Laren und Penaten der Wazavira[S. 7] in Gestalt von grossen und sehr wohl geformten irdenen Töpfen.

In dem nahe gelegenen Fluss gelang es einem meiner Leute, in wenig Minuten 60 Fische von einer Welsart mit blosser Hand zu fangen. Um den Strom schwebte eine Anzahl Vögel, wie z. B. der weissköpfige Fischadler, der schwarze Königsfischer, grosse schneeweisse Löffelgänse, Ibisse, Schwalben u. dergl. m. Dieser Fluss kommt aus einer etwa acht Meilen nördlich vom Dorfe Mpokwa belegenen Berggruppe und fliesst als schmaler Wasserstreifen herab, der sich unter hohen Binsen und dichten zu beiden Seiten wachsenden Farrnkräutern, der Heimat von Hunderten von Antilopen und Büffeln, durchwindet. Südlich von Mpokwa wird das Thal breiter, die Berge wenden sich nach Ost und West, und jenseits beginnt die Ebene, die als das Rikwa bekannt ist, welche während der Masikazeit überschwemmt ist, in der trockenen Jahreszeit aber denselben verdorrten Anblick darbietet, wie die meisten afrikanischen Ebenen, wenn das Gras reif ist.
[S. 8]
Am 21. gelangten wir, das rechte Ufer des Mpokwa entlang ziehend, an den Ursprung des Baches und die Quellen des Mpokwa, die aus tiefen, von hohen Bergrücken umgebenen Engpässen herkommen. Das Mbawala und der Büffel sind hier in Menge vorhanden.
Nach einem Marsche von 4½ Stunden kamen wir am 22. an den schönen Bach Mtambu, dessen Wasser süss und klar wie Krystall ist, und der nach Norden fliesst. Zum ersten male sahen wir hier die Heimat des Löwen und Leoparden, und es fielen mir dabei Freiligrath’s Verse über dieselbe ein, denn wir schlugen unser Lager wenige Schritte von einem Orte auf, der genau der Beschreibung des Dichters entspricht. Der Viehtreiber, der die Ziegen und Esel unter seiner Obhut hatte, trieb die Thiere bald nach unserer Ankunft im Lager ans Wasser, und um dahin zu kommen mussten sie einen von Elefanten und Rhinozeros in dem Farrnkraut gemachten Tunnel passiren. Kaum hatten sie den dunkeln Höhlendurchgang betreten, als ein schwarzgefleckter Leopard hervorsprang und seine Klauen in den Nacken eines der Esel einschlug, sodass dieser vor Schmerz furchtbar aufschrie. Die andern Esel stimmten in den schrecklichen Chor mit ein und schlugen mit den Hinterbeinen so sehr gegen die Räuberkatze in die Luft, dass der Leopard durch das Dickicht davonsprang, als ob er geradezu von dem lärmenden Geschrei, den sein Angriff erzeugt hatte, erschreckt worden sei. Der Hals des Esels zeigte einige starke Wunden, doch das Thier war nicht gerade gefährlich verletzt.
In der Hoffnung, dass ich vielleicht ein Abenteuer mit einem Löwen oder Leoparden in jenem dunkeln Gürtel hoher Bäume haben könnte, unter deren dichtem Schatten das undurchdringliche Dickicht sich ausbreitete, das so vortreffliche Schlupfwinkel für die Fleischfresser bildet, schlenderte ich den schrecklichen Platz entlang in Begleitung des Gewehrträgers Kalulu, welcher zwei Flinten und grössern Munitionsvorrath bei sich trug. Vorsichtig krochen wir dahin und blickten scharf in die tiefen, dunkeln Höhlen, deren Eingang wir auf unserm Wege erblickten. Jeden Augenblick erwarteten wir den berühmten Monarchen des Dickichts zu erblicken, wie er eben auf uns zuspringen[S. 9] wollte, und ich hatte ein besonderes Vergnügen daran, mir den Glanz und die Majestät des wüthenden Thieres vorzustellen, wenn es vor mich hintrete. In jede dunkle Oeffnung schaute ich genau hinein in der Hoffnung, das tödliche Glänzen der grossen wüthenden Augen und die finsterblickende Stirn des Löwen zu sehen, aber leider, nachdem ich eine Stunde nach Abenteuern ausgeschaut, war mir nichts begegnet. Dadurch wurde ich muthig und kroch in eine der belaubten, dornigen Höhlen, wo ich mich alsbald unter einem Laubdach befand, das ungefähr hundert Fuss über meinem Kopf von den stattlichen grossen Stämmen des königlichen Mvule gebildet wurde. Wer kann sich die Lage vorstellen? Es war eine ebene, wiesenartige Lichtung; dichtes undurchdringliches Dickicht umgab uns, jene stattlichen, von der Natur geschaffenen Säulen, eine herrliche Reihe ausgezeichneter Bäume, welche in bedeutender Höhe lebhaft grüne Laubmassen trugen, durch welche kein einziger Sonnenstrahl durchdringen konnte, standen ringsum, während zu unsern Füssen der Bach über glatte Kiesel in sanften Tönen dahin murmelte, welche der heiligen Ruhe des Schauplatzes entsprachen. Wer hätte diese heilige feierliche Harmonie der Natur entweihen können? Doch gerade als ich es für unmöglich hielt, dass jemand sich versucht fühlen könne, die friedliche Einsamkeit des Ortes zu stören, erblickte ich einen Affen hoch auf einem Baumzweige über meinem Kopfe, der sich mit erschreckten Blicken die unten stehenden sonderbaren Eindringlinge beschaute. Nun konnte ich nicht umhin, laut und lange zu lachen, bis ich von dem Chaos von Geschrei und sonderbaren Geräuschen, die mein Lachen zu erwidern schienen, zur Ruhe gebracht wurde. Eine Heerde Affen, die in dem dichtem Laube oben verborgen war, war grausam aufgeweckt worden, und durch den von mir verursachten Lärm erschreckt eilten sie mit furchtbarem Geschrei und Geheule von dem Schauplatz.
Wieder ins helle Sonnenlicht hinaustretend, schlenderte ich weiter und suchte nach etwas Schiessbarem. Bald sah ich in dem Walde, der zur Linken an das Thal des Mtambu grenzt, einen grossen, röthlichen, wilden, mit fürchterlichen Hauern bewaffneten Eber ruhig grasen. Ich liess Kalulu[S. 10] sich hinter einen Baum verkriechen und warf meinen Sonnenhut dicht daneben hinter einen andern, damit ich das Thier um so sicherer stellen könne, ging darauf bis auf eine Entfernung von etwa 40 Meter auf dasselbe zu, zielte bedächtig und feuerte auf seine vordere Schulter. Das Thier machte einen wüthenden Sprung, als ob es durchaus nicht verletzt sei, und stand dann mit emporstehenden Borsten und aufwärts gebogenem buschigem Schweif da, ein furchtbarer Anblick. Während es so aufhorchte und mit den scharfen kleinen Augen die Nachbarschaft durchmusterte, jagte ich ihm noch einen Schuss in die Brust, der ihm durch den Körper drang. Anstatt jedoch zu fallen, wie ich erwartet hatte, machte es einen furchtbaren Angriff in der Richtung, aus der die Kugel gekommen war, und da es an mir vorbeischoss, feuerte ich noch eine Kugel ab, die es geradezu durchbohrte. Trotzdem lief es weiter, bis es in einer Entfernung von sechs bis sieben Schritt von den Bäumen anlangte, hinter denen Kalulu und mein Hut versteckt lag, wo es plötzlich halt machte und dann hinstürzte. Als ich mich ihm aber mit meinem Messer nähern wollte, um ihm den Hals zu zerschneiden, sprang es plötzlich auf; es hatte den kleinen Kalulu erblickt und fast unmittelbar darauf wurden seine Augen durch meine weisse Kopfbedeckung angezogen. Diese sonderbaren vor ihm liegenden Gegenstände schienen für den Eber zu viel zu sein, denn mit einem schrecklichen Grunzen stürzte er sich seitwärts in ein dichtes Gestrüpp, aus dem man ihn nicht herausziehen konnte. Da es aber jetzt zu spät wurde und das Lager fast drei Meilen entfernt war, so musste ich, obwol ungern, ohne diese Beute heimkehren.
Auf unserm Wege ins Lager wurden wir von einem grossen Thiere, das uns beständig auf der linken Seite folgte, begleitet. Es war zu dunkel, um deutlich sehen zu können, doch war eine grosse Gestalt in nicht ganz klaren Umrissen erkennbar. Es muss ein Löwe gewesen sein, wenn es nicht der Geist des todten Ebers war.
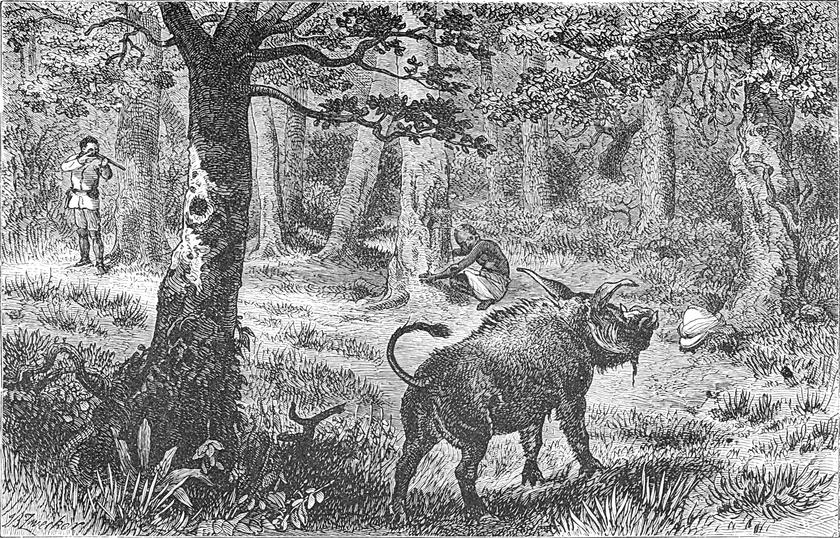
In jener Nacht wurden wir ungefähr um 11 Uhr durch das Gebrüll eines Löwen dicht am Lager aufgeschreckt. Bald kam noch einer und schliesslich ein dritter hinzu, und[S. 11] die Neuheit der Sache hielt mich wach. Ich spähte durch die Pforte des Lagers und versuchte ein gezogenes Gewehr, nämlich meine kleine Winchester-Flinte, auf deren Genauigkeit ich grosses Vertrauen setzte, gegen ein Thier zu richten; doch war es schade um die Patronen; sie hätten ebensogut mit Sägespänen gefüllt sein können, so wenig nützte mir mein Schiessen. Mismuthig über die elende Munition liess ich die Löwen allein und kehrte auf mein Lager zurück, wo ich von ihrem Brüllen in Schlaf gewiegt wurde.
Das Thal des durchsichtigen Mtambu, dieses irdische Paradies des Jägers, vertauschten wir am nächsten Morgen mit der den Wakawendi als Imrera’s Kolonie bekannten Ansiedlung, doch kam uns dies jetzt nach jener schönen Gegend wie eine Wüste vor. Das Dorf, in dessen Nähe wir unser Lager aufschlugen, hiess Itaga und lag im District von Rusawa. Sowie wir den Fluss Mtambu überschritten hatten, traten wir in Ukawendi ein, das gewöhnlich von den Eingebornen des Landes Kawendi genannt wird.
Der Bezirk Rusawa ist dichtbevölkert. Das Volk ist ruhig und Fremden freundlich gesinnt, obgleich nur wenige aus der Ferne diese Gegenden besuchen. Ein paar Waswahilihändler kommen zwar fast jedes Jahr aus Pumburu und Usowa hierher; da aber von diesem Volk sehr wenig Elfenbein zu erlangen ist, so schreckt die grosse Entfernung zwischen den verschiedenen Ansiedlungen den regelmässigen Händler davon ab, sich soweit zu wagen.
Wenn Karavanen hier ankommen, so ist der Bezirk Pumburu ihr Zielpunkt, welcher einen guten Tagesmarsch oder gegen 30 engl. Meilen südwestlich von Imrera liegt; oder sie ziehen nach Usowa am Tanganika, über Pumburu, Katuma, Uyombeh und Ugarawah. Usowa ist ein ganz wichtiger, bevölkerter und blühender Bezirk am Tanganika. Diesen Weg hatten wir, nachdem wir Imrera verlassen, eigentlich einzuschlagen beabsichtigt, doch verboten uns die am letzteren Ort uns zugekommenen Gerüchte ein solches Wagniss. Denn der Sultan von Usowa, Mapunda, der zwar ein grosser Freund arabischer Händler ist, befand sich im Kriege mit der Kolonie der Wazavira, welche wie wir uns erinnern, von Mpokwa und dessen Umgegend in Utanda[S. 12] vertrieben worden waren und sich zwischen Pumburu und Usowa niedergelassen haben sollten.
Als kluge, vorsichtige Leute, die eine grosse und werthvolle Expedition zu hüten hatten, mussten wir uns darüber entscheiden, was zu thun und welche Route einzuschlagen sei, da wir jetzt weit näher an Udschidschi als an Unyanyembé waren. Ich schlug vor, wir sollten, dem Compass nach, den directen Weg an den Tanganika einschlagen und ohne uns einem bestimmten Weg oder Führer anzuvertrauen, gerade westlich ziehen, bis wir an den Tanganika kämen, und dann dem Seeufer bis nach Udschidschi folgen. Denn in meinem Geist spukte stets die Vorstellung, dass Dr. Livingstone, wenn er von meiner Ankunft höre, was ja möglich war, falls ich einen bekannten Weg einschlug, Udschidschi verlassen und meine Expedition infolge dessen ihm stets nachziehen würde, ohne ihn zu erreichen. Doch hielten meine bewandertsten Leute es für besser, dass wir kühn nordwärts ziehen und an den Malagarazi marschiren sollten, der ein grosser von Osten her in den Tanganika fliessender Fluss sein sollte. Keiner meiner Leute jedoch kannte den Weg nach dem Malagarazi, auch konnten wir keinen Führer von dem Sultan Imrera miethen. Man sagte uns aber, der Malagarazi sei nur zwei Tagemärsche von Imrera entfernt. In diesem Falle hielt ich es für gerathen, meine Leute mit Vorräthen auf drei Tage zu versehen.
Das Dorf Itaga liegt in einer tiefen Bergschlucht und überblickt eine ausgedehnte bebaute Fläche. Die Leute ziehen süsse Kartoffeln, Maniok, — aus dem Tapioka gemacht wird, — Bohnen und den Holcus. Weder für Geld noch gute Worte konnten wir ein einziges Hühnchen kaufen, sondern waren nur im Stande, uns Korn und ein mageres, vor längerer Zeit aus Uvinza importirtes Exemplar einer Ziege zu verschaffen.
Des 25. Octobers werde ich mich stets als eines sorgenvollen Tages erinnern; denn mit ihm trat eine Reihe von Fatalitäten ein. Um Zutritt zu dem Hochplateau, welches das Thal von Imrera westlich und nördlich begrenzt, zu erlangen, zogen wir einen nach Osten führenden Weg. Nach einem Marsch von 2½ Stunden campirten wir am Fusse[S. 13] desselben. Der Pass versprach einen bequemen Aufgang auf den Gipfel des Hochlands, das sich in einer Reihe von Abhängen tausend Fuss über dem Thale Imrera erhob.
Meine Leute gaben mir zu verstehen, dass sie einen Tag in diesem Lager halt machen wollten, um sich aus Imrera weitere Erkundigungen in Betreff des Charakters des zwischen uns und dem Malagarazi liegenden Landes zu verschaffen. Das war natürlich Unsinn, da ich schon einen Tag in Imrera gehalten und die Führer mich dort bewogen hatten, diesen Weg einzuschlagen, weil sie angeblich von Eingeborenen schon zuverlässige Nachrichten über das Land erhalten hatten. Ich dachte an den Rathschlag des Generals Andrew Jackson, den er einem jungen Freunde ertheilte, welcher so lautete: „Sehen Sie wohl zu, ehe Sie etwas unternehmen, aber wenn Sie sich entschlossen haben, es zu thun, thun Sie es sofort und blicken Sie nie rückwärts“, — und gerade das beabsichtigte ich zu thun.
Gegen Abend schoss einer meiner Leute einen Büffel, und dieser kleine Umstand wurde wieder die Veranlassung zu Streit und bösen Worten. Dem Büffel gelang es nämlich in ein Dickicht zu entkommen, wo man ihn sicher am nächsten Morgen als Leiche gefunden hätte. Mehrere von meinen gefrässigen und faulen Leuten baten mich, nun nur noch einen Tag zu halten, damit sie sich durch Fleisch stärken könnten. „Nicht eine Stunde nach dem morgenden Sonnenaufgang“, antwortete ich. Sofort erscholl allgemein das Geschrei: „Kein “Poscho„“, d. h. Essen. „Ihr habt Nahrungsmittel für drei Tage bei Euch“, erwiderte ich, „aber wenn Ihr mehr wünscht, so ist Tuch hier. Geht und kauft Euch etwas.“
Als ich ihnen aber auftrug, sich ins Dorf zu begeben, um Einkäufe zu machen, schützten sie sämmtlich zu grosse Ermüdung vor, bestanden jedoch darauf, dass ich verpflichtet sei, noch einen Tag halt zu machen, denn selbst wenn sie Korn kauften, so müsste dasselbe doch gemahlen werden, ehe sie es verzehren könnten. Die verwöhnten Burschen blieben lange bei diesem Raisonnement, aber ich war unerbittlich. Die ganze Nacht über debattirten sie über die Schritte, die sie zu thun hätten, um mich zum Halten zu[S. 14] bewegen. Ich hatte es jedoch Bombay und Mabruki schon verboten, sich mit einer derartigen Bitte an mich zu wenden, indem ich ihnen für solchen Fall eine gehörige Strafe in Aussicht stellte, und Bombay erinnerte sich der von Speke erhaltenen schrecklichen Bestrafung zu gut, um eine Wiederholung derselben zu wünschen.
Am nächsten Morgen erliess ich bei Sonnenaufgang den Marschbefehl in möglichst strengem, unnachgiebigem Tone, wodurch eine jede Anspielung auf ein ferneres Halten ausgeschlossen war. Sie waren zwar sehr verdriesslich und zur Rebellion geneigt, da ihnen aber nichts mehr übrig blieb, was sie als Grund hätten anführen können, kamen sie schliesslich, wenn auch widerwillig, meinem Befehl nach, und als wir in unserm Lager am Ursprung des Rugufu-Flusses angekommen waren, hatten die Leute den fetten Büffel vergessen und waren in ausgezeichneter Stimmung.
Als wir jenen hohen Gebirgsbogen, welcher westlich und nördlich das Becken von Imrera begrenzt, bestiegen, boten sich uns ausgedehnte Aussichten nach Süden und Osten dar. Der Charakter der Landschaft von Ukawendi ist stets belebt und malerisch, aber nie erhaben. Die Einschnitte dieser Höhenkette enthalten verschiedene Ruinen von Bomas, die während der Kriegszeit erbaut zu sein schienen.
Auf diesem Marsch war die Mbembufrucht sehr reichlich vorhanden und da ich hinter meinen Leuten herzog, konnte ich fortwährend sehen, wie sich diese eiligst einen Vorrath von den auf dem Boden herumliegenden Früchten einsammelten.
Kurz ehe ich das Lager erreichte, hatte ich auf einen Leoparden geschossen, ohne dass es mir gelungen wäre, ihn zu erlegen, da er fortsprang. Zur Nacht brüllten die Löwen wie am Mtambu-Fluss.
Ein ziemlich langer Marsch im dunkeln Schatten eines grossen Waldes, der uns vor den heissen Sonnenstrahlen schützte, brachte mich am nächsten Tage an ein vor kurzem von Arabern aus Udschidschi erbautes Lager, die so weit auf ihrem Wege nach Unyanyembé gekommen, aber durch die Gerüchte über den zwischen Mirambo und den Arabern wüthenden Krieg erschreckt, von hier zurückgekehrt waren.[S. 15] Unsere Route zog sich dem rechten Ufer des breiten, trägen Rugufu-Flusses entlang, der von Rohr, Binsen und Papyrus fast verstopft wird. Büffelspuren fanden sich überall zahlreich vor, auch hatten wir einige Anzeichen für die Nähe des Rhinozeros. In einer dichten Baumgruppe nahe am Fluss entdeckten wir eine Colonie bärtiger, löwenartig aussehender Affen.
Als wir am Morgen des 28. im Begriff waren, das Lager zu verlassen, spazirte eine Heerde Büffel bedächtig in Sicht. Sofort wurde völlige Stille unter uns hergestellt, doch nicht, bevor die Thiere zu ihrem grossen Erstaunen die ihnen drohende Gefahr entdeckt hatten. Als wir anfingen, sie zu stellen, hörten wir alsbald das donnernde Geräusch ihres Gallopirens, wonach es allerdings eine unnütze Aufgabe ist, ihnen zu folgen auf einem langen Marsch in die Wüste.
An diesem Tage führte der Weg über grosse Lagen Sandstein und Eisenerz. Das Wasser war abscheulich und spärlich und der Hunger fing an, uns ernstlich zu bedrohen. Wir waren bereits sechs Stunden lang unterwegs und hatten noch nirgends ein Zeichen von Cultur entdeckt. Nach meiner Karte befanden wir uns noch zwei lange Märsche vom Malagarazi, wenn Kapitän Burton die Lage dieses Flusses richtig bezeichnet hatte; nach den Berichten der Eingeborenen hätten wir denselben an diesem Tage erreichen müssen.
Am 29. verliessen wir unser Lager und befanden uns nach wenigen Minuten vor der erhabensten aber wildesten Landschaft, die wir bisher in Afrika gesehen hatten. Das Land war nach allen Richtungen von tiefen, wilden, engen Schluchten durchschnitten, die sich überall hin, meist aber nach Nordwesten zogen, und zu beiden Seiten erhoben sich enorme viereckige Massen nackter Felsen (Sandstein), die theils rund und hochaufgethürmt, theils pyramidal, theils in kreisförmigen Bergketten mit scharfem, rauhem, kahlem Grat in die Höhe stiegen. Nirgends war viel Vegetation sichtbar, ausser wo sie ein spärliches Unterkommen in der gespaltenen Krone eines riesigen Berggipfels fand, wo sich etwas Erdreich gesammelt hatte, oder am Fusse der röthlichen Ockerabhänge, die sich überall steil vor unserm Blick erhoben.
[S. 16]
Wir hatten eine lange Reihe von Felsrinnen hinabzusteigen, wo wir von drohenden Massen verwitternden Gesteins umgeben waren, bis wir an eine trockene, steinige Schlucht kamen, wo Berge von einigen tausend Fuss Höhe sich über uns emporthürmten. Dieser Schlucht, die sich nach allen Richtungen hin wand, allmählich aber zu einer weiten sich nach Westen hinziehenden Ebene erweiterte, folgten wir. Der Weg, der von hier weiter führte, ging über einen niedrigen Kamm nach Norden und wir erblickten verlassene Ansiedlungen, deren Dörfer auf dichter aussehenden, burgartigen Felsmassen erbaut waren. In der Nähe eines steil aufsteigenden Felsens von mehr als 70 Fuss Höhe und etwa 50 Meter Durchmesser, der die benachbarte riesenhafte Sykomore wie einen Zwerg erscheinen liess, schlugen wir nach einem anhaltenden und raschen Marsch von 5½ Stunden unser Lager auf.
Die Leute waren sehr hungrig; sie hatten jedes Stückchen Fleisch und jede Spur von Korn, die sie besassen, vor 20 Stunden aufgegessen, und eine sofortige Aussicht auf Nahrungsmittel war nicht vorhanden. Mir waren nur 1½ Pfund Mehl geblieben, und diese Quantität hätte nicht ausgereicht, um damit anzufangen, eine Truppe von mehr als 45 Leuten zu nähren; ich hatte aber noch ungefähr 30 Pfund Thee und 20 Pfund Zucker, und sobald wir im Lager ankamen, liess ich jeden Kessel füllen und aufs Feuer setzen, und für alle Thee bereiten, indem ich einem jeden ein Quart dieses heissen, angenehmen, gut versüssten Getränks gab. Einige meiner Leute stahlen sich auch in die Tiefen des Dickichts, um wildes Obst zu suchen, und kehrten alsbald mit Körben voll Waldpfirsich und Tamarinden zurück, welche ihnen, obwol sie nicht sättigten, doch einen Genuss boten. Ehe wir uns an jenem Abend zu Bett begaben, begannen die Wangwana ein lautes, an Allah gerichtetes Gebet um Nahrungsmittel.
Zeitig am Morgen erhoben wir uns mit dem Entschluss, weiter zu reisen, bis wir uns Nahrungsmittel verschaffen konnten, oder vor Strapazen und Schwäche umfielen. Spuren von Rhinoceros und Büffeln waren reichlich vorhanden, doch sahen wir kein lebendes Wesen. Wir zogen über eine Menge[S. 17] kurzer Abhänge, kamen häufig in die Abgründe trockner, steiniger Rinnen, und schliesslich in ein Thal, das auf der einen Seite von einem dreieckigen Hügel mit steilen Seitenwänden, und auf der andern von einer kühnen Gruppe von drei Bergen begrenzt war. Als wir dies Thal hinabmarschirten, das bald sein trocknes, dürres Aussehen mit einem lebhaften Grün vertauschte, erblickten wir in der Ferne einen Wald und befanden uns bald in Kornfeldern. Gierig schauten wir nach einem Dorfe aus und entdeckten ein solches auf dem Gipfel des hohen dreieckigen, zu unserer Rechten befindlichen Berges. Bei dieser Entdeckung erhob sich ein lautes Freudengeschrei, die Leute warfen ihre Lasten ab und fingen an nach Nahrungsmitteln zu rufen. Ich ersuchte Freiwillige, vorzutreten, um Zeug mitzunehmen und die Höhen zu erklimmen, um Victualien um jeden Preis aus dem Dorfe zu bekommen. Während drei oder vier danach ausgingen, ruhten wir ganz ermattet auf dem Boden aus.
In etwa einer Stunde kehrte unser Fouragecommando mit der erfreulichen Nachricht zurück, dass Nahrungsmittel reichlich vorhanden seien. Das Dorf, das wir sahen, hiess „Welled Nzogera’s“, des Sohnes von Nzogera; dies liess uns erkennen, dass wir uns in Uvinza befanden, da Nzogera der erste Häuptling von Uvinza ist. Ferner theilten sie uns mit, der Vater Nzogera führe Krieg mit Lokanda-Mira wegen einiger im Thale des Malagarazi belegenen Salzgruben und es werde infolge dessen schwer sein, auf dem gewöhnlichen Wege nach Udschidschi zu ziehen; doch sei der Sohn von Nzogera gegen Entschädigung bereit, uns mit Führern zu versehen, die uns sicher auf einem nördlichen Wege nach Udschidschi bringen könnten.
Da sich unsere Aussichten gut gestalteten, lagerten wir, um die reichlichen Vorräthe zu geniessen, für welche unsere Mühen und Entbehrungen während des Durchschreitens der Ukawendi-Wälder und -Dickichte uns gut vorbereitet hatten.
Dann fing eine diplomatische Verhandlung an in Bezug auf die Quantität und Qualität der Tuche, die der Sohn von Nzogera gewöhnlich von den Reisenden verlangte. Es gelang uns, seine Anforderungen von 10 auf 7½ Doti Merikani[S. 18] und Kaniki herabzudrücken und uns die Führer, die wir zu haben wünschten, zu verschaffen.
Nachstehend gebe ich einen Auszug aus meinem Marschtagebuch, da ich ohne seine Hülfe es für unmöglich halte, unsere verschiedenen Erlebnisse detaillirt zu erzählen, sodass man sie in ihrer Reihenfolge gehörig überblickt, und da diese Auszüge am Schlusse eines jeden Tages niedergeschrieben wurden, so besitzen sie, nach meiner Ansicht, mehr Interesse als eine kühle Erzählung von Thatsachen, die jetzt durch die Erinnerung abgeschwächt sind.
31. October, Dienstag. Lager im Dickicht. Richtung des Weges Nord zu Ost. Zeit des Marsches 4 Stunden 15 Minuten.
Nachdem wir den Fuss des dreieckigen Berges verlassen hatten, auf welchem der Sohn von Nzogera seine Veste gebaut hat, führte uns eine lange Zeit unser Weg ostnordöstlich, um einen tiefen, unpassirbaren Sumpf zu vermeiden, der sich zwischen uns und dem geraden Wege nach dem Malagarazi-Flusse befand. Das Thal neigte sich rasch in diesen Sumpf hinab, welcher in seine breite Fläche das Wasser von drei ausgedehnten Bergzügen aufnahm. Alsbald kehrten wir nach Nordwesten und bereiteten uns darauf vor, über den Morast zu ziehen. Als wir an seinem rechten Ufer hielten, theilten uns die Führer eine furchtbare Katastrophe mit, welche sich wenige Schritt oberhalb der Stelle, wo wir hinüberziehen wollten, ereignet hatte. Sie erzählten nämlich von einem Araber und seiner aus 35 Sklaven bestehenden Karavane, die plötzlich versunken und nie wieder gesehen worden sei. Dieser Sumpf bot scheinbar eine Breite von einigen hundert Meter dar und es wuchs ein dichtes aus Gras und vielen verwesten Stoffen bestehendes Netzwerk darüber. In seiner Mitte und unter diesem Grase lief ein breiter, tiefer, reissender Fluss. Meine Leute schlichen den voranziehenden Führern mit vorsichtigen Tritten nach. Als wir uns der Mitte näherten, sahen wir die unsichere, von der Natur so sonderbar gebildete Grasbrücke sich in schweren, langsamen Wellenlinien, dem Wogen des Meeres nach einem Sturm vergleichbar auf und ab bewegen. Wo die beiden Esel unserer Expedition gingen, erhoben sich die Graswellen[S. 19] einen Fuss hoch und plötzlich stürzte einer derselben so unglücklich mit den Füssen durch, dass er ausser Stande war aufzustehen, und die entstandene grosse Vertiefung füllte sich alsbald mit Wasser. Mit Hülfe von zehn Leuten gelang es uns jedoch, ihn wieder herauszuheben und auf einen festeren Punkt zu bringen. So kam denn die ganze Karavane, indem sie die beiden Thiere rasch weiter führte, ohne Unfall hinüber.
Als wir auf der andern Seite anlangten, schlugen wir uns nach Norden und kamen in ein herrliches, in jeder Beziehung für den Ackerbau geeignetes Land. Grosse Felsen erhoben sich hier und da; doch wuchsen in den Spalten derselben stattliche Bäume, unter deren Schatten die Dörfer der Bewohner versteckt lagen. Hier wurde die grosse Gier verschiedener Dorfältesten nach Tuch durch die Anwesenheit des Jüngern Sohns Nzogera’s im Zaum gehalten. Ziegen und Schafe waren merkwürdig billig und in gutem Zustande, und folglich liess ich, um unsere Ankunft in der Nähe des Malagarazi zu feiern, eine Heerde von acht Ziegen schlachten und an meine Leute vertheilen.
1. November. Nachdem wir unser Lager verlassen, zogen wir nach Nordwesten und erblickten, als wir einen Bergabhang hinabstiegen, bald den ängstlich ersehnten Malagarazi, einen schmalen, aber tiefen Fluss, der durch ein von hohen Gebirgen eingeschlossenes Thal fliesst. Fischfressende Vögel sassen in Reihen auf den am Ufer befindlichen Bäumen; links herum lagen Dörfer ziemlich dicht aneinander. Nahrungsmittel waren reichlich und billig.
Nachdem wir das linke Ufer des Flusses einige Meilen entlang gereist waren, kamen wir zu den Ansiedelungen, welche Kiala als ihren Beherrscher anerkennen. Ich hatte angenommen, dass wir sofort über den Fluss setzen könnten, doch erhoben sich Schwierigkeiten. Man sagte uns, wir müssten unser Lager aufschlagen, ehe man sich auf Unterhandlungen einlassen könne. Als wir dagegen protestirten, sagte man uns, wir konnten über den Fluss setzen, wenn wir wollten, doch werde uns kein Mvinza dabei helfen.
Da wir gezwungen waren, an diesem Tage halt zu[S. 20] machen, wurde das Lager in der Mitte eines der Dörfer aufgeschlagen und die Ballen in einer Hütte aufgespeichert, wo vier Soldaten sie bewachten. Nachdem eine Gesandtschaft an Kiala, den ältesten Sohn des grossen Häuptlings Nzogera abgeschickt worden war, um ihn um Erlaubniss zu bitten, als friedliche Karavane den Fluss überschreiten zu dürfen, liess uns Kiala wissen, der Weisse könne seinen Fluss überschreiten, nachdem er 50 Tücher bezahlt habe. 56 Tücher bedeutete fast einen ganzen Ballen! Hier gab es also eine neue Gelegenheit, diplomatisch zu verfahren. Ich bevollmächtigte daher Bombay und Asmani mit Kiala über das Honga zu verhandeln; es sollte aber nicht mehr als 25 Doti betragen. Um 6 Uhr abends kehrten die beiden Leute, nachdem sie sieben Stunden lang unterhandelt hatten, mit dem Verlangen zurück, dass Nzogera dreizehn und Kiala zehn Doti erhalten müsse. Der arme Bombay war heiser, Asmani jedoch lächelte noch immer, und ich gab nach und gratulirte mir, dass die unverschämte Anforderung, die sich als eigentliche Räuberei kennzeichnete, nicht schlimmer ausgefallen war.
Drei Stunden später kam noch eine Forderung. Kiala hatte Besuch von einigen Häuptlingen seines Vaters erhalten, und als diese erfuhren, dass ein Weisser sich an der Fähre befände, verlangten sie einige Flinten und ein Fässchen Schiesspulver. Hier jedoch war meine Geduld erschöpft, und ich erklärte ihnen, sie müssten es mit Gewalt nehmen, denn ich werde mich nie in dieser Weise berauben lassen.
Bis 11 Uhr abends verhandelten Bombay und Asmani über diese Extraforderung, raisonnirten, zankten und tobten, bis Bombay erklärte, sie würden ihn durch ihr Schwatzen verrückt machen, wenn es noch viel länger dauerte. Ich befahl Bombay, zwei Tuche, für jeden Häuptling eins, mitzunehmen, und wenn sie das nicht für ausreichend hielten, würde ich mich mit ihnen in einen Kampf einlassen. Das Geschenk wurde angenommen, und die Unterhandlungen endigten um Mitternacht.
2. November. Ihata-Insel, 1½ Stunde westlich Von Kiala’s Behausung. Um 5 Uhr nachmittags kamen wir vor[S. 21] die auf dem linken Ufer des Malagarazi belegene Insel Ihata, nachdem der Morgen in kindischem Geschwätz mit dem Besitzer der Nachen an der Fähre verschwendet worden. Die schliessliche Forderung für das Uebersetzen betrug 8 Meter Zeug und 4 Fundo[1] Sami-Sami oder rothe Perlen. Dies wurde sofort bezahlt. Hierauf liess er vier Leute mit ihren Lasten in dem kleinen, unförmlichen, schwanken Nachen übersetzen. Als die Bootsleute die Passagiere und Lasten ausgesetzt hatten, erhielten sie den Befehl, auf der andern Seite zu bleiben, und er kam abermals mit einer Forderung. Die Fährleute hatten gefunden, dass zwei Fundo Perlen zu kurzes Maass hätten und dass noch zwei Fundo bezahlt werden müssten, sonst würde der Vertrag wegen des Uebersetzens als null und nichtig angesehen werden. Also rückten wir noch zwei Fundo heraus, doch nicht ohne zu protestiren und zu schwatzen, wie es in diesen Ländern nöthig ist.
Dreimal gingen die Nachen hin und zurück, und wiederum kam eine Forderung mit dem gewöhnlichen Geschrei und wüthendem Wortstreit. Diesmal sollten es fünf Khete[2] für den Mann sein, der uns an die Fähre führte, eine Schukka Tuch für einen Schwätzer, der sich an den altweibischen Dschumah gemacht hatte und nichts that als eben schwatzen und den Lärm vermehren. Auch diese Forderungen wurden bewilligt.
Gegen Sonnenuntergang versuchten wir, die Esel überzusetzen. Simba, ein schöner Kinyamwezi-Esel ging zuerst mit einem Strick um den Hals hinein; als er aber in der Mitte des Stromes angelangt war, sahen wir, wie er sich sträubte — ein Krokodil hatte ihn an der Kehle gepackt. Die Kämpfe des armen Thieres waren entsetzlich. Tschaupereh zog mit aller Kraft an dem Strick, aber es war nutzlos, denn der Esel sank und wir sahen ihn nicht mehr. Die Tiefe des Flusses ist an dieser Stelle ungefähr 15 Fuss. Wir hatten die hellbraunen Köpfe, glänzenden Augen und kammartigen Rücken in der Nähe gesehen, aber nicht geglaubt,[S. 22] dass die Reptilien einer so aufregenden Scene sich nähern würden, wie sie die Fähre während der Ueberfahrt darbot. Etwas betrübt über diesen Verlust nahmen wir unsere Arbeit wieder auf und waren um 7 Uhr alle mit Ausnahme von Bombay und dem einzigen uns jetzt noch übrig gebliebenen Esel drüben, welcher am Morgen hinübergebracht werden sollte, wenn die Krokodile den Fluss verlassen hätten.
3. November. Welche Zankereien haben wir in diesen letzten drei Tagen erlebt! Welche Angst haben wir seit unserer Ankunft in Uvinza ausgestanden! Die Wawinza sind schlimmer als die Wagogo und ihre Habgier ist noch unersättlicher. Wir bekamen den Esel mit Hülfe eines Mganga oder eines Medizinmannes hinüber, welcher ihn mit einigen gekauten Blättern eines nahe am Strome über ihm wachsenden Baumes bespie. Er theilte mir mit, er könne den Fluss zu jeder Stunde des Tages oder der Nacht überschreiten, nachdem er seinen Körper mit diesen gekauten Blättern eingerieben hätte, welche er für eine sehr wirksame Medizin hielt.
Um 10 Uhr vormittags erschien aus der Richtung von Udschidschi eine Karavane von 80 Waguhha, einem Stamme, der einen Landstrich auf der südwestlichen Seite des Sees Tanganika bewohnt. Wir erkundigten uns nach Neuigkeiten und erfuhren, dass ein Weisser gerade aus Manyuema in Udschidschi angekommen sei. Diese Nachricht setzte uns alle in Erstaunen.
„Ein Weisser?“ fragten wir.
„Ja, ein Weiser,“ lautete die Antwort.
„Wie ist er angezogen?“
„Wie der Herr,“ erwiderten sie auf mich deutend.
„Ist er jung oder alt?“
„Er ist alt; hat weisses Haar auf dem Gesicht und ist krank.“
„Von wo ist er hergekommen?“
„Aus einem weit hinter Uguhha liegenden, Manyuema genannten Lande.“
„Wirklich? Und hält er sich jetzt in Udschidschi auf?“
[S. 23]
„Ja, wir haben ihn vor ungefähr acht Tagen gesehen.“
„Glaubt Ihr, dass er dort bleiben wird, bis wir ankommen?“
„Sigue“ (das wissen wir nicht).
„Ist er schon früher in Udschidschi gewesen?“
„Ja, er hat es vor langer Zeit verlassen.“
Hurrah, das ist Livingstone! Das muss er sein! Es kann kein anderer sein; aber doch, vielleicht ist es doch ein anderer, irgendjemand von der Westküste, oder vielleicht Baker! Nein, Baker hat kein weisses Haar auf dem Gesicht. Aber jetzt müssen wir rasch marschiren, damit er nicht hört, dass wir im Anzuge sind, und wegläuft.
Ich hielt eine Anrede an meine Leute, fragte sie, ob sie bereit seien, ohne jeden Aufenthalt nach Udschidschi zu marschiren, und versprach einem jeden von ihnen darauf, wenn sie auf meine Wünsche eingingen, zwei Doti zu geben. Alle bejahten die Frage und waren fast ebenso erfreut wie ich selbst. Ich aber war geradezu toll vor Freude und ungemein darauf begierig, die brennende Frage zu lösen: „Ist dies Dr. David Livingstone?“ Gott gebe mir Geduld, ich wünschte aber doch, es gäbe in diesem Lande eine Eisenbahn oder wenigstens Pferde; denn mit einem Pferde könnte ich Udschidschi in ungefähr zwölf Stunden erreichen.
Wir brachen sofort von den Ufern des Malagarazi auf, von zwei Führern begleitet, die uns Usenge, der alte Fährmann, verschafft hatte, der sich jetzt, wo wir hinüber waren, sehr liebenswürdig gegen uns erwies.
Nach einem Marsche von etwas mehr als einer Stunde kamen wir im Dorf Isinga, des Sultans Katalambula, an. Die Salzebene, die wir dabei durchschritten, wird weiterhin im Innern fruchtbar. Nachdem wir uns gelagert, erhielten wir die Warnung, der Marsch am nächsten Tage sei mit Vorsicht zu machen, da eine Bande Wavinza unter Makumbi, einem grossen Häuptling Nzogera’s, vom Kriege zurückkäme, und Makumbi sei gewöhnt, nach einem Siege nichts zurückzulassen. Vom Erfolg berauscht greife er selbst die Dörfer seines eigenen Stammes an und mache alles Lebende, Sklaven sowie Vieh, zu Gefangenen. Die[S. 24] Folgen einer einmonatlichen Campagne gegen Lokanda-Mira sei die Zerstörung von zwei Dörfern, das Tödten eines Kindes jenes Häuptlings und das Niedermetzeln mehrerer Leute gewesen. Makumbi habe auch fünf Leute durch den Durst verloren, den sie bei ihrem Uebergang über eine südlich vom Malagarazi belegene Salzwüste erlitten hätten.
4. November. Mit grosser Vorsicht und unter tiefem Schweigen früh aufgebrochen. Ich schickte die Führer voraus und zwar den einen 200 Schritt vor dem andern, damit sie uns beizeiten benachrichtigen könnten. Der erste Theil des Marsches ging durch dünnes Gestrüpp von Zwergbäumen, das immer dünner und dünner wurde, bis es schliesslich ganz und gar verschwand. Nun hatten wir Uhha, ein flaches Land, betreten. Unter den hohen gebleichten Stengeln von Dourra und Mais waren Dörfer zu Dutzenden zu erblicken. Manchmal bildeten drei, manchmal fünf, zehn bis zwanzig bienenkorbförmige Hütten ein Dorf. Die Wahha lebten offenbar in völliger Sicherheit, denn kein einziges ihrer Dörfer war von den gewöhnlichen Vertheidigungsmitteln eines afrikanischen Dorfes umgeben. Ein schmaler, trockener Graben bildete die einzige Grenze zwischen Uhha und Uvinza. Nachdem wir Uhha betreten, war alle Gefahr vor Makumbi verschwunden.
In Kawanga hielten wir, und der Häuptling des Orts verlor keine Zeit, uns zu verständigen, dass er der grosse Mutware von Kimenyi unter dem König und der Zolleinnehmer für Seine Kiha-Majestät sei. Er erklärte, er sei der einzige in Kimenyi, einem östlichen District von Uhha, der Tribut verlangen könne, und es sei ihm sehr lieb und uns selbst eine Ersparniss an Mühe, wenn wir seine Forderung von 12 Doti guten Tuchs sofort abmachten. Das hielten wir jedoch nicht für das beste Verfahren, da uns der Charakter der Afrikaner bekannt war. Wir fingen also sofort an, diese Forderung zu verkleinern. Nach sechsstündigem heissen Reden reducirte der Mutware dieselbe jedoch nur um zwei Doti. Hierauf wurde sie denn in Ordnung gebracht unter der Abmachung, dass wir durch Uhha bis an den Rusugi-Fluss reisen dürften, ohne weiter etwas bezahlen zu müssen.
[S. 25]
5. November. Nachdem wir Kawanga früh am Morgen verlassen und unsern Marsch über die weiten Ebenen, die von der heissen Aequatorsonne weissgedörrt waren, fortgesetzt hatten, zogen wir nach Westen voll angenehmer Ahnungen, dass wir uns dem Ende unserer Mühen näherten, und froh darüber, dass wir in fünf Tagen den Mann erblicken sollten, um dessen willen ich aus so fernen civilisirten Ländern und durch so viele Beschwerlichkeiten gekommen war. Wir waren im Begriff, eine Gruppe von Dörfern zu passiren mit dem vollen Vertrauen von Leuten, an die niemand weiter eine Forderung hat, als ich zwei Männer aus einer Schar Eingeborener, die uns beobachtete, hervorspringen und an die Spitze der Expedition heranlaufen sah, offenbar in der Absicht, unser Weiterziehen zu verhindern.
Die Karavane hielt an und ich trat vor, um die Sache der beiden Eingeborenen zu untersuchen. Ich wurde von beiden Wahha mit den gewöhnlichen Yambos höflich begrüsst und dann gefragt:
„Warum zieht der Weisse durch das Dorf des Königs von Uhha ohne Gruss und Gabe? Weiss der Weisse etwa nicht, dass ein König in Uhha lebt, dem die Wangwana und Araber etwas für das Recht des Durchzuges bezahlen?“
„Wie? Wir haben ja gestern Abend den Häuptling von Kawanga bezahlt, der uns mitgetheilt hat, er sei der Beamte, der den Zoll für den König von Uhha einzunehmen habe.“
„Wie viel habt Ihr bezahlt?“
„Zehn Doti gutes Tuch.“
„Bestimmt?“
„Ganz bestimmt. Wenn Ihr ihn fragt, so wird er es Euch sagen.“
„Gut,“ sagte einer der Wahha, ein schöner, stattlicher, intelligent aussehender Jüngling; „es ist unsere Pflicht gegen den König, Euch hier aufzuhalten, bis wir die Wahrheit ermitteln. Wollt Ihr in unser Dorf spazieren und Euch unter dem Schatten unserer Bäume ausruhen, bis wir Boten nach Kawanga senden können?“
„Nein, die Sonne ist schon eine Stunde am Himmel[S. 26] und wir haben noch weit zu reisen. Aber um Euch zu beweisen, dass wir nicht durch Euer Land zu ziehen suchen, ohne das zu thun, was Rechtens ist, wollen wir dableiben, wo wir jetzt sind, und Euern Boten zwei oder drei Soldaten als Begleiter mitgeben, die Euch den Mann zeigen sollen, dem wir das Tuch bezahlt haben.“
Die Boten zogen fort. Mittlerweile aber flüsterte der stattliche Jüngling, der sich als ein Neffe des Königs auswies, einem jüngern Menschen einen Befehl ins Ohr. Dieser eilte sofort mit der Schnelligkeit einer Antilope in die Dörfergruppe, bei der wir eben vorbeigezogen waren. Als Folge dieses Auftrags sahen wir bald eine Truppe von ungefähr 50 Kriegern, die von einem langgewachsenen, stattlichen Manne geführt wurde, auf uns zukommen. Er war mit einem scharlachnen, Dschoho genannten Gewande bekleidet, dessen beide Enden in einen Knoten über der linken Schulter zusammengebunden waren. Ein Stück neue amerikanische Leinwand war wie ein Turban um seinen Kopf gefaltet und ein grosses gekrümmtes Stück Elfenbein hing ihm um den Hals. Er und seine Leute waren sämmtlich mit Speeren, Bogen und Pfeilen bewaffnet und ihre Annäherung zeichnete sich durch eine überlegte Ruhe aus, die unbedingtes Vertrauen auf jeden etwaigen Ausgang an den Tag legte.
Auf der Ostseite des Pombwe-Flusses in der Nähe des Dorfes Lukomo in Kimenyi in Uhha wurde uns Halt geboten.
Der prächtig gekleidete Häuptling war seinem Aussehen nach ein merkwürdiger Mensch. Sein Gesicht war oval, mit hohen Backenknochen, tief eingesunkenen Augen, einer vorragenden, kühnen Stirn, schöner Nase und wohlgeformtem Munde. Er war schlank von Gestalt und ebenmässig gebaut.
Als er sich uns genähert, begrüsste er mich in ganz herzlichem Tone mit den Worten:
„Yambo bana?“ Wie geht es Euch, Herr?
Ich erwiderte ihm gleichfalls herzlich: „Yambo mutware?“ Wie geht es Euch, Häuptling?
Ich und meine Leute wechselten solche Yambos auch[S. 27] mit den Kriegern aus, und in unserer ersten Bekanntschaft war nichts, was einen feindlichen Charakter angedeutet hätte.
Der Häuptling setzte sich mit untergeschlagenen Beinen und legte Bogen und Pfeile an seine Seite; dasselbe thaten seine Leute.
Ich setzte mich auf einen Ballen und jeder meiner Leute auf seine Last, wodurch ein Halbkreis gebildet wurde. Die Wahha waren etwas zahlreicher als wir, aber während sie nur mit Bogen und Pfeilen, Speeren und Knopfstöcken versehen waren, hatten wir Flinten, Musketen, Revolver, Pistolen und Beile.
Wir sassen alle und tiefes Schweigen wurde von der Versammlung beobachtet. Die grossen Ebenen um uns waren an diesem hellen Mittag so still, als ob sie von allen lebenden Wesen verlassen wären. Darauf sprach der Häuptling:
„Ich bin Mionvu, der grosse Mutware von Kimenyi, und der nächste nach dem Könige, der dort wohnt,“ auf ein grosses, etwa zehn Meilen nach Norden an nackten Bergen belegenes Dorf zeigend, „und bin hierher gekommen, um mit dem Weissen zu sprechen. Es ist stets Sitte der Araber und Wangwana gewesen, dem Könige, wenn sie durch dieses Land ziehen, ein Geschenk darzubringen. Beabsichtigt der Weisse nicht, dem Könige die Gebühren zu zahlen? Warum macht der Weisse halt am Wege? Warum will er nicht das Dorf Lukomo betreten, wo Nahrungsmittel sind und Schatten ist, wo wir die Dinge ruhig besprechen können? Gedenkt der Weisse zu kämpfen? Ich weiss wohl, dass er stärker ist als wir. Seine Leute haben Flinten und die Wahha haben nur Bogen, Pfeile und Speere; aber Uhha ist gross und wir haben viele Dörfer. Möge er überall um sich blicken; alles ist Uhha; unser Land dehnt sich viel weiter, als er an einem Tage überblicken und durchschreiten kann. Der König von Uhha ist stark; dennoch wünscht er die Freundschaft des Weissen. Will der Weisse Krieg oder Frieden haben?“
Dumpfes Beifallsmurmeln folgte dieser Rede Mionvu’s von Seiten seiner Leute und eine gewisse ungemüthliche Misbilligung seitens der meinigen. Als ich im Begriff[S. 28] stand, ihm zu antworten, kamen mir die Worte des General Sherman, die ich ihn gegen die Häuptlinge der Arapahoes und Cheyennes im Jahre 1867 bei North Platte aussprechen hörte, ins Gedächtniss zurück und ich legte in meiner Antwort an Mionvu, den Mutware von Kimenyi, einigermassen denselben Geist an den Tag.
„Mionvu, der grosse Mutware, fragt mich, ob ich zum Kriege hergekommen sei. Wann hat Mionvu je gehört, dass weisse Leute gegen Schwarze kämpfen? Mionvu muss wissen, dass die Weissen sich von den Schwarzen unterscheiden. Die Weissen verlassen weder ihr Land, um die Schwarzen zu bekämpfen, noch kommen sie, um Elfenbein oder Sklaven zu kaufen, sondern sie kommen her, um Flüsse, Seen und Berge aufzusuchen; um zu erfahren, was für Länder, Völker, Flüsse, Seen, Wälder, Ebenen, Berge und Gebirge in Euerm Lande sind; um die verschiedenen Thiere kennen zu lernen, die in dem Lande der Schwarzen wohnen, damit sie, wenn sie heimziehen, den weissen Königen, Männern und Kindern sagen können, was sie in dem so fernen Lande gesehen und gehört haben. Die Weissen unterscheiden sich von den Arabern und Wangwana, denn sie wissen alles und sind sehr stark. Wenn sie kämpfen, so laufen die Araber und Wangwana davon. Wir haben grosse Kanonen, welche donnern, und wenn sie schiessen, so erzittert die Erde. Wir haben Geschütze, welche Kugeln weiter tragen, als Ihr sehen könnt. Selbst mit diesen kleinen Dingern (auf meine Revolver weisend) könnte ich zehn Leute schneller tödten, als Ihr zählen könnt. Wir sind stärker, als die Wahha — Mionvu hat die Wahrheit gesagt —, trotzdem wünschen wir nicht, zu kämpfen. Ich könnte jetzt Mionvu tödten, dennoch spreche ich mit ihm als Freund. Ich wünsche, mit Mionvu und allen Schwarzen befreundet zu bleiben. Will mir nun Mionvu sagen, was ich für ihn thun kann?“
Als diese Worte ihm unvollständig, wie ich vermuthe, aber doch verständlich übersetzt wurden, zeigten die Gesichter der Wahha, wie sehr sie dieselben zu würdigen wussten. Ein- oder zweimal glaube ich, dass ich etwas wie Furcht in ihnen las, aber meine Versicherungen, dass ich[S. 29] Frieden und Freundschaft mit ihnen haben wolle, verscheuchte alsbald alle derartigen Empfindungen.
Mionvu erwiderte:
„Der Weisse sagt mir, dass er uns freundlich gesinnt sei. Warum kommt er dann aber nicht in unser Dorf? Warum bleibt er am Wege? Die Sonne ist heiss, Mionvu will hier nicht mehr sprechen. Wenn der Weisse ein Freund ist, so wird er in unser Dorf kommen.“
„Jetzt müssen wir halten. Es ist Mittag. Ihr habt unsern Marsch unterbrochen. Wir wollen also in Euerm Dorfe campiren,“ sagte ich, indem ich aufstand und meine Leute anwies, ihre Lasten aufzunehmen.
So waren wir zum Bleiben gezwungen; es half nichts; die Boten waren noch nicht von Kawanga zurückgekehrt. Als wir im Dorfe angekommen, hatte sich Mionvu der Länge nach in den spärlichen Schatten geworfen, den einige innerhalb des Boma stehende Bäume gewährten. Ungefähr um 2 Uhr nachmittags kehrten die Boten heim und sagten, es sei wahr, dass der Häuptling von Kawanga zehn Tücher genommen habe, aber nicht für den König von Uhha, sondern für sich selbst!
Mionvu, der offenbar scharfsinnig war und genau wusste, was er wollte, erhob sich jetzt und fing an, kleine Bündel aus je zehn dünnen Rohrstöckchen zu machen, und bald darauf überreichte er mir zehn dieser kleinen Bündel, die zusammen 100 Rohrstöcke enthielten, mit den Worten: Jeder Stab stelle ein Tuch vor, und das vom Könige Uhha verlangte Honga betrage mithin einhundert Tücher! Fast zwei Ballen!
Nachdem wir uns von unserm fast unbeschreiblichen Erstaunen erholt, boten wir ihm zehn an.
„Zehn Stück für den König von Uhha! Unmöglich! Ihr werdet Euch nicht eher von Lukowo fortrühren, bis Ihr uns hundert bezahlt habt!“ rief Mionvu in bedeutsamer Weise.
Ich antwortete ihm nicht, sondern ging in meine Hütte, die Mionvu für mich eingerichtet hatte, und lud Bombay, Asmani, Mabruki und Tschaupereh ein, sich mit mir zu berathen. Als ich sie fragte, ob wir uns nicht durch Uhha[S. 30] kämpfend durchschlagen könnten, bekamen sie einen gewaltigen Schreck, und Bombay bat mich flehend, mir wohl zu überlegen, was ich thun wolle, da es ganz unnütz sei, sich mit den Wahha in einen Krieg einzulassen.
„Ganz Uhha ist ein flaches Land, wir können uns nirgends darin verstecken. Jedes Dorf um uns herum wird sich erheben, und wie können 45 Menschen mit Tausenden kämpfen? Sie würden uns alle in ein paar Minuten tödten, und wie könnten Sie nach Udschidschi kommen, wenn Sie todt wären? Bedenken Sie das, mein lieber Herr, und werfen Sie Ihr Leben nicht für ein paar Tuchlappen fort.“
„Gut, Bombay; das ist aber Räuberei. Sollen wir uns dem unterwerfen? Sollen wir diesem Kerl alles geben, was er verlangt? Er könnte mir ebenso gut alles Tuch und alle Flinten abverlangen, wenn wir ihm nicht zeigen, dass wir im Stande sind, gegen ihn zu kämpfen. Ich kann Mionvu und seine bedeutendsten Leute selbst tödten und Ihr könnt alle diese heulenden Kerle ohne viele Mühe erschlagen. Wenn Mionvu und seine bedeutendsten Leute todt sind, so werden wir nicht sehr beunruhigt werden und dann könnten wir südlich an den Malagarazi und von da westlich nach Udschidschi ziehen.“
„Nein, mein lieber Herr, denken Sie keinen Augenblick daran. Wenn wir uns in die Nähe des Malagarazi begeben, so würden wir mit Lokanda Mira zusammentreffen.“
„Nun, dann wollen wir nach Norden gehen.“
„Dort hinauf zieht sich Uhha weit hin und jenseits Uhha sind die Watuta.“
„Gut, dann sage mir, was wir thun sollen. Wir müssen etwas thun und dürfen uns nicht berauben lassen.“
„Bezahlen Sie Mionvu, was er verlangt, und lassen Sie uns von hier fortziehen. Dies ist der letzte Ort, wo wir zu zahlen haben werden, und in vier Tagen sind wir in Udschidschi.“
„Hat Mionvu Dir gesagt, dass dies das letzte mal ist, wo wir zu zahlen haben?“
„Ja wohl, das hat er.“
„Was sagst Du, Asmani, sollen wir kämpfen oder bezahlen?“
[S. 31]
Asmani’s Gesicht hatte seinen gewöhnlichen lächelnden Ausdruck, er antwortete aber: „Ich fürchte, wir müssen zahlen. Dies ist ganz bestimmt das letzte mal.“
„Und Du, Tschaupereh?“
„Bezahlen Sie, Herr. Es ist besser, dass wir ruhig in diesem Lande weiter kommen. Wenn wir stark genug wären, so würden sie uns bezahlen. Ach! wenn wir nur zweihundert Flinten hätten, wie würden dann diese Wahha laufen!“
„Was sagst Du, Mabruki?“
„Ach, lieber Herr, es ist sehr hart, und diese Leute sind grosse Räuber. Ich würde wahrlich am liebsten ihnen die Köpfe abschlagen, aber Sie thun doch besser daran, zu bezahlen. Dies ist ja das letzte mal, und was sind hundert Tuche für Sie?“
„Schön also; Bombay und Asmani, Ihr geht zu Mionvu und bietet ihm zwanzig. Will er die nicht nehmen, so bietet Ihr ihm dreissig, vierzig bis achtzig, langsam steigend. Macht also viel Redensarten und gebt nicht ein Doti mehr. Ich schwöre es Euch allen, ich werde Mionvu erschiessen, wenn er mehr als achtzig beansprucht. Geht hin und verhaltet Euch klug!“
Um die Sache kurz zu machen, wurden Mionvu um 9 Uhr vormittags 64 Doti für den König von Uhha, 6 für ihn selbst und 5 für seinen Unterbeamten, alles in allem 75 Doti, d. h. 1¼ Ballen, übergeben. Kaum hatten wir diese bezahlt, als sie untereinander über die Beute zu streiten anfingen, und ich hoffte, die verschiedenen Parteien würden sich eine Schlacht liefern und ich somit einen Entschuldigungsgrund bekommen, sie zu verlassen und mich südlich in das Dickicht zu schlagen, dessen Existenz ich annahm, unter dessen freundlicher Bedeckung wir dann nach Westen ziehen könnten. Es wurde aber nur ein Wortkampf daraus, der sehr viel Lärm machte.
6. November. — Mit dem Morgengrauen zogen wir sehr still und traurig unsern Weg. Unser Tuchvorrath war arg vermindert. Wir hatten nur noch neun Ballen übrig, die bei richtiger Oeconomie zusammen mit den noch unberührten Perlen ausgereicht hätten, uns an den Atlantischen[S. 32] Ocean zu bringen. Wenn ich aber noch vielen Leuten von Mionvu’s Schlage begegnete, so hätte ich nicht genug gehabt, um nach Udschidschi zu gelangen, und obgleich wir diesem Orte so nahe sein sollten, schien mir Livingstone doch noch so weit wie je.
Wir zogen über den Pombwé und schlugen uns dann über eine leichte wellige Ebene, die sich allmählich auf unserer Rechten zum Berge erhob und sich zu unserer Linken in das Thal des Malagarazi senkte, welcher Fluss ungefähr 20 Meilen entfernt war. Ueberall zeigten sich Dörfer; Nahrungsmittel waren billig, Milch reichlich und Butter gut.
Nach einem vierstündigen Marsche überschritten wir den Kanengi-Fluss und kamen in das Boma von Kahirigi, das von mehreren Watusi und Wahha bewohnt wird. Hier sollte der Bruder des Königs von Uhha wohnen. Diese Nachricht war mir durchaus nicht angenehm, und ich fing an, Verdacht zu schöpfen, dass ich wiederum in ein Hornissennest gefallen sei. Wir hatten noch keine zwei Stunden Rast gehalten, als zwei Wangwana in mein Zelt kamen, die Sklaven unseres geckenhaften Freundes in Unyanyembé, Thani bin Abdullah’s, waren. Diese Leute kamen von seiten des Bruders des Königs, um Honga zu verlangen! Er verlangte 30 Doti, einen halben Ballen!
Dürfte ich nur alle die wilden, wüthenden Gedanken, die in mir tobten, als mir dies angekündigt wurde, schildern, so würde ich wol in einem spätern ruhigen Augenblicke über mich selbst erschrecken. Ich war aber böse, — nein, das ist nicht das Wort; ich war wild, verzweifelt wild, bereit und im Stande zu kämpfen und zu sterben, aber nicht von einer solchen Bande elender, nackter Räuber mich aufhalten zu lassen. Noch dazu angesichts von Udschidschi, wie man fast sagen konnte, nur vier Tagereisen von dem Weissen, den ich für Livingstone halte, wenn nicht noch ein zweites Exemplar von ihm in diesen Ländern herumreist. Gütige Vorsehung! Was soll ich thun?
Mionvu hatte uns gesagt, das Honga von Uhha sei bezahlt, und hier kommt noch eine Forderung vom Bruder des Königs! Zum zweiten male haben sie gelogen und[S. 33] sind wir betrogen worden. Das soll nicht noch einmal vorkommen.
Diese beiden Leute theilten uns mit, es existirten noch fünf Häuptlinge, die nur zwei Stunden auseinander wohnten, welche uns wie die, welche wir bereits besucht, Tribut abfordern würden. Als ich dies erfuhr, fühlte ich eine gewisse Ruhe. Es war viel besser, das Schlimmste sofort zu erfahren. Noch fünf Häuptlinge würden uns mit ihren Forderungen bestimmt ruiniren. Was sollte ich angesichts dessen thun? Wie soll ich zu Livingstone kommen, ohne völlig zum Bettler geworden zu sein?
Ich entliess die Leute, rief Bombay und befahl ihm mit Asmani den Tribut so billig wie möglich abzumachen. Dann zündete ich mir meine Pfeife an, setzte die Kappe der Ueberlegung auf und begann nachzudenken. In einer halben Stunde hatte ich einen Plan entworfen, den ich noch in derselben Nacht ausführen wollte.
Ich citirte die beiden Sklaven Thani bin Abdullah’s, nachdem das Honga zu jedermanns Zufriedenheit abgemacht war — obgleich die grössten Spitzfindigkeiten und diplomatischen Raisonnements ausser Stande waren, es auf weniger als 26 Doti herabzubringen —, und fragte sie über die Möglichkeit aus, den noch vor uns liegenden, Tribut verlangenden Wahha auszuweichen.
Dies setzte sie anfänglich in Erstaunen und sie erklärten es für unmöglich; schliesslich jedoch, nachdem ich in sie gedrungen, meinten sie, einer von ihnen könne uns um Mitternacht oder etwas später in das Dickicht, das sich an der Grenze von Uhha und Uvinza befände, führen. Hielten wir eine direct westliche Richtung durch diese Dschungels ein, so könnten wir, wie sie sagten, durch Uhha ohne weitere Beschwerden reisen. Wenn ich dem Führer 12 Doti bezahlen und meinen Leuten, wenn sie durch das schlafende Dorf zögen, völliges Stillschweigen auferlegen wolle, so sei der Führer überzeugt, ich könne Udschidschi erreichen, ohne ein einziges Doti weiter zu bezahlen. Es ist überflüssig hinzuzufügen, dass ich die dargebotene Hülfe zu diesem Preise freudig annahm.
Doch gab es da noch viel zu thun. Wir mussten uns[S. 34] Vorräthe für den Durchzug durch das Dickicht auf wenigstens vier Tage kaufen und ich schickte sofort Leute aus, um Korn zu jedem Preise herbeizuschaffen. Das Glück begünstigte uns, denn vor 8 Uhr abends hatten wir Vorräthe für sechs Tage.
7. November. — In der vorigen Nacht ging ich gar nicht zu Bett, denn meine Leute stahlen sich bald nach Mitternacht, als der Mond sich zu zeigen anfing, in Abtheilungen von vier Mann, aus dem Dorfe heraus und um 3 Uhr morgens befand sich die ganze Expedition ausserhalb des Boma, ohne dass der geringste Lärm gemacht worden wäre. Nachdem ich dem neuen Führer zugepfiffen hatte, fing die Expedition an, in südlicher Richtung dem rechten Ufer des Kanengi-Flusses entlang sich zu bewegen. Nach einstündigem Marsch schlugen wir uns nach Westen über die Grasebene und blieben auf derselben trotz der sich uns darbietenden für die nackten Leute sehr schlimmen Hindernisse. Hell beleuchtete der Mond unsern Pfad; doch warfen dunkle Wolken hier und da lange Schatten über die verlassenen einsamen Flächen, sodass die Mondstrahlen fast verdunkelt wurden. Zu solcher Zeit schien unsere Lage schlimm, bis sich der Mond wieder zeigte und über das Dunkel sein silbernes Licht leuchten liess.
Tapfer mühten sich die Leute ab, ohne zu murren, obwol ihre Beine von dem scharfen Grase bluteten. Endlich erschien der ambrosische Morgen mit seinen schönen, lieblichen Zügen. Der Himmel wurde uns neu geboren und brachte uns Trost und Hoffnung. Als der Tag angebrochen, eilten die Leute mit rascheren Schritten vorwärts, obwol sie durch die ungewohnte Reise angegriffen waren, bis wir um 8 Uhr morgens den raschen Rusugi-Fluss erblickten, wo in einem nahe gelegenen Gehölz halt gemacht wurde, um zu frühstücken und zu ruhen. Beide Ufer des Flusses wimmelten von Büffeln, Elenn und Antilopen; obwol uns aber der Anblick sehr lockte, wagten wir es doch nicht zu feuern, da ein Flintenschuss das ganze Land alarmirt haben würde. Ich zog daher blosses Zusehen und die Befriedigung, die ich über unser Glück empfand, vor.
Nachdem wir eine Stunde geruht, sahen wir einige[S. 35] Eingeborene, die Salz vom Malagarazi brachten, das rechte Ufer des Flusses hinaufkommen. Als sie sich unserm Versteck gegenüber befanden, entdeckten sie uns, legten ihre Salzbeutel nieder und liefen sofort laut schreiend davon, um einige ungefähr vier Meilen nördlich von uns belegene Dörfer zu allarmiren. Sofort befahl ich meinen Leuten, ihre Lasten wieder aufzunehmen und in wenigen Augenblicken waren wir über den Rusugi, und eilten direct auf ein vor uns liegendes Bambusdickicht zu. Kaum waren wir darin, als ein albernes Weib laut zu schreien anfing. Meine Leute waren sehr erschreckt über diese lärmende Demonstration, welche die Rache der Wahha auf unser Haupt herabziehen musste, da wir den ihnen gebührenden Tribut umgingen. In einer halben Stunde dürften uns Hunderte von heulenden Wilden in den Dschungels umringen und eine allgemeine Metzelei entstehen. Das Weib schrie immer wieder von neuem ohne Ursache furchtbar auf. Sofort legten einige meiner Leute in dem Instinkt der Selbsterhaltung ihre Ballen und Lasten nieder und verschwanden im Dickicht und der Führer kam mit der Bitte auf mich zugestürzt, den Lärm zum Stillstand zu bringen. Der Mann dieser Frau zog nun in äusserster Wuth und Furcht sein Schwert und bat mich, ihr sofort den Kopf abzuschlagen. Hätte ich nur ein Zeichen gegeben, so hätte das Weib ihr Leben für ihre Thorheit gelassen. Ich versuchte es, ihr Geschrei dadurch zu ersticken, dass ich meine Hand ihr über den Mund hielt, aber sie entzog sich ihr mit Gewalt und fuhr fort, schlimmer als je zu schreien. Mir blieb nichts übrig, als die Macht meiner Peitsche an ihren Schultern zu erproben. Nach dem ersten Schlage bat ich sie aufzuhören. „Nein!“ Sie schrie immer lauter, wie eine Unsinnige. Wiederum fiel meine Peitsche auf ihre Schultern herab. „Nein, nein, nein!“ Noch ein Schlag. „Willst Du wol still sein?“ „Nein, nein, nein!“ Lauter und immer lauter schrie sie, und rascher und immer rascher fielen die Schläge, um diese Widerspenstige zu zähmen. Als sie aber einsah, ich sei ebenso entschlossen zuzuschlagen, wie sie, zu schreien, gab sie es vor dem zehnten Schlage auf und wurde ruhig. Ein Tuch wurde ihr über den Mund und die Arme über den[S. 36] Rücken gebunden, und nach einigen Augenblicken, nachdem die Deserteure zu ihrer Pflicht zurückgekehrt, begab sich die Expedition mit verdoppelter Schnelligkeit vorwärts. Bis 1 Uhr mittags schritten wir standhaft weiter, bis wir den kleinen See Musunya erblickten; der neunstündige Marsch hatte uns sehr ermüdet.
Der See Musunya ist eins der kleinen kreisförmigen Becken, die in diesem Theil von Uhha vorkommen. Es gibt ihrer eine ganze Gruppe. Eigentlich könnte man sie nur grosse Pfützen nennen. In der Masikajahreszeit muss sich der See Musunya drei bis vier Meilen in die Länge und zwei in die Breite ziehen. Zahlreiche Flusspferde hausen in ihm und an seinen Ufern kommen viele Jagdthiere vor.
In unserm Bivouak verhielten wir uns, wie man sich denken kann, sehr ruhig; wir richteten weder Zelt noch Hütte auf, noch zündeten wir Feuer an, um im Fall einer Verfolgung ohne Aufenthalt weiter ziehen zu können. Ich hatte die Kammer meines gezogenen Winchestergewehrs (des in einer solchen Krisis ausserordentlich werthvollen Geschenks meines Freundes Morris) voll gefüllt und 200 Patronen in einem über meinen Schultern hängenden Beutel gesteckt. Auch waren die Flinten aller Soldaten fertig geladen, und wir zogen uns zurück, um unsere Strapazen im Gefühl vollkommener Sicherheit zu verschlafen.
8. November. Lange vor dem Morgengrauen waren wir auf dem Marsch und als der Tag anbrach, kamen wir aus dem Bambusdickicht heraus — an mehreren grossen, am Wege gelegenen Pfützen vorbei — auf die nackte Fläche von Uhha, welche weite Aussichten auf welliges Land darbietet, in dessen Eintönigkeit hier und da charakteristische Baumgruppen Abwechslung bringen. Stundenlang mussten wir uns über das wellenförmige Land hinschleppen, während die Sonne mit afrikanischer Glut brannte, diesmal jedoch ein wenig durch angenehme Lüftchen gemässigt, welche uns den Duft frischen Grases und fremdartiger bunter Blumen zuwehten, die auf der weiten, im übrigen blassgrünen Fläche wuchsen.
Wir kamen an den Rugufu-Fluss, nicht an den Rugufu[S. 37] von Ukawendi, sondern den nördlichen Strom dieses Namens, der ein Zufluss des Malagarazi ist. Es ist ein breiter, seichter, träger Fluss, der sich fast unmerklich nach Südwesten zieht. Während wir im tiefen Schatten, den uns eine dichte Dschungelgruppe gewährte, in unmittelbarer Nähe des rechten Ufers halt machten, um etwas zu ruhen, ehe wir die Reise fortsetzten, hörte ich deutlich im Westen einen Lärm wie von fernem Donner. Als ich fragte, ob dies Donner sei, erhielt ich zur Antwort, es sei der Kabogo.
„Kabogo? Was ist das?“
„Das ist ein grosser Berg auf der andern Seite des Tanganika, der voll tiefer Löcher ist, in welche das Wasser stürzt, und wenn es auf dem Tanganika windig ist, so gibt es einen Schall, wie Mvuha (Donner). Da dort viele Boote zu Grunde gegangen sind, so ist es Sitte bei Arabern und Eingeborenen, Tuch, Merikani und Kaniki, sowie namentlich weisse (Merikani-)Perlen hineinzuwerfen, um den Mulungu (Gott) des Sees zu besänftigen. Wer Perlen hineinwirft, kommt gewöhnlich ohne Fährlichkeit davon, aber wer das nicht thut, geht zu Grunde und ertrinkt im See. Es ist ein schrecklicher Ort.“ Diese Geschichte erzählte mir der stets lächelnde Führer Asmani und sie wurde von einigen meiner Begleiter, die früher den See beschifft hatten, bestätigt.
Dieser Ort, wo wir an den Ufern des Rugufu-Flusses zu Mittag halt machten, ist wenigstens 18½ Stunden oder 46 Meilen von Udschidschi entfernt und da der Kabogo nahe bei Uguhha sein soll, so muss er mehr als 60 Meilen von Udschidschi fern sein. Es wurde also der Lärm des donnernden Wassers, das sich in die Höhlen von Kabogo stürzen soll, von uns in einer Entfernung von mehr als hundert Meilen gehört.
Nach drei Stunden setzten wir unsere Reise durch dünne Wälder, über ausgedehnte Strecken von Urfelsen und dicht mit grossem Geröll bestreute Felder fort, an zahlreichen Büffel-, Giraffen- und Zebraheerden vorbei, und kamen über einen schwankenden, einem Torfmoor ähnlichen Morast an den kleinen Bach Sunuzzi und an einen Lagerplatz, der nur eine Meile von einer grossen Colonie der[S. 38] Wahha entfernt ist. Da wir aber in den Tiefen eines grossen Waldes begraben waren, in dessen Nähe sich kein Weg befand, und da wir keinen Lärm machten oder Feuer anzündeten, sondern tiefes Schweigen beobachteten, so konnten wir ruhig sein und bestimmt darauf rechnen, nicht gestört zu werden. Am Morgen — das hatte uns der Kirangozi zugesichert — sollten wir aus Uhha heraus sein, und wenn wir dann am selben Tage nach Niamtaga, in Ukaranga, reisten, so würden wir am nächsten in Udschidschi sein. Sei geduldig, liebe Seele! Noch einige Stunden und du wirst das Ende aller dieser Mühen kennen! Dann werde ich mich dem weissen Manne gegenüber befinden, der weisse Haare auf dem Gesicht hat, wer es auch sein mag!
9. November. Zwei Stunden vor dem Morgengrauen verliessen wir unser Lager am Sunuzzi-Fluss und schlugen uns durch den Wald in nordwestlicher Richtung, nachdem wir vorher unsere Ziegen geknebelt hatten, damit sie uns nicht durch ihr Meckern verriethen. Dies war ein Irrthum, der ein tragisches Ende hätte nehmen können, denn gerade als der östliche Himmel eine bleichgraue Färbung annahm, kamen wir aus dem Dickicht auf die Heerstrasse. Der Führer glaubte nämlich, wir hätten Uhha hinter uns und hob ein Freudengeschrei an, in das alle Mitglieder der Karavane einstimmten und alles zog mit erhöhter Energie vorwärts, als wir plötzlich auf die Ausläufer eines Dorfes kamen, dessen Bewohner im Begriff waren aufzustehen. Sofort wurde Stille geboten und die Expedition zum Halten gebracht. Ich trat vor, um mich mit dem Führer zu besprechen; er wusste aber nicht, was geschehen solle. Da keine Zeit zur Ueberlegung war, liess ich die Ziegen schlachten und auf dem Wege liegen und den Führer kühn durch das Dorf ziehen. Auch die Hühner wurden abgethan und darauf nahm die Expedition, unter Leitung des Führers, ihren Marsch rasch und schweigend wieder auf, nachdem ich den Befehl ertheilt, schleunigst in das südlich vom Wege belegene Dickicht zu ziehen. Ich blieb, bis der letzte Mann verschwunden war, dann bildete ich, nachdem ich mein Winchestergewehr in Bereitschaft gesetzt, mit meinen Flintenträgern und ihrer Munition den Nachtrab. Als wir im[S. 39] Begriff waren, an der letzten Hütte vorbeizuziehen, sprang ein Mann aus derselben und stiess einen Allarmruf aus, auch hörten wir laute Stimmen wie von Streitenden. In kurzer Zeit jedoch waren wir in den Tiefen der Dschungels und eilten vom Wege in südlicher leicht nach Westen sich ziehender Richtung. Einmal glaubte ich, dass wir verfolgt würden, und hielt hinter einem Baume, um unsere Feinde, wenn sie auf der Verfolgung beständen, daran zu hindern; nach wenigen Minuten aber stellte es sich heraus, dass niemand hinter uns her sei. Nach einem Marsch von einer halben Stunde wandten wir uns wieder nach Westen. Jetzt war es heller Tag und unsere Augen erfreuten sich an den malerischen, engen, kleinen Thälern, wo wilde Obstbäume wuchsen, seltene Blumen blühten und kleine Bäche über glatte Kiesel dahinflossen, wo alles herrlich und schön war, bis wir schliesslich durch einen hübschen kleinen Bach watend, dessen sanftes Gemurmel wir als liebliches Willkommen deuteten, die Grenzen des bösen Uhha überschritten und in Ukaranga eintraten, was mit jauchzendem Freudengeschrei begrüsst wurde.
Sofort fanden wir den ebenen Weg und gingen munter mit elastischen Schritten, in beschleunigtem Tempo weiter, da wir wussten, dass der Marsch sich seinem Ende nähere. Was kümmerten uns jetzt die Beschwerden, die wir überstanden, die unebenen, schwierigen Wälder, die dornigen Dickichte und schneidenden Gräser und das Geschrei der Wilden, das uns so beunruhigt hatte? Morgen! Ja, der grosse Tag nähert sich, und wir können in dieser triumphirenden Stimmung wol lachen und singen. Wir haben schwere Prüfungen erduldet; sind im Ungemach gegeneinander böse geworden, doch ist alles das jetzt vergessen und jedes Gesicht strahlt von der Glückseligkeit, die wir alle verdient haben.
Zu Mittag machten wir einen kurzen Halt, um uns auszuruhen und zu erfrischen. Man zeigte mir die Berge, von denen der Tanganika zu sehen sei, welche das Thal des Liutsché im Westen begrenzen. Bei ihrem Anblick konnte ich mich nicht länger halten; selbst dieser kurze Halt machte mich unruhig und unzufrieden. Wir nahmen den Marsch[S. 40] wieder auf; ich spornte meine Leute mit dem Versprechen an, dass sie morgen ihren Lohn empfangen und so viel Fisch und Bier bekommen sollten, als sie verzehren könnten.
Wir befanden uns in Sicht der Wakaranga-Dörfer. Als die Bewohner uns erblickten, zeigten sie bedeutende Erregung. Ich schickte Leute voran, um sie zu beruhigen, und sie kamen auch heraus, um uns zu begrüssen. Dies war uns so neu und willkommen, so anders als das Verfahren der unruhigen Wavinza und der Räuber von Uhha, dass wir gerührt waren. Doch hatten wir keine Zeit, uns auf dem Wege aufzuhalten und uns der Freude hinzugeben, denn ich wurde durch fast unbezwingliche Empfindungen vorwärts getrieben und wünschte meinen Zweifeln und Befürchtungen ein Ende zu machen. War Er noch da? Hatte Er von meiner Annäherung gehört? Würde Er die Flucht ergreifen?
Wie schön sieht Ukaranga aus! Die grünen Hügel sind von Gruppen strohgedeckter Kegel gekrönt; die Berge erheben und senken sich, theils nackt, theils bebaut, hier als Weideland, dort als Holzschläge, dort wiederum von Hütten belebt. Das Land hat etwas Aehnlichkeit mit Maryland.
Wir überschreiten den Mkuti, einen herrlichen kleinen Fluss, besteigen das andere Ufer und schreiten durch den Wald, wie Leute, die eine That vollbracht haben, auf die sie stolz sein können. Schon sind wir neun Stunden gereist und die Sonne sinkt rasch gen Westen; trotzdem scheinen wir nicht ermüdet zu sein.
Wir erreichen die Ausläufer von Niamtaga und hören Trommeln schlagen. Die Leute fliehen in die Wälder und verlassen ihre Dörfer, denn sie halten uns für Ruga-Ruga, die Waldräuber Mirambo’s, die, nachdem sie die Araber von Unyanyembé besiegt, die von Udschidschi bekämpfen wollen. Selbst der König flieht aus seinem Dorf und jedermann folgt ihm angsterfüllt. Wir ziehen in das Dorf, ergreifen ruhig Besitz davon, und mein Zelt wird daselbst aufgeschlagen. Schliesslich verbreitet sich das Gerücht, dass wir Wangwana aus Unyanyembé seien.
[S. 41]
„Nun, ist Mirambo denn todt?“ fragen sie.
„Nein,“ erwidern wir.
„Wie seid Ihr denn durch Ukaranga gekommen?“
„Ueber Ukonongo, Ukawendi und Uhha.“
„Oh — hi-le!“ Darauf lachen sie herzlich über ihre Angst und fangen an, sich zu entschuldigen. Der König wird mir vorgestellt und sagt, er sei nur in die Wälder gegangen, um uns anzugreifen, das heisst, er habe die Absicht gehabt, uns alle todtzuschlagen, wenn wir Ruga-Ruga gewesen. Wir wissen ja aber, wie sehr der arme König erschrocken war und dass er bestimmt nie gewagt hätte zurückzukehren, wären wir Ruga-Ruga gewesen. Doch wir sind nicht in der Stimmung, uns mit ihm über seine eigenthümliche Ausdrucksweise zu streiten, sondern schütteln ihm lieber die Hand und sagen ihm, wie wir uns freuen, ihn zu sehen. Er nimmt auch an unserer Freude theil und lässt uns sofort drei der fettesten Schafe, Töpfe mit Bier, Mehl und Honig zum Geschenk bringen und ich beglücke ihn noch mehr mit zwei der schönsten Tücher, die ich in meinen Ballen habe. Auf diese Weise kommt ein freundschaftlicher Vertrag zwischen uns zu Stande.
Während ich mein Tagebuch über die Erlebnisse dieses Tages führe, lasse ich Selim meinen neuen Flanellanzug auspacken, meine Stiefeln mit Oel schmieren, meine Kopfbedeckung mit Kreide reinigen und mit einem neuen Puggaree versehen, damit ich so anständig wie möglich vor dem weissen Mann mit dem grauen Bart und den Arabern von Udschidschi erscheinen könne, denn die Kleider, die ich im Dickicht und Walde getragen, sind in Fetzen. Gute Nacht! Nur noch einen Tag und wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Freitag, 10. November. Der 236. Tag seit Bagamoyo und der 51. seit Unyanyembé. Allgemeine Richtung nach Udschidschi, West zu Süd. Marschzeit sechs Stunden.
Es ist ein herrlicher, beseligender Morgen. Die Luft ist frisch und kühl. Der Himmel lächelt liebevoll auf die Erde und ihre Kinder. Die dichten Wälder sind von herrlichem, grünem Laub gekrönt; das Wasser des Mkuti rauscht unter dem Smaragdschatten, den seine bewachsenen Ufer[S. 42] darbieten, und scheint uns durch sein beständiges Rauschen zum Wettlauf nach Udschidschi aufzufordern.
Wir befinden uns alle ausserhalb des Rohrzaunes des Dorfes; ein jeder von uns sieht so nett und sauber und glücklich aus, wie damals, wo wir uns in den Dhows in Zanzibar einschifften, was Ewigkeiten her zu sein scheint; so viel haben wir gesehen und erfahren.
„Vorwärts!“
„Ay Wallah, ay Wallah, Bana yango!“ und die Braven schreiten leichten Herzens davon in einem Tempo, das uns bald in Sicht von Udschidschi bringen muss. Wir steigen einen mit Bambus bewachsenen Berg hinan, in eine Schlucht hinab, durch welche ein wüthender kleiner Giessbach stürzt, besteigen noch einen niedrigen Hügel, gehen dann einen ebenen Fusspfad entlang, welcher in dem Abhang einer langen Bergkette verläuft, und ziehen so eifrig weiter, wie es nur Leute mit leichtem Herzen thun können.
Man hat mich darauf vorbereitet, dass ich in zwei Stunden den Tanganika erblicken soll, denn der Kirangozi sagt, man sehe ihn von der Spitze eines steilen Berges. Ich fange vor Erregung fast an zu weinen; doch Geduld, wir müssen ihn doch erst sehen. Wir stürzen vorwärts, den Berg athemlos hinauf, damit die grosse Scene nicht etwa davoneile. Endlich sind wir auf dem Gipfel; aber ach, noch ist er nicht zu sehen. Noch ein Endchen weiter, gerade dort; ja, dort ist er, ein Silberstreifen. Ich erblicke ihn kaum zwischen den Bäumen, — hier aber ist er endlich wirklich, der Tanganika, und das sind die blauschwarzen Berge von Ugoma und Ukaramba. Eine ungeheure, weite Fläche, ein glänzendes Silberbett — darüber ein leuchtender, blauer Baldachin — hohe Berge als Faltensaum, Palmenwälder seine Fransen! Der Tanganika! Hurrah! und die Leute erwidern das Jubelgeschrei des Angelsachsen mit Stentorstimmen, die grossen Wälder und Berge scheinen sich an unserm Triumph zu betheiligen. „War dies der Ort, Bombay, wo Burton und Speke standen, als sie zuerst den See erblickten?“
„Ich weiss das nicht mehr genau, Herr, glaube aber, es war irgendwo hier in dieser Gegend.“
[S. 43]
„Die armen Kerle! Der eine halb gelähmt, der andere halb blind,“ sagte Sir Roderick Murchison, als er Burton und Speke’s Ankunft am Tanganika beschrieb.
Und ich? Nun, ich bin so glücklich, dass ich, wenn ich ganz gelähmt und blind wäre, doch glaube, ich könnte in diesem herrlichen Augenblick mein Bett auf mich nehmen und wandeln und alle Blindheit hätte sofort aufgehört. Zum Glück bin ich jedoch ganz wohl und keinen Tag krank gewesen, seitdem ich Unyanyembé verlassen. Wie viel würde Shaw darum geben, um jetzt an meiner Stelle zu sein? Wer ist glücklicher, er, der in den Freuden Unyanyembés schwelgt, oder ich, der ich auf dem Gipfel dieses Berges mit frohen Augen und stolzem Herzen auf den Tanganika hinabblicke?
Wir steigen den westlichen Abhang des Berges hinab, das Thal des Liutsché vor uns. Ungefähr eine Stunde vor Mittag haben wir das dichte Matetegestrüpp erreicht, welches an beiden Ufern des Flusses wächst, waten durch den klaren Strom, kommen auf der andern Seite an, treten aus dem Dickicht hervor und die Gärten der Wadschidschi liegen vor uns, ein Wunder von Pflanzenreichthum. Einzelheiten entziehen sich meiner raschen, oberflächlichen Beobachtung. Ich bin von meinen eigenen Gemüthsbewegungen fast überwältigt, wie ich die anmuthigen Palmen, die netten grünen Gemüseplätze und kleinen, von schwarzen Mateterohr-Zäunen umgebenen Dörfer erblickte.
Rasch eilen wir weiter, damit nicht die Nachricht unserer Annäherung die Leute von Bunder-Udschidschi erreiche, ehe wir in Sicht und für sie bereit sind. Wir halten an einem kleinen Bach, dann steigen wir den langen Abhang einer nackten Hügelkette hinauf, die allerletzte der unzähligen, die wir überschritten haben. Diese allein hindert uns daran, den See in seiner ganzen gewaltigen Ausdehnung zu überblicken. Wir kommen auf dem Gipfel an, überschreiten denselben bis an seinen westlichen Rand und — halt ein, Leser! — der Hafen von Udschidschi liegt in Palmen gehüllt nur 500 Schritt von uns entfernt. In diesem grossen Augenblicke denken wir nicht mehr an die unzähligen Meilen, die wir marschirt, die zahllosen Berge, die wir erklettert,[S. 44] die vielen Wälder, die wir durchwandert haben; die Erinnerung an die Dickichte und Dschungels, die uns belästigt, die heissen Salzebenen, die uns die Füsse verbrannt, die glühende Sonne, die uns versengt hat, an alle Gefahren und Beschwerden, die jetzt glücklich hinter uns liegen, ist verschwunden! Endlich ist die grosse Stunde da! Unsere Träume, Hoffnungen und Ahnungen sind jetzt erfüllt! Unsere Herzen und Empfindungen liegen in den Augen, wie wir in die Palmen spähen und es versuchen zu errathen, in welcher Hütte, in welchem Hause der weisse Mann mit dem grauen Bart, von dem man uns am Malagarazi berichtet, wol wohnen mag.
„Entfaltet die Fahne und ladet die Gewehre!“
„Ay Wallah, ay Wallah, Bana!“ erwidern die Leute eifrig.
„Eins, zwei, drei, feuert!“
Ein Kleingewehrfeuer von fast funfzig Flinten brüllt wie ein Salutschuss von einer Artilleriebatterie. Wir werden die Wirkung desselben auf das friedlich aussehende Dorf da unten sofort sehen.
„Jetzt, Kirangozi, halte die Fahne des Weissen hoch und lass die Zanzibarer Flagge vor dem Nachtrab hergehen. Und Ihr, Leute, haltet Euch dicht aneinander und feuert weiter, bis wir auf dem Marktplatz oder vor dem Hause des Weissen stehen. Ihr habt mir oft gesagt, dass Ihr die Fische des Tanganika riechen könnt; ich kann es jetzt auch. Hier gibt es Fische und Bier und eine lange Rast für Euch. Marsch.“
Ehe wir 100 Schritt weiter gegangen waren, hatten unsere wiederholten Schüsse den gewünschten Erfolg. Wir hatten Udschidschi benachrichtigt, dass eine Karavane im Anzug sei, und man sah die Leute zu Hunderten uns entgegenströmen. Der blosse Anblick der Fahnen liess jedermann wissen, dass wir eine Karavane seien, doch erregte die von dem riesigen Asmani, der das Gesicht heute zu einem beständigen Lächeln verzog, hochgetragene amerikanische Flagge zuerst allgemeines Erstaunen. Viele der Leute aber, die sich jetzt uns näherten, erinnerten sich der Flagge, denn sie hatten sie über dem amerikanischen Consulat und[S. 45] vom Mast so manchen Schiffes im Hafen von Zanzibar wehen sehen und begrüssten sie alsbald mit den Rufen: „Bindera Kisungu!“ Die Flagge eines Weissen! „Bindera Merikani!“ Die amerikanische Flagge!
Dann umgaben sie uns, die Wadschidschi, Wanyamwezi, Wangwana, Warundi, Waguhha, Wamanyuema und Araber und machten uns fast taub mit ihrem Geschrei „Yambo, yambo, bana! yambo, bana! yambo, bana!“ da jeder einzelne meiner Leute in dieser Weise begrüsst wurde.
Noch befinden wir uns etwa 300 Schritt vom Dorfe Udschidschi und mich umgibt eine dichte Menge. Plötzlich höre ich eine Stimme zu meiner Rechten in englischer Sprache mir zurufen:
„Guten Morgen, mein Herr.“
Erstaunt darüber, diese Begrüssung inmitten einer solchen Menge Schwarzer zu hören, kehre ich mich rasch um, um den Mann zu betrachten und erblicke ihn an meiner Seite mit ganz schwarzem, aber belebtem, frohem Gesichte, in einem langen, weissen Hemd, einen Turban von amerikanischer Leinwand um das wollige Haupt gewunden, und frage ihn: „Ach wer sind Sie denn?“
„Ich bin Susi, der Diener von Dr. Livingstone,“ sagte er lachend und eine glänzende Reihe Zähne zeigend.
„Was? Ist Dr. Livingstone hier?“
„Ja wohl!“
„In diesem Dorfe?“
„Ja wohl!“
„Ganz bestimmt?“
„Ganz bestimmt. Ich habe ihn ja eben verlassen.“
„Guten Morgen, mein Herr!“ liess sich eine andere Stimme vernehmen.
„Halloh,“ sagte ich, „ist das noch einer?“
„Ja, mein Herr.“
„Wie heissen Sie denn?“
„Mein Name ist Dschumah.“
„Wie, sind Sie Dschumah, der Freund von Wekotani?“
„Ja wohl.“
„Und ist der Doctor gesund?“
„Nein. Er ist nicht sehr wohl.“
[S. 46]
„Wo ist er so lange gewesen?“
„In Manyuema.“
„Nun, Susi, laufen Sie, um es dem Doctor mitzutheilen, dass ich komme.“
„Ja wohl, Herr!“ und wie ein Toller schnellte er davon.
Jetzt waren wir 200 Schritt von dem Dorfe entfernt. Die Menge wurde dichter und versperrte uns fast den Weg. Fahnen und Flaggen waren aufgehisst, Araber und Wangwana drängten sich durch die Eingeborenen, um uns zu begrüssen, denn nach ihrer Ansicht gehörten wir zu ihnen. Alle waren in höchstem Grade erstaunt und fragten: „Wie kommt Ihr von Unyanyembé?“
Bald kam Susi zurückgelaufen und fragte mich nach meinem Namen. Er hatte dem Doctor gesagt, dass ich im Anzuge sei, dieser aber war zu sehr erstaunt, um es zu glauben, und als er ihn um meinen Namen fragte, war Susi in Verlegenheit gerathen.
Während Susi’s Abwesenheit war dem Doctor jedoch die Nachricht zugekommen, dass es wirklich ein Weisser sei, dessen Flinten abgefeuert und dessen Fahnen zu sehen waren, und die grossen arabischen Magnaten von Udschidschi, Mohammed bin Sali, Sayd bin Madschid, Abid bin Suliman, Mohammed bin Gharib und andere hatten sich vor des Doctors Haus versammelt und dieser war aus seiner Veranda getreten, um die Sache zu besprechen und meine Ankunft zu erwarten.
Mittlerweile hatte die Spitze der Expedition halt gemacht; der Kirangozi war aus den Reihen ausgetreten, hielt seine Flagge hoch und Selim sagte mir: „Ich sehe den Doctor. Ach, was für ein alter Mann ist es! Er hat einen ganz weissen Bart.“ Und ich — was hätte ich nicht darum gegeben, einen Augenblick allein in der Wildniss sein zu können, um meiner Freude ungesehen in irgendeinem tollen Streiche Luft zu machen, um nur die Erregung, deren ich kaum Herr werden konnte, zu beschwichtigen. Rasch klopft mir das Herz; doch darf ich meine Empfindungen nicht durch einen Gesichtsausdruck verrathen, welcher der Würde Abbruch thun könnte, die ein Weisser unter solchen aussergewöhnlichen Umständen an den Tag legen muss.
[S. 47]
Ich that also, was ich für das Würdigste hielt; stiess die Menge zurück und schritt, von hinten hervorkommend, durch eine lebendige Allee von Menschen, bis ich an den von Arabern gebildeten Halbkreis gelangte, an dem vorn der Weisse mit dem grauen Bart stand. Als ich langsam auf ihn zutrat, bemerkte ich, dass er blass und ermüdet aussah und einen grauen Bart hatte, eine bläuliche Mütze mit verschossenem goldenem Bande, eine Weste mit rothen Aermeln und ein paar graue Hosen trug. Ich wäre gern auf ihn zugelaufen; nur war ich in Gegenwart eines solchen Pöbelhaufens zu feig dazu. Ich wäre ihm gern um den Hals gefallen; nur wusste ich nicht, wie er, als Engländer, mich aufnehmen würde[3]. Ich that also, was Feigheit und falscher Stolz mir als das Beste anriethen, schritt bedächtig auf ihn zu, nahm meinen Hut ab und sagte:
„Dr. Livingstone, wie ich vermuthe.“
„Ja,“ sagte er mit freundlichem Lächeln, die Mütze leicht lüftend.
Ich setze meinen Hut wieder auf den Kopf, er seine Mütze, wir reichen uns herzlich die Hand und ich sage laut:
„Ich danke Gott, Doctor, dass es mir gestattet ist, Sie zu sehen.“
[S. 48]
Er erwiderte: „Und ich bin dankbar, dass ich Sie hier begrüssen kann.“
Hierauf wende ich mich zu den Arabern, nehme als Antwort auf ihren Begrüssungs-Chorus von Yambos meine Kopfbedeckung ab und der Doctor stellt sie mir mit Namen vor. Dann kehren Livingstone und ich, die Menge und die Männer, die meine Gefahren mit mir getheilt haben, völlig vergessend zu seinem Tembé. Er weist auf die Veranda oder vielmehr den Lehm-Altan unter dem breiten überhängenden Dach hin und zeigt auf seinen eigenen Sitzplatz, dessen Construction ihm, wie ich sehe, sein Alter und die Kenntniss des Lebens in Afrika eingegeben hat, und der aus einer Strohmatte mit einem darüber gelegten Ziegenfell und noch einem andern Fell besteht, das an die Mauer genagelt ist, um seinen Rücken vor der Berührung mit dem kalten Lehm zu bewahren. Ich protestire dagegen, seinen Sitz einzunehmen, der ihm so sehr viel mehr ziemt als mir, der Doctor aber gibt nicht nach und ich muss ihn einnehmen.
Wir, der Doctor und ich, sitzen mit dem Rücken gegen die Wand. Die Araber setzen sich zur Linken. Mehr als tausend Eingeborene befinden sich vor uns und erfüllen dicht den ganzen Platz. Sie befriedigen ihre Neugierde und unterhalten sich über die Thatsache, dass zwei Weisse in Udschidschi zusammentreffen, der eine eben von Manyuema im Westen, der andere von Unyanyembé im Osten kommend.
Die Unterhaltung beginnt. Um was sie sich dreht, habe ich, offen gestanden, vergessen. Ach, wir richteten Fragen aneinander, wie folgende:
„Wie sind Sie hierhergekommen?“ und „Wo sind Sie die ganze lange Zeit über gewesen? Die Welt hat Sie für todt gehalten.“ Ja, so fing die Unterhaltung an; was der Doctor mir aber erzählt und was ich ihm gesagt, kann ich nicht genau wiedergeben, denn ich war damit beschäftigt, ihn anzublicken und den wunderbaren Mann, an dessen Seite ich jetzt in Central-Afrika sass, zu studiren. Jedes Haar seines Hauptes und Bartes, jede Runzel seines Gesichts, seine hagern Züge und etwas abgespanntes Aussehen brachte mir die Kunde, nach der ich mich immerwährend[S. 49] gesehnt, seitdem ich die Worte gehört: „Nehmen Sie, was Sie brauchen, aber — finden Sie Livingstone.“ Was ich da sah, war für mich eine Kunde von höchstem Interesse und ungeschminkte Wahrheit. Ich hörte und las zu gleicher Zeit. Was erzählten mir diese stummen Zeugen?
O Leser, wärest Du an dem Tage in Udschidschi an meiner Seite gewesen! Wie beredt hätte sich Dir das eigentliche Wesen der Mühen dieses Mannes offenbart! Wärest Du nur da gewesen, um ihn zu sehen und zu hören! Von seinen Lippen, die nie lügen, erfuhr ich die Einzelheiten derselben. Ich kann es nicht wiederholen, was er sagte, denn ich war zu sehr eingenommen, als dass ich mein Notizbuch hätte herausziehen und seine Erzählungen stenographiren können. Er hatte so viel zu erzählen, dass er mit dem Ende anfing und scheinbar die Thatsachen vergass, dass er über fünf bis sechs Jahre Rechenschaft abzulegen habe. Allmählich aber kam sein Bericht hervor, rasch nahm er grosse Verhältnisse an und wurde zu einer wunderbaren Geschichte von Thaten.
Die Araber erhoben sich mit einem Zartgefühl, das ich billigte, als ob sie instinctmässig wussten, dass wir uns selbst überlassen bleiben müssten. Ich schickte Bombay mit ihnen fort, damit er ihnen Nachrichten über den Stand der Angelegenheiten in Unyanyembé gebe, nach denen sie sich so sehr sehnten. Sayd bin Madschid war der Vater des tapfern jungen Mannes, den ich in Masange gesehen, der mit mir in Zimbizo gekämpft und von Mirambo’s Ruga-Ruga im Walde von Wilyankuru getödtet worden war; und da er wusste, dass ich dabei gewesen, wünschte er dringend die Geschichte des Kampfes zu hören; auch alle übrigen hatten Freunde in Unyanyembé, und natürlich erwarten sie sehnsüchtig Nachrichten über dieselben.
Nachdem ich Bombay und Asmani Befehl gegeben hatte, die Leute der Expedition mit Essen zu versehen, rief ich „Kaif-Halek“ oder „Wie geht es Ihnen?“ und stellte ihn Dr. Livingstone als einen der Soldaten vor, der die in Unyanyembé liegenden Güter zu hüten gehabt und den ich gezwungen hatte, mich nach Udschidschi zu begleiten, damit er persönlich seinem Herrn den Briefbeutel, den ihm[S. 50] Dr. Kirk anvertraut, übergeben könne. Dies war der berühmte mit dem Datum vom 1. November 1870 bezeichnete Beutel, der dem Doctor jetzt, 305 Tage, nachdem er Zanzibar verlassen, übergeben wurde. Wie lange wäre er wol noch in Unyanyembé geblieben, wenn ich nicht den grossen Reisenden in Central-Afrika aufgesucht hätte?
Der Doctor behielt seinen Briefbeutel auf den Knien, dann öffnete er ihn sofort, sah sich die Briefe, die in demselben enthalten waren, an und las ein paar von seinen Kindern, wobei sich sein Gesicht aufhellte.
Darauf bat er mich, ihm Nachrichten zu geben.
„Nein, Doctor,“ sagte ich, „lesen Sie erst Ihre Briefe, auf die Sie gewiss ungeduldig sind.“
„Ach,“ sagte er, „ich habe Jahre lang auf Briefe gewartet und habe Geduld gelernt. Da kann ich wirklich noch ein paar Stunden warten. Nein, erzählen Sie mir erst die allgemein interessanten Neuigkeiten. Was passirt in der Welt?“
„Vermuthlich wissen Sie schon, dass der Suezkanal zur Thatsache geworden, dass er eröffnet ist und jetzt ein regelmässiger Handel zwischen Europa und Indien durch denselben getrieben wird?“
„Ich habe von seiner Eröffnung nichts gehört. Das ist etwas Grossartiges. Nun, was noch?“
Bald darauf befand ich mich in der Rolle einer Jahreschronik ihm gegenüber. Ich brauchte nichts zu übertreiben oder ihm Sensationsnachrichten zu geben. Die Welt hatte in den letzten Jahren viel gesehen und erfahren. Die Pacific-Eisenbahn war vollendet worden; Grant war Präsident der Vereinigten Staaten geworden; Aegypten war von Gelehrten überflutet worden; die Revolution von Kreta war beendet; eine Revolution hatte Isabella vom spanischen Throne getrieben und einen Regenten an ihre Stelle gesetzt. General Prim war ermordet; Castelar hatte Europa mit seinen Fortschrittsideen über die Freiheit des Cultus electrisirt; Preussen hatte Dänemark gedemüthigt und Schleswig-Holstein annectirt und seine Armeen befanden sich jetzt um Paris. Der „Schicksalsmann“ war ein Gefangener in Wilhelmshöhe, die Königin der Mode und Kaiserin der Franzosen befand sich[S. 51] auf der Flucht und das im Purpur geborene Kind hatte auf immer die für sein Haupt bestimmte Kaiserkrone verloren. Die Napoleonische Dynastie war durch die Preussen, Bismarck und Moltke, vernichtet und das stolze Kaiserthum Frankreich in den Staub getreten.
Wozu hätte man diese Thatsachen noch zu übertreiben brauchen? Welch grosse Menge Nachrichten war das für jemand, der aus den Tiefen der Urwälder von Manyuema herauskam! Der Widerschein des glänzenden Lichtes der Civilisation strahlte auf Livingstone, als er sich verwundert eines der alleraufregendsten Blätter der Geschichte erzählen liess. Wie schwanden die kleinen Thaten der Barbaren vor diesen dahin. Wer konnte wissen, von welch neuen Sorgen und Unruhen Europa eben jetzt heimgesucht werde, wo wir, seine beiden vereinsamten Kinder, die Geschichte der letzten Ruhmesthaten und Leiden desselben besprachen. Würdiger hätte sie wol ein lyrischer Demodocus erzählt, doch spielte in Ermangelung des Dichters der Zeitungscorrespondent seine Rolle so gut und wahr als möglich.
Kurz nachdem die Araber fort waren, wurde uns von Sayd bin Madschid eine Schüssel heisser Fleischpasteten, von Mohammed bin Sali ein gewürztes Huhn, sowie von Muini Kheri eine Schüssel gekochtes Ziegenfleisch mit Reis zugeschickt. So kamen Geschenke von Nahrungsmitteln der Reihe nach an und wir machten uns ebenso rasch, wie sie gebracht wurden, an dieselben. Ich hatte eine gesunde, kräftige Verdauung und die Bewegung, die ich mir gemacht, hatte sie in guten Stand gesetzt; doch auch Livingstone, der sich darüber beklagt hatte, er habe keinen Appetit, sein Magen weise alles ausser einer Tasse Thee ab, ass wie ein kräftiger, hungriger Mann, und als er die Pfannkuchen mit mir um die Wette verzehrte, wiederholte er immer: „Sie haben mir neues Leben gebracht!“
„Wahrhaftig!“ sagte ich, „ich habe etwas vergessen. Rasch, Selim, bring uns die Flasche, Du weisst welche, und die silbernen Becher. Diese Flasche habe ich blos für diesen Fall mitgebracht, von dem ich hoffte, dass er eintreten werde, obgleich mir meine Hoffnung oft eitel erschienen ist.“
[S. 52]
Selim wusste die Flasche Sillery-Champagner zu finden und kehrte bald damit zurück. Ich gab dem Doctor einen silbernen Becher, gefüllt mit dem erheiternden Weine und sagte, indem ich etwas davon in meinen Becher goss: „Dr. Livingstone, auf Ihr Wohl!“
„Auf das Ihrige!“ antwortete er, und der Champagner, den ich für dieses glückliche Zusammentreffen aufbewahrt, wurde mit herzlichsten gegenseitigen Segenswünschen getrunken.
Wir plauderten und plauderten weiter; den ganzen Nachmittag wurden uns allerlei Speisen zugetragen. Jedesmal, wenn neue kamen, assen wir weiter, bis ich vollständig gesättigt und auch Livingstone genöthigt war einzugestehen, dass er ebenfalls genügend habe. Dabei befand sich Halimah, Livingstone’s Köchin, in einem Zustande grosser Aufregung. Sie hatte nämlich den Kopf wiederholt zur Küche herausgesteckt, um sich zu überzeugen, dass wirklich zwei Weisse dort auf der Veranda sässen, wo sonst gewöhnlich nur einer sich befand, der nichts essen wollte oder konnte. Sie hatte gefürchtet, ihr Herr wisse ihre Kochkunst nicht genügend zu schätzen, war aber jetzt über die ungeheure Menge verzehrter Speisen sehr verwundert und zugleich entzückt. Wir hörten, wie sie mit grosser Zungenfertigkeit die erstaunte Menge, die vor der Küche hielt, mit ihren Neuigkeiten erbaute. Die gute, treue Seele! Während wir ihr lautes Geschwätz mit anhörten, berichtete der Doctor über ihre treuen Dienste und die furchtbare Angst, die sie an den Tag gelegt, als unsere Flinten zuerst die Ankunft eines zweiten Weissen in Udschidschi ankündigten. Er erzählte mir, wie sie im Zustande höchster Aufregung aus der Küche zu ihm und dann wieder auf den freien Platz gelaufen sei, die verschiedensten Fragen aufwerfend; wie sie über die spärliche Einrichtung ihrer Speisekammer, ihre dürftigen Vorräthe in Verzweiflung gerathen und besorgt gewesen sei, ihre Armuth durch glänzendes Auftreten zu verdecken und den Weissen durch eine Art Barmekidenfest zu begrüssen. „Ist er denn nicht einer der unsern?“ sagte sie. „Bringt er uns nicht viel Tuch und Perlen? Sprecht mir nur nicht von den Arabern! Wie kann man Araber mit Weissen vergleichen?“
[S. 53]
Wir, Livingstone und ich, unterhielten uns über gar vieles, namentlich über seine unmittelbaren Sorgen und die Enttäuschung, die er bei seiner Ankunft in Udschidschi erlebt, als man ihm mittheilte, dass alle seine Waaren verkauft und er dadurch zum armen Mann geworden sei. Es waren nur noch etwa zwanzig Tücher von dem ganzen Vorrath übrig, den er dem Trunkenbold Scherif, dem Halbblutschneider, welchem der britische Consul die Güter anvertraut, in Verwahrung gegeben hatte. Ausserdem war er von einem Ruhranfall heimgesucht worden und befand sich in einem sehr beklagenswerthen Zustande. Er war noch keineswegs hergestellt, obgleich er heute gut gegessen hatte und sich schon kräftiger und besser zu fühlen begann.
Auch dieser für mich so glückliche Tag neigte sich schliesslich, wie alle andern, seinem Ende zu. Wir sassen mit unsern Gesichtern gen Osten gewandt, wie Livingstone es Tage lang vor meiner Ankunft gethan, und beobachteten die dunkeln Schatten, welche über dem Palmenhain jenseits des Dorfes und dem Wall von Bergen, den wir an jenem Tage überstiegen, daherzogen und diese jetzt rasch in der Dunkelheit verschwinden liessen. Wir lauschten mit dankbarem Herzen gegen den grossen Geber alles Glücks und Segens, dem lauten Donner der Wasser des Tanganika und dem Chor der Nachtinsekten. So vergingen die Stunden und wir sassen noch immer mit den merkwürdigen Ereignissen des Tages beschäftigt, als es mir einfiel, dass der Reisende seine Briefe noch nicht gelesen habe.
„Doctor,“ sagte ich, „Sie würden wol besser daran thun, Ihre Briefe zu lesen. Ich will Sie nicht länger aufhalten.“
„Ja,“ erwiderte er, „es wird spät und ich will meine Briefe lesen. Gute Nacht! Gott segne Sie!“
„Gute Nacht, mein theurer Doctor, und lassen Sie mich hoffen, dass die Nachrichten, welche Sie bekommen, Ihnen recht erwünscht sein mögen.“
Und jetzt, theurer Leser, nachdem ich Dir in kurzem berichtet, „wie ich Livingstone fand“, sage ich auch Dir „Gute Nacht.“
[1] 4 Fundo = 40 Halsbänder, 1 Fundo = 10 Halsbänder.
[2] Halsbänder.
[3] „Dieser Engländer war, wie ich später fand, ein Militär, welcher aus Indien in seine Heimat zurückkehrte und die Wüste hier durchzog, um nach Palästina zu kommen. Ich meinerseits war ziemlich direct aus England gekommen und wir sahen uns hier in der Wüste ungefähr auf dem halben Wege von unsern Ausgangspunkten. Als wir uns einander näherten, entstand die Frage, ob wir uns anreden sollten. Ich hielt es für wahrscheinlich, dass der Fremde mich anreden könne und wenn er das thäte, war ich ganz bereit, so gemüthlich und gesprächig zu sein, als es meine Natur erlaubte. Trotzdem fiel mir nichts besonderes ein, was ich ihm zu sagen hätte. Natürlich entschuldigt unter civilisirten Leuten dieser Umstand das Schweigen nicht; ich war aber scheu und träge und hatte keine grosse Lust, anzuhalten und mitten in diesen weiten Einöden wie bei einer Visite Conversation zu machen. Der Reisende mochte wol ähnliche Empfindungen durchmachen, denn mit Ausnahme einer stummen Begrüssung, die im Heben der Hand an die Mütze und höflichem Armschwenken bestand, gingen wir aneinander vorbei, als ob wir uns mitten in London befänden.“
KINGLAKE’S Eothen.
[S. 54]
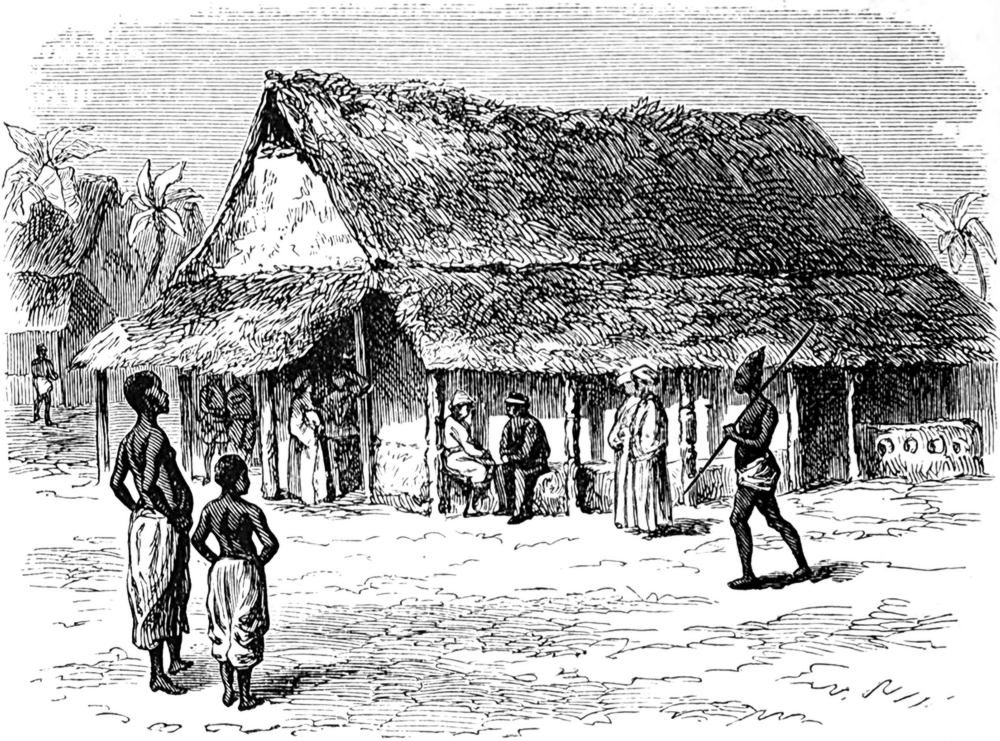
Auszug aus meinen Notizen über Livingstone’s Reisen.
„Wenn uns Liebe eint, so wird unser Verkehr unbeschreiblich schön und nutzbringend sein; wenn nicht, so ist die Zeit verloren und Ihr werdet mich nur peinigen. Ich werde Euch albern erscheinen und der Ruf, den ich habe, falsch. Alles Gute in mir ist magnetischer Natur und ich erziehe nicht durch Unterricht, sondern dadurch, dass ich meinem eigenen Berufe nachgehe.“
EMERSON’S Representative Men.
Früh am nächsten Morgen fuhr ich plötzlich aus dem Schlaf empor. Das Zimmer kam mir fremd vor. Es war ein Haus und nicht mein Zelt. Ach ja! Jetzt erinnerte ich mich, dass ich Livingstone aufgefunden und mich in seinem Hause befände. Ich horchte, damit das in mir erwachende[S. 55] Bewusstsein durch den Ton seiner Stimme bestätigt werde, hörte aber nichts als das dumpfe Tosen der Wasser.
Ruhig lag ich im Bett; ja, in einem wirklichen Bett; wenn es auch nur ein sehr einfaches vierbeiniges Gestell war, worauf Palmblätter anstatt Daunen ausgebreitet lagen und Pferdehaar nebst meinem Bärenfell die Stelle von Linnen vertraten. Ich fing damit an, mich einer strengen Geistesprüfung zu unterziehen und mir meine Stellung klar zu machen. Wozu wurde ich ausgeschickt? Um Livingstone zu finden. Hast du ihn gefunden? Ja natürlich, bin ich nicht in seinem Hause? Wessen Kompass hängt dort an dem Holznagel, wessen Kleider, wessen Stiefeln sind das? Wer liest diese Zeitungen, diese Nummern der Saturday-Review und des Punch, welche hier auf der Diele liegen? Gut. Was willst du also jetzt thun? Ich werde ihm morgen mittheilen, wer mich abgesandt hat, was mich hergebracht hat. Dann werde ich ihn bitten, einen Brief an Herrn Bennett zu schreiben und ihm soviel neues über sich mitzutheilen, als er Lust hat. Ich bin ja nicht hierher gekommen, um ihn auszuhorchen, sondern es genügt mir, dass ich ihn aufgefunden habe. Insoweit ist mein Erfolg vollständig, doch würde er noch glänzender sein, wenn Livingstone mir Briefe für Herrn Bennett und eine Anerkenntniss darüber gibt, dass er mich gesehen hat. Ob er das thun wird? Warum nicht? Ich bin hergekommen, um ihm einen Dienst zu erweisen; er hat weder Waaren noch Leute mehr, wol aber ich. Wenn ich ihm eine Freundlichkeit erweise, wird er sie mir nicht erwidern? Was sagt der Dichter?
Ich habe mir seine freundschaftlichen Gesinnungen dadurch erkauft, dass ich soweit gekommen bin, um ihm zu dienen, und glaube nach dem, was ich gestern Abend von ihm gesehen, dass er durchaus nicht so ungünstig und misanthropisch gesinnt ist, wie mir jener Mann gesagt, der ihn zu kennen behauptete. Trotz seiner einsilbigen Begrüssung[S. 56] hat er, als er mir die Hand reichte, einen bedeutenden Grad von Gemüthsbewegung an den Tag gelegt; auch ist er ja gar nicht fortgelaufen, wie man es mir vorher verkündet; freilich vielleicht nur, weil er keine Zeit dazu hatte. Dennoch, wenn er seiner Natur nach sich dadurch belästigt gefühlt hätte, dass jemand gekommen, um ihn aufzusuchen, so würde er mich nicht so empfangen, wie er es gethan, oder gar ersucht haben, bei ihm zu wohnen, sondern mich griesgrämig meiner Wege geschickt haben. Auch hat er nichts gegen meine Nationalität, denn er hat gesagt: „Hier sind Amerikaner und Engländer ganz gleich, wir sprechen dieselbe Sprache und haben dieselben Ideen.“ „Gewiss, Doctor, da stimme ich mit Ihnen überein; hier wenigstens sollen Amerikaner und Engländer Brüder sein, und was ich für Sie thun kann, soll geschehen. Sie können also über mich so frei verfügen, als ob ich Fleisch von Ihrem Fleisch, Bein von Ihrem Bein wäre.“
Ich kleidete mich rasch an mit der Absicht, dem Tanganika entlang zu wandeln, ehe der Doctor aufgestanden sei, öffnete die Thüre, die schrecklich in ihren Angeln knarrte, und spazierte auf die Veranda.
„Ah, Herr Doctor, Sie sind schon auf? Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen.“
„Guten Morgen, Herr Stanley. Es freut mich, Sie zu sehen; hoffentlich haben Sie gut geschlafen. Ich war gestern noch spät mit dem Lesen meiner Briefe beschäftigt. Sie haben mir gute und schlechte Nachrichten gebracht. Nehmen Sie aber doch Platz.“ Er machte mir an seiner Seite Platz. „Ja! Viele meiner Freunde sind todt. Meinen ältesten Sohn, d. h. meinen Sohn Thomas, hat ein schweres Unglück betroffen. Mein zweiter Sohn Oswald studirt auf der Universität Medicin und es geht ihm gut, wie ich höre. Meine älteste Tochter Agnes hat sich in einer Jacht mit «Sir Paraffine» Young und seiner Familie amüsirt. Sir Roderick ist auch wohl und drückt die Hoffnung aus, mich bald wiederzusehen. Sie haben mir einen ganzen Sack Briefe mitgebracht.“
Der Mann war also durchaus kein Gespenst und die Scenen des gestrigen Tages gehörten nicht der Traumwelt[S. 57] an. Ich blickte ihn aufmerksam an, denn dadurch versicherte ich mich, dass er nicht fortgelaufen sei, was ich auf dem ganzen Wege nach Udschidschi beständig fürchtete.
„Nun Herr Doctor“, sagte ich, „Sie wundern sich wol, warum ich hierher gekommen bin?“
„Freilich“, sagte er, „habe ich mich darüber gewundert. Ich glaubte zuerst, Sie seien ein Abgesandter der französischen Regierung an Stelle des Lieutenants Le Saint, der einige Meilen jenseits Gondokoro verstorben ist. Ich hörte, Sie hätten Boote, viele Leute und Vorräthe bei sich und glaubte wirklich, Sie seien ein französischer Officier, bis ich die amerikanische Flagge erblickte, und, Ihnen die Wahrheit zu sagen, es freut mich eigentlich, dass es so ist, denn ich hätte mich mit jenem auf Französisch nicht unterhalten können, und wenn er nicht Englisch verstand, so hätten wir ein schönes Paar Weisser in Udschidschi abgegeben. Gestern wollte ich Sie nicht danach fragen, weil es mich eigentlich nichts anging.“
„Ja“, sagte ich lachend, „um Ihretwillen freut es mich, dass ich ein Amerikaner und kein Franzose bin und dass wir einander vollständig ohne Dolmetscher verstehen können. Ich sehe, die Araber wundern sich, dass Sie, ein Engländer, und ich, ein Amerikaner, uns gegenseitig verstehen. Wir müssen uns hüten, ihnen mitzutheilen, dass die Engländer und Amerikaner sich bekämpft haben, dass es noch Alabama-Forderungen gibt und dass wir Leute wie die Fenier in Amerika haben, die Sie hassen. Doch im Ernst, Doctor, erschrecken Sie nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich gekommen bin, um Sie zu suchen.“
„Um mich zu suchen?“
„Ja wohl.“
„Wie so?“
„Nun, Sie haben doch wol vom «New York Herald» gehört?“
„Oh gewiss. Wer hätte von dieser Zeitung nicht gehört!“
„St! Herr James Gordon Bennett, der Sohn von Herrn James Gordon Bennett, des Besitzers des «Herald», hat ohne seines Vaters Wissen und Genehmigung mich beauftragt,[S. 58] Sie aufzusuchen, mir so viele Nachrichten, als Sie mir über Ihre Entdeckungen geben wollen, von Ihnen zu verschaffen und Sie möglichst mit Mitteln zu unterstützen.“
„Wie? Der junge Herr Bennett hat Sie beauftragt, mir nachzureisen, mich aufzusuchen und mir zu helfen! — Dann ist es freilich kein Wunder, dass Sie Herrn Bennett gestern Abend so sehr gelobt haben.“
„Ja, ich kenne ihn und bin stolz darauf, sagen zu können, dass er durchaus so ist, wie ich ihn geschildert habe, nämlich ein eifriger, grossmüthiger, aufrichtiger Mann.“
„Nun, ich bin ihm in der That sehr zu Dank verpflichtet und es macht mich stolz, wenn ich daran denke, dass Ihr Amerikaner soviel auf mich haltet. Sie sind gerade zur rechten Zeit angekommen, denn ich fing schon an zu glauben, ich müsse die Araber anbetteln. Selbst diesen fehlt es an Zeug; auch gibt es nur wenig Perlen in Udschidschi. Dieser Kerl, der Scherif, hat mich vollständig ausgeplündert. Ich wünschte, ich könnte Herrn Bennett in passenden Worten meinen Dank ausdrücken; sollte mir das aber nicht gelingen, so bitte ich Sie, halten Sie mich darum nicht für weniger dankbar.“
„Und jetzt, Doctor, da wir diese kleine Angelegenheit abgemacht haben, soll uns Feradschi das Frühstück bringen, wenn Sie nichts dagegen haben.“
„Sie haben mir Appetit gebracht,“ sagte er. „Halimah ist meine Köchin, aber sie kennt nicht einmal den Unterschied zwischen Thee und Kaffee.“
Der Koch Feradschi war, wie gewöhnlich, mit trefflichem Thee und einem Gericht dampfender Kuchen, welche der Doctor „Dampers“ nannte, zur Hand. Ich habe mir nie viel aus dieser Art Pfannkuchen gemacht, für Livingstone waren sie aber erwünscht, da er durch die harte Kost in Lunda fast alle Zähne verloren hatte. Dort war er genöthigt gewesen, von grünen Maisähren zu leben. Es gab nämlich in jenem District kein Fleisch und die Anstrengung, an den Kornähren zu nagen, hatte ihm sämmtliche Zähne gelockert. Ich meinerseits zog die harten virginischen, aus Korn gebackenen „Scones“ vor, die meiner Ansicht nach[S. 59] das schmackhafteste Brod abgeben, das man in Central-Afrika haben kann.
Livingstone sagte, er habe mich schon für einen sehr üppigen reichen Mann gehalten, als er meine grosse Badewanne erblickte, die mir einer meiner Leute nachtrug; heute aber halte er mich für noch üppiger, als meine Gabeln, Messer, Schüsseln und Tassen, silberne Löffel und silberne Theekanne herrlich glänzend auf dem reichen persischen Teppich ausgebreitet wurden und ich, wie er sah, durch meine gelben und schwarzen Mercure gut bedient wurde.
Das war der Anfang meines Lebens in Udschidschi. Ich hatte Livingstone vor meiner Ankunft nicht persönlich gekannt; früher war er mir nur ein Gegenstand, ein grosser Artikel für eine Tageszeitung, wie die meisten Dinge, an welchen das nach Neuigkeiten gierige Publikum Freude hat. Ich hatte Schlachtfelder besucht; Revolutionen, Bürgerkriege, Aufstände, Emeuten und Metzeleien mit angesehen; ich hatte nahe bei dem verurtheilten Mörder gestanden, um über seine letzten Kämpfe und Seufzer Bericht zu erstatten; niemals aber war es meine Aufgabe gewesen, über irgendetwas Bericht zu erstatten, das mich so sehr bewegt hätte wie die grossen Leiden, Entbehrungen und Widerwärtigkeiten dieses Mannes, die ich jetzt in ihrem ganzen Umfange erfuhr. Ich fing wahrhaftig an einzusehen, dass „die Götter oben die Angelegenheiten der Menschen mit gerechten Augen überwachen“ und die Hand einer alles beherrschenden gütigen Vorsehung zu erkennen.
Das Folgende sind Thatsachen, die wohl überlegt sein wollen. Ich hatte an einem Tage des October 1869 den Auftrag bekommen, Livingstone aufzusuchen. Herr Bennett hatte das Geld bereit liegen und ich war reisefertig. Doch möge der Leser wohl darauf achten, dass ich nicht sofort meine Expedition antrat. Ich hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen und viele tausend Meilen zu reisen, ehe ich dazu kam. Gesetzt nun, ich wäre von Paris direct nach Zanzibar gegangen, so hätte ich mich sieben bis acht Monate nach meiner Ankunft daselbst zwar in Udschidschi befunden, Livingstone wäre aber dort nicht aufgefunden worden; denn er war damals auf dem Lualaba und ich hätte ihm durch[S. 60] die Urwälder von Manyuema, auf unwegsamen Pfaden und längs des krummen Laufs des Lualaba Hunderte von Meilen folgen müssen. Die Zeit, die ich dazu brauchte, um den Nil hinauf, nach Jerusalem, Konstantinopel, Süd-Russland, dem Kaukasus und Persien zu reisen, benutzte Livingstone zu fruchtbaren Entdeckungen im Westen des Tanganika. Man bedenke ferner, dass ich in der letzten Hälfte des Juni in Unyanyembé ankam und daselbst drei Monate lang durch einen Krieg aufgehalten, ein unzufriedenes, ungeduldiges, ärgerliches Leben führte. Während ich mich aber so abärgerte und durch eine Reihe von Zufälligkeiten aufgehalten wurde, war Livingstone in demselben Monat gezwungen, nach Udschidschi zurückzukehren. Er brauchte die Zeit vom Juni bis zum October, um nach Udschidschi zu gelangen. Und im September befreite ich mich von der Knechtschaft, in welche mich der Zufall gebannt hatte, und eilte südlich nach Ukonongo, dann westlich nach Kawendi, darauf nördlich nach Uvinza und schliesslich wieder westlich nach Udschidschi, wo ich ungefähr drei Wochen nach Livingstone ankam, um ihn hier unter der Veranda seines Hauses ruhend und sehnsüchtig nach Osten blickend zu finden, nach der Weltgegend, wo ich herkam. Wäre ich direct von Paris abgegangen, um ihn aufzusuchen, so hätte ich ihn vielleicht nicht aufgefunden und dasselbe hätte leicht der Fall sein können, wenn ich im Stande gewesen wäre, direct von Unyanyembé nach Udschidschi zu ziehen.
Unter den Palmen von Udschidschi kamen und gingen die Tage friedlich und glücklich. Mein Gefährte nahm an Gesundheit und guter Laune zu. Ihm war das Leben wiedergegeben, die schwindende Lebenskraft wiederhergestellt worden; der Enthusiasmus für seine Aufgabe erreichte allmählich wieder die Höhe, die ihn zu dem Wunsche zwang, wieder im Stande zu sein, etwas zu leisten. Was konnte er aber mit fünf Menschen und 15 bis 20 Stück Zeug thun?
„Haben Sie das nördliche Ende des Tanganika gesehen?“ fragte ich ihn eines Tages.
„Nein. Ich habe es versucht dahin zu gehen, doch thaten die Wadschidschi alles mögliche, um mich auszuziehen, wie sie es mit Burton und Speke gethan, und ich[S. 61] hatte nicht viel Zeug. Wäre ich an das Ende des Tanganika gegangen, so hätte ich nicht nach Manyuema ziehen können, und das mittlere Wassersystem ist das wichtigste, und das ist der Lualaba. Dem gegenüber ist die Frage, ob es eine Verbindung zwischen dem Tanganika und dem Albert-Nyanza gibt, höchst unbedeutend. Das grosse Flusssystem ist der Fluss, welcher vom elften Grad südlicher Breite abfliesst, den ich sieben Grad nach Norden hin verfolgt habe. Der Chambezi, wie er an seinem südlichen Ende heisst, entwässert einen grossen Landstrich, der südlich von der südlichsten Quelle des Tanganika liegt; deshalb muss er der wichtigste sein. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass dieser See der obere Tanganika, und der Albert-Nyanza Baker’s der untere Tanganika ist, welche durch einen Fluss verbunden werden, der vom obern in den untern läuft. Das ist meine Meinung, welche sich auf arabische Berichte und einen Versuch gründet, den ich mit Wasserpflanzen über seinen Verlauf angestellt habe. Doch habe ich eigentlich nie viel darüber nachgedacht.“
„Nun, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, Doctor, so würde ich, ehe ich Udschidschi verliess, das untersuchen und die Zweifel über diesen Gegenstand lösen für den Fall, dass Sie, nachdem Sie hier fortgezogen, nicht wieder auf demselben Wege zurückkehren. Die Geographische Gesellschaft legt viel Gewicht auf diese vermeintliche Verbindung und erklärt, Sie wären der einzige Mann, der die Frage lösen kann. Wenn ich Ihnen dabei von Nutzen sein kann, so haben Sie über mich zu befehlen. Obgleich ich nicht als Forscher nach Afrika gekommen, so bin ich doch in Bezug hierauf ziemlich wissbegierig und würde Sie sehr gern begleiten. Ich habe ungefähr zwanzig Leute bei mir, die zu rudern verstehen; auch haben wir hinreichend viel Gewehre, Zeuge und Perlen. Wenn wir also von den Arabern ein Boot bekommen können, so lässt sich die Sache leicht machen.“
„O ja, wir können ein Canoe von Sayd bin Madschid bekommen. Dieser Mann ist sehr freundlich gegen mich gewesen und wenn es einen arabischen Gentleman gibt, so ist er es.“
[S. 62]
„Dann ist es also abgemacht, dass wir gehen?“
„Ja! ich bin dazu bereit, sobald Sie es sind.“
„Ich stehe zu Ihren Befehlen. Hören Sie denn nicht, dass meine Leute Sie den “grossen Herrn„ und mich den “kleinen Herrn„ nennen? Es würde sich doch nicht passen, dass der kleine Herr befiehlt.“
Jetzt fing ich an Livingstone zu kennen. Ich behaupte, dass niemand in seiner Gesellschaft sein kann, ohne ihn vollständig zu ergründen, denn es ist kein Falsch in ihm und wie er äusserlich erscheint, so ist auch sein Inneres beschaffen. Ich hoffe, dass ich in meiner Skizze seines Charakters und seiner Entdeckungen niemand beleidige; denn ich gebe einfach meine Meinung über den Mann, wie ich ihn gesehen und erkannt habe, nicht wie er sich selbst darstellt oder wie man ihn mir geschildert hat. Ich habe vom 10. November 1871 bis zum 14. März 1872 mit ihm zusammen gelebt, sein Leben im Lager und auf dem Marsche beobachtet und empfinde für ihn unbedingte Bewunderung. Das Lager ist der beste Ort, um die Schwächen eines Menschen an den Tag zu bringen, denn hier entwickelt er bestimmt, wenn er launig oder querköpfig ist, seine Sonderbarkeiten und schwachen Seiten. Ich halte es jedoch für möglich, dass Livingstone die Gesellschaft eines nicht passenden Genossen lästig geworden wäre. Ich weiss wenigstens, dass mir das sehr leicht widerfahren kann, wenn jemand einen so schroffen Charakter hat, dass es unmöglich ist, mit ihm zu reisen. Ich habe Leute gesehen, in deren Gesellschaft ich mich so geknechtet fühlte, dass es eine Pflicht der Selbstachtung war, mich sobald wie möglich von ihnen zu befreien, wo ich es empfand, dass wir durchaus nicht zueinanderpassten und dass meine Natur sich der ihrigen nie assimiliren könnte. Livingstone’s Charakter hingegen ist so, dass ich ihn verehren muss. Er hat meine ganze Begeisterung und nichts als die aufrichtigste Bewunderung hervorgerufen.
Dr. Livingstone ist ungefähr 60 Jahre alt, erschien jedoch, nachdem er völlig wiederhergestellt war, mehr wie ein Mann, der sein funfzigstes Jahr noch nicht überschritten hat. Sein Haar ist noch von bräunlicher Farbe, hier und[S. 63] da jedoch an den Schläfen mit etwas grau gemischt. Backen- und Schnurrbart sind sehr grau; die Augen nussbraun und ausserordentlich klar; er sieht so scharf wie ein Habicht. Nur die Zähne zeigen die Schwäche des Alters an, denn die harte Kost in Lunda hat in ihren Reihen Verheerungen angerichtet. Seine Gestalt, die bald etwas an Corpulenz gewann, ist ein wenig mehr als mittelgross und etwas gekrümmt. Wenn er geht hat er einen festen, aber schweren Tritt, der dem eines überangestrengten oder ermüdeten Mannes gleicht. Gewöhnlich trägt er eine Matrosenmütze mit grossem runden Schirm, an dem man ihn in ganz Afrika wiedererkannt hat. Seine Kleidung zeigte, als ich ihn zuerst sah, Spuren von Flickereien und Ausbesserungen, war aber pedantisch reinlich.
Man hatte mich zu dem Glauben verleitet, dass Livingstone einen menschenfeindlichen, griesgrämigen Charakter habe. Einige haben behauptet, er sei geschwätzig; andere, er sei geistig gestört und ganz anders geworden als der David Livingstone, den man als Missionär verehrt habe; er zeichne nur Notizen und Beobachtungen auf, die kein anderer als er selbst lesen könne; und ehe ich nach Central-Afrika kam, hiess es, er sei mit einer afrikanischen Prinzessin verheirathet.
Alle diese Behauptungen muss ich entschieden in Abrede stellen. Ich gebe zu, dass er kein Engel ist, doch nähert er sich einem solchen Wesen so sehr, als die Natur eines lebenden Menschen es gestattet. Nie habe ich eine Spur von Menschenfeindlichkeit oder Hypochondrie an ihm bemerkt, und was die Geschwätzigkeit betrifft, so ist Dr. Livingstone gerade das Gegentheil; er ist im höchsten Grade reservirt, und demjenigen, welcher behauptet, Dr. Livingstone habe sich verändert, kann ich nur erwidern, dass er ihn nie gekannt, denn es ist notorisch, dass Livingstone einen Fond von ruhigem Humor besitzt, den er zu jeder Zeit in Gesellschaft von Freunden an den Tag legt. Auch muss ich mir die Freiheit nehmen den Herrn zu rectificiren, der mir gesagt, Livingstone schreibe sich weder Notizen noch Beobachtungen auf. Das grosse Tagebuch, das ich seiner Tochter mitbrachte, ist voll von Bemerkungen und[S. 64] enthält nicht weniger als zwanzig Bogen voll Beobachtungen, die er blos während seiner letzten Reise nach Manyuema gemacht hat. In der Mitte des Buches ist ein Bogen nach dem andern, eine Spalte nach der andern sorgfältig nur mit Zahlen beschrieben. Auch enthält ein grosser Brief, den ich von ihm zur Beförderung an Sir Thomas MacLear erhalten habe, nichts als Beobachtungen. Während der vier Monate, die ich mit ihm zusammen war, habe ich es jeden Abend gesehen, wie er sorgfältig Aufzeichnungen machte. Ein grosser Blechkasten, den er mit sich führt, enthält zahllose Notizbücher, deren Inhalt, wie ich glaube, noch einmal an das Tageslicht kommen wird. Auch seine Karten bekunden viel Sorgfalt und Fleiss. Was das Gerücht über seine afrikanische Heirath betrifft, so ist es überflüssig mehr darüber zu sagen, als dass es unwahr ist, da es ganz unter der Würde eines Gentleman ist, so etwas in Verbindung mit dem Namen Livingstone auch nur anzudeuten.
Man kann jeden Zug in Dr. Livingstone’s Charakter sorgfältig analysiren und es wird kein Mensch daran etwas auszusetzen finden. Er ist, wie ich weiss, empfindlich, doch ist das mancher Mann von grossem Geist und edlem Charakter. Namentlich ist er darüber empfindlich, wenn man an ihm zweifelt oder kritisirt. Wer bezweifelt ihn aber auch? Das thun nur stubenhockende Geographen, nicht aber die angestrengt thätigen Reisenden, die zu hunderten auf der Liste der Königl. Geographischen Gesellschaft stehen. Ich habe nicht gefunden, dass ein Richard Burton oder Winwood Reade ihn kritisiren, und es kann einem Manne, der soviel Mühe und Fleiss daran gewandt hat, nicht angenehm sein, wenn seine Karten und Beobachtungen nach den Launen unverantwortlicher Leute abgeändert werden. Livingstone kann in seinen Schlüssen in Bezug auf manche Dinge im Irrthum sein, doch kann ihn ein Geograph, der zu Hause bleibt, nur corrigiren, wenn er Daten von Leuten erhalten hat, welche dieselbe Gegend erforscht haben. Weder Francis Galton noch Dr. Beke können durch gelehrte Ueberzeugungen die Nichtexistenz des Tanganika-Sees beweisen, denn vier Reisende haben ihn gesehen und darüber Bericht erstattet. Weder Francis Galton noch Dr. Beke können dem[S. 65] Oberst Grant beweisen, dass ein Strom wie der Victoria-Nil nicht existirt. Und doch, wieviel hat der Oberst Grant von diesem Fluss, diesem Strom gesehen? Noch keine funfzig Meilen. Da er ihn aber nach Norden und Nordwesten hat fliessen sehen, glaubte er aufrichtig und ehrlich, dass es derselbe Fluss ist, den er an Gondokoro hat vorbeifliessen sehen. So ist auch Livingstone der Meinung, nachdem er den Chambezi, Luapula und Lualaba über sieben Breitengrade verfolgt und ihn immer noch nach Norden hat fliessen sehen, auch von den Eingeborenen gehört hat, dass ein grosser See sich nördlich von dem Punkt befindet, auf dem er auf seinem gewaltigen Marsche nach Norden halt machte, als er dem Lauf des mächtigen Lualaba folgte — dass dieser Lualaba nichts anders als der Nil ist. Hat er denn nicht ein Recht dazu, sich dadurch gekränkt zu fühlen, dass stubenhockerische Geographen eine grosse, über drei Breitengrade sich erstreckende Gebirgskette hinzeichnen, nur um durch diese schwarze, düster aussehende Linie zu beweisen, „dass er die Zeit über mit dem Kopfe gegen eine Steinmauer gerannt sei?“ Livingstone versteht es trotz all seiner Kenntniss des geheimnissvollen Afrika noch nicht, ein Gebirge zu fabriciren; er ist zu einfach, um es zu unternehmen, das Aussehen der Natur nach einer beliebigen Methode, die nur gemüthlich zu Hause bleibenden Geographen bekannt ist, umzuwandeln.[4]
Ich habe viele liebenswürdige Züge an Livingstone gefunden. Seine Sanftmuth verlässt ihn niemals; ebenso wenig wie sein hoffnungsvolles Wesen. Weder aufreibende Sorten, noch Beunruhigungen des Geistes, noch lange Trennung von Haus und Familie kann ihn zum Klagen bringen. Er glaubt, alles wird schliesslich doch gut, denn er hat einen festen Glauben an die Güte der Vorsehung. Er ist, als Spielball unglücklicher Verhältnisse und der elenden Menschen, die ihm von Zanzibar zugeschickt worden, getäuscht und[S. 66] fast bis zu Tode gequält worden; dennoch will er die Aufgabe, die ihm sein Freund Sir Roderick Murchison gestellt hat, nicht im Stiche lassen. Den strengen Vorschriften der Pflicht allein hat er Heimat und Bequemlichkeit, Vergnügungen und Genüsse des civilisirten Lebens geopfert und hat mit dem Heldenmuthe des Spartaners, der Unbeugsamkeit des Römers, der ausdauernden Entschlossenheit des Angelsachsen niemals seine Aufgabe hintangesetzt, wenn sich auch sein Herz nach Hause sehnt, sondern er will seinen Obliegenheiten nachkommen, bis er Finis unter sein Werk setzen kann.
Livingstone hat eine liebenswürdige Ungezwungenheit, die ich zu würdigen verstand. So oft er zu lachen anfing war das so ansteckend, dass ich es ihm nachthun musste. Es war ein Lachen wie das des „Herrn Teufelsdröck“, das den ganzen Menschen vom Kopf bis zur Zehe erschüttert. Wenn er eine Geschichte erzählte, so geschah das in einer Weise, dass man von der Wahrheit derselben überzeugt wurde. Dabei war sein Gesicht von der überraschenden Komik der Geschichte so verklärt, dass ich bestimmt wusste, sie sei erzählens- und hörenswerth.
Die hagern Züge, welche mich bei unserer ersten Zusammenkunft erschreckt hatten, der schwere Tritt, der von Alter und anstrengenden Reisen sprach, der graue Bart und die leichte Beugung seines Körpers gaben ein ganz falsches Bild von dem Manne. Unter diesem abstrapazirten Aeussern lag ein unendlicher Fond von Lustigkeit und unerschöpflichem Humor; sein rauhes Aeussere schloss ein jugendliches, übersprudelndes Gemüth in sich. Jeden Tag bekam ich unzählige Scherze, reizende Anekdoten und interessante Jagdgeschichten zu hören, in denen seine Freunde Oswell, Webb, Vardon und Gordon Cumming immer die Haupthelden waren. Im Anfang wusste ich nicht bestimmt, ob nicht diese Jovialität, dieser Humor und übersprudelnde Witz das Resultat einer nervösen Aufgeregtheit sei; da ich aber fand, dass sie solange vorhielten als ich bei ihm war, so muss ich sie für normal halten.
Noch ein Punkt, der meine Aufmerksamkeit besonders auf sich zog, war sein wunderbares Gedächtniss. Wenn man[S. 67] an die vielen Jahre denkt, die er in Afrika ohne Bücher zugebracht hat, so kann man es wol als ein ungewöhnliches Gedächtniss betrachten, dass er ganze Gedichte aus Byron, Burns, Tennyson, Longfellow, Whittier und Lowell hersagen kann. Der Grund hierzu liegt wol in der Thatsache, dass er ein fast ausschliesslich innerliches Leben geführt hat. Zimmermann, der die Natur des Menschen gründlich studirt hat, sagt in dieser Beziehung: „So erinnert man sich auch leicht an alles, was man gelesen, gehört, gethan, erfahren und gedacht hat. Jeder Blick ins Stille erzeugt dann neue Gedanken und gewährt dem Geiste die reinsten Vergnügungen. Man schaut zurück auf das Vergangene, schaut vor sich hin auf die Zukunft und vergisst auch wol Vergangenheit und Zukunft bei dem Genüsse seines gegenwärtigen Glücks.“ (J. G. Zimmermann, Ueber die Einsamkeit. Leipzig, 1785.) Er hat ganz in einer innerlichen Welt gelebt, aus der er selten erwachte, ausser um sich dem zuzuwenden, was für ihn und seine Leute unmittelbar praktisch nothwendig war. Dann verfiel er wieder in dieselbe glückliche innere Welt, die er mit seinen eigenen Freunden, Verwandten, Bekannten, mit ihm vertrauter Lektüre, Gedanken und Ideenassociationen so bevölkert hat, dass seine eigene Welt überall, wie seine Umgebung auch beschaffen sein mochte, für seinen gebildeten Geist mehr Anziehendes als die äussere Umgebung besass.
Die Charakteristik von Dr. Livingstone würde nicht vollständig sein, wenn wir nicht auch die religiöse Seite seines Charakters in Rücksicht ziehen. Seine Religion ist nicht theoretischer Natur, sondern eine beständige ernste, aufrichtige Praxis; sie ist weder demonstrativ noch laut, sondern zeigt sich in ruhiger, praktischer Weise und ist beständig thätig; sie ist nie aggressiv, was bisweilen sehr lästig, wenn nicht gar ungebührlich ist. In ihm zeigt die Religion ihre lieblichsten Züge; sie beherrscht sein Betragen nicht nur gegen seine Dienstleute, sondern auch gegen die Eingeborenen, die bigotten Mohammedaner und alle, die mit ihm in Berührung kommen. Ohne dieselbe wäre Livingstone mit seinem hitzigen Temperament, seiner Begeisterung, seinem Muth und strebsamem Geist ein sehr unumgänglicher[S. 68] Mensch und harter Herr geworden. Die Religion hat ihn gezähmt und ihn zu einem christlichen Gentleman gemacht; alles Rohe und Eigenwillige ist dadurch veredelt und unterdrückt worden. Die Religion hat ihn zu dem umgänglichsten Menschen und nachsichtigsten Herrn gemacht, zu einem Manne, dessen Gesellschaft im höchsten Grade angenehm ist.
Ich habe oft zugehört, wie unsere Diener unsere verschiedenen Eigenschaften besprachen. „Euer Herr“, sagten meine Diener zu denen von Livingstone, „ist ein guter Mann, ein sehr guter Mann; er schlägt euch nicht, denn er hat ein gutes Herz; aber der unserige — ach, der ist scharf und heiss wie Feuer «mkali sana, kana moto».“ Während er im Anfange bei seiner Ankunft in Udschidschi von den Arabern und Mischlingen gehasst und in jeder möglichen Weise chicanirt worden ist, hat er sich durch seine stets gleichbleibende Güte und sein mildes, angenehmes Temperament Aller Herzen gewonnen. Ich habe es gesehen, dass ihm allgemeine Achtung gezollt wurde. Selbst die Mohammedaner gingen nie an seinem Hause vorüber, ohne anzusprechen und ihn zu begrüssen und ihm ein: «der Segen Gottes ruhe auf Euch!» zuzurufen. Jeden Sonntag-Morgen versammelte er seine kleine Gemeinde um sich und las ihnen Gebete und ein Kapitel aus der Bibel in einem natürlichen, ungezierten und aufrichtigen Tone vor. Darauf hielt er eine kurze Anrede in der Kiswahili-Sprache über den verlesenen Gegenstand, dem seine Zuhörer mit offenbarem Interesse und grosser Aufmerksamkeit folgten.
Es gibt noch einen Punkt in Livingstone’s Charakter, über den diejenigen, welche seine Bücher lesen und seine Reisen studiren, Auskunft haben möchten, und das ist seine Fähigkeit, dem schrecklichen Klima Central-Afrikas Widerstand zu leisten, die consequente Energie, mit der er seine Forschungen verfolgt. Diese letztere ist ihm und seiner Rasse angeboren. Er bietet ein schönes Beispiel der Ausdauer, Standhaftigkeit und Zähigkeit, welche den Angelsachsen auszeichnen; doch ist seine Fähigkeit, dem Klima Widerstand zu leisten, nicht nur der glücklichen Constitution, die ihm angeboren ist, sondern auch dem streng mässigen Leben, das er stets geführt hat, zuzuschreiben.[S. 69] Ein Trunkenbold oder ein Mann von lasterhaften Angewohnheiten könnte niemals das Klima von Central-Afrika vertragen.
Am zweiten Tage nach meiner Ankunft in Udschidschi fragte ich Livingstone, ob er sich nicht bisweilen danach sehne, seine Heimat wiederzusehen und sich nach sechsjährigen Forschungen etwas auszuruhen. Die Antwort, die er mir darauf gab, kennzeichnet den ganzen Mann. Er sagte nämlich:
„Sehr gern würde ich nach Hause gehen und meine Kinder noch einmal sehen; ich kann es aber nicht über mich gewinnen, die Aufgabe, die ich mir gesetzt, jetzt im Stiche zu lassen, wo sie fast vollendet ist. Es gehören nur noch sechs bis sieben Monate dazu, um die wirkliche Quelle, die ich entdeckt habe, in Zusammenhang zu bringen mit dem Petherick’schen Arm des Weissen Nils oder mit Sir Samuel Baker’s Albert-Nyanza, welches der See ist, den die Eingeborenen “Tschowambe„ nennen. Warum sollte ich nach Hause gehen, ehe meine Aufgabe beendet ist, um wieder zurückkehren zu müssen und dann erst etwas zu leisten, was ich jetzt gut zu Stande bringen kann?“
„Und warum“, fragte ich, „sind Sie soweit zurückgekehrt, ohne die Aufgabe, von der Sie sagen, dass sie geleistet werden müsse, zu beendigen?“
„Einfach, weil ich dazu gezwungen war. Meine Leute wollten nicht einen Schritt weitergehen. Sie empörten sich und beschlossen heimlich, wenn ich darauf bestände, weiterzugehen, Unruhen im Lande zu erregen, und nachdem sie das zu Stande gebracht, mich im Stich zu lassen. In diesem Falle wäre ich ermordet worden. Es war gefährlich vorwärts zu gehen. Ich hatte 600 Meilen der Wasserscheide erforscht und die hauptsächlichsten Flüsse, die ihr Wasser in das Central-Wassersystem ergiessen, untersucht; als ich aber die letzten 100 Meilen untersuchen wollte, verloren meine Leute den Muth und machten sich daran, meine Absicht in jeder möglichen Weise zu vereiteln. Jetzt, wo ich 700 Meilen zurückgelegt habe, um mir neue Vorräthe und eine neue Begleitung zu verschaffen, finde ich mich selbst von[S. 70] den Mitteln verlassen, um nur ein paar Wochen zu leben, und bin krank an Geist und Körper.“
Hier frage ich den Leser, wie er sich wol in einer solchen Krisis unter einer solchen Last von Schwierigkeiten benommen haben würde. Viele wären gewiss in grosser Eile gewesen, nach Hause zu kommen, um die neuen Entdeckungen, die aus den fortgesetzten Forschungen hervorgegangen, zu veröffentlichen und die Angst der trauernden, auf seine Rückkehr wartenden Familie und Freunde zu beschwichtigen. Es war doch sicherlich hinreichend viel für die Lösung des Problems, das den Geist seiner wissenschaftlichen Genossen in der Königl. Geographischen Gesellschaft bewegte, geleistet worden. Das war ja keine unfruchtbare Forschung, sondern schwere, ernste, jahrelange Arbeit voll Selbstverleugnung, ausdauernder Geduld und erhabener Tapferkeit, wie sie gewöhnliche Menschen nicht aufzuweisen haben.
Wenn nun Livingstone der Sitte anderer Reisender gefolgt und an die Küste geeilt wäre, nachdem er den See Bangweolo entdeckt, um der geographischen Welt darüber Mittheilung zu machen? Wenn er dann wieder zurückgekehrt wäre, um den Moero zu entdecken und über diesen Bericht erstattet, und dann dasselbe Verfahren bei der Entdeckung des Kamolondo abermals eingeschlagen hätte? Er hingegen entdeckt nicht nur den Chambezi, den See Bangweolo, den Fluss Luapula, den See Moero, den Fluss Lualaba und den See Kamolondo, sondern dringt noch weiter vorwärts, um das grossartige See- und Flusssystem in seinem Zusammenhang vollständig zu erforschen. Wäre er dem Beispiel gewöhnlicher Reisender gefolgt, so hätte er viel Zeit auf Hin- und Herreisen verwandt, um Mittheilungen zu machen, statt zu forschen, und wäre im Stande gewesen, ein Buch über die Entdeckung eines jeden einzelnen Sees zu schreiben und dadurch viel Geld zu verdienen. Der Inhalt seiner Bücher besteht aber nicht in den Forschungen weniger Monate. Seine „Missions-Reisen“ umfassen eine Periode von sechzehn Jahren; sein Buch über den Zambezi fünf Jahre, und wenn der grosse Reisende solange lebt um heimzukehren, so wird sein drittes Werk, das grossartigste von allen, die Berichte von acht bis neun Jahren enthalten.
[S. 71]
Bei Livingstone ist es Princip, was er unternimmt gut durchzuführen, und im Bewusstsein, dass er dies thut, findet er trotz seiner Sehnsucht nach der Heimat, die bisweilen überwältigend ist, einen gewissen Grad von Zufriedenheit, wenn nicht Glückseligkeit. Während anders geartete Leute einen langen Aufenthalt unter den Wilden Afrikas mit Schrecken betrachten würden, so findet Livingstone’s Geist Freude und Nahrung für seine wissenschaftlichen Studien darin. Die Wunder der Urwelt, die grossen Wälder und hohen Gebirge, die unversieglichen Ströme und Quellen der grossen Seen, die Wunder der Erde, die Herrlichkeiten des tropischen Himmels bei Tag und Nacht, kurz alle Erd- und Himmelserscheinungen sind Manna für einen Mann von solcher Selbstverleugnung und einem so hingebenden philantropischen Geiste. Der urwüchsigen Einfachheit der dunkeln Kinder Aethiopiens, unter denen er so viele Jahre seines Lebens zugebracht hat, kann er Reize abgewinnen. Er hat einen festen Glauben an ihre Fähigkeiten; sieht Tugend in ihnen, wo andere nur Barbarei erblicken, und wo er bei ihnen gewesen ist, hat er versucht das Volk zu heben, das anscheinend von Gott und der Christenheit vergessen worden ist.
Eines Abends nahm ich mein Notizbuch zur Hand und schrieb ihm die Worte vom Munde ab, die er mir über seine Reisen mitzutheilen hatte. Ohne Zaudern erzählte er mir seine Erlebnisse, von denen das Folgende ein kurzer Abriss ist.
Dr. David Livingstone hat die Insel Zanzibar im März 1866 verlassen. Am 7. April reiste er von der Mikindiny-Bai mit einer Expedition ins Innere ab, die aus zwölf Sepoys aus Bombay, neun Johannesen von den Komoro-Inseln, sieben freigelassenen Sklaven und zwei Leuten aus Zambezi, die er versuchsweise mitgenommen, nebst sechs Kamelen, drei Büffeln, zwei Mauleseln und drei Eseln bestand. So hatte er alles in allem dreissig Leute bei sich, von denen zwölf, nämlich die Sepoys, als Wächter bei der Expedition dienen sollten. Sie waren meist mit gezogenen Enfield-Gewehren bewaffnet, welche er von der Regierung in Bombay geschenkt bekommen hatte. Das Gepäck der Expedition[S. 72] bestand aus zehn Ballen Zeug und zwei Säcken Perlen, die als Circulationsmittel zum Einkauf der Lebensbedürfnisse in den Ländern, welche Livingstone zu besuchen beabsichtigte, verwerthet werden sollten. Ausser diesen schwerfälligen Tauschmitteln führten sie noch mehrere Kasten voll Instrumente, wie z. B. Chronometer, Luftthermometer, Sextanten, künstliche Horizonte, nebst Kisten voll Kleider, Medicin und persönliche Bedürfnisse mit sich. Die Expedition reiste das linke Ufer des Rovuma-Flusses hinauf, eine Strasse, die ungemein beschwerlich ist. Meilenlang mussten Livingstone und seine Begleiter sich den Weg mit Aexten durch den dichten, fast undurchdringlichen Schilfmoor, der sich an den Ufern des Flusses hinzieht, bahnen. Der Weg war ein blosser Fusspfad, der in planlosester Weise in das Dickicht hinein- und wieder hinausführte, wobei er ohne Rücksicht auf den weitern Verlauf sich den bequemsten Ausweg suchte. Die Pagazi konnten wol ziemlich bequem fortkommen, aber die Kamele waren wegen ihrer Grösse nicht im Stande, einen Schritt vorwärts zu machen, ohne dass ihnen die Aexte der Leute erst den Weg bahnten. Dieses Instrument war fast überall nothwendig und das Vorwärtsschreiten der Expedition wurde ausserdem vielfach aufgehalten durch die bei den Sepoys und Johannesen sich zeigende Unlust zur Arbeit.
Schon bald nach der Abreise der Expedition von der Küste fing das Murren und Klagen dieser Leute an, und bei jeder Gelegenheit legten sie eine entschiedene Abneigung gegen den Weitermarsch an den Tag. Um die Reise des Doctors zu verhindern und in der Hoffnung, dass sie ihn zur Rückkehr an die Küste zwingen könnten, behandelten sie die Thiere so grausam, dass in kürzester Zeit kein einziges mehr am Leben war. Da aber dieser Plan ihnen mislang, so machten sie sich daran, die Eingeborenen gegen den Weissen aufzustacheln, den sie frevelhafterweise ganz eigenthümlicher Dinge beschuldigten. Da ihnen dies wol gelungen wäre und es gefährlich war, solche Leute in seiner Umgebung zu haben, so kam der Doctor zu dem Schluss, dass es am besten sei, sie zu entlassen, und er schickte daher die Sepoys an die Küste zurück, nachdem er sie mit[S. 73] Lebensmitteln für die Heimreise versehen hatte. Diese Leute hatten sich in so üblen Ruf gebracht, dass die Eingeborenen sie als des Doctors Sklaven bezeichneten. Einer ihrer schlimmsten Fehler war der, dass sie gewohnt waren, ihre Flinten und Munition dem ersten besten Weib oder Knaben, dem sie begegneten, zum Tragen zu geben, und diese zu dem Zweck mit Drohungen und Versprechungen bestürmten, zu deren Verwirklichung sie weder die Macht noch das Recht hatten. Schon nach einstündigem Marsche waren sie müde und legten sich dann am Wege hin, um ihr schweres Schicksal zu bejammern und neue Pläne zu schmieden, wie sie ihres Führers Absichten vereiteln könnten. Gegen Abend erschienen sie gewöhnlich auf dem Lagergrunde wie halbtodte Menschen. Derartige Leute waren natürlich eine armselige Begleitung, denn wäre die Expedition von einem irgendwie erheblichen Stamme wandernder Eingeborener angegriffen worden, so hätte Livingstone sich nicht vertheidigen können und es wäre ihm nichts übrig geblieben, als sich ihnen zu ergeben und unterzugehen.
Am 18. Juli 1866 kam Livingstone und seine kleine Expedition in einem Dorfe an, das einem Häuptling der Wahiyou gehörte, acht Tagereisen vom Rovuma entfernt, von wo man die Wasserscheide des Nyassa-Sees überblickte. Das Gebiet, das zwischen dem Rovuma-Flusse und diesem Dorfe des Wahiyou-Häuptlings lag, war eine unbewohnte Wildniss, und Livingstone, sowie seine Expedition, hatte während des Durchschreitens derselben bedeutend von Hunger und Desertion der Leute zu leiden.
In den ersten Tagen des August 1866 kam der Reisende nach dem Lande Mponda’s, eines Häuptlings, der in der Nähe des Nyassa-Sees lebt. Auf dem Wege dahin desertirten ihm zwei Freigelassene. Hier bestand auch Wekotani — nicht Wakotani —, ein Schützling des Doctors, auf seiner Entlassung, angeblich weil er seinen Bruder gefunden habe; die Unwahrheit dieses Vorwandes stellte sich später heraus. Er behauptete zugleich, seine Familie lebe auf dem östlichen Ufer des Nyassa-Sees und Mponda’s Lieblingsfrau sei seine Schwester. Da Livingstone einsah, dass Wekotani ihn nicht weiter begleiten wolle, brachte er diesen zu Mponda, der[S. 74] ihn früher weder gesehen, noch je von ihm gehört hatte. Trotzdem liess er ihn bei diesem Häuptling, nachdem er den undankbaren Jungen noch mit soviel Zeug und Perlen versehen, dass er davon leben könne, bis sein „grosser Bruder“ ihn abholen würde, und ausserdem überzeugte er sich davon, dass Mponda ihn ehrenhaft behandeln werde. Wekotani konnte lesen und schreiben, was er in der Schule in Bombay gelernt hatte; Livingstone übergab ihm daher auch Schreibpapier, damit er, wenn er je dazu Neigung fühlte, Herrn Horace Waller oder ihm selbst schreiben könne. Ferner schärfte ihm der Doctor ein, sich nicht auf Sklavenzüge einzulassen, die von seinen Landsleuten, den Nyassanern, gewöhnlich gegen ihre Nachbarn ausgeführt werden. Als Wekotani fand, dass sein Entlassungsgesuch Erfolg hatte, versuchte er es, einen andern Schützling Livingstone’s, den Dschumah, der des Wekotani’s specieller Gefährte war, gleichfalls dazu zu bewegen, den Dienst zu verlassen und mit sich fortzunehmen, wobei er ihm als Lohn eine Frau und viel Pombé von seinem grossen Bruder versprach. Als Dschumah dies dem Doctor mittheilte, wurde ihm von diesem davon abgerathen, da er den Wekotani sehr im Verdacht hatte, er wolle Dschumah zum Sklaven machen. Letzterer zog sich darauf klugerweise von seinem Versucher zurück. Aus dem Gebiete Mponda’s ging die Reise weiter an das Südende des Nyassa in das Dorf eines Babisa-Häuptlings, der Arznei gegen eine Hautkrankheit zu haben wünschte. Mit seiner gewöhnlichen Güte blieb er im Dorf dieses Häuptlings, um dessen Krankheit zu behandeln.
Während er hier war, kam ein Mann von halb arabischer Abkunft vom westlichen Ufer des Sees her und berichtete, er sei von einer Bande Mazitu ausgeplündert worden, an einem Orte, von dem der Doctor und Musa, der Führer der Johannesen, wohl wussten, dass er wenigstens 150 Meilen nord-nordwestlich von ihrem Aufenthaltsorte entfernt sei. Musa hörte trotzdem aus Gründen, die wir sofort berichten werden, mit Eifer der Erzählung des Arabers zu und schenkte ihm vollen Glauben. Nachdem er sich die schauderhaften Einzelheiten vollständig angeeignet, kam er zu Livingstone, um ihm das zu berichten, was er selbst so gern[S. 75] gehört hatte. Der Reisende hörte die Erzählung geduldig an, die durch Musa’s Bericht nichts von ihrer furchtbaren Bedeutung verlor, und fragte den letzteren darauf, ob er sie glaube. „Ja“, sagte Musa rasch in gebrochenem Englisch, „er hat mir die Wahrheit gesagt; ich habe ihn gut ausgefragt und er sagte mir die Wahrheit.“ Livingstone erwiderte jedoch, er glaube das nicht, denn die Mazitu würden sich nicht damit begnügt haben, den Mann blos zu prügeln, sondern hätten ihn bestimmt ermordet; doch schlug er vor, sie beide möchten sich, um die Befürchtungen seines muselmännischen Untergebenen zu beschwichtigen, an den Häuptling, bei dem sie sich aufhielten, wenden, der als ein verständiger Mann im Stande sein werde, ihnen über die Wahrscheinlichkeit dieser Erzählung Auskunft zu geben. Sie gingen also zusammen zum Babisa-Häuptling, der, als er die Geschichte des Arabers hörte, denselben ohne Zaudern für einen Lügner und seine Geschichte für vollständig unbegründet erklärte, was er daraus schloss, dass er sicherlich zeitig von der Anwesenheit der Mazitu gehört hätte, falls sie vor kurzem in der Gegend gewesen wären.
Musa jedoch brach in die Worte aus: „Nein, nein, Doctor, nein, nein, nein! Ich wünsche nicht, zu den Mazitu zu gehen. Ich wünsche nicht, von den Mazitu getödtet zu werden, sondern will Vater, Mutter und Kind in Johanna wiedersehen. Ich wünsche mir keine Mazitu!“ Das waren Musa’s eigene Worte.
Livingstone erwiderte hierauf: „Auch ich wünsche nicht von den Mazitu getödtet zu werden, da Ihr sie aber fürchtet, so verspreche ich Euch, direct nach Westen zu gehen, bis wir weit aus dem Bereich der Mazitu heraus sind.“
Musa war jedoch dadurch nicht befriedigt, sondern seufzte und härmte sich weiter und meinte: „Wenn wir zweihundert Gewehre bei uns hätten, so würde ich gehen; unsere kleine Expedition wird aber über Nacht überfallen und getödtet werden.“
Livingstone wiederholte hierauf sein Versprechen, dass er nicht in ihre Nähe, sondern nach Westen ziehen werde.
Sobald er sich aber nach Westen wandte, liefen Musa und die Johannesen insgesammt fort.
[S. 76]
Als der Doctor sich über Musa’s Betragen ausliess, sagte er, er habe sich sehr stark versucht gefühlt, Musa und einen andern Rädelsführer zu erschiessen, sei aber trotzdem froh darüber, seine Hände nicht mit dem Blute dieser Spitzbuben besudelt zu haben. Ein paar Tage später kam noch ein anderer von Livingstone’s Leuten, namens Simeon Price, mit derselben Erzählung über die Mazitu zu ihm; da dieser aber durch die kleine Zahl seiner Leute gezwungen war, alle derartige Neigungen zur Desertion und Schwachmüthigkeit zu unterdrücken, so brachte er jenen sofort zum Schweigen und verbot ihm auf das strengste, noch einmal den Namen der Mazitu auszusprechen.
Hätten ihm die Eingeborenen nicht beigestanden, so hätte er daran verzweifeln müssen, je in das wilde, unerforschte Innere, das er jetzt zu betreten im Begriff stand, zu gelangen. „Zum Glück“, sagte er mit Salbung, „befand ich mich jetzt, nachdem ich die Ufer des Nyassa verlassen, in einem Lande, in welches noch nie ein Sklavenhändler den Fuss gesetzt. Es war ein neues, jungfräuliches Land und infolge dessen sind, wie ich es stets gefunden habe, die Eingeborenen gut und gastfrei und sie trugen mir mein Gepäck gegen eine sehr geringe Gabe an Zeug von Dorf zu Dorf.“ Noch in vielen andern Beziehungen wurde der Reisende in seiner Noth von diesen noch unverdorbenen, unschuldigen Eingeborenen freundlich behandelt.
Als Livingstone diese gastfreie Gegend im Anfange des December 1866 verliess, kam er in ein Land, wo die Mazitu ihre gewohnten Räubereien ausgeführt hatten. Dasselbe war von allen Vorräthen und Vieh vollständig ausgeplündert worden und das Volk in andere Gegenden, die ausserhalb des Bereichs dieser wilden Räuber lagen, ausgewandert. Wiederum wurde die Reisegesellschaft von quälendem Hunger gepeinigt und musste zu wilden Früchten, die in einigen Theilen dieses Landes wachsen, ihre Zuflucht nehmen. Zu Zeiten wurde der Zustand dieser schwer heimgesuchten Expedition noch durch die herzlose Desertion einiger Mitglieder verschlimmert, die mehr als einmal mit Livingstone’s persönlichem Gepäck, seinen zum Wechseln bestimmten Kleidern und seiner Wäsche fortliefen. Unter grössern und kleinern[S. 77] Unglücksfällen, die ihn hartnäckig verfolgten, kam er doch sicher durch die Länder der Babisa, Bobemba, Barungu, Ba-ulunga und Lunda.
Im Lande Lunda lebt der berühmte Cazembe, der den Europäern zuerst durch den portugiesischen Reisenden Dr. Lacerda bekannt geworden ist. Cazembe ist ein sehr intelligenter Fürst; ein grosser, stämmiger Mann, der eine eigenthümliche, aus gedruckten rothen Stoffen bestehende Kleidung, in der Form eines grossen schottischen Männerunterrocks, trägt. In diesem Staatsanzuge empfing König Cazembe, von seinen Häuptlingen und Leibwachen umgeben, den Dr. Livingstone. Ein Häuptling, der vom König und den Aeltesten abgesandt worden, um alle Einzelheiten über den Weissen zu erfahren, erhob sich darauf vor der Versammlung und trug das Resultat seiner Untersuchungen mit lauter Stimme vor. Er hatte erfahren, der Weisse sei angekommen, um sich die Gewässer, Flüsse und Seen anzusehen und bezweifelte, obwol er nicht begreifen konnte, wozu der Weisse dies brauche, durchaus nicht, dass sein Zweck gut sei. Darauf fragte Cazembe den Doctor, was er vorhabe und wohin er gehen wolle. Dieser erwiderte ihm, er habe daran gedacht, nach Süden zu ziehen, da er von Seen und Flüssen gehört, die in jener Richtung lägen. Hierauf fragte Cazembe: „Wozu wollt Ihr dahin gehen? Das Wasser befindet sich hier ganz in der Nähe. Wir haben in dieser Umgegend viele grosse Gewässer.“ Ehe die Versammlung auseinanderging, erliess Cazembe den Befehl, den Weissen überall ungestört und unbelästigt durch sein Land ziehen zu lassen. Es sei der erste Engländer, den er gesehen, meinte er, und er habe ihn gern.
Bald nach dieser Einführung beim König kam die Königin in das grosse Haus, von einer mit Speeren bewaffneten Leibwache von Amazonen umgeben. Sie war eine schöne, schlanke, stattliche junge Frau und dachte offenbar, sie werde auf den bäurischen Weissen einen grossen Eindruck machen, denn sie hatte sich in höchst königlicher Weise angethan und war mit einem schweren Speer bewaffnet. Doch brachte ihre Erscheinung, die so ganz anders war, als Livingstone sich eingebildet, diesen zum Lachen und[S. 78] vereitelte dadurch die beabsichtigte Wirkung vollständig, denn das Gelächter des Doctors war so ansteckend, dass die Königin selbst es zuerst nachmachte und die Amazonen in höfischer Weise ihr folgten. Hierdurch ausser Fassung gebracht, lief die Königin, von ihren gehorsamen Dämchen begleitet, in höchst würdeloser und im Vergleich zu der majestätischen Art, in welcher sie aufgezogen war, ziemlich unköniglicher Weise zurück. Livingstone wird noch viel über seinen Empfang an diesem Hofe, sowie den interessanten König und seine Königin zu erzählen haben. Und wer kann wol so gut wie er selbst die von ihm persönlich erlebten Scenen beschreiben?
Bald nach seiner Ankunft im Lande Lunda oder Londa, noch ehe er den Bezirk, über den Cazembe herrscht, betreten hatte, war er über den Chambezi genannten Fluss gekommen, der ein ganz bedeutender Strom ist. Die Aehnlichkeit des Namens mit dem grossen, schönen, südlichen Fluss, der auf immer mit Livingstone’s Namen verbunden sein wird, führte diesen zu der Zeit irre und er zollte ihm daher nicht die Aufmerksamkeit, die ihm gebührte, sondern hielt den Chambezi nur für ein Wasser, aus dem der Zambezi entsteht, und glaubte daher, dass er keine Beziehung zu den Quellen des ägyptischen Flusses habe, die er aufsuchte. Sein Fehler bestand darin, dass er sich zu sehr auf die Genauigkeit der portugiesischen Nachrichten verliess und es hat ihm viele Monate langwieriger Mühen und Reisen gekostet, denselben wieder gut zu machen.
Seit dem Anfang des Jahres 1867, wo er im Reiche Cazembe’s ankam, bis Mitte März 1869, der Zeit seiner Ankunft in Udschidschi, war er meist damit beschäftigt, die Irrthümer und falschen Darstellungen portugiesischer Reisender zu berichtigen. Wenn die Portugiesen vom Flusse Chambezi sprechen, so nennen sie ihn immer „unsern eigenen Zambezi“, welcher nämlich durch die portugiesischen Besitzungen in Mozambique fliesst. Sie hatten Livingstone gesagt: „Wenn Sie vom Nyassa zu Cazembe ziehen, so werden Sie unsern eigenen Zambezi überschreiten“. Diese bestimmte, wiederholte, nicht nur mündlich abgegebene, sondern auch in ihren Büchern und Karten verzeichnete[S. 79] Nachricht wirkte natürlich verwirrend. Als Livingstone nun bemerkte, dass ihre Beschreibungen mit dem, was er selbst gesehen, nicht übereinstimmten, brach er — aus einem ernsten Wunsche, Richtiges zu geben und in Zweifel darüber, ob er sich nicht selbst geirrt habe — auf, um noch einmal das Stück Land zu bereisen, durch das er schon gekommen war. Immer aufs neue durchzog er, wie ein ruheloser Geist, die verschiedenen Länder, die von mehreren Flüssen des complicirten Wassersystems bewässert werden, und richtete die nämlichen Fragen an die verschiedenen Völkerschaften, die er besuchte, bis er damit aufhören musste, um nicht für verrückt zu gelten.
Doch haben seine Reisen und langwierigen Mühsale in Lunda und den umliegenden Gebieten folgendes über allen Zweifel festgestellt: erstens, dass der Chambezi ein ganz anderer Fluss als der Zambezi der Portugiesen ist; und zweitens, dass der Chambezi, der ungefähr am elften Grad südlicher Breite entspringt, nichts anderes als der südlichste Zufluss des grossen Nils ist und dadurch diesem berühmten Flusse eine Länge von mehr als 2000 Meilen, den Breitengraden nach, gibt, wodurch er zum zweiten Fluss nach dem Mississippi, dem längsten Strom der Erde, wird. Der wirkliche Name des Zambezi ist Dombazi. Als Lacerda und seine portugiesischen Nachfolger bei ihrem Besuch bei Cazembe den Chambezi überschritten und seinen Namen hörten, war es natürlich, dass sie ihn als „unsern eigenen Zambezi“ bezeichneten und ihn, ohne weitere Untersuchung, so darstellten, als ob er in der Richtung dieses Stromes fliesse.
Während seiner Untersuchungen in dieser Gegend, die so reich an Entdeckungen waren, kam Livingstone an einen See, der nordöstlich von Cazembe liegt und von den Eingeborenen Liemba genannt wird, nach dem gleichnamigen Lande, das im Osten und Süden an denselben grenzt. Als er diesen See nach Norden verfolgte fand er, dass es der Tanganika oder vielmehr sein südöstlichstes Ende sei, welches auf seiner Karte dem Umriss von Italien sehr ähnlich sieht. Der Breitengrad des südlichen Endes dieses grossen Wasserkörpers ist ungefähr 8° 42′ südlicher Breite, wodurch er eine Länge von 360 engl. geographischen Meilen von Norden[S. 80] nach Süden erhält. Vom südlichen Ende des Tanganika zog Livingstone nach Marungu und bekam den See Moero in Sicht. Als er diesen See, der ungefähr 60 Meilen lang ist, bis an sein südliches Ende verfolgte, entdeckte er einen Fluss, der Luapula heisst und aus jener Himmelsgegend in denselben eintritt. Dem Luapula nach Süden folgend fand er, dass derselbe aus dem grossen See Bangweolo entspringt, der in seinem Flächenumfang beinahe ebenso gross wie der Tanganika ist. Als er die Gewässer untersuchte, welche sich in diesen See ergiessen, stellte sich heraus, dass der Chambezi der bei weitem bedeutendste unter diesen Zuflüssen sei, sodass er den Chambezi von seiner Quelle bis zum See Bangweolo und den Ausfluss aus dessen nördlichem Ende, unter dem Namen Luapula, verfolgt und gefunden hat, dass er in den See Moero fliesst. Wiederum kehrte er nach dem Reiche Cazembe’s mit der vollen Ueberzeugung zurück, dass der durch drei Breitengrade nach Norden sich verlaufende Fluss nicht derselbe sein könne, wie der unter dem Namen Zambezi nach Süden fliessende, obgleich ihre Namen sehr ähnlich lauten.
In Cazembe’s Wohnsitz fand er ein altes, weissbärtiges, der Mischlingsrasse angehöriges Individuum, namens Mahommed bin Sali, der vom Könige, wegen gewisser verdächtiger Umstände bei seiner Ankunft und seinem Aufenthalte im Lande, als eine Art Staatsgefangener behandelt wurde. Durch Livingstone’s Einfluss wurde Mahommed bin Sali befreit. Auf seinem Wege nach Udschidschi hatte er Ursache es sehr zu bereuen, dass er sich für dieses Halbblutindividuum ins Mittel gelegt hatte. Er erwies sich nämlich als ein elender, undankbarer Wicht, der die wenigen Begleiter von Livingstone zu verführen suchte und sich bei ihnen dadurch beliebt machte, dass er ihnen die Gunstbezeugungen seiner Concubinen verkaufte, wodurch er sie gewissermassen zu knechten verstand. Hier wurde der Doctor von allen, mit Ausnahme zweier, verlassen; denn selbst der treue Susi und Dschumah verliessen ihn, um in Mahommed bin Sali’s Dienste zu treten. Diese aber trennten sich bald wieder und kehrten zu ihrem alten Herrn zurück. Von dem Tage an, wo er den gemeinen alten Kerl[S. 81] in seiner Gesellschaft hatte, verfolgte ihn schweres Misgeschick bis zu seiner Ankunft in Udschidschi im März 1869.
Nun blieb er bis Ende Juni 1869 in Udschidschi, von wo er die Briefe schrieb, welche, obwol die Laienwelt es bezweifelte, dass er am Leben sei, doch der Königl. Geographischen Gesellschaft und seinen intimen Freunden die Ueberzeugung davon beibrachten, sodass diese Musa’s Bericht für die zwar scharfsinnige, aber lügenhafte Erfindung eines feigen Deserteurs hielten. Während dieser Zeit fasste er den Gedanken, um den Tanganika zu segeln; die Araber und Eingeborenen gingen aber so darauf aus, ihn zu betrügen, dass, falls er dies wirklich unternommen hätte, der Rest seiner Waaren ihn nicht in den Stand gesetzt haben würde, das mittlere Wassersystem zu erforschen, dessen Anfangspunkt er weit im Süden vom Wohnsitze Cazembe’s, ungefähr am elften Grad südlicher Breite, im Chambezi-Flusse gefunden hat.
In den Tagen, wo Kapitän Burton nach seinem Marsche von der Küste bei Zanzibar ermüdet in Udschidschi ausruhte, war das Land, in welches Livingstone bei seiner Abreise von Udschidschi seine Schritte lenkte, den Arabern nur durch ungenaue Berichte bekannt. Burton und Speke haben, wie es scheint, nie davon reden hören. Speke, der Geograph von Burton’s Expedition, hat zwar von einem Ort, der Urua hiess, gehört, dem er auf seiner Karte nach der allgemeinen, von den Arabern angegebenen Richtung eine Stelle gab; doch hatten die unternehmendsten Araber auf ihren Handelsreisen nach Elfenbein nur die Grenze von Rua berührt, wie die Eingeborenen und Livingstone es nennen; denn Rua ist ein ungeheures Land, das sechs Breitengrade lang ist und sich in einer bisher noch unbekannten Breite von Osten nach Westen erstreckt.
Ende Juni 1869 verliess Livingstone Udschidschi und begab sich über den See nach dem auf dem westlichen Ufer gelegenen Uguhha, um seine letzte und grösste Reihe von Erforschungen vorzunehmen. Das Resultat derselben bestand in einer abermaligen Entdeckung eines Sees von erheblicher Grösse, der mit dem Moero durch den grossen, Lualaba[S. 82] genannten Fluss in Verbindung steht und eine Fortsetzung der Kette von Seen bildet, die er vorher entdeckt hatte.
Vom Hafen von Uguhha ging er mit einer Gesellschaft von Händlern in fast direct westlicher Richtung nach dem Lande Urua ab. Ein funfzehntägiger Marsch brachte ihn nach Bambarre, dem ersten wichtigen Elfenbeindepot in Manyema, oder wie die Eingeborenen es aussprechen: Manyuema. Fast sechs Monate lang wurde er in Bambarre aufgehalten durch Geschwüre an den Füssen, aus denen Blutwasser floss, sobald er sie auf den Boden setzte. Als er sich erholt hatte reiste er in nördlicher Richtung ab und kam nach mehreren Tagen an einen breiten, seeartigen Fluss, welcher Lualaba heisst und nach Norden und Westen, an einigen Stellen nach Süden, in sehr verwirrender Weise dahinfliesst. Der Fluss war 1–3 engl. Meilen breit. Durch grosse Hartnäckigkeit gelang es Livingstone, dessen labyrinthischen Lauf zu verfolgen, bis er entdeckte, dass der Lualaba sich in den schmalen, langen See Kamolondo, ungefähr 6° 30′ südlicher Breite, ergiesst. Als er diesen nach Süden zu weiter verfolgte, kam er an den Punkt, wo er den Luapula in den See Moero eintreten sah.
Wenn man Livingstone’s Beschreibungen der Schönheiten der Landschaft am Moero anhört, so wird man ganz begeistert. Von allen Seiten von hohen Bergen eingepfercht, welche bis an den Rand von reicher tropischer Vegetation bekleidet sind, entlässt der Moero sein überflüssiges Wasser durch einen tiefen Spalt im Busen der Gebirge. Der ungestüme, grossartige Fluss donnert durch den Spalt wie ein Wasserfall, dehnt sich aber, nachdem er dieses enge und tiefe Bett verlassen hat, in den ruhigen, breiten, sich über Meilen erstreckenden Lualaba aus. Nachdem er grosse Biegungen nach Westen und Südwesten gemacht hat und sich darauf nach Norden wendet, tritt er in den Kamolondo. Von den Eingeborenen wird er Lualaba genannt, Livingstone aber hat, um ihn von andern Flüssen desselben Namens zu unterscheiden, ihm den Namen „Webb’s Fluss“ gegeben, nach Herrn Webb, dem reichen Besitzer von Newstead Abbey, den der Doctor als einen seiner ältesten und treuesten Freunde verehrt. Südwestlich vom Kamolondo[S. 83] befindet sich ein anderer grosser See, welcher sein Wasser durch den bedeutenden Fluss Loeki oder Lomami in den grossen Lualaba ergiesst. Diesem See, der den Eingeborenen als Tschebungo bekannt ist, hat Livingstone den Namen „Lincoln“ gegeben, damit er später in Büchern und Karten als Lincoln-See zum Gedächtniss des ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln bezeichnet werde. Livingstone that dies in Erinnerung an den lebhaften Eindruck, den es auf ihn machte, als er einen Theil von Lincoln’s Eröffnungsrede von einer englischen Kanzel hatte verlesen hören, worin die Ursachen dargelegt waren, die Lincoln dazu bewogen hatten, seine Emancipations-Proclamation zu erlassen, durch welche denkwürdige That vier Millionen Sklaven auf immer befreit wurden. Zum Gedächtniss dieses Mannes, dessen Wirken zu Gunsten der Negerrasse das Lob aller guten Menschen verdient, hat Livingstone ein Monument errichtet, das dauerhafter als Erz oder Stein ist.
In Webb’s Fluss tritt von Südsüdwest, etwas nördlich vom Kamolondo, ein grosser, Lufira genannter Fluss ein; doch sind die Bäche, welche sich aus der Wasserscheide in den Lualaba ergiessen, so zahlreich, dass des Doctors Karte sie nicht alle aufnehmen konnte und er sie, mit Ausnahme der bedeutendsten, ausgelassen hat. Indem er seinen Weg nach Norden fortsetzte und den Lualaba durch seine mannichfaltigen Curven bis zum vierten Grad südlicher Breite verfolgte, kam er an einen Ort, wo er von einem andern See im Norden hörte, in welchen jener fliesst. Hier kommen wir aber zu einem vollständigen Stillstand und können nur sagen: „Dies war der weitliegendste Punkt, von wo Livingstone gezwungen war, auf dem mühseligen 700 Meilen langen Weg nach Udschidschi zurückzukehren.“
Aus dieser kurzen Skizze von Dr. Livingstone’s wunderbaren Reisen wird hoffentlich selbst der oberflächlichste Leser sowol als der eigentliche Geograph dieses grosse System von Seen begreifen, die durch Webb’s Fluss miteinander verbunden werden, und erkennen, was Dr. Livingstone während dieser langen Jahre geleistet und wie sehr er unsere geographischen Kenntnisse von Afrika erweitert hat. Dass dieser unter verschiedenen Namen bekannte Fluss,[S. 84] der von einem See in einen andern nach Norden fliesst, trotz aller seiner Krümmungen und Windungen der Nil ist, darüber hegt Livingstone keinen Zweifel. Eine lange Zeit hindurch war er wirklich ganz unsicher darüber, wegen der grossen Biegungen und nach Westen, ja sogar nach Südwesten gerichteten Krümmungen; nachdem er ihn aber von seinem Ursprung, dem Chambezi, sieben Breitengrade hindurch, d. h. vom elften Grad bis zum vierten Grad südlicher Breite verfolgt hat, ist er zu dem Schluss gezwungen, dass es kein anderer als der Nil sein kann. Er hat ihn zuerst für den Congo gehalten, als Quellen des Congo aber den Kassai und Kwango erkannt, zwei Flüsse, welche auf der westlichen Seite der Wasserscheide des Nils, ungefähr in der Breite des Bangweolo, entspringen; auch hat er von einem andern Flusse, der Lubilasch heisst, gehört, welcher im Norden seinen Ursprung nimmt und nach Westen läuft. Der Lualaba kann dagegen nach Livingstone’s Ansicht, schon wegen seiner Grösse und Masse sowie seines beständigen, anhaltenden Laufes nach Norden durch ein breites, ausgedehntes Thal, das von hohen Bergen im Westen und Osten begrenzt wird, nicht der Congo sein. Die Höhe des nördlichsten Punktes, bis zu welchem er diesen wunderbaren Fluss verfolgt hat, betrug etwas mehr als 2000 Fuss; sodass, obgleich Baker behauptet, sein See sei 2700 Fuss über dem Meere, doch der Bahr Ghazal, durch welchen der Petherick’sche Arm des Weissen Nils sich in den Nil ergiesst, nur 2000 Fuss hoch liegt. In diesem Falle liegt die Möglichkeit vor, dass der Lualaba nichts anderes als der Petherick’sche Arm sein mag.[5]
Bekanntlich sind Elfenbein-Handelsstationen ungefähr 500 Meilen den Petherick’schen Arm hinauf gegründet. Diese Thatsache muss man im Gedächtniss behalten, wenn man hört, dass Gondokoro, auf dem vierten Grad nördlicher Breite, 2000 Fuss über dem Meere liegt und die Höhe auf[S. 85] dem vierten Grad südlicher Breite, wo halt gemacht wurde, nur etwas mehr als 2000 Fuss über dem Meeresspiegel liegt. Dass die beiden Flüsse, die sich 2000 Fuss über dem Meere befinden sollen und durch 8 Grad Breite voneinander getrennt sind, ein und derselbe Fluss sei, kann manchen Leuten als eine auffallende Behauptung erscheinen. Doch muss man mit blossen Ausdrücken der Verwunderung zurückhalten und in Betracht ziehen, dass dieser mächtige und breite Lualaba ein Seefluss von grösserer Breite als der Mississippi ist, dass sein Wasser zu Zeiten ausgedehnte Seen bildet, sich dann wieder in einen breiten Strom zusammenzieht und abermals einen See bildet u. s. w. bis zum vierten Breitengrade; und selbst jenseits dieses Punktes hat Livingstone von einem grossen nach Norden zu liegenden See gehört.
Wir müssen daher warten, bis die Höhe der beiden Flüsse, des Lualaba nämlich, wo Livingstone halt gemacht, und des südlichen Punktes auf dem Bahr Ghazal, wo Petherick gewesen ist, genau bekannt sind.
Nimmt man, um der Discussion willen, an, dass dieser namenlose See sechs Breitengrade einnimmt, da es derselbe sein kann, den der italienische Reisende Piaggia entdeckt hat, aus welchem der Petherick’sche Arm des Weissen Nils durch Binsenmoor in den Bahr Ghazal heraus und von dort, südlich von Gondokoro, in den Weissen Nil tritt, so könnte man die Flüsse für einen und denselben halten; denn wenn sich der See über soviel Breitengrade erstreckt, so wird die Schwierigkeit gehoben, dass man eine Verschiedenheit der Höhe zwischen zwei, 8 Grad auseinanderliegenden Punkten eines Flusses nothwendig annehmen muss.
Auch können Livingstone’s Beobachtungs- und Höhenmessungs-Instrumente falsch gewesen sein, und dies ist sehr wahrscheinlich, da sie fast sechs Jahre lang auf Reisen übel behandelt worden sind. Denn es gibt trotz der offenbaren Schwierigkeit, welche die Höhenlage zwischen beiden Punkten bereitet, noch einen andern triftigen Grund, um Webb’s Fluss oder den Lualaba für den Nil zu halten. Die Wasserscheide des Flusses nämlich, von der Livingstone 600 Meilen bereist hat, zieht sich durch ein Thal, das sich[S. 86] zwischen hohen östlichen und westlichen Gebirgszügen von Süden nach Norden erstreckt.
Dieses Thal oder Wassersystem nimmt nicht den Kassai oder Kwango auf, sondern Flüsse, die aus einer grossen Entfernung von Westen herfliessen, z. B. die bedeutenden Zuflüsse Lufira und Lomami, und grosse Flüsse aus dem Osten, wie den Lindi und Luamo; und während die intelligentesten portugiesischen Reisenden und Händler behaupten, dass der Kassai, Kwango und Lubilasch die Quellen des Congo sind, so hat noch niemand die Vermuthung aufgestellt, dass der grosse nach Norden fliessende Fluss, der den Eingeborenen als Lualaba bekannt ist, der Congo sei.
Dieser Fluss könnte aber doch der Congo oder vielleicht der Niger sein. Wenn der Lualaba nur 2000 Fuss und der Albert-Nyanza 2700 Fuss über dem Meere liegt, so kann der Lualaba nicht in diesen See fliessen. Und wenn der Bahr Ghazal sich nicht durch einen Arm acht Grad weit über Gondokoro hinzieht, dann kann der Lualaba nicht der Nil sein. Es ist aber voreilig, über diesen Gegenstand doctrinäre Ansichten auszusprechen. Denn Livingstone wird diesen Punkt selbst aufklären; und wenn er findet, dass es der Congo ist, so wird er der erste sein, der seinen Irrthum eingesteht.
Livingstone gibt zu, dass die Quellen des Nils noch nicht entdeckt sind, obgleich er den Lualaba durch sieben Breitengrade in seiner Richtung nach Norden verfolgte, und obschon er keinen Zweifel hat, dass dies der Nil ist, so kann man doch noch nicht behaupten, dass die Nilfrage ihre endgültige Lösung gefunden hat und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens hat er vom Vorhandensein von vier Quellen gehört, von denen zwei einem Fluss, der nach Norden fliesst, nämlich dem Webb’s Fluss oder Lualaba, und zwei einem andern, der nach Süden fliesst, nämlich dem Zambezi, als Ursprung dienen. Zu wiederholten malen hat er die Eingeborenen von diesen Quellen reden hören. Mehrmals ist er nur 100–200 Meilen von ihnen entfernt gewesen; doch immer kam etwas dazwischen, das ihn verhinderte sie selbst zu sehen. Nach dem Berichte derer, die sie gesehen haben, entstehen sie auf je einer Seite eines ebenen Walles, der[S. 87] keine Steine enthält. Einige haben ihn als einen Ameisenhügel bezeichnet. Eine dieser Quellen soll so gross sein, dass ein Mann, der auf der einen Seite steht, den gegenüberstehenden nicht sehen kann. Diese Quellen müssen entdeckt und ihre Lage genau bestimmt werden. Der Doctor nimmt an, dass sie nicht südlich von den Zuflüssen des Sees Bangweolo liegen. In seinem Briefe an den „Herald“ sagt er: „Diese vier ansehnlichen, wasserreichen Quellen, die so nahe beieinander entstehen und vier grossen Flüssen ihren Ursprung geben, entsprechen gewissermassen der Beschreibung Herodot’s, des Vaters aller Reisenden, die der Schreiber der Minerva in der Stadt Saïs in Aegypten von den unergründlichen Quellen des Nils gegeben hat.“
Für solche Leser, die das Original nicht zur Hand haben, füge ich hier die Uebersetzung[6] der Stelle aus Herodot bei:
Ueber die Quellen des Nils aber wollte keiner von denen, mit welchen ich darüber mich besprach, weder von den Aegyptiern, noch von den Libyern, noch von den Hellenen etwas sicheres wissen, ausser in Aegypten in der Stadt Saïs der Schreiber des heiligen Schatzes der Athene; dieser schien mir jedoch zu scherzen, wenn er behauptete, es genau zu wissen. Er sprach sich nämlich in folgender Weise darüber aus: es wären zwei Berge mit spitzauslaufenden Gipfeln, zwischen der Stadt Syene in der Thebais und zwischen Elephantine gelegen; der eine derselben hätte den Namen Krophi, der andere den Namen Mophi; mitten aus diesen Bergen strömten die Quellen des Nils in unergründlicher Tiefe; die eine Hälfte des Wassers fliesse in der Richtung nach Aegypten und gegen Norden zu, die andere aber nach Aethiopien hin und südwärts. Dass aber die Quellen unergründlich seien, das habe, so versicherte er, Psammetich, der König von Aegypten, zu versuchen unternommen; er habe nämlich ein Tau von vielen tausend Klaftern Länge flechten lassen und dasselbe dort hinabgelassen, ohne auf den Grund zu kommen. Ist dies nun wirklich der Fall gewesen, wie der Schreiber es erzählte, so liefert er nach meinem Ermessen damit den Beweis, dass dort gewaltige Wirbel und Gegenströmung sich befinden; weil nun das Wasser stets an den Bergen sich stösst, so konnte wol das hinabgeworfene Senkblei nicht auf den Grund kommen.
Von keinem andern konnte ich irgendetwas darüber erfahren, sondern nur soviel habe ich, soweit meine Forschung reichte, in Erfahrung[S. 88] gebracht, indem ich bis zur Stadt Elephantine selber als Augenzeuge gekommen bin, von da an aber nur vom Hörensagen berichten kann. Geht man von der Stadt Elephantine weiter aufwärts, so ist die Gegend steil; daher muss man hier an das Fahrzeug von beiden Seiten ein Tau anbinden, wie an einen Ochsen, und so die Reise machen; reisst es aber, so schiesst das Fahrzeug, von der Gewalt der Strömung getrieben, hinab; diese Gegend nimmt eine Fahrt von vier Tagen ein; der Nil hat hier viele Krümmungen, wie der Mäander; zwölf Schönen sind es, welche man auf diese Weise durchschiffen muss. Dann kommt man in eine ganz flache Gegend, in welcher der Nil um eine Insel herumfliesst, welche den Namen Tachompso führt; es bewohnen aber das Land von Elephantine aufwärts schon Aethiopier, sowie auch die Hälfte der Insel, die andere Hälfte bewohnen Aegyptier. An die Insel stösst ein grosser See, um welchen herum wandernde Aethiopier wohnen; hat man diesen See durchschifft, so kommt man in das Strombett des Nils, welcher in diesen See sich ergiesst; dann steigt man aus und nimmt den Weg längs des Flusses während vierzig Tagen; denn es ragen spitzige Felsen in dem Nil hervor und sind dort viele Klippen, durch welche die Schifffahrt unmöglich ist. Hat man nun dieses Land in den vierzig Tagen durchzogen, so besteigt man wieder ein anderes Fahrzeug und fährt auf demselben zwölf Tage lang; man gelangt sodann in eine grosse Stadt, welche den Namen Meroe führt. Diese Stadt wird für die Mutterstadt der übrigen Aethiopier ausgegeben; die darin Wohnenden verehren allein unter den Göttern den Zeus und Dionysos, und diese halten sie in grossen Ehren. Auch haben sie dort ein Orakel des Zeus: sie ziehen ins Feld, wenn der Gott durch einen Spruch es ihnen gebietet, und zwar dahin, wohin er gebietet.
Von dieser Stadt gelangt man zu den Automolen in der gleichen Zeit der Fahrt, in der man von Elephantine zu der Mutterstadt der Aethiopier gekommen ist. Diese Automolen (Ueberläufer) führen den Namen Asmah; es bedeutet aber dieses Wort nach der Sprache der Hellenen soviel als: die zur linken Hand dem Könige stehen. Es waren diese 24 Myriaden Aegyptier von der Kriegerkaste abgefallen zu den Aethiopiern aus folgender Ursache. Zur Zeit des Königs Psammetichus bestanden Wachen in der Stadt Elephantine nach der Seite Aethiopiens zu, und eine andere Wache in dem Pelusischen Daphnä nach der Seite Arabiens und Syriens und eine zu Marea nach Libyen zu. Noch zu meiner Zeit stehen an denselben Orten der Perser Wachen, wie sie zu Psammetichus’ Zeit standen; denn zu Elephantine wie zu Daphnä halten Perser Wache. Diese ägyptischen Krieger nun hielten drei Jahre lang Wache, ohne dass jemand sie ablöste; da beriethen sie sich miteinander, fassten dann den gemeinsamen Entschluss, von Psammetichus allesammt abzufallen, und zogen nach Aethiopien. Als Psammetich dies vernahm, verfolgte er sie, und als er sie eingeholt, bat er sie mit vielen Worten und forderte sie[S. 89] auf, doch nicht die vaterländischen Götter, sowie Weiber und Kinder im Stiche zu lassen. Da soll einer von ihnen auf seine Scham gezeigt und ausgerufen haben, wo nur diese sei, da würden sie schon Weiber und Kinder bekommen. Als sie nun nach Aethiopien gekommen waren, übergaben sie sich dem König der Aethiopier, der sie auf folgende Weise belohnte: er war gerade damals in Streit mit etlichen von den Aethiopiern gerathen, und nun forderte er sie auf, diese wegzujagen und ihr Land zu bewohnen. Nachdem sie auf diese Weise unter die Aethiopier eingebürgert worden waren, sind diese milder geworden, indem sie ägyptische Sitten angenommen.
Bis zu einer Reise von vier Monaten zu Wasser und Land kennt man demnach den Nil, abgesehen von seinem Lauf in Aegypten. Denn so viele Monate kommen heraus, wenn man zusammenrechnet, was verwendet wird auf die Reise von Elephantine bis zu diesen Automolen. Es fliesst aber der Nil von Abend und Sonnenuntergang her. Wie es von da an weiter geht, kann niemand mit Gewissheit angeben, denn es ist dieses Land eine Wüste infolge der Hitze.
Folgendes jedoch hörte ich von Männern aus Cyrene, welche vorgaben, zu dem Orakel des Ammon gekommen zu sein und ein Gespräch mit Etearchus, dem König der Ammonier, gehabt zu haben; da wären sie denn nach manchen andern Gesprächen auch über den Nil zu reden gekommen, wie niemand dessen Quellen kenne; und hätte Etearchus versichert, es seien einstens zu ihm Männer von dem Stamme der Nasamonen gekommen, welches ein Libysches Volk ist, das an der Syrte und dem ostwärts von der Syrte gelegenen Lande in keiner grossen Entfernung wohnt; diese Nasamonen seien zu ihm gekommen und hätten auf die Frage, ob sie etwas näheres von den Wüsten Libyens wüssten, erzählt, es hätten bei ihnen angesehene Männer recht ausgelassene Söhne gehabt, welche, als sie Männer geworden waren, auf manche unnütze Dinge verfielen, und so hätten sie denn auch fünf von ihnen durch das Loos erwählt, welche die Wüsten Libyens besichtigen und zusehen sollten, ob sie nicht etwas mehr zu sehen bekämen als die, welche die entlegensten Gegenden je besehen hätten. An dem Theil von Libyen nämlich, der am nördlichen Meer liegt, von Aegypten angefangen bis zum Vorgebirge Soloeis, wo Libyen endet, an dieser ganzen Küstenstrecke wohnen Libyer, und zwar viele Völker der Libyer, ausser dem, was Hellenen und Phöniker innehaben. Aber über dem Meer und der am Meere sich hinziehenden Bevölkerung, oberhalb derselben, ist Libyen voll von wilden Thieren, und oberhalb dieses Landstriches der wilden Thiere ist nur Sand und eine völlig wasserlose, an allem bare Wüste. Die Jünglinge nun, so erzählten sie, ausgesendet von ihren Kameraden und wohl versehen mit Wasser und Lebensmitteln, zogen zuerst durch das bewohnte Land und kamen, als sie dasselbe durchschritten, in das Land der wilden Thiere; aus diesem zogen sie dann durch die Wüste, indem sie ihren Weg in westlicher Richtung nahmen. Und[S. 90] als sie viel sandiges Land durchzogen hatten und in vielen Tagen erblickten sie mit einem mal wieder Bäume, welche in einer Ebene wuchsen; da traten sie herzu und pflückten von der auf den Bäumen befindlichen Frucht; als sie aber pflückten, kamen kleine Männer herbei, nicht einmal von mittlerer Grösse, packten sie und schleppten sie weg; es verstanden aber weder die Nasamonen deren Sprache, noch die, welche sie wegschleppten, die der Nasamonen. Sie führten sie dann durch grosse Sümpfe, und als sie durch dieselben waren, gelangten sie in eine Stadt, deren Bewohner alle an Grösse den frühern gleich waren und schwarz von Farbe; längs der Stadt floss ein grosser Strom von Abend nach Sonnenaufgang zu und waren Krokodile in demselben zu sehen.
Insoweit also wäre die Erzählung des Ammoniers Etearchus von mir angegeben; nun fügte er noch hinzu, es wären die Nasamonen zurückgekehrt, wie die Cyrenäer behaupten, und diejenigen, zu welchen sie gekommen, wären lauter Zauberer gewesen. In dem Flusse nun, welcher (an jener Stadt) vorbeifliesst, glaubte auch Etearchus den Nil zu erkennen, und erscheint dies auch ganz vernünftig. Denn der Nil kommt aus Libyen und zwar so, dass er dasselbe in der Mitte durchschneidet, und ist sein Lauf (wie ich vermuthe, indem ich aus dem, was offenkundig ist, auf das, was noch nicht erkannt ist, schliesse) in gleicher Richtung mit dem des Ister. Denn der Ister, der aus der Kelten Land und von der Stadt Pyrene kommt, nimmt seinen Lauf so, dass er Europa in der Mitte spaltet; die Kelten wohnen aber ausserhalb der Säulen des Hercules und sind die Nachbarn der Kynesier, welche unter allen Bewohnern Europas am äussersten Ende nach Sonnenuntergang zu wohnen. Es endet aber der Ister, nachdem er ganz Europa durchlaufen, in das Meer des Pontus Euxeinos, da, wo milesische Colonisten Istria bewohnen.
Es wird nun der Ister, weil er durch bewohntes Land fliesst, von vielen gekannt; über die Quellen des Nils aber kann niemand etwas angeben, denn das Libyen, durch welches er fliesst, ist unbewohnt und öde; was ich jedoch über seinen Lauf durch meine Erkundigung soweit als nur immer möglich erfahren konnte, ist hier angegeben; er kommt nämlich (aus Libyen heraus) nach Aegypten. Aegypten aber liegt so ziemlich gegenüber dem steinigen Cilicien; von da aber bis nach Sinope, das am Pontus Euxeinos liegt, ist ein gerader Weg von fünf Tagen für einen rüstigen Fussgänger. Sinope aber liegt gegenüber der Mündung des Ister ins Meer. Sonach glaube ich, dass der Nil durch ganz Libyen in gleicher Weise fliesst, wie der Ister (durch Europa). Soviel soll nun über den Nil gesagt sein.
Zweitens muss Webb’s Fluss bis an den Ort verfolgt werden, wo er sich mit irgendeinem Theile des alten Nils verbindet.
[S. 91]
Wenn dies beides geleistet worden ist, aber nicht früher, wird das Geheimniss des Nils aufgeklärt sein. Die beiden Länder, durch welche der merkwürdige seeartige Fluss Lualaba mit seinen zahlreichen Seen und weiten Wasserflächen fliesst, sind Rua (das Uruwwa Speke’s) und Manyuema. Zum ersten male erfährt Europa, dass zwischen dem Tanganika und den bekannten Quellen des Congo Millionen Neger leben, welche noch nichts von den weissen Völkern gesehen oder gehört haben, die ausserhalb Afrikas ein so reges Leben führen. Auf diejenigen unter ihnen, welche das Glück gehabt haben, das erste Exemplar dieser merkwürdigen weissen Rasse in der Person von Dr. Livingstone kennen zu lernen, scheint er einen sehr günstigen Eindruck gemacht zu haben, obgleich man aus Misverständniss über den Zweck seiner Reise und weil man ihn mit den Arabern in Verbindung gebracht hat, die dort furchtbar wüthen, seinem Leben mehr als einmal nachgetrachtet hat. Diese beiden ausgedehnten Länder Rua und Manyuema werden von wirklichen Heiden bevölkert und nicht, wie die Reiche Karagweh, Urundi und Uganda, von despotischen Königen beherrscht, sondern es hat ein jedes Dorf daselbst seinen eigenen Sultan oder Herrn. Dreissig Meilen ausserhalb ihres eigenen unmittelbaren Bereiches scheinen die Intelligentesten dieser kleinen Häuptlinge von nichts mehr zu wissen. Dreissig Meilen vom Lualaba entfernt gab es nur wenig Leute, die jemals von dem grossen Fluss etwas gehört hatten. Unwissenheit der Eingeborenen über ihr eigenes Vaterland vermehrte natürlich die Mühen Livingstone’s. Mit ihnen verglichen sind alle die Stämme und Völkerschaften, mit denen Livingstone sonst in Afrika in Berührung kam, als civilisirt zu betrachten; dennoch sind diese wilden Völker von Manyuema in den Künsten heimischer Industrie allen andern, die er gesehen, bedeutend überlegen. Wo andere Stämme und Völkerschaften sich daran genügen lassen, nachlässig über die Schultern geworfene Thierfelle als Kleidung zu benutzen, fabricirt das Volk von Manyuema aus feinem Grase bereitetes Zeug, das sich vortheilhaft mit dem feinsten Grastuch Indiens vergleichen lässt. Auch verstehen sie die Kunst, dieselben in verschiedenen Farben, schwarz, gelb[S. 92] und purpurroth, zu färben. Den Wangwana oder Freigelassenen von Zanzibar fiel die Schönheit dieses Artikels so auf, dass sie ihre Baumwollenzeuge gern gegen feines Grastuch umtauschten, und ich habe fast an jedem Schwarzen, der aus Manyuema kommt, dieses einheimische Tuch in elegant gemachte Damirs (arabisch, kurze Jacken) umgewandelt gesehen. Diese Länder sind auch sehr reich an Elfenbein. Das Fieber, nach Manyuema zu gehen, um bunte Perlen für seine köstlichen Elfenbeinzähne einzutauschen, ist ebenso gross wie dasjenige, welches die Menschen antrieb, sich in die Schluchten und Goldgruben von Californien, Colorado, Montana und Idaho zu begeben, oder nach Australien und in die Cap-Colonie zu ziehen, um Goldklumpen oder Diamanten zu suchen. Manyuema ist jetzt das Eldorado der Araber und der Wamrima-Stämme. Es ist nur etwa vier Jahre her, dass der erste Araber von Manyuema mit einem solchen Reichthum an Elfenbein und Berichten über die fabelhaften Massen, die sich dort vorfinden, zurückkehrte, dass seitdem die altgewohnten Wege nach Karagweh, Uganda, Ufipa und Marungu relativ verlassen worden sind. Die Einwohner von Manyuema haben in ihrer Unkenntniss des Werthes dieses kostbaren Artikels ihre Hütten auf Elfenbeinstützen erbaut. In Manyuema waren Elfenbeinsäulen ein ganz gewöhnlicher Anblick, und wenn man hiervon hört, kann man sich nicht länger über den Elfenbeinpalast Salomon’s verwundern. Generationen hindurch haben sie Elfenbeinzähne als Thürpfosten und Stützen für die Dachtraufen benutzt, bis sie vollständig verrottet und werthlos geworden waren. Die Ankunft der Araber hat sie aber bald über den Werth dieses Artikels belehrt, er ist jetzt bedeutend im Preise gestiegen, obwol er noch fabelhaft billig ist. In Zanzibar kostet das Frasileh (35 Pfd.) Elfenbein 50–60 Dollars, je nach seiner Qualität. In Unyanyembé kostet das Pfund ungefähr 1 Dollar 10 Cents; in Manyuema hingegen kann man das Pfund für Kupfer im Werthe von ½ bis 1¼ Cent kaufen. Die Araber verstehen jedoch die Kunst, die Märkte durch ihre Habgier und Grausamkeit zu ruiniren. Mit Musketen bewaffnet ist eine kleine Abtheilung Araber gegen das Volk von Manyuema unbesiegbar, welches bis vor[S. 93] kurzem noch niemals eine Flinte hat knallen hören. Das Entladen einer solchen Flinte flösst ihnen einen tödlichen Schrecken ein und es ist fast unmöglich, sie dazu zu bewegen, es gegen eine Flinte aufzunehmen. Sie glauben, die Araber hätten den Blitz gestohlen und dass gegen solche Leute Bogen und Pfeile nur wenig ausrichten können. Es fehlt ihnen keineswegs an Muth und sie haben oft erklärt, dass, wenn die Gewehre nicht wären, kein Araber das Land lebendig verlassen solle. Dies beweist, dass sie sich sehr gern in den Kampf mit den verhassten Fremdlingen einlassen würden, wenn das Knallen der Flinten ihnen nicht Schrecken einflösste.
In jedem Lande, das der Araber betritt, bringt er es bald dahin, dass sein Name und seine Rasse verhasst wird. Die Hauptursache hiervon ist aber nicht die Naturfarbe oder der Name des Arabers, sondern einfach der Sklavenhandel. Solange man den Sklavenhandel in Zanzibar bestehen lässt, wird dies im übrigen unternehmende Volk der Araber den Hass der Eingeborenen ganz Afrikas auf sich ziehen.
Auf der Hauptreiseroute von Zanzibar ins Innere von Afrika sind diese grausamen Handlungen aus dem einfachen Grunde unbekannt, weil die Eingeborenen mit Flinten bewaffnet sind, mit ihnen umzugehen verstehen und keineswegs zögern, bei günstiger Gelegenheit von denselben Gebrauch zumachen. Die Araber haben es zu spät eingesehen, welche Thorheit es war, den Eingeborenen Gewehre zu verkaufen, und schwören jetzt demjenigen, der in Zukunft das noch thun will, Rache. Sie haben aber diesen Fehler begangen und es ist sonderbar, dass sie das Thörichte desselben nicht schon damals eingesehen haben. In frühern Zeiten konnte der Araber unter dem Schutze seiner mit Flinten bewaffneten Sklavenescorte durch Useguhha, Urori, Ukonongo, Ufipa, Karagweh, Unyoro und Uganda mit einem blossen Stock in der Hand reisen; jetzt jedoch ist das weder für ihn noch für sonst jemand möglich. Ein jeder Schritt, den er thut, ob bewaffnet oder unbewaffnet, ist gefahrvoll. Die Waseguhha halten ihn in der Nähe der Küste auf und verlangen Tribut, wenn er nicht mit ihnen kämpfen will. In Ugogo[S. 94] ist er täglich denselben drückenden Forderungen oder derselben Alternative ausgesetzt. Auch die Wanyamwezi zeigen sich bereit, ihn in der gleichen Weise zu übervortheilen. Der Weg nach Karagweh ist voll von Beschwerden; da steht ihnen der schreckliche Mirambo im Wege, der ihre verbündeten Truppen mit Leichtigkeit besiegt und sogar Ausfälle bis an die Thüren ihrer Häuser in Unyanyembé macht. Glückt es ihnen aber, an Mirambo vorbeizukommen, so steht Swaruru vor ihnen, ein Häuptling, welcher den Tribut ballenweise verlangt und gegen den zu kämpfen vergeblich ist. Diese Bemerkungen beziehen sich auf den Sklavenhandel, der jetzt von den Arabern in Manyuema eingeführt wird. Da sie auf dem Wege zwischen Zanzibar und Unyanyembé durch die bedrohliche Haltung der Eingeborenen, welche die geringste Beleidigung mit Blut zu rächen bereit sind, belästigt werden, haben die Araber mit dem Menschenraube zwischen dem Tanganika und dem Meere aufgehört. In Manyuema dagegen, wo die Eingeborenen furchtsam, unentschlossen und in kleine Stämme zersplittert sind, treten sie wieder kühn auf und lassen ihren Neigungen zu jenem schändlichen Handel freien Lauf. Die Berichte, welche Livingstone aus jenen Gegenden mitbringt, sind höchst beklagenswerth. Er war z. B. der unfreiwillige Zuschauer bei einer furchtbaren That — einer an den Bewohnern eines volkreichen Bezirks verübten Metzelei, die sich auf dem Marktplatz, an den Ufern des Lualaba, zutrug, wo sich jene nach uralter Sitte versammelt hatten. Wie es scheint, lieben die Wamanyuema sehr, auf dem Markte Handel zu treiben, und halten dies für den höchsten irdischen Genuss. Sie können gar nicht genug an dem Vergnügen bekommen, mit grossem Kraftaufwande wegen der unbedeutendsten Summe, der kleinsten Perle zu feilschen, und wenn sie ihr jeweiliges Ziel erreicht haben, so sind sie sehr glücklich. Auch die Frauen lieben das Handeln ungemein und da sie sehr schön sind, so muss der Marktplatz bedeutende Anziehung auf das männliche Geschlecht ausüben. An einem solchen Markttage fing nun Tagamoyo, ein arabischer Mischling, mit seiner bewaffneten Sklavenbegleitung eine allgemeine Metzelei damit an, dass er massenhaft in die dichte[S. 95] Menschenmenge schiessen liess. Man nimmt an, dass ungefähr 2000 Menschen anwesend waren und beim ersten Flintenknall stürzten alle diese armen Leute nach ihren Nachen. In der furchtbaren Eile der Flucht wurden die Boote von den ersten wenigen Leuten, die sie glücklich in Besitz nahmen, fortgerudert. Wer nicht so davonkam, sprang in das tiefe Wasser des Lualaba; hier wurden viele eine Beute der zahlreichen, auf den Schauplatz stürzenden gefrässigen Krokodile; der grösste Theil jedoch erlag den Kugeln des unbarmherzigen Tagamoyo und seiner schurkischen Bande. Livingstone glaubt, wie auch die Araber selbst, dass hierbei ungefähr 400 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, getödtet und noch viel mehr zu Sklaven gemacht worden sind. Das ist aber nur einer der vielen Frevel, von denen er unfreiwillig Zeuge gewesen, und er ist ganz ausser Stande, die Entrüstung zu beschreiben, welche er gegen die unmenschlichen Verbrecher empfindet. Die Sklaven von Manyuema werden nämlich wegen ihrer schönen Gestalt und grossen Gelehrigkeit besser bezahlt als die aus irgendeinem andern Lande. Die Frauen sind, wie mir Livingstone wiederholt gesagt hat, ganz besonders hübsch und haben, mit Ausnahme des Haares, nichts mit den Negern der Westküste gemein. Sie sind von sehr heller Farbe, haben schöne Nasen, wohlgeformte, nicht zu volle Lippen und nur selten den vorstehenden Unterkiefer. Diese Weiber werden von den Mischlingen der Ostküste eifrig zu Frauen gesucht und selbst die echten Omani-Araber verschmähen es nicht sie zu heirathen. Im Norden von Manyuema kam Livingstone auf eine helle Rasse, ungefähr von der Farbe der Portugiesen oder unserer amerikanischen Mischlinge, der Quadronen in Louisiana, die sehr schön ist und sich besonders durch Scharfsinn und Klugheit im Handel auszeichnet. Die Weiber derselben tauchen sehr gewandt nach Austern, die sich in grosser Zahl im Lualaba finden.
Rua ist an einem Orte, der Katanga heisst, reich an Kupfer. Seit Urzeiten sind die Kupferminen dieses Ortes im Betriebe. In einem Flussbett hat man Gold gefunden, das in Stücken von der Gestalt von Stiften oder von der[S. 96] Grösse von Erbsen gefunden wird. Zwei Araber sind aus Speculation auf dieses Metall hingegangen, da sie aber mit der Kunst der Goldwäscherei unbekannt sind, so ist es kaum möglich, dass sie dabei Glück haben werden. An der Verfolgung dieser hochwichtigen und interessanten Entdeckungen wurde Livingstone, als er sich fast an der Schwelle des Erfolgs befand, dadurch verhindert, dass seine Leute sich direct weigerten, ihn weiter zu begleiten. Sie fürchteten sich, ohne bedeutende Bedeckung weiter zu ziehen, und da man in Manyuema keine Begleiter bekommen konnte, so kehrte Livingstone sehr wider seinen Willen nach Udschidschi zurück.
Sein Rückweg war lang und beschwerlich. Die Reise selbst hatte jetzt kein Interesse für ihn; denn er war denselben Weg nach Westen gezogen voll grosser Hoffnungen und Bestrebungen, ungeduldig, das Ziel zu erreichen, das ihm Ruhe von seinen Mühen versprach. Jetzt kehrte er ohne Erfolg, mit vereitelten Hoffnungen, fast angesichts seines Zielpunktes wieder um; da war es kein Wunder, dass sein alter, tapferer Muth, seine starke Constitution der Enttäuschung und Entmuthigung fast erlag.
Livingstone kam am 16. October in Udschidschi fast sterbend an. Unterwegs hatte er versucht, da es unmöglich war, gegen die Hartnäckigkeit seiner Leute anzukämpfen, sich mit dem Gedanken zu trösten, es werde nicht viel Zeit, höchstens noch fünf bis sechs Monate, dazu gehören, und darauf käme es nicht an, da es sich doch nicht vermeiden liesse. In Udschidschi habe er ja seine Waaren und von dort könne er ja mit neuen Leuten wieder ausziehen. Durch solche Hoffnungen versuchte er es sich einzureden, dass alles wieder in Ordnung kommen werde; man kann sich also den Schrecken vorstellen, als es sich herausstellte, dass der Mann, dem seine Güter in Verwahrung gegeben waren, sie sämmtlich gegen Elfenbein verkauft hatte.
Am Abend des Tages, als Livingstone nach Udschidschi zurückkehrte, sah er seine beiden treuen Diener Susi und Dschumah bitterlich weinen. Er fragte sie, was ihnen fehle, und erfuhr darauf zum ersten male die üble Botschaft, die seiner wartete. Denn sie sprachen:
[S. 97]
„All unser Eigenthum ist verkauft, Herr! Scherif hat alles für Elfenbein losgeschlagen.“
Später am Abend kam Scherif selbst zu ihm und bot ihm unverschämterweise die Hand, die Livingstone jedoch mit den Worten zurückstiess, er könne einem Diebe nicht die Hand reichen. Zu seiner Entschuldigung führte Scherif an, er habe aus dem Koran gewahrsagt und daraus erfahren, der Hakim (arabisch für Doctor) sei todt.
Jetzt war Livingstone von allem entblösst und hatte gerade genug, um sich und seine Leute ungefähr einen Monat zu unterhalten; dann wäre er genöthigt gewesen die Araber anzubetteln.
Livingstone sprach sich mir gegenüber dahin aus, dass Speke, wenn er die Höhe des Tanganika zu nur 1800 Fuss über dem Meeresspiegel angibt, in diesen Fehler durch einen blossen lapsus calami, etwa durch zu häufiges Schreiben der Jahreszahl unserer Zeitrechnung verfallen sein müsse; denn die Höhe sei nach seinen Berechnungen 2800 Fuss, wie er sie durch Bestimmung des Siedepunkts festgestellt, und nach dem Barometer sogar etwas über 3000 Fuss.
Vielfach beklagte sich Livingstone darüber, dass ihm Sklaven als Hüter seiner Waaren geschickt worden, nachdem er so häufig die Leute in Zanzibar gebeten, ihm Freigelassene zu senden. Mit geringer Mühe hätten die Leute, welche ihm Vorräthe zuzuschicken hatten, sich gute, treue Freigelassene verschaffen können; wenn sie es aber dabei bewenden liessen, sich nach Empfang eines Briefes von Dr. Livingstone wegen der Boten an Ludha Damdschi zu wenden, so ist es kein Wunder, dass unehrliche, unfähige Sklaven abgesandt wurden. Die Entdeckung Livingstone’s, dass ein freier Neger hundertmal fähiger und vertrauenswürdiger als ein Sklave sei, ist nicht neu. Schon vor Jahrtausenden sprach der Hirt Eumacus zu Ulysses: „Zeus hat gesagt: Der Tag, der Dich entehrt zum Sklaven, raubt Dir auch den halben Werth.“
Dr. Livingstone behauptet, er habe wiederholt den Dr. Kirk aufs dringendste ersucht, ihm keine Sklaven zu schicken. Niemand wusste besser, wie wenig Verlass auf sie sei, und man kann sich vorstellen, wie hoffnungslos ihm seine Aufgabe[S. 98] erscheinen musste, als er immer wieder von diesen unfähigen Menschen getäuscht-wurde. Es wird daher stets den Freunden beider Herren leidthun müssen, dass Dr. Livingstone’s hierauf gerichtete Bitten nicht mehr berücksichtigt worden sind.
Es gibt noch einen Punkt, über den ich einige Bemerkungen zu machen wünsche, das Verfahren nämlich, das die Gelehrten mit Livingstone’s Depeschen vorgenommen haben. Wenn ein Reisender in Central-Afrika etwas entdeckt, sei es nun ein See oder Berg, eine Ebene oder ein Fluss, und Schlüsse in Bezug auf seine Entdeckungen zieht, so sollten seine Gründe vor allen andern von grösstem Gewicht sein. Bisweilen hat er deren viele, zu viele wenigstens, um sie in einer Depesche mitzutheilen, und ist daher genöthigt, aus Mangel an Raum sie zurückzuhalten, bis er sie selbst in einem Buch veröffentlichen kann. In einem solchen Falle muss es jedermann einleuchten, dass stubenhockende Geographen beim Mangel genauer Daten nicht die Depeschen oder den ursprünglichen Entdecker und Erforscher zu corrigiren haben, und Ansichten, welche in der Absicht ausgesprochen werden, um die Thatsachen zu entkräften, sollten von keinem Leser eine grosse Bedeutung beigemessen werden. Nun hat Livingstone mit der Geographischen Gesellschaft als Körperschaft nicht correspondirt, wol aber seinem Freunde Sir Roderick Murchison geschrieben, und dieser hatte als Präsident der Gesellschaft das Recht, wie Livingstone es auch erwartete, den Inhalt dieser ziemlich langen Briefe der erhabenen wissenschaftlichen Körperschaft, deren Haupt er war, vorzulegen. Wie Livingstone mir selbst gesagt und andern Freunden geschrieben hat, ist der Grund, warum er es sich versagt hat, Einzelheiten mitzutheilen, seine Furcht, dass seine Depeschen willkürlichen Verbesserungen, etwaigen Lieblingstheorien zu Gefallen, ausgesetzt sein könnten, da viele der Kritiker die Thatsache vergessen, dass er das, was er erzählt, nur nach anstrengender Forschung kennen gelernt hat.
Es ist wirklich eine beklagenswerthe Thatsache, dass Entdecker die Wahrheiten, die sie für unzweifelhaft halten, nicht bekannt machen können ohne dass man annimmt, sie[S. 99] gehörten einer parteiischen Clique an, welche die Lieblingstheorien gewisser Geographen zu Hause umstürzen will, oder sie beschuldigt, „wohlbekannte Thatsachen entstellt zu haben“. Wenn der „gelehrte Herr Cooley“ nach dem Hörensagen eines Arabers die Umrisse eines grossen Sees zeichnet, welcher ganz Central-Afrika einnimmt und die verschiedenen Seen Nyassa, Tanganika und Nyanza in sich schliesst, warum sollte er nicht sofort seinen Irrthum eingestehen, wenn Livingstone, Burton, Speke, Grant, Wakefield, New, Roscher, von der Decken und Baker beweisen, dass es mehrere Seen gibt, die weit auseinanderliegen und verschiedene Namen führen. Es macht doch nur sehr wenig mehr Mühe, sechs Seen zu zeichnen, als einen einzigen grossen. Und das Zeugniss einer solchen Menge Reisender sollte doch gewiss grössere Bedeutung haben, als das eines Arabers. Trotzdem beschuldigt mich Herr Cooley der Verstocktheit oder des Misverständnisses, wenn ich behaupte, der See Tanganika sei ein Wasserkörper für sich, und er ist auch auf Kapitän Burton böse geworden, seitdem dieser den See entdeckt hat. Bei aller seiner Gelehrsamkeit in geographischen Dingen fehlt ihm doch der moralische Muth, einen Irrthum einzugestehen. Herr Cooley ist aber nur der Typus einer kleinen Anzahl Geographen. Die Cooley’sche Methode ist trotz grosser Bildung, Erfahrung und Begabung offenbar ansteckend; denn Herr F. Galton hat mit grosser, aber doch etwas spöttischer Urbanität meine Vertheidigung des Forschers „eine Sensationsgeschichte“ genannt, und Dr. Beke hat mit der ganzen Hartnäckigkeit eines Mannes, der ein Steckenpferd reitet, aufs entschiedenste erklärt, dass Livingstone die Quellen des Nils nicht entdeckt habe. Diese nachdrückliche Erklärung einer rasch gebildeten Meinung kann doch nichts als eine beklagenswerthe Voreingenommenheit seitens des Dr. Beke sein. Keiner der drei Herren, deren Namen ich hier angeführt habe, verdient mehr Glauben, als der grosse Forscher, der seine Bemerkungen über diesen Punkt auf dem 4.° südl. Breite und dem 25.° östl. Länge in Central-Afrika niedergeschrieben hat.
Dr. Livingstone verabscheut nun diese Cooley’sche Methode, welche Hartnäckigkeit, Intoleranz und Engherzigkeit[S. 100] bedeutet, und bemerkt, er werde seine Notizen für sich behalten, und darin hat er nach meiner unmassgeblichen Ansicht sehr recht. Die Geographische Gesellschaft ist gegründet worden, um die Kenntniss der wahren Geographie aller Länder möglichst zu fordern. Wenn die Gesellschaft von dieser Cooley’schen Methode durchsäuert würde und sich hartnäckig gegen die Offenbarungen von Forschern sperrte, wie könnte sie jemals den Zweck, für den sie gegründet ist, erreichen? Würde ein solches Verhalten die Forscher ermuthigen? Wenn die Mitglieder der Gesellschaft sich von kleinen Eifersüchteleien, Lieblings Vorstellungen, rohen, unmöglichen Theorien beherrschen lassen, würden dann wol Leute ausziehen und tausende von Dollars für die Aufklärung der Welt in Bezug auf das geheimnissvolle Innere Afrikas ausgeben?
Ich habe keine eigenen Ansichten über irgendetwas, das ich nicht selbst gesehen, ausgesprochen, da ich nicht danach geize, mehr verunglimpft zu werden, als es schon geschehen ist. Unglücklicherweise befinde ich mich im Bann der Ungnade einiger Geographen, weil ich unbewusst das ausgeführt habe, was, wie sie wünschten, von einem der Ihrigen geleistet werden sollte.
Ich habe geglaubt — und in der That theilte die ganze Welt meine Ueberzeugung —, dass sie um ihren grossen Genossen aufrichtig besorgt und begierig wären, wie sie sagten, zu wissen, ob David Livingstone noch am Leben sei. Die Amerikaner theilten diese Sorge und ein amerikanischer Zeitungsbesitzer unternahm es plötzlich, jemand nach Central-Afrika auszuschicken, um Livingstone aufzusuchen und zu unterstützen. Dieser Mensch hatte zufälligerweise Erfolg, kehrte in die civilisirte Welt zurück und erklärte, dass Livingstone, der grosse Forscher, noch am Leben sei. Sofort wurde diese Nachricht mit Hohn aufgenommen! Der Präsident der Königl. Geographischen Gesellschaft erklärte sie für Unsinn; der Vicepräsident für eine Sensationsnachricht; die Cooleyiten für Verstocktheit und Misverständniss, und ein Beke behauptete sogar, die Theorie Dr. Livingstone’s sei unmöglich. Fast ganz England und ein grosser Theil von Amerika wurde hierdurch[S. 101] gänzlich verwirrt; allmählich jedoch kamen Beweise für die grosse Thatsache zum Vorschein, dass Livingstone nicht nur am Leben sei, sondern auch jeden Buchstaben, der angeblich von ihm herrühre, ohne irgendwelche Abänderung oder Interpellation von einer andern Hand selbst geschrieben habe. Dann kamen Angriffe auf den Charakter des unglücklichen Zeitungscorrespondenten. Ein Individuum nannte ihn einen „Charlatan und Lügner“; ein anderer meinte, er sei durchaus nicht, was er zu sein vorgebe; während noch andere meinten, der vielgeschmähte Journalist habe die Depeschen von einem Boten gestohlen, und ähnliches gemeines, ungerechtes Zeug.
Man erlaube dem einfachen Zeitungscorrespondenten an alle Geographen, Redacteure, Kritiker und professionsmässige Verleumder die Frage zu richten, was wol in aller Welt aus Dr. Livingstone, dem berühmten Forscher, geworden wäre, wenn sie ihre Debatten, Theorien und Discussionen, ihre Zänkereien und Speculationen fortgesetzt hätten und niemand ihm Trost, Gesundheit und Hülfe gebracht hätte?
Dr. Livingstone hat es wol nicht geglaubt, dass sein schlichter Freund durch solche Angriffe belohnt werden würde und dass man die schwachen Anstrengungen, denen ich mich, immer nur das eine Ziel im Auge und ohne an die Möglichkeit von Neidern und Böswilligen zu denken, unterzogen, so aufnehmen würde. In meiner Unschuld meinte ich, ich brauche blos meine Geschichte ehrlich und wahr zu erzählen und sie werde sofort ohne alle Kriteleien und Zweifel aufgenommen werden. Daher ist es wol natürlich, dass ich mich gekränkt fühle durch Angriffe auf meine Ehre und Wahrhaftigkeit an Stellen, wo ich sie am wenigsten vermuthet und am meisten auf einen andern Empfang gehofft hatte.
Dr. Livingstone hatte grosse Zweifel darüber, ob es sich passe, an die Königl. Geographische Gesellschaft Depeschen zu schicken, ohne eine Garantie dafür zu haben, dass die Mittheilungen nicht pecuniär ausgebeutet würden. Zur Privatbelehrung der Mitglieder war er sehr gern bereit, seine Kenntnisse mitzutheilen; er wünschte aber nicht, dass seine Entdeckungen einem jeden Mitglied beliebig zur Verfügung[S. 102] gestellt würden, das Lust hätte, sich auf seine Kosten zu bereichern. Auch beklagte er sich darüber, dass ein gewisses Mitglied der Geographischen Gesellschaft gewissenloserweise eine rohe Kartenskizze benutzt habe, die er der Gesellschaft geschickt hatte, um seinen Weg zu erläutern. Als Livingstone nun bei seiner Heimkehr den Wunsch ausgesprochen, es möge eine genaue, nach den vom Observatorium des Cap der Guten Hoffnung verbesserten und beglaubigten Beobachtungen berichtigte Karte angefertigt werden, habe dieses Mitglied ihm entgegnet, er habe fünf bis sechs Monate an der vorliegenden Karte gearbeitet und könne nicht daran denken, eine neue zu zeichnen, wenn er nicht etwa 200 £ für seine Mühe bekäme. Ueber derartige Thatsachen beschwert sich Dr. Livingstone. Vor der Königl. Geographischen Gesellschaft als Körperschaft hat er die höchste Achtung und denkt mit Stolz an seine Beziehungen zu derselben. Nur über einige wenige Mitglieder beklagt er sich, von denen er glaubt, sie hätten seine Depeschen in ihrer Gelehrsamkeit verunstaltet, wären als doctrinäre Theoretiker gegen ihn vorgegangen und hätten seine Karten abgeändert, um ihren eigenen krankhaften Vorstellungen und Phantasien in Cooley’s Manier Genüge zu leisten. Obgleich es nun nur wenige derartige Mitglieder gibt, so ist ihr Einfluss doch zu gross, als dass man an ihnen ohne eine Bemerkung vorübergehen könnte.
Wir verlebten mehrere glückliche Tage in Udschidschi und es wurde nun Zeit, unsere Fahrt auf dem Tanganika vorzubereiten. Livingstone erholte sich bei der neuen Kost, mit der ihn mein Koch versah, von Tag zu Tag. Zwar konnte ich ihm keine Mahle bereiten, wie sie Jupiter und Merkur in der Hütte von Baucis und Philemon erhielten; denn wir hatten keine Beeren der keuschen Minerva, eingemachte Kirschen, Endivien, Radieschen, getrocknete Feigen, Datteln, duftige Aepfel und Weintrauben, aber wir hatten Käse und Butter, die ich selbst bereitete, frische Eier, Hühner, Hammelbraten, Fische aus dem See, herrliche saure Milch, Sahne, Palmwein, Eierpflanzen, Gurken, süsse Kartoffeln, Erbsennüsse und Bohnen, weissen Honig aus Ukaranga,[S. 103] saftige, süsse Singwe — eine pflaumenartige Frucht aus den Wäldern von Udschidschi — und Maiskuchen statt des Weizenbrotes.
Während der Mittagshitze sassen wir unter unserer Veranda und unterhielten uns über verschiedene Projecte, und am frühen Morgen und Abend suchten wir die Ufer des Sees auf und spazierten daselbst, um die kühlen Lüfte einzuathmen, welche die Oberfläche des Wassers in Bewegung setzten und die unruhige Brandung weit auf den glatten, weissen Sand hinaufrollten.
Es war die trockene Jahreszeit und wir hatten herrliches Wetter; die Temperatur betrug nie mehr als 21° R. im Schatten.
Der Marktplatz, der die breite, silberne Wasserfläche überblickte, bot uns Belehrung und Unterhaltung. Täglich waren hier Vertreter von fast allen Stämmen, die in der Nähe des Sees wohnen, zu sehen. Da gab es die ackerbauenden, heerdenzüchtenden Wadschidschi mit ihren Heerden; dort die Fischer von Ukaranga und Kaole, aus der Gegend jenseits Bangwé und selbst von Urundi, mit ihren Breitlingen, die sie Dogara nennen, mit Welsen, Barschen und andern Fischen; oder die Palmölhändler, hauptsächlich aus Udschidschi und Urundi, mit grossen, fünf Gallonen enthaltenden Töpfen voll röthlichen Oels, das so fest wie Butter ist. Hier standen die Salzhändler aus den Salzebenen von Uvinza und Uhha; dort die Elfenbeinhändler aus Uvira und Usowa; die Bootmacher aus Ugoma und Urundi; die Trödler mit billigen Waaren aus Zanzibar, die dünne, gedruckte Zeuge verkaufen, sowie Wechsler, die blaue Mutunda-Perlen gegen Sami-Sami und Sungomazzi oder Sofi umtauschen. Die Sofiperlen sehen wie kleine Stückchen dickes, etwa halbzölliges Thonpfeifenrohr aus und sind hier sehr gesucht. Hier fand man Waguhha, Wamanyuema, Wagoma, Wavira, Wasige, Warundi, Wadschidschi, Waha, Wavinza, Wasowa, Wangwana, Wakawendi, Araber und Waswahili in lärmendem Handel und Feilschen beschäftigt. Mit unbedecktem Haupt und fast unbekleidet tändelten die Jünglinge mit schwarzhäutigen, wollköpfigen Phylissen, die nicht wie ihre weissen[S. 104] Schwestern vor dem glühenden Blick der Liebe zu erröthen wissen. Alte Weiber klatschten, wie sie es überall thun; Kinder spielten und lachten und balgten sich, ebenso wie die Kinder bei uns zu Lande, und auf ihre Speere oder Bogen gestützte Greise waren gerade ebenso schwatzhaft auf dem Marktplatz von Udschidschi, wie die alten Leute anderer Himmelsstriche.
[4] Alle Kritiken, die ich über Livingstone’s Entdeckungen gelesen habe, sind zu sehr von dem odium geographicum gefärbt, als dass man ihnen das Gewicht beilegen könnte, das den ruhigen, kühlen Aussprüchen einer gesunden, logischen Ansicht erfahrener Reisenden und Männern der Wissenschaft zukommt.
[5] [Durch die spätere Reise Stanley’s ist es klargestellt, dass diese Annahme Livingstone’s nicht zutreffend und dass der Lualaba in Wirklichkeit doch der Congo ist. In Erinnerung an den grossen Reisenden führt dieser grosse Strom jetzt den Namen „Livingstone-Fluss“.]
[6] Herodot, übersetzt von J. Chr. F. Baehr, S. 41–48.
[S. 105]
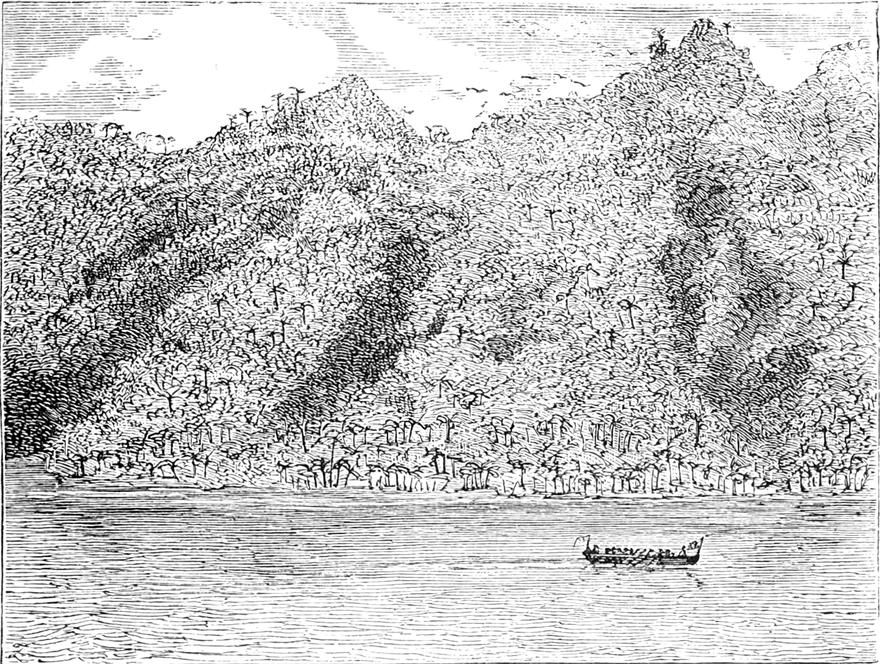
Unser Fahrzeug ein schwanker Nachen. — Sehr grosser hundeähnlicher Affe. — Die Fischer des Tanganika. — Fluss und Dorf Zassi. — Sondirungen des Sees. — Die Insel Nyabigma. — Störung beim Abendessen. — Feindseligkeit der Eingeborenen. — Krieg zwischen Mukamba und Warumaschanya. — Ein Mgwana behauptet, der Rusizi fliesse aus dem See. — Ich werde vom Fieber aufs Lager geworfen und vom Doctor gepflegt. — Mukamba widerspricht dem Bericht des Mgwana. — Massen von Krokodilen. — Ruhinga’s Kunde. — Das Ende des Sees und die Mündung des Rusizi. — Die Frage, ob der Rusizi in den See oder aus demselben fliesst, ist auf immer gelöst. — Der Doctor glaubt noch immer an einen Abfluss des Sees. — Burton’s und Speke’s weitester Punkt. — Zeichen von Unruhe in Mruta’s Dorfe. — Die New York-Herald-Inseln. — Cap Luvumba. — Ein Gefecht in Vorbereitung. — Der Sultan wird beruhigt. — Eine tragikomische Scene. — Rückkehr nach Udschidschi.
[S. 106]
„Ich leugne es aufs bestimmteste, dass ich mich durch irgendwelche Instruction der Königl. Geographischen Gesellschaft in Bezug auf die Lage des Weissen Nils habe verleiten lassen, die grosse Bedeutung der Richtung des Rusizi-Flusses ausser Acht zu lassen. Es ist eine Thatsache, dass wir unser Bestes thaten, ihn zu erreichen, dass es uns aber nicht gelang.“
BURTON’S Zanzibar.
„Das einstimmige Zeugniss der Eingeborenen, dass der Rusizi-Fluss ein Zufluss sei, ist der zwingendste Beweis dafür, dass er aus dem See herausfliesst.“
SPEKE.
„Ich beanspruche daher für den See Tanganika solange die Ehre, das südlichste Reservoir des Nils zu sein, bis ein positiverer, auf factische Beobachtungen gestützter Beweis es anders bestimmen wird.“
FINDLAY.
Hätten Livingstone und ich, nachdem wir uns entschlossen, das nördliche Ende des Sees Tanganika zu besuchen, uns durch die abgeschmackten Forderungen und Befürchtungen einer Schar Wadschidschi zwingen lassen, nach Unyanyembé zurückzukehren, ohne das Problem des Rusizi-Flusses gelöst zu haben, so hätten wir es gewiss verdient, in der Heimat mit allgemeinem Hohngelächter aufgenommen zu werden. Burton’s Miserfolge jedoch, der die Frage nicht erledigt hat, weil er Wadschidschi in seine Dienste genommen, und das damalige lächerliche Verhalten des wilden Häuptlings Kannena, dienten uns zur Warnung, von solchen Leuten für die Lösung eines geographischen Problems eine Unterstützung zu erwarten. Auch hatten wir ja eine hinreichende Zahl guter Matrosen bei uns, die ganz unter unsern Befehlen standen. Konnten wir uns daher nur ein Canoe verschaffen, so liess sich unseres Erachtens die Sache gut ausführen.
Nachdem wir uns also an Sayd bin Madschid gewandt, gestattete er uns in freigebiger Weise sofort den Gebrauch seines Bootes zu jedem beliebigen Zweck. Wir mietheten daher zwei Wadschidschiführer zu je zwei Doti und trafen unsere Vorbereitungen, etwa eine Woche nach meiner Ankunft, aus dem Hafen von Udschidschi abzureisen.
Ich habe schon mitgetheilt, weshalb Livingstone und ich die Untersuchung der nördlichen Hälfte des Tanganika und des Flusses Rusizi, über den so viel geschrieben und gesagt worden ist, unternahmen.
[S. 107]
Ehe wir uns einschifften, hatte sich Livingstone noch nicht definitiv entschlossen, was er in seiner traurigen Lage thun solle. Seine Dienerschaft bestand aus Susi, Dschumah, Hamoydah, Gardner und Halimah, der Köchin, die mit Hamoydah verheirathet war. Zu diesen kam noch Kaif-Halek, der Mensch, den ich gezwungen hatte, mich mit Livingstone’s Briefen von Unyanyembé aus zu begleiten.
Wohin konnte sich Dr. Livingstone begeben mit diesen wenigen Leuten und dem geringen Rest von Zeugen und Perlen, der ihm noch von dem vom schwachköpfigen Scherif verschwendeten Vorrath übrig geblieben? Das war eine schwer zu lösende Frage. Wäre Dr. Livingstone bei guter Gesundheit gewesen, so hätte sie die ihm eigene Kühnheit und sein unbezwinglicher Muth kurz beantwortet. Er hätte sich einiges Zeug von Sayd bin Madschid, wenn auch zu einem enormen Preise, leihen können, das ausgereicht hätte, ihn nach Unyanyembé und der Seeküste zu bringen. Wie lange aber wäre er wol genöthigt gewesen, in Udschidschi zu bleiben und auf die Waaren zu warten, die für ihn in Unyanyembé liegen sollten? Wie lange wäre er von Erwartungen gefoltert worden, hätte er in der täglichen Hoffnung auf das Ende des Krieges und die Ankunft seiner Güter dort weilen müssen? Wer weiss, wie lange seine geschwächte Gesundheit gegen die zahlreichen Enttäuschungen, die ihm bevorstanden, Widerstand hätte leisten können?
Ich war so kühn, bei aller Dr. Livingstone’s grossen Erfahrungen als Reisender gebührenden Hochachtung, ihm folgende Wege vorzuschlagen, von denen er einen oder den andern annehmen konnte:
Erstens, nach Hause zu gehen und sich die so wohl verdiente Rast, der er damals sehr zu bedürfen schien, zu gönnen.
Zweitens, nach Unyanyembé zu ziehen, dort seine Güter in Empfang zu nehmen und hinreichend viel Pagazi zu miethen, um nach Manyuema oder Rua zu reisen und das Nil-Problem, das seiner Meinung nach der Lösung so nahe sei, zu erledigen.
Drittens, nach Unyanyembé zu gehen, dort seine Karavane in Empfang zu nehmen, Leute zu miethen und sich[S. 108] mit Sir Samuel Baker zu vereinigen, indem er nach Muanza marschirte und durch Ukerewe oder den Victoria-Nyanza in meinen Booten bis nach Mtesa’s Palast in Uganda segelte. Hierdurch würde er Mirambo und Swaruru von Usui vermeiden, die ihn sonst auf dem gewöhnlichen Karavanenwege nach Uganda berauben würden. Von Mtesa könnte er sich zu Kamrasi, dem König von Unyoro, begeben, wo er jedenfalls etwas über den grossen Weissen erfahren würde, der mit einer zahlreichen Mannschaft in Gondokoro sein sollte.
Viertens, nach Unyanyembé zu gehen, seine Karavane in Empfang zu nehmen, Leute zu miethen und nach Udschidschi, sowie über Uguhha nach Manyuema zurückzukehren.
Fünftens, über den Rusizi durch Ruanda und weiter nach Itara und Unyoro zu Baker zu gehen.
Auf jeder dieser Touren, welche ihm auch als die zweckmässigste erschiene, wollten ich und meine Leute ihm als Eskorte und Lastträger nach besten Kräften beistehen. Wenn er die Heimfahrt wählte, so würde ich stolz darauf sein, ihn zu begleiten und mich seinen Befehlen in Bezug auf Marsch- und Rasttage vollständig zu unterwerfen.
Sechstens schlug ich ihm als letzten Ausweg vor, sich von mir bis Unyanyembé begleiten zu lassen, wo er seine Waaren in Empfang nehmen, von mir grosse Vorräthe des allerbesten Tuches, vorzüglicher Perlen, Gewehre und Munition, Kochgeräthe, Kleider, Boote und Zelte erhalten und sich in einem bequemen Hause ausruhen könne, während ich an die Küste eilte, eine neue aus 50–60 treuen, gutbewaffneten Leuten bestehende Expedition organisirte und ihm durch dieselbe neue Vorräthe von erwünschten Genüssen in Gestalt von Naturalien zuschickte.
Nach langer Ueberlegung entschloss er sich, den letzten Weg einzuschlagen, da dieser ihm der beste, am leichtesten auszuführende zu sein schien, obwol er es nicht unterliess, sich über die unverantwortliche Apathie seines Agenten in Zanzibar zu beklagen, die ihm so viel Mühe, Verlegenheit und aufreibende Märsche von Hunderten von Meilen verursacht hatte.
Unser Schiff, ein zwar nur schwankes, aus dem edeln[S. 109] Mvule-Baum Ugomas ausgehöhltes Canoe, war eine afrikanische Argo, die auf eine edlere Unternehmung als ihr berühmtes griechisches Vorbild ausging, denn wir zogen nicht für schnöden Lohn nach einem goldenen Vlies aus, sondern um womöglich eine Heerstrasse für den Handel zu entdecken, welche die Schiffe vom Nil bis Udschidschi, Usowa und nach dem fernen Marungu führen könne. Wir konnten nicht wissen, was wir alles auf der Reise ans Nordende des Tanganika entdecken könnten, denn wir meinten, der Rusizi sei ein Ausfluss des Tanganika, der nach dem Albert- oder Victoria-Nyanza fliesse, da Eingeborene wie Araber uns sagten, der Rusizi fliesse aus dem See heraus.
Sayd bin Madschid hatte behauptet, sein Nachen könne 25 Mann und 3500 Pfd. Elfenbein tragen. Auf diese Kunde hin schifften wir 25 Leute ein, von denen mehrere sich Beutel mit Salz für den Handel mit den Eingeborenen eingepackt hatten. Als wir aber vom Ufer bei Udschidschi abstiessen, entdeckten wir, dass das Boot zu schwer beladen sei und bis an den Hauptbalken einsank. Wir kehrten daher ans Ufer zurück, luden sechs Leute und die Salzbeutel aus und behielten somit 16 Ruderer, den jungen Araber Selim, den Koch Feradschi und zwei Wadschidschiführer bei uns.
Nachdem wir so unser Boot in Ordnung gebracht, stiessen wir ab und steuerten auf die Bangwe-Insel zu, die 4–5 Meilen von dem Bunder von Udschidschi entfernt ist. Als wir dieselbe passirten, theilten uns unsere Führer mit, die Araber und Wadschidschi hätten während eines vor einigen Jahren stattgehabten Einfalls der Watuta, bei welchem diese eine Menge Einwohner in Udschidschi massacrirten, auf dieser Insel Schutz gesucht. Nur diejenigen, welche hierher geflohen waren, entkamen dem Feuer und Schwert, mit dem die Watuta Udschidschi heimgesucht hatten.
Nachdem wir an der Insel vorbeigefahren und den verschiedenen Biegungen und Einschnitten des Ufers gefolgt waren, kamen wir in Sicht der herrlichen Bai von Kigoma, die sofort als ausgezeichneter Hafen gegen die auf dem Tanganika herrschenden sehr veränderlichen Winde sich darstellt.[S. 110] Etwa um 10 Uhr vormittags fuhren wir ins Dorf Kigoma, da der Ostwind sich gerade erhob und uns in den See zu treiben drohte. Von Udschidschi nach Norden fahrende Reisende, die nicht sehr eilig sind, benutzen stets Kigoma als ersten Hafen für ihre Boote.
Mit dem nächsten Morgengrauen brachen wir unser Zelt ab, legten das Gepäck im Boot zurecht, kochten, tranken Kaffee und fuhren wieder weiter nach Norden.
Der See war ganz ruhig, sein dunkelgrünes Wasser spiegelte den heitern blauen Himmel wider. Flusspferde kamen in beunruhigende Nähe unseres Nachens, um Luft zu schöpfen und tauchten die Köpfe wieder unter, als ob sie mit uns Verstecken spielten. Als wir den hohen Waldhügeln von Bemba gegenüber und eine Meile vom Ufer entfernt waren, hielten wir die Gelegenheit für günstig, das Wasser zu sondiren, da die Farbe desselben auf eine bedeutende Tiefe schliessen liess. Hier fanden wir, dass sie 35 Faden betrug.
An diesem Tage fuhren wir dicht am Ufer entlang, an welchem eine schön bewaldete und von grünem Gras bekleidete Bergreihe sich sehr steil, fast jählings in die Tiefe des Sees herabsenkte, sich unmittelbar über uns thürmend und, als wir um die verschiedenen Vorgebirge und Vorsprünge fuhren, grosse Erwartungen neuer, wunderbarer Bilder erweckend, die sich unsern Blicken eröffnen würden, sobald die tiefen Einschnitte vor uns lagen. Auch wurden wir nicht enttäuscht, denn die Waldhügel mit ihren reichen schönbelaubten Bäumen, von denen viele aus ihrem Blütenschmuck unbeschreiblich süsse Düfte entsandten, erhoben ihre Häupter in mannichfaltigen Umrissen, hier als Pyramiden oder abgestumpfte Kegel, dort tafelförmig oder in kirchendachähnlichen Formen, dort wiederum als eine herrliche Masse mit glatten Umrissen oder wilden gezackten Contouren und alles dies bildete einen höchst interessanten Anblick. Die ausnehmend schönen Bilder am Ende der verschiedenen Buchten entlockten uns manchen Ausruf der Bewunderung. Bei mir war es sehr natürlich, dass ich die höchste Bewunderung für diese Reihenfolge herrlicher Naturgemälde empfand; nicht minder aber war dies auch bei Livingstone[S. 111] der Fall, obgleich man hätte annehmen können, dass er, von viel schönern, wunderbarem derart gesättigt, längst seinen Sinn für Naturschönheiten abgestumpft haben müsste.
Auf dem Wege von Bagamoyo nach Udschidschi hatte ich nichts gesehen, was sich dem vergleichen liesse, nichts von diesen Fischeransiedlungen unter dem Schatten von Palmen-, Platanen-, Bananen- und Mimosen-Hainen, oder Cassavagärten rechts und links von Palmenwäldern oder Plätzchen voll üppigen Korns, welche auf die ruhige Bucht niederschauten, deren stille Wasser am frühen Morgen die Schönheit der Berge widerspiegelten, die sie vor den tobenden, draussen wüthenden Stürmen schützten.
Offenbar glauben die Fischer sich in einer angenehmen Lage zu befinden. Der See bietet ihnen so viele Fische, wie sie wollen, mehr, als sie zu verzehren im Stande sind, sodass die Fleissigen viel verkaufen können. Die steilen Abhänge der Hügel, welche die Frauen bearbeiten, erzeugen viel Korn, z. B. Dourra und Mais neben Cassava, Erd- oder Erbsennüssen und süssen Kartoffeln. Die Palmen geben Oel und die Platanen herrliches Obst in reicher Menge. Die Schluchten und tiefen Gründe versehen sie mit hohen stattlichen Bäumen, aus denen sie ihre Canoes schnitzen. Die Natur hat sie mit allem aufs reichlichste versehen, was sich der Mensch für Herz und Magen nur wünschen kann. Wenn man sich diese Scenen, die sowol innerlich als äusserlich vollständig glücklich machen können, ansieht, überfällt den Beschauer wol der Gedanke, wie diese Leute nach der Heimat seufzen müssen, wenn sie, von den Arabern für ein paar Doti erkauft, durch die traurige, zwischen diesem Lande und der Seeküste liegende Wüste, nach Zanzibar gebracht werden, um dort Gewürznelken zu lesen oder als Lastträger zu arbeiten!
Als wir in die Nähe von Niasanga, unserm zweiten Lagerort, kamen, trat uns die Aehnlichkeit zwischen der Reihe malerischer Berge und Buchten mit ihrer Weide- und Ackerbau-Landschaft und den Küsten des alten Pontus lebhaft vor Augen. Wenige Minuten, ehe wir unser Boot ans Ufer zogen, ereigneten sich zwei kleine Zwischenfälle. Ich schoss nämlich einen sehr grossen Affen mit hundeähnlichem Gesicht,[S. 112] der von der Schnauze bis zum Ende des Schwanzes 4 Fuss 9 Zoll mass. Sein Gesicht war 8½ Zoll lang und er wog ungefähr 100 Pfund. Er hatte weder eine Mähne noch einen Büschel am Ende seines Schwanzes, sein Körper aber war von langem, borstigem Haar bedeckt. Wir sahen zahlreiche Exemplare dieser Gattung, wie auch kleinere mit Katzenköpfen und langen Schwänzen. Der zweite Vorfall war der Anblick einer grossen Eidechse von etwa 2½ Fuss Länge, die in ihren Schlupfwinkel forthuschte, ehe wir sie genau sehen konnten. Dr. Livingstone hielt sie für den Monitor terrestris.
Unter einem Bananenbaume schlugen wir unser Lager auf. Unsere Umgebung bestand aus dem jetzt dunkelgrauen Wasser des Tanganika, einem amphitheatralischen Bergzuge und dem Dorfe Niasanga, das an der Mündung des Flüsschens Niasanga liegt und von Palmenhainen, Platanendickichten und kleinen Korn- und Cassavafeldern eingeschlossen ist. In der Nähe unseres Zeltes befanden sich ungefähr ein halbes Dutzend grösserer und kleinerer den Dorfbewohnern gehöriger Canoes. Unser Zelt blickte auf die herrliche, von Lüftchen gefächelte Wasserebene, und in der Ferne auf Ugoma, Ukaramba und die Insel Muzimu, deren Berge und Höhenzüge tiefblau aussahen. Zu unsern Füssen befanden sich reine, in kleine Reihen und Haufen angeschwemmte Kieselsteine. Eine Untersuchung derselben offenbarte uns das Material der Berge, die sich hinter uns zur Rechten und Linken erhoben. Es war Thonschiefer und Conglomerat-Sandstein, harter weisser Lehm, ockerartiger Lehm, der viel Eisen enthielt, glatter Quarz u. s. w. Wenn wir zu unserm Zelt hinausblickten, konnten wir zu unsern beiden Seiten eine Reihe dicker hoher Binsen sehen, die gleichsam eine Hecke zwischen dem Ufer und dem Niasanga umgebenden bebauten Lande bildeten. Unter den hier vorkommenden Vögeln waren am bemerkenswerthesten die muntern Bachstelzen, die von den Eingeborenen als Friedensboten und von guter Vorbedeutung angesehen werden, daher jeder Schade, den man ihnen zufügt, sofort mit einer Strafe geahndet wird; sie bieten ja auch nur Böswilligen eine Verlockung zur Gewaltthätigkeit dar. Bei[S. 113] unserer Landung kamen sie uns entgegengeflogen und schwebten in der Luft vor uns her, sodass wir sie leicht mit den Händen hätten ergreifen können. Im übrigen kamen Krähen, Turteltauben, Fischhabichte, Königsfischer, Ibis nigra und Ibis religiosa, Reiher, Gänse, Stossvögel, Reisvögel, Meisen und Adler vor.
An diesem Ort litt Dr. Livingstone an Diarrhoe, was, wie er selbst sagte, sein einziger schwacher Punkt ist; später fand ich, dass er sehr häufig daran zu leiden hat. Jede Gemüthsbewegung oder Unregelmässigkeit beim Essen zeigte sich bei ihm in dieser Weise. Bei mir fand gerade das Umgekehrte statt. Wenn ich mich der Malaria aussetzte, in der Nähe eines schädlichen Sumpfes campirte oder Gemüthsbewegungen hatte, so bekam ich sofort sehr starke Verstopfung und bisweilen einen Wechselfieberanfall.
Der dritte Tag unserer Reise auf dem Tanganika brachte uns nach dem Fluss und Dorf Zassi, nachdem wir vier Stunden gerudert waren. An unserm Wege erhoben sich die Berge 2000–2500 Fuss über dem Wasser des Sees. Mir kam es vor, als ob die Landschaft bei jedem Schritt malerischer und belebter würde, und ich hielt sie für viel lieblicher als die Umgebung von Lake George oder am Hudson. Die traulichen Plätzchen am Ende der Bucht mit ihren stets schönen Federpalmen und breiten grünen Platanen geben wunderhübsche Bilder ab; sie sind alle von Fischern in Besitz genommen, deren conische, bienenkorbförmige Hütten aus dem Laube hervorblicken. Die Gestade sind sehr bevölkert und jede Terrasse, jedes kleine Plateau und Stückchen ebenen Bodens ist besetzt.
Zassi lässt sich leicht erkennen durch eine Gruppe kegelförmiger Hügel, welche sich in der Nähe desselben erheben und Kirassi heissen. Ihnen gegenüber, in einer Entfernung von ungefähr einer Meile vom Ufer, sondirten wir und fanden eine Tiefe von 35 Faden wie am Tage vorher. Eine Meile weiter konnte ich mit meinem 115 Faden langen Senkblei keinen Grund finden. Als ich es zurückzog, riss die Leine und ich verlor drei Viertel derselben mit dem Blei. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir Livingstone, er habe eine Stelle, dem hohen im Süden von Udschidschi[S. 114] belegenen Kabogo gegenüber, sondirt und die grosse Tiefe von 300 Faden erreicht. Auch er verlor dabei sein Blei und 100 Faden Leine, hatte aber noch ziemlich 900 Faden übrig, welche sich im Boot befanden. Diese lange Lothleine hofften wir auf unserm Wege vom östlichen nach dem westlichen Ufer des Sees benutzen zu können.
Am vierten Tage kamen wir in Nyabigma an, einer sandigen Insel in Urundi. Wir hatten die Grenze zwischen Udschidschi und Urundi eine halbe Stunde vor Nyabigma passirt. Der Mschala-Fluss wird von beiden Nationen als die eigentliche Grenze angesehen, obgleich es einige Warundi gibt, die über die Grenze hinaus in Udschidschi eingewandert sind, z. B. der Mutware und die Dorfbewohner des volkreichen Kagunga, das eine Stunde nördlich von Zassi liegt. Auch gibt es kleine Abtheilungen von Wadschidschi, die das schöne Land in den Deltas der Flüsse Kasokwe, Namusinga und Luaba benutzt haben, von denen die beiden ersten in dieser Bucht, an deren Ende Nyabigma liegt, in den Tanganika fliessen.
Aus Nyabigma kann man eine recht schöne Aussicht geniessen auf die tiefe Bogenlinie der grossen Gebirgskette, die vom Cap Kazinga bis an das Cap Kasofu, 20 bis 25 Meilen weit läuft. Diese grosse, theils höckrige, theils kammartige, unregelmässige Gebirgslinie gibt eine höchst imposante Scene ab. Tiefe Schluchten und Klüfte bieten den zahlreichen, im Hintergrunde entspringenden Bächen und Flüssen Abfluss; weisse Wölkchen umhüllen fast immer den Gipfel des Gebirgs. Vom Fusse desselben erstreckt sich eine weite Alluvialebene, die über alle Beschreibung reich an Palmen, Platanen und schotenreichen Bäumen ist. Ueberall sieht man Dörfer in Gruppen. In diese Alluvialebene mündet der Luaba- oder Ruaba-Fluss, nördlich vom Cap Kitunda, sowie die Flüsse Kasokwe, Namusinga und Mschala auf der Südseite desselben. Die sämmtlichen Deltas der Flüsse, die sich in den Tanganika ergiessen, werden von allen Seiten von einem aus Matete, einer riesigen Grasart, und Papyrus gebildeten Dickicht eingehegt. In einigen derselben, wie z. B. denen des Luaba und Kasokwe, haben sich Moräste gebildet, in denen das Matete- und Papyrusdickicht[S. 115] undurchdringlich ist. In ihrem Innern befinden sich stille, tiefe Pfützen, die von verschiedenen Wasservögeln, wie z. B. Gänsen, Enten, Schnepfen, Speckenten, Königsfischern, Ibissen, Kranichen, Störchen und Pelikanen bewohnt sind. Ihren Aufenthaltsort zu erreichen ist jedoch für den auf Wild ausgehenden Jäger sehr schwer und oft sowol wegen der verrätherischen Natur dieser Moräste mit grosser Gefahr verbunden, als auch wegen der schrecklichen Fieberanfälle, die in diesen Gegenden immer auf Durchnässung der Füsse und Kleider erfolgen, bedenklich.
In Nyabigma bereiteten wir uns durch Austheilung von zehn Patronen an jeden unserer Leute auf einen Kampf mit den zwei Stationen weiter wohnenden Warundi für den Fall vor, dass sie uns durch ein zu naseweises Zurschautragen ihres Vorurtheils gegen Fremde dazu veranlassen sollten.
Mit dem Morgengrauen des fünften Tages verliessen wir den Hafen der Insel Nyabigma und befanden uns in nicht ganz einer Stunde auf der Höhe von Cap Kitunda. Dies ist eine ebene Platte von Conglomerat-Sandstein, die sich etwa acht Meilen vom Fusse der grossen Gebirgscurve erhebt, die dem Luaba und seinen Nachbarströmen den Ursprung gibt. Wir setzten über die tiefe Bai, an deren Ende das Delta des Luaba liegt und gelangten an das Vorgebirge Kasofu. In seiner Umgegend liegen zahlreiche Dörfer. Von hier aus erblickten wir eine Reihe von Vorgebirgen oder Spitzen, nämlich Kigongo, Katunga und Buguluka, die wir alle passirten, ehe wir in der schönen Gegend von Mukungu halt machten.
In Mukungu, wo wir am fünften Tage weilten, wurde uns Honga oder Tribut abverlangt. Das Tuch und die Perlen, von denen wir während unserer Fahrt auf dem See lebten, gehörte mir; da Dr. Livingstone aber der ältere, erfahrenere und wichtigste Mann unserer Gesellschaft war, lag es ihm ob, alle solche Anforderungen zu erledigen. Wie oft hatte ich mich nicht dieser langwierigen, peinvollen Aufgabe des Tributzahlens unterziehen müssen! Ich war daher sehr neugierig zu sehen, wie der grosse Reisende dies Geschäft abmachen würde.
Der Mateko (der Rangstufe nach weniger als ein Mutware)[S. 116] von Mukungu forderte uns 2½ Doti ab. So viel betrug die an uns bald nach Eintritt der Dunkelheit gestellte Forderung. Der Doctor fragte darauf, ob für uns nichts mitgebracht worden sei und erhielt zur Antwort: Nein, es sei jetzt zu spät, um irgendetwas zu bekommen; wenn wir aber den Tribut bezahlten, so sei der Mateko bereit, uns bei unserer Rückreise etwas zu geben. Hierüber lächelte Livingstone und sagte dem ihm gegenüberstehenden Mateko: „Wenn Ihr uns jetzt nichts geben könnt und so lange warten wollt, bis wir zurückkehren, so werden auch wir mit dem Honga bis dahin warten.“ Hierüber war der Mateko überrascht und protestirte gegen diesen Vorschlag. Wir bemerkten nun, dass er verdriesslich geworden und drangen in ihn, uns ein Schaf, ein einziges, kleines Schaf zu bringen, da unser Magen fast leer sei und wir mehr als einen halben Tag darauf gewartet hätten. Dieses Ersuchen ward auch von Erfolg gekrönt, denn der alte Mann eilte fort und brachte uns ein Lamm sowie einen Topf von zwölf Liter süsses, aber starkes Zogga (Palmweinpunsch), und dafür zahlte ihm Livingstone 2½ Doti Tuch. Das Lamm wurde geschlachtet und da wir bei guter Verdauung waren, bekam uns sein Fleisch sehr gut, doch hatten wir die Wirkungen des Zogga zu bedauern. Susi nämlich, der unschätzbare Diener Dr. Livingstone’s, und Bombay, der Führer meiner Karavane, waren mit der Bewachung unseres Canoes betraut; da sie aber zu viel von diesem berauschenden Punsch getrunken, schliefen sie sehr fest, und am Morgen hatten wir den Verlust mehrer werthvoller, unentbehrlicher Gegenstände zu bedauern, unter denen ich Livingstone’s 900 Faden lange Senkleine, 500 Stück Nadel-, Reifen- und Hohl-Patronen für meine Gewehre und 90 mir gleichfalls gehörige Musketenkugeln nenne. Ausser diesen uns gegen die feindlichen Warundi unentbehrlichen Dingen war ein grosser Sack Mehl und des Doctors ganzer Vorrath an weissem Zucker gestohlen. Dies war das dritte mal, dass mein Verlass auf Bombay mir einen bedeutenden Verlust verursachte und zum neunundneunzigsten mal hatte ich es bitter zu bereuen, so unbedingtes Vertrauen auf das ihm von Speke und Grant gezollte grosse Lob gesetzt zu haben. Nur die unwissenden[S. 117] Dieben eigene Furcht hatte die Wilden daran verhindert, das ganze Boot mit allem Inhalt zu nehmen und Bombay sowie Susi zu Sklaven zu machen. Ich kann mir lebhaft die freudige Ueberraschung der Wilden vorstellen beim Anblick und vortrefflichen Geschmack des Livingstone’schen Zuckers, sowie die Verwunderung, mit der sie die merkwürdige Munition der Wasungu betrachtet haben müssen. Hoffentlich haben sie sich nicht mit den explodirenden Kugeln und gereiften Patronen aus Unwissenheit über ihren tödlichen Inhalt Schaden gethan, sonst wäre der Kasten und sein Inhalt eine wirkliche Pandorabüchse für sie geworden.
Ueber unsern Verlust sehr misgelaunt setzten wir am sechsten Tage zur gewohnten Stunde unsere Wasserreise fort. Wir fuhren dicht an den niedrigen Landspitzen, die von den Flüssen Kigwena, Kikumu und Kisunwe gebildet werden, vorüber und steuerten, sobald eine Bucht interessant aussah, ihren Einschnitten nach. Während unserer Wasserreise brachte uns jeder Tag ähnliche Bilder. Zur Rechten erhoben sich die Gebirge von Urundi, die uns hin und wieder die Schluchten zeigten, durch welche die verschiedenen Flüsse und Bäche in den See traten. Am Fusse derselben lagen die Alluvialebenen, wo die Oelpalme und liebliche Platane blühten, unter deren Schatten Dutzende von Dörfern gruppirt waren. Hin und wieder kamen wir an langen, schmalen Streifen von kiesigem oder sandigem Uferlande vorbei, auf denen Marktplätze für den Fischverkauf und die Stapelproducte der verschiedenen Gemeinden improvisirt waren. Dann zogen wir an breiten Morästen vorüber, die durch die zahlreichen, aus den Bergen kommenden Bäche gebildet werden und auf denen Matete und Papyrus wuchert. Bald reichten die Berge mit ihren steilen Wänden dicht ans Wasser, bald traten sie in tiefen Einschnitten zurück, an deren Fuss eine Alluvialebene von einer Breite von 1–8 Meilen bestimmt zu sehen war. Fortwährend erblickte man Canoes, die dicht an der Brandung herfuhren und furchtlos der Möglichkeit einer Katastrophe Trotz boten, wie sie z. B. durch Umschlagen der Boote und Verspeisen der Bemannung von gefrässigen Krokodilen herbeigeführt werden könnte. Bisweilen zeigte sich uns ein[S. 118] Boot in geringer Entfernung vor uns, worauf unsere Leute, vom Chorgesang ermuntert, sich aufs äusserste anstrengten, es einzuholen. Wenn die Eingeborenen unsere Anstrengungen sahen, so verdoppelten auch sie die ihrigen und gaben zugleich, indem sie beim Rudern ganz nackt dastanden, reiche Gelegenheit, vergleichende Anatomie zu treiben. Dann wiederum sahen wir eine Gruppe Fischer, die in puris naturalibus faul dalagen und mit neugierigen Blicken die an ihnen vorbeifahrenden Nachen verfolgten. Ein anderes mal fuhren wir an einer Canoeflottille vorbei, deren Besitzer ruhig in ihren Hütten sassen und fleissig Haken und Ruthen anwandten oder ihre Netze auswarfen, oder an Leuten, die ihre langen Schleppnetze dicht am Ufer für einen Zug vorbereiteten. An einem andern Orte befanden sich furchtlos im Wasser spielende Kinder, deren Mütter unter dem Schatten eines Baumes mit Vergnügen zuschauten, woraus ich den Schluss zog, dass es in dem See, ausser in der Nachbarschaft der grossen Flüsse, nicht viel Krokodile gibt.
Nachdem wir die niedrige Landspitze von Kisunwe, die durch den Kisunwe-Fluss gebildet wird, umfahren hatten, kamen wir in Sicht des ungefähr 4–5 Meilen entfernten Cap Murembwe. Das dazwischen liegende Land ist ein flaches, sandiges, kieshaltiges Ufer. In der unmittelbaren Nähe desselben befinden sich Dörfer zu Dutzenden und das belebte Ufer zeigt die dichte Bevölkerung dieser Gegend an.
Ungefähr auf halbem Wege zwischen dem Cap Kisunwe und Murembwe befindet sich ein Haufen von Dörfern, der Bikari heisst und einen Mutware hat, der gewohnt ist, Honga zu nehmen. Da es uns unmöglich gemacht war, es auf längere Zeit mit einer feindlich gesinnten Gemeinde aufzunehmen, so vermieden wir alle Ortschaften, welche bei den Wadschidschi in bösem Rufe stehen. Doch selbst unsere Wadschidschiführer befanden sich bisweilen im Irrthum und führten uns mehr als einmal an gefährliche Orte. Offenbar hatten sie nichts dagegen, in Bikari halt zu machen, da es der zweite Lagerplatz von Mukungu ist; denn ihnen war das Halten im kühlen Schatten von Platanen dem Holzpuppen gleichen Sitzen in einem schwanken Canoe unendlich lieber. Ehe sie uns aber ihre Gründe auseinandersetzten,[S. 119] rief uns das Volk von Bikari mit lauter Stimme ans Ufer und bedrohte uns mit der Rache des grossen Wami, wenn wir nicht halt machten. Da diese Stimmen durchaus nicht sirenenhaft klangen, so verweigerten wir es hartnäckig, ihrer Aufforderung nachzukommen. Als jene ihre Drohungen als erfolglos erkannten, nahmen sie ihre Zuflucht zu Steinen und bewarfen uns mit denselben in eindringlichster Weise. Da ein Stein nur ein Fuss weit von meinem Arme vorbeiflog, so schlug ich vor, dass man ihnen dafür eine Kugel in die unmittelbare Nähe ihrer Füsse entsenden solle; Livingstone sagte zwar nichts dagegen, zeigte jedoch deutlich, dass er dies nicht ganz billige. Da uns diese Feindseligkeiten durchaus nicht angenehm waren und wir Zeichen derselben fast bei jedem Dorfe, an dem wir vorüberkamen, erblickten, so reisten wir weiter, bis wir nach der Spitze von Murembwe kamen, welches als Delta des gleichnamigen Flusses durch breites Dornendickicht, stachliges Rohr und dichte Buchen- und Papyrusbüsche so gut geschützt war, dass der kühnste Mrundi wol vor einem Angriffe zurückschrecken musste, namentlich wenn er daran dachte, dass sich jenseits dieses unwirthbaren Morastes die Gewehre von Fremdlingen befanden, die seine Leute in so roher Weise herausgefordert hatten. Wir zogen unsere Canoes ans Ufer und unser stets bereiter Koch Feradschi zündete auf einem kleinen Fleck reinen Sandes ein Feuer an und kochte uns einen prächtigen Mokkakaffee. Trotz der uns noch drohenden Gefahr waren wir sehr glücklich und würzten unser Mahl mit etwas Moralphilosophie, die uns unbewusst zu höhern Wesen machte, als die uns umgebenden Heiden, auf die wir jetzt, unter dem Einfluss des Mokka und der Philosophie, mit ruhiger Verachtung, die nicht ohne einen gewissen Grad von Mitleid war, hinabblickten. Der Doctor erzählte einiges aus seinem Leben unter ähnlich gesinnten Völkerschaften, unterliess es aber nicht, mit der Weisheit eines erfahrenen Mannes, solche Vorkommnisse dem unklugen Verhalten der Araber und Mischlinge zuzuschreiben. In dieser Ansicht stimmte ich rückhaltlos mit ihm überein.
Von der Murembwe-Spitze setzten wir nach Beendigung unseres Kaffeegenusses und des Gesprächs über Moral unsere[S. 120] Reise fort und steuerten auf Cap Sentakeyi los, welches wir, obwol es 8–10 Meilen entfernt ist, doch bis zur Dunkelheit zu erreichen hofften. Die Wangwana ruderten mit Macht; doch schon waren zehn Stunden verflossen und die Nacht kam heran und wir befanden uns noch immer sehr weit von Sentakeyi. Da es eine schöne Mondnacht und wir uns unserer gefährlichen Lage sehr wohl bewusst waren, so gingen sie darauf ein, noch ein paar Stunden weiter zu rudern. Ungefähr um 8 Uhr abends ruderten wir an einen verlassenen Fleck am Ufer, auf eine reine Sandbank, die etwa 30 Fuss lang und 10 Fuss breit war, von der sich eine Lehmwand 10–12 Fuss in die Höhe hob, während auf jeder Seite verwitterte Felsenmassen herumlagen. Hier konnten wir uns unseres Erachtens durch stilles Verhalten der Beobachtung und darausfolgenden Belästigungen auf einige Stunden entziehen und darauf, nachdem wir ausgeruht, unsere Reise fortsetzen. Unser Theekessel kochte und die Leute hatten sich ein kleines Feuer angezündet und ihre irdenen Töpfe mit Wasser zum Grützekochen gefüllt, als unsere Späher dunkle Gestalten unserm Bivouak zukriechen sahen. Nachdem wir sie angerufen, kamen sie sofort hervor und begrüssten uns mit der Formel der Eingeborenen „Wake“. Unsere Führer erklärten ihnen, dass wir Wangwana seien, bis zum Morgen dort zu campiren gedächten und, wenn sie etwas zu verkaufen hätten, uns freuen würden, mit ihnen am folgenden Tage in Handelsbeziehungen zu treten. Nach ihren Aeusserungen waren sie hierüber hocherfreut und entfernten sich, nachdem sie noch ein paar Worte gewechselt und versprochen hatten, am nächsten Morgen mit Nahrungsmitteln wiederzukehren und Freundschaft mit uns zu schliessen; wir hatten wohl bemerkt, wie sie genaue Beobachtungen in Bezug auf unser Lager machten. Als wir den Thee tranken, liessen uns unsere Späher wissen, dass sich wieder ein Trupp uns nähere, der in derselben Weise wie der erste uns begrüsste und aufmerksam beobachtete. Auch dieser entfernte sich in äusserst freudiger Stimmung, wie mir schien, und nach kurzer Zeit kam noch eine dritte Partie, welche es wie die frühern machte. Aus alle dem schlossen wir, dass die Neuigkeit sich rasch[S. 121] durch das Dorf verbreite. Auch hatten wir bemerkt, wie zwei Canoes mit mehr als gewöhnlicher und nöthiger Eile hin und zurück fuhren. Wir hatten guten Grund, argwöhnisch zu sein, denn es ist nicht gewöhnlich, dass sich die Bewohner der Länder zwischen Udschidschi und Zanzibar nach Eintritt der Dunkelheit unter irgendeinem Vorwand besuchen oder begrüssen. Nach Eintritt der Dunkelheit ist es niemand gestattet, um das Lager herumzuschleichen, ohne dass man auf ihn schiesst; und dieses Hin- und Hergehen, diese demonstrativen Freudenbezeugungen bei der Ankunft einiger Wangwana, einem Ereigniss, das in vielen Theilen von Urundi als etwas ganz gewöhnliches angesehen worden wäre, war sehr verdächtig. Während Livingstone und ich zu dem Schlusse kamen, dass diese Bewegungen doch wol Feindseligkeiten bedeuteten, kam eine vierte sehr laute und lärmende Abtheilung an und besuchte uns. Jetzt war unser Abendessen beendet und wir hielten es nun für hohe Zeit, zu handeln. Nachdem der vierte Besuch sich unter übermässigen Freudenbezeugungen entfernt hatte, schickten wir unsere Leute rasch ins Boot und nachdem wir alle, mit Einschluss der Wachen, Platz genommen, stiessen wir vom Lande ab, aber auch nicht einen Augenblick zu früh. Als nämlich das Canoe in dem herrschenden Zwielicht vorwärtsglitt, machte ich den Doctor auf mehrere dunkle Gestalten aufmerksam, von denen sich einige hinter zur Rechten liegenden Felsen verbargen, andere darüber hinwegkrochen, um bessere Positionen zu gewinnen. Gleichzeitig kamen von der Linken Leute in derselben verdächtigen Weise heran und alsbald rief uns eine Stimme von der Höhe der Lehmbank an, die über unsern eben verlassenen Ruheplatz hinüberragte. „Das war nett gemacht!“ rief Livingstone, als wir durchs Wasser schossen und die getäuschten Räuber hinter uns liessen. Hier wurde ich wiederum durch die blosse Anwesenheit des Doctors daran verhindert, ein paar gutgezielte Schüsse in die Menge hineinzusenden, um sie davor zu warnen, in Zukunft Fremde zu belästigen, weil ich dachte, dieser werde, wenn es nothwendig sei, nicht zögern, den Befehl dazu zu ertheilen.
Nachdem wir noch sechs Stunden gerudert und in der[S. 122] Zeit um Cap Sentakeyi gekommen waren, hielten wir an dem kleinen Fischerdorf Mugeyo, wo man uns unbelästigt schlafen liess. Mit dem Morgengrauen setzten wir unsere Reise fort und kamen ungefähr 8 Uhr morgens im Dorfe des freundlichen Mutware von Magala an. Wir hatten 18 Stunden nacheinander gerudert, was im Verhältniss von 2½ Meilen in der Stunde 45 engl. Meilen ausmachte. Bei der Aufnahme, die wir vom Lager am Cap Magala, einem der hervorragendsten Punkte im Norden von Udschidschi, von der Gegend machten, fanden wir, dass die grosse Insel Muzimu, die wir immer seit unserer Umfahrt um Cap Bangwe, unweit Udschidschi-Bunder, gesehen hatten, eine südsüdwestliche Richtung habe und dass das westliche Ufer sich bedeutend dem östlichen nähere. Die Breite des Sees betrug an diesem Punkte etwa 8–10 Meilen. Wir hatten einen schönen Blick auf die westlichen Hochlande, welche durchschnittlich 3000 Fuss über dem See zu liegen schienen. Der etwas nach Norden und Westen von Magala sich erhebende Luhanga-Pic konnte etwa 500 Fuss höher und der nördlich vom Luhanga liegende Sumburizi, wo Mruta, der Sultan von Uvira, dem Lande, das diesem Theile von Urundi gegenüberliegt, lebt, etwa 300 Fuss höher als die benachbarten Höhen sein. Nördlich vom Cap Magala zieht sich der See zwischen zwei Gebirgsketten hin, die beide an einem ungefähr 30 Meilen nördlich von uns belegenen Punkte zusammenstossen.
Die Warundi von Magala waren sehr höflich und gafften uns gründlich an. Sie sammelten sich um die Zeltthür und beobachteten uns hartnäckig, als ob wir Gegenstände des höchsten Interesses seien, die jedoch leicht auf immer plötzlich verschwinden könnten. Der Mutware kam in grossem Staat, spät am Nachmittag, um uns zu besuchen. Es war ein junger Mensch, der mir in der Menge der Gaffer durch sein stattliches Aussehen und seine schönen Zähne, die er, weil er das Lachen sehr liebte, beständig zeigte, aufgefallen war. Man konnte ihn nicht verkennen, obwol er jetzt mit vielen Elfenbeinzierathen, Halsbändern und schweren Messingringen um Hand- und Fussgelenk geschmückt war. Die Werthschätzung, die wir für ihn an[S. 123] den Tag legten, erwiderte er und gab uns für zwei Doti Tuch und ein Fundo Samsam ein schönes fettes breitschwänziges Schaf und einen Topf Milch. Beides war in unserer Lage ausserordentlich annehmbar.

In Magala hörten wir, dass ein Krieg zwischen Mukamba, nach dessen Land wir reisten, und Warumaschanya, dem Sultan eines Nachbarbezirks, wüthe, und man rieth uns, lieber zurückzukehren, wenn wir nicht beabsichtigten, einem dieser Häuptlinge gegen den andern beizustehen. Da wir aber ausgezogen waren, um das Problem des Rusizi-Flusses zu lösen, so hatten derartige Rücksichten kein Gewicht für uns.
Am achten Morgen nach unserer Abfahrt von Udschidschi sagten wir dem gastfreien Volke von Magala Lebewohl und begaben uns auf die Reise nach dem Lande Mukamba’s, welches in Sicht war. Bald nachdem wir die Grenze zwischen dem eigentlichen Urundi und dem Theile, der als Usige bekannt ist, überschritten hatten, erhob sich ein Sturm aus Südwesten. Das furchtbare Schwanken unseres Bootes in den Wogenthälern warnte uns, weiter zu fahren und wir wandten den Nachen nach dem ungefähr vier Meilen weiter nördlich gelegenem Dorfe Kisuka zu, wo das in Usige belegene Mugere anfängt. In Kisuka besuchte uns ein bei Mukamba lebender Mgwana und erzählte uns Einzelheiten über den zwischen Mukamba und Warumaschanya ausgebrochenen Krieg, aus denen hervorging, dass diese beiden Häuptlinge sich beständig in den Haaren lagen. Uebrigens ist es doch eigentlich eine nicht sehr blutige Art Krieg. Ein Häuptling nämlich macht einen Raubzug in das Land des andern, wobei es ihm glückt, mit einer Heerde Vieh abzuziehen und ein paar Leute, die er überrascht hat, zu tödten. Wochen oder auch Monate können vergehen, ehe der andere sich rächt und einen ähnlichen Fang thut, wodurch das Gleichgewicht wieder hergestellt wird, sodass keiner etwas gewonnen hat. Nur selten greifen sie sich mit Muth und Energie an, da der Afrikaner seiner Natur nach sehr gegen eine energische Kriegführung ist.
Dieser Mgwana gab uns auch auf unser Befragen weit interessantere Nachrichten, nämlich über den Rusizi. Denn[S. 124] er versicherte uns mit Kennermiene, die zu bezweifeln ein Zeichen grosser Dummheit sei, dass der Rusizi-Fluss aus dem See nach Suna’s (Mtesa’s) Lande fliesse. „Wo könnte er auch sonst hinfliessen?“ fragte er. Livingstone war geneigt, dieses zu glauben oder wollte wol mehr diese Behauptung auf sich beruhen lassen, bis sie durch Augenschein bestätigt sei. Ich hatte, wie ich dem Doctor sagte, mehr Neigung es zu bezweifeln. Erstens war die Nachricht zu gut, um wahr sein zu können, und zweitens erging sich der Mensch zu begeistert über diesen Gegenstand, der für ihn doch gar kein Interesse haben konnte. Seine „Barikallahs“ und „Inschallahs“ waren mir viel zu warm und seine Antworten stimmten viel zu sehr mit unsern Wünschen überein. Der Doctor legte aber grosses Gewicht auf den Bericht eines Mgwana, mit dem er im fernen Süden zusammengetroffen und der ihm mitgetheilt, der Grossvater oder Vater Rumanika’s, des jetzigen Königs von Karagweh, habe daran gedacht, das Bett des Kitangule-Flusses zu verbreitern, damit seine Nachen nach Udschidschi fahren könnten, um dort Handelsverbindungen anzuknüpfen. Aus diesem Umstande, der mit seinem oft ausgesprochenen und auch jetzt festgehaltenen Glauben, dass das Wasser des Tanganika irgendwo einen Abfluss habe, übereinstimmte, glaube ich, dass Livingstone dem Bericht des Mgwana zugethan war. Im weitern Verlauf jedoch werden wir sehen, zu welchem Ziele dies führte.
Am neunten Morgen nach unserer Abfahrt von Udschidschi passirten wir etwa zwei Stunden nach Sonnenaufgang das breite Delta des Mugere, eines Flusses, welcher seinen Namen auch der am östlichen Ufer belegenen Gegend gibt, über die Mukamba herrscht. Wir befanden uns gerade der südlichsten seiner drei Mündungen gegenüber, als wir einen grossen Unterschied in der Färbung des Wassers entdeckten, welche sich durch eine fast gerade östlich und westlich von der Mündung gezogene Linie gut markiren liess. Auf der Südseite befand sich reines, hellgrünes Wasser, auf der nördlichen war es schlammig und man konnte den Strom gerade nach Norden fliessen sehen. Bald nachdem wir die erste Mündung passirt, kamen wir an die[S. 125] zweite und dritte, von denen jede nur wenige Schritt breit ist, aber hinreichend viel Wasser entlässt, um uns zu gestatten, die Strömungen einige Ruthen nach Norden über ihre Mündungen hinaus zu verfolgen.
Ueber die dritte Mündung des Mugere hinaus zeigte sich eine Biegung, auf deren anderm Ufer sich eine Gruppe von Dörfern befand. Sie gehörten Mukamba und in einem derselben lebt dieser Häuptling selbst. Die Eingeborenen hatten noch nie einen Weissen gesehen und wir wurden natürlich bei unserer Landung von einer grossen Menge umgeben, sämmtlich mit langen Speeren bewaffnet. Dies sind ausser Knütteln und eines hin und wieder vorkommenden Beiles die einzigen Waffen, die man bei ihnen antrifft.
Man wies uns in eine Hütte, die Dr. Livingstone und ich gemeinsam einnahmen. Von dem, was sich an jenem Tage ereignete, habe ich nur eine dunkle Erinnerung, da ich zum ersten male, seitdem ich Unyanyembé verlassen, vom Fieber niedergeworfen wurde. Ich erinnere mich nur dunkel, dass ich den Versuch machte, Mukamba’s Alter zu bestimmen und bemerkte, dass er im ganzen stattlich aussehe und uns wohl geneigt sei. Während der Pausen der Qualen und Bewusstlosigkeit glaubte ich zu sehen, wie Livingstone sich auf mich zu bewegte, und zu fühlen, wie er mir den heissen Kopf und die brennenden Glieder liebevoll betastete. Ich hatte mehrere Fieberanfälle zwischen Bagamoyo und Unyanyembé erduldet, ohne dass irgend jemand mir Erleichterung von den langwierigen, marternden Kopfschmerzen gebracht, oder die trübe Aussicht, die nothwendig das Bett eines einsamen, kranken Reisenden umgibt, erhellt hätte. Obgleich aber das Fieber, von dem ich drei Monate lang frei gewesen, diesmal stärker als gewöhnlich auftrat, so war ich doch nicht sehr traurig darüber, da ich jetzt die liebevolle, väterliche Güte des vortrefflichen Mannes, dessen Kamerad ich war, genoss.
Am nächsten Morgen, nachdem ich vom Fieber etwas genesen und Mukamba mit einem aus einem Ochsen, einem Schaf und einer Ziege bestehenden Geschenk angekommen war, konnte ich den Antworten, welche er auf die Fragen über den Rusizi-Fluss und das Ende des Sees gab, meine[S. 126] Aufmerksamkeit schenken. Der stets muntere und enthusiastische Mgwana befand sich auch da und war durchaus nicht beschämt, als uns der Häuptling durch ihn sagen liess, dass der Rusizi, der sich in einer Entfernung von zwei Tagereisen zu Wasser, oder einer Tagereise zu Lande von der Spitze des Sees mit dem Ruanda oder Luanda verbinde, in den See fliesse.
So wurden unsere, durch die bestimmten und wiederholten Versicherungen, dass der Fluss aus dem See heraus nach Karagweh fliesse, erregten Hoffnungen ebenso schnell zu Schanden, wie sie erweckt worden waren.
Wir bezahlten Mukamba das aus 9 Doti und 9 Fundo Samsam, Lunghio und Muzurio N’zige bestehende Honga. Hier wären die gedruckten Taschentücher, deren ich in Unyanyembé so viele hatte, gut gegangen. Nachdem der Häuptling sein Geschenk erhalten, führte er seinen Sohn, einen hoch aufgeschossenen Jüngling von ungefähr 18 Jahren bei dem Doctor ein als einen Menschen, der gern von ihm adoptirt werden möchte. Dieser aber wies mit einem gutmüthigen Lachen alle solche Verwandtschaft von der Hand, da sie nur dazu bestimmt war, ihm noch etwas Tuch abzunehmen. Mukamba beruhigte sich dabei und bestand nicht darauf, mehr zu bekommen.
Am zweiten Abend unseres Aufenthalts bei Mukamba hatte sich Susi, der Diener Livingstone’s, infolge der freigebigen, reichlichen Gaben des Häuptlings an Pombé gründlich betrunken. Gerade beim Morgengrauen des nächsten Tages wurde ich durch ein scharfes, knallendes Geräusch erweckt. Ich horchte auf und bemerkte, dass der Lärm in unserer Hütte stattfand. Er rührte vom Doctor her, der um Mitternacht gefühlt hatte, wie sich jemand an seine Seite niedergelegt; da er glaubte, ich sei es, hatte er in freundlicher Weise Platz gemacht und sich auf den Rand seines Bettes gelegt. Als er aber am Morgen sich ziemlich kalt fühlte, wurde er ganz wach und entdeckte, als er sich auf seinen Ellenbogen stützte, um zu sehen, wer sein Bettkamerad sei, zu seiner grossen Verwunderung seinen schwarzen Diener Susi, der von seinen wollenen Decken Besitz ergriffen, sie in egoistischer Weise um sich gewickelt hatte[S. 127] und jetzt fast das ganze Bett einnahm. Der Doctor hatte mit der ihm eigenen Sanftmuth, statt sogleich einen Stock zu nehmen, sich daran genügen lassen, Susi auf den Rücken zu klopfen und ihm zu sagen: „Susi, steh auf, Du befindest Dich in meinem Bett. Wie kannst Du Dich in dieser Weise betrinken, nachdem ich es Dir schon so oft verboten? Steh doch auf! Du willst nicht? Da hast Du was!“ und damit gab er ihm einige Schläge mit der Hand. Susi aber schlief und schnarchte weiter. Daher fuhr der Doctor mit seinen Schlägen fort, bis selbst Susi’s dickes Fell sie zu fühlen anfing und er zu dem Bewusstsein erwachte, wie wenig liebevolle Hingabe für seinen Herrn darin liege, dass er dessen Bett usurpirt habe. Am nächsten Tage sah Susi wegen dieser Mittheilung seiner Schwäche an den „kleinen Herrn“, wie ich hiess, sehr niedergeschlagen aus.

In der Dämmerung des nächsten Tages setzten wir uns in unser Boot und ruderten über den See, nachdem Mukamba uns Lebewohl gesagt und gebeten hatte, sobald wir seinen[S. 128] Bruder Ruhinga, dessen Gebiet am Ende des Sees liege, erreicht hätten, ihm unsere Nachen zuzuschicken und mittlerweile zwei unserer Leute mit ihren Flinten bei ihm zu lassen, um seine Vertheidigung zu unterstützen, im Fall dass Warumaschanya ihn sofort nach unserer Abreise angriffe. In neun Stunden waren wir am Ende des Sees in Mugihewa, dem Lande Ruhinga’s, des ältern Bruders Mukamba’s, angekommen. Als wir dahin zurückblickten, wo wir hergekommen, bemerkten wir, dass wir, anstatt einen directen, ostwestlichen Curs einzuhalten, in der Diagonale von Südwesten nach Nordwesten gefahren seien. Mit andern Worten, wir waren von Mugere, welches wenigstens zehn Meilen vom nordöstlichsten Punkt der Ostküste entfernt ist, nach Mugihewa, das am nördlichsten Punkt der westlichen Küste liegt, gekommen. Wären wir längs der Ostküste um das nördliche Ufer des Sees gefahren, so wären wir bei Mukanigi, dem Lande des Warumaschanya, und Usumbura, dem des Simveh, seines Freundes und Verbündeten, vorbeigekommen. Durch unsere eben beschriebene diagonale Richtung hatten wir das äusserste Ende des Sees ohne irgendwelche Schwierigkeiten erreicht.
Das Land Mugihewa, in dem wir uns jetzt befanden, liegt im Delta des Rusizi-Flusses. Es ist ein sehr flaches Land, dessen höchster Punkt nicht zehn Fuss über dem See liegt, und hat zahlreiche Senkungen, die vom üppigsten Mateterohr und hochgeschossenen Papyrus bewachsen sind, sowie teichartige Vertiefungen, die, von stehenden Wassern erfüllt, massenweise Malaria-Ausdünstungen verbreiten. Grosse Viehheerden werden hier gezogen, denn wo der Boden nicht von Sumpfpflanzen bedeckt ist, erzeugt er gutes, kräftiges Gras. Die Schafe und Ziegen, namentlich erstere, sind immer in gutem Zustande und obgleich man sie nicht mit englischen oder amerikanischen vergleichen kann, so sind sie doch die schönsten, die ich in Afrika gesehen habe. Auf diesem Boden sieht man zahlreiche Dörfer, weil der dazwischen liegende Raum nicht von den üppigen wuchernden Dschungels, die in andern Theilen Afrikas gewöhnlich sind, besetzt ist. Nur die abessinische Euphorbia Kolquall, welche ein Häuptling hier zur Vertheidigung um[S. 129] die Dorfschaften hat anpflanzen lassen, hindert daran, von einem Ende von Mugihewa bis ans andere zu sehen. Das Wasser am Ende des Sees vom westlichen bis zum östlichen Ufer wimmelt von Krokodilen. Vom Ufer aus zählte ich zehn Krokodilköpfe und der Rusizi soll auch ganz voll davon sein.
Ruhinga, der uns bald nachdem wir in seinem Dorfe Quartier aufgeschlagen, besuchte, war ein sehr liebenswürdiger Mann, dem es stets gelang, irgendetwas zu sehen, das seine Lachlust reizte. Obgleich er etwa 5–6 Jahre älter als Mukamba war, — er selbst sagte, er sei 100 Jahre alt — hatte er nicht halb so viel Würde und wurde auch von seinem Volke nicht so sehr verehrt, wie sein jüngerer Bruder. Ruhinga kannte jedoch das Land besser, als Mukamba, hatte ein vorzügliches Gedächtniss und war im Stande, uns in intelligenter Weise Auskunft über dasselbe zu geben. Nachdem er uns als Häuptling die Honneurs gemacht und mit einem Ochsen und einem Schaf, nebst Milch und Honig beschenkt hatte, versuchten wir eifrig, so viel Kunde wie möglich von ihm zu bekommen.
Folgendes kann als der Hauptinhalt der von Ruhinga erhaltenen Nachrichten gelten:
Das an das Ende des Sees, im Osten an das eigentliche Urundi, im Westen an Uvira grenzende Land zerfällt in folgende Districte: erstens das von Mukamba beherrschte Mugere, durch welches sich die kleinen Flüsse Mugere und Mpanda in den See ergiessen. Zweitens das von Warumaschanya regierte Mukanigi, welches das ganze nordöstliche Ende des Sees einnimmt und durch das die kleinen Flüsse Karindwa und Mugera wa Kanigi in den See fliessen. Drittens liegt auf der östlichen Hälfte des am Ende des Sees befindlichen Gebietes das von Simveh, dem Freunde und Bundesgenossen Warumaschanya’s beherrschte Usumbura und erstreckt sich bis zum östlichen Ufer des Rusizi. Viertens zieht sich vom westlichen Ufer des Rusizi bis an das äusserste nordwestliche Ende des Sees Mugihewa, das Land Ruhinga’s. Fünftens liegt westlich von Uvira Ruwenga, welches sich nördlich an Mugihewa vorbeizieht, dasselbe bis an die Berge von Tschamati hin überragt und gleichfalls von[S. 130] Mukamba beherrscht wird. Jenseits Ruwenga, von den Bergen von Tschamati bis zum Fluss Ruanda, liegt das Land Tschamati. Westlich von Ruwenga liegt Uaschi, welches alle die Berge, die auf einem zweitägigen Marsch in jener Richtung liegen, einschliesst. Das sind die kleinern Unterabtheilungen des Gebiets, welches als Ruwenga und Usige bekannt ist. Ruwenga umfasst die Länder Ruwenga und Mugihewa; Usige die Länder Usumbura, Mukanigi und Mugere. Doch bilden alle diese Länder nur einen Theil von Urundi, welches alles Land in sich schliesst, das vom Mschala-Fluss im Osten bis nach Uvira im Westen den See begrenzt und sich zehn Tagereisen direct nördlich von dem Ende des Sees und einen Monat in nordöstlicher Richtung bis nach Murukuko, der Hauptstadt Mwezi’s, des Sultans von ganz Urundi, erstreckt. Gerade im Norden von Urundi befindet sich Ruanda, ebenfalls ein sehr grosses Land.
Der Rusizi-Fluss entsteht nach dem Berichte Ruhinga’s in der Nähe eines Kivo genannten Sees, der nach seiner Aussage so lang, wie von Mugihewa bis Mugere, und so breit wie von Mugihewa bis nach dem Lande Warumaschanya’s oder etwa 18 Meilen lang und 8 Meilen breit ist. Dieser See wird an seinen westlichen und nördlichen Ufern von Bergen umgeben. An der südwestlichen Seite eines dieser Berge entspringt der Rusizi, der zuerst ein kleiner rascher Bach ist. In seinem weitern Verlauf zum See nimmt er folgende Flüsse auf: Kagunissi, Kaburan, Mohira, Nyamagana, Nyakagunda, Ruviro, Rofubu, Kavimvira, Myove, Ruhuha, Mukindu, Sange, Rubirizi, Kiriba und schliesslich den Ruanda-Fluss, welcher der grösste von allen zu sein scheint. Der See Kivo führt seinen Namen von dem Lande, in dem er liegt. Auf der einen Seite befindet sich Mutumbi (wol das Utumbi von Speke und Baker); im Westen Ruanda; im Osten Urundi. Der Name des Häuptlings von Kivo ist Kwansibura.
Nach so vielen genauen Einzelheiten über den Fluss Rusizi erübrigte uns nur noch, ihn selbst zu sehen. Am zweiten Morgen nach unserer Ankunft in Mugihewa wählten wir zehn starke Ruderer aus und machten uns daran, das[S. 131] Ende des Sees und die Mündung des Rusizi zu erforschen. Wir fanden, dass das nördliche Ende des Sees von sieben breiten Buchten ausgezackt ist, von denen eine jede 1½–3 Meilen breit ist. Lange und breite Sandvorsprünge, die von Matete überwachsen sind, trennten jede Bai von der andern. Die erste, von Westen nach Osten anfangend, war im breitesten Theile, bis an den äussersten südlichen Punkt Mugihewa ungefähr drei Meilen breit und dient als Demarcationslinie zwischen dem Bezirke Mukamba’s Ruwenga und Ruhinga’s Mugihewa; die Länge derselben beträgt zwei Meilen. Die zweite Bucht war eine Meile von dem südlichen Ende von Mugihewa bis nach Ruhinga’s am Kopfe der Bucht belegenem Dorfe und nur noch eine Meile bis zu einer andern Sandzunge, an deren Spitze eine kleine Insel lag. Die dritte Bucht erstreckte sich fast eine Meile lang nach einer langen Düne, an deren Ende wiederum eine 1¼ Meile lange Insel lag, welche die westliche Seite der vierten Bucht bildet, an deren Spitze sich das Delta des Rusizi befindet. Diese vierte Bucht war an ihrer Basis ungefähr drei Meilen tief und zog sich eine halbe Meile weiter ins Land hinein als die übrigen. Sondirungen ergaben eine Tiefe von sechs Fuss, die sich einige hundert Schritt von der Hauptmündung des Rusizi gleichblieb. Der Strom war sehr trägfliessend und lief nicht mehr als eine engl. Meile in der Stunde. Obwol wir beständig unser Glas brauchten, um den Fluss aufzufinden, konnten wir den Hauptkanal desselben nicht eher sehen, als bis wir uns ihm auf 200 Schritt genähert hatten und ihn dann nur daran erkennen, dass wir beobachteten, aus welcher Mündung die Fischerboote herauskamen. Die Bucht hatte sich an diesem Punkte von zwei Meilen auf etwa 200 Meter Breite verengert. Wir forderten ein Boot auf, uns den Weg zu zeigen und aus blosser Neugier der Besitzer fuhr uns eine ganze Flottille von Canoes voran. Wir folgten und fuhren in einigen Minuten den Strom hinauf, der sehr rasch, aber nur ungefähr zehn Meter breit und ungemein seicht, nicht mehr als zwei Fuss tief war. Ungefähr eine halbe Meile ruderten wir hinauf, wo der Strom sehr stark war, 6–8 Meilen in der Stunde floss, und kamen weit genug, um die Natur desselben bei seiner[S. 132] Mündung beobachten zu können. Hier konnten wir sehen, dass er weiter wurde und sich in unzählige Kanäle spaltete, die an einzelnen Gruppen von Binsen und Matetegras vorüberströmten, und dass er wie ein Morast aussah. Wir waren den mittleren oder Hauptkanal hinaufgefahren. Der westliche Kanal war ungefähr acht Meter breit. Nachdem wir zur Bucht zurückgekehrt waren, bemerkten wir, dass der östlichste Kanal ungefähr sechs Meter breit und zehn Fuss tief, aber sehr träge sei. So hatten wir jede der drei Mündungen untersucht und unsern Zweifel über den Charakter des Rusizi als Aus- oder Zufluss erledigt. Jetzt war es nicht mehr nöthig, weiter hinaufzufahren, da sich im Flusse selbst nichts Erforschenswerthes befand.
Die Frage, ob der Rusizi ein Aus- oder Einfluss sei, ist auf immer beantwortet. In dieser Beziehung herrscht jetzt kein Zweifel mehr. An Grösse ist er mit dem Malagarazi-Flusse nicht zu vergleichen, auch kann er nur für die allerkleinsten Boote schiffbar gemacht werden. Das einzige Merkwürdige an ihm ist, dass er von Krokodilen wimmelt, wogegen kein einziges Flusspferd sich sehen liess. Dies kann gleichfalls als ein Beweis seiner Seichtheit gelten. Die Buchten im Osten des Rusizi sind ebenso gebildet wie die im Westen. Wenn man die Breite der verschiedenen Buchten von einer Spitze zur andern und der sie trennenden Dünen genau in Rechnung bringt, so kann der See ungefähr 12–14 Meilen breit sein. Hätten wir uns einfach daran genügen lassen, einen Blick auf seine Gestaltung und den Zusammenstoss der östlichen und westlichen Hügelkette zu werfen, so hätten wir behauptet, der See ende in einem Punkte, wie Kapitän Speke ihn auf seiner Karte gezeichnet hat. Die genauere Erforschung desselben hat aber diese Idee zu Schanden gemacht. Der Tschamati-Berg ist der äusserste nördliche Endpunkt der westlichen Kette und scheint bei oberflächlicher Untersuchung an die Ramata-Berge der östlichen Kette, die dem Tschamati gegenüberliegen, zu stossen; doch trennt ein etwa eine Meile breites Thal die beiden Höhenzüge und durch dieses fliesst der Rusizi dem See zu. Der Tschamati bildet zwar das Ende der westlichen Hügelkette, die östliche dehnt sich aber Meilen lang[S. 133] weiter nach Nordwesten hin. Nachdem der Rusizi aus dieser breiten Oeffnung herausgetreten, läuft er scheinbar als breiter, mächtiger Strom in hundert Kanälen durch eine weite, von ihm selbst gebildete Alluvialebene, bis er in der Nähe des Sees, wie oben beschrieben, nur durch drei Kanäle in denselben hineinfliesst.

Ich darf es nicht unterlassen, hier zu sagen, dass, obwol Livingstone und ich gegen den starken Strom des Rusizi, der rasch in den Tanganika fliesst, zu kämpfen gehabt haben, der Doctor doch der Ueberzeugung lebt, dass, welche Rolle auch der Rusizi spielen möge, der Tanganika doch irgendwo einen Ausfluss haben müsse, weil alle Süsswasserseen Ausflüsse haben. Livingstone kann seine Ansichten und Gründe hierfür viel besser als ich auseinandersetzen, und um nicht über den Gegenstand falsch zu berichten, will ich ihn ruhen lassen, bis Livingstone selbst Gelegenheit hat, sich darüber auszusprechen, was er vermöge seiner grossen Kenntniss Afrikas sachkundiger zu thun vermag.
Mir und, wie ich glaube, auch dem Doctor ist jetzt eins klar, dass nämlich Sir Samuel Baker den Albert Nyanza um einen, wenn nicht zwei Breitengrade wird verkürzen müssen. Dieser berühmte Reisende hat seinen See weit in das Gebiet der Warundi hineingezeichnet und Ruanda an sein östliches Ufer verlegt; während ein grosser Theil desselben, wenn nicht das ganze, nördlich von dem Theil gezeichnet werden müsste, den er auf seiner Karte als Usigé bezeichnet. Die Aussage eines so intelligenten Mannes wie Ruhinga ist nicht zu verachten; denn wenn der Albert-See bis auf hundert Meilen in die Nähe des Tanganika käme, so würde jener gewiss von seinem Dasein gehört haben, sogar wenn er ihn nicht selbst gesehen hätte. Ruhinga ist ursprünglich von Mutumbi gekommen und von diesem Lande nach Mugihewa, dem Bezirk, den er jetzt beherrscht, gereist. Er hat Mwezi, den grossen König von Urundi, gesehen und beschreibt ihn als einen etwa vierzigjährigen, sehr guten Mann.
Unsere Aufgabe war jetzt beendigt; es gab nichts mehr, was uns in Mugihewa zurückhalten konnte. Ruhinga war sehr[S. 134] freundlich gegen uns gewesen und hatte uns einen Ochsen nach dem andern zum Schlachten und Essen geschenkt. Dasselbe hatte Mukamba gethan. Ihre Frauen versahen uns reichlich mit Milch und Butter und wir hatten jetzt bedeutende Vorräthe davon.
Livingstone hatte eine Reihe von Breiten- und Längenbeobachtungen angestellt, nach denen Mugihewa auf 3° 19′ südl. Breite liegt.
Früh am Morgen des 7. December verliessen wir Mugihewa und kamen an dem südlichen Ende der Katangara-Inseln vorüber in die Nähe der Hochlande von Uaschi, dicht an die Grenzlinie zwischen dem Gebiete Mukamba’s und Uvira. Diese soll von einer weiten Schlucht gebildet werden, in deren Tiefen sich ein Hain schöner geradstämmiger Bäume befindet, aus denen die Eingeborenen Canoes verfertigen.
Am Kanyamabengu-Flusse vorbei, welcher dicht an dem Markt von Kirabula in den See fliesst, dem äussersten Punkte, wo Burton und Speke den Tanganika untersucht haben, steuerten wir südlich dem westlichen Ufer des Flusses entlang noch eine halbe Stunde weiter nach Kavimba, wo wir halt machten, um unser Frühstück zu bereiten.
Das Dorf, wo Mruta, König von Uvira, lebt, war von unserm Lager aus zu sehen, und da wir Leute die Berge häufiger auf- und absteigen sahen, als für uns von guter Vorbedeutung zu sein schien, beschlossen wir, unsere Fahrt nach Süden fortzusetzen. Ausserdem trafen wir eine trostlos aussehende Anzahl Wadschidschi, die einige Tage vor unserer Ankunft deshalb geplündert worden waren, weil sie, wie die Wavira glaubten, es versucht hatten, Hongazahlungen auszuweichen. Dergleichen Thatsachen und unsere Kenntniss von der allgemeinen im Lande herrschenden Unsicherheit, die von vielen in den Bezirken des Tanganika wüthenden Kriegen herrührten, bestimmte uns, nicht in Kavimba anzuhalten.
Ehe die Wavira sich versammelt hatten, begaben wir uns rasch in unser Boot und wandten uns nach Süden einem starken Winde entgegen, der gerade von Südwesten hertrieb. Nachdem wir etwa zwei Stunden, dem sich rasch[S. 135] erhebenden Sturm entgegen, anstrengend gerudert hatten, wandten wir unser Boot in eine kleine, ruhige, unter hohen Buchen fast verborgene Bucht und begaben uns für die Nacht ans Land.
Mit den uns umgebenden Gefahren vertraut und wohl wissend, dass der unversöhnliche Wilde unser schlimmster Feind sei, verwandten wir unsere ganze Kraft auf die Errichtung eines starken Zaunes von Dornbüschen, setzten uns darauf zum Abendessen und legten uns nieder. Vorher hatten wir jedoch Wachen für unser Boot ausgestellt, damit die kühnen Diebe von Uvira es nicht stehlen könnten, in welchem Falle wir in eine böse Lage gekommen wären.
Bei Tagesanbruch verliessen wir nach unserm einfachen, aus Kaffee, Käse und Dourra-Gebäck bestehenden Frühstück die Spitze Kukumba und steuerten noch einmal nach Süden. Obwol unsere Feuer die Aufmerksamkeit der scharfsichtigen, argwöhnischen Fischer von Kukumba auf sich gezogen, hatten sich unsere Vorsichtsmassregeln sowie die von uns ausgestellte Wache als wirksam gegen die Diebe von Uvira bewährt.
Auf unserer Weiterfahrt zeigten sich die westlichen Ufer des Sees als höher und kühner, wie die Waldhöhen von Urundi und die struppigen Erhebungen von Udschidschi. Zwischen den gekerbten Spitzen der vordern Berglinie zeigte sich ein dahinter liegender Höhenzug, der Vortrab der Berge, die sich weiter ins Land erheben, der eine Höhe von 2500–3000 Fuss über dem See erreichte. In den Einschnitten der vordern Gebirgsreihe streben einzelne Berge von bedeutender Höhe plötzlich steil empor und sind in landschaftlicher Beziehung höchst malerisch. Die meisten dieser Berge haben abgerundete, glatte oder auch tafelförmige Gipfel. Der Bergrücken, den sie bilden, lässt hie und da Vorsprünge von mehr allmählich absteigenden Contouren als Vorgebirge in den See treten. So oft wir um diese Punkte herumfuhren, nahmen wir mit dem Compass die Lage der Gegend auf und beobachteten die Richtung aller interessanten, hervorragenden Gegenstände. Oft werden diese Caps von Alluvialebenen gebildet, durch welche bestimmt ein Fluss fliesst. Diese hübschen Alluvialebenen,[S. 136] die von Süden, Westen und Norden von einem grossartigen Bergbogen umgeben werden, bieten eine üppige, bezaubernde Landschaft dar. Die Vegetation scheint hier von selbst zu wachsen. Gruppen der Palme Elaeis Guinensis hüllen ein dunkelbraunes Dorf ein; eine Reihe majestätischer, herrlich gewachsener Mvule-Bäume, eine weite von lebhaft grünen Sorghumstauden bedeckte Fläche, fallschirmartig belaubte Mimosen, ein schmaler Streifen weissen Sandes, auf welchen Boote der Eingeborenen weit ausserhalb des Bereiches der wogenden, unruhigen Brandung hinaufgezogen sind; Fischer, die träge im Schatten eines Baumes liegen: das sind die Scenen, welche sich uns auf der Fahrt in unserm Canoe auf dem Tanganika darboten. So oft wir von der Romantik solcher wilden Tropenlandschaft ermüdet waren, brauchten wir nur das Auge zu den grossen Gebirgsgipfeln zu erheben, die in düsterer Majestät rechts aus der Ferne herüberschauen; die leichten Zeichnungen der Federwolke zu beobachten, die ihre Gipfel streift und durch den Wind nach Norden getrieben wird; oder die Verwandlungen zu betrachten, welche die Wolken annehmen, wie sie aus diesen leichten Flocken in die dichtem, finstern Haufenwolken übergehen, den Vorläufer von Sturm und Regen, die sich bald in eine unheilschwangere Gruppe aufeinandergethürmter Alpen verwandeln und uns mahnen, dass der bisher brauende Sturm da und es Zeit sei, ein Unterkommen zu suchen.
Hinter Muikamba sahen wir verschiedene Gruppen von hohen Mvule-Bäumen. Bis nach Bemba hin werden die Berggipfel von den Wabembe bewohnt, wogegen die Wavira die Alluvialebenen längs des Flusses und der niedrigern Abhänge des Gebirges bebauen. In Bemba hielten wir an, um Stückchen von Pfeifenthon mitzunehmen in Uebereinstimmung mit dem Aberglauben der Wadschidschi, welche meinen, dass man eine gute, glückliche Ueberfahrt hat, wenn man nach dieser alten Sitte verfährt.
Hinter Ngovi kamen wir an eine tiefe Bucht, welche sich im Bogen bis zu dem zehn Meilen entfernten Cap Kabogi hinzieht. Nachdem wir etwa zwei Drittel des Weges zurückgelegt, gelangten wir an eine Gruppe von drei sehr steilen Felsinselchen, von denen die grösste etwa 300 Fuss[S. 137] Länge und 200 Fuss Breite an ihrer Basis hatte. Hier machten wir Vorbereitungen, um die Nacht zu bleiben. Die Inseln wurden von einem buntgefiederten alten Hahn, der als Sühnopfer für den Geist der Insel gehalten wurde, von einer kränklichen, gelb aussehenden Drossel, einem hammerköpfigen Storch und zwei Fischhabichten bewohnt, welche, als sie entdeckten, dass wir von dem Orte Besitz genommen, der ihnen nach frommer Sitte vorbehalten war, auf die westlichste Insel fortflogen, von wo aus sie uns feierlich von ihren Horsten weiter beobachteten.
Da wir den Namen dieser Inseln Kavunvweh nur mit Mühe aussprechen konnten, nannte sie Livingstone, da er glaubte, dass sie die einzige von uns zu machende Entdeckung sein würden, die „New York-Herald-Inseln“ und bekräftigte mir diesen neuen Namen durch einen Händedruck. Durch sorgfältigen Ueberschlag wurde ihre Lage als auf 3° 41′ südl. Breite befindlich festgestellt.
Der Gipfel der grössten Insel war sehr geeignet zur Aufnahme der Gegend, und wir benutzten diese Gelegenheit, da wir einen sehr ausgedehnten Rundblick auf den breiten, länglichen See und die denselben umgebenden hohen Gebirgszüge genossen. Die Ramata-Berge zeigten sich deutlich und lagen nordnordöstlich davon; Cap Katanga Südost zu Süd; Sentakeyi ostsüdöstlich; Magala Ost zu Nord; der südwestliche Punkt der Muzimu-Insel zeigte nach Süden, der nördliche nach Südsüdost.
Mit dem Morgengrauen des 9. December bereiteten wir uns auf unsere Weiterreise vor. In der Nacht waren wir einigemal von Fischern besucht worden, die jedoch durch unsere ängstliche Wachsamkeit am Raube verhindert worden waren. Es schien mir aber, dass die Bewohner des andern Ufers, die uns besuchten, eifrig auf eine Gelegenheit warteten, über unser Boot herzufallen oder uns persönlich als Beute fortzuschleppen. Durch diesen Gedanken wurden unsere Leute bedeutend beunruhigt, wenn man nach der Energie, mit der sie von unserm letzten Lagerplatze fortruderten, urtheilen darf.
Am Cap Kabogi kamen wir in das Gebiet der Wasansi. Dass wir einem andern Stamm uns gegenüberbefanden, erfuhren[S. 138] wir durch die Begrüssungsformel „Moholo“, die uns eine Gruppe Fischer zurief. Die Begrüssung der Wavira heisst nämlich „Wake“, ebenso wie auch in Urundi, Usige und Uhha.
Bald darauf kamen wir in Sicht von Cap Luvumba, einem absteigenden Vorsprung eines Gebirgsrückens, der weit in den See hineinragt. Da ein Sturm im Anzuge war, steuerten wir in eine gemüthliche, kleine Bucht, die vor einem Dorfe lag, zogen unsern Nachen aus dem Wasser, schlugen das Zelt auf und bereiteten uns für die Nacht vor.
Da die Eingeborenen ruhig und höflich zu sein schienen, hatten wir keinen Grund, anzunehmen, dass sie gegen Araber und Wangwana feindselig gesinnt seien. Wir liessen also unser Frühstück kochen und legten uns darauf, wie gewöhnlich, zu einem Nachmittagsschläfchen hin. Bald schlief ich ein und träumte in meinem Zelt, ohne von dem Streit und Zank, der, seitdem ich mich gelegt, entstanden war, etwas zu ahnen, als ich eine Stimme mir zurufen hörte: „Herr, Herr! stehen Sie rasch auf, soeben fängt ein Kampf an!“ Ich sprang auf und spazierte, nachdem ich meinen Revolvergürtel rasch vom Flintenständer genommen, hinaus. Wirklich schien eine erhebliche Feindseligkeit zwischen den beiden Parteien, nämlich einer lärmenden, rachsüchtig aussehenden Anzahl Eingeborener und unsern Leuten zu bestehen. Sieben oder acht der Unsrigen hatten sich hinter dem Boot versteckt und ihre geladenen Gewehre halb auf die leidenschaftlich erregte Masse gerichtet, die jeden Augenblick sehr an Anzahl zunahm; den Doctor aber konnte ich nirgends sehen.
„Wo ist der Doctor?“ fragte ich.
„Er ist mit seinem Compass über jenen Berg gegangen“, sagte Selim.
„Ist jemand bei ihm?“
„Susi und Dschumah.“
„Bombay, schicke sofort zwei Leute an den Doctor, damit er hierher eile.“
Doch gerade in diesem Augenblick erschien er und seine beiden Leute auf dem Abhang eines Berges und blickte in ruhiger Weise auf die tragikomische Scene, die das kleine[S. 139] Becken, in welchem wir lagerten, darbot. Denn trotz des ernstlichen Aussehens derselben mischte sich wirklich manches Komische hinein, da ein nackter, vollständig betrunkener Jüngling, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, den Boden mit seinem einzigen Lendentuche schlug und wie ein Toller schrie und wüthete. In seiner eigenen vorzüglichen Sprache schwor er hoch und theuer, kein Mgwana oder Araber dürfe sich auch nur einen Augenblick auf dem geheiligten Boden von Usansi aufhalten. Auch sein Vater, der Sultan, war ebenso betrunken wie er, aber nicht ganz so heftig in seinem Betragen.
Mittlerweile kam Livingstone herab und Selim hatte mein gezogenes Winchestergewehr gefüllt mit Patronen in meine Hand gesteckt. Ruhig erkundigte sich der Doctor, was vorläge, und erhielt von den Wadschidschiführern die Antwort, die Leute wünschten, dass wir fortzögen, da sie Feinde der Araber seien, weil der älteste Sohn des Sultans von Muzimu, der grossen fast gegenüberliegenden Insel, von einem Belutsch namens Khamis in Udschidschi zu Tode geprügelt worden sei, als der junge Mensch es gewagt, in den Harem des andern hineinzusehen. Seit der Zeit sei der Friede zwischen den Wasansi und Arabern gebrochen.
Nach Berathschlagung mit den Führern kamen wir zu dem Schluss, dass es besser sei, den Versuch zu machen, den Sultan durch ein Geschenk zu beruhigen, als sich durch die überspannte Laune eines betrunkenen Jungen beleidigt zu fühlen. Dieser hatte in seiner unsinnigen Wuth den Versuch gemacht, einen meiner Leute mit einer Sichel, die er bei sich trug, zu verletzen. Dies galt als Kriegserklärung und die Soldaten waren zum Kampf bereit; es lag jedoch keine Nothwendigkeit vor, sich mit dem betrunkenen Pöbel in einen Kampf einzulassen, der, wenn wir es gewünscht, mit unsern blossen Revolvern von der Stelle hätte verscheucht werden können.
Der Doctor entblösste seinen Arm und sagte, er sei weder Mgwana noch Araber, sondern ein Weisser; die Araber und Wangwana unterschieden sich von uns durch die Farbe. Wir Weissen seien in jeder Beziehung andere Menschen, als die, welche sie zu sehen gewohnt seien. Kein[S. 140] Schwarzer habe je von einem Weissen etwas zu leiden gehabt. Diese Rede schien eine grosse Wirkung hervorzubringen, denn es bedurfte nicht vieler Worte, um den betrunkenen Jüngling und seinen ebenso berauschten Vater zu bewegen, Platz zu nehmen und ruhig zu sprechen. In ihrer Unterhaltung mit uns bezogen sie sich häufig auf Mombo, den Sohn Kisesa’s, des Sultans von Muzimu, der in brutaler Weise ermordet worden sei. „Ja, brutal ermordet!“ riefen sie wiederholt in ihrer eigenen Sprache aus, indem sie durch eine ausdrucksvolle Pantomime andeuteten, wie der unglückliche Jüngling gestorben sei.
Livingstone setzte seine Unterhaltung mit ihnen in milder, väterlicher Weise fort und eben liessen ihre lauten Proteste gegen die Grausamkeit der Araber nach, als der alte Sultan plötzlich aufstand, in sehr aufgeregter Weise hin und herlief, sein Bein auf dieser Wanderung absichtlich mit der scharfen Spitze seines Speeres verletzte und dann ausrief, die Wangwana hätten ihn verwundet!
Bei diesem Ausruf ergriff die Hälfte der versammelten Menge schleunigst die Flucht; ein altes Weib jedoch, das einen starken Stab trug, auf dessen Spitze das Bild einer Eidechse eingeschnitzt war, begann den Häuptling mit der ganzen Macht ihrer beweglichen Zunge zu schimpfen und ihm vorzuwerfen, er wünsche, dass sie alle getödtet würden. Andere Weiber kamen dazu und riethen ihm gleichfalls, ruhig zu sein und das Geschenk anzunehmen, das wir ihm gern geben wollten.
Offenbar gehörte nicht viel dazu, um alle in dem kleinen Thal anwesenden Leute zu einem blutigen Streit zu veranlassen. Das milde, geduldige Betragen Livingstone’s bewirkte jedoch vor allen Dingen, dass Blutvergiessen verhindert wurde, solange noch die geringste Aussicht für eine freundschaftliche Beilegung des Streites bestand, und schliesslich siegte es ob und es gelang, sowol den Sultan als seinen Sohn in froher Stimmung fortzuschicken.
Während der Doctor sich mit ihnen unterhielt und ihre wilden Leidenschaften zu beschwichtigen versuchte, liess ich das Zelt abbrechen, die Boote ins Wasser bringen und das Gepäck besorgen; und als die Verhandlungen freundschaftlich[S. 141] geschlossen waren, bat ich den Doctor ins Boot zu springen, da dieser Friede anscheinend nur eine Ruhe vor dem Sturm bedeute. „Ausserdem,“ sagte ich, „befinden sich etliche Feiglinge in unserm Boot, die im Fall einer abermaligen Störung sich nicht besinnen würden, uns beide hier zu lassen.“
Von Cap Luvumba fingen wir ungefähr um ½5 Uhr nachmittags an, quer über den See zu rudern; um 8 Uhr befanden wir uns gegenüber Cap Panza, dem nördlichen Ende der Insel Muzimu; um 6 Uhr morgens waren wir südlich von Bikari und ruderten auf Mukungu in Urundi los, wo wir um 10 Uhr morgens, nach einer 17½stündigen Ueberfahrt über den See ankamen, der, wenn man die Stunde zu 2 Meilen rechnet, in directer Entfernung etwa 35 engl. Meilen breit sein und dessen Länge vom Cap Luvumba bis hierher etwas mehr als 43 Meilen betragen kann.
Am 11. December kamen wir nach siebenstündigem Rudern wieder im malerischen Zassi an; am 12. in der südlichen Bucht von Niasanga, und um 11 Uhr vormittags waren wir um Bangwe gefahren und Udschidschi lag vor uns.
Still, ohne wie gewöhnlich Flinten abzuschiessen, da wir wenig Pulver und Kugeln hatten, fuhren wir in den Hafen. Bei unserer Landung kamen unsere Soldaten und die arabischen Grossen an den Rand des Wassers, um uns zu begrüssen.
Mabruki hatte viel zu erzählen, was in unserer Abwesenheit geschehen war. Dieser treue Mensch, der als Wache für Livingstone’s Haus zurückgelassen worden war, hatte sich vorzüglich aufgeführt. Kalulu hatte sich verbrüht und zeigte infolge dessen eine schrecklich aussehende Brandwunde auf seiner Brust. Mabruki hatte Marora in Ketten gelegt, weil er einen der Esel verwundet; der stotternde Feigling Bilali, ein Kerl, der stets den Weibern etwas vorrenommirte, hatte einen Tumult auf dem Marktplatz erregt und war von Mabruki tüchtig mit dem Stock bearbeitet worden. Vor allem willkommen war mir ein Brief des amerikanischen Consuls in Zanzibar vom 11. Juni,[S. 142] welcher Telegramme aus Paris vom 22. April desselben Jahres enthielt. Der arme Livingstone rief aus: „Und ich habe keine. Wie angenehm ist es, einen wirklich guten Freund zu besitzen!“
Unsere Reise auf dem Tanganika hatte 28 Tage gedauert, während welcher Zeit wir mehr als 300 Meilen zu Wasser zurückgelegt hatten.
[S. 143]
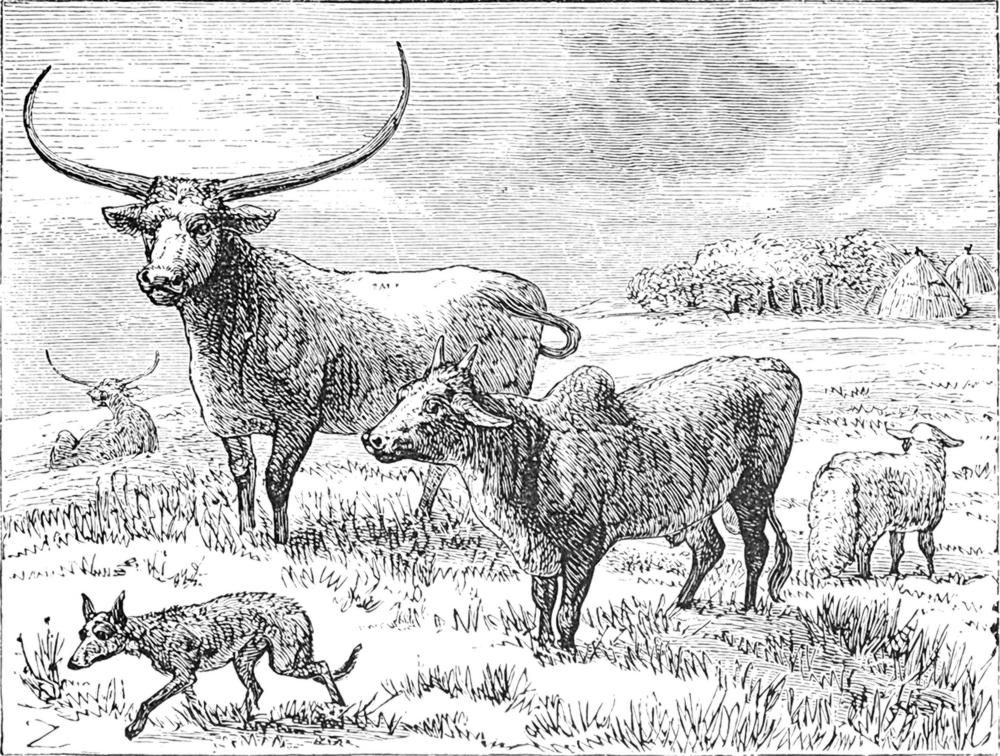
(Zweite Folge.)
In einem besondern Kapitel wollen wir jetzt besprechen, welche neuen geographischen und ethnographischen Thatsachen uns, seitdem wir Uyanzi oder Magunda Mkali verlassen, in Bezug auf die Länder Unyamwezi, Ukonongo, Ukawendi, Uvinza, Uhha, Ukaranga, Udschidschi, Urundi, Usowa, Ukaramba, Ugoma, Uguhha, Rua und Manyuema bekannt geworden sind.
Das erste Land, das wir zu betrachten haben, ist U-nyamwezi, in welchem das u von den Eingeborenen wie das deutsche u oder englische oo ausgesprochen wird. Ich erlaube mir in Bezug auf die eigentliche Bedeutung des Wortes von allen meinen Vorgängern abzuweichen. Die Herren[S. 144] Krapf und Rebmann, denen die Welt die erste Anregung zur Erforschung des Innern Ostafrikas verdankt, übersetzen das Wort U-nya-mwezi als das „Land des Mondes“, wobei U immer das Praefixum für „Land“ ist, nya „von“ und mwezi „Mond“ bedeutet. Auch der gelehrte Kapitän Burton scheint sich derselben Ansicht zuzuneigen und Speke nimmt dieselbe Interpretation unbedenklich an. Bei aller Achtung für die tüchtigere Kenntniss Afrikas, welche diese Herren im Vergleich zu mir besitzen, möchte ich doch denen, die Freunde davon sind, Finessen wie diese zu discutiren, meine Meinung dahin äussern, dass man einem Kinyamwezi-Wort eine Kiswahili-Definition gegeben hat. In der Kiswahili-Sprache nämlich würde das Land des Mondes Umwezi genannt werden; dagegen ist Unyamwezi ein Kinyamwezi-Wort und kann nicht wegen der Aehnlichkeit der letzten beiden Silben mit dem wohlbekannten Kiswahili-Worte mwezi, das „Mond“ bedeutet, so gedeutet werden. Wenn wir uns übrigens das Kiswahili als Maassstab nehmen, um das Wort U-nya-mwezi zu deuten, so könnten wir ebenso gut die andere Bedeutung der letzten beiden Silben mwezi, welches in der Kiswahili-Sprache ebenso wol Dieb wie Mond heisst, annehmen.
Kapitän Burton sagt, Herr Desborough Cooley ziehe die Bedeutung „Herr der Welt“ für das Wort Unyamwezi vor, welches er „Monomoezi“ buchstabirt. Zwar ziehe ich Cooley’s Deutung der von Burton gegebenen vor, dennoch erlaube ich mir auch von Herrn Cooley in Bezug auf die Genauigkeit der Uebersetzung abzuweichen. Soweit ich von Wanyamwezi und Arabern, die das Land genau kennen, erfahren, lebte einmal ein König in Ukalaganza — was der ursprüngliche Name des Landes ist, unter welchem auch die westlichen Stämme es allein kennen — welcher Mwezi hiess und das ganze Land von Uyanzi bis Uvinza beherrschte. Er war damals der grösste König, niemand konnte vor ihm in der Schlacht bestehen, keiner herrschte so weise wie er. Nach dem Tode dieses grossen Königs aber kämpften seine Söhne unter sich um den Besitz der höchsten Gewalt, und in den verschiedenen darauf folgenden Kriegen wurden die Districte, welche die Söhne für sich gewonnen hatten, im[S. 145] Laufe der Zeit mit verschiedenen Namen bezeichnet und von dem mittlern und grössern Theil des Landes, welches noch den alten Namen Ukalaganza behielt, unterschieden. Das Volk von Ukalaganza aber, das den vom alten König Mwezi eingesetzten Erben anerkannte, wurde nach und nach als Kinder von Mwezi und das Land als Unyamwezi bezeichnet, während die andern Districte Konongo, Sagozi, Gunda, Simbiri u. s. w. hiessen. Zur Unterstützung dieser Theorie, die sich auf eine mir vom alten Häuptling von Masangi, das am Wege nach Mfuto liegt, mitgetheilte Erzählung gründet, will ich nur anführen, dass der Name des jetzigen Königs von Urundi Mwezi ist; und es ist bekannt, dass der Name fast jedes Dorfes in Afrika einfach von einem lebenden oder todten Beherrscher abgeleitet wird. Als Beispiel mögen die folgenden dienen: das Dorf Misonghi heisst von Kwihara bis Bagamoyo Kadetamare, was der Name seines Häuptlings ist; Kapitän Burton kann diese Thatsache bestätigen, da er den Namen Kadetamare auf seiner eigenen Karte hat. Der District Nyambwa in Ugogo verliert rasch seinen alten Titel und ist allgemeiner als Pembera Pereh bekannt, was der Name des altersschwachen Sultans von Nyambwa ist. Mrera in Ukonongo ist der Name des Häuptlings, wogegen der District früher als Kasera bezeichnet wurde. Mbogo oder „Büffel“ hat gleichfalls seinen Namen einem grossen bevölkerten Districte in Ukonongo gegeben. Dann finden wir noch Pumburu, den Namen eines benachbarten Häuptlings von Mapunda in Usowa. Uganda schwindet rasch gegen den berühmten Namen des Königs Mtesa dahin und in einigen, vielleicht schon nach zehn Jahren werden spätere Reisende die Araber vom grossen Lande Unyamtesa oder Umtesa sprechen hören. Ich widersetze mich also entschieden der poetischen Deutung von Unyamwezi als „Land des Mondes“, oder der übelmeinenden als „Land des Diebes“; denn Unyamwezi bedeutet einfach „das Land Mwezi’s“.
Aufs entschiedenste weiche ich auch von Kapitän Burton darin ab, dass er annimmt, dass „Nimeamaye“, ein Land, das vom holländischen Historiker Dapper als 60 Tagereisen vom Atlantischen Ocean geschildert wird, Unyamwezi sein[S. 146] kann. Denn ein zu Pferde Reisender konnte die Entfernung vom Atlantischen Ocean nach Unyamwezi sogar 1671, also vor 200 Jahren, wo das Land sich noch bis auf zehn Tagereisen vom Tanganika erstreckte, nicht in 60 Tagen zurücklegen; wohl aber hätte ein von keiner Last beschwerter Eingeborener vielleicht Manyuema in der Zeit erreichen können und Nimeamaye ist wol eine Verstümmelung, die daraus entstanden ist, dass man den richtigen Laut Manyuema oder Manyuemaye falsch aufgefasst hat.
Gegenwärtig dehnt sich Unyamwezi von Osten nach Westen in gerader Entfernung ungefähr 145 Meilen weit aus, d. h. vom Fluss Ngwhalah zwischen Mgongo Tembo und Madedita, auf 34° östl. Länge, bis Usenye, auf 31° 25′ östl. Länge, welches als das westlichste Ende von Ukalaganza oder Unyamwezi angesehen wird; und von Norden nach Süden, vom südlichen Ende des Victoria Nyanza auf 3° 51′ südl. Breite bis zum Gombé-Flusse, auf 5° 40′ südl. Breite, also 149 geographische Meilen lang, sodass es eine quadratische Fläche von mehr als 24500 Meilen einnimmt.
Dieser grosse Flächenraum zerfällt in verschiedene Districte: Unyanyembé, Usagari, Ugunda, Ugara, Nguru, Msalala, Usongo, Khokoro, Usimbiri, Nasangaro, Ugoro u. s. w. Von diesen ist Unyanyembé, sowol wegen seiner centralen Lage als auch wegen starker Bevölkerung, der bedeutendste in Unyamwezi. Das im Norden von Unyanyembé wohnende Volk ist als Wasukuma bekannt, das im Süden lebende als Watakama. Die letztere Bezeichnung wird selten in Unyanyembé, aber häufig von den Wasukuma gebraucht.
Ueberhaupt kann man Unyamwezi als das schönste Land im östlichen Central-Afrika bezeichnen. Es ist ein grosses, wellenförmiges Tafelland, das nach Westen sanft zum Tanganika abfällt, der das Wasser des grössten Theils desselben aufnimmt. Wer sich das Land aus der Vogelperspective ansähe, würde Wälder, einen in Purpur gefärbten Laubteppich erblicken, der hier und da von nackten Ebenen und lichten Strecken unterbrochen wird, die sich nach allen Himmelsrichtungen erstrecken; hin und wieder erheben sich Massen von felsigen Bergen, die wie abgestumpfte[S. 147] Kegel über die sanften, sich bis an den Horizont hinziehenden Landwellen emporragen, welche sich wie die Wogen eines Meeres nach einem Sturm ausnehmen. Stellt man sich auf irgendeinen hervorstehenden Punkt, auf einen der riesigen Syenitblöcke, die aus dem Kamm der Berge um Mgongo Tembo oder den Felsbuckeln von Ngaraiso hervorragen, so wird man eine Landschaft erblicken, wie man sie nie vorher gesehen. Es gibt dort keine erhabenen, grossartigen Berge; nichts malerisches bietet sich dem Blick dar; man könnte die Landschaft sogar prosaisch, monoton nennen, denn man hat dieselbe schon hundertmal gesehen, ehe man nach Uyanzi gekommen; aber gerade in dieser übermässigen Eintönigkeit liegt das Erhabene. Denn der zu Schaum und wilden Wogen gepeitschte Ocean ist erhaben; ebenso ist es aber auch der unter der Aequatorialsonne schlummernde, der das tiefe Blau des Firmaments widerspiegelt und sich ohne eine Spur von Kräuselung weit ausdehnt. In gleicher Weise liegt etwas Erhabenes in diesem Anblick der grossen, ewigen, anscheinend unendlichen Ausdehnung von Wäldern in Unyanyembé. Das Laub ist von allen Farben des Prismas; wenn sich die Wälder aber in die Ferne hinziehen, umhüllt sie ein stiller, geheimnissvoller Dunst und lässt sie zuerst hellblau, dann allmählich dunkelblau erscheinen, bis sie in der Ferne verschwimmen. Blickt man auf diese hinschwindenden Umrisse, so verfällt man unwillkürlich in eine träumerische Stimmung, die in ihren Umrissen ebenso unbestimmt ist wie die Aussicht am Horizont. Ich behaupte, dass sich niemand eine solche Landschaft lange ansehen kann ohne zu wünschen, dass auch sein Leben so heiter dahinschwinden möge, wie die Contouren der Wälder in Unyamwezi.
In der Seegegend fanden wir eine Art pisolitischen Kalkstein; in Ugogo Thonschiefer und Syenit in abwechselnden Schichten; in Unyamwezi dagegen erheben sich die ungeheuern, glatten Schichten, welche sich uns in Uyanzi mit kahlen Buckeln zeigten, zu massigen Hügeln oder grossen verwitternden Bruchstücken von Felsmassen, die natürlich durch den Reichthum der Vegetation, die ihre rauhen, unebenen Linien dem Menschenblick entzieht, gemildert werden.
[S. 148]
In Unyamwezi gibt es nur zwei Flüsse, die diesen Namen verdienen, nämlich der nördliche und südliche Gombé. Der nördliche, unter dem Namen Kwala, bisweilen auch Wallah bekannte Fluss entsteht südlich von Rubuga und tritt, nachdem er in einem nordwestlichen Bogen dahingeflossen, im Norden von Tabora in den Gombé, der hier selbst ein Strom von ziemlicher Grösse und Wichtigkeit ist. Mit guten, leichten Booten kann man sich im letzten Theil der Regenzeit ohne Schwierigkeit etwa acht Meilen von Tabora einschiffen und glücklich bis zum Tanganika fahren; natürlich nur, wenn alle Stämme es zugeben. In dieser Weise könnte eine gut ausgerüstete Expedition Wunder bewirken.
Der Nghwhalah-Fluss — als nördlich von Kusuri entspringend bekannt und den Weg nach Unyanyembé oft durchschneidend, wie man sehen kann, wenn man nach Tura kommt — schlägt einige Meilen östlich von Madedita eine stetige Richtung nach Süden ein, zieht durch Nguru, wird dann in Manyara wieder sichtbar und ist hier als südlicher Gombé bekannt, der jedoch nur während der Höhe der Regenzeit fliessendes Wasser enthält. Von Manyara läuft er nach dem Lande Ugala in der Richtung Nord zu West und nimmt vor seiner Verbindung mit dem Malagarazi die Ströme Mrera und Mtambu auf, die, nachdem sie die östliche Basis der Rusawa-Berge umsäumt haben, nach Nordosten gegen das Parkland von Uvenda nach dem Gombé fliessen.
Alle andern Bäche, die in Unyamwezi wenig zahlreich und ohne Bedeutung sind, entsenden ihre Gewässer entweder in den nördlichen oder südlichen Gombé. Gewöhnlich bekommt man das Wasser aus grossen Pfuhlen oder tiefen, länglichen Höhlungen, die man in Indien Nullahs, in Amerika dagegen Gullies (Rinnen) nennen würde. Wo Nullahs und Pfuhle fehlen gräbt man sich Gruben, aus welchen man ein blass milchartig aussehendes Wasser erhält. Diese Farbe des Wassers wird von dem Eingeborenen von Unyamwezi als ein sicheres Zeichen der Güte angesehen und er legt seine Bewunderung dieser Eigenschaft an den Tag, indem er auf die Frage, ob das Wasser gut ist, mit Inbrunst antwortet: „o miope sana“, „o, es ist ganz[S. 149] weiss!“ woraus man natürlich entnehmen soll, dass es sehr gut sei.
Die Erzeugnisse der Wälder von Unyamwezi sowie von Ukonongo und Uvinza sind ähnlich denen von Uyanzi, nämlich die allen baumbewachsenen Hochlanden in der Nähe des Aequators gemeinsamen.
Der riesigste Baum, den man zwischen Uyanzi und dem Tanganika findet, ist der Mtamba, wilde Feigenbaum, der ebenso gross wird wie die mächtigen Baobabs von Ugogo. Er trägt eine angenehme Art Feigen, welche, wenn sie reif sind, von den Eingeborenen gern gegessen werden. Doch gibt es dieser Sykomoren nur wenige und sie stehen weit auseinander. Andere in den Wäldern häufig vorkommende Bäume werden durch die Kiswahili-Worte Mtundu, Miombo, Mkora, Mkurongo, Mbembu, Mvule, Mtogwe, Msundurusi, Mninga, Mbugu, Matonga bezeichnet.
Erfinderischerweise haben die Eingeborenen für sie alle Nutzanwendungen gefunden. Der Imbite bildet Balken, die so schön wie die der Ceder sind und sich zierlich schnitzen lassen. Aus ihm fertigt man auch Thüren und geschnittene Säulen, welche sich den Veranden entlang ziehen. Das Holz duftet sehr angenehm und seine dunkelröthlichen mahagoniartigen Streifen, die mit blassgelben abwechseln, sehen sehr hübsch, ja prächtig aus.
Der Mkora ist ein schöner, grosser Baum, der in den Wäldern von Ugogo und einigen Theilen Ukonongos zu stattlichen Proportionen heranwächst; aus ihm schnitzen sich die Eingeborenen sehr mühselig den Kiti oder Sessel, der bei den Aeltesten und Häuptlingen Afrikas so allgemein im Gebrauch ist, sowie auch die grossen Mörser, in welchen das Dourra oder Sorghum, Korn und Mais zu Mehl gestampft wird.
Der Mkurongo ist der Baum, aus welchem die Stange bereitet wird, deren sich die Eingeborenen in ganz Central-Afrika als Mörserkeule für das Zerstampfen des Korns bedienen. Es ist härter und dauerhafter als das weisse amerikanische Wallnussholz und hat, wenn es polirt ist, ein weisslich glänzendes Aussehen.
Der Mbugu bringt die weiche, nützliche Rinde hervor,[S. 150] aus welcher die Eingeborenen ihre Tuche verfertigen. Die Rinde wird, nachdem sie gut eingeweicht worden, zerstampft und bietet dann, nachdem sie etwas getrocknet und abgerieben ist, das Aussehen eines dicken, losen Filzes dar. Auch werden bisweilen Seile daraus gemacht; noch häufiger aber wird sie zur Fabrikation von Kirindos oder runden Schachteln gebraucht, die wie urwüchsige Hutschachteln aussehen und mit einer Mischung verschiedener Lehmsorten bemalt und verziert werden. Diese Kirindos sind bisweilen riesig und werden zur Aufspeicherung von Korn gebraucht und über dem Boden von einem starken Unterbau von Holzblöcken unterstützt, damit die Ameisen nicht heran können. Die Rinde des Mbugu bildet auch vortreffliche Dächer und wird oft von den Familienvätern oder luxuriöseren Jünglingen benutzt, um eine Kitanda oder rohe Bettstelle zu machen. Aus der Rinde dieses Baumes bauen sich auch die am Rufidschi wohnenden Warori ihre Boote.
Aus dem Mvule-Baume verfertigen sich die Seestämme ihre Canoes. Die grössten auf dem Tanganika befindlichen sind erheblich mehr als 60 Fuss lang. Seine bedeutendste Grösse erreicht der Baum in den Schluchten von Ugoma, das auf dem westlichen Ufer Udschidschi gegenüber liegt. Uvira, Urundi und Usowa besitzen auch sehr schöne Exemplare desselben. Es ist eine mühselige Arbeit, diese Bäume umzuhauen und ihre enormen Holzblöcke zu Booten auszuhöhlen; denn es gehören mehr als drei Monate dazu, ehe ein Canoe fertig wird, um in See zu stechen. Während der Aushöhlung des ungeheuern Blocks macht der Besitzer längs der obern Seite desselben eine Anzahl Feuer aus den Abfällen und bittet seine Nachbarn, ihm für etwas Korn oder Palmöl dabei behülflich zu sein. Wenn das Boot bereit ist in See zu gehen, braut er einige Töpfe Pombé und ladet alle seine Nachbarn ein, es auf den See zu bringen. Nach jedem angestrengten Versuch stärken sich diese mit dem einheimischen Bier und machen sich wieder mit erneuter Kraft und grossem Geschrei an die Arbeit. Man kann ein grosses Canoe für 120 Doti Tuch oder einen Ballen von etwa 75 Pfund Gewicht kaufen; wenn die Araber und Wadschidschi aber sich ein Boot kaufen wollen, so nehmen sie[S. 151] gewöhnlich verschiedenerlei Waaren mit, z. B. ein Dutzend Töpfe Palmöl, ein Dutzend Ziegen und eine Anzahl verschiedenartiger Zeuge, einige Hacken und einige Beutel voll Salz und Korn, wodurch der Handel vortheilhafter wird.
Die übrigen Bäume, welche die Wälder Central-Afrikas hervorbringen, sind der Kolquall oder Kandelaberbaum; der Msundurusi oder Kopalbaum, welcher in Ukawendi häufig vorkommt; der Moumbo oder Palmyra; der Miombo; die schöne, duftende Mimose; der Mtundu; und an den Ufern des Tanganika-Sees sieht man auch den herrlichen Guinea-Palmbaum, welcher Mtschikitschi heisst, und die Platane.
Das Palmöl wird aus der Frucht der Palme ausgezogen, welche an dieser nach Art der Dattel herabhängt. Jene wird gestossen und gekocht und das Oel wird, nachdem es abgekühlt, in grossen irdenen Töpfen gesammelt, die zehn bis zwanzig Liter enthalten. Für vier Meter oder ein Doti Tuch kauft man sich den grössten Topf Palmöl, welches wie weiche, gelbe, ockerfarbige Butter aussieht. Die Wadschidschi und andere bedienen sich oft dieses Oels zum Kochen.
Aus demselben Baum, der Guineapalme, zieht man einen berauschenden Saft, der Tembo heisst und ein viel angenehmeres Getränk als das Pombé oder Bier ist.
Platanen kommen auch häufig in allen an den See grenzenden Dörfern vor. Der Zogga genannte Punsch wird durch das Einstampfen von Platanen in den grossen, hölzernen Mörsern, in denen die verschiedenen Kornarten zu Mehl gestossen werden, bereitet.
Pflanzen aus den Familien der Cacteen und Aloë sieht man im ganzen Lande, besonders aber in den dürren Ebenen von Ugogo und des südlichen Uvinza.
Die Tamarindenbäume sind in allen Wäldern häufig, erreichen aber ihre grösste Höhe in Usagara und westlich von Unyanyembé. Aus ihren Früchten bereitet man, wenn man sie in Wasser taucht, ein angenehmes säuerliches Getränk.
Die Tamarisken und verschiedenen Arten Akazien verdienen auch eine Erwähnung, wenn man nur dafür Raum hätte. Die letztern wachsen überall und werden den Karavanen wegen ihrer weit ausgebreiteten Zweige sehr lästig.[S. 152] Die Dornen- und Gummibäume sind den Reisenden mit am schädlichsten; die ersteren starren von allerlei bösen Dornen. Eines Tages packte ein solches zudringliches Gewächs meinen Dolmetscher Selim, als er an der Ruhr erkrankt daher ritt, am Halse und brachte ihm ganz nahe an der Gurgelader eine hässliche Wunde bei, von der er bis an sein Lebensende eine Narbe behalten wird.
Von Fruchtbäumen gibt es hier den Mbembu oder Waldpfirsich, die Matonga oder Brechnuss, die Tamarinde, die Singwe oder Waldpflaume, den Mtogwe oder Waldapfel, und in Ukawendi sind zahlreiche Arten Trauben. Ausserdem kommen aber noch eine Menge in diesem Boden heimische Gattungen vor, von denen einige gefährlich, andere unschädlich sind, deren Namen und Eigenschaften ich jedoch nicht erfahren konnte.
Unter den von den Arabern von Unyanyembé in ihren Gärten gepflanzten und sorgfältig gezogenen Obstbäumen befinden sich der Papaw, die Guava, die Limone, Citrone, Granate, der Mango, die Banane und die Orange.
Die Hauptnahrungsmittel der verschiedenen in Unyamwezi und den westlichen, bis zum See Tanganika sich erstreckenden Länder bilden das Matama (Kiswahili) oder Dourra (arabisch) oder Dschowar (hindostanisch), welches nach Linné den Namen Holcus sorghum führt; das Badschri (Holcus spicatus); die Hirse (Panicum italicum); das Maweri oder Sesam und der Mais. Ausserdem gibt es zahlreiche Hülsenfrüchte, von denen jedoch die Wicke, sowie die Feld- und grosse Gartenbohne die gewöhnlichsten sind. In Unyanyembé und Udschidschi kommt der Reis in grossen Mengen vor, während der Weizen nur von den Arabern erbaut wird.
Süsse Kartoffeln, Yamswurzeln und Maniok sind in Unyanyembé und Udschidschi und in einigen Theilen von Ukawendi in Ueberfluss. Zuckerrohr gedeiht in Udschidschi.
Es gibt hier nur eine Erntezeit, welche am Tanganika im April, in Unyamwezi im Mai und in der Seegegend im Juni stattfindet.
Baumwolle, Taback und die Ricinuspflanze werden überall in den Centralgegenden gezogen. Kürbisse und[S. 153] Gurken sind gleichfalls zahlreich und in Menge vorhanden. Der Indigo wächst wild.
Unter den in Central-Afrika einheimischen Sträuchern, Pflanzen und Grasarten sind der wilde Thymian und Salbei, die Stechpalme und Sonnenblume, der Cayenne-Pfeffer, der Ingwer, die Kurkuma, der Oleander und die Gloriosa superba (in der Nähe des Tanganika) anzuführen; ebenso die Mohnblume, die in der Umgegend der Dörfer von Ukawendi wild wächst, sowie der wilde Senf und Curry. In den grossen den See begrenzenden Waldungen sieht man hunderte von verschiedenartigen, blühenden Sträuchern, wundervolle, süsse Düfte aushauchend. Unter den Gräsern befinden sich das Habichtskraut, Ochsenauge, die in Indien als Bhota bekannte Grasart, das Nagelkraut und ausserdem noch viele üppige Arten, wie z. B. das Tiger- und Speergras.
Den Lotus, die Wasser- und blattlosen Lilien trifft man in den stillen Seen des Gombé und den Pfuhlen von Ukawendi an.
Papyrus- und Mateterohr wächst am Rande aller unbewohnten, auf den Alluvialebenen der Ufer des Tanganika befindlichen Plätze. Die Aeschinomenae oder Markbäume sieht man an den Mündungen der grossen, sich in diesen See ergiessenden Flüsse.
Da die Grenzen, die mir in diesem Kapitel gezogen sind, mich daran hindern, auf einen detaillirten zoologischen Bericht der Säugethiere und Vogelgattungen Central-Afrikas einzugehen, so werden die Leser es mir verzeihen, wenn ich kurz bin.
Ich werde mit den Vierhändern, als den am höchsten organisirten Thieren, anfangen.
Von diesen ist der grösste der Wanderu-Pavian. Er zeichnet sich durch Grösse und löwenartiges Aussehen aus. In der Entfernung ähnelt er einem kleinen Löwen und sein heiseres, dumpfes Brüllen in den dichten Wäldern von Ukawendi dient nicht wenig dazu, die Täuschung zu vermehren. Eine lange, gräuliche Mähne umgibt ihm Kopf und Hals. Sein Rückenhaar ist dunkelgrau mit hellbraun gemischt; sein langer Schwanz endet büschelförmig. Er wohnt in grossen, ausgehöhlten Bäumen und Höhlen. Diese Gattung haben[S. 154] wir in der Nähe der Quellen des Rugufu gesehen. An einigen weiter westlich liegenden Zuflüssen desselben Flusses erblickten wir zahlreiche Exemplare dieses Pavians, die aber eine gelbbraune Farbe hatten.
Auf diesen folgt der grosse, hundeähnliche Pavian, von dem ich im vorhergehenden Kapitel eine Beschreibung gegeben habe. In Ukawendi und dem westlichen Ukonongo finden sich auch kleinere Arten mit schwarzen Gesichtern, die dem Tota Abessiniens ähnlich sind. Sie sind sehr beweglich und klettern vorzüglich, leben in Heerden zusammen und nähren sich von wilden Beeren, Mbembu oder Waldpfirsichen und Insekten.
Von grössern Katzenarten haben wir den Löwen und Leoparden in den Wäldern von Ukawendi gesehen. Das Fell des Löwen gehört stets dem Sultan. Der Löwe bewohnt die dicken Holzumgürtungen an den Bächen und wird auch überall da in den Waldgegenden gefunden, wo es Jagdthiere gibt.
Das Geheul der gefleckten Hyäne liess sich auf unserer Reise durch Afrika besonders in Utanda und Ugogo allnächtlich hören. Dieses Thier ist von der Grösse eines Bullenbeissers und hat einen mächtigen Kopf, der sehr starke Kinnladen aufweist. Seine Farbe ist ein schmutziges mit Grau vermischtes Gelbbraun, das von schwarzen, verblasst aussehenden Flecken bedeckt ist. Die Ohren sind gross, dick und gleichfalls schwarz gefleckt. Das Zahnsystem ähnelt dem des Hundes; doch hat die Hyäne drei falsche Backenzähne in der obern Reihe und vier in der untern. Diese Zähne sind mit furchtbaren Schneidespitzen bewaffnet, die sie in den Stand setzen, die grössten Knochen zu zermalmen.
Die von uns gesehenen Schakals ähneln unsern Prairie-Coyoten und ihr Geschrei ist ebenso scharf und bellend. Sie sind, was ihre Schnauze betrifft, Füchsen ähnlich und haben dicke, buschige Schwänze. Ihre Farbe ist dunkelgrau.
Ausserdem sahen wir Elefanten, Rhinozeros, Kameloparden oder Giraffen, Zebras, Hartebeests, Elenn, Büffel, Springböcke, Pallahs oder Wasserböcke, schwarze Antilopen, gesprenkelte Gnu, röthliche und bleifarbene Schweine und[S. 155] wilde Eber, Hyrax oder Kaninchen, Kudus (Antilope strepsiceros), kleine Perpusilla oder Blauböcke und zahlreiche Reit- oder Rothböcke (Antilope eliotragus). Da ich diese schon beschrieben habe, so ist es unnöthig, meine Bemerkungen hier zu wiederholen. Doch kann ich hier erwähnen, dass ich viele Prairiehunde oder Erdeichhörnchen an den Ufern des Rugufu und des Gombé gefunden habe. Auch sahen wir im Kingani, Gombé, dem Malagarazi und dem See Tanganika zahlreiche Flusspferde und Krokodile.
Von Hausthieren gibt es hier die in allen Ländern gewöhnlichen, darunter zweierlei Arten Ochsen, von denen die eine in Ugogo, Unyanyembé und Uhha anzutreffende durch einen zwischen den Schultern sitzenden Höcker, wie ihn der amerikanische Bison hat, ausgezeichnet ist; die andere, die wir nur in Udschidschi sahen, charakterisirt sich durch lange Beine, einen dünnen Körper und enorm lange Hörner.
Schafe sind bei allen Stämmen gewöhnlich und zeichnen sich durch breite, fette, schwere Schwänze aus. Auch Ziegen sind zahlreich und von verschiedenen Farben. Die schönsten, die Afrika aufzuweisen hat, sind die von Manyuema, welche kurze Beine und starke Leiber haben.
Die Esel, von denen viele in Ubanarama vorkommen, sind stark und gross, aber bösartig und wild.
In jedem Dorfe sieht man viele Hunde. Sie sind von der echten Pariarasse — feig und räudig.
Auch zahme Katzen kommen in jedem Dorfe zahlreich vor; sie müssen hier ein gutes Leben haben, da Ratten jedes von Menschen bewohnte Gebäude heimsuchen.
In Central-Afrika sind die Vögel ausserordentlich zahlreich. Die uns am häufigsten aufstossenden waren Fischadler, Bussarde, Weiher, Geier, weisshalsige Krähen, Turteltauben, Ortolane und sattelschnäblige Störche; am Gombé, Mpokwa und Rugufu: Ibis nigra und Ibis religiosa, Tukans, wilde Gänse (deren Flügel mit Sporen bewaffnet sind), wilde Enten, schwarze Madagaskarenten und Möven; am Tanganika-See: Reisvögel, Drosseln, hammerköpfige Störche, Pelikans, bleifarbene und mit Büschen auf dem Kopfe versehene Kraniche, Taucher, Königsfischer, ägyptische Gänse,[S. 156] geöhrte Silbertaucher, Meerschwalben, Perlhühner, Wachteln, Schneehühner (Ptarmigan) und Florikans. Auch habe ich in Ugogo Strausse, am See Ugombo Schwäne, am Tanganika, in der Nähe des Rusizi-Flusses, Schnepfen und Bachstelzen gesehen; und ausserdem grosse und kleine Eulen, Fledermäuse, Bartvögel, sowie Balaeniceps und Sandpfeifer. Sonst erkannte ich noch Wiedehopfe, Papageien, Dohlen, Zaunkönige, Rothdrosseln, goldene Fliegenfänger und die kleinen Federbuschreiher. Diese Liste ist, wie man wol sieht, viel zu lang, als dass ich mich auf eine Beschreibung der einzelnen Gattungen einlassen könnte.
Von Reptilien sahen wir eine grosse grüne Schlange, die Boa, und eine kleine Schlange mit silberfarbigem Rücken. Unzählig waren die Feldeidechsen; auch haben wir Schildkröten, Iguanas, Gymnopus, Kröten, Frösche und grosse essbare Süsswasserschildkröten gesehen.
Die hauptsächlichsten Insekten waren: die gewöhnliche Hausfliege, Moskitos, Flöhe, Läuse, Tsetse-, Pferde- und Viehfliegen, ungeheure Käfer, Drachenflügler, Taranteln, Garten- und Hausspinnen, gelbe Skorpione, Hundertfüssler, Tausendfüssler, Raupen, Seichameisen, weisse, rothe und schwarze Ameisen.
Im Tanganika gibt es sehr verschiedenartige Fische:
1. Den Wels, von den Wadschidschi Singa genannt, der nach ihren Berichten vier, ja sogar bis sechs Fuss lang wird. Ein Wels, den ich gezeichnet habe, war 38½ Zoll lang und wog 10¾ Pfund, galt aber für klein. Er ist ein sehr fetter Fisch, der auf dem Rücken schwarzbraun, am Bauche hellbraun ins weissliche spielend ist. Er hat keine Schuppen und gehört derselben Art an, die wir in Pfuhlen und Flüssen finden. Er wird zu hunderten im Gombéfluss gefangen, zerschnitten, getrocknet und zum Verkauf an Araber, mohammedanisirte Neger und Waswahili nach Unyanyembé gebracht.
2. Der nächste an Grösse und Bedeutung ist der schuppige Sangara, der für essbar gilt; der hier auf dem Holzschnitt dargestellte war 23 Zoll lang, mass 5½ Zoll um den Leib und wog 6½ Pfund.
3. Darauf kommt der Mvuro, ein dicker, fleischiger[S. 157] Fisch, der für vorzüglich gilt; er hat gleichfalls Schuppen. Der auf der Abbildung gezeichnete war 18 Zoll lang, hatte 15¼ Zoll Leibesumfang und wog 5¼ Pfund.

[S. 158]
4. Ein schuppiger, Tschai genannter Fisch, den ich abgezeichnet, war 9¼ Zoll lang, hatte einen Leibesumfang von 4 Zoll, eine grünliche Färbung auf dem Rücken und war am Bauche hell.
5. Ein schuppenloser, 7 Zoll langer, 4 Zoll breiter Fisch, der mit blassen, tintenartigen, ¼ Zoll breiten Streifen versehen ist, einen weissen Bauch hat und sehr hübsch aussieht, ist im See sehr zahlreich und wird täglich in Massen von den Fischern von Udschidschi gefangen.
6. Noch ein schuppenloser, 6 Zoll langer Fisch, mit silberfarbigem Bauch, schmeckt wie Forellen und ist sehr beliebt.
7. Ein Barsch, der meist 8 Zoll lang ist und 6 Zoll Leibesumfang hat, ist ein sehr trockener Fisch und wird nur von den Armen gekauft.
8. Ein kurzer, dicker Aal ist von zartem Geschmack. Der hier gezeichnete war 17 Zoll lang und hatte einen Leibesumfang von 4 Zoll.
Die eben genannten Gattungen sind die bedeutendsten Fische des Tanganika; es gibt aber noch eine Art, welche, obgleich die kleinste, doch mehr als jede andere dem Volk als Nahrung dient, nämlich der kleine Dogara, eine Art Clupea (Ellritze), die in grossen Netzen zu tausenden gefangen wird. Sie werden zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet oder gesalzen und in dieser Gestalt sogar bis nach Unyanyembé ausgeführt. Hier gibt es auch verschiedene Varietäten von Fischen, die wie die Sardinen der französischen Küste aussehen und mit Angelruthen oder Handnetzen gefangen werden. Auch werden auf den Märkten von Udschidschi Krabben und eine Art Austern feilgeboten.
Die den hier in Betracht kommenden Völkerschaften bekannten Metalle sind: Kupfer und Eisen. Das Kupfer wird von der Küste und aus Rua hergebracht; das bearbeitete Eisen aus Usukuma oder den nördlichen Staaten von Unyamwezi und aus Uvira. Alle Messingzierathen, die tief im Innern getragen werden, werden von den Eingeborenen aus dem dicken Messingdraht, den ihnen die Karavanen verkaufen, fabricirt. Zwar ist Eisenerz sehr häufig und kommt sogar an vielen Stellen zwischen Unyamwezi und[S. 159] Udschidschi offen zu Tage liegend zum Vorschein, wird jedoch selten bearbeitet, obgleich es Beispiele in Ukonongo und Uvinza gibt, dass die Eingeborenen das Erz schmelzen und sich selbst Eisen fabriciren.
Die Krankheiten, von denen die Eingeborenen im Westen von Unyanyembé am meisten heimgesucht werden, sind die acute und chronische Ruhr, die Cholera, das rückkehrende Fieber, Wechselfieber, der Typhus, das Nervenfieber, Herzkrankheiten, Rheumatismus, Lähmung, Pocken, Krätze, Augenentzündungen, Halsentzündungen, Schwindsucht, Kolik, Hautausschläge, Geschwüre, Syphilis, Tripper, Krämpfe, Mastdarmvorfall, Nabelbruch und Nierenentzündung.
Die fürchterlichste Geissel von Ost- und Central-Afrika sind aber die Pocken. Die gebleichten Schädel der Opfer dieser grausamen Krankheit, die an jeder Karavanenstrasse zu finden sind, zeigen nur zu deutlich die Verwüstung an, welche sie jährlich nicht nur in den Reihen der Handelsexpeditionen, sondern auch in den Dörfern der verschiedenen Stämme anrichten. Manche Karavanen werden durch sie decimirt und es gibt Dörfer, wo mehr als die halbe Bevölkerung ausgestorben ist. Dr. Livingstone hat manchen armen Afrikaner durch die Kuhpockenimpfung gerettet und sein Kummer über die täglichen Verwüstungen, welche die Pocken unter dem Volk anrichten, hat ihn dazu veranlasst, um Zusendung von Impfstoff zu bitten.
Die vom Volke selbst gebrauchten Arzneimittel sind entweder einfache Kräuter oder Abkochungen von Kräutern, die ihnen die Waganga oder Medicinleute geben. Der Medicinalgebrauch der Ricinuspflanze ist unbekannt. Das aus den Samen ausgezogene Oel wird nur zum Einsalben des Kopfes und Körpers gebraucht. Brechmittel bekommt man aus der Rinde eines gewissen Baumes und die Araber behaupten, dass sie sehr wirksam sind. Gegen Nierenkrankheiten setzen die Waganga eine Medicin aus der Wurzel einer Pflanze und den Blättern eines in der Nähe von Unyamwezi wachsenden Strauches zusammen, dessen Namen sie mir aber nicht nennen wollten, obgleich ich ihn für ein Tuch zu erkaufen suchte. Obwol ich einen Menschen diese Medicin einen Monat lang täglich benutzen sah, habe ich[S. 160] doch keine Wirkung davon beobachtet. Unter den Arabern wird gegen Nierenleiden Masticgummi in Wasser gekocht und jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Tasse voll davon, oder morgens und abends eine Tasse frischer Milch getrunken. Gegen Rheumatismus besteht die Cur darin, dass man sich in die Sonne legt oder tüchtig frottiren lässt. Die Kolik glaubt man dadurch zu curiren, dass man einen Finger weit in den Hals steckt und dadurch Brechen erzeugt. Gegen Ruhr werden warme Steine abwechselnd rund um den Unterleib gelegt. Kranke, die an miasmatischen Fiebern leiden, hüllen sich in Tücher ein und legen sich in die Sonne, bis Schweiss eintritt. Diese Behandlung habe ich unter den Leuten meiner eigenen Expedition mit dem Tode endigen sehen. Bei den Pocken wird die Quarantäne streng erzwungen und nur diejenigen, die schon früher die Pocken gehabt haben, wagen sich in die Nähe der Kranken. Mitglieder einer Karavane, die an Pocken leiden, werden aus der Gesellschaft der Gesunden ausgeschlossen und man weist ihnen besondere Behausungen ausserhalb des Lagers an. Bei den nachfolgenden Karavanen befinden sich jedoch immer leichtsinnige junge Burschen, die gedankenlos in solche Hütten hineingehen und nach einigen Tagen sich krank fühlen, über Mangel an Appetit, Schmerzen im Rücken und schleichendes Fieber klagen; und dann weiss man bald, dass sie erkrankt sind, worauf sie gleichfalls ausgeschlossen werden, und wenn sie nicht weiter gehen können, lässt man sie liegen, um zu sterben; denn keine Colonie duldet es, dass sie sich ihren Pforten nähern, und eine Karavane kann in der Wüste nicht halt machen. Wer in dieser Weise wie ein Verfluchter von den übrigen Menschen ausgestossen ist, sucht sich mit einem Vorrath an Nahrungsmitteln und Wasser ein Dickicht auf, baut sich eine Hütte und bleibt daselbst bis er gesund wird oder stirbt.
Nachdem man das schöne Parkland und die Wälder von Unyamwezi verlassen, befindet man sich in Ukonongo, das berühmt ist wegen seiner wilden Waldpfirsichbäume und des schönen Tekaholzes, sowie wegen der grossen Lager von Eisenerz, die man auf der Reise nach Süden und Westen häufig aus der Erde hervorragen sieht. Der östliche[S. 161] Theil desselben bildet nur die Fortsetzung des Parklandes von Unyamwezi; wenn man sich aber seiner westlichen Grenze, die an Ukawendi stösst, nähert, so fallen grosse Bergrücken sehr ins Auge, welche die Wasserscheide für den Fluss Mrera und die zahlreichen Sumpfschluchten, die sich nach der Rikwa-Ebene wenden, bilden.
Der erste Anblick, den man von den blauen kegelförmigen Bergen erhält, welche sich entweder einzeln oder zu dreien über die ausgedehnte, dem Vernehmen nach über den Rungwa-Fluss hinweg bis zu den Weideländereien der südlichen Watuta reichende Ebene erheben, ist sehr hübsch und angenehm, ja man könnte fast sagen malerisch. Viele Zuflüsse des Rungwa-Flusses entstehen gerade da, wo Ukonongo an Ukawendi stösst. Einige derselben entspringen im Bezirk von Kasera. Man hat mir gesagt, der Rungwa-Fluss sei so gross wie der Malagarazi und seine Hauptquelle läge in Central-Urori. Während der Regenzeit überflutet dieser Fluss die ihn umgebende Ebene, gerade wie der Mukondokwa es mit der Makata-Ebene thut. Daher hat Speke auf seiner Karte einen bläulichen Fleck, welcher die Rikwa-Lagune darstellen soll. Trotz vieler Anfragen über diesen Punkt habe ich doch nichts darüber erfahren können, ausser dass die Ebene während der Regenzeit von Wasser bedeckt ist.
Wenn es wahr wäre, dass der Rungwa in Central-Urori entsteht, dann müssten wir die Behauptung als wahrscheinlich annehmen, dass der Rufidschi oder Ruhwha-Fluss seine Quellen südwestlich von Ubena, an einer Gruppe von Bergen hat, die möglicherweise dieselben sind, aus denen der Chambezi entspringt.
Südlich von Ukonongo befindet sich das Gebiet der Watuta, südöstlich die Districte der Warori, südwestlich Ufipa und Karungu, westlich Ukawendi, nördlich Utakama oder die südlichen Provinzen von Unyamwezi.
Wir lernen in Ukawendi ein fast unbewohntes Land mit unregelmässiger Oberfläche kennen, das bewaldet, von zahlreichen schönen Bächen durchzogen, fruchtbar und von einer üppigen Fauna und Flora begünstigt ist. Die einzigen bedeutenderen Ansiedelungen sind die von Mana Msenge im Norden, von Ngondo und Tongwe im Westen, am Tanganika;[S. 162] die von Rusawa in der Mitte, Pumburu im Süden und Utanda im Südosten.
Die wichtigsten Flüsse sind der Rugufu, welcher in der Berggruppe nahe bei Pumburu entspringend parallel mit dem See durch ein tiefes Thal nach Norden und südlich vom Malagarazi in den See fliesst. Der nächste ist der Loadscheri, der zwischen den Höhenzügen von Kagungu und Pumburu entsteht und in der Nähe des Hauptdorfes Urimba in den See einmündet. Ausserdem gibt es noch zahlreiche Flüsse, wie den Uwelasia, Sigunga, Mviga und Kivoe.
Ukawendi, welches unter den Ländern der Centralgegend den dritten Rang einnimmt, erstreckt sich vom Malagarazi-Fluss ungefähr von 5° 10′ bis etwa zu 6° 18′ südl. Breite. Im Norden wird es vom südlichen Uvinza und dem Malagarazi-Flusse, im Osten von Ugara und Ukonongo, im Süden von Usowa und Ufipa und im Westen vom Tanganika-See begrenzt.
Nördlich von Ukawendi kommen wir in das südliche Uvinza, ein Land, das durch tiefe Schluchten mit wildem Gebirgscharakter und nach allen Richtungen von dunkeln, nackten Höhenzügen durchschnitten wird. Im Alluvialthal des Malagarazi findet man zahlreiche Salzgruben, aus denen die Eingeborenen erhebliche Mengen Salz zu Tage fördern. Nur wenig Flüsse fliessen durch das Land; unter den ihm eigenthümlichen Producten befinden sich Ziegen und Korn.
Jenseits des Malagarazi kommt man an einen länglichen, nach der geographischen Breite sich hinziehenden Streifen ärmlichen Landes, welches Nord-Uvinza heisst. Der Boden ist arm und nährt nur spärliche Gebüsche von Gummibäumen, Dornen, Tamarinden, Mimosen und wenige verkrüppelte Exemplare des Tekabaumes. Sehr ausgedehnt sind die Salzebenen, und der Besitz derselben und das ausschliessliche Recht auf sie veranlassen häufig Streitigkeiten zwischen den beiden grossen Häuptlingen Lokanda Mira und Nzogera.
Der Malagarazi ist an seinem Ursprung als der nördliche Gombé bekannt. Wo er durch die ausgedehnten Salzebenen fliesst, schmeckt sein Wasser leicht salzig, aber doch nicht unangenehm. Er fällt südlich von Udschidschi-Bunder[S. 163] in den Tanganika. Ich glaube, dass er durch Boote auf seinem ganzen Lauf vom See bis Wilyankuru schiffbar ist; in der Regenzeit ist er es bestimmt.
Nord-Uvinza wird von dem Weidelande Uhha im Norden, von Ukalaganza und Usagozi oder West-Unyamwezi im Osten, vom Malagarazi im Süden und von Ukaranga im Westen begrenzt.
Seine Hauptansiedelungen sind Mpete, Usenye, Yambeho, Siala, Isinga, Nzogera’s Insel und Lokanda Mira’s Bezirk. Die Hauptproducte sind Ziegen, Schafe, Korn und Salz.
Von Uvinza kommen wir nach Uhha. Dies ist ein grosses, ebenes Land, das mit den Prairien von Nebraska Aehnlichkeit hat. Es zerfällt in die zwei Abtheilungen von Kimenyi und Antari. Uhha, im weitesten Sinne des Wortes, wird nördlich von Ututa, südlich und östlich von Uvinza und westlich von Ukaranga und Udschidschi begrenzt.
Der Gebirgszug, welcher die Grenze zwischen Uhha und Ututa bilden soll, gibt zwei bedeutenden Strömen, dem Rusugi und Rugufu, ihren Ursprung. Andere Flüsse sind der Sunuzzi, Kanengi und Pombwé. Fast alle Flüsse, welche durch Uhha laufen, sind etwas salzig, namentlich der Pombwé, Kanengi und Rusugi.
Auf den kahlen Ebenen von Uhha leben grosse Heerden von Vieh mit Rückenhöckern und breitschwänzige Schafe. Auch die Ziegen sind hier sehr schön. Der Boden ist fruchtbar und bringt reiche Ernten von Holcus sorghum und Mais hervor. Das Klima ist gut und die Hitze wird durch die Luftströmungen vom Tanganika und durch die Winde von Usagara gemässigt.
Kleine Seen oder grosse Teiche sind ein charakteristischer Zug für Uhha. Sie nehmen ausgedehnte, seichte, kreisförmige Niederungen oder Becken ein. Es fehlt nicht an Beweisen, dass ein grosser Theil von Uhha einmal unter Wasser stand und das Thal des Malagarazi-Flusses nichts als ein tiefer Arm des Tanganika war. In dieser Gegend würde ein Geolog von Fach viel Interessantes finden.
Im Westen und jenseits des kleinen Flusses Sunuzzi kommen wir nach Ukaranga, einem Lande, das einen sehr[S. 164] verschiedenartigen Charakter darbietet. Im Norden, wo es an Nord-Uhha stösst, ist es gebirgig; im Süden bildet es eine längliche, ebene Abdachung, die von hohen Tekabäumen bedeckt wird; in seiner Mitte besteht es aus wellenförmigen Bergen, die von raschfliessenden, klaren Bächen durchzogen werden, ein fruchtbarer, herrlicher Bezirk. Vom Osten ziehen sich, in rechten Winkeln vor dem das nordöstliche Uhha von Ukaranga trennenden Gebirgsstocke nach Westen zu, eine Anzahl paralleler, mit Bäumen bewachsener Höhenzüge hin und enden plötzlich in der Nähe des Alluvialthals des Liutsché.
Die Bäume von Ukaranga sind hauptsächlich Teka-, Mbugu- und Bambusbäume; das Klima ist besonders mild und feucht. Ein beständiger Sprühregen scheint sich über die Gipfel der Ukaranga-Berge auszugiessen und daher entstehen die zahlreichen Bäche, die sich in den Liutsché ergiessen.
Von den Höhen von Ukaranga tritt man in das Liutsché-Thal hinab und befindet sich in Udschidschi, einem durch hervorragende Schönheit und Fruchtbarkeit ausgezeichneten District, und erblickt jenes mächtige Binnenmeer, dessen Ufer von jetzt ab als geheiligt zu betrachten sind, weil „die Stätte, die ein guter Mann betritt“ auf ewig geheiligt ist. Und in der That, die Natur unterstützt uns in unserer Liebe für die classischen Grenzländer des Tanganika. Niemand, er sei noch so prosaisch, kann an dem Strande von Udschidschi stehen und bei Sonnenuntergang nach Westen über den breiten, silbernen Wassergürtel blicken, ohne im tiefsten Herzen durch die Farben gerührt zu werden, welche die Sonne ihm am Himmel offenbart. Die Farben des Aethers kommen und vergehen mit zauberischer Schnelligkeit. Sie sind golden und azurfarben, rosa und silbern, purpurn und safrangelb; in dünnen Linien und breiten Streifen verwandeln sich Feder- und Haufenwolken in glänzendes, farbiges Gold; auf der riesigen, bläulich schwarzen Scheidewand, welche den Tanganika nach Westen begrenzt, strahlen sie ihren Glanz ab und offenbaren das ganze Gebirgspanorama, über welches sie liebliche rosa Farbentöne ausgiessen und das sie in einer Flut von Silberlicht baden.
[S. 165]
Der merkwürdigste Stamm Central-Afrikas sind die Wanyamwezi. Mein Ideal eines solchen ist ein schlanker Schwarzer mit langen Gliedern und gutmüthigem Gesicht, auf dem sich stets ein Lächeln zeigt. In der Mitte der obern Zahnreihe weist er eine kleine Lücke auf, die ihm als Knaben beigebracht worden, um seinen Stamm anzuzeigen. Hunderte langer, starrer Locken hängen ihm den Nacken herab; er ist fast nackt und zeigt eine Gestalt, die ein vorzügliches Modell für einen schwarzen Apollo abgeben würde. Ich habe viele Individuen dieses Stammes in der Kleidung der Freigelassenen von Zanzibar gesehen, in einem Turban von neuer, amerikanischer Leinwand oder im langen Disch-dascheh (Hemd) der Araber, die ebenso schön und intelligent aussahen, wie irgend ein Mswahili von der Küste von Zanguebar; aber was ich eben beschrieb, ist mein Ideal.
Der Mnyamwezi ist der Yankee von Afrika; er ist ein geborener Händler und Reisender. Seit undenklicher Zeit hat sein Stamm den Gütertransport von einem Lande ins andere als sein Monopol behandelt. Der Mnyamwezi ist das Kameel, das Pferd, der Maulesel und Esel, kurz das Lastthier, nach dem sich alle Reisenden sehnen, um ihr Gepäck von der Küste ins ferne afrikanische Innere bringen zu lassen. Der Araber kann ohne seine Hülfe nirgends hinziehen; der weisse Reisende, der eine Erforschungsexpedition macht, kann nicht ohne ihn auskommen. Meist findet man ihn in grosser Zahl in Bagamoyo, Konduchi, Kaole, Dar Salaam und Kilwa, wo er darauf wartet, für eine lange Reise gemiethet zu werden. Er ist wie der Matrose, der seinen Wohnsitz in gewissen Miethshäusern der grossen Seestädte hat, und gleicht ihm auch darin, dass er nirgends Ruhe findet. Die Seeküste ist einem Mnyamwezi, was New York für einen englischen Matrosen. In New York kann sich der englische Matrose gegen höhern Lohn verdingen; ebenso kann sich der Mnyamwezi an der Küste für seinen Rückweg mehr bezahlen lassen, als von Unyamwezi ans Meer. Es ist eine so grosse Nachfrage nach ihm und wenn es Krieg gibt, ist er so selten, dass sein Lohn hoch ist und 36–100 Meter Tuch beträgt. Hundert dieser menschlichen Lastthiere können dem Reisenden selbst nur für die dreimonatliche[S. 166] Reise bis nach Unyanyembé gegen 10000 Meter Tuch kosten. Dieses Tuch repräsentirt aber in Zanzibar 5000 Dollars Gold. Mit Geduld und strenger Oekonomie kann man sich aber dieselbe Zahl auch für 3000 Dollars verschaffen.
Auf dem Lualaba, in den Wäldern von Ukawendi, auf den Bergen von Uganda, den Gebirgen von Karagweh und in den Ebenen von Urori, auf dem Plateau von Ugogo, in dem Parklande von Ukonongo, in den Sümpfen von Useguhha, in den Engpässen von Usagara, der Wildniss von Ubena, und unter den Hirtenstämmen der Watuta, die Ufer des Rufidschi entlang, im sklavenhandelnden Kilwa, kurz überall in ganz Central-Afrika kann man die Wanyamwezi finden mit Ballen aus Zanzibar bepackt, welche Baumwollenwaaren und Fabrikate aus Massachusetts, Calicots aus England, gedruckte Baumwollenwaaren aus Muskat, Tuche aus Cutsch, Perlen aus Deutschland, Messingdraht aus Grossbritannien enthalten.
Wenn sie mit Karavanen ziehen, sind sie gelehrig und leicht zu behandeln; in ihren Dörfern findet man sie als ein lustiges Völkchen; auf ihren eigenen Handelsexpeditionen zeigen sie sich geschickt und scharfsinnig; als Ruga-Ruga sind sie gewissenlos und kühn; in Ukonongo und Ukawendi sind sie Jäger, in Usukuma Eisenschmelzer und Viehtreiber; in Lunda suchen sie energisch nach Elfenbein und an der Küste staunen sie schüchtern die neue Umgebung an.
Die Wanyamwezi sterben, wie ich fürchte, aus oder sie sind nach andern Ländern ausgewandert. Meine erste Behauptung gründe ich darauf, dass so grosse Landstriche verödet sind, wie z. B. Mgongo Tembo, Rubuga, Kigwa, Utanda, Mfuto, Masange und Wilyankuru. Unruhige und unzufriedene Geister wie Manwa Sera, Niongo, Mirambo und Oseto tragen durch ihre beständigen Streitigkeiten wesentlich dazu bei, Unyamwezi zu entvölkern. Auch sind die Strapazen der Reise, denen gerade die Blüte der Nation ausgesetzt ist, der Vermehrung des Volkes nicht günstig. Von zehn gebleichten Schädeln, die man an den Handelswegen im Innern erblickt, gehören acht unglücklichen Wanyamwezi an, die den Gefahren und Entbehrungen, die jeder Karavane auf dem Fusse folgen, unterlegen sind. Auch die Sklaverei[S. 167] mit ihren Schrecknissen trägt zur Demoralisation und Ausrottung dieses Volkes bei. Es ist traurig daran zu denken, dass ein Volk wie das kriegerische Geschlecht der Makololo noch innerhalb Menschengedenken, seit Livingstone zuerst Linyanti sah, vom Erdboden verschwunden ist. Wie mächtig könnte nicht eine philantropische Regierung dieses Volk machen! Welch herrliches Zeugniss könnte es nicht für die civilisatorische Menschenliebe werden! Was für gelehrige Convertiten für das Evangelium würde es abgeben, wenn ein praktischer Missionar sich zu ihm begäbe!
Gross ist in Unyamwezi die Macht der „Uganga“ (Medizin). Mir sagte man nach, dass ich im Stande sei, Regen zu machen, alle Brunnen im Lande zu vergiften und alle Krieger Mirambo’s mit einem Arzneipräparat zu tödten, bis ich mir die Mühe gab, diese mir zugeschriebene Macht in Abrede zu stellen. Anfangs brachten sie mir ihre Kranken, mit Geschwüren Behaftete, Syphilitische, Krätzige und an den Pocken Erkrankte, Schwindsüchtige und an der Ruhr Leidende, bis sie schliesslich durch meine ernstlichen Versicherungen sich davon überzeugten, dass ich für dieselben nichts thun könne. Ein an chronischer Dysenterie leidender Greis brachte mir ein schönes, fettes Schaf und eine Schüssel Tschoroko (Wicken) als Bezahlung für eine Kur seiner Krankheit. Ich hätte das Schaf nehmen und ihm eine werthlose Mischung dafür geben können, sagte ihm aber, dass ich für seine Krankheit nichts zu thun im Stande sei. Ich schenkte ihm jedoch ungefähr 100 Gran Dover’sches Pulver und einige Doti gutes Tuch zur Kleidung für sich und seine Frau, ohne sein Schaf zu nehmen, da mir des Mannes Leiden so sehr zu Herzen gingen.
Nie begibt sich eine Partie Wanyamwezi auf die Jagd, ohne vorher den Mganga (Medizinmann) zu Rathe gezogen zu haben, welcher sie gegen Entgelt mit Zaubermitteln, Tränkchen, Kräutern und Segenssprüchen versieht. Ein Stückchen vom Ohr eines Zebra, Löwenblut, die Klaue eines Leoparden, die Lippe eines Büffels, der Schwanz einer Giraffe, die Augenbraue eines Hartebeet sind Schätze, von denen man sich nur gegen Bezahlung trennt. Um den Hals hängen sie sich ein dreieckiges Stückchen polirten Quarzes oder[S. 168] Stückchen geschnitzten Holzes oder einen allmächtigen Talisman, der in einer Pflanze besteht, die eifersüchtig in einen ledernen Beutel eingenäht ist.
Im Ganzen sind die Wanyamwezi erzfeige. Ihre Karavanen stehlen sich demüthig durch Ugogo; wenn sie aber dieses gefürchtete Land hinter sich haben, renommiren sie sehr unter den andern Stämmen. Während in ihrem Lande Krieg geführt wird, sind sie gewohnt, sich nie an Karavanen zu vermiethen. Ihre Häuptlinge rathen dann von allen Handelsunternehmungen entschieden ab und deren Befehle sind ihnen Gesetz.
Das Regierungssystem in Unyamwezi ist eine Erbmonarchie. Der König heisst Mtemi. Ausser in Unyanyembé, Usagozi und Ugala verdient jedoch kein Häuptling diesen Namen, obwol er aus Courtoisie den Häuptlingen der Districte gegeben wird. Der jetzige König von Unyanyembé heisst Mkasiwa; Pakalambula ist König von Ugara, und Moto oder „Feuer“ heisst der König von Usagozi.
Mkasiwa kann 3000 Krieger aus einer Bevölkerung von fast 20,000 Menschen in Unyanyembé ausheben. Die kleinen Districte von Tabora und Kwihara können allein 1500 Krieger stellen.
Unter den Wanyamwezi gibt es manche sonderbare Gebräuche, z. B. wenn ein Kind geboren wird, zerschneidet der Vater die Eihäute und bringt sie an die Grenze seines Districts, wo er sie in der Erde vergräbt. Ist die Grenze ein Strom, so vergräbt er sie an seinem Ufer. Darauf bringt er eine Baumwurzel heim und gräbt sie an seiner Thürschwelle ein. Hierauf ladet er seine Freunde zu einem Feste ein, wozu er einen Ochsen oder ein halbes Dutzend Ziegen und Pombé hergibt. Werden Zwillinge geboren, so tödten sie nie einen derselben, sondern halten das für einen grössern Segen. Die Mutter begibt sich, wenn die Niederkunft naht, schleunig in den Wald und wird dort von einer Freundin gepflegt.
Die Hochzeitsceremonien sind denen der Wagogo ähnlich; die Frau wird von dem Vater für Kühe oder Ziegen, je nach den Mitteln der Bewerber, gekauft.
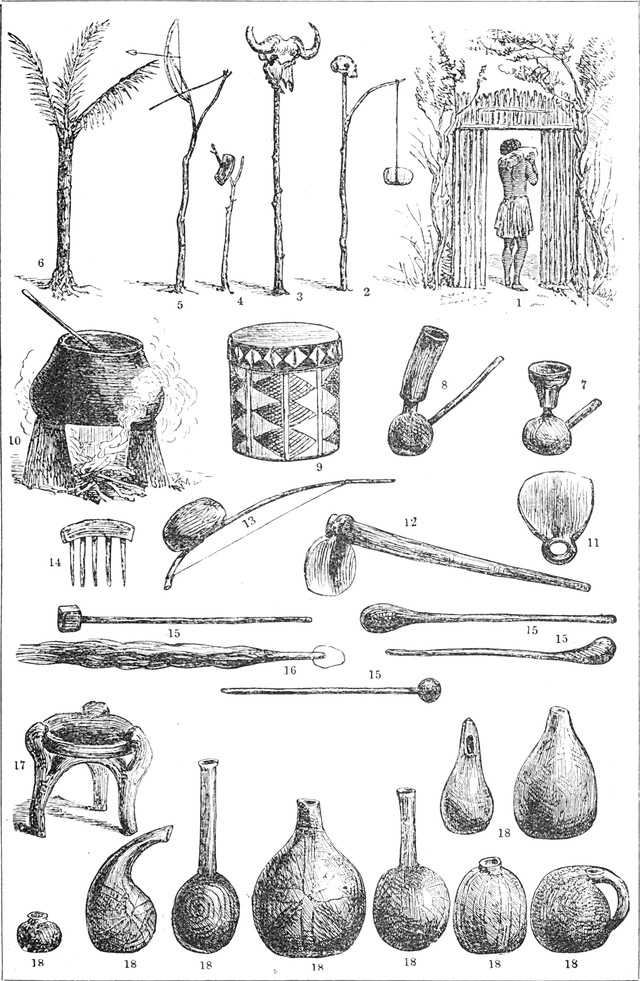

Die zu üblen Zwecken angewandte Zauberkunst wird[S. 169] mit dem Tode bestraft. Auch ist die unter den Wagogo gebräuchliche Ceremonie, um Bösewichter zu entdecken und zu überführen, ähnlich der in Unyamwezi angewandten. Verbrechen gegen den Staat und die Gemeinde werden auch mit dem Tode bestraft. Ein entdeckter Dieb, der seiner Schuld überführt ist, kann entweder sofort getödtet oder je nach dem Urtheil des Königs (Mtemi) zum Sklaven des Besitzers des Gutes werden, das er zu stehlen versucht hat.
Nach dem Tode tragen die Wanyamwezi die Leichen entweder ins Gestrüpp oder begraben die Vornehmeren in sitzender Stellung oder seitwärts liegend, wie die Wagogo. Auf dem Marsch wird eine Leiche einfach bei Seite geworfen und der Hyäne zur Beute überlassen, welche am besten für die Reinigung des Waldes sorgt. Der Sultan wird innerhalb des Dorfes begraben.
Die nördlichen Wanyamwezi sind ein sehr fleissiges Volk. Sie schmelzen sich das Eisen selbst und fabriziren fast alle vom Tanganika bis Usagara gebrauchten Hacken. Keine Karavane kehrt von Unyanyembé zurück, ohne sich Hacken zu kaufen, mit welchen sie den Wagogo den Tribut für die Rückreise bezahlen. Das in dieser Weise eingeführte Eisen wird von den östlichen und westlichen Stämmen zu verschiedenen Instrumenten verwendet. Aus demselben verfertigen sie sich Speere, Pfeilspitzen, Sicheln und Kriegsbeile. In Unyanyembé sieht man oft den eingebornen Handwerker mit diesen Mordinstrumenten einen Hausirhandel gegen Tuch treiben. Für zwei Meter kann man einen neuen Speer oder ein Dutzend Pfeile kaufen. Vier Meter Leinwand gibt man für einen Bogen bester Art, der mit Messing- und Kupferdraht verziert ist; zwei Meter für ein furchtbar aussehendes Beil. Diese letztere Waffe ist, wie man aus den beigegebenen Abbildungen ersehen kann, derjenigen ähnlich, welcher sich die Picten im Steinalter und die Römer und Aegypter in ihren frühesten historischen Perioden bedient haben, und es ist genau dieselbe, wie sie von Bagomoyo bis San Salvador, von Nubien bis zum Kaffernlande benutzt wird.
Auf Kinyamwezi heisst die Gottheit Miringu, auf Kigogo Mulungu, auf Kiswahili Mienzi Mungu. Die Wanyamwezi[S. 170] betrachten Gott als den Schöpfer und Austheiler aller Reichthümer. Er wird fast nur angebetet, um ihn um weltliche Reichthümer anzuflehen. Wenn der Tod ein Mitglied einer Familie in Unyamwezi geraubt hat, so sagen die Verwandten vom Todten, dass „Miringu ihn genommen hat“, oder dass „er verloren gegangen ist;“ „es ist Gottes Werk.“ Der ehrfurchtsvolle Ton, in welchem sie davon sprechen, zeigt auch, dass die Thatsache in ihren Augen wunderbar ist.
„Kann ein Mädchen seinen Schmuck vergessen oder eine Braut ihre Zierrathen?“ Bei den Wanyamwezi scheint es nicht der Fall zu sein. Von der Stunde an, dass sie Mama zu rufen beginnt, sind ihre Zierrathen der beständige Gegenstand ihrer Besorgnisse. Sie liebt es, die hübschen aus rothen, gelben, weissen und grünen Perlen bestehenden Armbänder zu betrachten, die in solchem Contrast zu ihrer dunklen Hautfarbe stehen; ihre Finger durch die langen aus bunten Perlen bestehenden Halsbänder, die an ihrem Halse herabhängen, gleiten zu lassen; oder mit dem Perlengürtel zu spielen, der ihre Taille umgibt; sie steckt sie sich sogar ins Haar und hört es gern, wenn man ihr sagt, dass sie ihr gut stehen. Sie freut sich, einen spiralförmigen Drahtgürtel zu besitzen, selbst wenn sie kein Kleidungsstück besitzt, das ihn nöthig macht. Mit Ungeduld erwartet sie den Tag, wo sie sich verheirathen und ein Tuch besitzen kann, um es um ihren Leib zu falten, und wo sie das Recht hat, über ihre Hühner zu verfügen und sie gegen das billige von arabischen Kaufleuten verkaufte Flitterwerk auszutauschen.
Die in angelsächsischen Ländern vorkommenden Theegesellschaften haben ein hohes Alter. Als die Aegypter das erste Culturvolk waren, waren sie oder wenigstens ihnen ähnliche Versammlungen Mode. Wer hat nicht auf den Bildern des alten Aegyptens, die sich auf den Mauern des wieder aufgefundenen Memphis befinden, Damengesellschaften erblickt? Ich habe diese Gastmäler in Abessinien, diesem so conservativen Lande, gesehen. In Unyamwezi kann man auch Damengesellschaften sehen und selten habe ich etwas erblickt, das sich der Glückseligkeit und vollständigen Zufriedenheit so nähert, wie die Gesichter der alten und[S. 171] jungen Frauen eines Kinyamwezi-Tembé, wenn sie sich gegen Sonnenuntergang aus den verschiedenen Häusern versammelt haben und die Ereignisse des Tages oder die trivialen Interessen besprechen, über die sich ein geselliger Kreis von Wanyamwezi zu unterhalten pflegt. Jedes Frauenzimmer hat ihren kleinen Schemel und ihre heranwachsende Tochter an der Seite, die, während die Mutter mit vor Zufriedenheit glänzendem Gesichte schwatzt und raucht, ihre flinken Hände dazu verwendet, die wolligen Locken der Mutter in eine Anzahl Flechten und Löckchen zu verwandeln. Die ältern Frauenzimmer sitzen mit untergeschlagenen Beinen im Kreise herum und erzählen, wie Schwalben schwatzend, ihre Erfahrungen. Die Eine spricht davon, wie ihre Kuh aufgehört hat, Milch zu geben; die Andere, wie gut sie ihre Milch an den Weissen verkauft hat; eine Dritte von ihren Erlebnissen im Felde, während sie daselbst mit der Hacke beschäftigt war; eine Vierte berichtet, wie ihr Gatte noch nicht aus der Kinyamwezi-Hauptstadt zurückgekehrt, wohin er gezogen, um Korn zu verkaufen.
Während die Dorfmatronen sich ihrer harmlosen Unterhaltung hingeben, findet man den Pater familias auf der Börse, dem Etablissement, wo die jungen Leute ihre Gespräche führen, wo die Preise der Artikel und die Politik ihres Districts vielleicht mit ebenso viel Scharfsinn und Verstand besprochen wird, wie an ähnlichen Orten civilisirterer Länder. Dieser öffentliche Versammlungsort eines Kinyamwezidorfes heisst in der Volkssprache „Wanza“ oder „Uwanza“ und befindet sich meist auf einer Seite eines quadratischen innerhalb des Dorfes liegenden Platzes. Wenn es nicht viel zu thun gibt — und es ist selten, dass hier viel zu thun ist — rauchen die Männer hier und unterhalten sich, auf den Hacken sitzend, vielleicht gerade über dieselben Gegenstände, die eben bei den Weibern verhandelt werden. Am wahrscheinlichsten bildet wol der Weisse, der eben angekommen ist, den Gegenstand ihrer Unterhaltung, denn dieser bietet ihnen unzweifelhaft das interessanteste Thema, obgleich sie trotz des Interesses und der Neugierde, die sich an ihn heftet, nie so unverschämt sind, die Thatsache zu bezweifeln, dass er ein Weisser ist, oder seine Aussagen zu[S. 172] bestreiten, wie es gewissen Leuten die sich civilisirt nennen, zu thun beliebt. Wenn jemand einen Speer zu schleifen, ein Schwert zu verzieren, einen Axtstiel zu machen, eine Pfeife zu rauchen oder Neuigkeiten mitzutheilen hat, so geht er in die Wanza. Wenn niemand da ist, so macht er seine Arbeit rasch ab und sucht sich die Gruppe unter dem grossen Baum auf, der sich stets in dem Dorfe befindet, unter dessen Schatten er seiner Liebhaberei für intelligente Unterhaltung nachgehen kann. Was die Agora für Athen und die Börse für die modernen Hauptstädte ist, das ist die Wanza für ein Dorf in Unyamwezi.
Aus den vorhergehenden Bemerkungen kann man sehen, dass die Wanyamwezi gern rauchen. Wenn man sich die Darstellungen der verschiedenen Pfeifenarten ansieht, bemerkt man, dass sie eine bedeutende Geschicklichkeit in der Fabrikation an den Tag legen. Auch sieht man, dass dieselben denen der nordamerikanischen Indianer sehr ähnlich sind. Während aber die Indianer rothen Seifenstein für ihre Pfeifen verwenden, bedienen sich die Wanyamwezi des schwarzen, wie er sich im westlichen Usukuma findet. Da dieser weiche Stein jedoch nicht ganz leicht zu bekommen ist, so fabriciren sie sich die Pfeifen auch aus schwarzem Lehm, der mit fein gehacktem Stroh gemischt wird. Der Taback ist in Unyamwezi nicht besonders gut. Man fabricirt ihn in derselben Gestalt wie die Laiber in Abessynien. Für ein Doti oder vier Meter Tuch kauft man einen Laib von drei Pfund; ebenso viel kostet eine aus schwarzem Seifenstein fabricirte Pfeife, deren Rohr reichlich mit schönem Messing- oder Kupferdraht verziert ist.
Die Eingeborenen lieben es auch sehr, indischen Hanf mit ihrem Taback zu mischen. Ihre Nargileh ist aber ein sehr einfacher Apparat, der aus einem Kürbis und einem hohlen Stock besteht. Schon ein paar Züge aus demselben genügen, schreckliche Hustenanfälle hervorzurufen, welche den ganzen Körper zu martern scheinen. Das macht ihnen aber Vergnügen, denn sie greifen oft dazu, obwol ihr lärmender, rauher Husten unbeschreiblich widerlich ist.
Die Wanyamwezi von Unyanyembé besitzen viele Viehheerden. Von jedem Lande, wo man Vieh sieht, lässt sich[S. 173] mit Bestimmtheit annehmen, dass es selten von Krieg überzogen wird. Zwischen der Küste und Udschidschi fanden wir Vieh nur in Usagara, Ugogo, Unyanyembé und Uhha; alle übrigen Länder züchteten nur Ziegen, Schafe und Hühner. Einige der reicheren Araber von Unyanyembé besitzen grosse Viehheerden und haben 40–50 Milchkühe; doch gibt es nur wenige Wanyamwezi, die deren mehr als 30 besitzen. Eine Milchkuh ist 20–30 Doti oder 75–110 Meter Leinwand werth. In Usukuma hingegen kann man eine Kuh für zwei bis vier Doti kaufen. 2½ Liter Milch gilt als reichliches Maass für eine Kuh. Das ist aber nicht das Gewöhnliche; vielmehr bringt meines Erachtens eine Kuh durchschnittlich nur 1¾ Liter. Ich liess mir zehn Tage lang täglich 4½ Liter Milch für vier Meter Tuch (Kitambi, ein farbiges Zeug) geben. Hieraus machte ich mir selbst Butter und Käse, was in Unyanyembé der grösste materielle Genuss ist, den ein Weisser haben kann.
Wie alle Neger liebt dieser Stamm die Musik sehr. Freilich ist sie barbarisch und wird bald monoton, aber ihre besten Musiker verstehen sie doch immer amüsant zu machen. Es gibt viele Improvisatoren unter ihnen. Die letzte Scandalgeschichte, politische Nachrichten oder persönlicher Klatsch wird bestimmt, wenn er hinreichend das öffentliche Interesse in Anspruch nimmt, auch in Musik gesetzt. Schon eine Woche, nachdem Mirambo den Krieg erklärt hatte, gab es in ganz Unyamwezi kein Dorf, das nicht Mirambo’s in irgend einer Weise des Abends in seinen Liedern Erwähnung gethan hätte; und da es lauter bekannte Melodien waren, so wurde nur der Name des jetzt berühmten Königs an die Stelle eines früher gebrauchten gesetzt. Auch der Musungu oder Muzungu, wie es bisweilen ausgesprochen wird, wurde bald nach seiner Ankunft ein beliebtes Thema, das aber in kurzer Zeit den Reiz der Neuheit verlor.
Die Nahrung dieser Eingeborenen, wie überhaupt aller Bewohner Central-Afrikas, besteht aus Matamamehl, dem Holcus sorghum (dem arabischen Dourra oder Dura), das in eine Art dicken Brei, ein einfach aufgebrühtes Gericht, verwandelt wird. Dazu werden Blätter von Gartenpflanzen, wie z. B. Bohnen und Gurkenpflanzen, gekocht und hineingerührt.[S. 174] Nur selten essen die Eingeborenen Fleisch, da es zu theuer sein würde, und es gibt viele Thiere, die sie nicht mögen. Mit wahrem Genuss verzehren sie aber Fötusse und Eingeweide und wenn sie Fleisch auf anderer Leute Kosten bekommen können, so stopfen sie sich gern damit voll. Wenn meine Jagden vom Glück begünstigt waren, so pflegten die zu meiner Karavane gehörigen Wanyamwezi die ganze Nacht aufzubleiben, um ihre Fleischportionen aufzuzehren, als ob dies eine heilige Pflicht sei. Der amerikanische, aus Mais verfertigte Mehlbrei ist in ganz Central-Afrika wohl bekannt. Wenn dieses einfache Gericht gekocht wird, versammeln sich die Männer der Familien um den Topf, holen sich eine grosse Handvoll heraus, tunken sie in eine Schüssel Grünkraut oder Ghee (geschmolzene Butter) und stopfen sich das Ganze in den Mund. Die Frauen essen für sich allein, da es der männlichen Würde nicht geziemt, zusammen mit den weiblichen Verwandten zu speisen.
In Central-Afrika wird selten ein sehr hohes Alter erreicht, obwol man in jedem Dorfe graues Haar und gekrümmte Rücken sieht. Die ältesten Leute habe ich in Ugogo und Unyanyembé gesehen, was sichere, wohlgeordnete Länder sind. Magombo, den Sohn von Kanyenyi, würde ich für fast 90 Jahre alt halten. Schon im Jahre 1858, also vor 14 Jahren, erwähnt ihn Kapitän Burton als alt und hochbetagt. Noch lebt er zwar, ist aber ausser Stande, ohne Beistand weit zu gehen. Sein ältester Sohn Kisewah muss bedeutend über 60 Jahre und sein jüngster Sohn Mtundu Ngondeh fast 50 Jahre alt sein. Der Sultan von Mizanza, welcher Sny bin Amer, den Freund Burton’s und Speke’s, erschlug, kann meiner Ansicht nach nicht weniger als 80 Jahre alt sein, und Pembera Pereh, der Häuptling von Nyambwa, muss ungefähr dasselbe Alter erreicht haben.
Die Wakonongo und Wakawendi haben, meines Erachtens, früher demselben Geschlecht, wie die Wanyamwezi angehört, denn ihre Sprache, Manieren und Gewohnheiten sind dieselben. Wenn man aber den Malagarazi überschreitet und nach Uvinza kommt, so befindet man sich unter einem anderen Volke. Bei der Beschreibung der Sitten und Gebräuche[S. 175] der Wavinza schliesse ich die Wadschidschi, Wakaranga, Warundi, Wavira, Watuta und Watusi mit ein.
Schon der Gruss, den man bei der Ankunft in Uvinza vernimmt, deutet auf neue Stämme und neue Gewohnheiten hin, die man im Begriff ist kennen zu lernen. Zwischen zwei Wavinza ist eine erste Einführung eine sehr langweilige Ceremonie. Wenn sie sich nähern, so strecken sie beide Hände gegen einander aus und sprechen die Worte „Wake, Wake“; dann fassen sie sich gegenseitig an die Ellenbogen, reiben einander die Arme und sagen rasch „Wake, Wake, Waky, Waky“, was mit den Grunztönen „Huh, Huh“, die gegenseitige Freude bedeuten, endet. Die Weiber begrüssen die Männer — ja selbst halberwachsene Jünglinge — indem sie sich soweit vorwärts beugen, bis ihre Fingerspitzen auf den Fusszehen ruhen oder indem sie ihre Körper seitlich beugen und die Hände zusammenschlagen mit dem Ausrufe: „Wake, Wake, Waky, Waky; Huh, Huh“. Dies erwidern die Männer, indem sie ihre Hände zusammenschlagen und mit denselben Worten antworten.
Die Kleidung aller dieser Menschen, wenn sie nicht reich genug sind, sich von durchziehenden Karavanen Tuch zu kaufen, oder geschickt genug, sich ihre eigenen Zeuge zu fabriciren wie die Wadschidschi und Warundi es thun, besteht aus einer Ziegenhaut, die durch einen Knoten über der Schulter befestigt ist und an einer Seite ihres Körpers herabfällt.
Als Zierrathen lieben sie solide Messingringe um Knöchel und Handgelenk oder das Kitindi, Messingdraht, der spiralförmig gedreht ist. Auch sind polirte Eberhauer oder ein polirtes Stück von dünnem, gebogenem Elfenbein Lieblingszierrathen für den Hals in ganz Uvinza, Uhha, Udschidschi und Urundi.
Die Wadschidschi fabriciren ihr eigenes Tuch aus der von ihnen erbauten Baumwolle sehr geschickt; das Gewebe desselben ist dem des mexikanischen Serape ähnlich. Wie die Wakaranga sind sie ein abergläubisches Geschlecht. In Niamtaga habe ich, nicht weit von der Dorfpforte, ihre Schutzgottheit gesehen, einen in Holz geschnitzten, bemalten, männlichen Kopf. Das Gesicht war weiss angestrichen[S. 176] und hatte schwarze starrende Augen; die Figur hatte viereckige, hochstehende Schultern und eine Art Kopfputz, der gelb angemalt war. Ein Jeder verbeugte sich bei seinem Eintritt in das Thor aufs tiefste vor dem Götzenbilde, wie Katholiken es vor dem Bilde der heiligen Jungfrau zu thun pflegen.

Die Wadschidschi glauben Macht über Krokodile zu besitzen und mit diesen Reptilien auf so freundschaftlichem Fusse zu stehen, dass sie dieselben zu allem, was sie wünschen, zwingen können. In Udschidschi läuft das Gerücht um, dass es ein Krokodil gibt, das ebenso gelehrt ist, wie der im Barnum’schen Museum in New York befindliche Seehund, sodass es den Befehlen seiner Freunde unbedingt gehorcht und sogar auf Befehl einen Menschen aus seinem Hause in den See bringt oder auf einen gedrängten Marktplatz geht, um einen Dieb mitten in einer grossen Versammlung zu entdecken. Die am westlichen Ufer des Sees befindlichen Höhlen von Kabogo sind den Wadschidschi schrecklich, und so oft sie an diesem Ort vorüberziehen, vergessen sie[S. 177] nicht, die erzürnte Gottheit des Sees dadurch zu besänftigen, dass sie Perlen und Tuch ins Wasser werfen. Dies soll nach ihrer Aussage nothwendig sein und ebenso soll der Gott die weissen (Merikani-) Perlen allen andern vorziehen. Dieser hergebrachten Sitte müssen die Wangwana aus Zanzibar und die Araber nachkommen, bevor die Wadschidschi sie ans andere Ufer bringen. Auch muss jedes Boot, das an Bemba vorbeifährt, eine bestimmte Portion von dem dortigen Pfeifenthon abbrechen, ehe es mit Sicherheit auf eine gute Reise rechnen kann. Dass dies eine seit vielen Generationen bestehende und befolgte Sitte ist, geht aus den ungeheuern Aushöhlungen hervor, die in der Kreideklippe gemacht worden sind.
Nirgends habe ich eine grössere Verschiedenheit der Sitten in Bezug auf die Haartracht gesehen, als in Urundi und Udschidschi. Entweder wird das Haar völlig abrasirt oder man lässt es in Diagonalen oder horizontalen Linien stehen. Entweder bildet es Kämme, Büsche, Streifen, kleine Locken an den Schläfen und der Stirn; oder es wird in Stirnbändern und bisweilen in schmalen, welligen oder geraden Linien getragen. Hieraus kann man schliessen, dass die Kunst des Friseurs in barbarischen Ländern ebenso hoch steht, wie in civilisirten. Was die Schmückung ihrer Leiber durch Tätowiren betrifft, so stehen sie darin höher als andere Stämme. Man findet hier ein tätowirtes Rad um den Nabel und um jede Brust. Auf den Armen besteht das Tätowiren in wellenförmigen Linien oder in concentrischen Falten oder in Linien, die diagonal über die Brust zur Schulter laufen, ebenso in Armbändern um das Handgelenk oder in einem verwickelten System von wellenförmigen und horizontalen Linien, die sich von der linken Schulter zur rechten Hüfte oder von der rechten Schulter zur linken Hüfte über die Magengegend hinziehen. Auf dem Unterleib sieht man grosse Flecken, die gar keine Zeichnung haben. Uebrigens muss das Tätowiren schmerzhaft sein, wenn man nach den ungeheuren Blasen urtheilen darf, welche nach dem Punktiren entstehen.
Die Eitelkeit des Negers auf Zierrathen wird nur durch seine Armuth beschränkt. Wer im Stande ist, es zu bezahlen,[S. 178] trägt 30–40 Halsbänder von Sami-Sami, Merikani, Sofi oder Pfeifenrohrperlen, Kadunduguru und Rosaperlen. Hierbei spreche ich von den Wadschidschi und Warundi, besonders von den letzteren. Am Halse hängen ihnen dünne geschnitzte Stücke Elfenbein, Flusspferdzähne und Eberhauer herab und hinten vom Nacken schwere Stücke geschnitzten Elfenbeins. Einige tragen am Halse lange, schmale Glöckchen aus einheimischem Eisen, zusammengedrehten Eisendraht und Zaubermittel oder weisse, polirte Steine und Schalen als Amulets. Um die Handgelenke haben sie Armbänder von Sami-Sami oder blauen Mutunda, welch letztere besonders beliebt sind; auch umgeben Gürtel von diesen Perlen ihre Taille.
Ihre Kleidung besteht aus einem gegerbten Ziegen-, Kalb- oder Schaffell, das mit dem rothen porösen Lehm, der von den Bächen durch die Schluchten herabgetrieben wird, gefärbt ist. Auch werden diese Fellkleider mit schwarzen Linien, Flecken und Kreisen verziert nach Art der unter den amerikanischen Indianern herrschenden Sitte.
Wie die Wagogo, und vielleicht noch mehr, lieben die Warundi den Ocker auf dem Körper. Ausser dass sie denselben mit dieser Lehmart einreihen, was seine Farbe bedeutend heller macht, schmieren sie sich auch das Gesicht, den Kopf, die Augenlider und Augenbrauen damit dunkelroth an.
Ihre Frauen haben die Sitte, sich die langen beutelförmigen Brüste mit einem um den Leib gebundenen Strick auf dem Brustkasten festzubinden. Zum Schutz oder aus Gewohnheit tragen sie lange Röcke, die bisweilen am obern Ende mit der Figur einer kleinen Eidechse oder eines Krokodils verziert sind.
Die am See wohnenden Stämme haben schwere Speere für den Nahekampf oder um einen Menschen zu viertheilen, und leichte Assegai, die sie mit grosser Genauigkeit 50–60 Meter schleudern können. Die hier benutzten Bogen sind kürzer als die der Wanyamwezi und Wakonongo, die Pfeile sind aber dieselben, nur dass sie mit grösserer Geschicklichkeit und bedeutenderem Geschmack gemacht sind.
Die Wabembe oder Wavembe (Kannibalen, welche die[S. 179] schroffen Felsenketten im Westen des Tanganika und gegenüber dem nordöstlichen Urundi bewohnen) sind ein Volk, das selten von den Reisenden auf dem See gesehen wird. Sie scheinen aus ihren eigenen Gewohnheiten den Schluss zu ziehen, dass auch andere Menschen Menschenfresser sind, und wenn sich Araber und Wangwana in ihrer Nähe zeigen, so bleiben sie in ihren eigenen Bergdörfern. Sie sollen, obgleich ich für die Wahrheit dieses Berichtes nicht einstehe, arabischen Kaufleuten, von denen sie wussten, dass sie einen kranken oder sterbenden Sklaven hatten, das Anerbieten gemacht haben, ihn für Korn und Vegetabilien zu kaufen, und wenn sie einen ungewöhnlich fetten Freigelassenen aus Zanzibar sehen, so sollen sie ihre Hände in den Mund stecken und verwundert ausrufen: „Tschukula, ngema sana, hapa! Tschumvi mengi!“ Futter, gut, in der That, hier! Salz in Menge!
Die Wasansi oder Basansi, wie Dr. Livingstone meint, dass sie heissen sollten, sind Nachbarn der Wabembe und gehören, wie ich fürchte, gleichfalls zur Klasse der Kannibalen. Es waren Wasansi, die uns, dem Doctor und mir, am Cap Luvumba wegen des Mordes des Sohnes des Sultans Kisesa durch den Belutsch Khamis den Skandal machten und uns erklärten, sie wollten nie wieder einen „Murungwana“ (Freigelassenen aus Zanzibar) sehen. Nie habe ich in meinem Leben eine solche Aufregung gesehen, wie sie diese Leute zeigten, als sie bemerkten, dass einer meiner Soldaten eine Ziege zerlegte, um sie zu vertheilen. Es schien, als ob sie beim Anblick des Fleisches von einer Art Wahnsinn ergriffen würden, wie man ihn etwa bei einem hungrigen fleischfressenden Thier erwarten könnte. Mit wilden Augen flehten sie um das kleinste Theilchen Fleisch und kämpften unter einander, als einer meiner Leute ein Stück unter sie warf. Eifrig sammelten sie sich die Blutgerinsel, die von der Ziege stammten, vom Boden auf und blickten mit heisshungriger Gier jeden Bissen Fleisch an, den einer meiner Leute ass. Was an dem Kannibalismus der Wabembe Wahres sein mag, weiss ich nicht, doch bin ich überzeugt, dass die Wasansi Menschenfresser sind.
[S. 180]
Die Bewohner von Manyuema sind die geschicktesten Fabrikanten von Waffen, was man aus den hier abgebildeten Speerspitzen und Dolchen ersehen kann.
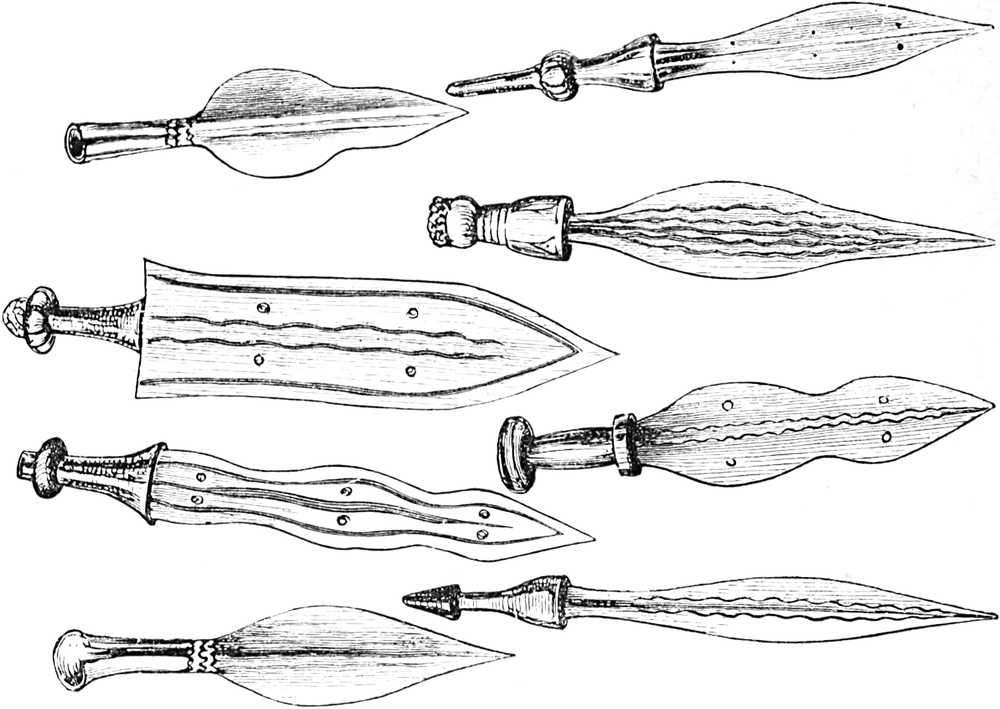
[S. 181]
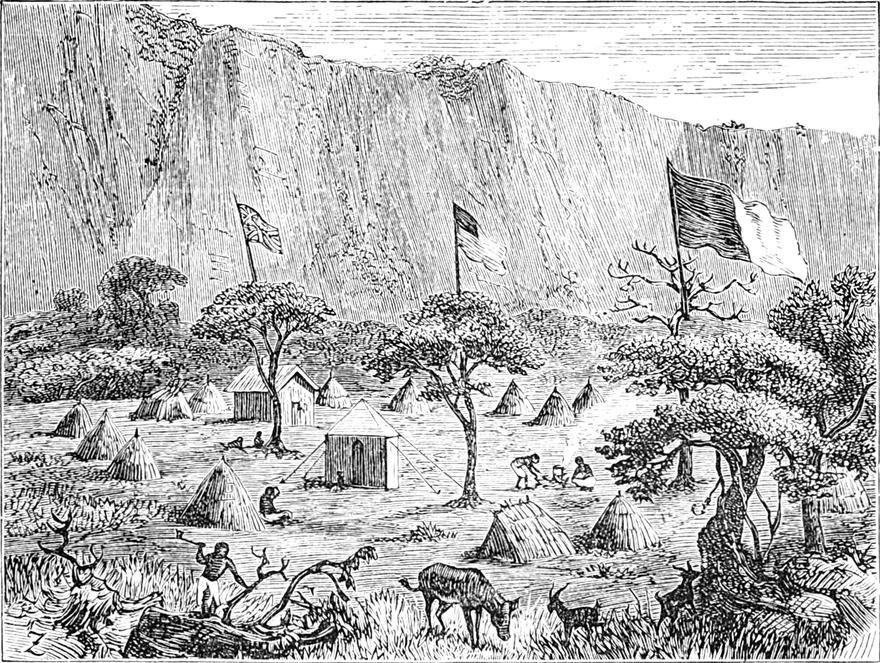
Plaudereien mit Livingstone über die Ereignisse unseres „Pickenicks“. — Der Doctor will durchaus nicht in seine Heimat zurückkehren, ehe er seine Aufgabe gelöst. — Er tadelt Dr. Kirk, dass ihm dieser Sklaven zugeschickt, denen er befohlen, Livingstone nach Hause zu bringen. — Er bekommt seine gezogenen Enfield-Gewehre wieder. — Er entschliesst sich, mich nach Unyanyembé zu begleiten. — Ein Anfall von remittirendem Fieber. — Unser Christfest. — Abreise von Udschidschi. — Unsere Reise auf dem Tanganika. — Ankunft am Liutsché und Fahrt über denselben. — Fahrt über den Malagarazi. — Im Tanganika existirt keine Strömung. — Ankunft in Urimba. — Zebrajagd. — Das Thal des Loadscheri. — Erlegung einer Büffelkuh. — Zusammentreffen mit einem Elefanten. — Erzählungen Reisender. — Rothbärtige Affen. — Anblick von Magdala. — Das Thal Imrera. — Der Doctor ist fussleidend. — Heerden von Wild in der Mpokwa-Ebene. — Erlegung zweier Zebras. — Eine Heerde Giraffen. — Eine Giraffe wird verwundet. — Ibrahim’s Sklave Ulimengo läuft fort. — Breite von Mpokwa. — Umschmelzen von Zink-Feldflaschen zu Kugeln. — Mit diesen wird eine Giraffe erlegt. — Aufbruch nach Misonghi. —[S. 182] Der Doctor wird entsetzlich zerstochen von wilden Bienen. — Mirambo ist durch Hunger vernichtet. — Shaw’s Tod. — Ereignisse aus dem Leben und Tod Robert Livingstone’s. — Ein Löwe im Grase. — Drei Löwen. — Ankunft in Ugunda. — Einfangen des Deserteurs Hamdallah. — Ankunft in Unyanyembé.
Wir fühlten uns ganz zu Hause, als wir uns auf unsere schwarze Bärenhaut, den bunten persischen Teppich und die reinen neuen Matten setzten, den Rücken an die Wand lehnten, unsern Thee behaglich schlürften und uns über die Einzelheiten des „Picknicks“ unterhielten, wie Livingstone durchaus unsere Reise an den Rusizi zu nennen beliebte. Es schien, als ob alte Zeiten, die wir so gern ins Gedächtniss riefen, wieder zurückgekehrt seien, obgleich unser Haus äusserlich sehr einfach aussah und unsere Diener nur nackte Barbaren waren. In der Nähe dieses Hauses aber hatte ich Livingstone nach dem ereignissvollen Marsch aus Unyanyembé zuerst gesehen; auf dieser selben Veranda hatte ich seine wunderbare Schilderung der weiten bezaubernden Gegenden im Westen des Sees Tanganika gehört; hier hatte ich ihn zuerst kennen gelernt, und von dem Augenblicke an ist meine Bewunderung für ihn stets im Wachsen und ich fühle mich erhoben, wie er mir zum ersten male mittheilt, er müsse unter meiner Begleitung und auf meine Kosten nach Unyanyembé gehen. Die alten Lehmmauern, die kahlen Balken, das alte Strohdach und diese eigenthümlich aussehende alte Veranda werden für mich ein historisches Interesse mein Leben lang behalten. Daher habe ich mir die Mühe gegeben, das einfache alte Haus durch eine Zeichnung unsterblich zu machen.
Ich habe eben gesagt, dass meine Bewunderung für Livingstone zugenommen hat. Das ist wahr; denn der Mann, den ich mir so ruhig wie einen andern bedeutenden Menschen hatte ansehen wollen, um seinen Charakter und seine Ansichten genau zu schildern, hat mich besiegt. Soll ich hier aussprechen, was meine ursprüngliche Absicht gewesen? Es ist wahr wie das Evangelium. Ich wollte ihn mir ansehen, genau berichten, was er mir gesagt, sein Leben und[S. 183] Aussehen schildern, ihm darauf ein „Auf Wiedersehen!“ zurufen und zurückreisen. Dass er in seiner Manier besonders unangenehm und barsch sei, weshalb ich sofort in Streit mit ihm gerathen müsse, war meine bestimmte Ueberzeugung gewesen. Ausserdem war er ein Engländer, — vielleicht ein Mann, der sich eines Lorgnons bediente, durch das er mich mit wüthendem oder eiskaltem Blicke messen würde (was beides dasselbe besagen will), oder mich, wie der junge Fähnrich des Scinde’schen Cavallerie-Regiments in Abessinien, nachdem er einige Schritte zurückgetreten, gelassen fragen könnte: „Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen?“ Oder er konnte mich wol gar, wie der alte General in Senafe, Sir — —, anschnauzen: „Nun, Herr! Wer sind Sie? Was wollen Sie hier?“ Allerdings waren meine Bekanntschaften mit Engländern derartig, dass ich nicht erstaunt gewesen wäre, wenn er gesagt hätte: „Darf ich Sie wol fragen, mein Herr, ob Sie einen Einführungsbrief an mich haben?“ Was wäre das aber für eine Frage an den Ufern des Tanganika gewesen? Ich hätte mich auf einen Berg bei Udschidschi zurückziehen, dort zwei Tage bleiben und dann zurückkehren müssen, um der Welt mitzutheilen, wie ich angelaufen sei. Der edle, wahrhaft christliche, offenherzige Livingstone hingegen handelte wie ein Held, lud mich in sein Haus ein, drückte seine Freude darüber aus, mich zu sehen und wurde, um die Wahrheit dieser Aussage zu bestätigen, auch gleich gesund. „Sie haben mir neues Leben gebracht!“ Als ich am Wechselfieber erkrankt zwischen Leben und Tod schwebte, hat er mich wie ein Vater gepflegt, und jetzt sind wir über einen Monat zusammen gewesen. Kann man sich wundern, dass ich einen Mann liebe, dessen Gesicht seine ganze Natur widerspiegelt, dessen Herz die Güte selbst, dessen Ziele die höchsten sind, bisweilen aber doch heftig in die Worte ausbreche: „Aber, Herr Doctor, Ihre Familie würde Sie doch so gern, so sehr gern sehen. Kommen Sie doch mit mir. Ich verspreche Ihnen, Sie bis an die Küste zu geleiten. Sie sollen den schönsten Esel zum Reiten haben, den man in Unyanyembé bekommen kann. Ihre Bedürfnisse sollen, sowie Sie dieselben nur andeuten, befriedigt werden. Lassen Sie doch die Quellen des Nils und kommen Sie nach[S. 184] Hause, um auszuruhen. Dann können Sie ja, nachdem Sie das ein Jahr gethan und Ihre Gesundheit wiederhergestellt haben, zurückkehren und Ihre Aufgabe beendigen.“
Darauf lautete seine Antwort stets: „Nein. Ich sehne mich allerdings sehr danach, meine Familie zu sehen. Die Briefe meiner Kinder rühren mich sehr; ich darf aber noch nicht nach Hause gehen, sondern muss erst meine Aufgabe lösen. Ich bin ja nur durch Mangel an Vorräthen aufgehalten worden und würde jetzt schon die Entdeckung des Nils vollendet haben, wenn ich ihn bis an seine Verbindung mit dem Baker’schen See oder dem Petherick’schen Arm des Nils verfolgt hätte. Wäre ich nur noch einen Monat weiter gereist, so hätte ich sagen können: “die Arbeit ist vollendet„. Dr. Kirk hat mir aber immer wieder von neuem Sklaven geschickt und er sollte doch wissen, wie diese beschaffen sind. Ich kann es nicht begreifen, warum er sich nur an Banyanen gewandt hat, um mir Leute zu besorgen.“
Noch waren einige der Leute, welche Livingstone daran verhindert hatten, seine interessanten Entdeckungen fortzusetzen, in Udschidschi und hatten die der Regierung gehörigen gezogenen Enfield-Gewehre in ihren Händen, welche sie zurückbehalten wollten, bis sie ihren Lohn bekommen hätten. Da sie aber je 60 Dollars vom englischen Consul in Zanzibar unter der contractlichen Bedingung erhalten hatten, dass sie ihrem Herrn überall hin folgen sollten, dagegen nicht nur seinen Befehlen ungehorsam gewesen, sondern ihm sogar überall in den Weg getreten waren, so war es abgeschmackt, dass ein paar Leute die Oberhand über den Doctor behalten und ihm die Rückgabe der von der Regierung in Bombay geschenkten Gewehre verweigern sollten. Ich hatte gehört, wie die dem Doctor freundlich gesinnten arabischen Scheikhs den Leuten in milder Weise zugeredet hatten, die Waffen auszuliefern; war Zeuge von der Hartnäckigkeit der Meuterer gewesen, und da nahm ich denn auf dem Burzani von Sayd bin Madschid’s Hause Gelegenheit, meine Ansicht nicht nur zum Besten der eigensinnigen Sklaven, sondern auch zu dem der Araber auszusprechen und ihnen zu sagen, wie gut es sei, dass ich Livingstone am Leben gefunden, denn wenn sie ihm auch nur ein Haar[S. 185] gekrümmt hätten, so wäre ich an die Küste zurückgegangen, um mit einer Rache-Expedition wiederzukehren. Ich hätte jetzt jeden Tag darauf gewartet, dass Livingstone’s Flinten ihm zurückgegeben würden und gehofft, ohne Gewalt auszukommen; da nun aber mehr als ein Monat verstrichen und die Waffen noch nicht abgeliefert seien, so bäte ich mir die Erlaubniss aus, sie mit Gewalt zu nehmen, und diese wurde mir gewährt. Sofort wurde Susi, der tapfere Diener Livingstone’s (der werth gewesen wäre, mit Silber aufgewogen zu werden, wäre er nicht ein unverbesserlicher Dieb gewesen), mit ungefähr einem Dutzend Bewaffneter abgeschickt, um die Waffen abzuholen, und in wenigen Minuten waren wir ohne weitere Belästigung im Besitz derselben.
Livingstone war entschlossen, mich nach Unyanyembé zu begleiten, um dort seine am 1. November 1870 durch den britischen Consul von Zanzibar abgesandten Vorräthe in Empfang zu nehmen. Da mir die Leitung der Escorte anvertraut worden, so war es meine Pflicht, die verschiedenen Routen von Udschidschi nach Unyanyembé zu studiren. Ich war mir der grossen Verantwortlichkeit sehr wohl bewusst, die die Begleitung eines solchen Mannes mit sich bringt; auch waren meine eigenen Empfindungen bei dem Fall im Spiel. Wenn nämlich Livingstone durch meine Unvorsichtigkeit, solange er bei mir war, ein Schaden geschähe, so würde man gleich sagen: „Ja! wäre er nur nicht mit dem Stanley gereist, so wäre er jetzt noch am Leben!“
Ich nahm also meine von mir selbst angefertigte Karte vor, auf die ich volles Vertrauen setzte, und entwarf eine Route, die uns nach Unyanyembé führen sollte, ohne dass wir auch nur ein Tuch als Tribut zu zahlen hätten, und der uns schlimmstenfalls durch Dschungels führte, wodurch wir alle die Wavinza und plündernden Wahha vermeiden könnten. Dieser friedliche, sichere Weg führte zu Wasser nach Süden die Küste von Ukaranga und Ukawendi entlang bis zum Cap Tongwe. Hier würden wir uns gegenüber dem im Ukawendi-Districte Rusawa belegenen Dorfe Itaga, dessen Sultan Imrera ist, befinden und dann könnten wir den alten Weg wieder einschlagen, den ich von Unyanyembé nach Udschidschi gereist war. Dies setzte ich dem Doctor auseinander[S. 186] und er erkannte sofort die Ausführbarkeit und Sicherheit dieser Route an. Wenn ich dabei wirklich, wie ich wünschte, zu Imrera käme, so würde das den besten Beweis dafür geben, dass meine Karte richtig sei.
Am 13. December kehrten wir von unserer nördlichen Expedition auf dem Tanganika zurück. Von diesem Tage an begann Livingstone Briefe an seine zahlreichen Freunde zu schreiben und die werthvollen Kenntnisse, die er während seiner Reisejahre im Süden und Westen des Tanganika gesammelt, aus seinen Tagebüchern in sein umfangreiches Notizbuch einzutragen. Während er in Hemdärmeln, das grosse Notizbuch auf den Knien, auf der Veranda sass, habe ich ihn gezeichnet und die Aehnlichkeit des nebenstehenden Bildes ist vortrefflich, weil der mich unterstützende Künstler mit angeborenem Talent die Fehler meiner Skizze entdeckt hat. Dadurch bin ich im Stande, Livingstone dem Leser genau so vorzuführen, wie ich ihn gesehen habe, über die Erlebnisse auf seinen langen Märschen nachdenkend.
Bald nach meiner Ankunft in Udschidschi hatte er sich daran gemacht, einen Brief an James Gordon Bennett zu schreiben, worin er ihm dankte. Nachdem er ihn beendet, bat ich ihn, nur noch das Wort junior hinzuzufügen, da er nur dem jüngeren Bennett Dank schuldig sei. Ich hielt den Brief für vortrefflich und bat den Doctor, auch nicht ein Wort hinzuzufügen. Die Empfindungen seines Herzens hatten ihren Ausdruck in so dankbaren Worten gefunden; und wenn ich Herrn Bennett richtig beurtheilte, so wusste ich, dass er damit zufrieden sein würde. Denn er war ja nicht so sehr dabei interessirt, geographische Neuigkeiten, als vielmehr die grosse Thatsache zu erfahren, dass Livingstone selbst am Leben sei.
In diesem letzten Theil des December schrieb er auch Briefe an seine Kinder, an Sir Roderick Murchison und an Lord Granville. Auch wollte er an den Grafen Clarendon schreiben und mir fiel die schwere Aufgabe zu, ihm mitzutheilen, dass dieser ausgezeichnete Mann gestorben sei.
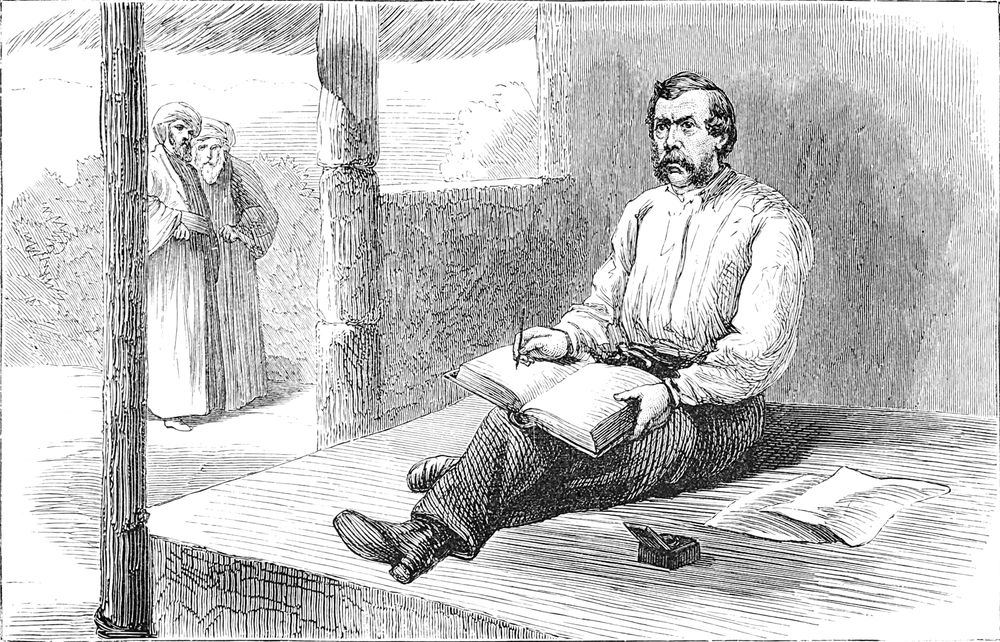
Mittlerweile bereitete ich die Expedition auf den Rückweg nach Unyanyembé vor und vertheilte Ballen und Gepäck, sowol des Doctors grosse Blechkasten als auch meine[S. 187] eigenen unter meine Leute; denn ich hatte den Entschluss gefasst, Livingstone’s Leute als Passagiere mit marschiren zu lassen, da sie ihre Pflicht gegen ihren Herrn so vorzüglich erfüllt hatten.
Sayd bin Madschid hatte am 12. December Udschidschi verlassen, um gegen Mirambo zu ziehen und diesen schwarzen Bonaparte wegen der Ermordung seines Sohnes in den Wäldern von Wilyankuru mit Krieg zu überziehen. Er hatte 300 kräftige, mit Gewehren bewaffnete Burschen von Udschidschi mitgenommen. Der tapfere alte Häuptling brannte vor Rache und Wuth und erschien mit seinem 7 Fuss langen Gewehr als ganz stattlicher Krieger. Ehe wir nach dem Rusizi gegangen, hatte ich ihm eine gute Reise gewünscht und die Hoffnung ausgedrückt, dass er Central-Afrika von dem Tyrannen Mirambo befreien möge.
Am 20. December wurde die Regenzeit durch einen heftigen Regen, Donner, Blitz und Hagel eingeleitet, wobei das Thermometer auf 27° R. fiel. Am Abend dieses Tages bekam ich zum dritten male in Afrika Urticaria (Nesselausschlag) und war sehr leidend. Es war nur der Vorläufer eines Anfalls von remittirendem Fieber, das sieben Tage anhielt. Es ist dies die bösartige Form, die schon vielen Afrika-Reisenden auf dem Zambezi, Weissen Nil, Congo und Niger tödlich geworden ist. Man hat dabei Congestionen nach dem Kopfe, einen raschen Puls, starkes Herzklopfen und böse Phantasien. Seit ich mit Livingstone zusammengekommen, war dies mein vierter Fieberanfall. Die Aufregung des Marsches und die mich beständig erfüllende Hoffnung hatte auf dem Wege nach Udschidschi auch meinen Körper gegen Fieberanfälle gestählt; zwei Wochen aber, nachdem das grosse Ereigniss sich vollzogen hatte, liessen meine Kräfte nach; ich war völlig ruhigen Geistes geworden und erkrankte infolge dessen. Da ich mich jedoch niemals der Unmässigkeit oder andern ausschweifenden Gewohnheiten, die so manche Constitution ruiniren, hingegeben hatte, so unterlag ich zum Glück den wiederholten Anfällen dieser heimtückischen Krankheit nicht.
Weihnachten kam heran und der Doctor und ich hatten den Beschluss gefasst, diese herrliche, von alters her gefeierte[S. 188] Zeit hier so wie in angelsächsischen Ländern, nämlich mit einem Festmahl, wie es Udschidschi uns bieten konnte, zu feiern. Am Abend vorher hatte mich das Fieber ganz und gar verlassen und am Weihnachtsmorgen stand ich, obgleich noch sehr schwach, völlig angekleidet auf, belehrte den Koch Feradschi über die Wichtigkeit dieses Tages für uns Weisse und versuchte es, diesem wohlgenährten Wilden einige Finessen der Kochkunst beizubringen. Wir verschafften uns vom Markt zu Udschidschi und dem guten alten Muini Kheri fette breitschwänzige Schafe, Ziegen, Zogga und Pombé, Eier, frische Milch, Platanenfrüchte, Singwe, gutes Kornmehl, Fische, Zwiebeln, süsse Kartoffeln u. dgl. Leider jedoch war meine Schwäche uns hier hinderlich; denn Feradschi verdarb den Braten, verbrannte uns unsere Eierkuchen und das Mittagessen misglückte total. Dass der dickköpfige Schelm nicht Prügel erhielt kam nur daher, dass ich unfähig war, meine Hände zu seiner Bestrafung zu rühren; ich sah ihn aber mit einem so schrecklichen Blick an, dass jeder andere als Feradschi dadurch vernichtet worden wäre. Der dumme, hartköpfige Koch hingegen kicherte nur und hat wol, wie ich glaube, nachher mit vielem Vergnügen die Pasteten, Eierspeisen und Braten, die durch seine Nachlässigkeit für den Gaumen von Europäern verdorben waren, selbst verzehrt.
Vor seiner Abreise hatte Sayd bin Madschid Befehl hinterlassen, dass wir sein Boot auf unserer Heimreise gebrauchen könnten und freundlicherweise lieh uns auch Muini Kheri sein grosses Fahrzeug für denselben Zweck. Denn die Expedition, die jetzt um den Doctor und seine fünf Leute nebst Gepäck vermehrt war, erheischte noch ein Boot. Für die Dschungels von Ukawendi, welche wir durchziehen wollten, hatten wir uns mit Milch, Ziegen und Vorräthen an fetten Schafen versehen. Die gute Halimah, Livingstone’s Köchin, hatte einen Sack voll schönes Mehl bereitet, wie sie es nur in ihrer grossen Verehrung für ihren Herrn herzustellen im Stande war. Auch ihr Gatte Hamoydah hatte freiwillig aufs aufmerksamste bei der Herstellung dieses wichtigen Nahrungsmittels geholfen. Ich kaufte einen Esel für Livingstone und zwar den einzigen, den man in Udschidschi[S. 189] erlangen konnte, für den Fall, dass er auf dem langen Marsche von seinem alten Uebel heimgesucht werde. Kurz, wir hatten reichlich Nahrungsmittel, Schafe, Ziegen, Käse, Tuch, Esel und Boote, womit wir eine lange Strecke weit vorwärts kommen konnten; es fehlte uns also an nichts.
Der 27. December, der Tag unserer Abreise von Udschidschi, ist da. Ich war wol im Begriff, dem Hafen, dessen Name meinem Angedenken stets heilig sein wird, auf immer Lebewohl zu sagen. Die Boote, grosse, schwerfällige, hohle Baumstämme, sind mit Vorräthen schwer beladen; die Ruderer sind zur Stelle; die englische Flagge weht am Spiegel von Livingstone’s Boot, die amerikanische über dem meinigen und ich kann sie nicht ansehen ohne einen gewissen Stolz, dass die beiden angelsächsischen Nationen heute auf diesem grossen Binnenmeer angesichts der wilden Natur und der Barbaren vertreten sind.
Die grossen arabischen Kaufleute, die staunenden Kinder von Unyamwezi, Freigelassene aus Zanzibar, verwunderte Waguhhu und Wadschidschi, wilde Warundi begleiten uns an die Boote; alle sind am heutigen Tage still, ja sogar traurig, dass die Weissen, sie wissen nicht wohin, fortziehen.
Um 8 Uhr morgens fahren wir ab, überall hin die mit den Händen winkenden Araber und Neugierigen grüssend. Einige derselben versuchten uns etwas Gefühlvolles beim Abschied zu sagen; namentlich der überführte Sünder Mohammed bin Sali. Obwol ich aber äusserlich keine Misbilligung seiner Worte oder der herzlichen Weise zeigte, mit der er mir die Hand drückte, so bedauerte ich es doch nicht wegen seines an Livingstone im Jahre 1869 verübten Verrathes, ihn zum letzten mal gesehen zu haben. Er bat mich sehr, „Mengi Salaams“ an jedermann in Unyanyembé zu bringen. Hätte ich das aber gethan, so wäre ich keineswegs darüber erstaunt gewesen, wenn mich alle für einen hoffnungslosen Narren gehalten hätten.
Wir stiessen von dem Lehmufer am Fusse des Marktplatzes ab, während die Landabtheilung unter der Führung des riesigen Asmani und Bombay’s ohne irgendwelches Gepäck ihre Reise nach Süden längs der Ufer des Sees antrat. Wir hatten abgemacht, mit ihnen an der Mündung eines[S. 190] jeden Flusses zusammenzutreffen und sie von einem Ufer ans andere überzusetzen.
Der Doctor fuhr in Sayd bin Madschid’s Boot, welches ungefähr ein Drittel kürzer als das unter meinem Befehl stehende war, voran und die britische Flagge, die an einem Bambusrohr befestigt war, flatterte hinter ihm her wie ein scharlachrother Meteor. Mein mit Wadschidschi-Matrosen bemanntes Boot, die ich gemiethet hatte, um die Boote vom Cap Tongwe wieder nach Udschidschi Bunder zurückzubringen, folgte und hatte eine viel höhere Flaggenstange, auf der das immer schöne amerikanische Sternenbanner flatterte. Die bedeutende Höhe meiner Stange entlockte dem Doctor, dessen loyaler Patriotismus dadurch erregt wurde, die Bemerkung, er werde sich die höchste Palmyrapalme als Flaggenstange abschneiden, da es sich nicht gezieme, dass die britische Flagge soviel niedriger als die der Vereinigten Staaten sei.
Unsere Soldaten waren über den Gedanken, nach Unyanyembé zu gehen, durchaus nicht weniger freudig erregt als wir. Sie stimmten den Freudengesang der Zanzibarer Bootsleute an, welcher mit dem begeisterten Chorgesang endigt: „Kinan de re re Kitunga“. So ruderten sie dann wie Tolle daher, bis sie vor reiner Erschöpfung genöthigt waren auszuruhen, während der Schweiss stromweise an ihnen herabfloss. Sowie sie ausgeruht hatten, machten sie sich wieder an ihre Ruder und stimmten den Gesang der Mrima an: „O Mama, re de mi Ky“, der sie bald wieder zu grossen Anstrengungen anspornte. Durch diese energischen ruckweisen Anstrengungen, sowie durch Gesang und Gelächter, Gestöhne und Geschrei, gaben unsere schwitzenden und keuchenden Leute ihrem freudigen Gefühl über den Gedanken Ausdruck, dass wir heimkehrten und dass auf der Route, die ich nach Unyanyembé erwählt, durchaus keine Gefahr zu fürchten sei.
schrien sie mit wildem Gelächter und führten dabei wuchtige[S. 191] Streiche mit den Rudern, welche die alten ungelenken Boote vom Vorsteven bis zum Spiegel erbeben liessen.
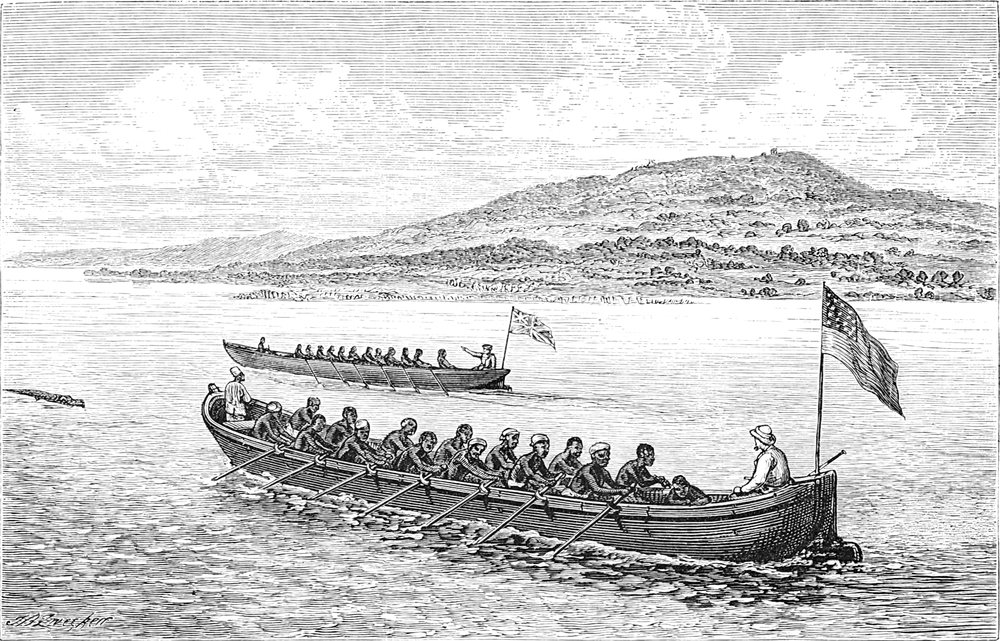
Die Abtheilung am Ufer schien an unserer Aufregung theilzunehmen und sang den wilden Refrain des tollen afrikanischen Liedes mit. Wir sahen, wie sie vorwärts eilten, um mit uns gleichen Schritt zu halten, wenn wir um die Caps und Vorsprünge und an den Buchten vorbeifuhren, deren Ufer mit Riedgras, Schilfrohr und Binsen bedeckt waren. Wir sahen den winzigen, beweglichen Kalulu, den kleinen Bilali und Madschwara die der Karavane gehörigen Heerden von Ziegen, Schafen und Eseln treiben und auch diese Thiere schienen sich an der allgemeinen Freude zu betheiligen.
Auch die stolze, wilde Natur, der hehre, blaue, unendliche Himmelsdom, die weite, lebhaft grüne Ebene zur Linken, die ausgedehnte, glänzende Wasserfläche schien in feierlicher Heiterkeit an unserer Freude theilzunehmen und sie zu vermehren.
Um 10 Uhr morgens kamen wir an der Wohnstätte Kirindo’s, eines alten Häuptlings, an, der wegen seiner grossen Freundlichkeit gegen Dr. Livingstone und Feindseligkeit gegen die Araber merkwürdig ist. Diese konnten sich das nicht erklären, wogegen der Doctor den Grund wohl wusste; denn er hatte nur freundliche, aufrichtige Worte mit Kirindo gewechselt, während alle Araber mit ihm verkehrten, als ob er gar kein Mensch, viel weniger ein Häuptling sei.
Kirindo’s Wohnsitz liegt an der Mündung des Liutsché, die sehr breit ist. Der Fluss schleicht hier langsam durch einen Wald von Aeschinomenen (Markbäumen) in den See. Diesen Ort hatten wir als Sammelplatz für die See- und Landabtheilung bestimmt, damit die Boote alle ans andere, anderthalb Meilen entfernte Ufer hinüberbrächten. Die Mündung des Liutsché bildet die Bai von Ukaranga, welche ihren Namen vom gleichnamigen, am andern Ufer, einige hundert Schritt vom See entfernt liegenden Dorf Ukaranga führt, wohin wir übersetzen sollten. Aus dem grössern Boote wurde alles Gepäck entfernt und sorgfältig ins kleinere gepackt; einige ausgesucht gute Ruderer fuhren[S. 192] nun mit dem Doctor ab, welcher das Aufschlagen des Lagers in Ukaranga überwachen sollte, während ich zurückblieb, um die widerspenstigen, eigensinnigen Esel zu binden und sie in das grosse Boot zu schleppen, damit dasselbe nicht Gefahr laufe, umgeworfen und von hungrigen Krokodilen verzehrt zu werden, die ringsumher auf Beute lauerten. Dann wurde die Ziegenheerde eingeschifft und daneben so viele von unsern Leuten als möglich. Etwa 30 blieben noch mit mir zurück und für diese sollte das Boot noch einmal zurückkehren.
Wir kamen alle gut in Ukaranga an, obwol wir in die gefährliche Nähe einer Heerde Flusspferde geriethen, und setzten über die weite Mündung des damals in Flut befindlichen Liutsché in etwa vier Stunden.
Am nächsten Tage nahmen wir unsern Weg in derselben Weise, wie wir von Udschidschi abgereist waren, wieder nach Süden auf, so zwar, dass die Seeabtheilung sich so nahe als möglich am Ufer hielt, jedoch, wo es sich thun liess und Wind und Wetter es gestatteten, kühn über die zahlreichen kleinen Buchten, welche die Ufer des Tanganika einkerben, wegsetzte. Die Ufer waren wunderschön grün infolge der kurz vorher stattgehabten Regengüsse; das Wasser des Sees spiegelte das blaue Firmament treulich wieder. Es gab zahlreiche Flusspferde; die an diesem Tage gesehenen hatten rothe Ringe rund um den untern Theil des Ohrs und am Halse. Eins dieser Ungeheuer, das etwas spät auftauchte, wurde durch unser Boot, welches direct auf dasselbe zusteuerte, so erschreckt, dass es jählings untertauchte und dabei seine ganze Körperlänge zeigte. Auf halbem Wege zwischen der Mündung des Malagarazi und der des Liutsché sahen wir ein Lager am Ufer, nämlich Mohammed bin Gharib, einen Mswahili, der oft in Livingstone’s mir mündlich mitgetheilten Erzählungen seiner Abenteuer und Reisen als einer der freundlichsten und besten Muselmänner Central-Afrikas vorgekommen war. Er erschien mir als ein freundlich gesinnter Mann mit einem Gesichtsausdruck, den man hier selten antrifft, dem der Offenherzigkeit nämlich.
Die Vegetation der Ufer war, als wir weiter kamen,[S. 193] wahrhaft tropisch; jede Biegung des Sees zeigte uns neue Schönheiten. Den weichen Kreidefelsen, aus welchen die steilen Ufer des Sees in der Nähe des Malagarazi meist bestehen, hat die Brandung eigenthümlich mitgespielt.
An der Mündung dieses Flusses langten wir ungefähr um 2 Uhr nachmittags an, nachdem wir 18 Meilen von Ukaranga gerudert waren. Die Landabtheilung stiess sehr ermüdet ungefähr um 5 Uhr nachmittags zu uns.
Der nächste Tag wurde dazu verwandt, die Karavane über die breite Mündung des Malagarazi in unser einige Meilen nördlich vom Flusse belegenes Lager überzusetzen. Diesen Fluss würde eine civilisirte Gemeinde sehr vortheilhaft finden, um die Entfernung zwischen dem Tanganika und der Küste zu verkürzen. Man könnte nämlich fast 100 Meilen auf diesem Flusse fahren, der zu allen Jahreszeiten tief genug ist, um bis Kiala in Uvinza schiffbar zu sein, von wo aus sich ein gerader Weg leicht nach Unyanyembé führen liesse. Auch Missionäre könnten auf ihren Reisen nach Uvinza, Uhha und Ugala davon Vortheil ziehen.
Am 30. kamen wir, indem wir die malerischen Caps Kagongo, Mviga und Kivoe umschifften, nach ungefähr dreistündigem Rudern in Sicht der an der Mündung des raschfliessenden aber trüben Rugufu belegenen Dorfschaften. Hier hatten wir wieder die Karavane über die von Krokodilen heimgesuchte Flussmündung überzusetzen.
Am Morgen des 31. schickten wir ein Boot mit Leuten aus, um uns Nahrungsmittel in einigen Dörfern, die man auf der andern Seite erblickte, zu besorgen. Für 4 Doti kauften wir genug, um die aus 48 Personen bestehende Karavane vier Tage lang zu erhalten. Dann lichteten wir die Anker, theilten dem Kirangozi mit, dass wir nach Urimba wollten und gaben ihm den Befehl, sich so nahe wie möglich am Ufer des Sees zu halten, wo es thunlich wäre, sonst aber so zu verfahren, wie es am besten ginge. Von der Mündung des Rugufu, dessen Quellen wir auf unserer pfadlosen Herreise nach Udschidschi passirt hatten, bis nach dem sechs Tagereisen zu Wasser entfernten Urimba gibt es keine Dörfer und also auch keine Nahrungsmittel. Da jedoch die Landabtheilung, ehe sie Udschidschi verlassen,[S. 194] Rationen für acht Tage mitbekommen und an diesem Morgen für vier Tage ausgetheilt erhalten hatte, befand sie sich in keiner Gefahr zu verhungern, falls die Gebirgsspitzen, welche sich jetzt steil und abschüssig hintereinander entfalteten, sie daran verhindern sollten, mit uns im Verkehr zu bleiben. Man darf nämlich nicht vergessen, dass eine Reise wie diese bisher noch nie von einem Araber oder Mswahili versucht worden war und daher jeder Schritt, den die Leute thaten, in ein Land hinein geschah, von dem sie nicht wussten, an welchem Theil des Ufers der Weg sie hinführe. Wir segelten um das steile Vorgebirge von Kivoe, dessen waldbewachsene Höhe und zackiger Abhang, der bis an den Rand des Ufers von Holz bewachsen war und dessen herrliche Buchten und ruhige Schlupfwinkel wol jedermann hätten poetisch stimmen können; boten den wilden Wogen der Bucht von Kivoe Trotz und fuhren direct auf das nächste Cap Mizohazy zu, wo wir infolge von Wind und Wellen genöthigt waren, zur Nacht halt zu machen.
Hinter Mizohazy liegt das schroffe Cap Kabogo, nicht das furchtbare Kabogo, dessen Namen die abergläubischen Eingeborenen in geheimnissvolle Schrecken gehüllt haben und dessen gewaltiges Donnergebrüll wir auf unserer Flucht vor den Wahha beim Uebersetzen über den Rugufu vernommen, sondern eine Landspitze in Ukaranga, an deren harten, unwirthlichen Felsen so manches Boot schon zerschellt worden; wir fuhren dicht an seinen unheildrohenden Felsmassen vorbei, voll Dank für die Ruhe des Tanganika. In der Nähe dieses Kabogo befinden sich einige sehr schöne Mvulebäume, die sich sehr zum Bootbau eignen, es gibt aber keine lärmenden Eingeborene, die sich um das Privilegium sie abzuholzen streiten.
Am Rande des Wassers, ungefähr drei Fuss über demselben, erblickte man deutlich an der glatten Fläche der Felsabhänge von Kabogo den höchsten Wasserstand des Sees. Dies bewies uns, dass der Tanganika während der Regenzeit ungefähr drei Fuss über sein Niveau in der trockenen Jahreszeit steigt und während der letztern durch Verdunstung auf sein normales Niveau zurückgeführt wird. Durch die Menge Flüsse, die wir auf dieser Reise passirten,[S. 195] war ich im Stande zu beobachten, ob, wie man mir gesagt, eine Strömung nach Norden vorhanden sei. Ich sah es deutlich, dass, wenn der Wind aus Südwesten, Süden oder Südosten blies, die braune Flut der Flüsse nach Norden strömte; doch kam es auch etliche mal vor, dass, wenn wir bei Nordwest- und Nordwinden an den Flussmündungen vorbeikamen, die trüben Fluten von den Mündungen aus nach Süden getrieben wurden, woraus ich den Schluss ziehe, dass im Tanganika keine andere Strömung existirt, als die vom veränderlichen Winde bedingte.
In einer gemüthlichen, bei einem Sigunga benannten Orte gelegenen Bucht legten wir an, um unser zweites Frühstück einzunehmen. Eine an der Mündung der Bai befindliche Insel machte ganz den Eindruck, dass dies ein sehr schöner Ort für eine Missionsstation sein würde. Die grossen Bergabhänge im Hintergrunde, ein wellenförmiges, gut bewaldetes Land zwischen denselben und der Bucht vermehrten noch die Reize dieses Ortes. Die Insel, die Platz für ein grosses, wohlzuvertheidigendes Dorf hat, könnte aus Klugheitsrücksichten die eigentliche Mission und Gemeinde aufnehmen. Die von Land umschlossene Bucht würde ihre Fischerei und Handelsfahrzeuge beschützen und der fruchtbare Boden zwischen den Bergen und der Bai die Bevölkerung der Insel aufs allerreichlichste zu ernähren im Stande sein. Holz, um Boote und Häuser zu bauen, ist dicht bei der Hand; das umgebende Land hat viele Jagdthiere, und das gelehrige, höfliche Volk von Ukaranga wartet nur auf Seelenhirten.
Nach einem kurzen Aufenthalt in dem schönen Sigunga stiessen wir vom Lande und kamen nach drei Stunden an der Mündung des Flusses Uwelasia an. Wir amüsirten uns damit, auf die zahlreichen Flusspferde und Krokodile zu schiessen, wodurch wir auch hofften, die Aufmerksamkeit unserer Landabtheilung auf uns zu ziehen, deren Flinten wir seit dem Rugufu nicht mehr hatten knallen hören.
Am 3. Januar verliessen wir Uwelasia und kamen am Cap Herembe vorüber in der Bai von Tongwe an. Diese Bucht ist ungefähr 25 Meilen breit und erstreckt sich vom Cap Herembe bis zum Cap Tongwe. Da wir uns so nahe[S. 196] an unserm Bestimmungsort befanden, Urimba ist nämlich blos sechs Meilen von der Herembe-Spitze entfernt, machten sich die Mannschaften beider Boote eifrig an ihre Ruder und ermuthigten sich mit Geschrei, Gelächter und Gesang zu den äussersten Anstrengungen. Die Flaggen der beiden grossen angelsächsischen Völker spielten in den milden Lüften, näherten sich bisweilen und entfernten sich dann wieder wie zwei schüchterne Liebhaber. Das schmale, kleine Boot Livingstone’s blieb voran und die rothe Kreuzfahne Englands, die vor mir herflatterte, schien dem schönen nachfolgenden Boote zu sagen: „Folge mir, England führt Dich.“ Und gebührte hier nicht wirklich England der erste Platz? Es hat ja ein Recht dazu, indem es den Tanganika entdeckt hat; Amerika ist erst als zweites hinzugekommen.
Urimba, ein grosser Bezirk von Kawendi, hat ein Dorf gleiches Namens, das von Flüchtlingen aus Yombeh bewohnt wird, welche das Delta des Loadscheri, obgleich es, wie das des Rusizi, ein äusserst ungesunder Ort ist, doch der Nachbarschaft Pumburu’s, des Sultans des südlichen Kawendi, sehr vorziehen. Sie scheinen von den nachhaltigen Verfolgungen ihrer Unterdrücker so eingeschüchtert und mistrauisch gegen Fremde geworden zu sein, dass sie uns durchaus nicht in ihr Dorf lassen wollten, worüber ich, aufrichtig gesagt, sehr erfreut war, nachdem ich mir die pesthauchende Fäulniss ihrer Umgebung angesehen hatte. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, ja sogar in einer Entfernung von einigen Meilen nach beiden Seiten, könnte meines Erachtens ein Weisser auch nicht eine einzige Nacht schlafen, ohne sich den Tod zu holen. Südlich vom Dorfe, am äussersten südöstlichen Winkel der Tongwe-Bai, etwa 1½ Meile westlich vom hohen Pic Kivanga oder Kakungu, fand ich einen geeigneten Lagerplatz. Nach einer vom Doctor angestellten Beobachtung befanden wir uns auf 5° 54′ südl. Breite.
Die Eingeborenen hatten nichts von unserer Landabtheilung gehört und da das Delta des Loadscheri und Mogambazi sich 15 Meilen lang hinzieht und eine ganz unpassirbare Gegend bildete, die vollständig flach, von hohem Matete, Aeschinomenen und Dornbüschen bewachsen und von Wasser[S. 197] überflutet ist, so war es unnütz, unsere Leute dadurch abzustrapaziren, dass sie in diesem unwirthlichen Lande nach unserer Landabtheilung suchten. Auch konnten wir uns keine Lebensmittel verschaffen; denn die Dörfer waren halbverhungert, sodass die Einwohner aus der Hand in den Mund lebten von dem, was ein widerwilliges Geschick ihnen in die Netze trieb.
Am zweiten Tage nach unserer Ankunft in Urimba begab ich mich mit meinem Flintenträger Kalulu, der Livingstone’s vorzügliches doppelläufiges Gewehr (ein Reilly Nr. 12) trug, auf die Suche nach Wild. Nachdem ich ungefähr eine Meile gegangen, stiess ich auf eine Heerde Zebras. Ich wusste es dadurch, dass ich auf Hand und Füssen vorwärtskroch, so einzurichten, dass ich auf etwa 100 Schritt in ihre Nähe kam; es war aber ein schlimmer Ort, denn niedrige Sträucher stachen mich; die Tsetse-Fliegen liessen sich auf das Visir meiner Flinte nieder, zerstachen mir die Nase, flogen mir in die Augen, kurz brachten mich vollständig ausser Fassung; und um meine Unzufriedenheit noch zu vermehren, beunruhigten meine Anstrengungen, mich von den Dornen freizumachen, die Zebras, welche sich den verdächtigen Gegenstand im Busch ansahen. Ich feuerte zwar auf die Brust eines derselben, verfehlte es aber, wie zu erwarten war. Darauf galopirten die Zebras ungefähr 300 Schritt weit fort; ich stürzte ins Freie, spannte rasch den Drücker des linken Laufs, zielte nach einem herrlichen Thier, das seinen Gefährten vorantrabte, und schickte ihm auf gut Glück eine Kugel durchs Herz. Auch brachte mir ein anderer glücklicher Schuss eine grosse Gans mit scharfen Hornsporen am vordem Theile des Flügels. Dieser Fleischvorrath trug wesentlich dazu bei, unsere Gesellschaft zu verproviantiren für die uns bevorstehende Reise durch das unbekannte Land, das sich zwischen uns und Mrera in Rusawa in Kawendi befand.
Erst am dritten Tage nach unserer Ankunft im Lager von Urimba langte unsere Landabtheilung an. Sie hatte unsere grosse Flagge auf einem zwanzig Fuss hohen Bambus über dem höchsten Baum in der Nähe unseres Lagers erblickt, als sie den scharfen, hohen Bergrücken hinter dem funfzehn[S. 198] Meilen entfernten Nerembe überschritten, und dieselbe zuerst für einen grossen Vogel gehalten; es gab aber scharfsichtige Leute unter ihnen, und geführt von ihnen erreichten sie unser Lager, wo sie so begrüsst wurden, wie es nur Leuten widerfährt, die für verloren gehalten sind.
In diesem Lager bekam ich einen neuen Fieberanfall, der durch die Nachbarschaft des fürchterlichen Deltas herbeigeführt wurde, dessen blosser Anblick mich schon krank machte.
Am 7. Januar brachen wir unser Lager ab und wandten uns nach Osten, was für mich soviel wie nach Hause hiess. Doch geschah dies nicht ohne Bedauern! Ich hatte viel Glück und Freude und angenehme Gesellschaft an den Ufern des Sees gefunden, hatte liebliche Landschaften gesehen, welche mich sirenenartig zur Ruhe einluden, wo es weder Tumult, noch Streit, noch Niederlagen, weder Hoffnung, noch Enttäuschung gab, sondern nur eine träumerische, träge, aber angenehme Ruhe, die nur einige Nachtheile mit sich führte. Denn hier gab es Fieber; und ich hatte keine Bücher oder Zeitungen, kein Weib unserer Rasse, kein Theater oder Hotel oder Restaurant, keine Austern oder Pfeffermünz-Pasteten oder Buchweizen-Kuchen oder sonst etwas, was ein gebildeter Gaumen liebt. Daher hatte ich den Muth, als ich dem friedlichen See und den grossen, blauen Bergen, welche je weiter sie zu beiden Seiten in die Ferne rückten, noch intensiver blau wurden, Lebewohl sagte, dieses schreckliche Wort ohne Thränen und Seufzer auszusprechen.
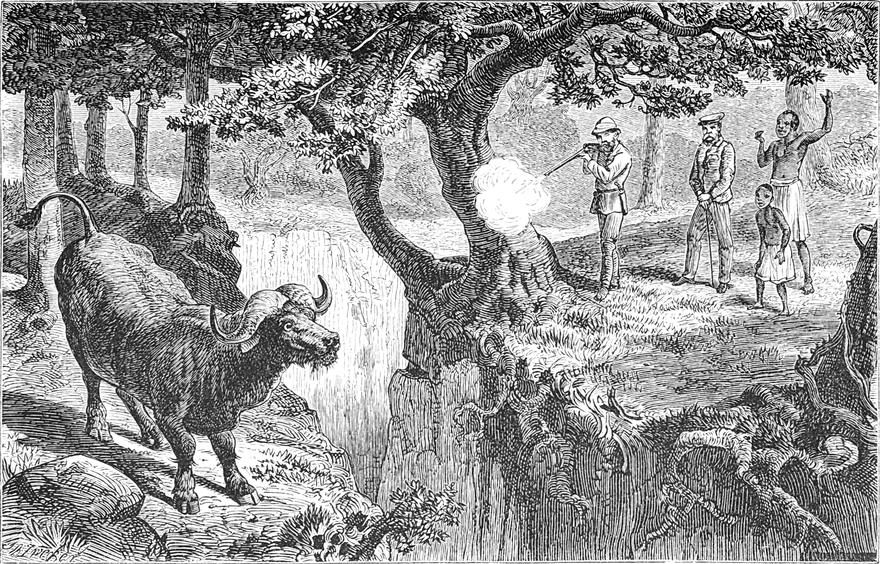
Unser Weg führte uns durch das Thal des Loadscheri, welches sich, nachdem wir sein Delta verlassen, immer mehr verengte, bis es zu einer Waldschlucht wurde, die von dem laut brüllenden Strom ganz erfüllt war, dessen überwältigender Sturz selbst die Luft, die wir athmeten, in Mitleidenschaft zu ziehen schien. In dieser engen Bergschlucht wurde es drückend und sehr zur Zeit führte der Weg auf eine Anhöhe, weiter auf eine Terrasse, dann auf einen Berg und zuletzt auf ein Gebirge, auf dem wir unser Lager aufschlugen. Als wir noch mit Vorbereitungen dazu beschäftigt waren, zeigte der Doctor schweigend auf etwas hin und sofort herrschte überall todtenähnliche Stille. Das Chinin, welches[S. 199] ich am Morgen genommen, schien jeden Theil meines Gehirns afficirt zu haben; dennoch blieb ein böses Uebel nach; obgleich ich aber unter der schweren Last der Reillyflinte bebte, so kroch ich doch dahin, wo er hinwies. Ich blickte eine tiefe Feldschlucht hinab, an deren anderer Seite ich eine schöne Büffelkuh hinaufklettern sah. Sie hatte eben den Gipfel erreicht und wandte sich um, um ihren Feind zu betrachten, als es mir gelang, ihr einen Schuss gerade hinter das Schulterblatt und dicht am Rückgrat hineinzujagen, was ihr ein dumpfes Schmerzgeschrei entlockte. „Sie ist erlegt“, rief der Doctor, „das ist ein sicheres Zeichen, dass Sie dieselbe getroffen haben“; und meine Leute erhoben sogar ein Freudengeschrei bei der Aussicht auf Fleisch. Ein zweiter Schuss in den Rücken brachte das Thier auf die Knie und ein dritter endete sein Leben. So hatten wir wieder Vorrath an Lebensmitteln, die uns, zerschnitten und über einem Feuer getrocknet, wie die Wangwana es zu thun pflegen, ein gut Stück durch die vor uns liegende, menschenleere Wildniss weiter bringen konnten. Für den Doctor und mich liessen wir die Zunge, den Höcker und einige besonders gute Stücke salzen und hatten so nach ein paar Tagen vorzügliches Pökelfleisch. Es ist nicht unangemessen, dass ich hier mittheile, dass die Wangwana das Gewehr mehr lobten als den Jäger.
Am nächsten Tage setzten wir unsern Marsch unter der Führung unseres Kirangozi nach Osten fort; aus dem Wege, den er uns führte, war aber zu ersehen, dass er nichts vom Lande wisse, obwol er uns durch seine Redseligkeit hatte glauben lassen, er kenne Ngondo, Yombeh und Pumburu’s Districte ganz genau. Als wir ihn von der Spitze der Karavane zurückriefen, waren wir im Begriff, in den reissenden Loadscheri hinabzusteigen, auf dessen anderer Seite sich drei unpassirbare Bergzüge ausdehnten, die wir in einer ganz von unserm Wege abliegenden Richtung nach Nord-Nordost hätten passiren müssen. Nachdem ich mich mit dem Doctor besprochen, trat ich selbst an die Spitze der Karavane, folgte dem Grat des Bergrückens und zog direct nach Osten, ohne auf den Weg weiter zu achten. Zuweilen kreuzte ein bereister Weg unsern Pfad und als wir demselben[S. 200] folgten, kamen wir an die Furt des Loadscheri. Dieser entspringt im Süden und Südosten des Pic Kakungu. Nach Ueberschreitung des Flusses benutzten wir den Weg so gut wir konnten, bis wir die von Karah nach Ngondo und Pumburu im südlichen Kawendi führende Hauptstrasse erreichten.
Bald nachdem wir unser Lager verlassen, bogen wir von dem bereisten Wege ab und gingen auf eine in dem vor uns liegenden Bogen von Bergen befindliche Oeffnung los, da sich Pumburu mit dem Volke von Manya Msengé, einem District von Nord-Kawendi, im Kriege befand. Das Land besitzt eine Fülle von Jagdthieren, Büffeln und Zebras; unter den hervorragenden Bäumen befand sich die Hyphaene und Borassuspalme, ein Baum, welcher Früchte von der Grösse der Kanonenkugel eines 600-Pfünders trägt, welche die Eingeborenen nach Aussage des Doctors „Mabyah“[7] nennen und deren Samen sie rösten und essen. Als Nahrungsmittel sind sie dem Europäer nicht zu empfehlen.
Am 10. war ich, an der Spitze meiner Leute, den Kompass in der Hand, drei Stunden lang Führer. Ein schönes Parkland lag vor uns; das Gras war aber sehr hoch und die jetzt ernstlich eintretende Regenzeit machte mir meine Arbeit höchst unangenehm. Durch dieses hohe Gras, das mir immer bis an den Hals reichte, musste ich mir nämlich auf meinen Kompass bauend meinen Weg bahnen, um die Expedition zu führen, da keine Spur eines Weges vorlag und wir uns jetzt in einem völlig unbereisten Lande befanden. An einem schönen, nach Norden fliessenden kleinen Bach, einem der Zuflüsse des Rugufu, schlugen wir unser Lager auf.
Auch der 11. sah mich durch das Gras ziehen, welches bei jedem Schritt Regentropfen auf mich herabschauerte. Nach zwei Stunden überschritten wir wieder einen kleinen Bach, der in seinem Bett schlüpfrige, den Einfluss heftiger Giessbäche bekundende Felsen enthielt. Viele grosse Pilze gedeihen hier. Als wir den Bach passirten, rief ein alter[S. 201] Pagazi aus Unyamwezi in wehmüthigem Tone: „Mein Kibuyu ist todt!“ wodurch er sagen wollte, er sei ausgeglitten und habe beim Falle seinen auf Kiswahili „Kibuyu“ genannten Kürbis zerbrochen.
Am östlichen Ufer machten wir halt, um unser zweites Frühstück einzunehmen, und kamen nach einem Marsche von 1½ Stunde an einen weitern Bach, den ich zuerst wegen der Aehnlichkeit seiner Umgebung für den Mtambu hielt, obgleich meine Karte mir sagte, dass dies nicht möglich sei. Die umliegende Landschaft hatte jedoch viele Aehnlichkeit mit jener, und im Norden sahen wir einen dem Magdala ähnlichen, tafelförmigen Berg, den ich auf unserm Wege an den Malagarazi im Norden von Imrera entdeckt hatte. Obwol wir nur 3½ Stunden gereist waren, war der Doctor sehr matt, da das Land äusserst uneben ist.
Am nächsten Tage schritten wir über mehrere Bergrücken, wo uns herrliche Landschaften von überwältigender Schönheit überall umgaben, und erblickten einen mächtigen, raschfliessenden Strom, dessen Bett zwischen enorm hohen Sandsteinmauern eingesenkt war und dort wie ein kleiner Niagara lärmte und toste.
Nachdem wir unser Lager auf einer malerischen Anhöhe aufgeschlagen hatten, wollte ich den Versuch machen, uns Fleisch zu verschaffen, das in dieser interessanten Gegend doch jedenfalls vorhanden zu sein schien. Ich ging daher mit meinem kleinen Winchester-Gewehr die Ufer des Flusses entlang nach Osten. Etwa ein bis zwei Stunden zog ich so weiter durch eine Gegend, die immer malerischer und lieblicher wurde, und ging dann eine viel versprechende Schlucht hinauf. Ohne Erfolg an ihrem Rande entlang schreitend, befand ich mich alsbald zu meinem leicht begreiflichen Erstaunen direct einem Elefanten gegenüber, diesem furchtbaren Kolosse, der Personification der Macht in Afrika, der seine grossen, breiten Ohren wie schwellende Segel ausgebreitet hielt. Mich dünkte, als ich seinen gewaltigen Rüssel wie einen warnenden Finger vorwärts gestreckt sah, eine Stimme zu hören, die mir „Siste, Venator!“ zurief. Doch weiss ich nicht, ob dies nur in meiner Einbildung lag oder von Kalulu herkam, der, wie ich glaube,[S. 202] gerade rief: „Tembo, tembo! Bana yango!“ („ein Elefant, ein Elefant, Herr!“). Denn der junge Schelm war, sobald er den furchtbaren Koloss in solcher unmittelbaren Nähe erblickte, davongelaufen. Als ich mich von meinem Erstaunen erholt, hielt auch ich es für klüger, mich zurückzuziehen, zumal ich nur eine mit verrätherischen Sägespänepatronen geladene Erbsenflinte in der Hand hatte. Wie ich zurückblickte sah ich, wie er seinen Rüssel bewegte, und verstand, dass er sagen wollte: „Adieu, junger Mann! es ist ein Glück für Dich, dass Du Dich zu rechter Zeit entfernst, denn sonst hätte ich Dich zu Brei zerstampft.“
Als ich mir hierzu gratulirte, flog eine Wespe direct auf mich zu und pflanzte mir ihren Stachel in den Nacken, sodass für diesen Nachmittag mein in Aussicht genommenes Vergnügen vereitelt war. Bei meiner Rückkehr ins Lager fand ich meine Leute murrend; ihre Provision war zu Ende und für die nächsten drei Tage war keine Aussicht vorhanden, ihnen welche zu schaffen. Mit dem gefrässigen Individuen eigenen Mangel an Vorsicht hatten sie ihre Kornrationen und den ganzen Vorrath an Zebra- und Büffelfleisch möglichst rasch verzehrt und schrien jetzt, sie müssten verhungern.
Zahlreiche Spuren von Thieren waren zwar vorhanden; da aber die Regenzeit da war, hatte sich das Wild überall hin zerstreut; in der trockenen Jahreszeit hätten wir in diesen Wäldern unsere Speisekammer jeden Tag mit neuen Vorräthen versehen können.
Als der Doctor und ich ungefähr um 6 oder 7 Uhr morgens unsern Thee vor unserm Zelt einnahmen, ging eine aus zwölf Stück bestehende Heerde von Elefanten etwa 800 Schritt an uns vorüber. Unsere Fundi Asmani und Mabruki Kisesa wurden sofort abgesandt, um sie zu verfolgen. Ich wäre selbst mit meinem schweren Reilly-Gewehre ihnen gefolgt, wäre ich nicht so furchtbar ermüdet gewesen. Alsbald hörten wir das Knallen ihrer Flinten und hofften, dass sie Glück haben möchten, da sie dann einen tüchtigen Vorrath an Fleisch gehabt und wir beide uns an einem Elefantenfuss als zarten schönen Braten hätten erlaben können. Nach einer Stunde aber kehrten sie ohne jeglichen[S. 203] Erfolg zurück; sie hatten den Thieren nur etwas Blut entzogen, welches sie uns auf einem Blatte zeigten.

Um einen afrikanischen Elefanten zu tödten, dazu gehört ein sehr gutes gezogenes Gewehr. Ich glaube, dass ein Kaliber Nr. 8, mit einer Fraser’schen Kugel geladen und in die Schläfe geschossen, jedesmal einen Elefanten zu Fall bringen würde. Faulkner erzählt zwar einige sonderbare Geschichten, wie er auf einen Elefanten zugetreten sei und ihn durch eine in die Stirn gejagte Kugel sofort getödtet habe. Die Erzählung ist jedoch so unglaublich, dass ich sie lieber nicht glaube; namentlich da er hinzufügt, der Abdruck der Mündung seines Gewehrs habe sich am Rumpfe des Elefanten vorgefunden. Afrikanische Reisende, namentlich Jagdfreunde, lieben es oft zu sehr, Dinge zu erzählen, die für gewöhnliche Menschen ans Unglaubliche streifen. Solche Geschichten muss man wegen des Amüsements, die sie heimischen Lesern gewähren, cum grano salis aufnehmen. Wenn ich je in Zukunft von jemandem höre, dass er auf 500 Meter Entfernung einer Antilope das Rückgrat gebrochen, so werde ich annehmen, es sei durch einen Schreib- oder Druckfehler eine Null zuviel hinzugekommen, denn das ist eine in einem afrikanischen Walde fast unmögliche Heldenthat. Vielleicht kann es einmal vorkommen, aber gewiss nicht zweimal nacheinander. Denn eine Antilope gibt bei einer Entfernung von 500 Meter eine sehr kleine Zielscheibe ab; und es gehören derartige Geschichten durch göttliches Recht dem Jäger an, der Afrika nur um der Jagd willen durchzieht. An der Küste von Zanzibar habe ich junge Officiere getroffen, wenig über zwanzig Jahr alt, die mit erstaunlicher Zungenfertigkeit von ihren fürchterlichen Abenteuern mit Elefanten, Leoparden, Löwen und sonstigen Thieren zu erzählen wussten. So oft sie nur auf ein im Flusse befindliches Flusspferd geschossen, hatten sie es erlegt; wenn sie einer Antilope begegnet waren, war es bestimmt ein Löwe gewesen und sie hatten ihn sofort hingestreckt; wenn sie einen Elefanten in einem zoologischen Garten erblickten, war es bestimmt derjenige, den sie in Afrika gesehen und ohne Mühe eingefangen hatten: „Ich habe noch jetzt die Hauer zu Hause und kann sie Ihnen,[S. 204] wenn Sie wollen, eines Tages zeigen.“ Bei manchen Leuten ist es eine Krankheit, eine wirkliche Manie, dass sie nie im Stande sind, die positive, buchstäbliche Wahrheit zu erzählen. Das Reisen in Afrika ist an sich schon hinlänglich gefährlich, ohne dass man es noch zu übertreiben braucht. Fast alle Leute, welche sich bei der abessinischen Expedition befanden, werden sich des wunderlichen Majors erinnern, der seine furchtbaren, ausserordentlich schrecklichen Geschichten massenhaft zu erzählen pflegte. Eines Tages beschenkte ich diesen Herrn mit einer mir von Satanta, dem Häuptling der Kiowas, in der Nähe von Medicine Lodge zu Kansas, geschenkten Büffelhaut. Doch schon am nächsten Tage hörte ich, dass er den Büffel auf einer amerikanischen Prairie mit einer Pistolenkugel erschossen habe. Dies ist nur ein Beispiel der Phantasiestückchen, welche viele Reisende zu erzählen lieben. Viele Leute haben eine Neigung zur Uebertreibung. Die Jäger von Süd- und Nordafrika sind berühmt wegen ihrer zahlreichen Jagdanekdoten, von denen ich meine, dass sie einfache Flunkereien sind.
Am 13. setzten wir unsern Marsch über verschiedene Bergrücken fort, und bei unserm Auf- und Absteigen erblickten wir nie vorher erforschte Berge und Thäler. Nach Norden zu stürzten sich vom Regen angeschwollene Bäche und erstreckten sich grossartige Urwälder, in deren Dämmerschatten ein Weisser früher nie gewandert war.
Am 14. sahen wir dieselben Landschaften, nämlich eine ununterbrochene Reihe sich dem Längengrade nach hinziehender Bergrücken, die miteinander und dem Tanganika-See parallel laufen. Nach Osten fallen diese Berge in steilen Abhängen und Terrassen nach tiefen Thälern zu ab, wogegen sie nach Westen zu allmählichere Abhänge bilden. Dies sind die besondern Charakterzüge von Ukawendi, der östlichen Wasserscheide des Tanganika.
An diesem Tage trafen wir in einem der Thäler mit einer Colonie Affen mit röthlichem Barte zusammen, deren Geheul an den Felsen widerhallte, als sie die Karavane erblickten. Es war mir unmöglich, mich ihnen zu nähern, denn sie kletterten an den Bäumen empor, kreischten mir drohend entgegen und sprangen dann rasch weiter, wenn[S. 205] ich mich noch mehr näherte. Beinahe hätten sie mich dazu gebracht, sie zu verfolgen, wenn mir nicht plötzlich eingefallen wäre, dass meine Abwesenheit die Expedition aufhielt.
Etwa um Mittag sahen wir unsern Magdala, den grossen sich thürmenden Berg, dessen steile, düster aussehende Masse unsere Blicke auf sich gezogen hatte, als er sich auf unserer eiligen Reise längs des grossen Kammes des Rusawa, dem Krokodilflusse zu, in seiner ganzen Grossartigkeit über die Ebene erhob. Die frühere mystische Schönheit der umliegenden, baumbekleideten Ebene erkannten wir wieder. Damals war sie ausgebleicht und von einem leichten Nebel lieblich bedeckt, jetzt hingegen mit lebhaftem Grün geschmückt. Alle Pflanzen, Kräuter und Bäume sprossten nach dem Regen in üppiger Lebenskraft. Flüsse, die in jenen heissen Sommertagen gar nicht vorhanden waren, stürzten sich jetzt schäumend zwischen dicken Gürteln mächtiger Bäume und tosend in die Waldthäler hinab. Wir passirten viele solcher Bäche, die alle Zuflüsse des Rugufu sind.
Schönes, bezauberndes Ukawendi! Womit soll ich die Lieblichkeit deiner hehren, wilden, freien, üppigen Natur vergleichen? Gibt es etwas Gleiches in Europa? Habe ich etwas Aehnliches in Asien, etwa in Indien gesehen? Ja, vielleicht in Mingrelien und Imeritien. Denn dort gibt es schäumende Flüsse, malerische Hügel, kühne Berge, emporstrebende Gebirge, weite Wälder mit herrlichen, hohen Baumreihen, reinen, geraden Stämmen, durch welche man lange Strecken hinabsehen kann wie hier. Nur dass man in Ukawendi fast die Vegetation wachsen sehen kann. So fruchtbar ist die Erde, die Natur so gütig, dass man sich, selbst ohne die Absicht sich hier niederzulassen oder den Wunsch, die verderbliche Atmosphäre länger als absolut nothwendig ist einzuathmen, unmerklich zu ihr hingezogen fühlt, wenn man an die Möglichkeit denkt, dass das unter dieser glänzenden, fesselnden Schönheit des Landes sich verbergende Verderben durch ein Culturvolk sich entfernen und die ganze Gegend sich ebenso gesund als fruchtbar machen liesse. Selbst als ich unter dem Druck der schrecklichen Krankheit dahinwankte; als sich mein Gemüth immer mehr[S. 206] und mehr verbitterte, mein Gehirn mitunter durch die stets wiederkehrenden Fieberanfälle afficirt wurde; als ich wusste, wie die aus eben dieser Schönheit entspringende Malaria mir langsam die Constitution untergrub und hinterlistig die Kräfte des Geistes und Körpers vernichtete, betrachtete ich das lockende Antlitz des Landes mit bethörter Liebe und fühlte eine gewisse Traurigkeit mich an jedem Tage beschleichen, der mich davon trennte, ja war fast geneigt, mit dem Schicksal zu hadern, das mich gewaltsam aus Ukawendi zu entfernen schien.
Am neunten Tage unseres Marsches von den Ufern des Tanganika erblickten wir unsern „Berg Magdala“, der sich wie eine dunkle Wolke im Nordosten erhob, wodurch mir klar wurde, dass wir uns Imrera näherten und dass unser Icarus-Vorsatz, die unbewohnten Dschungels von Ukawendi zu durchziehen, bald von Erfolg gekrönt sein werde. Gegen den Rathschlag aller Führer und die Vorschläge der ermüdeten und verhungerten Leute unserer Expedition hatte ich darauf bestanden, mich nur vom Kompass und meiner Karte leiten zu lassen. Zwar setzten die Führer alles daran, mich zu bewegen, meine Route zu verändern und nach Südwest zu ziehen, was mich, wenn ich darauf gehört hätte, unzweifelhaft ins südwestliche Ukonongo oder nordwestliche Ufipa gebracht haben würde. Traurig fragten mich die alten erfahrenen Soldaten, ob ich sie denn durchaus verhungern lassen wolle, da der Weg, den ich hätte einschlagen sollen, nach Nordosten läge. Ich zog es aber vor, mein Vertrauen auf den Kompass zu setzen. Zwar schien keine Sonne, als wir durch den Urwald, durch Dschungels, über Bäche und steile Bergrücken und in tiefe Thäler hinabzogen, sondern ein dicker Nebel bedeckte die Waldung; häufig prasselte der Regen auf uns herab, und das Firmament bestand aus einem undurchdringlichen grauen Dunst; aber der Doctor setzte vollständiges Zutrauen in mich, und ich blieb meinem Vorsatze treu.
Sobald wir an unserm Lager angekommen waren, zerstreuten sich meine Leute im Walde, um Nahrung zu suchen. Dicht dabei fanden sie einen Hain von Singwebäumen. Auch genügten die zahlreichen in der Nähe wachsenden Pilze,[S. 207] den nagenden Hunger meiner Leute zu stillen. Wäre es nicht heftiges Regenwetter gewesen, so hätte ich Wildpret fürs Lager schaffen können; doch hinderten mich die Ermattung und das schwächende Fieber ganz und gar daran, aus dem Lager zu gehen, wenn wir einmal halt gemacht hatten. Die Jäger wurden durch die in unserer Nachbarschaft befindlichen zahlreichen Löwen, deren schreckliches Gebrüll Tag und Nacht gehört wurde, so in Schrecken gesetzt, dass sie trotz der Belohnung von 5 Doti, welche ich auf jedes erlegte Thier ausgesetzt, es nicht wagten, in die finstern Waldwiesen oder schrecklichen Holzgehege ausserhalb des freundlich geschützten Lagers zu dringen.
Am Morgen des zehnten Tages versicherte ich meinen Leuten, dass wir uns ganz in der Nähe von Nahrungsmitteln befänden, ermunterte die Liebenswürdigsten unter ihnen durch dies Versprechen reichlicher Nahrung und drohte den Widerspenstigeren mit bösen Schlägen, falls sie meine Geduld zu sehr auf die Probe stellten. Dann zog ich Ost zu Nord durch den Wald, und die fast erschöpfte Expedition schleppte sich mit Mühe hinter mir her. Es war wirklich eine verzweifelte Lage, und ich bedauerte die armen Leute viel mehr als sie selbst es thaten. Obwol ich in ihrer Gegenwart aufbrauste, wenn sie sich niederlegen und nicht weiter ziehen wollten, war doch niemand weiter als ich davon entfernt, ihnen etwas zu thun. Denn ich war zu stolz auf sie; aber unter den Umständen wäre es gefährlich, ja sogar selbstmörderisch gewesen, einen Zweifel an der Richtigkeit des Weges zur Schau zu tragen. Die einfache Thatsache, dass ich meinen Weg nach des Doctors kleinem, köstlichen Rathgeber, dem Kompass, fortsetzte, übte einen grossen moralischen Einfluss auf sie aus, und obwol sie klagend und mit hagern Gesichtern protestirten, folgten sie doch meinen Fusstapfen mit einer geradezu rührenden Vertrauensseligkeit.
Viele Meilen lang schritten wir so über glattes, etwas abwärts geneigtes Rasenland, mit einem Blick in Wald und Parkschönheiten zur Rechten und Linken und vor uns, wie man sie selten sieht. In einem Tempo, das bald den Hauptkörper der Expedition weit hinter mir liess, ging ich voran[S. 208] mit einigen tapfern Burschen, die trotz ihrer schweren Last gleichen Schritt mit mir hielten. Nach einigen Stunden schritten wir den leichten, bequemen Abhang eines Bergrückens hinauf, der in wenigen Minuten die Wahrheit oder Ungenauigkeit meiner Karte feststellen sollte. Als wir an den östlichen Rand des Bergrückens kamen, erkannten wir in einer Entfernung von etwa fünf Meilen und 1000 Fuss unter dem Hochplateau, auf dem wir standen, das Thal von Imrera!
Zu Mittag befanden wir uns in unserm alten Lager. Die Eingeborenen sammelten sich um uns und brachten uns Vorräthe an Nahrungsmitteln sowie ihre Glückwünsche dazu dar, dass wir gut aus Udschidschi zurückgekommen seien. Es dauerte aber lange, ehe das letzte Mitglied der Expedition ankam. Die Füsse des Doctors waren nämlich sehr wund und bluteten infolge des mühsamen Marsches. Seine Schuhe waren so abgetragen, und er hatte dieselben so zerschnitten und mit einem Messer bearbeitet, um seinen mit Blasen bedeckten Füssen Erleichterung zu verschaffen, dass keiner von meinen Leuten sie als Geschenk angenommen haben würde, wenn er auch noch so sehr erpicht darauf gewesen wäre, seine Füsse nach Art der Wasungu zu bekleiden.
Der Führer Asmani war sehr erstaunt, als er sah, dass der kleine Kompass den Weg besser kenne als er, und erklärte es feierlichst als seine Ueberzeugung, jener könne nicht lügen. Sein Ruf litt sehr, weil das kleine Ding ihm die Palme streitig gemacht hatte, und nach diesem Vorfalle wurde seine gerühmte Kenntniss des Landes erheblich in Zweifel gezogen.
Nachdem wir einen Tag halt gemacht, um uns zu erholen, setzten wir unsern Weg am 18. Januar 1872 nach Unyanyembé fort. Einige Meilen hinter Imrera verlor Asmani wieder den Weg, und ich war genöthigt, ihm denselben zu zeigen, wodurch ich mir abermals Ehre und Vertrauen als Führer erwarb. Auch meine Schuhe waren sehr schlecht geworden und es war schwer zu entscheiden, ob die des Doctors oder die meinigen schlechter waren. Ueber das Aeussere des Landes war eine grosse Veränderung[S. 209] gekommen, seit ich durch dasselbe gen Norden nach Udschidschi gezogen war. Der wilde Wein hing jetzt in Trauben am Wege; die Kornähren waren hinreichend vorgeschritten, um zur Nahrung gepflückt und geröstet zu werden; die verschiedenen Pflanzen liessen ihre Blüten fallen und die dichten Wälder und Gräser des Landes waren grüner als je.
Am 19. kamen wir in Mpokwa’s verlassenem Dorfe an. Die Füsse des Doctors waren durch den Marsch sehr wund gerieben. Er war den ganzen Weg von Urimba zu Fuss gegangen, obgleich er einen Esel besass, während ich, zu meiner Schande sei es gesagt, hin und wieder geritten war, um mit meinen Kräften haushälterisch umzugehen, damit ich im Stande sei, nach unserer Ankunft im Lager zu jagen.
Zu unserm Gebrauch wurden zwei Hütten geräumt; als wir es uns aber gerade bequem machten, entdeckten unsere scharfäugigen Burschen mehrere Heerden von Jagdthieren in der westlich von Mpokwa gelegenen Ebene. Rasch verzehrte ich einen Bissen Kornbrot und Kaffee und eilte mit Bilali als Flintenträger und Livingstone’s berühmter Reilly-Flinte nebst den nöthigen Kugeln davon. Ich stürzte mich durch einen tiefen Bach, wurde abermals nass, bahnte mir den Weg durch ein dichtes Farrnkraut und kam schliesslich an einem dünnen Waldgürtel an, durch den ich gezwungen war zu kriechen. In 1½ Stunde befand ich mich bei einer Gruppe von Zebras, die sich 130 Meter entfernt spielend unter dem Schatten eines grossen Baumes herum bissen. Als ich mich plötzlich erhob, zog ich ihre Aufmerksamkeit auf mich, aber das treue alte Gewehr war schon an meiner Schulter und piff! paff! gingen beide Läufe los, und zwei herrliche Zebras, ein Männchen und ein Weibchen, fielen todt unter den Baum, unter dem sie gestanden hatten. Nach einigen Sekunden war ihnen der Hals durchschnitten; ich gab das Zeichen, dass ich Glück gehabt hätte, und bald war ich von einem Dutzend meiner Leute umringt, welche ihre Freude an den Tag legten durch reichliche Complimente, die sie meiner Flinte, aber nicht mir spendeten. Als ich mit dem Fleisch ins Lager zurückkam, empfing ich die Glückwünsche des Doctors, die ich viel höher schätzte, da er von einer langen Erfahrung her wusste, was Schiessen heisst.
[S. 210]
Als die essbaren Theile der beiden Zebras an die Wage gehängt wurden, fanden wir nach des Doctors Aufzeichnungen, dass wir 719 Pfund gutes Fleisch besassen, was unter 44 Leute vertheilt für jeden etwas über 16 Pfund ausmachte. Bombay war besonders glücklich, da er einen Traum gehabt, worin ich eine Hauptrolle gespielt und nach rechts und links Thiere erschossen hatte; als er mich nun mit dem wundervollen Reilly-Gewehr abziehen gesehen, hatte er meinen Erfolg durchaus nicht bezweifelt und daher seine Leute bereit gehalten, um mir zu folgen, sobald sie meine Flintenschüsse hören würden.
Das Nachstehende entnehme ich meinem Tagebuche:
20. Januar 1872. Heute machten wir halt. Als ich auf die Jagd ging, sah ich eine Heerde von elf Giraffen. Nach Ueberschreitung des Mpokwa-Baches gelang es mir, mich einer derselben auf 140 Meter zu nähern, von wo ich auf sie losfeuerte. Sie wurde zwar verwundet, doch gelang es mir nicht, sie zum Fall zu bringen, obgleich ich sehr wünschte, ein Fell zu besitzen.
Am Nachmittag ging ich nach der Ostseite vom Dorfe und stiess auf eine Heerde von sechs Giraffen. Ich verwundete abermals eine, doch kam sie trotz meiner Anstrengung davon.
Was für merkwürdige Thiere sind es doch! Wie schön sind ihre grossen, hellen Augen! Ich hätte einen Eid darauf leisten können, dass beide Schüsse gut getroffen hätten; die Thiere gingen aber mit so majestätischen Bewegungen ab, wie ein Klipper, der sich umwendet. Wenn sie laufen, haben sie einen ungeschickten Gang, der etwas den Verzerrungen einer indischen Nautch oder thebanischen Tänzerin ähnelt, und in einer träumerisch wogenden Bewegung besteht, an welcher sich selbst ihr Schwanz mit dem langen Büschel schwarzer Haare betheiligt.
Livingstone, welcher es wohl verstand, einen eifrigen, aber getäuschten Jäger zu trösten, schrieb meinen Mangel an Erfolg dem Umstand zu, dass ich blos mit Bleikugeln geschossen hätte, welche zu weich wären, um durch das dicke Fell der Giraffen zu dringen, und rieth mir, meine Zinkfeldflaschen zu zerschmelzen und die Kugeln dadurch härter zu[S. 211] machen. Es war nicht das erste mal, dass ich Ursache hatte, den Doctor als Reisegefährten zu bewundern. Niemand verstand es so gut wie er, jedermann im Unglück zu trösten oder das Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn ich ein Zebra getödtet, so war sein Freund Oswell, der südafrikanische Jäger und er selbst lange überzeugt gewesen, dass Zebrafleisch das schönste in ganz Afrika sei. Wenn ich eine Büffelkuh erlegt, so war sie bestimmt die beste ihrer Art und ihre Hörner werth, als Muster nach Hause transportirt zu werden, und wie fett war sie! Wenn ich ohne Beute nach Hause kam, so war entweder das Wild sehr scheu oder die Leute hatten zuviel Lärm gemacht und es erschreckt. Niemand könne doch bereits in Unruhe versetzte Thiere stellen. Er war wirklich ein sehr rücksichtsvoller Gefährte, und da ich wusste, dass er in Allem wahr sei, so war ich auf sein Lob, wenn ich Glück hatte, stolz und leicht getröstet, wenn ich nichts erreicht hatte.
Der alte Pagazi Ibrahim, der in Ukawendi durch das Zerbrechen seines alten Kibugu so sehr betrübt worden war, hatte vor unserer Abreise von Udschidschi sein Tuch in einem Sklaven aus Manyuema angelegt, der den Namen „Ulimengo“ trug, was die „Welt“ bedeutet. Als wir uns Mpokwa näherten, lief Ulimengo davon mit der ganzen, aus einigen Tuchen und einem Beutel voll Salz bestehenden Habe seines Herrn, die dieser nach Unyanyembé zum Verhandeln mitgenommen. Ibrahim war untröstlich und jammerte in so kläglicher Weise, dass die Leute, statt Mitleid mit ihm zu fühlen, ihn auslachten. Ich fragte ihn, warum er sich so einen Sklaven gekauft und demselben, als er bei ihm gewesen, nicht ordentlich zu essen gegeben habe. Trotzig erwiderte er darauf: „War er etwa nicht mein Sklave? War etwa das Tuch, mit dem ich ihn kaufte, nicht das meinige? Wenn das Tuch mir gehörte, konnte ich nicht damit kaufen, was ich wollte? Warum sprecht Ihr so mit mir?“
An diesem Abend wurde aber Ibrahim’s Herz durch Ulimengo’s Heimkehr mit dem Salz und Tuch erfreut, und der einäugige Greis tanzte in seiner Herzensfreude und kam rasch zu mir gelaufen, um mir die frohe Botschaft zu bringen. „Sieh da, die “Welt„ ist zurückgekommen. Wahrhaftig![S. 212] Mein Salz und mein Tuch sind auch da. Wirklich!“ Ich sagte ihm, dass er gut daran thun werde, ihm zukünftig ordentlich zu essen zu geben, da die Sklaven ebenso gut wie ihre Herren des Essens bedürften.
Von 10 Uhr abends bis Mitternacht war Livingstone damit beschäftigt, den Stern Canopus zu beobachten und dadurch festzustellen, dass Mpokwa, im District von Utanda, in Ukonongo auf 6° 18′ 40″ südl. Br. liegt. Als ich diese Lage mit der auf meiner Karte durch einen Ueberschlag festgestellten verglich, ergab sich eine Differenz von drei Meilen, denn ich hatte den Ort auf 6° 15′ südl. Br. verzeichnet.
Am nächsten Tage machten wir halt. Livingstone’s Füsse waren so entzündet und wund, dass er keine Schuhe anziehen konnte. Auch meine Hacken waren wund und thörichterweise schnitt ich grosse Kreise aus meinen Schuhen heraus, um im Stande zu sein, umherzugehen.
Nachdem ich meine Zinkfeldflaschen in Kugeln verwandelt und mich mit einem Schlächter und Flintenträger versehen hatte, begab ich mich, mit der löblichen Absicht etwas zu schiessen, in das liebliche, ebene Parkland westlich vom Bache Mpokwa. In der Ebene sah ich nichts, ging also über einen Bergrücken und kam in ein breites, von hohem Grase und vereinzelten Hyphaenepalmen und Mimosen bedecktes Becken. Hier bemerkte ich eine Gruppe Giraffen, die Zweige der Mimosen benagend, und machte mich daran, sie im Grase zu stellen, indem ich von den hohen, grasbewachsenen Ameisenhügeln Vortheil zog, um mich den vorsichtigen Thieren nähern zu können, ehe ihre grossen Augen mich entdeckten. Ich kam ihnen mit Hülfe dieser sonderbaren Erhebungen auf 170 Meter nahe, weiter aber konnte man nicht kriechen, ohne von ihnen gesehen zu werden, so dünn und kurz war das Gras. Ich holte tief Athem, wischte mir die schweisstriefende Stirn ab und setzte mich auf einen Augenblick hin. Auch meine schwarzen Gehülfen waren von der Anstrengung und den grossen Erwartungen, die durch die Nähe der edeln Thiere erweckt wurden, ebenso athemlos wie ich. Ich spielte mit meiner schweren Reilly-Flinte, untersuchte meine Patronen, erhob[S. 213] mich und wandte mich dann mit bereit gehaltenem Gewehr. Ich zielte gut, lange und fest, senkte dann das Gewehr etwas, um die Visire einzustellen, hob es noch einmal und liess es wieder sinken. Eine Giraffe hatte den Leib halb zu mir gewandt; wiederholt hob ich das Gewehr, zielte noch einmal rasch auf die Herzgegend des Thieres und schoss ab. Es wankte, taumelte, machte noch einen kurzen Galopp, aber das Blut stürzte in dickem Strom aus der Wunde und ehe die Giraffe 200 Schritt zurückgelegt hatte konnte sie nicht weiter, sondern hatte die Ohren zurückgezogen und liess mich ganz herankommen. In der Entfernung von 20 Schritt jagte ich ihr noch eine Zinkkugel durch den Kopf, worauf sie sofort todt niederstürzte.
„Allah ho akhbar!“ schrie Khamisi, mein Schlächter, inbrünstig. „Das ist Fleisch, Herr!“
Ich war eigentlich betrübt, als ich das edle Thier vor mir hingestreckt liegen sah. Wenn ich ihm das Leben hätte wiedergeben können, ich glaube, ich hätte es gethan. Ich hielt es für sehr schade, dass so herrliche Thiere, die für den Dienst des Menschen in Afrika so geeignet wären, nicht zu etwas anderm als blos zur Nahrung verwandt werden könnten. Pferde, Maulesel und Esel sterben in diesen ungesunden Gegenden; welch ein Segen würde es aber für Afrika sein, wenn sich Giraffen und Zebras zum Nutzen der Forscher und Handelsleute zähmen liessen. Auf einem Zebra könnte man von Bagamoyo aus Udschidschi in einem Monat erreichen, während ich mehr als sieben Monate zu dieser Reise gebraucht habe!
Die todte Giraffe mass 16 Fuss 9 Zoll von dem rechten Vorderhufe bis zur Spitze des Kopfes und war eine der grössten, obwol man schon Thiere von 17 Fuss Höhe gesehen hat. Sie war mit grossen schwarzen, fast runden Flecken besät.
Ich liess Khamisi bei dem todten Thiere, während ich ins Lager eilte, um Leute zu schicken, die es zerschneiden und das Fleisch in das Dorf bringen könnten. Khamisi aber kletterte aus Furcht vor den Löwen auf einen Baum und die Geier setzten sich auf das Thier, sodass als meine Leute dort ankamen, die Augen, die Zunge und ein grosses[S. 214] Stück des Hintertheils schon verzehrt waren. Was übrig blieb zeigte auf der Wagschale folgendes Gewicht:
|
Ein Hinterbein
|
134
|
Pfd.
|
Der Rumpf
|
87
|
Pfd.
|
|
Das andere
|
136
|
„
|
Die Brust
|
46
|
„
|
|
Ein Vorderbein
|
160
|
„
|
Die Leber
|
20
|
„
|
|
Das andere
|
160
|
„
|
Die Lungen
|
12
|
„
|
|
Die Rippen
|
158
|
„
|
Das Herz
|
6
|
„
|
|
Der Hals
|
74
|
„
|
|||
|
Gesammtgewicht der essbaren
Theile: 993 Pfd.
|
|||||
|
Haut und Kopf 181 Pfd.
|
|||||
An den drei folgenden Tagen litt ich an einem schweren Fieberanfall und musste im Bett liegen bleiben. Ich wandte meine gewöhnlichen Heilmittel dagegen an, Coloquinten und Chinin. Die Erfahrung hat mich aber gelehrt, dass ein übermässiger Gebrauch eines und desselben starken Abführmittels die Wirkung desselben schwächt und dass es daher für Reisende gut ist, verschiedene Laxantien mitzunehmen, um gehörig auf die Leber wirken zu können, wie z. B. Coloquinten, Calomel, Jalapenharz und Bittersalz, und dass man Chinin nicht eher nehmen sollte, bis ein Abführmittel den Organismus darauf vorbereitet hat.
Das Fieberrecept Livingstone’s besteht aus drei Gran Jalapenharz, zwei Gran Calomel und soviel Cardamom-Tinctur, wie nöthig ist, um die Reizung des Magens zu verhindern; daraus wird eine Pille gemacht, die sofort zu nehmen ist, wenn man bedeutende Mattigkeit und Niedergeschlagenheit, die sichern Vorläufer des afrikanischen Fiebertypus, empfindet. Ein bis zwei Stunden später sollte man eine Tasse Kaffee ohne Zucker und Milch zu sich nehmen, damit die Wirkung um so rascher eintritt. Livingstone meint auch, dass das Chinin zu gleicher Zeit mit dieser Pille genommen werden solle; dagegen hat mir die Erfahrung, die zwar im Vergleich zu der seinigen wenig Bedeutung hat, bewiesen, dass Chinin erst nach der Wirkung des Abführmittels nützt. Mein Magen konnte z. B. Chinin nie vertragen, wenn nicht ein Abführmittel vorhergegangen war. Ein wohlbekannter Missionär in Konstantinopel empfiehlt[S. 215] Reisenden drei Gran Brechweinstein, damit der Magen von Galle befreit werde; aber der verehrte Pastor vergisst dabei, dass noch andere Organe, als der Magen in dieser Krankheit leiden, und wenn auch in einigen Fällen ein leichter Anfall durch dieses Mittel glücklich beseitigt worden sein mag, so ist es doch ein viel zu heftiges für einen durch das afrikanische Klima geschwächten Menschen. Ich habe mich drei- oder viermal genau nach dieser Methode behandelt, ich kann sie aber mit gutem Gewissen nicht empfehlen. Gegen Urticaria kann ich zwar drei Gran Brechweinstein empfehlen, doch würde eine Magenpumpe denselben Zweck ebenso gut erreichen.
Am 27. gingen wir nach Misonghi ab. Ungefähr auf der Mitte des Wegs sah ich den Führer der Expedition laufen und sein schnelles Forteilen schien sich bald allen ihm Folgenden mitzutheilen, bis auch mein Esel anfing, mit den Hacken um sich zu schlagen. Im nächsten Augenblick wurde ich die Ursache dieser Aufregung gewahr, als eine Wolke wilder Bienen mir um den Kopf schwirrte, von denen sich drei oder vier auf mein Gesicht setzten und mich schrecklich zerstachen. Wir liefen wie die Wahnsinnigen ungefähr eine halbe Meile weit, wobei wir uns fast ebenso aufführten wie die armen zerstochenen Thiere.
Da dies ein ungewöhnlich langer Marsch war, so hegte ich Zweifel, ob der Doctor ihn aushalten könne, da seine Füsse so wund waren. Ich beschloss daher, ihm Leute mit der Kitanda entgegenzuschicken. Der tapfere alte Held wollte aber durchaus nicht getragen werden und legte den ganzen Weg bis zum Lager, einen Marsch von 18 Meilen, zu Fuss zurück. Er war am Kopf und im Gesicht furchtbar zerstochen; die Bienen hatten sich in Menge in seinem Haar festgesetzt; nachdem er aber eine Tasse warmen Thee und etwas Nahrung zu sich genommen, war er so munter, als ob er noch keine Meile gereist sei.
In Mrera, in Central-Ukonongo, hielten wir einen Tag, um Korn zu mahlen und die Vorräthe zu kaufen, die wir während unseres Durchzugs durch die zwischen Mrera und Manyara liegende Wildniss brauchten.
Am 31. Januar trafen wir in Mwaru, beim Sultan Kamirambo,[S. 216] eine von einem Sklaven des Sayd bin Habib geführte Karavane, die uns in unserm, in einem dichten Gestrüpp verborgenen Lager besuchte. Nachdem er sich gesetzt und Kaffee getrunken, fragte ich ihn:
„Was für Nachrichten, mein Freund, bringst Du uns aus Unyanyembé?“
„Meine Nachrichten sind gut, Herr.“
„Wie steht es mit dem Kriege?“
„Ja! wo ist Mirambo? Er isst jetzt sogar Felle. Er ist ausgehungert. Mein Herr, Sayd bin Habib, ist im Besitz von Kirira. Die Araber donnern an den Thoren von Wilyankuru. Sayd bin Madschid, der in zwanzig Tagen von Udschidschi nach Usagozi gekommen ist, hat den König Moto (Feuer) gefangen genommen und erschlagen. Simba von Kasera hat die Waffen zur Vertheidigung seines Vaters Mkasiwa von Unyanyembé ergriffen. Der Häuptling von Ugunda hat 500 Mann ins Feld geschickt. Ach, ach, wo ist jetzt Mirambo? In einem Monat wird er durch Hunger zu Grunde gegangen sein.“
„Wirklich bedeutende und gute Nachrichten, mein Freund.“
„Ja wohl — im Namen Gottes.“
„Und wohin ziehst Du mit Deiner Karavane?“
„Sayd, der Sohn Madschid’s, der aus Udschidschi kam, hat uns von dem Wege erzählt, den der Weisse eingeschlagen hat, und gesagt, er sei glücklich in Udschidschi angekommen und befände sich jetzt auf dem Rückwege nach Unyanyembé. Da haben wir denn geglaubt, dass, wenn der Weisse den Weg gehen könne, wir es auch könnten. Und siehe da, die Araber ziehen jetzt zu hunderten auf dem Wege des Weissen, um in Udschidschi Elfenbein einzuhandeln.“
„Ich bin dieser Weisse.“
„Sie?“
„Ja wohl.“
„Nun, man hat uns ja gesagt, Sie seien todt und hätten mit den Wazavira gekämpft.“
„Ach, mein Freund, das sind die Worte von Ndschara, dem Sohne von Khamis. Sieh mal her (auf Livingstone[S. 217] zeigend), dies ist der Weisse, mein Vater[8], den ich in Udschidschi besucht habe. Er geht mit mir nach Unyanyembé, um sein Tuch in Empfang zu nehmen, worauf er wieder an die grossen Wasser zurückkehren wird.“
„Wunderbar! Du redest die Wahrheit.“
„Was kannst Du mir vom Weissen in Unyanyembé sagen?“
„Von welchem Weissen?“
„Dem Weissen, den ich im Hause von Sayd, dem Sohne Salim’s — in meinem Hause — in Kwihara zurückgelassen habe.“
„Er ist todt.“
„Todt?“
„Wirklich.“
„Das kann doch gar nicht der Fall sein.“
„Ja, er ist wirklich todt.“
„Seit wie lange?“
„Seit vielen Monaten.“
„Woran ist er gestorben?“
„Am Homa (Fieber).“
„Sind noch mehr von meinen Leuten gestorben?“
„Das weiss ich nicht.“
„Genug.“ Ich sah den Doctor an und dieser sagte:
„Das habe ich Ihnen ja gesagt; als Sie ihn mir als einen Trunkenbold schilderten wusste ich, dass er nicht am Leben bleiben könne. Gewohnheitssäufer bleiben hier zu Lande ebenso wenig am Leben, wie Leute, die andern Lastern ergeben sind. Ich schreibe den Todesfall, der in meiner Expedition auf dem Zambezi vorkam, ganz derselben Ursache zu.“
„Ach, Herr Doctor, da sind nun zwei von uns todt. Ich werde der dritte sein, wenn dieses Fieber lange dauert.“
„O nein, keineswegs. Wenn Sie am Fieber sterben sollten, so wären Sie in Udschidschi gestorben, als Sie den schweren Anfall von remittirendem Fieber hatten. Denken Sie doch nicht daran. Ihr Fieber kommt jetzt nur vom Nasswerden her. Ich selbst reise nie während der nassen[S. 218] Jahreszeit. Diesmal habe ich es nur gethan, weil ich so besorgt war und Sie nicht in Udschidschi aufhalten wollte.“
„Ja, es gibt doch nichts schöneres, als einen guten Freund hier zu Lande bei sich zu haben, durch den man ermuthigt und aufrecht erhalten wird. Armer Shaw! Er war zwar ein schlechter Mensch, aber trotzdem dauert er mich sehr. Wie oft habe ich es versucht, ihn aufzuheitern; es fehlte ihm aber an Energie und die letzten Worte, die ich vor unserer Trennung zu ihm sprach, waren: «Denken Sie daran, dass Sie sterben werden, wenn Sie nach Unyanyembé zurückkehren.»“
Vom Führer der Karavane des Sayd bin Habib erhielten wir auch die Nachricht, dass mehrere Packete Briefe und Zeitungen und Kisten durch meine Boten und Araber für mich aus Zanzibar angekommen seien, und dass Selim, der Sohn Scheikh Haschid’s aus Zanzibar, unter den neuerdings in Unyanyembé Angekommenen sich befinde. Livingstone erinnerte mich in seiner grossen Gutmüthigkeit auch daran, dass er nach seinen Berichten einen Vorrath von Fruchtsäften und Schiffszwieback, Suppen, Fischen, eingemachtem Schinken und Käse in Unyanyembé liegen habe und dass er sich freuen werde, diese Leckerbissen mit mir zu theilen. Das munterte mich sehr auf und während der verschiedenen Fieberanfälle, die ich in dieser Zeit erlitt, liebte es meine Einbildungskraft, bei den Genüssen von Unyanyembé zu verweilen. Ich stellte es mir vor, wie ich die Schinken und Zwiebäcke und Fruchtsäfte wie ein Toller verzehren werde. Ich lebte von diesen rasenden Phantasien, mein armes, geplagtes Gehirn schwärmte für so einfache Dinge, wie Weizenbrot und Butter, Schinken, Speckseiten, Caviar, und ich hätte keinen Preis für dieselben für zu hoch gehalten. Ich war so weit von Europa und Amerika entfernt und doch war es mir eine Freude während dieses schweren Zustandes der Niedergeschlagenheit, in den ich durch immer wiederkehrende Fieberanfälle gerathen war, bei diesen Dingen zu verweilen. Ich wunderte mich, wie Leute, die derartige Genüsse zur Verfügung hätten, überhaupt krank und des Lebens überdrüssig werden könnten und meinte, ich würde im Stande sein, selbst sterbend aufzuspringen und einen tollen Fandango[S. 219] zu tanzen, wenn ein Weizenbrot und ein schönes Stückchen frischer Butter mir vorgesetzt würden.
Zwar fehlten uns diese eben aufgezählten Leckerbissen, aber wir besassen dafür eingesalzene Giraffen- und gepökelte Zebrazungen; wir hatten von Halimah selbst verfertigtes Ugali, süsse Kartoffeln, Thee, Kaffee und heisse Pfannkuchen; alles dessen war ich aber nun überdrüssig. Mein geschwächter, von Arzneimitteln wie Ipecacuanha, Coloquinten, Brechweinstein, Chinin und ähnlichen Dingen angegriffener und gereizter Magen verweigerte diese grobe Nahrung. In Verzweiflung rief meine Seele aus: „Hätte ich nur ein Weizenbrot! 500 Dollars für einen Laib Brot!“
Der Doctor ass, trotz des unaufhörlichen Regens, Thaus und Nebels, der Marschanstrengungen und seiner wunden Füsse wie ein Held und ich fasste daher den ernsten Entschluss, es ihm in männlicher Weise in der ausdauernden Aufmerksamkeit, die er dem Wohle seiner Verdauungskraft widmete, nachzuthun; aber es mislang mir vollständig.
Dr. Livingstone besitzt alle Gaben eines Reisenden. Seine Kenntniss von allem, was Afrika betrifft, von Felsen, Bäumen, Früchten und deren Eigenschaften, ist sehr gross. Auch steckt er voll weiser Ansichten über ethnologische Dinge. Er ist mit der Kunst ein Lager aufzuschlagen und mit allen dazu gehörigen Kniffen vertraut. Sein Bett ist so angenehm wie eine Federmatraze; jeden Abend wird dies unter eigener Oberaufsicht zurechtgemacht. Erst lässt er sich dazu zwei gerade Stangen von 3–4 Zoll im Durchmesser schneiden; diese werden parallel nebeneinander in einer Entfernung von 2 Fuss gelegt, quer darüber einige kurze, 3 Fuss lange Stöcke, Schösslinge von Bäumen, und über diese ein hoher Haufen Gras. Dann kommt ein Stück wasserdichtes Segeltuch und wollene Decken, und so wird ein Lager hergestellt, das für einen König gut genug wäre.
Auf Livingstone’s Anrathen kaufte ich Milchziegen, durch welche wir seit unserm Abgang aus Udschidschi dreimal täglich mit frischer Milch zum Thee und Kaffee versorgt wurden. Nebenbei gesagt trinken wir viel von diesen angenehmen Erregungsmitteln und hören selten mit dem Trinken auf, bevor nicht jeder von uns 6 bis 7 Tassen zu sich genommen[S. 220] hat. Auch sind wir im Stande gewesen, uns mit Musik zu versehen, welche zwar rauh, aber doch besser als gar keine ist. Ich meine das musikalische Geschrei der Papageien aus Manyuema.
Auf dem halben Wege zwischen Mwaru, dem Dorfe Kamirambo’s, und dem verlassenen Tongoni von Ukamba schnitt ich die Anfangsbuchstaben von Livingstone’s und meinem Namen in einen grossen Baum mit dem Datum des 2. Februar. Zweimal habe ich mir dies in Afrika zu Schulden kommen lassen; zum ersten mal nämlich, als wir in Süd-Uvinza hungerten, schrieb ich das Datum mit meinen Anfangsbuchstaben und dem Worte „verhungernd“ in grossen Buchstaben in den Stamm einer Sykomore.
Als wir durch den Wald von Ukamba zogen, sahen wir den gebleichten Schädel eines Unglücklichen, der den Entbehrungen der Reise erlegen war. Bei dieser Gelegenheit bemerkte der Doctor, dass er nicht durch einen afrikanischen Wald und seine feierliche, heitere Stille ziehen könne, ohne den Wunsch zu haben, ruhig unter den todten Blättern begraben zu werden, wo er sicherlich ungestört liegen bleiben werde. In England sei nicht Platz genug vorhanden und daher würden die Gräber oft entweiht. Daher habe er, seitdem er seine Frau in den Wäldern von Schupanga beerdigt, sich immer nach einem solchen Ort gesehnt, wo seine Gebeine die ewige von ihm ersehnte Ruhe geniessen könnten.
Am selben Abend erzählte mir der Doctor, als die Zeltthür herabgelassen und das Innere durch ein Paraffinlicht angenehm erhellt war, einige auf die Laufbahn und den Tod seines ältesten Sohnes Robert bezügliche Vorfälle. Die Leser von Livingstone’s erstem Buche „South Africa“, das jeder Knabe besitzen sollte, werden sich wol der Achtung des sterbenden Sebituane für den kleinen Knaben Robert entsinnen. Frau Livingstone und ihre Familie gingen ans Cap der Guten Hoffnung und von dort nach England. Hier bekam Robert einen Hauslehrer. Als er aber, ungefähr 18 Jahr alt, der Unthätigkeit müde geworden, verliess er Schottland und ging nach Natal, von wo aus er den Versuch machte, zu seinem Vater zu gelangen. Da ihm dies[S. 221] misglückte, schiffte er sich nach New York ein, nahm Dienste in der Nordarmee in einem Freiwilligenregiment von New Hampshire, nannte sich anstatt Robert Moffatt Livingstone nun Rupert Vincent, damit sein Lehrer, der seine Pflichten gegen den jungen Mann nicht gekannt zu haben scheint, ihn nicht auffinden könne. Nach einer der Schlachten vor Richmond wurde er nach einem Hospital in Nord-Carolina gebracht und starb daselbst an seinen Wunden.

Am 7. Februar kamen wir am Gombé an und schlugen unser Lager in der Nähe eines der grössten Seen desselben auf. Dieser ist wol mehrere Meilen lang und wimmelt von Flusspferden und Krokodilen.
Von diesem Lager aus schickte ich den Koch Feradschi und Tschaupereh nach Unyanyembé, um uns die Briefe und Arzneien, die mir aus Zanzibar zugeschickt waren, bis nach Ugunda entgegenzubringen. Wir dagegen zogen am nächsten Tage in unser altes Quartier am Gombé, wo wir zuerst in das eigentliche Jägerparadies in Central-Afrika eingeführt worden waren. Der Regen hatte zwar die meisten Heerden auseinandergetrieben, es gab jedoch noch viele Jagdthiere in der Umgegend. Bald nach dem Frühstück nahm ich Khamisi und Kalulu mit mir auf die Jagd. Nach einem langen Marsch kamen wir an ein dünnes Gebüsch, wo ich die Spuren verschiedener Thiere, z. B. von Ebern, Antilopen, Elefanten, Rhinozeros, Flusspferden und eine ungewöhnliche Zahl von Löwenspuren entdeckte. Plötzlich hörte ich Khamisi rufen: „Herr, Herr, hier ist ein Simba! (Löwe).“ Erzfeige, wie der junge Bursche war, kam er vor Furcht und Erregung zitternd zu mir gelaufen, um mir den Kopf des Thieres zu zeigen, das gerade aus dem hohen Grase hervorsah und uns standhaft anblickte. Gleich darauf sprang der Löwe von einer Seite auf die andere, doch war das Gras so hoch, dass man ihn nicht genau sehen konnte. Indem ich einen vor mir stehenden Baum benutzte, kroch ich ruhig weiter mit der Absicht, das schwere Gewehr gegen denselben anzulegen, da ich infolge mehrerer Fieberanfälle zu schwach und ganz ausser Stande war, aus freier Hand sicher zu zielen. Gross war aber mein Erstaunen, als ich das Gewehr vorsichtig an den Baum gestützt und[S. 222] die Mündung auf den Punkt gerichtet hatte, wo ich das Thier hatte stehen sehen. Als ich nämlich weiter hinblickte, wo das Gras dünner und spärlicher war, sah ich das Thier, wirklich ein Löwe, sehr rasch davonspringen. Der König des Waldes befand sich in voller Flucht. Von dem Augenblicke an habe ich aufgehört, ihn als das mächtigste Thier zu betrachten oder sein Gebrüll am hellen Tage für furchtbarer zu halten als das Girren einer Taube.
Am nächsten Tage machten wir wiederum halt, und da ich ausser Stande war, mein Verlangen nach der Jagd an einem Orte zu unterdrücken, wo es so viel Wild aller Art gab, schlenderte ich bald nach dem Morgenkaffee, nachdem ich ein paar Leute mit Geschenken an meinen Freund Mamanyara, dessen man sich von der Geschichte mit der Ammoniak-Flasche her erinnert, geschickt hatte, noch einmal in den Wald hinaus. Kaum 500 Schritt vom Lager hielt ich nebst meinen Leuten plötzlich still, indem wir in unserer unmittelbaren Nähe, etwa 100 Schritt entfernt, das Brüllen dreier Löwen hörten. Instinctiv erhoben meine Finger die beiden Drücker, da ich einen gemeinsamen Angriff derselben auf mich erwartete, denn wenn auch ein Löwe die Flucht ergriffen hatte, so war es doch kaum glaublich, dass drei dasselbe thun würden. Während ich mich scharf umsah, entdeckte ich in bequemer Schussweite ein schönes Hartebeest, das hinter einem Baum zitternd kauerte, als ob es die Krallen des Löwen in seinem Nacken zu fühlen fürchtete. Obgleich es mit dem Rücken zu mir gewandt dastand, so meinte ich, eine Kugel könne es doch tödlich treffen und feuerte deshalb auf dasselbe, ohne einen Augenblick zu zögern. Das Thier sprang hoch auf, als ob es gedächte durch den Baum zu springen, erholte sich aber und stürzte sich dann durch das Unterholz nach einer andern Richtung als die, in der ich die Löwen glaubte, und ich habe es nie wiedergesehen, obgleich ich von der blutigen Spur her weiss, dass ich es getroffen habe. Auch habe ich nichts mehr von den Löwen gesehen oder gehört. Weit und breit suchte ich in dem Gehölz nach irgendwelcher Beute, war aber gezwungen, ohne eine solche ins Lager zurückzukehren.
Ueber mein Unglück verstimmt, brachen wir bald nach[S. 223] Mittag nach Manyara auf, wo wir gastfreundlich von meinem Freunde begrüsst wurden, der mir Leute zugeschickt hatte, damit sein weisser Bruder nicht im Walde, sondern in seinem Dorfe halt mache. Vom Häuptling wurden uns Honig und Nahrungsmittel geschenkt, die uns in unserer Lage sehr willkommen waren. Hier zeigten sich wieder die freundlichen Gesinnungen, wie sie den centralafrikanischen Häuptlingen eigen, welche noch nicht von Arabern verdorben worden sind, und wie sie auch Dr. Livingstone unter den Babisa und Ba-ulunga und in Manyuema angetroffen hat. Von allen Häuptlingen, von Imrera in Ukawendi an bis nach Unyanyembé wurde ich ebenso freundlich wie von Mamanyara aufgenommen.
Am 14. langten wir in Ugunda an und bald nachdem wir es uns in einer Hütte, die der Häuptling uns zum Gebrauch überlassen, bequem gemacht hatten, kamen Feradschi und Tschaupereh mit Sarmean und Uledi Manwa Sera zurück, welches, wie man sich erinnert, die beiden Soldaten waren, die ich mit Briefen nach Zanzibar geschickt, damit sie Arznei für den kranken Shaw mitbrächten. Sarmean hatte den Deserteur Hamdallah, der auf unserm Wege nach Udschidschi in Manyara weggelaufen war, aufgegriffen. Dieser Bursche hatte, wie es scheint, in Kigandu halt gemacht und dem Häuptling und Doctor des Dorfes mitgetheilt, er sei vom Weissen abgeschickt worden, um das Tuch, das dieser für die Cur von Mabruk Salim zurückgelassen habe, wieder zu holen. Der einfältige Häuptling hatte es ihm wirklich auf sein blosses Wort hin ausgeliefert und infolge davon sei der Kranke sowie auch noch ein anderer, den ich in Unyanyembé zurückgelassen, gestorben.
Als Sarmean aus Zanzibar in Unyanyembé ankam, etwa funfzig Tage nachdem unsere Expedition nach Udschidschi abgegangen war, erhielt er die Nachricht, dass der Weisse (Shaw) gestorben sei und dass ein Mensch namens Hamdallah, der sich bei mir als Führer vermiethet habe und bald darauf zurückgekehrt sei, sich in Unyanyembé befände. Bis Feradschi und sein Gefährte ankamen hatte er ihn unbelästigt gelassen, dann aber waren sie alle gemeinschaftlich in seine Hütte gegangen und hatten ihn in Sicherheit gebracht.[S. 224] Sarmean hatte mit dem Eifer, der ihn immer in meinem Dienst auszeichnete, sich eine Holzgabel verschafft und den Deserteur mit dem Nacken zwischen die Zacken derselben gebracht. Ein festgebundenes Querholz verhinderte ihn daran, sich von dieser so gewandt angelegten Last zu befreien.
Nicht weniger als sieben Packete Briefe und Zeitungen aus Zanzibar hatten sich während meiner Abwesenheit von Unyanyembé dort angesammelt. Sie waren zu verschiedenen Zeiten den Führern von Karavanen anvertraut worden, die sie, ihrem dem Consul gegebenen Versprechen getreu, in meinem Tembé abgegeben hatten. Darunter befand sich ein Packet von Dr. Kirk an mich, welches auch einige Briefe für Dr. Livingstone enthielt, dem ich sie natürlich sofort überlieferte mit meinem Glückwunsch, dass er von seinem Freunde nicht ganz vergessen worden sei. In demselben Packet befand sich auch ein Brief von Dr. Kirk an mich vom 25. September 1871, d. i. fünf Tage nachdem ich Unyanyembé auf meinem anscheinend hoffnungslosen Unternehmen verlassen hatte, der mich bat, Livingstone’s Waaren in meine Obhut zu nehmen und mein möglichstes zu thun, um sie ihm zukommen zu lassen. Auch enthielt er einige phantastische Rathschläge, wie ich eine unmögliche Route über den See Ukerewe einschlagen solle. Der Brief war jedoch in einem herzlichen, freundlichen Tone abgefasst.
„Nun Doctor“, sagte ich zu Livingstone, „der englische Consul bittet mich, alles zu thun, Ihnen Ihre Waaren zukommen zu lassen. Es thut mir sehr leid, dass ich diese Vollmacht nicht früher erhalten habe, denn dann hätte ich den Versuch gemacht; doch habe ich, ohne diese Instruction, mein möglichstes gethan, Sie zu Ihren Gütern zu befördern. Da der Berg nicht im Stande gewesen, zu Mohammed zu kommen, so war Mohammed genöthigt, zum Berge zu gehen.“
Dr. Livingstone war aber zu sehr in seine eigenen, aus der Heimat kommenden Briefe vertieft, die jetzt gerade ein Jahr alt waren.
Ich erhielt gute und schlechte Nachrichten aus New York; doch waren die guten die spätern und verwischten[S. 225] alle Gefühle, welche durch die schlechten in mir hervorgerufen worden waren. Auch waren etwa 100 Nummern New Yorker, Bostoner und Londoner Zeitungen voll von wunderbaren Nachrichten. Die pariser Commune hatte sich in Waffen gegen die National-Versammlung erhoben; die Tuilerien, das Louvre und das alte Lutetia Parisiorum waren durch die Schurken von St. Antoine in Brand gesteckt worden! Französische Soldaten hatten Männer, Weiber und Kinder gemordet; in der schönsten Stadt der Welt war teuflische Wildheit und eingefleischte Rachgier thätig! Schöne Frauen waren in Dämonen verwandelt und von einer rohen Soldateska durch die Strassen geschleppt worden, um allgemein verwünscht und erbarmungslos dem Tode hingegeben zu werden. Zarte Kinder waren durch Bajonnete an den Boden geheftet; Schuldige und Unschuldige erschossen, niedergemetzelt, erdolcht, vernichtet; eine ganze Stadt der summa injuria einer wüthenden, rücksichtslosen, brutalen Armee preisgegeben worden! O Frankreich! Franzosen! Derartiges ist selbst im Herzen des barbarischen Central-Afrika unbekannt. Wir stiessen die Zeitungen mit den Füssen verächtlich von uns und blickten, um unsern verletzten Gefühlen Erleichterung zu verschaffen, auf die komischen Seiten der Welt, wie sie sich in den unschuldigen Blättern des „Punch“ darstellt. O guter, freundlicher „Punch“! Der Segen des Reisenden komme über dich! Deine Scherze wirkten wie wohlthätige Arznei! Deine freundliche Satire erzeugte eine hysterische Munterkeit in uns.
Unsere Thür war von vielen neugierigen Eingeborenen umdrängt, die mit unbeschreiblicher Verwunderung die enormen Papierbogen betrachteten. Ich hörte sie oft die Worte wiederholen: „Khabari Kisungu“, Nachrichten des Weissen, und vernahm, wie sie über die Fülle der Nachrichten sprachen und ihren Glauben äusserten, dass der Wasungu „Mbyah sana“ und sehr „Mkali“ sei, womit sie sagen wollten, dass der Weisse sehr böse und sehr gescheit und gewandt sei. Durch das Wort „böse“ wird häufig grosse Bewunderung ausgedrückt.
Am vierten Tage nach unserm Abgang von Ugunda, oder am 18. Februar, dem 35. Tage seit unserer Abreise[S. 226] aus Udschidschi, erschienen wir mit fliegenden Fahnen und unter Gewehrfeuer im Thale Kwihara, und als Dr. Livingstone und ich durch das Portal meines alten Quartiers traten, begrüsste ich ihn in aller Form in Unyanyembé und in meinem eigenen Hause. Seit dem Tage, wo ich die Araber krank und fast lebensmüde, aber trotzdem von der hohen Hoffnung beseelt, dass meine Mission von Glück gekrönt werde, verlassen hatte, waren 131 Tage vergangen — unter welchen Wechselfällen weiss der Leser jetzt. In dieser Zeit hatte ich mehr als 1200 engl. Meilen zurückgelegt. Aus der Mythe, der ich durch die Wildniss nachgezogen war, war eine Thatsache geworden, und diese wurde mir um so deutlicher, als der lebendige Mann Arm in Arm mit mir in mein altes Zimmer trat und ich ihm sagte: „Herr Doctor! endlich sind wir zu Hause!“
[7] In der Kiswahili-Sprache bedeutet mabyah, mbyah oder byah „schlecht, unangenehm“.
[8] Es ist ein höflicher Brauch in Afrika, ältere Leute als Baba (Vater) anzureden.
[S. 227]
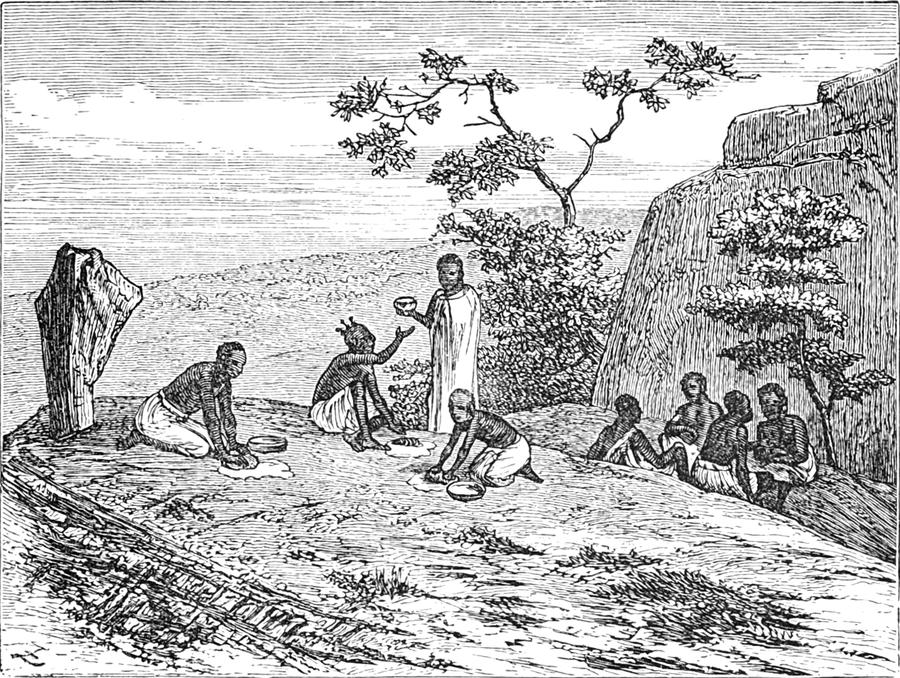
Livingstone’s Vorräthe werden aufgemacht. — Sie erweisen sich als eine Täuschung. — Asmani wird als schuldig erfunden. — Weisse Ameisen haben den Branntwein ausgetrunken und die Flaschen wieder zugekorkt! — Die Güter werden Livingstone übergeben. — Er schreibt Briefe nach Hause. — Sein Brief an James G. Bennett. — Gesang der Eingeborenen. — Der letzte Abend mit Livingstone. — Sein Tagebuch wird versiegelt. — Unsere endliche Abreise. — Lebewohl! — Halt in Tura. — Briefe vom Doctor. — Ankunft in Kiwyeh. — Ueberall erschallen Schlachthörner der Wagogo. — Vollständiges Kampfkostüm. — Ein falscher Alarm. — Der Häuptling Khonze leistet unserm Weiterziehen Widerstand. — Vorbereitung zum Kampf. — Ein Mnyamwezi wird an der Kehle gepackt und der Frieden wiederhergestellt. — Ankunft in Kanyenyi. — Besuch des Sultans. — Das Dorf Mapanga. — Plötzliches Zusammenlaufen bewaffneter Eingeborenen. — Vierzig Speere gegen vierzig Flinten. — Tribut wird verlangt und bezahlt. — Leucole’s Bericht über Farquhar’s Tod. — Das Thal des Mukondokwa. — Durch die Masikazeit verursachte Noth. —[S. 228] Furchtbare Fluten. — Kampf gegen Moskito-Schwärme. — Des Doctors Depeschen-Kasten in Gefahr. — Er wird mit Seilen durch den Fluss gezogen. — Ankunft in Simbamwenni. — Die Stadtmauer ist fortgeschwemmt. — Furchtbarer Sturm. — Zerstörung von hundert Dörfern. — Die Msunva-Dschungels. — Schrecken derselben. — „Heiss Wasser“ Ameisen. — Nachrichten aus Zanzibar. — Ankunft in Bagamoyo. — Zusammenkunft mit der Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung Livingstone’s.
Jetzt erschien mir Unyanyembé als ein irdisches Paradies. Livingstone war nicht weniger glücklich, denn er befand sich in einem bequemen Quartiere, das im Vergleich zu seiner Hütte in Udschidschi ein Palast war. Unsere Vorrathsräume waren von Leckerbissen angefüllt und enthielten ausserdem noch Tuch, Perlen, Draht und tausenderlei zu einer Reise gehöriger und beschwerlicher Dinge, mit denen ich mehr als 150 Leute in Bagamoyo bepackt hatte. Ich besass 74 Lasten verschiedener Sachen, von denen jetzt die werthvollsten Livingstone für seinen Marsch an die Quellen des Nils überliefert werden sollten.
Wir erlebten einen grossen Tag, als ich mit Hammer und Meisel Livingstone’s Kisten aufbrach, damit wir unsern ausgehungerten Magen an den Leckerbissen ergötzen könnten, die uns von den Wirkungen der schlechtnährenden Dourra- und Maisnahrung, der wir in der Wildniss ausgesetzt gewesen, erlösen sollten. Ich glaubte bestimmt, dass eine aus eingemachten Schinken, Schiffszwieback und Fruchtsäften bestehende Diät mich unbesiegbar, wie Talus, machen und dass ich dann nur eines starken Flegels bedürfen würde, um im Stande zu sein, die mächtigen Wagogo in die Regionen des Nichts zu schicken, wenn sie es wagen sollten, auch nur eine Miene zu machen, die ich nicht billigte.
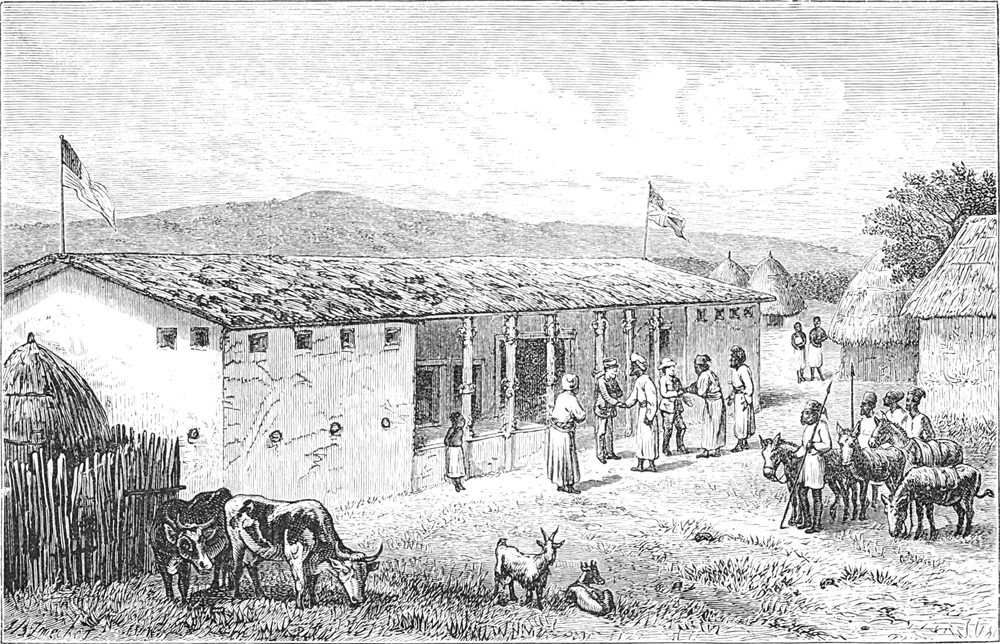
Die erste von mir geöffnete Kiste enthielt drei Zinnbüchsen mit Biscuit, sechs Zinnbüchsen eingemachten Schinken, kleine Dinger, die nicht viel grösser als Fingerhüte waren und als man sie aufmachte, nur einen Esslöffel voll reichlich gepfefferten gehackten Fleisches enthielten. Die Vorräthe des Doctors sanken dadurch 500 Grad unter Null in meiner Achtung. Darauf kamen fünf Töpfe mit eingemachten[S. 229] Fruchtsäften, von denen wir einen öffneten. Auch dies erwies sich als eine Täuschung; denn die Steinkruken wogen 1 Pfund und in jeder befand sich nur wenig mehr als ein Theelöffel voll Saft. Ja, wir fingen wirklich an zu glauben, dass unsere Hoffnungen und Erwartungen zu hoch geschraubt gewesen seien. Darauf kamen drei Flaschen Curry; aber wer macht sich etwas aus Curry? Noch ein Kasten wurde aufgemacht und es fiel ein kurzer dicker holländischer Käse heraus, der so hart wie ein Ziegel, aber sonst gut und unversehrt war; in Unyamwezi ist er freilich weniger tauglich. Dann kam noch ein Käse zum Vorschein, doch war er ganz verzehrt, nämlich hohl und blosser Schein. Der dritte Kasten enthielt nur zwei Zuckerhüte; der vierte Lichte; der fünfte Flaschen mit Salz, verschiedenen Saucen, Anchovisessenz, Pfeffer und Senf. Um Gottes willen! was war das für eine Nahrung, um einen Sterbenden, wie mich, wieder ins Leben zu rufen! Der sechste Kasten enthielt vier Hemden, zwei paar starke Schuhe, einige Strümpfe und Schuhbänder, welche den Doctor so entzückten, dass er, als er sie anprobirte, ausrief: „Nun bin ich wieder ich selbst!“ „Wer Ihnen das geschickt hat, ist wirklich Ihr Freund!“ meinte ich. „Ja“, sagte er, „das hat mein Freund Waller gethan.“
Die fünf andern Kisten enthielten eingemachtes Fleisch und Suppen; die zwölfte aber, die ein Dutzend Flaschen medicinischen Branntwein enthalten sollte, war fort und durch ein genaues Verhör Asmani’s, des Führers der Livingstone-Karavane, kam es heraus, dass nicht nur diese eine Kiste mit Branntwein fehlte, sondern auch zwei Ballen Tuch und vier Säcke von in Afrika höchst werthvollen Perlen, von Sami-Sami nämlich, die von den Eingeborenen so viel wie Gold geschätzt werden.
Nachdem die Vorräthe untersucht waren, fühlte ich mich sehr enttäuscht. Alles erschien mir bei meiner Verstimmung als Täuschung. Unter den Zinnkasten, die Zwieback enthielten, erwies sich bei der Oeffnung nur einer als gut und der ganze Inhalt desselben reichte noch nicht zu einer vollständigen Mahlzeit. Und die Suppen — wer macht sich etwas aus Suppen in Afrika? Gibt es dort nicht genug[S. 230] junge Ochsen, Schafe und Ziegen, aus denen sich eine weit bessere Suppe, als eine solche eingemachte, bereiten lässt? Erbsen- oder irgendeine andere Pflanzensuppe wäre prächtig gewesen; aber Hühner- und Wildsuppen! Was war das für ein Unsinn!
Dann untersuchte ich meine eigenen Vorräthe. Da fand ich noch etwas schönen, alten Branntwein und eine Flasche Champagner. Als ich jedoch die Tuchballen ansah, ward es mir offenbar, dass die Unehrlichkeit auch hier ihre Hand im Spiel gehabt habe und es wurde Asmani, dem von Dr. Kirk die Livingstone’schen Güter anvertraut worden waren, als der Schuldige bezeichnet. Als ich seine Habseligkeiten untersuchen liess, fand ich 8–10 bunte Tücher mit dem Zeichen meines Agenten in Zanzibar. Da er ausser Stande war, darüber Rechenschaft zu geben, wie sie in seinen Kasten gekommen seien, confiscirte ich sie sofort und vertheilte sie unter die verdienstvollsten Leute des Doctors. Einige der Wächter schuldigten ihn auch an, in meinen Vorrathsraum gegangen zu sein und 2–3 Gorah amerikanischer Baumwollenzeuge aus meinen Ballen gestohlen und einige Tage später einem meiner Leute die Schlüssel entrissen und zerbrochen zu haben, damit nicht andere Leute hineinkommen und seine Schuld beweisen könnten. Da Asmani sich gleichfalls als einer von den „moralischen Idioten“ auswies, so entliess ihn Livingstone sofort. Wären wir nicht so bald in Unyanyembé angekommen, so wäre wol der ganze von Zanzibar hergeschickte Vorrath verschwunden gewesen.
Da Unyanyembé reich an Früchten, Korn und Rindvieh ist, beschlossen wir, uns noch einmal ein Weihnachtsessen, diesmal aber ein ordentliches, bereiten zu lassen, und da ich bei ziemlich guter Gesundheit war, konnte ich die Vorbereitungen dazu selbst beaufsichtigen. Nie hat man wol in einem Tembé von Unyamwezi eine so grosse Verschwendung wie im unsrigen gesehen und nie hat es da so viel Delikatessen gegeben.
Als wir in Unyanyembé ankamen, waren wenig Araber anwesend, da sie alle die Veste Mirambo’s belagerten. Etwa eine Woche nach unserer Heimkehr kam das kleine[S. 231] Herrchen Scheikh Sayd bin Salim — El Wali —, welcher der Oberbefehlshaber dieser Truppen war, von seinem Heere nach Kwihara. Der kleine Scheikh hatte es aber nicht so sehr eilig, den Mann zu begrüssen, dem er so grosses Unrecht gethan. Sobald wir von seiner Ankunft hörten, ergriffen wir die Gelegenheit, sofort Leute zu ihm zu schicken wegen der Waaren, die nach Livingstone’s Abreise an die Mikindany-Bucht an den Wali zur Weiterbeförderung gesandt worden waren. Als unsere Leute zum ersten mal zu ihm kamen, erklärte sich der Herr für zu krank, um sich mit dergleichen abgeben zu können; am zweiten Tage aber wurden sie uns ausgeliefert und die Bitte hinzugefügt, der Doctor möge über den Zustand derselben nicht zu böse sein, da die weissen Ameisen alles zerstört hätten.
Die Vorräthe, die dieser Mensch in Unyanyembé zurückbehalten hatte, befanden sich in sehr traurigem Zustande. Die Kosten ihrer Fracht nach Udschidschi waren vorher bezahlt; die Güter waren aber seit 1867 absichtlich von Sayd bin Salim hier aufgehalten worden, damit er seine Liebhaberei für Spirituosa befriedigen und zwei werthvolle Gewehre, die sich darunter befanden, erben könne. Die weissen Ameisen hatten aber nicht nur factisch den Kasten, in dem die Gewehre verpackt waren, sondern auch die Flintenkolben aufgefressen. Die. Läufe waren oxydirt und die Schlösser ganz zerstört. Auch die Branntweinflaschen waren merkwürdigerweise diesen gefrässigen, unwiderstehlichen Zerstörern zum Opfer gefallen, den weissen Ameisen, welche auf irgendeine unerklärliche Weise den starken Henessy’sehen Branntwein ausgetrunken und die Korken durch Kornstöpsel ersetzt hatten. Auch die Arzeneien waren verschwunden, und die Zinktöpfe, in denen sie gut verpackt waren, durch Zernagung zerstört. Zwei Branntweinflaschen und eine kleine Zinkschachtel voll Medizin waren das Einzige, was von allen vernichteten Gütern übrig geblieben war.
Ich bat Livingstone, den Scheikh Sayd auch fragen zu lassen, ob er die beiden Briefe erhalten, die der Doctor bei seiner ersten Ankunft in Udschidschi an Dr. Kirk und Lord Clarendon abgeschickt hatte, und ob er sie dem Befehle[S. 232] gemäss weiter an die Küste befördert habe. Die Antwort, die er dem Boten gab, lautete bejahend und später erhielt ich dieselbe Antwort in Livingstone’s Gegenwart.
Am 22. Februar hörten die Regengüsse auf, die uns auf der ganzen Strecke von Udschidschi hartnäckig verfolgt hatten, und wir bekamen schönes Wetter. Während ich mich auf meine Heimreise vorbereitete, schrieb der Doctor fleissig an seinen Briefen und trug Notizen in das Tagebuch, welches ich seiner Familie mitnehmen sollte. Wenn wir nicht damit beschäftigt waren, besuchten wir die Araber in Tabora, die uns beide mit der grossartigen Gastfreundschaft aufnahmen, wegen der sie berühmt sind.
Unter den Waaren, die ich Dr. Livingstone übergab, als ich die Tuche sortirte, die ich auf meine Heimreise mitnehmen wollte, befanden sich:
|
Doti.
|
Yards.
|
|||
|
Beste amerikanische Leinewand
|
285
|
=
|
1140
|
|
|
Beste Kaniki (blau)
|
16
|
=
|
64
|
|
|
Mittel Kaniki (blau)
|
60
|
=
|
240
|
|
|
Mittlere Dabwani-Tuche
|
41
|
=
|
164
|
|
|
Barsati-Tuche
|
28
|
=
|
112
|
|
|
Gedruckte Taschentücher
|
70
|
=
|
280
|
|
|
Mittleres Rehani-Tuch
|
127
|
=
|
508
|
|
|
Mittleres Ismahili-Tuch
|
20
|
=
|
80
|
|
|
Mittleres Sohari-Tuch
|
20
|
=
|
80
|
|
|
Vier Stücke schönes Kunguru (roth)
|
22
|
=
|
88
|
|
|
Vier Gorah Rehani
|
8
|
=
|
32
|
|
|
Gesammtsumme
|
697
|
=
|
2788.
|
|
Ausserdem:
[S. 233]
Dies machte eine Gesammtsumme von ungefähr 40 Lasten. Manche der in dieser Liste enthaltenen Dinge, namentlich die Karabiner und die Munition, die Säge, Zimmermannswerkzeuge, Perlen und der Draht würden in Unyanyembé zu beliebig hohen Preisen zu verkaufen gewesen sein. Von den 33 Lasten, welche für Livingstone in meinem Tembé aufgespeichert lagen (den Vorräthen nämlich, die ihm am 1. November 1870 zugeschickt worden), waren nur wenige für seine Rückkehr nach Rua und Manyuema zu brauchen. Die 697 Doti Tuch, die ich ihm überliess, bildeten die einzigen verkäuflichen Werthgegenstände, die er besass, und in Manyuema, wo die Eingeborenen ihr eigenes Tuch fabriciren, wären sie völlig unverkäuflich gewesen; meine Perlen und der Draht dagegen konnten, ökonomisch gehandhabt, ausreichen, ihn und seine Leute mehr als zwei Jahre in jenen Gegenden zu erhalten. Sein eigenes Tuch und das, was ich ihm gab, machte zusammen 1393 Doti aus; rechnet man den Lebensunterhalt für den Tag zu zwei Doti, so genügte dies, ihn und sechzig Leute 696 Tage zu erhalten. So hatte er Vorräthe für vier Jahre und die einzigen Gegenstände, die ihm fehlten, um wieder eine vollständig ausgerüstete Expedition zu haben, waren die, welche er und ich in folgender Liste verzeichnet haben:
|
Einige
|
Zinnbüchsen
|
mit
|
amerikanischem Weizenmehl.
|
|
„
|
„
|
„
|
Schiffszwieback.
|
|
„
|
„
|
„
|
eingemachten Früchten.
|
|
„
|
„
|
„
|
Sardinen.
|
|
„
|
„
|
„
|
Lachs.
|
|
10 Pfd. Hyson-Thee.
|
|||
|
Etwas Zwirn und Nähnadeln.
|
|||
|
Ein Dutzend officielle Couverts.
|
|||
|
Ein Nautical-Almanach für 1872 und 1873.
|
|||
|
Ein neues Tagebuch.
|
|||
|
Ein Chronometer.
|
|||
|
Eine Kette für widerspenstige Leute.
|
|||
Mit den eben aufgezählten Artikeln würde er alles in allem 70 Lasten gehabt haben, die ihm jedoch ohne Lastträger nur beschwerlich gewesen wären, denn er konnte mit den neun Leuten, die er jetzt nur hatte, mit einem so prächtigen Sortiment von Waaren nirgends hingehen. Deshalb[S. 234] erhielt ich den Auftrag, sobald ich Zanzibar erreicht hätte, 50 Freie anzuwerben, jeden von ihnen mit einem Gewehr, einem Beil und sonstigem Zubehör auszurüsten, sowie 2000 Kugeln, 1000 Feuersteine und 10 Fässchen Pulver zu kaufen. Die Leute sollten Livingstone als Lastträger überall hin begleiten, wo er es verlangte. Denn ohne solche Begleiter dienten ihm die auf seine reichlichen Mittel basirten Hoffnungen nur zur Qual, da die Sachen ohne Lastträger sich gar nicht verwerthen liessen. Alle Reichthümer Londons und New Yorks wären ihm vollständig unnütz gewesen, wenn er nicht die Mittel zur Beförderung hatte. Nun vermiethet sich aber kein Mnyamwezi während der Kriegszeit als Träger. Wer mein Tagebuch über das Leben in Unyanyembé gelesen hat, weiss, wie hartnäckig conservativ die Wanyamwezi sind. Mir lag also, meinem berühmten Gefährten gegenüber, noch die Pflicht ob, mich mit der grössten Eile, als ob es sich um Leben und Tod handle, an die Küste zu begeben, dort für ihn Leute anzuwerben, als ob er selbst da sei, für ihn mit ebenso grossem Eifer wie für mich selbst zu arbeiten und nicht zu ruhen, bis seine Wünsche erfüllt seien. Dieses gelobte ich mir zu thun; aber freilich war das der Todesstreich für mein Project, den Nil hinunterzugehen und Nachrichten über Sir S. Baker einzuziehen.
Livingstone’s Briefe waren beendet. Er übergab mir zwanzig nach Grossbritannien, sechs nach Bombay, zwei nach New York und einen nach Zanzibar. Die beiden nach New York gerichteten waren für James Gordon Bennett jun.; nur dieser und nicht sein Vater hatte meine Expedition veranlasst. Ich bitte den Leser um Entschuldigung, dass ich einen dieser Briefe hier wieder veröffentliche, da er nach Inhalt und Stil den Mann charakterisirt, für den es sich lohnte, eine kostbare Expedition auszurüsten, um sichere Nachrichten über sein Leben oder seinen Tod zu erhalten.
Udschidschi am Tanganika, Ostafrika. November 1871.
Herrn James Gordon Bennett jun.
Verehrter Herr! Für gewöhnlich ist es etwas schwer, an jemand zu schreiben, den man nie gesehen hat. Es ist fast so, als ob man[S. 235] sich an eine Abstraction wendet; doch benimmt mir die Anwesenheit Ihres Repräsentanten, des Herrn H. M. Stanley, in diesen fernen Gegenden das Gefühl des Fremdseins, das ich sonst empfinden würde, und ich fühle mich ganz heimisch, wenn ich Ihnen schreibe, um Ihnen für die grosse Güte zu danken, die Sie dazu veranlasst hat, ihn herzusenden.
Wenn ich Ihnen den verzweifelten Zustand darstelle, in welchem er mich aufgefunden hat, so werden Sie leicht einsehen, dass ich allen Grund habe, mich sehr starker Ausdrücke der Dankbarkeit zu bedienen. Ich erreichte Udschidschi nach einer Fussreise von 400–500 Meilen Länge, die ich unter einer glühenden Sonne zurückgelegt hatte, enttäuscht, abgemattet und, fast am Ende des geographischen Theils meiner Mission, zur Rückkehr gezwungen durch eine Anzahl mohammedanischer Halbblutsklaven, die mir statt freier Männer aus Zanzibar zugeschickt waren. Die Leiden meines Gemüths wurden durch den traurigen Anblick der Inhumanität der Menschen gegeneinander noch gesteigert und hatten einen höchst nachtheiligen Einfluss auf meine Constitution ausgeübt und sie über alle Massen geschwächt. Ich glaubte, an Ort und Stelle sterben zu müssen. Es ist nicht zu viel gesagt, dass fast jeder Schritt auf dem peinigenden, durchglühten Wege mir schmerzhaft wurde und ich in Udschidschi als ein blosses Knochenskelet anlangte.
Hier fand ich, dass Waaren im Werthe von etwa 500 Pfd. Sterling, die ich aus Zanzibar herbestellt hatte, unverantwortlicherweise einem Trunkenbold, einem Schneider, mohammedanisches Halbblut, anvertraut worden waren, der, nachdem er sie theilweise 16 Monate lang auf dem Wege nach Udschidschi verschwendet, damit endete, den Rest zu seinen eigenen Gunsten gegen Sklaven und Elfenbein zu verkaufen. Er hatte aus dem Koran prophezeit und gefunden, dass ich todt sei; hatte auch dem Gouverneur von Unyanyembé geschrieben, dass er mir Sklaven nach Manyuema nachgeschickt habe, die bei ihrer Rückkehr mich für todt ausgegeben, und um die Erlaubniss nachgesucht, die wenigen Waaren, die seine Trunksucht noch übrig gelassen hatte, zu verkaufen.
Er wusste jedoch ganz genau von Leuten, die mich gesehen hatten, dass ich am Leben sei und auf meine Güter und Leute warte; er ist aber, was die Moralität betrifft, offenbar ein Idiot, und da es hier kein Gesetz als das des Dolches und der Muskete gibt, musste ich hier äusserst entkräftet und von allem entblösst, ausser ein paar Tauschtuchen und Perlen, die ich vorsichtigerweise für den Fall der äussersten Noth hier gelassen, sitzen bleiben.
Die nahe Aussicht auf Bettlerarmuth unter den Udschidschianern machte mich ganz elend.
Zwar konnte ich nicht verzweifeln, da ich einmal so sehr über einen Freund gelacht, welcher bei seiner Ankunft an der Mündung[S. 236] des Zambezi behauptete, er fühle sich versucht zu verzweifeln, weil er die Photographie seiner Frau zerbrochen hatte, denn hiernach könnten wir durchaus kein Glück mehr haben. Seit der Zeit hat der Gedanke an Verzweiflung für mich einen so starken Beigeschmack des Lächerlichen bekommen, dass bei mir daran nicht mehr zu denken ist.
Als ich nun ungefähr auf die niedrigste Stufe herabgesunken war, verbreiteten sich unbestimmte Gerüchte, dass ein Engländer mich besuchen werde. Zwar hatte ich mich in Gedanken mit dem Manne verglichen, der von Jerusalem nach Jericho ging, doch konnte wol kaum weder ein Priester, noch Levite, noch Samariter auf meinen Weg gerathen. Dennoch war der gute Samariter nahe bei der Hand und einer meiner Leute stürzte in grösster Eile auf mich zu und rief in grosser Aufregung: „Da kommt ein Engländer, ich sehe ihn!“ worauf er fortschnellte, um ihm entgegenzugehen.
An der zum ersten male in diesem Theile der Welt gesehenen amerikanischen Flagge, welche sich an der Spitze der Karavane befand, erkannte ich die Nationalität des Fremden.
Ich bin kalt und zugeknöpft, wie wir Insulaner es gewöhnlich sein sollen; aber Ihre Güte drang mir durch Mark und Bein. Sie überwältigte mich geradezu und ich rief in meinem Innern: „Möge der Höchste Ihnen und den Ihrigen seinen reichsten Segen zutheil werden lassen!“
Auch die Nachrichten, die mir Herr Stanley mitzutheilen hatte, waren erschütternd. Die mächtigen politischen Veränderungen auf dem Continent; der Erfolg der atlantischen Kabel; die Wahl des General Grant und viele andere Dinge fesselten meine Aufmerksamkeit tagelang und hatten einen unmittelbaren und höchst wohlthätigen Einfluss auf meine Gesundheit. Ich war jahrelang völlig ohne Nachrichten von Hause gewesen, ausser den spärlichen, die ich aus einigen Nummern der „Saturday Review“ und des „Punch“ vom Jahre 1868 erhalten hatte. Mein Appetit kam wieder und in einer Woche fühlte ich mich sehr gekräftigt.
Herr Stanley brachte mir auch eine sehr gütige, ermuthigende Depesche von Lord Clarendon (dessen Tod ich aufrichtig betrauere), welche die erste ist, die ich seit dem Jahre 1866 vom Auswärtigen Amte erhalten, und zugleich die Nachricht, dass die britische Regierung gütigerweise 1000 Pfd. Sterling zu meinem Beistande abgeschickt habe. Bis Herr Stanley zu mir kam, wusste ich gar nichts von dieser Geldunterstützung. Ich bin ohne Besoldung hergekommen; jetzt ist aber dieser Mangel glücklich gehoben und ich wünsche dringend, dass Sie und alle meine Freunde es erfahren, dass ich, obwol nicht durch Briefe ermuthigt, doch mit der John Bull eigenen Zähigkeit und immer im Glauben an ein glückliches Ende der Aufgabe treu nachgegangen bin, die mir mein Freund Sir Roderick Murchison gesetzt hat.
[S. 237]
Die Wasserscheide des südlichen Central-Afrika ist mehr als 700 Meilen lang. Die daselbst befindlichen Quellen sind fast unzählbar, d. h. es würde ein Menschenleben dazu gehören, sie zu zählen. Von der Wasserscheide aus laufen sie in vier grosse Flüsse zusammen und diese vereinigen sich wiederum zu zwei mächtigen Strömen im grossen Nilthal, welches zwischen 10 und 12° südl. Br. anfängt. Es dauerte lange, ehe mir ein Licht über dieses alte Problem zu dämmern anfing und bis ich einen klaren Begriff von dem Wassersystem erhielt. Ich musste mir selbst den Weg Schritt für Schritt erkunden und tappte meist im Dunkeln, denn wer kümmerte sich darum, wie die Flüsse verliefen? „Wir tranken unser Theil und liessen das Uebrige weiter laufen.“
Die Portugiesen, welche Cazembe besucht haben, fragten nur nach Sklaven und Elfenbein und nach weiter nichts. Ich hingegen erkundigte mich nach den Gewässern in Kreuz- und Querfragen, bis ich beinahe fürchten musste, dass man mich selbst für einen Wasserkopf halten werde.
Meine letzte Aufgabe, in der ich aus Mangel an geeigneter Begleitung so behindert worden bin, bestand darin, das centrale Wassersystem, durch das Manyuema oder kürzer Manyema genannte Land der Kannibalen zu verfolgen. Dieses Wassersystem enthält vier grosse Seen. Dem vierten war ich nahe, als ich zur Rückkehr gezwungen wurde. Derselbe ist 1–3 Meilen breit und an allen Punkten und zu jeder Jahreszeit unzugänglich. Zwei nach Westen ziehende Wasserläufe, der Lufira oder Bartle Frere’s-Fluss fliessen in denselben beim See Kamolondo. Ferner fliesst auch der grosse Fluss Lomame durch den Lincoln-See in denselben und scheint den westlichen Arm des Nils, auf dem Petherick Handel getrieben hat, zu bilden.
Nun habe ich zwar 600 Meilen der Wasserscheide kennen gelernt, aber leider ist gerade das nächste hundert Meilen das Interessanteste von allem, denn in demselben entstehen, wenn ich nicht irre, vier Quellen aus einem Erdhügel, von denen die letztere in nicht sehr grosser Entfernung zu einem grossen Flusse wird.
Zwei derselben, der Lufira und Lomame, laufen nördlich nach Aegypten, und zwei, der Leambaye oder Obere Zambezi und der Kaful fliessen südlich ins innere Aethiopien.
Sind das nicht die Quellen des Nils, deren der Schreiber der „Minerva“ in der Stadt Saïs Herodot gegenüber Erwähnung gethan?
So häufig und an so entfernten Orten habe ich von denselben gehört, dass ich ihr Dasein nicht bezweifeln kann, und trotz des schweren Heimwehs, das mich jedes mal ergreift, wenn ich an meine Familie denke, wünsche ich doch meine Aufgabe durch ihre Wiederentdeckung zu Ende zu führen.
Abermals sind Waaren im Werthe von 500 Pfd. Sterl. in unverantwortlicher Weise Sklaven anvertraut worden und, anstatt vier[S. 238] Monate, mehr als ein Jahr unterwegs gewesen. Auf Ihre Kosten muss ich an den Ort gehen, wo sie sich befinden, ehe ich meine Arbeiten naturgemäss vollenden kann.
Wenn meine Enthüllungen in Bezug auf die schreckliche Sklaverei von Udschidschi dazu führen sollten, dass der Sklavenhandel auf der Ostküste unterdrückt würde, so werde ich das als einen noch grössern Erfolg ansehen als die Entdeckung der sämmtlichen Nilquellen. Jetzt, wo Sie die Sklaverei zu Hause abgethan haben, leihen Sie uns doch Ihre mächtige Beihülfe zu diesem grossen Zwecke. Das herrliche Land hier ist wie von einem Fluch des Himmels heimgesucht, damit die sklavenhändlerischen Privilegien des kleinen Sultans von Zanzibar nur nicht beeinträchtigt werden und die Krone Portugal sich eine Anwartschaft auf Rechte, die mythisch sind, bis auf eine spätere Zeit bewahre, wo Afrika für die portugiesischen Sklavenhändler zu einem zweiten Indien werden soll.
Ich schliesse, indem ich Ihnen noch einmal für Ihren grossen Edelmuth danke und bin dankbarlich
Ihr
DAVID LIVINGSTONE.
Dem obigen Briefe habe ich nichts hinzuzufügen; er spricht für sich selber; damals aber war ich der Ansicht, dass er den besten Beweis für den Erfolg meiner Expedition abgebe. Was mich betraf, kümmerte ich mich durchaus nicht um seine Entdeckungen, ausser insoweit sie die Zeitung, die mir den Auftrag gegeben hatte, ihn aufzusuchen, betrafen. Freilich empfand ich eine gewisse Neugier in Bezug auf das Resultat seiner Reisen, aber da er mir gesagt, dass er seine Aufgabe noch nicht vollendet habe, so hielt ich es für unzart, ihn nach mehr zu fragen, als er freiwillig gab. Denn seine Entdeckungen sind die Früchte seiner eigenen Arbeit und gehörten ihm. Durch ihre Veröffentlichung hoffte er seinen Lohn zu empfangen, den er auf seine Kinder vererben wollte. Doch hatte Livingstone einen höhern und edlern Ehrgeiz als den blossen Geldlohn, den er zu erhalten hofft; denn er folgt den Geboten der Pflicht. Nie hat es jemand gegeben, der sich so völlig dieser abstracten Tugend hingegeben hat. Seine Neigungen trieben ihn zur Heimkehr an und es gehörten die ernstesten Entschlüsse dazu, diesen Lockungen Widerstand zu leisten. Dagegen schmiedete er mit jedem neuen Schritt, den er zurücklegte, eine Kette der Sympathie, welche später die[S. 239] christlichen Nationen mit den Heiden des tropischen Afrika durch Nächstenliebe verbinden soll. Wenn es ihm gelänge, diese Liebeskette durch Entdeckung und genaue Beschreibung von Völkerschaften, die noch im Dunkel leben, zu vollenden, sodass er die Guten und Menschenfreundlichen unter seinen Landsleuten dazu veranlasst, sich für ihr Heil und ihre Erlösung zu interessiren, so sieht Livingstone darin eine reichliche Belohnung. Einige werden dies zwar für das Unternehmen eines Wahnsinnigen, den Plan eines Don Quixote erklären. So steht es aber doch nicht, meine Freunde; denn so sicher wie die Sonne über Christen und Ungläubige, civilisirte Menschen und Heiden scheint, wird der Tag der Erleuchtung kommen. Und wenn auch weder der Apostel Afrikas, noch wir jüngern Leute und vielleicht auch nicht einmal unsere Kinder ihn erblicken mögen, so wird eine spätere Zukunft es doch erleben und dem kühnen Pionnier der Civilisation ihre Anerkennung zollen. —
Das Folgende entnehme ich meinem Tagebuche:
12. März. Die Araber haben mir nicht weniger als 45 Briefe an die Küste mitgegeben. In den letzten Tagen bin ich Kurier geworden. Der Grund hiervon ist, dass regelrecht organisirte Karavanen Unyanyembé wegen des Krieges mit Mirambo nicht verlassen können. Wenn ich nun auch diese ganze Zeit über in Unyanyembé geblieben wäre, um das Ende des Krieges abzuwarten! Ich glaube nämlich, dass die Araber vor Ablauf von neun Monaten von jetzt ab noch nicht im Stande sein werden, den Mirambo zu besiegen.
Heute haben sich die Eingeborenen versammelt, um mir zu Ehren vor meinem Hause einen Abschiedstanz aufzuführen. Es sind, wie ich sehe, die Pagazi von Singiri, des Führers von Mtesa’s Karavane. Meine Leute betheiligten sich gleichfalls, und durch die Musik mir selbst zum Trotz gefesselt, nahm ich auch daran theil und tanzte zur grossen Bewunderung meiner Tapfern mit, welche darüber sehr erfreut waren, ihren Herrn von seiner gewöhnlichen Steifheit ablassen zu sehen.
Es ist ein wilder Tanz. Die Musik ist lebhaft und entsteht durch den sonoren Ton von vier Trommeln, welche[S. 240] vier in der Mitte des Zauberkreises stehende Leute umgehängt haben. Der stets komische Bombay, der sich beim Tanz der Mrima am gemüthlichsten fühlt, hat meinen Wassereimer auf dem Kopfe; der kräftige, flinke, festauftretende Tschaupereh eine Axt in der Hand und ein Ziegenfell auf dem Haupt. Baraka hat meine Bärenhaut und hantiert mit einem Speer herum. Der stierköpfige Mabruki ist auf den Geist der Sache eingegangen und schreitet feierlich auf und ab, wie ein Elefant. Ulimengo hat eine Flinte und geberdet sich wie ein wüthender Bramarbas, sodass man meinen sollte, er wolle sich auf eine Schlacht mit Hunderttausenden einlassen. Khamisi und Kamna stehen, Rücken an Rücken, vor den Trommlern und werfen um die Wette die Füsse in die Luft. Auch Asmani, die personificirte Riesenkraft, ein wirklicher Titane, hat ein Gewehr, mit dem er in der Luft herumfuchtelt, als ob er Thor sei, der mit seinem Hammer Tausende erschlägt. Unser aller Skrupel und Leidenschaften ruhen; wir sind Dämonen, die sich unter dem himmlischen Licht der Sterne bekämpfen und theilnehmen an einem Zauberdrama, in welchem wir durch den furchtbaren Donner der Trommeln zur thätigen Bewegung angeregt werden.
Die Kriegsmusik ist beendet und eine neue beginnt. Der Chorführer ist auf die Knie gesunken und taucht mit dem Kopf zwei- bis dreimal in eine Aushöhlung des Bodens. Ein Chor, der auch auf den Knien ruht, wiederholt in klagenden Tönen die letzten Worte eines feierlichen langsamen Refrains. Wörtlich übersetzt lautet der Gesang so:
Dies war der eigenthümliche Abschied, der mir von den Wanyamwezi Singiri’s zutheil wurde. Ich habe denselben wegen seiner merkwürdigen epischen Schönheit, rhythmischen Vortrefflichkeit und gewaltigen Leidenschaft als eins der wunderbarsten Erzeugnisse der chorliebenden Kinder Unyamwezis durch diese Blätter unsterblich machen wollen.
13. März. Endlich ist der letzte Tag meines Zusammenseins mit Livingstone vorüber; der letzte Abend, den wir gemeinsam zu verleben haben, ist da und ich kann dem Morgen nicht ausweichen. Es ist mir zu Muthe, als ob ich gegen das Schicksal rebelliren möchte, das mich von ihm trennt. Rasch folgen sich die Minuten und werden zu Stunden. Unsere Thüre ist verschlossen und jeder von uns ist mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Wie die seinigen beschaffen sind, weiss ich nicht; die meinigen sind traurig. Es scheint mir, als ob ich meine Tage in einem elyseischen Felde verlebt habe. Warum sollte ich sonst die nahe Abschiedstunde so schwer empfinden? Haben mich nicht in letzter Zeit eine Reihe von Fieberanfällen Tag für Tag kraftlos auf ein schmerzhaftes Lager geworfen? Habe ich nicht in furchtbaren Phantasien gerast? nicht im Delirium die Fäuste wüthend geballt und mit der wilden Kraft der Verzweiflung um mich geschlagen? Dennoch bedauere[S. 242] ich es, das Vergnügen aufgeben zu müssen, das ich in der so theuer erkauften Gesellschaft dieses Mannes empfunden, und kann doch nicht den sichern Fortschritt der Zeit hemmen, welche heute Abend dahin fliegt, als ob sie meiner spotte und sich an meinem Elende weide. So mag es denn sein! Wie oft habe ich nicht schon im Leben den Schmerz der Trennung von Freunden empfunden, wie oft noch länger zu bleiben gewünscht, wo das Unvermeidliche doch geschehen, das Schicksal uns trennen musste. Dieses mal ist es dieselbe traurige Empfindung, nur dass sie tiefer schmerzt; dass der Abschied auf immer stattfinden kann! Auf immer? Ja, auf immer! so hallte ein wehmüthiger Seufzer wieder.
Ich habe mir alles niedergeschrieben, was er heute Abend gesagt hat; der Leser soll das aber nicht mit mir theilen; es gehöre mir allein.
Ich bin ebenso eifersüchtig auf sein Tagebuch wie er selbst und habe in grossen gothischen Buchstaben und deutlicher Schrift auf jede Seite des wasserdichten Segeltuchdeckels desselben geschrieben: „Auf keinen Fall zu öffnen!“ was er mit seinem Namen unterschrieben hat. Jedes Wort habe ich stenographirt, das er mir gesagt hat in Bezug auf die gleichförmige Vertheilung einiger Seltenheiten an seine Freunde und Kinder, und den letzten Wunsch betreffs „seines theuern alten Freundes Sir Roderick Murchison“, wegen dessen er sich geängstigt hat, seitdem wir in Uganda die Zeitung erhalten, aus der wir ersahen, dass der alte Herr einen Schlaganfall gehabt. Sobald ich nach Aden komme, soll ich ihm bestimmt Nachrichten über ihn schicken; und ich habe es ihm versprochen, dass er sie von mir rascher erhalten soll, als es je früher in Central-Afrika geschehen ist.
„Morgen Abend werden Sie allein sein, Herr Doctor.“
„Ja; das Haus wird so aussehen, als ob ein Todesfall darin stattgefunden hat. Sie würden doch besser daran thun, hier zu bleiben, bis der Regen, der jetzt nahe bevorsteht, vorüber ist.“
„Ich wünschte zu Gott, ich könnte das, lieber Herr Doctor; doch jeder Tag, den ich jetzt noch hier verweile,[S. 243] wo keine Nothwendigkeit mehr vorliegt, hält Sie von Ihrer Arbeit und Ihrer Heimat zurück.“
„Das weiss ich; aber denken Sie doch an Ihre Gesundheit. Sie sind nicht im Stande zu reisen. Was haben ein paar Wochen mehr oder weniger zu bedeuten? Sie werden ebenso rasch an die Küste gelangen, wenn der Regen vorüber ist, als wenn Sie jetzt fortziehen. Zwischen hier und der Küste werden die Ebenen überschwemmt sein.“
„Meinen Sie das? Ich will aber die Küste in 40, allerhöchstens 50 Tagen erreichen. Der Gedanke, dass ich Ihnen dadurch einen wesentlichen Dienst leiste, wird mich anspornen.“
14. März. Mit dem Morgengrauen waren wir aufgestanden; die Ballen und das Gepäck wurden zum Hause hinausgetragen und die Leute bereiteten sich auf den ersten Marsch nach Hause vor.
Wir nahmen ein trauriges Frühstück zusammen ein. Ich konnte nicht essen, das Herz war mir so voll; auch mein Gefährte schien keinen Appetit zu haben. Wir fanden noch etwas zu thun, was uns etwas länger zusammenhielt. Um 8 Uhr war ich noch nicht fort und hatte doch die Absicht gehabt, um 5 Uhr morgens abzuziehen.
„Doctor“, sagte ich, „ich werde zwei Leute bei Ihnen lassen, die heute und morgen hier bleiben können, denn es kann doch sein, dass Sie bei der Eile meiner Abreise etwas vergessen haben. Einen Tag bleibe ich in Tura an der Grenze von Unyamwezi, um ein letztes Wort, einen letzten Wunsch von Ihnen in Empfang zu nehmen. Jetzt müssen wir scheiden, es hilft doch nichts. Leben Sie wohl!“
„Nun, ich werde Sie noch ein Stückchen begleiten. Ich muss sehen, wie Sie sich auf den Weg machen.“
„Vielen Dank. Nun, Leute, nach Hause! Kirangozi, erhebe die Fahne, und Marsch!“
Das Haus sah verödet aus, es entschwand unsern Blicken. Die Vergangenheit, die Gedanken an meine Bestrebungen und Hoffnungen überwältigten mich. An die alten Berge, die mir früher interesselos und unbedeutend erschienen waren, hatten sich geschichtliche Erinnerungen geknüpft. Auf jener Burzani hatte ich Stunden lang gesessen,[S. 244] geträumt, gehofft, geseufzt. Auf jenem Hügel hatte ich gestanden und die Schlacht und Zerstörung von Tabora beobachtet. Unter jenem Dache war ich krank gewesen, hatte ich delirirt und wie ein Kind über das Geschick geweint, das meiner Mission drohte. Unter jenen Bananenbäumen lag mein todter Kamerad, der arme Shaw! Ich hätte ein Vermögen darum gegeben, wenn ich ihn jetzt an meiner Seite gehabt hätte. Aus diesem Hause war ich nach Udschidschi gezogen; mit einem neuen, theuern Gefährten war ich in dasselbe wie zu einem alten Bekannten zurückgekehrt, und jetzt musste ich alles verlassen. Schon jetzt erscheint mir alles wie ein sonderbarer Traum.
Wir gingen Seite an Seite; die Leute stimmten einen Gesang an. Ich blickte Livingstone lange an, um mir seine Züge recht genau ins Gedächtniss zu prägen.
„Soweit ich es verstehen kann, liegt also die Sache so, Herr Doctor, dass Sie nicht beabsichtigen heimzukehren, bis Sie sich über die Quellen des Nils vergewissert haben. Wenn Sie sich darüber aber zufrieden gestellt haben, so werden Sie nach Hause kommen und auch andere zufrieden stellen, nicht wahr?“
„Ja wohl! Sobald Ihre Leute zurückkommen, werde ich sofort nach Ufipa aufbrechen, dann über den Rungwa-Fluss nach Süden und um das Ende des Tanganika gehen. Darauf werde ich in südöstlicher Richtung nach Tschicumbi’s Wohnsitz am Luapula gehen, mich über den Luapula direct nach den Kupferminen von Katanga begeben, und acht Tagereisen südlich von Katanga sollen, nach den Angaben der Eingeborenen, die Quellen sich befinden. Wenn ich sie gefunden, kehre ich über Katanga zu den unterirdischen Behausungen von Rua zurück. Von diesen Höhlen werde ich in zehn Tagen in nordöstlicher Richtung nach dem See Kamolondo ziehen. In Ihrem Boote werde ich im Stande sein, von dem See den Lufira-Fluss hinauf nach dem See Lincoln zu reisen; dann kann ich auf meinem Rückwege nach Norden über den Lualaba an den vierten See gehen, von dem ich meine, dass er das ganze Problem lösen wird, und da werde ich wol finden, dass es entweder der Tschauambe (Baker’s See) oder Piaggia’s See ist.“
[S. 245]
„Wie viel Zeit aber meinen Sie, dass diese kleine Reise beanspruchen wird?“
„Höchstens anderthalb Jahr von dem Tage an, wo ich Unyanyembé verlasse.“
„Nehmen wir zwei Jahre an; es könnten ja doch unvorhergesehene Verhältnisse eintreten. Es wird doch gut sein, wenn ich die Leute auf zwei Jahre miethe und zwar von dem Tage an, wo dieselben in Unyanyembé ankommen.“
„Ja, das wird gut sein.“
„Nun aber, mein lieber Doctor, auch die besten Freunde müssen sich trennen. Sie haben mich weit genug begleitet; daher bitte ich Sie, umzukehren.“
„Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen: Sie haben das geleistet, was nur wenige zu thun im Stande sind, und zwar viel besser als verschiedene grosse Reisende, die ich kenne. Ich bin Ihnen dankbar für das, was Sie an mir gethan. Gott geleite Sie sicher nach Hause und segne Sie, mein Freund!“
„Und möge Gott auch Sie uns allen glücklich heimführen, mein theurer Freund! Leben Sie wohl!“
„Leben Sie wohl!“
Wir schüttelten uns die Hände und ich musste mich von ihm losreissen, um nicht zu weich zu werden. Doch auch Susi, Dschumah und Hamoydah, die getreuen Genossen des Doctors, mussten mir die Hand drücken und küssen, ehe ich ganz fortkam. Daher verrieth ich meine Empfindungen!
„Adieu, Doctor, theurer Freund!“
„Adieu!“
„Marsch! Was haltet Ihr? Vorwärts! Geht Ihr nicht nach Hause?“ So trieb ich meine Leute vor mir her. Jetzt keine Schwäche mehr. Ich werde sie marschiren lassen, dass sie an mich denken sollen. Von heute in vierzig Tagen werde ich das abmachen, was mich früher drei Monate gekostet hat. —
Freundlicher Leser! Ich habe die vorstehenden Tagebuchblätter am Abend eines jeden Tages geschrieben. Ich sehe sie jetzt nach sechs Monaten wieder an, schäme mich ihrer[S. 246] aber nicht. Noch jetzt werden meine Augen trübe, wenn ich an die Trennung denke. Ich durfte das nicht ausstreichen oder abändern, was ich niedergeschrieben, als meine Gefühle so lebhaft waren. Gebe Dir Gott, dass Du, wenn Du Dich jemals auf eine Reise nach Afrika begibst, einen ebenso edeln, treuen Mann wie David Livingstone zum Gefährten haben mögest! Vier Monate und vier Tage habe ich mit ihm unter einem Dache, auf demselben Boote oder in demselben Zelte zugebracht und habe nie einen Fehler an ihm entdeckt. Ich selbst bin ein hitziger Mensch und habe schon oft wol ohne ausreichende Ursache Bande der Freundschaft zerrissen, aber bei Livingstone habe ich nie eine Ursache gehabt, mich gekränkt zu fühlen. Ein jeder Tag, den ich mit ihm zubrachte, hat meine Bewunderung für ihn nur erhöht.
Ich habe nicht die Absicht, meine Leser mit einer genauen Schilderung unseres Rückmarsches zu belästigen und werde ihnen nur einige Ereignisse, die uns auf der Reise nach der Küste passirten, erzählen.
17. März. Wir kamen an den Kwalah-Fluss, welchen ein Eingeborener von Rubuga Nyahuba, ein anderer Unyahuha nannte. Am heutigen Tage fiel der erste Regen der Masikazeit. Ehe ich zur Küste komme, werde ich angeschimmelt sein. Im vorigen Jahre begann die Masikazeit in Bagamoyo am 23. März und hörte am 30. April auf.
Am nächsten Tage hielt die Expedition in West-Tura, auf der Grenze von Unyamwezi, und am 20. kamen wir in Ost-Tura an. Bald darauf hörten wir ein lautes Schiessen, und Susi und Hamoydah, Livingstone’s Diener, erschienen mit Uredi und einem andern von meinen Leuten nebst einem Brief für Sir Thomas MacLear auf der Sternwarte des Cap der Guten Hoffnung, sowie einem Brief für mich, welcher folgendermassen lautete:
„Kwihara, 15. März 1872.
Lieber Stanley!
Wenn Sie bei Ihrer Ankunft in London telegraphiren können, so berichten Sie mir genau, wie sich Sir Roderick befindet. Sie haben gestern die Sache genau präcisirt, als[S. 247] Sie sagten, dass ich über die Quellen mit mir noch nicht im Reinen sei, sowie ich aber eine Ueberzeugung darüber gewonnen hätte, zurückkehren und andern genügende Auskunft über dieselben geben werde. Gerade so steht die Sache.
Ich wünschte, ich könnte Ihnen ein besseres Wort als das schottische zurufen: «Mit starkem Muth den steilen Berg hinan!» Denn das werden Sie thun und ich freue mich, dass Ihr Fieber vor Ihrem Abgange die gefahrlosere Form der Intermittens angenommen hat. Ich hätte Sie nur mit sehr grosser Sorge abziehen lassen, wenn Sie noch mit dem continuirlichen Fieber behaftet gewesen wären. Es ist mir ein Trost, Sie der Fürsorge des gütigen Herrn und Vaters aller Wesen zu empfehlen.
Dankbarlich
Ihr
DAVID LIVINGSTONE.“
„Ich habe, so sehr ich konnte, daran gearbeitet, Beobachtungen abzuschreiben, die ich auf einer Marschroute von Kabuire zurück nach Cazembe und weiter an den See Bangweolo angestellt hatte und bin ganz müde davon. Meine grossen Zahlen füllen sechs Bogen Papier von grösstem Format und mancher Tag wird wol vergehen, ehe ich mich wieder ans Abschreiben mache. Als ich im Jahre 1869 in Udschidschi krank war, habe ich meine Pflicht gethan und bin nicht zu tadeln, obwol man sich zu Hause darüber etwas im Dunkeln befindet. Einige arabische Briefe sind angekommen und ich übersende sie Ihnen.
D. L.“
16. März 1872.
„Nachschrift. Heute Morgen habe ich ein Billet an meinen Verleger Murray, 50, Albemarle Street, geschrieben, damit er Ihnen womöglich behülflich sei, das Tagebuch durch die Post oder sonstwie an Agnes zu schicken. Wenn Sie ihn aufsuchen, werden Sie in ihm einen biedern Gentleman kennen lernen. Glückliche Reise!
DAVID LIVINGSTONE.“
An Herrn HENRY M. STANLEY. — Aufenthalt unbekannt.“
[S. 248]
Einige Wangwana kamen nach Tura, um sich unserer heimkehrenden Expedition anzuschliessen, da sie sich fürchteten, allein durch Ugogo zu ziehen; andere sollten nachkommen; da man ihnen aber in Unyanyembé ganz bestimmt gesagt hatte, dass die Karavane jedenfalls am 14. abgehen werde, so wollte ich nicht länger warten.
Als wir Tura am 21. verliessen, wurden Susi und Hamoyda zum Doctor zurückgeschickt, während wir unsern Marsch an den Nghwhalah-Fluss fortsetzten.
Zwei Tage später kamen wir vor dem Dorfe Ngaraiso an, in welches die Spitze der Karavane hineinzugehen versuchte, doch wurden sie von den bösen Wakimbu mit Gewalt vertrieben.
Am 24. schlugen wir unser Lager auf einer sogenannten Tongoni oder Lichtung auf. Es war ein sehr romantischer Ort, wie man aus der allerdings nur skizzenhaften Abbildung zu Anfang dieses Kapitels ersehen kann.
Einst befand sich diese Gegend in einem höchst blühenden Zustande. Der Boden ist ausgezeichnet fruchtbar, das üppige Bauholz würde in der Nähe der Küste sehr viel werth sein, und es gibt hier, was in Afrika sehr geschätzt wird, reichlich Wasser. Wir lagerten in der Nähe eines glatten, breiten Syenitblocks, an dessen einer Seite sich ein massiver viereckiger Fels hoch emporhob, die verschiedenen in der Nachbarschaft befindlichen Bäume überragend; auf dem andern Ende stand noch ein eigenthümlicher Felsblock aufrecht, der an seinem Fusse gelockert war.
Meine Leute benutzten die grosse Felsplatte, um sich ihr Korn selbst zu mahlen, was hier ja gewöhnlich geschieht, wenn Dörfer nicht in der Nähe sind oder das Volk feindlich gesinnt ist.
Am 27. März gelangten wir nach Kiwyeh. Als wir mit dem Morgengrauen den Mdaburu-Fluss verliessen, liess ich die Leute in aller Form warnend bedeuten, dass wir im Begriff wären, in Ugogo einzutreten. Unter lautem, trompetenartigen Blasen zogen wir aus dem Dorfe Kaniyaga und kamen durch ausgedehnte wogende Maisfelder. Da die Aehren reif genug zum Rösten und Dörren waren, wurden[S. 249] wir von einer Besorgniss befreit; denn sehr häufig leiden Karavanen zu Anfang März Hunger, der sowol die Eingeborenen als Fremden heimsucht.
Darauf kamen wir in die Districte der Gummibäume und wussten, dass wir in Ugogo seien; denn die Wälder dieses Landes bestehen hauptsächlich aus Gummi- und Dornbäumen, Mimosen und Tamarisken sowie verschiedenen wilden Fruchtbäumen. Es gab viel Trauben, die jedoch noch nicht reif waren; auch fanden wir eine runde röthliche Frucht von der Süsse der Sultanatraube mit stachelbeerähnlichen Blättern. Eine andere, etwa von der Grösse einer Aprikose, hatte sehr bittern Geschmack.
Als wir aus den dichten Dorndschungels heraustraten, erblickten wir die ausgedehnten Ansiedelungen von Kiwyeh und fanden östlich vom Dorfe des Häuptlings einen Lagerplatz unter dem Schatten einer Gruppe kolossaler Baobabs.
Die Bevölkerung von Kiwyeh besteht etwa zu gleichen Theilen aus Wakimbu und Wagogo. Der alte Kiwyeh, der in den Tagen Speke’s und Grant’s lebte, ist todt und jetzt regiert sein junger Sohn das Gebiet. Obgleich die Herrschaft dieses Jünglings äusserlich gut aussieht und seine loyalen Unterthanen ihr Vieh zu Hunderten zählen, so ist seine Lage doch eine misliche, denn seine grosse Jugend bietet den ihn umgebenden Wagogohäuptlingen viele Versuchungen.
Kaum waren wir im Lager, als wir überall Kriegshörner laut ertönen hörten und Boten erblickten, die nach allen Richtungen rasch dahinflogen, um Kriegsalarm zu schlagen. Zuerst als ich erfuhr, dass das Volk durch die Hörner zu den Waffen gerufen wurde, hatte ich halb und halb den Verdacht, dass ein Angriff auf unsere Expedition gemacht werden solle, doch erklärten mir die Worte „Urugu, Warugu“ (Dieb, Diebe), die allgemein im Umlauf waren, alsbald die Ursache. Mukondoku nämlich, der Häuptling des bevölkerten, zwei Tagemärsche nach Norden zu liegenden Bezirkes, wo wir auf unserm frühern Zuge nach Westen etwas in Angst gerathen waren, stand im Begriff, den jungen Mtemi, Kiwyeh, anzugreifen, und deshalb wurden die Soldaten von Kiwyeh zum Kampf zusammengerufen. Die Leute[S. 250] stürzten sich in ihre Dörfer und in kurzer Zeit sahen wir sie im vollem Kriegskostüm heraufziehen. Strauss- und Adlerfedern wogten auf der Stirn oder Zebra-Mähnen um den Kopf; Knie und Knöchel waren mit kleinen Schellen besetzt. Vom Nacken flatterten ihre Dschoho-Gewänder; Speere, Assegais, Knüttel und Bogen schwenkten sie über den Kopf oder hielten sie in der rechten Hand, als ob sie zum Wurf bereit seien. Zu beiden Seiten eines grossen Heereskörpers, der im gleichmässigen, raschen Doppelschritt aus dem Hauptdorfe herauskam, wobei die Schellen am Fuss- und Kniegelenk harmonisch erklangen, befanden sich Trupps von Plänklern, die ganz besonders begeistert zu sein schienen und sich auf dem Wege in Scheinkämpfen übten. Eine Colonne nach der andern, Compagnien und Gruppen passirten eilig aus jedem Dorfe an unserm Lager vorüber, bis etwa fast tausend Soldaten in den Krieg gezogen waren. Diese Scene gab mir die beste Vorstellung von der Schwäche selbst der grössten Karavanen, die zwischen Zanzibar und Unyanyembé reisen.
Gegen Abend kehrten die Krieger aus dem Walde zurück, da der Alarm sich als grundlos erwiesen hatte. Anfangs hiess es allgemein, die Eindringlinge seien Wahehe oder Wadirigo, unter welchem Spottnamen dieser Stamm wegen seiner Neigung zum Diebstahl bekannt ist. Die Wahehe machen oft Streifzüge nach dem fetten Vieh von Ugogo. Aus ihrem eigenen im Südwesten gelegenen Lande ziehen sie durch das Dickicht und bücken sich bei Annäherung an die Heerden, indem sie sich den Körper mit aus Ochsenhaut bestehenden Schilden bedecken. Wenn sie so zwischen das Vieh und die Hirten gekommen sind, erheben sie sich plötzlich, fangen an, das Vieh mit Gerten zu peitschen, treiben es in die Dschungels zu den zu diesem Behuf Zurückgebliebenen, kehren dann schnell um und pflanzen ihre Schilde vor sich hin, um mit den empörten Schäfern zu kämpfen.
Am 30. langten wir in Khonze an, das sich durch die grossen Laubkugeln auszeichnet, welche die riesigen Sykomoren und Baobabs über die Ebene ausbreiten. Der Häuptling von Khonze rühmt sich, vier Tembés zu besitzen, aus[S. 251] denen er 50 Bewaffnete um sich sammeln könnte. Von den Wanyamwezi-Bewohnern dazu angespornt, bereitete sich dieser Bursche darauf vor, sich unserer Weiterreise zu widersetzen, weil ich ihm nur 3 Doti (12 Meter Tuch) als Honga geschickt hatte.

Wir hielten und warteten auf die Heimkehr einiger uns freundlich gesinnter Wagogo-Reisender, die sich uns angeschlossen und die wir gebeten hatten, unserm Bombay bei den Unterhandlungen über den Tribut beizustehen; plötzlich kamen diese Wagogo in athemloser Eile zu uns zurück und riefen: „Warum haltet Ihr hier? Wollt Ihr sterben? Diese Heiden wollen den Tribut gar nicht nehmen, sondern rühmen sich, dass sie Euer ganzes Tuch verzehren wollen.“
Die Wanyamwezi-Ueberläufer, welche in Wagogo-Familien hinein geheirathet haben, haben uns in diesem Lande stets zur Plage gereicht. Als der Häuptling von Khonze heraufkam, liess ich meine Leute ihre Flinten laden und that dies auch mit meiner eigenen in sehr demonstrativer Weise in seiner Gegenwart. Darauf ging ich auf ihn zu und fragte ihn, ob er gekommen sei, um uns unser Tuch mit Gewalt abzunehmen, oder ob er ruhig das annehmen wolle, was ich ihm anböte. Als der Mnyamwezi, der diese Feindseligkeiten angeregt hatte, im Begriff war zu reden, ergriff ich ihn an der Gurgel und drohte, ihm seine Nase noch platter zu schlagen, wenn er es versuchen sollte, in meiner Gegenwart zu sprechen, und ihn zuerst zu erschiessen, wenn wir zum Kampfe gezwungen würden. Hierauf wurde der Schurke in den Hintergrund gestossen. Der Häuptling, der sich über dieses Verfahren sehr amüsirte, lachte laut über die diesem Schmarotzer angethane Kränkung und in kurzer Zeit hatten er und ich die Tributfrage zu gegenseitiger Befriedigung erledigt und wir trennten uns als gute Freunde. Am Abend erreichte die Expedition Sanza.
Am 31. kamen wir zu Kamyenyi, dem grossen Mtemi — Magomba’s — dessen Sohn und Erbe Mtundu M’gondeh ist. Als wir gerade an dem Tembé des grossen Sultans vorüberzogen, war sein Msagira oder erster Rath, ein angenehmer Mann mit grauem Haar, damit beschäftigt, eine Dornhecke um ein Fleckchen jungen Korns zu ziehen. Er begrüsste[S. 252] die Karavane mit einem sonoren „Yambo“, stellte sich an die Spitze derselben und führte sie an unsern Lagerplatz. Als er mir vorgestellt wurde, war er sehr herzlich in seiner Manier. Ich liess ihm ein Kiti (Sessel) anbieten und er unterhielt sich mit mir in leutseliger Weise. Er erinnerte sich meiner Vorgänger Burton, Speke und Grant sehr wohl und sagte, ich sei viel jünger als sie. Auch bot er mir Eselsmilch an, da er sich erinnerte, dass einer der Weissen (Burton?) solche zu trinken pflegte. Die Art, wie ich sie trank, schien ihm sehr amüsant zu sein.
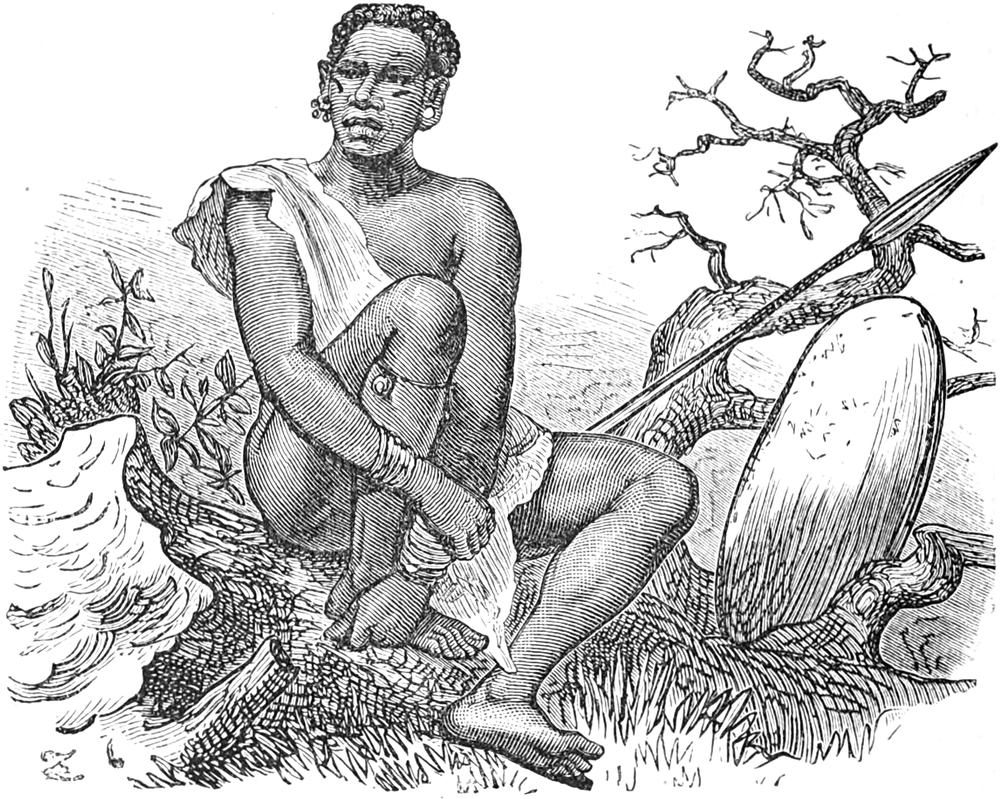
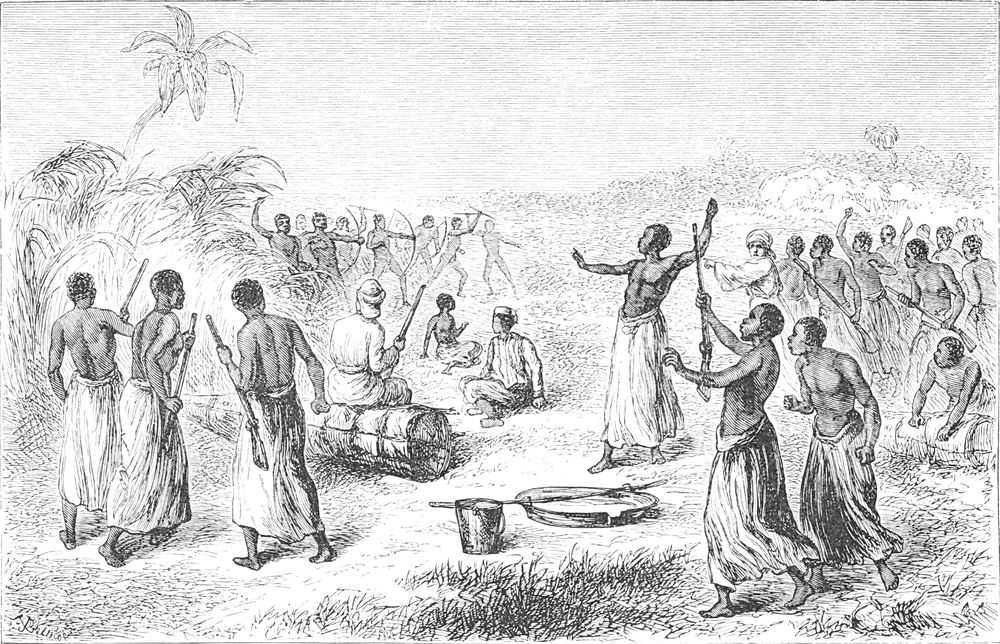
Sein Sohn Unamapokera war ein hoch aufgeschossener Mann von etwa 30 Jahren, der mit mir grosse Freundschaft schloss und mir den Tribut leicht zu machen sowie einen Menschen mitzugeben versprach, welcher mir den Weg zeigen solle nach Myumi, einem Dorfe an der Grenze von Kanyenyi, wodurch ich den raubgierigen Kisewah vermeiden könne, der gewohnt sei, Karavanen grossen Tribut abzunehmen.
Mit Hülfe Unamapokera’s und seines Vaters gelang es uns, nur wenig, d. h. 10 Doti zu zahlen, während Burton 60 Doti Tuch hatte bezahlen müssen.
[S. 253]
Am 1. April standen wir früh auf und erreichten Myumi nach einem Marsche von vier Stunden; dann zogen wir weiter und gelangten etwa um 2 Uhr nachmittags an einen grossen Ziwa oder Teich inmitten der Dschungels und am nächsten Tage um 10 Uhr morgens auf die Felder von Mapanga. Als wir an dem Dorfe Mapanga vorbei an einen jenseits gelegenen Ruheplatz zogen, wo wir frühstücken und den Tribut bezahlen konnten, stürzte uns ein Bursche entgegen und fragte, wohin wir wollten. Nachdem wir ihm geantwortet, dass wir an einen Lagerplatz gingen, eilte er vorwärts und wir hörten ihn gleich darauf in einem Felde zu unserer Rechten mit einigen Leuten sprechen.
Mittlerweile hatten wir einen anmuthigen, schattigen Platz gefunden und halt gemacht; unsere Leute lagen auf dem Boden oder standen in der Nähe ihrer Lasten. Bombay war eben im Begriff, einen Ballen zu öffnen, als wir eine grosse Menge Menschen zusammenlaufen und laut schreien hörten. Gleich darauf kamen 40–50 Bewaffnete, ein Häuptling an der Spitze, aus dem Dickicht hervorgestürzt, schwangen ihre Speere über den Köpfen oder waren im Begriffe, ihre Bogen zu spannen und stiessen ein Geheul aus, wie es nur Wilde können, das ungefähr wie ein langgezogenes „Hhaat-uh — Hhaat — uhh-uhh“ klang und das zugleich trotzig, bestimmt und drohend, unverkennbar sagen wollte: „Ihr wollt doch wohl? Nein, Ihr wollt nicht!“
Ich hatte es schon geahnt, dass die von mir gehörten Stimmen nichts Gutes für uns bedeuteten, und infolge dessen meine Waffen und Patronen in Ordnung gebracht. Das war wahrhaftig eine schöne Gelegenheit zu einem Abenteuer! Wenn sie nur einen Speer auf uns geworfen oder wir einen Schuss in diesen drohenden Haufen von Wilden hineingefeuert hätten, so wäre es zwischen den sich gegenüberstehenden Banden zu einem bösen Kampfe gekommen! Es wäre keine geregelte Schlacht, kein äusseres Kriegsgepränge, sondern ein mörderischer Strauss geworden, ein rasches Feuern von Hinterladern und Musketensalven, in das sich fliegende Speere und das Rauschen der Bogen gemischt hätte, wobei die Memmen sofort, von brüllenden Wilden[S. 254] verfolgt, fortgelaufen wären; und wer weiss, wie das geendet haben könnte? Zwar waren nur 40 Speere gegen 40 Flinten, aber wie viel von den mit Flinten Bewaffneten wären wol davongelaufen? Vielleicht alle und ich wäre mit meinen kleinen Flintenträgern allein geblieben, um mir den Hals abschneiden oder mich enthaupten zu lassen, damit mein Kopf eine lange Stange in der Mitte eines Kigogo-Dorfes zieren könne, wie der des armen Monsieur Maizan in Dege la Mhora in Uzaramo. Welch glückliches Ende wäre das für meine Expedition gewesen! Und dazu der Verlust des Livingstone’schen Tagebuchs, der Frucht einer sechsjährigen Arbeit!
Hier zu Lande taugt es nichts zu kämpfen, wenn man nicht durch die alleräusserste Noth dazu gezwungen wird. In Ugogo kann man nicht wie Mungo Park kriegerisch gesinnt sein und Glück haben, es sei denn, dass man eine ausreichende Zahl Truppen bei sich hat. Mit 500 Europäern könnte ich Afrika von Norden nach Süden durchstreifen und brauchte bei richtigem Takt und bei der moralischen Wirkung, die eine solche Truppe einflösst, nur wenig zu kämpfen.
Ohne also von dem Ballen aufzustehen, auf dem ich sass, bat ich den Kirangozi, eine Erklärung des furchtbaren Lärms und der drohenden Mienen zu verlangen und zu fragen, ob sie gekommen seien, um uns zu berauben.
„Nein“, sagte der Häuptling, „wir wünschen Euch nicht den Weg zu versperren oder Euch zu berauben, sondern wollen nur Tribut haben.“
„Aber seht Ihr denn nicht, dass wir hier halten und der Ballen schon geöffnet ist, um Euch den Tribut zu schicken. Wir sind so weit von Eurem Dorfe, um, nachdem der Tribut bezahlt ist, unseres Weges weiter zu ziehen, da der Tag noch jung ist.“
Der Häuptling brach in ein lautes Lachen aus, in das auch wir einstimmten. Er war offenbar über sein Betragen beschämt, denn freiwillig gab er die Erklärung ab, als er und seine Leute eben Holz schlugen, um einen neuen Zaun für ihr Dorf zu machen, sei ein Jüngling zu ihm gekommen und habe erzählt, dass eine Karavane von Wangwana im[S. 255] Begriff sei durch das Land zu ziehen, ohne halt zu machen und zu erklären wer sie seien. Alsbald waren wir sehr gute Freunde. Er bat mich ihm Regen zu machen, da sein Korn leide und es seit Monaten keinen Regen gegeben habe. Ich sagte ihm darauf, dass die Weissen zwar sehr gross und gescheit seien und weit über den Arabern ständen, aber doch keinen Regen machen könnten. Obwol sehr enttäuscht, bezweifelte er diese Behauptung doch nicht und gestattete uns, nachdem wir ihm ein geringfügiges Honga bezahlt, unseres Weges zu ziehen, ja er begleitete uns sogar etwas weiter, um uns den Weg zu zeigen.
Um 3 Uhr nachmittags kamen wir in ein Dornendickicht und um 5 Uhr nach Muhalata, einem Gebiete, über das Nyamzaga als Häuptling herrscht. Ein Mgogo, den ich mir zum Freunde gemacht, erwies sich als sehr treu. Er gehörte nach Mulowa, einem süd-südöstlich, südlich von Kulabi, belegenen Lande, und war unter Beihülfe von Bombay bei der Festsetzung des Tributs in meinem Interesse sehr thätig. Als wir am nächsten Tage auf unserm Wege nach Mvumi durch Kulabi zogen und die Wagogo im Begriff waren, uns wegen des Honga Aufenthalt zu bereiten, übernahm er es, uns von weitern Zahlungen zu befreien, indem er behauptete, wir seien aus Ugogo oder Kanyenyi. Da nickte der Häuptling einfach mit dem Kopfe und wir zogen weiter. Es scheint also, dass die Wagogo von Karavanen, welche nur in ihrem eigenen Lande Handel treiben und nicht über ihre Grenzen hinaus wollen, kein Lösegeld erpressen.
Nach Kulabi zogen wir über eine nackte, rothe, lehmige Ebene, über die der Wind von den Höhen von Usagara, die jetzt als bläulich schwarze Berge vor uns erschienen, schrecklich heulte. Mit heftiger, einschneidender Gewalt schienen die furchtbaren Stürme uns durch den Körper zu dringen, als ob wir nur aus leichtem Gazegewebe beständen. Männlich kämpften wir gegen diesen mächtigen „Peppo“ (Sturm), zogen durch Mukamwa’s Land und kamen über ein breites, sandiges Flussbett hinweg ins Gebiet von Mvumi, dem letzten Tribut erhebenden Häuptling von Ugogo.
Am 4. April schlugen wir uns durch das Dickicht, nachdem[S. 256] ich Bombay und meinen freundschaftlichen Mgogo mit 8 Doti Tuch als Abschiedstribut an den Sultan abgeschickt, und in fünf Stunden waren wir auf der Grenze der Wildniss Marenga Mkali, dem „harten“, bittern oder salzigen Wasser.
Aus unserm Lager schickte ich drei Leute nach Zanzibar mit Briefen an den amerikanischen Consul, einer telegraphischen Depesche an den „Herald“ und der Bitte an den Consul, er möge die Leute bald wieder an mich zurückschicken mit einem Vorrath von Genussmitteln, wie sie hungrige, ermüdete und durchnässte Leute wohl zu schätzen wissen. Die drei Boten erhielten den Auftrag, sich durch nichts, ob Regen oder Flüsse oder Ueberschwemmungen, aufhalten zu lassen, da wir sie, wenn sie nicht vorwärts eilten, einholen würden ehe sie die Küste erreichten. Mit einem inbrünstigen „Inschallah, Bana!“ zogen sie ab.
Am 5. begaben wir uns mit einem kräftigen aufmunternden Hurrah mitten in die Wildniss, die ihrer ewigen Ruhe und Einsamkeit wegen den geräuschvollen Streitigkeiten der Wagogo-Dorfschaften sehr vorzuziehen war. Neun Stunden lang zogen wir dahin und stöberten durch lärmende Ausrufe wilde Rhinozeros, furchtsame Quaggas und Heerden von Antilopen auf, welche die Dschungels dieser breiten Salzbecken massenhaft bewohnen. Am 7. kamen wir unter strömendem Regen in Mpwapwa an, wo mein schottischer Begleiter Farquhar gestorben war.
Wir hatten den enormen Marsch von 338 englischen Meilen vom 14. März bis zum 7. April, d. i. in 24 Tagen, mit Einschluss aller Aufenthalte, zurückgelegt, was also etwas mehr als 14 Meilen täglich ausmachte.
Leukole, der Häuptling von Mpwapwa, bei dem ich Farquhar gelassen hatte, gab mir folgenden Bericht von seinem Tode: „Bis zum fünften Tage, nachdem Ihr ihn verlassen, schien der weisse Mann sich zu bessern; dann aber fiel er bei einem Versuch, aufzustehen und aus dem Zelte herauszuspazieren, auf den Boden. Von dem Augenblicke an wurde er immer schlimmer und schlimmer und starb am Nachmittag wie ein Mensch, der einschlafen will. Beine und Unterleib waren ihm bedeutend angeschwollen[S. 257] und ich glaube, etwas muss in ihm zerrissen sein als er fiel, denn er schrie wie ein Mensch, der grossen Schaden erlitten hat, und sein Diener sagte: «der Herr meint, er sei im Begriff zu sterben.»“
„Wir liessen ihn unter einen grossen Baum tragen und daselbst liegen, nachdem wir ihn mit Blättern zugedeckt hatten. Sein Diener nahm Besitz von seinen Sachen, nämlich der Flinte, den Kleidern und der wollenen Decke, und zog in das Tembé eines Mnyamwezi in der Nähe von Kisokweh, wo er drei Monate gelebt hat und dann auch gestorben ist. Vor seinem Tode verkaufte er das Gewehr seines Herrn für 10 Doti an einen Araber, der nach Unyanyembé ging. Das ist alles, was ich davon weiss.“
Er zeigte mir hierauf die Vertiefung, in welche die Leiche Farquhar’s geworfen worden war; ich konnte dort aber keine Spur von seinen Gebeinen finden, obgleich wir uns genau danach umsahen, um ein anständiges Grab für sie herzustellen. Ehe wir Unyanyembé verliessen, waren 50 Leute zwei Tage lang damit beschäftigt, Felsblöcke zusammenzutragen, aus denen ich um das Grab Shaw’s einen soliden, dauerhaften Bau errichtete, der 8 Fuss lang und 5 Fuss breit war und von dem Dr. Livingstone meinte, er würde als das Grab des ersten in Unyamwezi verstorbenen Weissen hunderte von Jahren dauern. Obwol wir nun keine Ueberreste des unglücklichen Farquhar entdecken konnten, so sammelten wir doch eine grosse Menge Steine und bauten daraus einen Wall in der Nähe des Stromes auf, um den Ort zu bezeichnen, wo seine Leiche hingelegt worden war.
Erst als wir in das Thal des Mukondokwa-Flusses kamen, hatten wir viel von der Masika zu leiden. Hier nämlich brausten und donnerten die Giesbäche; der Fluss war eine mächtige, braune Flut, die mit fast unwiderstehlicher Macht abwärts strömte. Die Ufer desselben waren überflutet, breite Nullahs ganz von Wasser gefüllt, die Felder überschwemmt und dennoch fiel noch immer der Regen in Strömen hernieder, die uns verkündeten, was wir während unseres Durchzugs durch die Küstengegend zu leiden haben würden. Trotzdem eilten wir weiter wie Leute, denen jeder Augenblick kostbar ist, weil sie von einer Sündflut[S. 258] überrascht werden können. Dreimal passirten wir diese furchtbare Flut an den Furten vermittelst Seilen, die von einem Ufer ans andere an Bäumen befestigt wurden, und kamen am 11. nach Kadetamare als elende, vom Unglück heimgesuchte Menschen. Dort lagerten wir auf einem Berge, gegenüber dem zur Rechten des Flusses liegenden Berge Kibwe, der einen der höchsten Gipfel der Bergkette bildet.
Am 12. April erreichten wir nach dem ermüdendsten Marsche, den ich je gemacht, die Mündung des Mukondokwa-Passes, aus welchem sich der Fluss in die Makata-Ebene ergiesst. Wir erkannten, dass die Regenzeit in diesem Jahr ungewöhnlich heftig sei, denn der üble Zustand des Landes, wie wir ihn im vorigen Jahr angetroffen hatten, war nichts im Vergleich zu dem diesjährigen. Dicht am Rande der schäumenden, aufgeregten Flut lag unsere Route, die sich häufig in tiefe Graben senkte, worin wir uns bisweilen bis an den Gurt, manchmal bis an den Hals im Wasser befanden. Doch wurden wir durch die dringendste Nothwendigkeit weiter getrieben, um nicht in einer der Dorfschaften bis ans Ende der Monsunregen campiren zu müssen. So zogen wir denn über Marschgründe, bis an die Knie im Kothe watend, unter triefenden Dschungel-Gewölben, durch Pfützen, die bis an die Achseln reichten, weiter. Jeder Wasserlauf schien bis zum Ueberfliessen voll zu sein, und noch immer strömte der Regen weiter, schlug die Oberfläche des Wassers zu einem gelben Schaum und peitschte uns, dass wir fast den Athem verloren. Ein halbtägiger Kampf gegen diese Schwierigkeiten brachte uns, nachdem wir über den Fluss gesetzt, wieder zu dem traurigen Dorfe Mvumi.
Die Nacht brachten wir damit zu, uns der schwarzen, gefrässigen Moskitos zu erwehren und in heldenmüthigen Versuchen Ruhe und Schlaf zu finden, was uns zum Theil infolge der äussersten Ermattung des Körpers gelang.

Am 13. zogen wir vom Dorfe Mvumi fort. Es hatte die ganze Nacht geregnet und hörte auch am Morgen nicht auf. Meilenweit zogen wir über überschwemmte Felder, bis wir wieder einmal ans Ufer eines Flussarms kamen, wo derselbe eng und in der Mitte zu tief zum Uebersetzen war. Wir fingen also an, einen Baum zu fällen, und richteten es[S. 259] so ein, dass er gerade über den Strom fiel. Ueber diesen gefallenen Baum bewegten sich unsere Leute langsam mit ihren Ballen und Kisten; Rodschab aber, ein junger Bursche, nahm, entweder aus Uebereifer oder aus Tollheit, Livingstone’s Kasten, der seine Briefe und das Tagebuch enthielt, auf den Kopf und ging damit in den Fluss. Ich kam als erster am andern Ufer an, um den Uebergang zu überwachen, und erblickte plötzlich diesen Menschen mit dem kostbarsten Kasten auf dem Kopf im Flusse gehend. Auf einmal fiel er in ein tiefes Loch und Mann und Kasten verschwanden mir aus den Augen, sodass ich über das den Depeschen drohende Schicksal in Verzweiflung gerieth. Zum Glück erholte er sich wieder und kam herauf, während ich ihm, einen auf seinen Kopf gezielten geladenen Revolver in der Hand, zuschrie: „Nimm Dich in Acht! Wenn Du diesen Kasten fallen lässt, so wirst Du sofort erschossen!“
Meine sämmtlichen Leute hielten bei ihrer Arbeit inne und blickten auf ihren durch die Flut und die Kugel zugleich gefährdeten Kameraden. Der Mensch selbst schien die Pistole mit dem grössten Schrecken anzusehen und es gelang ihm nach einigen verzweifelten Anstrengungen, den Kasten glücklich ans Ufer zu bringen. Da die darin befindlichen Gegenstände keinen Schaden erlitten hatten, kam Rodschab ohne Strafe davon, wurde aber gewarnt, unter keinen Umständen den Kasten wieder anzurühren, welcher dem sicherfüssigen, vorzüglichen Pagazi Maganga zur Aufbewahrung übergeben wurde.
Von diesem Seitenfluss gelangten wir in etwa einer Stunde an den Hauptfluss; hier aber genügte uns ein Blick auf seine wilden Wasser. Wir arbeiteten angestrengt, um eine Fähre zu bauen; nachdem wir aber vier Bäume abgeschlagen, die grünen Stämme zusammengebunden und dann in den wirbelnden Strom hinabgestossen hatten, sahen wir sie wie Blei sinken. Darauf banden wir sämmtliche starke Seile, die wir besassen, zusammen, machten daraus ein Tau von 180 Fuss Länge, wanden ein Ende desselben um Tschaupereh’s Körper und schickten ihn hinüber, um das Tau an einem Baume zu befestigen. Er wurde weit stromabwärts getrieben, da er aber ein vorzüglicher Schwimmer[S. 260] war, so gelang ihm der Versuch. Darauf wurden die Ballen, von den Seilen umschnürt, in den Strom gelassen und durch den Fluss ans andere Ufer gezogen, und ebenso geschah es mit dem Zelt und denjenigen Dingen, die durch das Wasser keinen Schaden leiden konnten. Auch wurden mehrere meiner Leute und ich selbst durch das Wasser gezogen, wobei die besten Schwimmer auf die Jungen aufpassten. Als die Reihe aber an die Briefkasten und Werthsachen kam, wussten wir kein Mittel sie herüber zu bekommen. Es wurde daher auf jeder Seite des Stromes ein Lager aufgeschlagen; das eine auf einem Ameisenhaufen von erheblicher Höhe auf dem Ufer, das ich eben verlassen hatte; während meine Leute sich an einem flachen, schmutzigen Sumpfe niederlassen mussten. Ein fast fusshoher Damm wurde in einem Kreise von 30 Fuss Durchmesser aufgeworfen, mein Zelt in die Mitte desselben gestellt und ringsherum Lauben erbaut.
Dies war eine neue, aussergewöhnliche Lage, in der wir uns befanden. Noch nicht 20 Schritt von unserm Lager schwoll ein Fluss an, der flache, niedrige Ufer hatte; über uns lagerte ein düsterer Regenhimmel; um uns zu drei Seiten ein ungeheuerer Wald, auf dessen Zweige wir beständig den Regen herabprasseln hörten; uns zu Füssen ein grosser, tiefer, schwarzer, ekelhafter Koth; hierzu kam noch der Gedanke, dass der Fluss austreten und uns dadurch völlig vernichten könne.
Am Morgen schwoll der Strom noch immer an und ein unvermeidliches Geschick schien unser zu harren. Noch war es Zeit zu handeln, die Leute mit den werthvollsten Gegenständen der Expedition herüberkommen zu lassen; Dr. Livingstone’s Tagebuch und Briefe und meine eigenen Papiere hielt ich für viel werthvoller als alles andere. Als ich den schrecklichen Strom ansah, kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht die Kasten dadurch einzeln herüberschaffen könne, dass ich zwei dünne Stangen schneiden, quer darüber Stöcke binden und dadurch eine Art Tragbahre herstellen liess, auf der ein Kasten angebunden werden könne. Zwei hinüberschwimmende Leute, die sich gleichzeitig am Tau hielten und die Enden der Stangen auf ihren Schultern hätten, mussten meines Erachtens im Stande sein,[S. 261] einen Kasten von 70 Pfund bequem hinüberzuschaffen. In kurzer Zeit wurde eine solche Bahre angefertigt und sechs Paar unserer stärksten Schwimmer wurden angefeuert durch ein Glas steifen Grog und ein Versprechen von Tuch, das ihnen in Aussicht stand, falls sie alles unbeschädigt ans Ufer brächten. Als ich sah, wie leicht sie sich mit der Bahre auf den Schultern hinüberzogen, war ich erstaunt, dass ich nicht früher auf diesen Plan verfallen war. Eine Stunde nachdem das erste Paar das Uebersetzen begonnen hatte, befand sich die ganze Expedition sicher am östlichen Ufer. Sofort brachen wir unser Lager ab und marschirten nach Norden durch den sumpfigen Wald, der an einigen Stellen vier Fuss unter Wasser stand. Nachdem wir sieben Stunden lang beständig im Wasser gewatet und manche eigenthümliche Unfälle erlebt hatten, kamen wir nach Rehenneko. Jetzt befanden wir uns am Rande der überschwemmten Ebene des Makata, welche schon im Regen des vorigen Jahres zu schrecklich gewesen war, als dass man kalten Blutes daran hätte denken können, sie zu überschreiten.
Zehn Tage lang, bis zum 25., lagerten wir daher auf einem in der Nähe von Rehenneko belegenen Berge und entschlossen uns erst, als der Regen vollständig aufgehört hatte, über den Makata zu setzen. Die Tuchballen waren sämmtlich, mit Ausnahme einer kleinen Anzahl, die ich zu meinem eigenen Unterhalt zurückbehalten hatte, an die Leute als Geschenke für ihre Arbeit vertheilt worden.
Wir hätten jedoch eigentlich noch einen Monat länger warten müssen, denn die Ueberschwemmung hatte sich noch nicht um vier Zoll verringert. Da wir nun aber einmal bis an den Hals im Wasser wateten, so war es unnütz zurückzukehren. Auf zwei Märschen von je acht Stunden arbeiteten wir uns durch Schlamm, Koth, tiefe Pfützen, bis an den Hals reichendes Wasser und wahre Kothfluten, schwammen über Nullahs, wateten durch Wasserrinnen und kamen am zweiten Tage gegen Sonnenuntergang an die Ufer des Makata-Flusses. Diese Nacht werden meine Leute wol nie vergessen; kein einziger von ihnen war im Stande einzuschlafen, ehe Mitternacht lange vorüber war, wegen der dichten Schwärme von Moskitos, welche uns zu verzehren[S. 262] drohten; und als am nächsten Tage das Marschhorn ertönte, war nicht einer unter ihnen, der nicht willig gewesen wäre von hier rasch fortzumarschiren.
Um 5 Uhr morgens fingen wir an über den Makata zu setzen; am andern Ufer aber erstreckte sich sechs Meilen weit ein grosser See, dessen Wasser langsam zum Wami flössen. Dies war der Zusammenfluss der Ströme; hier vereinigten sich vier Flüsse zu einem. Die Eingeborenen von Kigongo warnten uns zwar den Versuch zu machen, da das Wasser uns über den Kopf reichen werde; ich brauchte aber meinen Leuten nur zu winken und sie setzten ihren Weg fort. Selbst das Wasser — wir wurden geradezu zu Amphibien — war besser als der furchtbare Schmutz und die Haufen verwesender Pflanzen, die gegen das Boma des Dorfes getrieben wurden. Bald waren wir bis an die Schultern im Wasser; dann sank letzteres wieder bis an die Knie; darauf reichte es uns wiederum bis an den Hals und wir mussten auf den Zehenspitzen waten und die Kinder über dem Wasser halten. Es wiederholten sich die Leiden des gestrigen Tages, bis wir am Rande des Kleinen Makata halten mussten, der in einem Tempo von acht Knoten in der Stunde daherstürzte. Dieser war aber nur 50 Schritt breit und auf der andern Seite erhob sich ein hohes Ufer und trockenes Parkland, das sich bis nach Simbo ausdehnte. Es blieb uns nichts übrig als zu schwimmen; dies ging aber sehr langsam vor sich, da die Strömung so reissend und stark war. Doch thaten guter, thatkräftiger Wille, hohe Belohnungen, Geldgeschenke und das lebhafte Gefühl, dass wir uns der Heimat näherten, Wunder und in einigen Stunden befanden wir uns am andern Ufer des Makata.
Freudig hoffend zogen wir den trockenen, ebenen Pfad, der jetzt vor uns lag, von Heldenmuth und Veteranenausdauer beseelt, dahin. In einem Tage machten wir drei gewöhnliche Märsche ab und kamen lange vor der Nacht in Simba an.
Am 29. überschritten wir den Ungerengeri. Als wir nach Simbamwenni, der „Löwenstadt“ von Useguhha, kamen, welche Veränderung erblickten wir da! Der überflutende Strom hatte die vordere Mauer der stark ummauerten Stadt[S. 263] vollständig fortgeschwemmt und etwa fünfzig Häuser zerstört. Die Dorfschaften der Waruguru an den Abhängen der Uruguru-Berge, der Mkambaku-Bergkette, hatten auch schwer gelitten. Wenn ein Viertel der Berichte, die uns mitgetheilt wurden, auf Wahrheit beruhte, so mussten wenigstens auch 100 Menschen umgekommen sein.
Die Sultanin war geflohen und die Veste Kisabengo’s existirte nicht mehr! Ein tiefer Kanal, den er bei Lebzeiten hatte ausgraben lassen, um einen Arm des Ungerengeri in die Nähe der Stadt zu leiten, die sein Stolz war, hatte Simbamwenni zu Grunde gerichtet. Nach der Zerstörung des Ortes hatte sich der Fluss ein neues Bett ungefähr 300 Meter von der Stadt gebildet. Was uns am meisten in Erstaunen setzte, waren die Massen von Trümmern, die überall in Haufen dalagen, und die grosse Anzahl Bäume, die niedergestreckt waren. Sie schienen sämmtlich in derselben Richtung zu liegen, als ob ein starker Wind von Südwesten gekommen wäre. Der Anblick des Ungerengeri-Thals war vollständig verändert; aus einem Paradiese war es zu einer furchtbaren Wüste geworden.
Wir setzten unsern Marsch bis nach Ulagalla fort und es wurde uns bei unserer Weiterreise klar, dass ein ungewöhnlicher Sturm über das Land hergefahren sei, denn die Bäume lagen an einigen Stellen wie in Schwaden.
Ein sehr anstrengender langer Marsch brachte uns nach Mussoudi, ans östliche Ufer des Ungerengeri; doch lange, ehe wir es erreicht hatten, wussten wir, dass ungeheuer viel Menschenleben und Eigenthum zerstört worden sei. Man kann sich die Ausdehnung und den Charakter des Unglücks vorstellen, wenn ich sage, dass nach dem Berichte Mussoudi’s fast hundert Dorfschaften fortgefegt worden sind.
Der Diwan Mussoudi erzählte, die Einwohner hätten sich wie gewöhnlich zur Ruhe begeben, wie sie es seit 25 Jahren, wo er sich im Thale niedergelassen, immer gethan, als sie mitten in der Nacht ein Getöse wie von vielfachem Donner hörten, das sie aufweckte und ihnen die Thatsache klar machte, dass der Tod ihnen in Gestalt einer furchtbaren Wassermasse drohe, welche wie eine Mauer[S. 264] herabstürzte, die höchsten Bäume mit sich fortriss und mit einem grausen Schlage Dörfer zu Dutzenden der völligen Zerstörung anheimgab. Das sechs Tage nach dem Ereigniss sich darbietende Schauspiel, wo der Fluss sich schon in seine während des Monsun normale Breite und Tiefe zurückgezogen hatte, ist geradezu furchtbar. Wohin man auch blicken mag findet man etwas, das auf die Verwüstung, die das Land heimgesucht hat, hinweist. Kornfelder sind viele Fuss hoch von Sand und Trümmern bedeckt; das Sandbett, das der Fluss verlassen hat, ist ungefähr eine Meile breit und es stehen nur noch gegen drei Dörfer von allen, die ich auf der Hinreise nach Unyanyembé gesehen. Als ich Mussoudi fragte, wohin die Leute gegangen seien, antwortete er: „Gott hat die meisten derselben zu sich genommen; einige sind aber nach Udoe gegangen.“ Der schwerste Schlag, der je den Stamm der Wakami getroffen, rührt allerdings von der Hand Gottes her, und um die Worte des Diwans zu brauchen: „Gottes Macht ist wunderbar und wer kann ihm widerstehen?“
Ich kehre wieder zu meinem Tagebuche zurück und mache daraus folgende Auszüge.
30. April. An Msuwa vorbei reisten wir rasch durch Dschungels, die uns auf unserm Wege nach Unyanyembé so viel Beschwerden bereitet hatten. Welch schreckliche, unbeschreibliche, Ekel erregende Düfte erzeugt doch dieses Dickicht! Es ist so dicht, dass ein Tiger nicht hindurchkriechen, und so undurchdringlich, dass selbst ein Elefant es mit ganzer Kraft nicht durchbrechen könnte! Wenn man das hier von uns eingeathmete Miasma condensiren und in eine Flasche füllen könnte, welch tödliches, augenblicklich wirkendes, in seinen Eigenschaften unenträthselbares Gift würde dies sein! Ich glaube, es würde rascher als Chloroform und tödlicher als Blausäure wirken.
Alle Schrecken finden sich daselbst beisammen: Boas über unsern Häuptern, Schlangen und Skorpione zu unsern Füssen; Landkrabben, Schildkröten und Iguanas bewegen sich in unserer Nähe; Malaria steckt in der Luft, die wir athmen; der Weg ist von „Heisswasser“-Ameisen heimgesucht, die uns die Beine so zerstechen, dass wir uns wie Tolle[S. 265] krümmen und tanzen. Trotzdem sind wir so glücklich, unserm Untergange zu entgehen, und das kann auch noch manchem späteren Reisenden gelingen. Doch finden sich hier wirklich die zehn Plagen Aegyptens, durch welche der Reisende Spiessruthen laufen muss:
1. Mai. Kingaru Hera. Hier hörten wir von einem grossen Sturm, der in Zanzibar gewüthet und daselbst angeblich alle Häuser und Schiffe zerstört haben soll; ebenso sollte er in Bagamoyo und Whinde gewüthet haben. Ich bin jetzt hinreichend mit der Tendenz des Afrikaners zum Uebertreiben bekannt, aber es mögen auch dort wirklich ernste Verluste stattgefunden haben, wie sich aus den Wirkungen des Sturmes im Innern schliessen lässt. Man sagt mir auch, dass sich Weisse in Bagamoyo befinden, die im Begriff sind ins Innere zu reisen, um mich aufzusuchen. Ich kann gar nicht begreifen, wer sich nach mir umsehen sollte. Man muss wol irgendeine dunkle Vorstellung von meiner Expedition haben, obgleich ich es nicht erklären kann, wie sie davon etwas erfahren, dass ich jemanden aufgesucht habe, denn ich habe, ehe ich Unyanyembé erreichte, keiner Seele etwas davon gesagt.
2. Mai. Rosako. Kaum war ich im Dorf angekommen, als die drei Leute, die ich von Mvumi in Ugogo abgesandt, daselbst eintrafen und mir vom freigebigen amerikanischen Consul einige Flaschen Champagner, mehrere Töpfe mit Fruchtsaft und zwei Büchsen bostoner Zwieback mitbrachten. Nach meinen schrecklichen Erlebnissen im Makata-Thale war mir dies sehr willkommen. In eine dieser Büchsen hatte der Consul vier Nummern des „Herald“ sorgfältig eingepackt. Von diesen enthielt eine meine Correspondenz aus Unyanyembé, in der sich einige merkwürdige Druckfehler namentlich in Bezug auf die Zahlen und die afrikanischen[S. 266] Namen befinden. Vermuthlich habe ich infolge meiner Schwäche sehr schlecht geschrieben. In einer andern Nummer befanden sich mehrere Auszüge aus verschiedenen Zeitungen, aus denen ich ersah, dass viele Redacteure die Expedition nach Afrika als eine Fabel ansehen. Leider ist sie für mich eine schreckliche, ernste Thatsache gewesen, eine anstrengende, gewissenhaft durchgeführte That, die mit Entbehrungen, Krankheit, ja fast mit dem Tode verknüpft gewesen. 18 Leute haben dieses Unternehmen mit dem Leben bezahlt. Auch ist der Tod meiner beiden weissen Begleiter keine Fabel; diese armen Leute hat ihr Schicksal in den unwirthlichen Regionen des Innern erreicht.
Einer dieser kritischen Artikel, der aus der Feder eines Redacteurs in Tennessee stammt, endigt, nachdem er sich humoristisch über die Expedition ausgelassen, folgendermassen:
„Das Schicksal dieser Expedition steht fest, und wenn Livingstone nicht selbst in der civilisirten Gesellschaft wieder erscheint, so brauchen wir nicht darauf zu rechnen, je wieder etwas von diesem Commissionär des “Herald„ zu hören. Er wird wol in einen zweiten grossen Makata-Sumpf hineingerathen und den Weg seines unglücklichen Hundes Omar gehen. Sic semper.“
Während ich in Afrika in einem Auftrage reiste, von dem ich in meiner Unschuld annahm, dass er sich den meisten Christenleuten empfehlen müsse, gab es also Menschen, die innig wünschten, dass ich keinen Erfolg haben möchte. Es ist sonderbar, wie wenig Unterschied zwischen der Cultur und der Barbarei besteht, welch geringer Unterschied zwischen manchen Weissen und wilden Negern existirt. Diese letzteren habe ich, wenn man sie gut behandelt, als freundliche, angenehme Leute kennen gelernt; die im obigen Auszuge sich darstellende Gesinnung zeigt mir aber, was ich zu Hause zu erwarten habe. Jedenfalls habe ich das Lachen auf meiner Seite. Wenn ich nur so lange lebe, um nach Hause zu kommen, so finde ich vielleicht Gelegenheit, noch mehr zu lachen.
Einer der Briefe, die mir mein Bote aus Zanzibar mitgebracht, berichtet, dass in Bagamoyo eine Expedition existirt, die sich „Expedition zur Auffindung und Unterstützung[S. 267] Livingstone’s“ nennt. Was werden die Führer derselben jetzt thun? Livingstone ist aufgefunden und hat schon die nöthige Hülfe. Er selbst sagt, er brauche nichts mehr. Es ist doch ein Unglück, dass sie sich nicht früher aufgemacht haben, dann könnten sie mit Anstand weiter ziehen und von ihm willkommen geheissen werden.
4. Mai. Wir sind bei Kingwere’s Fähre angekommen, aber nicht im Stande, die Aufmerksamkeit des Fährmanns auf uns zu ziehen. Zwischen unserm Lager und Bagamoyo haben wir eine wenigstens vier engl. Meilen breit überschwemmte Ebene. Das Uebersetzen unserer Expedition über dieselbe wird viel Zeit in Anspruch nehmen.
5. Mai. Kingwere, der Besitzer des Canoes, kam ungefähr um 11 Uhr vormittags aus seinem Dorfe Gongoni vom andern Ufer der Wasserfläche an. Nach seinen Bewegungen zu schliessen, möchte ich annehmen, dass er der Nachkomme eines schwarzen Königs Log sei, denn ich habe in keinem Lande, an keinem Individuum die Eigenthümlichkeiten jener fürstlichen Persönlichkeit so deutlich erkannt wie an Kingwere. Er brachte zwei kurze gebrechliche Nachen mit, in denen nur 12 Mann von uns Platz hatten. Es war 3 Uhr nachmittags, ehe wir im Dorfe Gongoni ankamen.
6. Mai. Nachdem ich Kingwere die Nothwendigkeit, rasch zu handeln, durch das Versprechen eines goldenen Fünfdollarstücks eingeschärft, hatte ich die Genugthuung, den letzten Mann um 3½ Uhr nachmittags in meinem Lager ankommen zu sehen.
Eine Stunde später sind wir auf dem Wege und zwar in einem Schritt, den ich meine Karavane nie zuvor hatte annehmen sehen. Die Empfindungen jedes Einzelnen sind ausserordentlich gespannt, was sich durch eine gewisse Lebhaftigkeit, ja ich möchte sagen ein jähes Ungestüm der Bewegungen kundthut. Meine Gefühle entsprechen übrigens genau den ihrigen, und ich bin durchaus nicht zu stolz, die grosse Freude, die sich meiner bemächtigt hat, einzugestehen. Denn es erfüllt mich mit Stolz, dass ich die Sache glücklich zu Ende geführt habe; doch bin ich, ehrlich gesprochen, nicht einmal dadurch so freudig erregt, als durch[S. 268] die Hoffnung, morgen an einer reichlich mit den guten Dingen dieser Welt besetzten Tafel zu sitzen. Welche Freude werde ich an Schinken, Kartoffeln und gutem Brot haben! Ist das nicht ein beklagenswerther Gemüthszustand? Mein lieber Freund, warten Sie es ab, bis Sie durch abzehrenden Hunger und grobe, Ekel erregende Nahrung zu einem Skelet abgemagert sind; bis Sie durch einen Makata-Sumpf gewatet und in solchem Wasser, wie wir, 525 engl. Meilen marschirt sind; dann werden auch Sie ordentliche Speisen für etwas Göttliches halten.
Glücklich sind wir, dass wir uns nach Vollendung unserer Expedition, nach der Plage und Eile des Marsches, nach aller Angst und Qual vor feindseligen Stämmen, nach dem angreifenden, funfzehn Tage dauernden Marsche durch wahrhaft stygischen Morast und Koth der friedlichen Ruhe Beulahs nähern! Können wir es da wol unterlassen, unsere Glückseligkeit kundzuthun durch Abfeuern von Gewehren, bis unsere Pulverhörner geleert sind, oder durch Hurrahs auszudrücken, bis wir heiser sind, sowie jedes direct von der See kommende Menschenkind mit herzlichen, die Seele erfreuenden „Yambos“ zu begrüssen? Das halten die Wangwana-Soldaten für unmöglich, und ich sympathisire so sehr mit ihnen, dass ich, ohne sie zu tadeln, ihre tollsten Streiche gestatte.
Mit Sonnenuntergang kommen wir in die Stadt Bagamoyo. In Beulah hörten wir die Worte: „Es sind noch mehr Pilger zur Stadt gekommen“; in Bagamoyo sagte man: „Der Weisse ist zur Stadt gekommen“. Morgen werden wir nach Zanzibar übersetzen und in die goldene Pforte eingehen; dort werden wir nichts mehr sehen, riechen oder schmecken, was den Magen beleidigt!
Der Kirangozi stösst so mächtig ins Horn wie Astolf, während sich Eingeborene und Araber um uns drängen; und die glänzende Fahne, deren Sterne über dem Wasser des grossen Sees in Mittel-Afrika geflattert, die dem durch Unglück in Udschidschi fast aufgeriebenen Livingstone Hülfe versprochen, kehrt zwar zerfetzt und zerrissen, aber nicht entehrt ans Meer zurück.
Als wir in die Mitte der Stadt kamen, sah ich auf den[S. 269] Stufen eines grossen, weissen Hauses einen Weissen in Flanellkleidern und mit einer der meinigen ähnlichen Kopfbedeckung stehen; er war jung, hatte einen röthlichen Backenbart, ein leuchtendes, lebendiges, munteres Gesicht und hielt den Kopf leicht auf eine Seite gebeugt, wodurch er ein etwas nachdenkliches Aussehen bekam. Da ich mich mit allen Weissen gewissermassen verwandt fühlte, spazierte ich auf ihn zu. Auch er kam auf mich zu, schüttelte mir die Hand und hätte mich fast umarmt.
„Wollen Sie nicht eintreten?“ fragte er.
„Besten Dank.“
„Was wollen Sie trinken, Bier, Porter oder Branntwein? Bei Gott, ich gratulire Ihnen zu Ihren glänzenden Erfolgen“, sagte er mit grosser Erregung.
Ich erkannte ihn sofort. Es war ein Engländer. Sie haben es an sich, in dieser Weise aufzutreten; aber in Central-Afrika war es etwas anderes. (Ein glänzender Erfolg! Ist das wirklich die Ansicht, die man von der Sache hat? Um so besser. Wie so weiss er aber überhaupt etwas davon? Ach, ich habe ja ganz vergessen; meine Leute haben, wie ich sehe, geschwatzt.)
„Schönen Dank! ich nehme alles sehr gern, was Sie mir geben wollen.“
„Junge, bringe rasch Bier her, oder ich werde dir sieben Teufel ausprügeln“, sagte er in lebhaftem Tone.
Es würde unnütz sein, Einzelheiten der Unterhaltung, die zwischen uns stattfand, mitzutheilen. Alsbald erzählte er mir mit der ihm eigenen leichten, lebendigen Weise, wer er sei, wozu er hergekommen, was seine Hoffnungen, Gedanken und Empfindungen über die verschiedensten Dinge seien. Es war Lieutenant William Henn von der königlichen Marine, Anführer der Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung Livingstone’s, welche die Königl. Geographische Gesellschaft im Begriffe war abzusenden. Der erste Führer derselben bei ihrer Organisation war Lieutenant Llewellyn S. Dawson, der, sobald er von meinen Leuten erfuhr, dass ich Livingstone aufgefunden, nach Zanzibar übergesetzt war und nach einer Besprechung mit Dr. John Kirk seine Stelle niedergelegt hatte. Er hatte jetzt nichts mehr[S. 270] damit zu thun, sondern der Oberbefehl war dem Lieutenant Henn zugefallen. Auch ein gewisser Herr Charles New, ein Missionär aus Mombasah, hatte sich der Expedition angeschlossen; doch auch dieser war zurückgetreten. Jetzt blieb also niemand übrig, als Lieutenant Henn und Oswald Livingstone, der zweite Sohn des Doctors.
„Ist Herr Oswald Livingstone hier?“ fragte ich mit höchstem Erstaunen.
„Ja wohl, er wird sogleich erscheinen.“
„Was wird er jetzt thun?“ fragte ich.
„Ich halte es jetzt für mich nicht der Mühe werth, mich auf die Expedition zu begeben. Sie haben uns den Wind weggefangen. Da Sie ihm Hülfe gebracht haben, so hat es, nach meiner Ansicht, eigentlich keinen Zweck, dass ich hingehe. Was meinen Sie?“
„Das hängt davon ab. Sie kennen die Ihnen ertheilten Befehle am besten. Wenn Sie nur hergekommen sind, um ihn aufzusuchen und ihm Hülfe zu bringen, so kann ich Ihnen in Wahrheit sagen, dass das bereits geschehen ist, und dass er nichts als einige Büchsen eingemachtes Fleisch und noch ein paar Kleinigkeiten braucht, die Sie wol nicht haben. Ich habe die Liste davon von ihm selbst geschrieben bei mir. Jedenfalls muss aber sein Sohn hingehen, und für den kann ich mit Leichtigkeit Leute zusammenbringen.“
„Gut, wenn er schon Hülfe hat, so ist mein Hingehen zwecklos .... Ich hatte auf gute Jagd gehofft, von der ich ein grosser Freund bin. Wie gerne möchte ich einen afrikanischen Elefanten erlegen.“
„Nun, Livingstone bedarf Ihrer nicht. Wie er sagt, hat er hinreichend viel Vorräthe, um bequem seine Reise zu beendigen; und er muss es doch am besten wissen. Wenn ihm etwas mangelte, so würde er es in seiner Liste aufgeführt haben. Eine grössere Fülle würde ihm nur eine Last sein, denn er könnte nicht Lastträger dafür bekommen. Was haben Sie da?“
„Ach“, sagte er leicht lächelnd, „wir haben ein Magazin voll Tuch und Perlen, wir haben mehr als 190 Lasten an Vorräthen.“
„190 Lasten!“
[S. 271]
„Ja wohl.“
„Wohin wollen Sie denn mit allen diesen Lasten? Es gibt ja an der ganzen Küste nicht genug Leute, um eine solche Masse zu transportiren. Denn für 190 Lasten brauchen Sie 250 Träger, da Sie wenigstens 50 Ueberzählige mitnehmen müssten!“
Jetzt trat ein hochaufgeschossener, hagerer junger Mann mit hellem Teint, blondem Haar, dunklen, glänzenden Augen herein, der mir als Herr Oswald Livingstone vorgestellt wurde. Es bedurfte kaum der Einführung, denn in seinen Zügen lag viel, was an seinen Vater erinnerte. Er sah ruhig und entschlossen aus und in der Art, wie er mich begrüsste, zeigte sich ein schweigsamer Charakter, woraus ich auf eine empfängliche Natur schloss, die für die Zukunft Gutes versprach. Es konnte kaum einen grösseren Contrast geben als zwischen diesen beiden jungen Leuten. Der Eine flüchtig, geschwätzig, inconsequent, aufbrausend, von unbezwinglicher Lebenslust überschäumend, von der Beweglichkeit des Quecksilbers, heiter und jovial; der Andere gesetzt bis zum Ernst, von gleichmässig ruhigem Betragen, mit entschlossenem, festem Gesicht, aber aufblitzenden Augen, die einen sonst unbeweglichen Gesichtsausdruck belebten. Von Beiden würde nach meiner Meinung wol der letztere der geeignete Führer einer Expedition gewesen sein; doch wäre Henn, wenn er Ausdauer und zwar nicht blos die zur physischen Constitution gehörige, sondern den sittlichen Muth besass, mit Ausdauer und Tapferkeit stets wiederkehrendes Unglück, Fieber, Entbehrungen und Beschwerden zu ertragen, wegen seines Humors und seiner übersprudelnden Munterkeit ein wünschenswerther Gefährte gewesen. Livingstone schien seiner Natur nach im Stande zu sein, die ganze Last der Verantwortlichkeit zu tragen, wogegen Henn bei seiner natürlichen Lebendigkeit und impulsivem Wesen noch zu jung für eine solche Aufgabe zu sein schien, obwol er sich im reifen Mannesalter befand.
„Ich habe soeben dem Lieutenant Henn gesagt, dass, gleichviel ob er geht oder nicht, Sie Ihren Vater aufsuchen müssen, Herr Livingstone.“
„Gewiss, das will ich.“
[S. 272]
„Das ist schön. Ich werde Ihnen Leute und die Vorräthe, deren Ihr Vater bedarf, besorgen. Meine Leute werden Sie ohne Schwierigkeiten nach Unyanyembé bringen. Diese kennen den Weg gut und das ist ein grosser Vortheil; sie verstehen es, mit Negerhäuptlingen zu unterhandeln und Sie werden sich um ihretwillen nicht den Kopf zu zerbrechen sondern nur zu marschiren brauchen. Vor allen Dingen ist Eile nöthig. Denn Ihr Vater wartet auf die Sachen.“
„Ich werde sie schon rasch genug marschiren lassen, wenn es nur darauf ankommt.“
„Sie werden mit wenig Gepäck landeinwärts ziehen und daher leicht lange Märsche machen können.“
So war es denn abgemacht. Henn kam zu der definitiven Ansicht, dass, da der Doctor bereits Hülfe erhalten, er selbst nicht nöthig sei. Ehe er jedoch förmlich seine Stelle niederlegte, wollte er noch mit Dr. Kirk Rücksprache nehmen und zu dem Zweck am nächsten Tage mit der Expedition des „Herald“ nach Zanzibar übersetzen.
Um 2 Uhr morgens legte ich mich in bequemem Bett zum Schlafen nieder. Gewisse Dinge im Schlafzimmer, wie z. B. Ränzel, Tornister, Mantelsäcke, Sättel, Gewehrfutterale hatten einen Geruch von Neuheit an sich. Offenbar fehlte es der neuen Expedition noch an Erfahrung; doch hätte eine Reise ins Innere bald den Vorrath von überflüssigen Dingen, mit denen sich jeder Neuling zuerst belastet, verringert.
Ach! wie seufzte ich erleichtert auf, als ich mich auf mein Bett warf und den Gedanken fasste: „Gott sei Dank, mit dem Marschiren hat es ein Ende.“
[S. 273]
Am 7. Mai 1872 um 5 Uhr nachmittags langte die Dhow, welche meine Expedition nach Zanzibar zurückführte, im Hafen an, und meine Leute, hoch erfreut, sich einmal wieder so nahe ihrer Heimat zu finden, feuerten eine Salve nach der andern ab. Die amerikanische Flagge wurde aufgehisst, und alsbald sahen wir, wie die Hausdächer und Werfte von Zuschauern, unter denen sich viele Europäer befanden, besetzt waren, die ihre Gläser auf uns richteten.
Langsam kamen wir ans Ufer; ein Boot wurde ausgesetzt, um uns ans Land zu bringen; wir stiegen hinein, und alsbald war ich bei meinem Freunde, dem Consul, der mich in Zanzibar herzlich willkommen hiess. Bald darauf wurde ich dem Pastor Charles New vorgestellt, der noch vor einigen Tagen ein wichtiges Mitglied der englischen Expedition gewesen war, einem kleinen, schmächtigen Herrn, der, obgleich er schwächlich aussah, doch einen solchen Grad von Energie besass, dass er für diesen Körper fast zu gross zu sein schien. Auch er beglückwünschte mich herzlich.
Nach einem reichlichen Mahle, dem ich in einer Weise, die meine neuen Freunde in Erstaunen setzte, Gerechtigkeit widerfahren liess, machte mir Lieutenant Dawson, ein kräftiger, starker, junger Mann, von prächtiger Gestalt, stattlichem[S. 274] Aussehen, raschen, intelligenten Zügen, einen Besuch und sagte:
„Herr Stanley, erlauben Sie, dass ich Ihnen gratulire.“
Dann erzählte er mir, wie er auf meinen Erfolg neidisch sei, wie ich ihm den Wind weggefangen habe (ein seemännischer Ausdruck, den auch Lieutenant Henn gebraucht hatte), wieder, als er von meinen Leuten erfahren, dass Dr. Livingstone aufgefunden sei, sofort von Bagamoyo nach Zanzibar übergesetzt sei und nach einer kurzen Unterredung mit Dr. Kirk seine Stelle niedergelegt habe.
„Aber meinen Sie nicht, Herr Dawson, dass Sie auf den blossen mündlichen Bericht meiner Leute hin etwas zu rasch darin verfahren sind?“
„Das kann sein“, sagte er; „ich hörte aber, dass Herr Webb einen Brief von Ihnen erhalten und dass Sie und Livingstone entdeckt hätten, der Rusizi laufe in den See, sowie dass Sie des Doctors Briefe und Depeschen bei sich hätten.“
„Ja, aber Sie haben doch alle diese Nachrichten nur von meinen Leuten erhalten; Sie hatten doch nichts selbst gesehen und haben also Ihre Stelle früher niedergelegt, als Sie persönliche Beweise für die Thatsache besassen.“
„Nun, Dr. Livingstone ist doch aufgefunden und hat Hülfe bekommen, wie Herr Henn mir sagte, nicht wahr?“
„Ja, das ist wahr. Er ist mit allem gut versehen, braucht nur einige wenige Genussmittel, die ich ihm durch eine Expedition von 50 Freien zukommen lassen will. Gewiss ist Dr. Livingstone aufgefunden und hat Hülfe bekommen, und ich habe alle Briefe und Depeschen, die er seinen Freunden schicken konnte, bei mir.“
„Glauben Sie denn nicht, dass ich vollständig richtig gehandelt habe?“
„Kaum; obgleich es vielleicht am Ende ganz dasselbe geworden wäre. Denn ein grösserer Vorrath an Tuch und Perlen, als er schon hat, würde ihm nur eine Last sein. Indessen Sie haben Ihre Befehle von der Königl. Geographischen Gesellschaft. Da ich diese noch nicht gesehen habe, kann ich nicht darüber urtheilen, was Sie am besten hätten thun müssen; doch meine ich, Sie haben unrecht[S. 275] daran gethan, Ihre Führerschaft eher niederzulegen, als Sie mich gesehen, denn dann hätten Sie wol eine ausreichende Entschuldigung für die Niederlegung Ihres Amtes gehabt. Ich wenigstens hätte bei der Expedition so lange ausgehalten, bis ich mich mit meinen Auftraggebern besprochen, obwol in einem Falle wie dieser der Befehl wahrscheinlich gelautet haben würde: “Kommen Sie nach Hause„.“
„Wie die Sache aber liegt, habe ich doch wol recht gethan.“
„Es wäre jetzt ganz bestimmt unnütz, Livingstone aufzusuchen und ihm Hülfe zu bringen, weil er sie bereits hat; aber Sie hatten vielleicht andere Befehle?“
„Nur wenn ich ins Innere ging, sollte ich meine Aufmerksamkeit auch auf die Erforschung des Landes wenden; da Sie mir aber beim Hauptzweck zuvorgekommen sind, so bin ich gezwungen nach Hause zurückzukehren. Die Admiralität hat mir nur Urlaub gegeben um Livingstone aufzusuchen und durchaus nichts über die Erforschung des Landes gesagt.“
„Steht denn in Ihren Befehlen gar nichts darüber, was Sie zu thun haben, falls Sie mit mir zusammenträfen?“
„Kein Wort, obwol die Thatsache meinen Auftraggebern bekannt war; denn eins der Mitglieder der Geographischen Gesellschaft hat mir privatim gesagt, vielleicht könnte ich auch Ihnen Hülfe bringen. Ich wusste nichts von Ihrer Expedition, ausser was in Ihren Briefen an den “Herald„ stand; wir hatten aber gehört, dass Sie am Fieber erkrankt und vielleicht todt seien. Als ich hier ankam, hörte ich viel von Ihnen reden, und man erzählte, dass Sie Livingstone gerade an dem Tage aufgefunden hätten, wo wir hier ankamen; darauf legten wir aber nicht viel Gewicht. Erst nachdem ich Ihre eigenen Leute gesprochen, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich überflüssig sei, und habe deshalb mein Amt niedergelegt.“
„Warum hat man meinen Namen in den Ihnen mitgegebenen Instructionen nicht erwähnt? Man wusste doch nach dem, was Sie sagen, dass ich mich im Innern befände, und mochte ich auch ein noch so schwacher Reisender sein, so war das doch immer eine Möglichkeit, die aufstossen konnte.“
[S. 276]
„Um die Wahrheit zu sagen, man wünschte es nicht, dass Sie ihn auffänden. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie eifersüchtig man bei uns zu Hause auf Ihre Expedition ist.“
„Ich sollte Livingstone also nicht auffinden! Was geht es jene an, wer ihn auffindet und ihm Hülfe bringt, wenn es nur wirklich geschieht?“
Das waren meine ersten erschütternden Nachrichten, und von diesem Augenblick an betrachtete ich mich als einen bei den Engländern verurtheilten Mann. Dass jemand so unmenschlich sein könnte, mir Miserfolg zu wünschen, weil ich an der Spitze einer amerikanischen Expedition stand, war mir nie in den Sinn gekommen. Bis zu diesem Augenblicke hatte ich nie überhaupt daran gedacht, wie die Menschen mein Glück oder Misgeschick ansehen würden. Ich hatte zuviel mit meiner Aufgabe zu thun, um an so etwas Unvernünftiges, Unwahrscheinliches zu denken, dass es Leute gäbe, welche lieber Dr. Livingstone unwiederbringlich verloren geben, als wünschen würden, dass ein amerikanischer Zeitungsschreiber ihn auffinde.
Ich war jedoch nicht lange in Zanzibar, ehe ich die in England herrschenden Gesinnungen völlig durchschaute. Man zeigte mir Ausschnitte aus Zeitungen, worin mehrere Mitglieder der Königl. Geographischen Gesellschaft die amerikanische Expedition lächerlich gemacht hatten und eins derselben sogar so weit gegangen war zu sagen, es bedürfe des „eisernen Kopfes eines Engländers“, um ins Innere von Afrika zu dringen. Dr. Kirk hatte sehr freundlich hingeschrieben und es ausgesprochen, dass er sich blos auf mich verlasse; dafür war ich ihm dankbar und bedauerte es, der Ueberbringer eines so zurückhaltend formell gehaltenen Schreibens von Dr. Livingstone an ihn zu sein.
An jenem Abend schickte ich einen Knaben ins englische Consulat mit Briefen des grossen Reisenden an Dr. Kirk und Herrn Oswald Livingstone.
Von den amerikanischen und deutschen Einwohnern wurde ich warm begrüsst; sie hätten wirklich nicht mehr Gefühl an den Tag legen können, wenn Dr. Livingstone ein ihnen theurer, naher Verwandter gewesen wäre. Kapitän[S. 277] H. A. Fraser und Dr. James Christie lobten mich auch sehr. Wie es scheint, hatten diese beiden Herren es versucht, privatim eine Expedition auszusenden, um ihrem Landsmann Hülfe zu schicken; aber sie ist aus irgendeinem Grunde nicht zu Stande gekommen. Sie hatten 500 Dollars zu diesem löblichen Zweck zusammengesteuert. Der Mann jedoch, dem sie das Commando anvertraut hatten, war von einem andern für einen andern Zweck mit einem höhern Gehalt angeworben worden. Statt jedoch sich darüber zu ärgern, dass ich das gethan, was sie beabsichtigt hatten, gehörten sie zu meinen begeistertsten Bewunderern.
Am nächsten Tage besuchte mich Dr. Kirk und gratulirte mir herzlich zu meinem Erfolg. Er machte durchaus keine Anspielung auf den Inhalt des von Dr. Livingstone erhaltenen Briefes. Auch Bischof Tozer kam und dankte mir für den Dr. Livingstone geleisteten Dienst.
An diesem Tage entliess ich auch meine Leute, warb jedoch sogleich wieder zwanzig von ihnen an, die sich zum „grossen Meister“ begeben sollten. Bombay, der im Innern des Landes jeden Gedanken an Geldbelohnungen verächtlich von sich gewiesen, in meiner grössten Noth jedoch versucht hatte, mir in jeder Weise in den Weg zu treten, erhielt ausser seinem Sold ein Geschenk von 50 Dollars, und ein jeder der übrigen je nach seinem Verdienst 20–50 Dollars. Denn am heutigen Tage mussten alle Feindseligkeiten begraben und alles Unrecht verziehen werden. Diese armen Leute hatten ja nur ihrer Natur gemäss gehandelt, und von Udschidschi bis an die Küste hatten sie sich vorzüglich betragen, was ich nicht vergass.
Als ich mich in einem Spiegel erblickte, fand ich mein Aussehen schrecklich abgezehrt und verändert. Jedermann bestätigte meine Ansicht, dass ich viel älter geworden und mein Haar ergraut sei. Kapitän Fraser hatte bei seiner Begrüssung gesagt: „Aber Sie sind älter als ich, mein Herr!“ und mich überhaupt nicht erkannt, bis ich ihm meinen Namen gesagt. Selbst dann machte er die spasshafte Bemerkung, er glaube, dies wäre ein zweiter Tichbornefall. Ich hatte mich selbst in der kurzen Periode von dreizehn Monaten, nämlich vom 23. März 1871 bis zum 7. Mai[S. 278] 1872, so sehr verändert, dass meine Identität kaum festzustellen war.
Auch Lieutenant Henn kam am Morgen nach meiner Ankunft zu mir und bat um Erlaubniss, den Auftrag, den ich vom Dr. Livingstone erhalten, zu sehen, was sofort geschah. Ich füge hier eine Abschrift des Auftrags bei:
„Unyanyembé, 14. März 1872.
Ich habe durch die Benutzung von Sklaven zu Karavanen, die mir durch den englischen Consul zugeschickt worden, so viele Verluste erlitten, dass, wenn Herr Stanley noch einem derartigen Trupp begegnet, ich ihn ersuche, sie umkehren zu lassen, übrigens aber in der ganzen Angelegenheit nach eigenem Gutdünken zu verfahren.
DAVID LIVINGSTONE.“
„Das bezieht sich aber gar nicht auf unsere Expedition,“ sagte Lieutenant Henn.
„Natürlich nicht,“ erwiderte ich, „es bezieht sich nur auf Sklavenkaravanen. Mit Ihrer Expedition habe ich überhaupt gar nichts zu thun. Was mich betrifft, können Sie thun, was Sie wollen. Aber Sie fragten mich gestern Abend, wie Sie sich erinnern werden, ob Dr. Livingstone bereits Hülfe habe. Darauf antworte ich Ihnen abermals “Ja„, und hier sind die Sachen (die von Livingstone selbst aufgestellte Liste zeigend), welche er zu haben wünscht. Wenn Sie trotzdem glauben, zu ihm ziehen zu müssen, so rathe ich Ihnen, das zu thun. Jedenfalls, meine ich, sollten Sie die Waaren nicht eher verkaufen, was Sie, wie ich höre, vorhaben, bis Sie von der Königl. Geographischen Gesellschaft Nachrichten haben. Diese hat vielleicht andere Absichten mit Ihnen, da sie jetzt schon so viele Kosten auf diese Expedition verwendet hat.“
„Ich werde mein Amt niederlegen und die ganze Sache dem jungen Livingstone überlassen.“
„Thun Sie, was Sie wollen. Sie müssen Ihre eigenen Angelegenheiten am besten beurtheilen können.“
„Ich weiss, was ich thun werde. Ich werde mit Kapitän Fraser nach Kilima-Ndscharo gehen und dort eine gute[S. 279] Jagdpartie mitmachen. New sagt mir, dass es in diesem Theil des Landes eine Menge Wild gibt.“
Lieutenant Henn ging denn auch direct aus dem amerikanischen Consulat, um seine förmliche Entlassung einzureichen, und von nun ab befand sich die Expedition in den Händen des Herrn Oswald Livingstone, der sich dazu entschloss, die Vorräthe zu verkaufen und nur das zurückzubehalten, was seinem Vater nützlich sein könne. Ehe er sie jedoch verkaufte, sagte ich zu Dr. Kirk, es wäre doch das Beste, sie aufzubewahren, weil die Königl. Geographische Gesellschaft sie vielleicht anderweitig für Forschungsreisen zu verwenden wünsche.
„Nein,“ sagte Dr. Kirk, „diese Waaren gehören Dr. Livingstone und da er sie nicht braucht, so kann man sie für ihn ohne viel Verlust in Geld umsetzen.“
Von Pastor Charles New, einem auf der Ostküste von Afrika, einige Meilen westlich von Mombasah wohnenden Missionär, erfuhr ich eine Menge auf das Scheitern der englischen Expedition bezügliche Einzelheiten. Obgleich er mir seine Bemerkungen mündlich mitgetheilt hat, so hat er sie doch später in Gestalt eines an mich gerichteten Briefes niedergelegt und ich ziehe hier dasjenige aus demselben aus, was auf diese Angelegenheit Bezug hat:
Nach einem langen Aufenthalt in Ost-Afrika war ich im Begriff nach England zurückzukehren, als ich in Zanzibar mit der englischen Expeditionsgesellschaft zusammentraf. Ganz wider mein Erwarten und auf Rath des Senats der Königl. Geographischen Gesellschaft wurde ich ersucht, mich der Expedition anzuschließen. Nach vieler Ueberlegung und einigem Zaudern that ich dies und nahm die Stelle eines Dolmetschers und dritten Befehlshabers an. Mein vom Lieutenant Dawson aufgesetzter Vertrag lautete so:
„Ich willige ein, meine Dienste der Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung Livingstone’s umsonst zu widmen und mich der ursprünglich in England von der Königl. Geographischen Gesellschaft organisirten Expedition unter folgender Bedingung anzuschliessen:
1) Sollte durch irgendeinen Zufall Lieutenant Dawson unfähig werden, den Oberbefehl weiter zu führen, so werde ich Lieutenant William Henn als den Befehlshaber der Expedition ansehen und mich seinen Befehlen fügen.
2) Sollte Lieutenant William Henn auch ausser Stande sein, den Befehl zu übernehmen, so werde ich ihn führen und alles thun, um[S. 280] die Zwecke der Expedition, wie sie in den Institutionen der Königl. Geographischen Gesellschaft niedergelegt sind, zu fördern.“
So lautete der von mir unterzeichnete Pact. Nachdem ich mich der Expedition angeschlossen, that ich alles, um die Vorbereitungen zur Abreise so viel wie möglich zu beschleunigen. Lieutenant Dawson, Lieutenant Henn und ich selbst gingen mit den Waaren und Wächtern über den Kanal nach Bagamoyo, um dort sofort Wa-Pagazi anzuwerben und uns ohne Verzug auf den Weg zu begeben. Bei unserer Ankunft in Bagamoyo trafen wir drei Leute, die ein paar Tage vor uns angeblich von Ihnen aus dem Innern angekommen waren. Wir fragten dieselben aus und erfuhren von ihnen, dass Sie mit Dr. Livingstone in Udschidschi zusammengekommen und mit ihm ans Nordende des Sees gegangen seien, den Rusizi in den See hätten fliessen sehen, dann nach Udschidschi zurückgegangen und von dort östlich bis Unyanyembé zusammengereist seien. Dort sei Dr. Livingstone mit der Absicht geblieben, seine Forschungen fortzusetzen. Sie aber kehrten in aller Eile an die Küste zurück; Sie seien schon in Ugogo und könnten in ein paar Tagen in Bagamoyo eintreffen.
Darauf sprachen Dawson und Henn ihre Absicht aus, die Expedition aufzugeben und nach England zurückzukehren auf Grund dessen, dass Sie die ihnen in Afrika gestellte Aufgabe bereits gelöst hätten. An dem Abend aber fragte mich Lieutenant Dawson, ob ich, falls es nöthig erscheine, Dr. Livingstone noch weitere Hülfe zuzuschicken, willens wäre, die Expedition zu leiten. Ich drückte meine Bereitschaft aus, über diesen Vorschlag nachzudenken. Am nächsten Tage kehrte Dawson nach Zanzibar zurück, um sich mit Dr. Kirk zu besprechen. Zwei Tage darauf erhielt ich Briefe von Dr. Kirk und von Lieutenant Dawson. Beide boten mir die Leitung der Unterstützungsexpedition an, da Herr Oswald Livingstone, dem es sehr darum zu thun war, sich zu seinem Vater zu begeben, darauf einging, sich meiner Leitung anzuvertrauen. Ich schrieb an Dr. Kirk und theilte ihm meine Bereitwilligkeit mit, die Hülfsexpedition zu führen. Mittlerweile aber hatte Lieutenant Henn seine Ansicht geändert und bestand jetzt darauf, den Oberbefehl zu führen. Ich war also genöthigt, mich zu seinen Gunsten zurückzuziehen. Man hoffte jedoch, dass ich als Zweiter dem Lieutenant Henn folgen würde und wäre das nöthig oder auch nur möglich gewesen, so hätte ich dies auch gethan.
Die Expedition war aber keineswegs das, was sie ursprünglich in England gewesen war. Sie war zu einer verhältnissmässig unbedeutenden Reise nach Unyanyembé geworden, welche von zwei Leuten, die ein wirkliches Interesse daran und genügende Energie und Ausdauer hatten, leicht auszuführen war. Das war die Ansicht, die ich von der Sache hatte. Deshalb zog ich mich, auf den Grund hin zurück, dass meine Dienste nicht mehr gebraucht und meine Anwesenheit[S. 281] eine leichte Aufgabe nur erschweren würde. Man hat allgemein angenommen, ich habe mich schriftlich dazu verpflichtet, unter allen Umständen dem Lieutenant Henn zu folgen. Das ist aber nicht der Fall. Mein erster Pact bezog sich auf die Expedition, wie sie ursprünglich in England organisirt worden war, und stellte fest, dass ich unter Lieutenant Henn dienen wolle für den Fall, dass Lieutenant Dawson durch irgendeinen Unfall zum Oberbefehl unfähig geworden sei. Lieutenant Dawson war aber gar nicht durch einen Unfall unfähig geworden, sondern er reichte seine Entlassung ein. Und dieser Rücktritt, der ursprünglich nicht vorhergesehen war, änderte, wie Dr. Kirk in seinem Briefe an mich sagte, vollständig alle frühem Anordnungen und auf dieser neuen Grundlage wurde mir die Expedition angeboten. Nachdem Lieutenant Dawson sich zurückgezogen, mussten neue Einrichtungen getroffen werden und jedes Individuum hatte die Freiheit, mitzugeben oder sich zurückzuziehen, wie es wollte.
Ich hatte aber andere Gründe, um nicht eine zweite Stelle in dieser Expedition unter dem Lieutenant Henn anzunehmen. Meiner Ansicht nach ist er ungeeignet und unfähig, eine solche Expedition zu leiten. Beim Abgange hatte er erklärt, sein Hauptzweck sei die Jagd, er wolle versuchen, Büffel und Elefanten zu schiessen. Solch ein Mann ist aber nach meiner Ansicht, nicht der richtige, um Dr. Livingstone Hülfe zu bringen, und ich meine, man hätte mich nicht auffordern sollen, unter ihm zu dienen. Wäre die ursprüngliche Expedition unverändert geblieben, so wäre ich unter allen Umständen mitgegangen. Noch ein Punkt: Lieutenant Henn hatte gedroht, von der Expedition zurückzutreten, ehe wir irgendetwas von Ihrer Rückkunft gehört hatten, und dadurch eine Unbeständigkeit an den Tag gelegt, welche das übelste in Bezug auf seinen Erfolg als Befehlshaber versprach. Als ich hörte, dass Lieutenant Henn mit seinem Rücktritt gedroht hatte, machte ich bei Dr. Kirk einen Besuch, um mit diesem Herrn die Angelegenheit zu besprechen. Ich zeigte Dr. Kirk, dass dieser Stand der Dinge den Erfolg der Expedition sehr beeinträchtige, und schlug ihm vor, die Leute von der Expedition zusammenzurufen, um zwischen den Lieutenants Dawson und Henn ein besseres Einvernehmen zu Stande zu bringen. Dr. Kirk sagte darauf: „Nein, thun Sie das nicht, Henn wird Sie zwei oder drei Tage lang ins Innere begleiten und dann ruhig zurückkehren.“ —
Hier wollen wir aufhören. Ich habe Herrn New eine Freundlichkeit erwiesen, da ich eine sehr hohe Meinung von seinen Fähigkeiten für seinen edeln, grossen Beruf habe, und bin überzeugt, er wird es mir vergeben, wenn ich in freundlicher Weise seine eigenen kleinen Fehler kritisire.[S. 282] Der Leser kann aus dem obigen Briefe ersehen, dass die Herren Dawson, Henn und New nicht auf sehr freundschaftlichem Fusse miteinander standen. In der That hätte ein Fremder nach dem, was man sich in Zanzibar erzählte, gemeint, die drei Herren ständen auf sehr gespanntem Fusse zueinander. Das schien aber nur äusserlich der Fall zu sein; es lag keine tiefe Feindschaft zu Grunde. Auch war es für einen wirklichen, ernstlichen Streit doch noch etwas zu früh. So lange sie alle unter einem festen unumschränkten Führer standen, schlummerten kleine Antipathien und kamen nicht zur Geltung; sobald sich aber dieser Führer, Lieutenant Dawson, zurückzog, trat etwas Eifersucht hervor, die durch die Frage angeregt wurde, welche Dawson an New richtete, ob er in dem Falle, dass eine Hülfe nöthig, willens sei, den Befehl zu übernehmen. Herr New wollte sich vorbehalten, darüber nachzudenken; wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Herr Henn gleichfalls den Befehl haben wollte, da es nur ein gedankenloses Wort von ihm gewesen, als er sagte, er wolle die Expedition aufgeben, denn damals war er noch nicht zu einem endgültigen Schlusse gekommen. Nach zweitägiger Ueberlegung erklärte Herr New seine Bereitwilligkeit, den Oberbefehl anzunehmen, und gerade in diesem Augenblicke drückte auch Herr Henn seinen Entschluss aus, mit der Hülfsexpedition zu ziehen. Da er nun der Zweite dem Range nach war, so konnte er über dieses Recht nach Belieben verfügen, und die verschiedenen Parteien hatten es ihm bewilligt, da sie contractlich dazu verpflichtet waren. Herr New jedoch hat nach seiner eigenen Auslassung seine Stelle niedergelegt und als Entschuldigung dafür angeführt, „die Expedition sei nicht mehr das, was sie gewesen“; doch ist Herr New darin etwas inconsequent, wenn er sagt, dass sie sich wesentlich geändert habe. Freilich hatte der frühere Führer sich zurückgezogen, aber nach seiner eigenen Version hatte er sich dazu verpflichtet, dem Lieutenant Henn zu gehorchen, wenn der Lieutenant Dawson durch einen Zufall unfähig gemacht sei. Der Zufall, nämlich mein Erscheinen, trat ein und Lieutenant Dawson machte sich durch seinen freiwilligen Rücktritt unfähig, den Oberbefehl zu führen. Deshalb hatte[S. 283] Lieutenant Henn wirklich das Recht des Oberbefehls und Herr Charles New musste ihm gehorchen. „Sollte durch irgend einen Zufall Lieutenant Dawson unfähig werden, den Oberbefehl weiter zu führen, so werde ich Lieutenant William Henn als den Befehlshaber der Expedition ansehen und mich seinen Befehlen fügen.“ In diesem Pacte steht nichts von der ursprünglichen Organisation.
Ferner sagt Herr New, die Sache „sei jetzt zu einer verhältnissmässig unbedeutenden Reise geworden, welche von zwei Leuten, die ein wirkliches Interesse daran und genügende Energie und Ausdauer hatten, leicht auszuführen sei“. Darin stimme ich mit ihm überein und behaupte, dass nicht nur zwei, sondern auch einer sich hätte hinbegeben und den Plan viel besser als zwei sich zankende Leute hätte ausführen können. Aber über die verhältnissmässige Geringfügigkeit weiche ich sehr von ihm ab. Ich meine, es sei für einen Unerfahrenen viel schwerer, eine Karavane nach Unyanyembé, als für einen Erfahrenen eine solche von Unyanyembé weiter zu führen. Bis die Expedition nach Unyanyembé gekommen, wäre sie in der Schule der Erfahrung erzogen und die spätere Reise wäre im Verhältniss zu dem ersten Versuch auf einem neuen Gebiet nichts gewesen, wenigstens habe ich das gefunden. Ich hatte mehr Mühe, mit meinen Karavanen nach Unyanyembé zu ziehen, als in allen darauf folgenden Reisen zusammengenommen. Die Erfahrung, die ich auf der ersten Hälfte meiner Märsche gewonnen, setzte mich in den Stand, die übrigen Reisen rasch und leicht abzumachen. Wenn Herrn Charles New’s Erfahrung als afrikanischer Reisender irgendetwas werth war oder für eine noch unerfahrene Gesellschaft nutzbar gemacht werden sollte, so galt dies gerade von der Küste bis nach Unyanyembé und nicht auf der weitern Reise.
Nachdem Lieutenant Henn und Herr Livingstone Unyanyembé erreicht, wären sie meines Erachtens vollständig im Stande gewesen, die Karavane auch ohne Herrn New überall hin zu führen; die auf dem Marsche erworbenen Erfahrungen würden sie befähigt haben, ganz ohne ihn auszukommen. Mir scheint es doch, dass Herr New, wenn er[S. 284] „nach einigem Zaudern“ darauf einging, sich der Expedition anzuschliessen, als ein Mann wie Dawson ihr Führer war, um ihr die Wohlthat seiner Erfahrungen zukommen zu lassen, und wenn er, nach Dawson’s Rücktritt, Henn für unfähig hielt, nach der Ansicht aller billig Denkenden um so mehr verpflichtet war, sowol Henn als Livingstone mit seinen Erfahrungen beizustehen, bis er ihnen beigebracht hätte, wie sie ohne ihn weiter reisen könnten. Dann erst hätte sich Herr New, wenn er wollte, ohne irgendeinen Nachtheil für seinen Ruf zurückziehen können.
Wenn auch Herrn Henn’s Hauptzweck die Büffel- und Elefantenjagd gewesen, so befreite dieser Umstand doch Herrn New nicht von seiner Pflicht, ihn zu begleiten, ihm Rath zu ertheilen und ihn für den Fall, dass alles Wild fehlte, in der Treue gegen den Hauptzweck der Expedition zu ermuntern, der sie alle ihre Unterstützung zugesagt hatten. Obwol Lieutenant Henn von Natur einen unsteten, lebhaften Charakter hatte, so zeigte er sich doch consequenter als Herr New, selbst wenn sein Zweck nur die Jagd war, indem er zum zweiten mal nach Bagamoyo ging; denn jener ging, nachdem er aus Bagamoyo nach Hause zurückgekehrt war, nicht wieder an seinen Dienst, sondern gab erst seine Stellung auf, bot dann seine Hülfe wieder an, und zog sich wiederum zurück und zwar nur, weil man ihm den Oberbefehl angeboten hatte, als Henn noch nicht ganz entschieden war und weil, nachdem dieser sich zur Expedition entschlossen hatte, ihm der Oberbefehl als das ihm gebührende Recht übertragen wurde und nicht an Pastor Charles New.
Es war Herrn New’s Pflicht, unter Henn’s Commando, wie er es übernommen, mitzugehen; wenn dann Henn die Vorhersage des Dr. Kirk zur Wahrheit gemacht, hätte er mit Ehren selbst das Commando übernehmen können, das er nach seiner eigenen Aussage so sehr zu haben wünschte.
Wenn nun auch Herr New keine beneidenswerthe Rolle in diesem Akte der kleinen, nicht nachahmungswerthen Komödie spielt, so erscheint er doch im ersten Akte fast wie ein Held, und ich bewundere ihn sehr als einen wahren, ernsten und tapfern Mann. Nach einem neunjährigen[S. 285] Aufenthalte in Afrika erhält er am Vorabend seiner Abreise nach England, wohin er sich begibt, um seine geschwächte Gesundheit zu stärken, eine Einladung, die englische Expedition als Dolmetscher zu begleiten. Nach kurzem Zaudern unterstützt er sie aufs kräftigste und verpflichtet sich, alles zu thun, was in seiner Macht steht, um die menschenfreundliche Mission, welche diese kleine Anzahl Engländer vorhat, zu fördern. Bis er von meinen Leuten erfährt, dass Livingstone aufgefunden sei und Hülfe erhalten habe, gibt er sich seiner Aufgabe mit der ganzen Energie seiner Natur hin; er segelt von Zanzibar nach Mombasah, kehrt sofort mit 20 Soldaten als Schutz für die Expedition zurück und gewinnt durch seine treue Hingabe an seine Aufgabe aller Herzen. Herr New hat in Zanzibar einen sehr guten Eindruck unter den dortigen Europäern hinterlassen, und es ist ihre einstimmige Meinung, dass er, wenn ich nicht so bald an die Küste gekommen wäre, die grosse, kostspielige Expedition in guter Ordnung durchgeführt hätte. Ich zögere durchaus nicht, es auszusprechen, dass er wegen seiner energischen Natur und langen Erfahrung für diese Aufgabe völlig geeignet war.
Der grosse Fehler der Organisation bestand aber in dem Versuch, so viele nicht zueinander passende Charaktere zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden. Kein einziges Mitglied hatte die geringste Charakterverwandtschaft zum andern. Der eine war ehrgeizig, eigensinnig, übereilt und zum Angriff geneigt; der andere lebhaft, dem Impuls des Augenblicks hingegeben und von Natur inconsequent; der dritte energisch, reizbar, fromm und zu offenherzig; der vierte schweigsam, ernst und bestimmt. New und Livingstone wären sehr gut miteinander ausgekommen. Dawson wäre allein wol besser als in Verbindung mit einem andern gewesen. Wenn Henn allein den Oberbefehl gehabt, so würde er seine Pflicht in ehrenhafter Weise durchgeführt haben, denn Energie und Ehrenhaftigkeit sind die beiden Hauptzüge seines Charakters. Aber zu einem einheitlichen, harmonischen Organismus fehlten dreien derselben alle Vorbedingungen, während der vierte sich keiner Partei angeschlossen, sondern ein neutraler Zeuge der Streitigkeiten[S. 286] geblieben war. Hätten sie die Expedition unternommen, so würden sie sich gezankt haben und es wäre schmählicher gewesen, als wenn sie gar nicht fortgezogen wären. Es war daher für den Ruf der Engländer ein Glück, dass meine Ankunft ihre Expedition vor dem völligen Untergange im Innern schützte.
In Zanzibar bieten sich wenige Gelegenheiten zur Abreise. Das englische Kriegsschiff „Magpie“ war am Morgen nach meiner Ankunft zum Kreuzen abgefahren, und wir erfuhren nachher, dass es, wie beabsichtigt, den „Wolverine“ getroffen und durch dieses Kriegsschiff Briefe nach den Sechellen und England weiter befördert hatte. Wenn es wahr ist, was man mir gesagt hat, dass ein englisches Kriegsschiff auch nicht eine Stunde selbst auf Dr. Livingstone gewartet haben würde, so habe ich kein Recht, mich darüber zu beschweren, dass es nicht wartete, bis ich ihm auch nur eine kleine Depesche über Herrn Livingstone mitgeben konnte. Andererseits schien es mir aber sonderbar, dass der Kapitän eines Kriegsschiffes mit seinem Fahrzeug auf die Jagd nach Bagamoyo fahren könne, ein anderer dagegen nicht einmal ein paar Augenblicke warten durfte, um einen Brief, der gute Nachrichten über Livingstone enthielt, mitzunehmen.
Ein englischer Geistlicher hat mir zwar gesagt, dass ein britischer Kreuzer sogar wenn Dr. Livingstone selbst in Zanzibar erschienen wäre, sich nicht eine Stunde lang über seine Zeit aufhalten könne, um ihn weiter zu befördern. Ich kann aber kaum annehmen, dass die nothwendige Disciplin eines britischen Kriegsschiffes in einem solchen Ausnahmsfalle nicht hätte gelockert werden dürfen.
Nachdem ich meine Expedition aufgelöst, machte ich mich daran, Dr. Livingstone’s Bitte gemäss, eine neue zu formiren. Was der englischen Expedition fehlte, kaufte ich mit dem von Herrn Oswald Livingstone mir gegebenem Gelde. Auch die 50 Flinten wurden mir aus den Vorräthen der englischen Expedition von ihm geliefert, ebenso die Munition, das Hongatuch für die Wagogo und das für den Unterhalt der Truppen bestimmte Tuch. Herr Livingstone arbeitete angestrengt im Interesse seines Vaters und stand[S. 287] mir mit allen seinen Fähigkeiten bei. Er übergab mir Nautische Almanache für die Jahre 1872, 1873 und 1874 zum Einpacken; ebenso einen Chronometer, den Dr. Kirk aufbewahrt und der früher Dr. Livingstone gehört hatte. Alle diese Dinge wurden nebst einem Tagebuche, Couverts, Notizbüchern, Schreibpapier, Arzneimitteln, eingemachten Früchten und Fischen, Wein, Thee, Messern, Gabeln und Tafelgeräth, Zeitungen, Privatbriefen und Depeschen, sowie 1 Centner feines amerikanisches Mehl und einige Kästchen Zwieback in luftdichte Zinnkasten verpackt.
Bis zum 19. Mai hiess es, dass Herr Oswald Livingstone die Karavane seinem Vater zuführen werde; aber ungefähr an dem Tage änderte er seinen Entschluss und setzte mich durch ein paar Zeilen in Erstaunen, in denen er mir mittheilte, er sei entschlossen aus Gründen, die er für ausreichend und richtig halte, nicht nach Unyanyembé zu gehen. Ich erlaubte mir, ihm die Andeutung zu machen, dass es seine Pflicht sei, sich hinzubegeben, nachdem er bis nach Zanzibar gekommen. Aber offenbar handelte er nach bester Erkenntniss, und wenn man in Betracht zieht, dass Dr. Kirk ihm den Rath gegeben, nicht seine Gesundheit zu gefährden und seine Studien zu unterbrechen, wo eine absolute Nothwendigkeit seiner persönlichen Beaufsichtigung der Karavane nicht vorlag, so glaube ich, dass er ganz recht gethan hat, den Plan aufzugeben. Denn Dr. Kirk war seines Vaters Freund und früherer Genosse auf dem Zambezi; und da der junge Livingstone viel Vertrauen in sein Urtheil und zwar mehr als in sein eigenes setzte, war es natürlich, dass er den Rath des Freundes seines Vaters befolgte.
Unter diesen Umständen war es meine Pflicht, den Befehlen Dr. Livingstone’s nachzukommen und ihm einen guten, tüchtigen Führer, einen Araber, für die Expedition nach Unyanyembé zu besorgen. In dieser Absicht schrieb ich einen Brief an Dr. Kirk, worin ich ihn darum bat, seinen Einfluss beim Sultan geltend zu machen. Die Antwort, die ich von Dr. Kirk erhielt, lautete folgendermassen:
[S. 288]
„Britisches Consulat zu Zanzibar, 20. Mai 1872.
Werther Herr!
Dr. Livingstone’s eigener Brief an Seyd Barghasch ist demselben vor langer Zeit übergeben und erklärt worden; darauf habe ich ihm aber mitgetheilt, dass Sie nicht mehr daran dächten, ihn um den betreffenden verantwortlichen Leiter der Expedition zu bitten. Unter den veränderten Umständen, wo Herr W. O. Livingstone den Gedanken aufgegeben hat, seinem Vater zu folgen, werde ich mich sehr freuen, Ihnen beim Sultan behülflich zu sein, und werde, wenn Sie es wünschen, sofort zu ihm schicken und ihn darum bitten, den geeigneten Mann auszusuchen, den Sie natürlich sich ansehen und nach Ihrem besten Dafürhalten entweder verwerfen oder annehmen können.
Ergebenst
Ihr
(gez.) JOHN KIRK.“
Dr. Kirk hatte mit seiner Bitte beim Sultan keinen Erfolg, wie er mir später mittheilte; ich traf deshalb sofort Schritte, anderweitig einen Führer zu beschaffen, und es gelang mir in wenigen Stunden einen von Scheikh Haschid sehr empfohlenen Mann zu finden, den ich gegen Vorausbezahlung von 100 Dollars miethete. Der junge Araber schien zwar nicht übermässig intelligent, aber doch ehrlich und tüchtig zu sein. Ich überliess es aber Dr. Livingstone, ob er ihn nach seiner Ankunft in Unyanyembé noch weiter benutzen wolle, da dieser dann selbst entscheiden könne, ob er ganz zuverlässig sei.
Am 25. segelte Lieutenant Dawson, nachdem er sich einen Platz auf der amerikanischen Barke „Mary A. Way“, Kapitän Russell, nach New York genommen hatte, ab. Ich gab ihm einen Einführungsbrief an einen Freund in New York mit. Wir trennten uns in höchst freundschaftlicher und wohlwollender Weise, da ich ihn für einen ritterlichen Gentleman hielt.
Am Morgen des 26. machte Dr. Kirk seinem Freunde, Herrn Webb, im amerikanischen Consulat einen Besuch und als er im Hause war, ergriff ich die Gelegenheit, ihm zu sagen:[S. 289] „Herr Doctor, ich fürchte, ich werde nicht im Stande sein, die Expedition für Dr. Livingstone so schnell wie ich hoffte abzusenden. Wenn das Dampfschiff, welches Herr Henn, Herr Livingstone und ich gemiethet haben, abfahren muss, ehe ich die Expedition auf den Weg bringen kann, so würde ich Sie bitten, sich der Mühe zu unterziehen.“
Hierauf erwiderte mir Dr. Kirk: „Wenn Sie das thun, so werde ich es abschlagen müssen. Ich will mich nicht wieder unnöthigen Beleidigungen aussetzen.[9] Als Privatmann habe ich nicht die Absicht, noch irgendetwas für Dr. Livingstone zu thun. Officiell werde ich für ihn ebenso handeln, wie für jeden andern britischen Unterthan.“
„Sie sprechen von unnöthigen Beleidigungen, Herr Dr. Kirk?“ fragte ich.
„Ja wohl.“
„Darf ich fragen, worin dieselben bestanden haben?“
„Er tadelt mich, dass ihn die Karavanen nicht zur rechten Zeit erreicht, und wirft mir vor, Sklaven gemiethet zu haben. Was kann ich aber dafür, dass die Leute ihn nicht erreicht haben?“
„Verzeihen Sie, Herr Doctor, aber wenn Sie an Dr. Livingstone’s Stelle wären, so würden Sie ebenso gehandelt haben. Sie würden Ihren besten Freund mindestens im Verdacht der Kälte, um nicht mehr zu sagen, gehabt haben, wenn Ihnen die Leiter der Karavanen ein mal nach dem andern erzählt hätten, dass sie vom Consul den Befehl erhalten, Sie zurückzubringen und Sie unter keinen Umständen irgendwohin zu begleiten.“
„Er konnte ja aber aus den Contracten ersehen, dass ich dieselben dazu gemiethet hatte, ihn überallhin zu begleiten. Wenn er lieber Negern und Mischlingen als meinen Worten und officiellen Mittheilungen glaubt, so ist er ein Narr; das ist alles, was ich zu sagen habe.“
„Aber, werthester Herr, wie kann Dr. Livingstone anders[S. 290] als einigen Zweifel gegen den Vertrag zu hegen? Schwören es ihm nicht alle die Leute zu, dass Sie ihnen befohlen haben, ihn zurückzubringen? Alle seine Bitten sind umsonst, und das Ganze endet damit, dass er gezwungen ist, von seinen Entdeckungen zurückzukehren. Musste er nicht glauben, dass dem irgendetwas Unerklärliches zu Grunde liege? Ueberall im Innern hat er dieselbe Geschichte immer wieder von neuem gehört, dass Sie ihm einen Brief geschrieben haben, der ihm befiehlt, zurückzukommen.“
„Dafür kann ich nichts; ich habe ihm einen Brief geschrieben gerade so, wie er ihn mir geschickt.“
„Dann“, sagte ich, „geht es nicht an, dass ich die Karavanen in Zanzibar lasse. Ich muss sie selbst noch auf den Weg bringen.“
Am nächsten Tage sammelte ich die Leute; da es aber gefährlich war, ihnen das freie Herumspazieren in der Stadt zu gestatten, so schloss ich sie in einen Hof ein, gab ihnen daselbst zu essen und liess sie warten, bis alle 57 beim Namensaufruf sich als anwesend meldeten.
Mittlerweile verschaffte ich mir mit Hülfe des amerikanischen Consuls die Dienste des Hauptdragomans des amerikanischen Consulats Dschohari, der den Auftrag erhielt, die Expedition über die überschwemmte Ebene des Kingani zu führen, und dem es eingeschärft wurde, in keinem Falle zurückzukehren, bis die Expedition vom westlichen Ufer des Kingani-Flusses abmarschirt sei. Herr Oswald Livingstone bezahlte ihm freigebigerweise ein Douceur dafür, dass er seiner Pflicht vollkommen nachkomme.
Als eine Dhow vor dem amerikanischen Consulat vor Anker gegangen war, hielt ich folgende Anrede an meine alten Gefährten: „Ihr steht jetzt im Begriff, nach Unyanyembé zum “Grossen Meister„ zurückzukehren. Ihr kennt ihn und wisst, dass er ein guter Mann ist und ein gütiges Herz hat. Er ist anders als ich und wird Euch nicht so schlagen, wie ich es gethan. Aber Ihr wisst doch auch, dass ich Euch alle belohnt, Euch alle mit Tuch und Geld reich gemacht habe. Ebenso wisst Ihr, wie ich stets Euer Freund gewesen bin, wenn Ihr Euch gut aufführtet. Ich habe Euch reichliche Nahrung und Kleidung gegeben. Wenn Ihr[S. 291] krank waret, habe ich mich um Euch bekümmert. Wenn ich nun schon so gut gegen Euch war, so wird es der Grosse Meister um so viel mehr sein. Er hat eine liebliche Stimme und spricht freundlich. Wann habt Ihr je seine Hand gegen einen Frevler aufheben sehen? Wenn Ihr Böses gethan hattet, so sprach er nicht böse, sondern nur traurig zu Euch. Wollt Ihr mir nun jetzt versprechen, ihm zu folgen, ihm in allen Dingen zu gehorchen und ihn nicht zu verlassen?“
„Das wollen wir, das wollen wir, Herr!“ riefen sie alle eifrigst.
„Dann bleibt noch eins übrig. Ich wünsche Euch allen die Hand zu drücken, ehe Ihr fortgeht und wir uns auf immer trennen.“ Alle stürzten sogleich auf mich zu und wir schüttelten uns gegenseitig kräftigst die Hände.
„Jetzt nehme ein jeder seine Last auf!“
Ich führte sie nun auf die Strasse und an den Strand, sah, wie sie alle eingeschifft und die Segel aufgehisst wurden und wie die Dhow westwärts nach Bagamoyo abfuhr.
Es war mir sonderbar zu Muthe und ich fühlte mich einigermassen verlassen. Meine schwarzen Freunde, die so viele Hunderte von Meilen mit mir gereist, so viele Gefahren mit mir getheilt hatten, waren fort und ich war allein gelassen. Werde ich wol je eins ihrer freundlichen Gesichter wiedersehen?
Am 29. fuhr der dem deutschen Consulat gehörige Dampfer „Afrika“, den die Herren Henn, Livingstone, New, Morgan und ich gemiethet hatten, von Zanzibar nach den Sechellen ab, geleitet von den besten Wünschen aller auf der Insel wohnhaften Europäer.
Auf unserer Reise nach Osten sahen wir die „Mary A. Way“, auf welcher sich Dawson allein befand. Ich wunderte mich, dass dieser eine so langsame Segelgelegenheit benutzt hatte. Nach meiner Ankunft in England bekam ich aber einen an den Secretär der Königl. Geographischen Gesellschaft gerichteten Brief zu Gesicht, worin er sagt:
„Ich hätte dieselbe Route genommen; aber wenn ich auch Herrn Stanley sein wohlverdientes Glück nicht misgönne,[S. 292] so wäre es mir, wenn nicht uns beiden, unangenehm gewesen, zusammen zu reisen, und von Zanzibar gibt es nur wenige Gelegenheiten nach Europa.“
Ich kann mir die Gesinnungen, von denen dieser Brief eingeflösst worden, nicht vorstellen; sie sind so anders als ich nach der offenen, edlen Natur des Schreibers voraussetzen musste. Ich kann es jedoch begreifen, dass es ihm nicht angenehm sein mochte, mit mir zu reisen, wenn sich irgend jemand unedle, misgünstige Vergleiche zu Schulden kommen liess; warum es aber mir unangenehm sein sollte, kann ich gar nicht einsehen.
Am 9. Juni kamen wir bei den Sechellen an, ungefähr zwölf Stunden nachdem die französische Post nach Aden abgegangen war. Da eine Verbindung zwischen Mahé, auf den Sechellen, und Aden nur einmal im Monat stattfand, so mussten wir auf der Insel Mahé einen ganzen Monat bleiben. Die Herren Livingstone, New, Morgan und ich mietheten ein kleines hölzernes Haus, welches wir Livingstone-Cottage nannten; Herr Henn dagegen zog in ein Hotel.
Der Aufenthalt in Mahé gehört zu den angenehmsten Erinnerungen an meine Rückreise von Afrika. Ich fand in meinen Gefährten angenehme Gesellschafter und echte Christen. Herr Livingstone entwickelte eine Menge liebenswürdiger Charakterzüge und erwies sich als ein fleissiger, nachdenkender, ernster Mann. Als schliesslich der französische Dampfer von Mauritius ankam, bedauerte ein jeder von uns, dass wir die schöne Insel und die gastfreien britischen Beamten, die dort stationirt sind, verlassen mussten. Der Civil-Commissär, Hales Franklyn, und Dr. Brooks thaten ihr Bestes, um es dem Wanderer angenehm zu machen, und ich benutze diese Gelegenheit, die vielen Höflichkeiten, die ich persönlich von ihnen erfahren, hiermit besonders hervorzuheben.
In Aden gingen die von Süden kommenden Passagiere auf den französischen Postdampfer „Mei-kong“ über, der von China nach Marseille fuhr. In diesem Hafen wurde ich von Dr. Hosmer und dem Repräsentanten des „Daily Telegraph“ mit offenen Armen empfangen. Diese sagten mir, wie man die Resultate der Expedition ansähe, aber[S. 293] erst bei meiner Ankunft in England machte ich mir die ganze Lage klar.
Herr Bennett, welcher das ganze Unternehmen ins Leben gerufen und erhalten hatte, krönte dasselbe jetzt durch eine der freigebigsten Thaten, die man sich denken kann. Ich hatte Dr. Livingstone versprochen, dass ich 24 Stunden, nachdem seine Briefe an Bennett in den Londoner Zeitungen veröffentlicht wären, die für seine Familie und Freunde in England bestimmten Briefe der Post übergeben werde. Um es mir zu ermöglichen, mein verpfändetes Wort zu halten, beförderte Herrn Bennett’s Agent die beiden Briefe durch den Telegraphen, was ihm nahezu 2000 Pfd. Sterling kostete.
**
*
Nur noch einige Worte, theurer Leser, und dann zum Schluss! Es wäre vielleicht würdevoller, wenn ich hier innehielte und unter diesen Bericht über meine Reiseabenteuer und Entdeckungen das Wort Finis setzte. Es gibt aber einige Dinge, an denen ich nicht stillschweigend vorübergehen kann, und unter diesen befindet sich die Behandlung, die ich in England erfahren.
Die englische Presse scheint sich vor meiner Ankunft in England in einem Netze von Irrthümern befunden zu haben. Kaum ein afrikanisches Wort war richtig, alle Daten falsch, die Thatsachen in unbegreiflichster Weise verdreht, und das schien zu Zweifeln und Argwohn Veranlassung zu geben. Mit Ausnahme eines aus Unyanyembé geschriebenen Briefes, der Depeschen nach meiner Rückkehr aus Zanzibar und meiner Briefe aus Marseille, verwerfe ich alles übrige. Ich kann nur für das einstehen, was ich geschrieben habe. Was im „New York-Herald“ als meine Briefe und Depeschen veröffentlicht worden, erkenne ich als correct an mit Ausnahme, wo Druckfehler sich eingeschlichen haben, was bei den sonderbaren Namen und wol auch bei meiner Handschrift natürlich ist, die, wenn man am Fieber leidet, nicht sehr klar oder zierlich ausfallen kann.
Es ist aber eine erstaunliche Thatsache, dass englische Redacteure darauf eifersüchtig waren, dass ein amerikanischer Correspondent Dr. Livingstone hatte auffinden sollen.[S. 294] Fast alle englischen Zeitungen haben ihre Ansichten über diesen Punkt in ganz deutlichen Ausdrücken ausgesprochen, obgleich die hauptsächlichsten und angesehensten nicht gezögert haben, mir zu gleicher Zeit viel Lob zu zollen. Ich beziehe mich hierbei auf die „Times“, die „Daily News“ und die „Morning Post“.
Meine Herren Redacteure, wenn ich Ihnen auch für Ihr einem jungen und nach seiner eignen Ansicht in keiner Weise ausgezeichneten Journalisten gezolltes Lob danke, so muss ich doch offen gestehen, dass Sie kein Recht haben, auf mich oder sonst jemand eifersüchtig zu sein. Ich bin nur ein Special-Correspondent der Zeitung, der ich zu dienen die Ehre habe und ganz zur Verfügung stehe. Ich war contractlich verpflichtet, überallhin zu gehen, wenn es mir befohlen wurde. Ich habe nicht nach der Auszeichnung gestrebt, Livingstone aufzusuchen; als ich aber den Ruf erhielt, war ich gezwungen, entweder zu gehorchen oder meine Stelle niederzulegen. Ich habe es vorgezogen, das erstere zu thun. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, so werden Sie wissen, was aus der mir anvertrauten Mission geworden, wie sie angefangen und wie sie beendet ist.
Auch haben Sie kein Recht, meine Herren, auf meinen Auftraggeber eifersüchtig zu sein. Ihnen stand ja Afrika ebenso offen wie ihm. Die Amerikaner empfanden ein ebenso grosses Interesse für Dr. Livingstone wie die Engländer. Es hatten wol ebenso viele Amerikaner seine Bücher gelesen, wie Engländer. Von dem Wunsche beseelt, die Sehnsucht der Amerikaner, etwas über Dr. Livingstone zu erfahren, zu befriedigen, hatte mein Auftraggeber den Gedanken gefasst, einen Special-Correspondenten nach Central-Afrika zu senden, um Livingstone aufzusuchen. Es standen ihm reichliche Mittel zu Gebote, und er hatte den Willen dazu. Wenn ein Special-Correspondent den Auftrag zurückgewiesen hätte, so hätte ihn ein anderer angenommen; es standen ihm genug zu Befehl, und wenn keiner der bei seiner Zeitung ständig Angestellten sich der Aufgabe unterzogen hätte, so hätte sich aus einer Menge intelligenter Leute ein Freiwilliger gefunden, und das Resultat wäre mit Gottes gnädiger Hülfe dasselbe, vielleicht sogar ein besseres[S. 295] gewesen. Hätte einer von Ihnen daran gedacht, die Aufgabe auszuführen und das ernstlich gewollt, so hätten sich Tausende von Engländern sofort freiwillig dazu erboten, und es wäre zu demselben Resultat, vielleicht zu einem bessern, gekommen. Sie haben sich ja alle ausgezeichnet: die „Times“ in der Krim, im indischen Aufstande, sowie überhaupt bei allen politischen Begebenheiten; ihr Name ist auf dem ganzen Erdball wohlbekannt. Ebenso haben sich der „Daily Telegraph“ und die „Daily News“ bei unzähligen Gelegenheiten ausgezeichnet. Wenn nun der „New York-Herald“ den Unternehmungsgeist der Presse ins Herz von Afrika, in dieses fabelhafte, dunkle Gebiet zu tragen wünschte, wer will es ihm verwehren? Wenn er die Kosten tragen kann, warum sollten da andere Zeitungen darüber murren? Es dreht sich hier einfach um Geld, welches der nervus rerum aller Unternehmungen ist. Man kann mit gehörig viel Geld leicht ganz Afrika erforschen; und nicht nur erforschen, sondern erobern und civilisiren; nicht nur civilisiren, sondern mit Eisenbahnen von einem Ende zum andern durchschneiden. Wozu also die Eifersucht? Die Welt steht Ihnen ebenso gut offen, wie dem „New York-Herald“.
Wo liegt denn die Grösse der That? Der Reisende, den ich gesucht habe, war gar nicht verloren. Er war am Leben. Wäre er todt gewesen und hätten seine Aufzeichnungen sich zerstreut unter den Stämmen befunden und ich hätte sie und jedes Stückchen Manuscript über seine Entdeckungen sowie seine Gebeine zusammengebracht und sie denen übergeben, welche sie zu schätzen wissen, so wäre das gross gewesen. Was ich aber so glücklich war auszuführen, war weniger gross, aber wol etwas verdienstvoll. Ich fand ihn krank und verlassen, und durch meine Ankunft wurde er heiter; mit meinen Waaren kam ich ihm zu Hülfe.
Ist der Umstand, dass ich ihm Heiterkeit und Unterstützung brachte, eine Quelle des Misvergnügens für Sie? Nun, meine Herren! würden Sie ihm nicht dieselben Dienste in eben solcher Weise geleistet haben? Wenn Sie ein Kind in den Rinnstein fallen sähen, würden Sie nicht Ihre Hand ausstrecken, um es aufzuheben? Wenn Sie einen ehrlichen,[S. 296] armen Mann sähen, würden Sie ihn nicht unterstützen? Wenn Sie sich dem Schwachen gegenüber befänden, würden Sie ihm nicht mit einem Theil Ihrer Kraft beistehen? Wenn Sie Leiden sähen, würden Sie dieselben nicht zu mildern suchen?
Nun denn! wie haben Sie mich dafür belohnt, dass ich das gethan, was Sie in solchem Falle auch gethan hätten? Einige von Ihnen haben erst die Wahrheit meiner Erzählung angezweifelt; dann die Briefe, die ich als von ihm kommend vorgewiesen, als Fälschungen verdächtigt; dann mich beschuldigt, auf Sensationsnachrichten auszugehen; darauf die einzelnen Thatsachen, die ich veröffentlicht, bekrittelt und mich, als ob ich ein Verbrechen begangen hätte, begeifert. Sie konnten eine einfache Erzählung, die ungekünstelte, klare, buchstäbliche Wahrheit tadeln! Wie schwach! Wie kindisch! Glauben Sie es mir aber, meine Herren Redacteure und Kritiker, oder glauben Sie es mir nicht: was in meinem Buch erzählt ist, hat sich nach meinem besten Wissen und Gewissen so zugetragen.
Und was haben Sie für sich zu sagen, meine Herren Geographen? Denken Sie mich mit Ihrem Unglauben ebenso niederzuschlagen, wie Sie James Bruce, René Caillie oder Paul du Chaillu niedergeschlagen haben? Gedenken Sie mich ebenso durch Ihre Unfreundlichkeit zu verwunden, wie den berühmten Burton und den tapfern Petherick? Sie haben die Welt glauben lassen, dass Sie sich um Ihren grossen Genossen kümmerten. Sie wünschten, dass man annähme, dass Sie sich danach sehnten, zu erfahren, was aus ihm geworden, als nichts über ihn zu hören war. Nun wird ohne Ihre Hülfe oder Ihren Beirath die Mission angefangen und bis zu Ende durchgeführt, und Sie erhalten die Nachricht, Livingstone ist aufgefunden und hat Hülfe erhalten; Ihr grosser Genosse ist am Leben und steht im Begriff, seine Entdeckungen mit noch grösserer Thatkraft weiter zu verfolgen. Und was antworten Sie darauf: „Es gibt einen Punkt, in Bezug auf den etwas Aufklärung wünschenswerth ist; denn es scheint der Glaube vorzuherrschen, dass Herr Stanley Dr. Livingstone aufgefunden und ihm Hülfe gebracht hat; wogegen es, ohne der Energie, Thatkraft[S. 297] und Treue des Herrn Stanley zu nahe zu treten, wahr ist, dass, wenn hier überhaupt ein Auffinden und eine Hülfe stattgefunden hat, sie von Dr. Livingstone ausgegangen ist, der Herrn Stanley entdeckt und unterstützt hat. In Wirklichkeit ging es Dr. Livingstone sehr gut, während Herr Stanley fast von allem entblösst war. Es ist nothwendig, dass die gegenseitige Lage der Parteien richtig dargestellt werde. Wir hoffen, dass die von der Königl. Geographischen Gesellschaft ausgesandte Expedition sowol Dr. Livingstone als Herrn Stanley Hülfe bringen und sie in den Stand setzen wird, ihre Forschungen fortzusetzen.“
Meine Herren, darf ich Sie wol fragen, wenn Sie glaubten, dass es Dr. Livingstone ganz vorzüglich ginge, warum schickten Sie dann Ihre Expedition aus, ihm zu helfen?
Was haben Sie dann gethan, als ich in England ankam, nachdem Sie eine Woche lang die Briefe Ihres Collegen in Händen hatten? Wollen wir den guten „Punch“ antworten lassen: „Der Präsident der Königl. Geographischen Gesellschaft, welcher entdeckt hat, dass Livingstone Stanley aufgefunden und Stanley nicht Livingstone, hat schliesslich auch die Entdeckung gemacht, dass Stanley sich in England befindet. Das ist keine üble Entdeckung. Sie scheint jedoch nur nach ernsten Anstrengungen gelungen zu sein. Herr Stanley erfährt am 6. August, nachdem er eine Woche in England ist, dass die Königl. Geographische Gesellschaft ihn entdeckt hat.“ Hören wir den „Daily Telegraph“, er sagt: „Es gebührt sich, dass die Mitglieder der Königl. Geographischen Gesellschaft Herrn Stanley eine ernste, ehrliche Ehrenerklärung abgeben, da er (Herr Stanley) für dieselbe das Leben des grossen Reisenden gerettet und uns alle diese kostbaren Documente (Briefe) gebracht hat.“ Dafür habe ich denn auch einen kalten Dankbrief erhalten, eine Woche nach meiner Ankunft in England.
Wie haben Sie sonst noch Ihre Gefühle an den Tag gelegt, nachdem Sie die gute Kunde, dass Ihr Freund am Leben sei, erhalten hatten? Ihr Vicepräsident lud mich im Auftrage Ihres Vorstandes zu einer Sitzung der geographischen Abtheilung der Britischen Gesellschaft ein. Ich kam[S. 298] dieser Bitte nach. Nachdem ich aber meinen Vortrag gehalten und Livingstone gegen ziemlich strenge Kritiken vertheidigt hatte, erhob sich Ihr Vicepräsident und sagte mit weicher, sanfter Stimme: „Wir wünschen keine Sensationsgeschichten, sondern nur Thatsachen.“
Was war denn die Sensationsgeschichte, die ich erzählt hatte? Nachdem ich meine Mittheilungen über die „Entdeckungen am nördlichen Ende des Tanganika-See“ gemacht, las Herr C. R. Markham einen vom Oberst Grant (dem Gefährten Speke’s) verfassten Aufsatz vor, welcher besagte, Livingstone befände sich in einem grossen Irrthume, wenn er glaube, die Quellen des Nils auf dem elften Grade südl. Br. entdeckt zu haben, und dass er (Grant), da er keine Spuren von Gorillas, Kannibalen oder Eingeborenen, die Schweine essen, gefunden habe, auch nur annehmen könne, Livingstone sei viel weiter nach Westen gekommen, als er meine. Bald darauf erhob sich Dr. Charles Beke, um seine Ansichten über den Gegenstand auszusprechen, nämlich über Livingstone’s Entdeckungen. Beke wusste ganz bestimmt, dass Livingstone die Quellen des Nils nicht entdeckt habe. Der wichtigste Einwurf gegen die Theorie, dass der Lualaba der Nil sei, ergebe sich aus Dr. Schweinfurth’s Forschungen. Dieser berühmte Botaniker habe den Uelle, einen grossen Fluss, der von Osten nach Westen fliesst, auf 3° 45′ nördl. Br. entdeckt und dieser scheine in den Blauen Bergen, westlich vom Albert-Nyanza, zu entspringen und das Becken des Nils vollständig abzuschneiden. Ferner sagte Sir Henry Rawlinson, nachdem er meiner höflich Erwähnung gethan, dass er sehr bezweifle, ob Livingstone sich auf dem Nilbecken befinde, und dass er glaube, der Lualaba endige in einem grossen centralen See, dessen Entdeckung, wie er aufrichtig hoffe, die Arbeiten Livingstone krönen werde.
Wollen wir jetzt die Motive untersuchen, welche diesen entgegenstehenden Ansichten zu Grunde liegen, dann werden wir wissen, welchen Werth wir denselben beizumessen haben. Oberst Grant war der Gefährte Speke’s auf seinem berühmten Marsche von Zanzibar nach Gondokoro und glaubte ganz fest, dass Speke die Nilquellen in dem Fluss[S. 299] entdeckt habe, der aus dem Victoria-Nyanza heraus und nordwestlich in einen See fliesst, dessen einen Winkel Sir Samuel Baker später entdeckt hat. Als Freund und Genosse Speke’s auf dieser Expedition liebt es der tapfere Herr nicht, davon zu hören, dass irgendein anderer Ansprüche darauf erhebt, eine andere Nilquelle entdeckt zu haben. Es ist ein Stückchen ritterlicher Freundschaft seinerseits, das gebe ich gern zu; aber was weiss denn eigentlich Oberst Grant persönlich über Speke’s Quellen des Nils? Möge Speke selbst Zeugniss ablegen: „Ich richtete es so ein, dass Grant mit unsern Gütern, dem Vieh und den Frauen direct zu Kamrasi’s Wohnsitz gehen und meine Briefe und eine Karte sofort an Petherick, nach Gani, expediren solle, während ich den Fluss hinauf bis an seine Quelle oder an seinen Austritt aus dem See ging und nachdem ich ihn, soweit als es thunlich war, beschifft, wieder zurückkäme.“
Dies beweist, dass Grant persönlich niemals den Fluss aus dem Victoria-Nyanza hat herauskommen sehen. Im besten Glauben und in naiver Unschuld zog er 60 Meilen über Land zu Kamrasi, wohin er sich wie ein gewöhnlicher Bote begab, um Speke’s Depeschen hinzubringen, und während seiner Abwesenheit entdeckt Speke die Ripon-Fälle und marschirt dann Grant nach Unyoro nach. Es ist also die Vertheidigung Speke’s eine ritterliche That par excellence, aber keine Geographie. Noch nie hat eine so kostspielige Expedition wie die von Speke und Grant so wenig Resultate erzielt. Auf dem blossen Umstande fussend, dass er einen südlichen und nördlichen Punkt eines Sees gesehen, hat Speke einen grossen Wasserkörper gezeichnet, der ein Areal von mehr als 40000 engl. Quadratmeilen einnimmt.
Weil Grant weder Gorillas, noch Kannibalen, noch schweineverzehrende Menschen gesehen hat, bildet er sich ein, dass Livingstone viel mehr nach Westen gekommen ist, als er annimmt. Dies ist abgeschmackt. Ich habe selbst die Kannibalen von Ubembe und Usansi gesehen und alle Araber in Udschidschi auch von den Menschenfressern von Manyuema reden hören. Baker hat von Menschenfressern, die sich 200 Meilen westlich von Gondokoro befanden, gehört. Burton und Speke haben die Kannibalen von Ubembe[S. 300] gesehen. Livingstone ist aber vier Längengrade weiter westlich als das westliche Ufer des Tanganika gewesen. Was wird also nun aus Grant’s Einwendungen? In Bezug auf Stämme, die Schweine essen, ist zu bemerken, dass fast ein jeder Stamm in ganz Afrika das Fleisch des wilden Ebers verzehrt. Ich habe zwar nie von Stämmen gehört, welche sich zahme Schweine halten; Livingstone hat sie aber gesehen und es ist guter Grund zu glauben, dass die Manyuema überhaupt ein viel höherer Menschenschlag sind als irgendeiner, den man im Osten in der Nähe des Aequators trifft.
Der Präsident der Königl. Geographischen Gesellschaft, Sir Henry Rawlinson, ist ein eifriger Vertreter der Theorie, dass alle Süsswasserseen einen Abfluss haben müssen; dennoch glaubt er gleichzeitig, dass der grosse Fluss Lualaba in einem Sumpf oder einem Süsswassersee endigt, der keinen Ausfluss hat. Ist da Sir Henry nicht etwas inconsequent? Wenn alle Süsswasserseen einen natürlichen Abfluss haben müssen, warum soll der „grosse Binnensee“, von dem man annimmt, dass er den Lualaba aufnimmt, keinen haben?
Trotzdem hat mich der Präsident der geographischen Abtheilung der Britischen Gesellschaft, Herr F. Galton, dafür, dass ich Livingstone in solcher Weise vertheidigt habe, mit merkwürdiger Leutseligkeit beschuldigt, ein Fabrikant von Sensationsnachrichten zu sein.
Warum aber das? Dr. Livingstone zog aus, um den Ngami zu entdecken, hielt tapfer auf der Reise aus und seine Anstrengungen wurden mit der Entdeckung desselben belohnt. Auch Francis Galton unternahm es, den See Ngami zu entdecken. Wie ihm das glückte, können wir von seinem Reisebegleiter Andersson erfahren (Andersson’s Reisen): „Ich muss gestehen, dass, als ich zuerst meines Freundes (Galton’s) Erzählung las, ich anfangs etwas sehr erstaunt darüber war, als ich auf seine angenehme Versicherung stiess, dass er sich nicht viel daraus mache, den See Ngami zu erreichen. Es ist zwar wahr, dass wir, als wir an der Walfisch-Bai landeten, nur wenig, Hoffnung hatten, dorthin zu kommen; aber ich hatte, wenigstens für mein Theil, immer gemeint, dass das grosse Ziel[S. 301] unserer Reise gerade der Ngami sei.“ Und weiter: „Galton schien von der Aussicht entzückt zu sein, bald wieder in civilisirte Länder zurückzukehren. Obgleich er bewiesen hatte, dass er fähig sei, Strapazen und Beschwerden so gut wie irgendeiner von uns zu ertragen, so leuchtete doch ein, dass er genug hatte.“ — „Dass wir (Galton und Andersson) den See Ngami nicht erreichten, hat mir sehr leid gethan.“ — „Nicht lange nach seiner Rückkehr hat ihm die Königl. Geographische Gesellschaft, wie ich mit Freuden hörte, ihre goldene Medaille als Belohnung für seine der Wissenschaft geleisteten Dienste zuertheilt.“
Ich kann dieses Kapitel nicht schliessen, ohne noch ein Wort zu Gunsten der jungen Herren zu sagen, die zur englischen Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung Livingstone’s gehört haben. Ich muss gestehen, dass ich durchaus keine gerechtfertigten Gründe einsehen kann, warum der Vorstand der Königl. Geographischen Gesellschaft sie wegen ihrer Rückkehr getadelt hat. Das Geld für ihre Ausrüstung ist vom britischen Publikum nur für die Unterstützung David Livingstone’s zu einer Zeit gezeichnet worden, wo man diesem gesagt hatte, dass meine Expedition misglückt sei. Nach der vom Vorstand in den Zeitungen veröffentlichten Anzeige wurden freiwillige Befehlshaber gewünscht, die Dr. Livingstone Hülfe bringen sollten. Die Herren Dawson, Henn und Livingstone wurden mit der Erfüllung dieser Pflicht betraut. In einer Versammlung der Gesellschaft kündigte Lieutenant Dawson an, dass, da die Augen des britischen Publikums auf ihn gerichtet seien, die Kenntniss dieser Thatsache ihm ein um so grösserer Sporn sein werde, um das Geheimniss, das über Livingstone’s Schicksal ruhe, zu lüften und seinen Aufenthaltsort auszukundschaften. Diese jungen Herren reisten aus England nach Zanzibar, um getreulich die Instructionen zur Aufsuchung und Unterstützung von Dr. Livingstone auszuführen. Als ihr Anführer in Bagamoyo, dem Ausgangspunkt seiner Route, ankam, brachte er in Erfahrung, dass Dr. Livingstone aufgefunden sei und bereits Hülfe erhalten habe, worauf er nach Zanzibar zurück eilte, um sich mit dem britischen Consul zu besprechen, wie man es ihm[S. 302] befohlen hatte. Dieser rieth ihm, unter den gegebenen Verhältnissen die Reise nicht fortzusetzen; auch hörte er aus derselben Quelle, die durch eine Nachschrift in einem Blaubuch bestätigt ist, dass Dr. Livingstone mit den Geographen in England nicht auf freundschaftlichem Fusse stehe. Hierauf legte der Befehlshaber (Lieutenant Dawson) seine Stelle nieder, weil man ihn zu dem Glauben gebracht hatte, dass seine Anwesenheit Dr. Livingstone nicht angenehm sein werde. Darauf übernahm es Lieutenant Henn, die Expedition zu führen; als er aber an dem Ausgangspunkt derselben ankam, erschien ich persönlich auf dem Felde und benachrichtigte ihn als Erwiderung auf die Frage, ob Dr. Livingstone in Noth sei, dass der Reisende alle nöthigen Vorräthe besässe, mit Ausnahme von funfzig tüchtigen Freigelassenen und einigen Genussmitteln, worüber ich ihm ein Verzeichniss zur Prüfung vorwies. Auch er kehrte nun nach Zanzibar zurück, besprach sich mit seinem Freunde Dr. Kirk und legte sein Commando zu Gunsten von Oswald Livingstone nieder. Schliesslich unternahm es dieser, ein Sohn des Reisenden, eine Expedition zu seinem Vater zu führen. Da er aber gerade an einer schweren Krankheit zu leiden anfing, die nach der Ansicht des seinem Vater befreundeten Dr. Kirk ihn ganz unfähig machte, eine solche Reise zu unternehmen, legte er, wenn auch sehr wider seinen Willen, förmlich sein Amt nieder.
Wenn wir freimüthig und ehrlich untersuchen, wer dafür verantwortlich ist, dass die englische Expedition sich zurückgezogen hat und zurückgekehrt ist, so ist das meiner unmassgeblichen Meinung nach keineswegs Lieutenant Dawson oder seine Gefährten. Sie hatten den Auftrag erhalten, Livingstone Hülfe zu bringen, gleichzeitig aber den Rath des Dr. Kirk einzuholen. Wenn dieser der Expedition den Rath ertheilte, nicht weiter zu gehen, weil er der Meinung war, dass ihre Anwesenheit dem Dr. Livingstone nicht angenehm sein würde, so hatten die jungen Herren nach meiner Meinung vollständig Recht, umzukehren; denn Dr. Kirk war berechtigt, da er zum obersten Schiedsrichter ihres Schicksals erwählt worden, ihnen den Rath zur Rückkehr zu ertheilen, wenn seiner Ansicht nach ihre Anwesenheit in Unyanyembé[S. 303] Dr. Livingstone nicht ganz angenehm war. Allerdings stimme ich mit Dr. Kirk in dieser Ansicht nicht überein, dass dies der Fall gewesen wäre; sondern ich weiss, dass Dr. Livingstone die jungen Leute, die dazu gekommen wären, ihm einen Dienst zu erweisen, willkommen geheissen haben würde und dass sie, soweit er dabei in Betracht kam, die Fäden seiner Arbeit hätten aufnehmen können. Dagegen stimme ich mit Dr. Kirk darin überein, dass ihre Anwesenheit nicht mehr nöthig, ihre Hülfe nicht erforderlich war. Auch bin ich nicht der Ansicht des Herrn, dass Dr. Livingstone einen Streit mit der Königl. Geographischen Gesellschaft gehabt oder den Mitgliedern derselben in irgendeiner Weise feindlich gesinnt ist. Während der vier Monate, die ich in seiner Gesellschaft verlebte, habe ich ihn nie ein Wort gegen die Königl. Geographische Gesellschaft äussern hören, und fast alle seine persönlichen Freunde sind Mitglieder gerade dieser Gesellschaft.
Die erste und eigentliche Ursache des Untergangs der Expedition bestand aber darin, dass der Vorstand es unterlassen hatte, dem Befehlshaber, Lieutenant Dawson, für den Fall Instructionen mitzugeben, dass er mich mit Dr. Livingstone’s Briefen und Depeschen treffe und die Versicherung von mir erhalte, er sei reichlich mit Vorräthen versehen. Hätten sie officiell die Möglichkeit zugegeben, dass die amerikanische Expedition in ihrem Liebeswerk von Erfolg gekrönt worden sei und die jungen Leute auf diesen Fall vorbereitet, so brauchte der Vorstand jetzt nicht Lieutenant Dawson und seine Gefährten der Untreue und Unfähigkeit zu beschuldigen und diese selbst brauchten nicht zu bedauern, dass sie freiwillig ihr Glück und ihr Leben dem Dienst der Gesellschaft gewidmet haben. Da der Vorstand diesen sehr wichtigen Artikel in seinen Instructionen ausgelassen, so sind die Mitglieder desselben einzig und allein für das Scheitern der englischen Expedition verantwortlich.
Und jetzt, theurer Leser, will ich schliessen. Ich habe den Wagogo und ihrer wilden Unverschämtheit; Mionvu, dem grössten aller Brandschatzer und Tributsauger; den lärmenden Wavinza; den ungastlichen Warundi;[S. 304] den arabischen Sklavenhändlern und Mischlingen; allen Fiebern, sowol remittirenden wie intermittirenden; den Makatasümpfen und Krokodilen; den Bitterwassern und öden Ebenen; meinen eigenen schwarzen Freunden und treuen Nachfolgern; dem christlichen Helden und grossen Reisenden Livingstone Lebewohl gesagt, und so biete ich denn auch Euch, Kritikern, und allen Freunden wie Feinden, ein Lebewohl!
[9] Leser, die sich für diesen Gegenstand interessiren, werden begierig sein, zu erfahren, worin diese Beleidigung bestanden hat. Sie bezieht sich auf Dr. Livingstone’s Brief aus Udschidschi an Dr. Kirk vom 30. October 1871. Siehe Anhang.
Ich wünsche noch zu sagen, dass ich, wenn ich im Laufe dieses Buches manches harte Wort gegen gewisse Geographen und andere Leute veröffentlicht und dadurch die Gefühle irgend jemandes verletzt habe, dies sehr bedauere. Meine Entschuldigung besteht darin, dass alles, was ich geschrieben, das Product meiner dermaligen Empfindungen gewesen ist. Ich bin ein reisender Journalist und mehr an rasches Schreiben als an elegante Diction gewöhnt; ich habe es aber vorgezogen, meine Gedanken und Eindrücke, wie wenig Werth sie auch haben mögen, so stehen zu lassen, wie sie gewesen, als sie in eine Form umzuarbeiten, die wol in literarischer Beziehung viel besser, aber nicht die meinige gewesen wäre.
Im allerletzten Augenblicke, wo die Bogen meines Werkes fast alle ausgedruckt, wurde ich durch eine Einladung zu einem Festmahl der Königl. Geographischen Gesellschaft, ich gestehe es, ebenso erfreut wie überrascht. Seitdem ich in England gelandet, ja schon vorher, hatte ich die bestimmte Ueberzeugung gewonnen, dass der einfache Dienst, den die Vorsehung mir gestattet hat, der geographischen Wissenschaft dadurch zu leisten, dass ich den grossen Forscher aufgefunden, ihm Hülfe gebracht und die Resultate vieljähriger Arbeit nach England gebracht habe, ein der Königl. Geographischen Gesellschaft nicht willkommenes Ereigniss sei. Diese Empfindung mag einigen Bemerkungen meines Buches den Charakter der Bitterkeit gegeben haben;[S. 305] offenherzig gestehe ich jetzt ein, dass jene Ueberzeugung unbegründet gewesen ist. Grosse Körperschaften bewegen sich langsam; ich war ungeduldig und ohne Zweifel waren die Hoffnungen und Erwartungen meinerseits, dass meine Erzählung sofort ohne Zögern, Zweifel und Krittelei aufgenommen werden würde, ungerechtfertigt. Ich hatte geglaubt, dass ich um meiner Mittheilungen willen sofort von der Königl. Geographischen Gesellschaft aufgenommen werden würde, hatte aber nicht die Schwierigkeiten erwogen, die sich nothwendig an die Bewegungen einer so erhabenen wissenschaftlichen Körperschaft knüpfen. Die Mühlen der Götter sollen langsam, aber sicher mahlen; ebenso hat die Königl. Geographische Gesellschaft langsam, aber sicher entdeckt, dass ich kein Charlatan bin, sondern das wirklich geleistet habe, was ich ausgesagt; dann erst erkannte sie mich als ihren Genossen mit einer Wärme und Grossmuth an, die ich nie vergessen werde. Ich erlaube mir, den Mitgliedern der Königl. Geographischen Gesellschaft zu versichern, dass die Anerkennung meiner schwachen Dienstleistungen ihrerseits mir nicht weniger willkommen ist, weil sie etwas spät eingetreten. Besonders danke ich Sir Henry Rawlinson sowol für die gütigen, grossmüthigen Worte, die er über mich gesprochen, als auch für die schöne Art, in der er eine einst rasch über mich hingeworfene Aeusserung zurückgenommen, die er gethan, als ihm einige Thatsachen noch nicht bekannt waren, die seitdem ans Licht getreten sind. Ich will nur noch hinzufügen, dass nach der Ehre, die mir Ihre Majestät die Königin von England erzeigt hat, ich stets die Medaille der Königl. Geographischen Gesellschaft als höchste Auszeichnung schätzen werde.
[S. 306]
Mit der Erlaubniss des Herrn Bates, ständigen Secretärs der Royal Geographical Society, werden die folgenden interessanten Auszüge aus den Verhandlungen dieser Gesellschaft veröffentlicht:
Der Vorsitzende las vor der Verhandlung folgenden officiellen Brief vor, den er vom Staatssecretär für die Auswärtigen Angelegenheiten, Lord Clarendon, als Antwort auf die Petition erhalten, welche die Regierung um Unterstützung für Dr. Livingstone ersucht hatte. Er war überzeugt, die ganze Gesellschaft würde Lord Clarendon und der Regierung Ihrer Majestät für diese Mittheilung einmüthig ihren tiefgefühlten Dank aussprechen.
„Auswärtiges Amt, 19. Mai 1870.
Mein Herr!
Ich habe keine Zeit verloren, meinen Collegen Ihre Bemerkungen über die Lage, in welcher sich Dr. Livingstone infolge von Geldmangel befindet, mitzutheilen und die Regierung Ihrer Majestät hat nicht unterlassen alles das in Betracht zu nehmen, was Sie zu Gunsten einer weitern dem ausgezeichneten Reisenden zu bewilligenden Geldsumme vorgebracht haben: dass er sich nämlich drei Jahre lang ohne Hülfe und Verbindung mit England allein durchgekämpft; nach den letzten Nachrichten einen Punkt erreicht hat, von dem er ohne Vorräthe weder vorwärts noch zurück kann, und das ihm bei seiner Abreise bewilligte Geld erschöpft ist, also weitere Mittel sehr dringend nöthig sind, um ihn neu auszurüsten und ihm seine Bedürfnisse ins Innere des Landes zu transportiren.
Ich habe hiermit das Vergnügen, Sie davon in Kenntniss zu setzen, dass Ihrer Majestät Regierung bereit ist, 1000 Pfd. Sterling für die Expedition des Dr. Livingstone zu bewilligen und sich der ernstlichen Hoffnung hingibt, dass die Summe dazu dienen möge, ihn sicher in sein Vaterland zurückzubringen.
Ich bin, mein Herr,
Ihr gehorsamer Diener
CLARENDON.
Sir R. I. Murchison, Bart.“
[S. 307]
Am 23. Mai 1870 spricht Sir R. Murchison in folgender Weise über seinen Freund Dr. Livingstone:
Im Verlaufe des letzten Jahres sind wir in einem Zustand ängstlicher Spannung in Bezug auf die Lage unsers grossen Reisenden Livingstone geblieben, und ich bedauere diese Ansprache schliessen zu müssen, ohne im Stande zu sein, irgendetwas Ermuthigendes in der Beziehung zu sagen, dass wir ihn bald zu Hause begrüssen können. Zu gleicher Zeit ist aber keine Ursache vorhanden, an seinem Leben und seiner Sicherheit zu verzweifeln. Wir wissen, dass er sich einige Zeit in Udschidschi am See Tanganika aufgehalten hat, woher er am 30. Mai vorigen Jahres nach Hause geschrieben, von wo er aber aus Mangel an Lastträgern und Vorräthen ausser Stande war sich fortzubegeben. Zwar wurden ihm diese durch Dr. Kirk aus Zanzibar zugeschickt, aber leider hat der Ausbruch der Cholera diese Hülfsexpedition aufgehalten und an der Weiterreise verhindert. Nach neueren Mittheilungen jedoch, die das Auswärtige Amt erhalten, hat die Seuche so sehr nachgelassen, dass wir annehmen können, der Verkehr zwischen der Küste und Udschidschi sei jetzt schon wieder eröffnet.
Die Aufgabe, die Livingstone noch bevorsteht, ist häufig erörtert worden, und hoffentlich wird er am Leben bleiben, um bis an das nördliche Ende des Tanganika zu gelangen und dort festzustellen, ob sein Wasser in den Albert-Nyanza Baker’s fliesst. Wenn diese Verbindung erwiesen würde, so können wir dem Gedanken Raum geben, dass Livingstone, der jetzt weiss, dass das grosse Unternehmen Sir Samuel Baker’s gegenwärtig ausgeführt wird, es versuchen werde, mit seinem grossen Collegen zusammenzukommen. Da die grosse Expedition Baker’s anfänglich aufgehalten worden, so hat er bekanntlich Chartum erst im Februar verlassen, um den Weissen Nil hinaufzugehen. Nachdem er Gondokoro, wie man annimmt, in den ersten Tagen des März erreicht hat, wird einige Zeit nothwendig damit vergehen, eine Faktorei an den oberen Stromschnellen und jenseits des Nebenflusses Asua zu gründen, wo die Dampfboote zusammengesetzt werden sollen, ehe sie auf das Wasser des Nils gebracht werden, auf dem sie in den grossen Albert-Nyanza-See zu fahren gedenken. Sobald sich jedoch ein Dampfer auf dem See befindet, können wir uns versichert halten, dass Baker mit seiner bekannten Energie und Raschheit nicht einen Augenblick verlieren wird, um es zu versuchen, das südliche Ende desselben zu erreichen in der Hoffnung, dort Livingstone hülfreiche Hand bieten zu können. Wollen wir uns daher dieser freudigen Hoffnung hingeben, die in der That die glücklichste Erfüllung unserer Herzenswünsche sein würde.
Das britische Publikum wird sich über diesen Gegenstand am besten informiren, wenn es ein neuerlich erschienenes kleines Werk des Herrn Keith Johnston jun. studirt. In dieser Schrift hat der Verfasser eine kurze Geschichte aller Forschungen in Südafrika gegeben und auch nach den besten Autoritäten (Petermann u. A.) eine[S. 308] Karte gezeichnet, die deutlich nachweist, in welcher Ausdehnung die Flüsse, welche von den südlich und südsüdwestlich vom See Tanganika gelegenen Hochlanden herfliessen, zum grössten Theil von diesem See unabhängig und wol Zuflüsse des Congo sind. Auf der andern Seite sind die Flüsse, welche in den See Tanganika durch den Livingstone’schen See Liemba eintreten, wahrscheinlich die letzten Quellen des Nils selbst, wogegen der Kasai und andere Ströme, welche die Seen Bangweolo und Moero bilden, wol in den Congo fliessen.
Wenn sich diese letzte Hypothese als wahr erweisen sollte, werden sich die Gewässer, die Livingstone zuerst entdeckt hat, sowol als die Quellen des Nils als des Congo herausstellen. Was aber den Nil betrifft, so muss mein scharfsinniger Freund fühlen, dass das Problem in Bezug auf denselben ungelöst bleibt, bis er beweist, dass einige der Gewässer des Tanganika in den Albert-Nyanza fliessen.
Mittlerweile ist die Hypothese von Herrn Findlay u. A. (dass der See Tanganika mit dem Albert-Nyanza in Verbindung steht) nach den jetzigen Abschätzungen der relativen Höhenlage dieser südlichen Gewässer die wahrscheinlichste. Gebe Gott, dass der berühmte Livingstone die Wahrheit derselben erweise und dass wir ihn bald als den Entdecker der letzten Quellen des Nils sowol als des Congo zu Hause begrüssen mögen.
Ueber diesen wichtigen und höchst interessanten Gegenstand ist es angenehm die Mittheilung zu machen, dass unser ausgezeichnetes Ehrenmitglied Dr. Petermann auf einer Generalkarte von Südafrika in der letzten Nummer seiner „Mittheilungen“ eine chronologische Skizze aller der wunderbaren, schwierigen Reisen Livingstone’s vom Jahre 1841–1869 entworfen hat. In Bezug auf die Nebenflüsse des Congo unterscheidet sich die Karte Petermann’s von der Johnston’s in der Annahme, dass die Gewässer der Seen Bangweolo, Moero und Ulenge nach Norden und Osten zeigen. Wenn dies der Fall sein sollte, so werden sie auch in den grossen Albert-Nyanza Baker’s münden.
Indem ich die Betrachtung dieses überaus interessanten Gegenstandes schliesse, freue ich mich im Stande zu sein mitzutheilen, dass Ihrer Majestät Regierung infolge der Darstellungen, die ich Lord Clarendon über die isolirte Stellung Livingstone’s in Udschidschi gemacht habe, wo er sich trotz der Nähe seines letzten Zieles, des nördlichen Endes des Sees Tanganika, ohne Lastträger und Vorräthe befand, freundlichst die Mittel bewilligt hat, wodurch der grosse Reisende wirksame Unterstützung erhält, ehe er in sein ihn bewunderndes Vaterland zurückkehrt.
In der Ansprache des Vorsitzenden der Königl. Geographischen Gesellschaft wird gesagt, dass den Herren Dr. Beke, Arrowsmith und Findlay grosser Ruhm dafür gebühre, dass sie auf theoretische Gründe hin die grosse nach Süden reichende[S. 309] Ausdehnung des Nilbeckens unterstützt hätten, falls nämlich das grosse Problem der südlichen Wasserscheide des Nils gelöst würde.
Wenn ihnen der Ruhm für diese Theorie gebührt, welchen soll jetzt Sir H. Rawlinson, nachdem Sir R. Murchison, der treue Freund Livingstone’s, todt ist und Dr. Beke seine Unterstützung der obigen Theorie zurückgezogen hat, diesem für die theoretische Unterstützung zuschreiben, die der Herr der Ansicht leiht, dass die Wasserscheide nicht die des Nils, sondern die des Congo ist?
Aus der 14. Sitzung der Königl. Geographischen Gesellschaft vom 13. Juni 1870 ersieht man, dass der Vorsitzende derselben es ausspricht, dass man keine Expedition beabsichtigt hat, um Livingstone aufzusuchen. Ich erhielt meine Befehle im October 1869. Die Königl. Geographische Gesellschaft sollte es mir also nicht zum Vorwurf machen, dass ich das gethan, was sie zu thun beabsichtigt habe, und nicht darüber ärgerlich sein, dass ich ihn aufgefunden, da das mit ihren Pflichten durchaus nicht collidirt hat.
Ehe der Vorsitzende auf die zu haltenden Vorträge einging, sprach er sich aus über die Art der Unterstützung, welche zum Ruhme des Earl Clarendon und der englischen Regierung dem Dr. Livingstone zugeschickt worden. Es hätten in Bezug auf die Angelegenheit viele Misverständnisse geherrscht, wenn man nach den zahlreichen Petitionen schliessen dürfe, die er von verschiedenen thatkräftigen jungen Leuten erhalten, die es gewünscht hätten, Dr. Livingstone aufzusuchen. Man habe nämlich angenommen, dass eine Expedition im Begriff sei, zu diesem Zweck aus unserm Vaterlande abzugehen. Eine solche Expedition wäre jedoch nicht beabsichtigt worden. Dr. Livingstone sei mehr als 3½ Jahre ohne einen einzigen europäischen Begleiter im Herzen von Afrika gewesen. Er (der Präsident) wisse nicht bestimmt, ob nicht ein nicht acclimatisirter junger Mann aus England Livingstone ungelegen kommen würde, weil er ausser andern Mühen auch noch die haben würde, für ihn zu sorgen. Deshalb kündige er hiermit an, dass die 1000 Pfd. Sterl., welche die Regierung hergegeben hätte, durch den Consul in Zanzibar, Herrn Churchill, der zufälligerweise hier im Lande sei und bald nach Zanzibar gehe, abgeschickt werden würden. Dieser wird Dr. Kirk instruiren, eine ähnliche Expedition wie die vorjährige, die durch die Cholera verhindert wurde, auszurüsten. Die Epidemie hat sehr nachgelassen und jetzt besteht die einzige Schwierigkeit darin, nach Udschidschi zu kommen, wo Dr. Livingstone sich nach den letzten Berichten befindet und aus Mangel an Lastträgern und Vorräthen nicht im Stande ist sich an einen andern Ort zu begeben. Damit diese Vorräthe von Zanzibar nach Udschidschi kommen, bedarf es[S. 310] zweier Monate; daher soll man sich in den nächsten Monaten keinen Sorgen hingeben. In etwa 7 bis 8 Monaten können gute Nachrichten da sein und bald darauf würden wir hoffentlich wol unsern Freund in seinem Vaterlande wiedersehen.
Brief von Herrn Churchill, Consul in Zanzibar, in Bezug auf Dr. Livingstone.
„Zanzibar, 18. November 1870.
Mylord!
Nach einem sehr grossen Zeitverlust, der denjenigen, die mit diesem Lande unbekannt sind, unnöthig erscheinen wird, ist es mir gelungen, Dr. Livingstone eine Verstärkung von 7 Mann zuzuschicken, welche sich verpflichtet haben, sich als Lastträger, Bootsleute u. s. w. zur Disposition des Doctors zu stellen und eine Menge Perlen, Tuch und Provision zu seinem Gebrauch mitgenommen haben. Er wird durch dieselbe Gelegenheit die Briefe und Schriftstücke, die mir Lord Clarendon und die Geographische Gesellschaft anvertraut haben, nebst einigen Kleidungsstücken erhalten, die seine Verwandten mir übersandt haben. Ich hoffe, dass sie Udschidschi im Monat Februar erreichen werden, jetzt aber lässt sich noch nichts Sicheres darüber sagen. In einer künftigen Depesche werde ich einen Bericht über die durch diese Expedition veranlassten Ausgaben abstatten. Etwa vor einem Monat erhielten wir Nachrichten davon, dass Leute und Vorräthe, die im October 1869 von Dr. Kirk abgesandt worden, am letzten Juni in Unyanyembé angekommen seien. Sieben der Leute waren an der Cholera gestorben und der Rest hatte, nachdem sie die ihnen mitgegebenen Provisionen verzehrt, auf Anrathen des Gouverneurs von Unyanyembé die Vorräthe, die sie Livingstone bringen sollten, zu ihrem eigenen Unterhalt angegriffen. Dies erscheint auf den ersten Blick unglaublich; wenn man aber weiter darüber nachdenkt, so kann man es dadurch erklären, dass die Karavane, wenn sie nicht irgendwelche Lebensmittel gehabt, an der Weiterreise verhindert worden wäre und dass der Gouverneur von Unyanyembé ihr, ohne Autorität des Sultans, die nöthigen Subsistenzmittel verweigerte.
Die letzten Berichte aus dem Innern theilen mit, dass Dr. Livingstone, nachdem er einen Ort Manime (Manyuema) besucht habe, nach Udschidschi zurückgekehrt sei.“
Im weitern Verlaufe sagte der Präsident, dass der Brief von Dr. Kirk, welcher in Sir Roderick Murchison’s Brief an die „Times“ erwähnt werde, drei Wochen später als der von Herrn Churchill geschrieben sei, und da dieser nicht die Behauptung enthielte, dass Dr. Livingstone wirklich in Udschidschi angekommen sei, obwol er[S. 311] seine Nachrichten aus derselben Quelle wie Herr Churchill habe, so scheine es, dass der Letztere dieses Ereigniss gleichsam vorausgenommen habe. Dr. Kirk sage nämlich nur, dass ein arabisch geschriebener Brief vom Juli 1870 vom Gouverneur von Unyanyembé eingetroffen sei, welcher aussage, dass Livingstone in Udschidschi zu gleicher Zeit mit den Leuten und Vorräthen erwartet werde, die auf dem Wege dahin seien. Auch sagte er, dass der Reisende in einem fernen Manime genannten Lande gewesen sei. Um die Wichtigkeit dieser Mittheilung zu begreifen sei es nöthig, auf den letzten Brief Rücksicht zu nehmen, den Livingstone selbst nach Hause geschrieben habe. Es sei ein vom 30. Mai 1869 datirter, aus Udschidschi an Dr. Kirk gerichteter Brief. In demselben sage Livingstone: „Was die mir bevorstehende Aufgabe betrifft, so besteht sie darin, die Quellen, die ich entdeckt und die 5–700 Meilen südlich von Speke’s und Baker’s Nil liegen, mit diesem zu verbinden. Die Wassermasse, welche von 12° südl. Br. nach Norden fliesst, ist so gross, dass ich vermuthlich sowol an den Quellen des Nils als des Congo herumarbeite. Ich muss also das östliche Wassersystem bis an den Punkt verfolgen, wo Baker umgekehrt ist. Tanganyika, Nyige Chowambe (Baker’s?) sind ein Wasser und das Ende desselben liegt 300 Meilen südlich von hier. Den Ausfluss desselben, ob er nun Congo oder Nil sei, muss ich feststellen. Die westlich von hier wohnenden Menschen, welche Manyema heissen, sind, wenn die Araber die Wahrheit reden, Kannibalen. Dort werde ich wol zuerst hinzugehen und dann, wenn ich ungefressen zurückkomme und meine neuen Leute aus Zanzibar vorfinde, den Tanganika hinunterzugehen haben.“
Das folgende ist ein wichtiger Brief Dr. Kirk’s, den er etwa einen Tag nach seiner Rückkehr von der in Kikoka, dem ersten Lager jenseits des Kingani, abgehaltenen Jagdpartie geschrieben hat.
„Zanzibar, 18. Februar 1871.
Mylord!
Ich habe die Ehre Ihnen zu berichten, dass ich, nachdem ich durch einen Eingeborenen erfahren, dass sich die von Herrn Churchill mit Vorräthen für Dr. Livingstone, laut seiner Depesche vom 18. November 1870, abgesandten Leute noch in Bagamoyo, einer uns gegenüberliegenden Seestadt des Festlandes, befänden und noch gar keine Schritte dazu gethan hätten, sich Lastträger zu verschaffen oder ihre Reise anzutreten, beschloss, womöglich selbst hinzugeben und bei ihrer Abreise zugegen zu sein. Kapitän Tucker, der Befehlshaber von Ihrer Majestät Schiff “Columbine„, hat mir auf meine Bitte freundlichst einen Platz in seinem Schiffe zu diesem Zweck zur Disposition gestellt.
[S. 312]
Als ich Bagamoyo erreichte, entdeckte ich, dass die betreffenden Leute noch im Dorfe seien, wogegen arabische Karavanen sich auf dieselbe Reise begeben hatten. Freilich sind Lastträger in diesem Jahre schwer zu haben, da nur wenige Leute aus Unyamwezi infolge der daselbst wüthenden Cholera hierher gekommen sind.
Es ist mir jedoch, indem ich meinen Einfluss bei den Arabern benutzte, gelungen, alle Vorräthe, mit Ausnahme von vier Lasten, abzusenden und ich bin ihnen selbst eine Tagereise bis ins Binnenland gefolgt. Die noch übrig bleibenden vier Lasten sollten, wie ich bei meiner Rückkehr anordnete, durch eine arabische Karavane nach Unyanyembé gebracht werden und von dort durch Said bin Salim, den dortigen Gouverneur, nach Udschidschi geschickt werden.
Wenn sie einmal auf der Reise sind, so gibt es wenig Motive für die Leute sich aufzuhalten; wogegen sie in Bagamoyo in guten Hütten unter ihren eigenen Leuten gern verweilen, da sie dort, ohne dass man es erfährt, ihr Leben geniessen und trotzdem ihren Monatslohn erwerben zu können meinen. Wäre ich nicht persönlich hingegangen, so hätten sie sich wol noch mehrere Monate daselbst aufgehalten.
Als ich auf dem kurzen Ausfluge, den ich von Bagamoyo machte, auf der Handelsstrasse reiste, begegneten mir mehrere Karavanen auf dem Wege von Unyamwezi, Urori u. s. w., und aus meinen an die Eingeborenen und ihre Führer gestellten Fragen stellte sich heraus, dass man in Unyanyembé keine Nachrichten aus Udschidschi erhalten und dort nichts über Dr. Livingstone bekannt sei. Alle konnten berichten, dass er auf eine Reise gegangen sei, von der er nach den letzten Nachrichten noch nicht zurückgekehrt war.
Das Land, durch das ich zog, nachdem ich über den Kingani gesetzt, war ein schönes Wald- und Parkland voll der verschiedensten Arten grossen Wildes, wie z. B. Giraffen, Elenn, Zebras, Hartebeests, Wildbeests u. s. w., von denen ich einige in einer Entfernung von noch nicht 12 Meilen von der Küstenstadt Bagamoyo erlegte. Der Kingani ist voll von Flusspferden und an seinen Ufern finden sich wilde Büffel.
Leider wird diese reiche und verhältnissmässig gesunde Gegend, wo die Giraffe vorkommt, stets von der Tsetsefliege heimgesucht, die dem Vieh und den Pferden gefährlich ist.
Auf meiner Heimreise nach Bagamoyo habe ich einen Tag dem Studium der französischen Anstalten und ihrer Behandlung Freigelassener gewidmet. Hierüber werde ich mir die Ehre geben, Eurer Lordschaft einen besondern Bericht abzustatten.
Seitdem ich vor vier Jahren die Stadt Bagamoyo gesehen, hat sie sich um das Dreifache vergrössert. Die Hütten der Eingeborenen werden rasch durch Steinhäuser verdrängt und hier, wie sonst an der Küste, geht der Handel rasch in die Hände der Kutchees über.
JOHN KIRK.“
[S. 313]
An den Redacteur des „Daily Telegraph“.
„68, Portsdown Road, Maida Vale, 25. Juli 1872.
Mein Herr! Mit grossem Interesse habe ich den Bericht Ihres Correspondenten über die Unterredung gelesen, die er gestern in Marseille mit Herrn Stanley, dem Auffinder des Herrn Dr. Livingstone, gehabt, und fühle mich berufen meinem Freunde, Dr. Kirk, beizustehen. Ich muss damit anfangen zu sagen, dass ich, falls in Zanzibar irgendeine Nachlässigkeit in Bezug auf die Mittheilungen an Dr. Livingstone stattgefunden hat, als der politische Agent und Ihrer Majestät Consul während der letzten fünf Jahre, einen Theil des Dr. Kirk zukommenden Tadels auf mich nehmen muss, da ich während der Zeit, wo ich auf meinem Posten war, d. h. länger als zwei Jahre, für alle an den Tag gelegte Lässigkeit verantwortlich bin.
Während meines ersten Aufenthalts in Zanzibar (vom Juni 1867 bis April 1869) glaubte man, wie Sie sich erinnern werden, dass Dr. Livingstone ermordet worden sei; es wurden daher, wenn überhaupt welche, doch nur sehr wenige Briefe für ihn nach Zanzibar geschickt. Wenigstens kann ich dafür garantiren, dass durch meine Hände während der ganzen Zeit kein einziger Brief an ihn gegangen ist.
In Uebereinstimmung mit Dr. Livingstone’s Bitte sandte ich in der Mitte des Jahres 1868 eine gewisse Anzahl von Vorräthen und Arzneien nach Udschidschi; weiss aber nicht, dass ihm irgendwelche Privatbriefe mit Ausnahme derer, die Dr. Kirk und ich ihm geschrieben, aus dem oben erwähnten Grunde geschickt worden sind. Bei einer frühern Gelegenheit hatte Dr. Seward über Kilwa Chinin und Vorräthe, die den Doctor in Udschidschi erwarten sollten, abgesandt. Bei diesen beiden Expeditionen wurde Dr. Kirk’s sehr werthvolle Unterstützung uns leicht zutheil, und ich muss hier für das grosse Interesse Zeugniss ablegen, das Dr. Kirk immer an allem genommen hat, was seinen Freund Dr. Livingstone betraf. Ich habe bei keiner Gelegenheit auch nur das geringste Zeichen von Eifersüchteleien seitens des Dr. Kirk wahrgenommen.
Nach meiner Abreise von Zanzibar im April 1869 hat Dr. Kirk noch eine aus vierzehn Leuten und einer grossen Karavane von Vorräthen bestehende Expedition organisirt und dem grossen Reisenden nach Udschidschi zugeschickt. Die Cholera kam dazwischen und hat dieselbe aufgehalten, sodass von den vierzehn Leuten nur sieben Unyanyembé erreicht haben. Hier scheinen die Uebriggebliebenen sich der Vorräthe bemächtigt zu haben. Hierfür kann aber doch Dr. Kirk nicht getadelt werden. Auch ist es noch immer besser, dass sie dies gethan, als dass sie die Erklärung abgegeben hätten, sie könnten aus Mangel an Subsistenzmitteln ihre Reise gar nicht weiter fortsetzen.
[S. 314]
Bei meiner Rückkehr nach Zanzibar im August 1870 bereitete ich aus den reichen von Ihrer Majestät Regierung mir mitgegebenen Mitteln eine dritte Expedition vor und wählte andere Leute, welche das Land in der Umgegend von Udschidschi kannten, um die angeblich Verstorbenen zu ersetzen. Sie erhielten die Instruction, nach Udschidschi zu gehen und dort auf Dr. Livingstone zu warten. Der Weg war aber unsicher und keine Karavane wagte es, noch eine ganze Zeit lang nachdem die Expedition organisirt war, ins Innere des Landes vorzudringen; daher wurde sie in Bagamoyo aufgehalten; inzwischen reiste auch ich im December ab wegen Krankheit. Dies ist die Karavane, von der Herr Stanley sagt, dass sie Bagamoyo zwei Tage vor Dr. Kirk’s Besuch an der Küste mit dem Schiff “Columbine„ verlassen habe. Mit derselben wurden die Briefe und Packete, die ich für Dr. Livingstone nach Zanzibar gebracht, befördert. Kirk soll bei seinem Besuch in Bagamoyo vorzüglich die Jagd im Auge gehabt und die Karavane vollständig vernachlässigt haben; doch beweist Herrn Stanley’s eigene Behauptung, dass die Karavane schon aufgebrochen war, als Kirk nach Bagamoyo kam, und ein Dorf von 500 Einwohnern ist doch nicht so gross, dass er die Sachlage nicht in zehn Minuten hätte erfahren können. Wenn er also wirklich mit den Officieren der “Columbine„ auf die Jagd ging, so that er es im Bewusstsein, dass der Zweck seiner Reise nach Bagamoyo bereits erfüllt sei. Auch zeigt ja Herrn Stanley’s Behauptung, dass das blosse Gerücht von Dr. Kirk’s bevorstehender Ankunft die gute Wirkung hatte, die Karavane in Bewegung zu setzen.
Denjenigen, welche mit Zanzibar unbekannt sind, wird die Behauptung Stanley’s, dass ihn elf Packete ihm von Hause im Laufe von neun Monaten zugesandter Briefe in Udschidschi erreicht hätten, wogegen Livingstone in drei Jahren nicht einen einzigen Brief erhalten habe, sehr sonderbar erscheinen. Dazu kann ich aber die Erklärung geben, dass diese Packete wahrscheinlich zugleich mit dem Telegramm durch dieselbe Post in Zanzibar angekommen und nach Udschidschi durch einen und denselben Boten gesandt worden sind. Auch kann eine Karavane durch das Land ziehen, während es einer andern unmöglich wird ihren Bestimmungsort zu erreichen, und gerade der Kampf, der in Unyanyembé stattfand, an dem sich Herr Stanley betheiligte, kann den Weg für spätere Karavanen geebnet haben. Ich brauche mich übrigens nur auf Herrn Stanley’s eigene Abenteuer zu beziehen, um auf die Beschwerden hinzuweisen, denen bisweilen Karavanen auf ihrem Wege nach Udschidschi ausgesetzt sind; und wenn Dr. Livingstone andererseits keine Briefe erhalten hat, so kam dies, wie ich gezeigt habe, daher, dass ihm überhaupt keine Briefe geschrieben wurden, weil seine Freunde ihn für todt hielten.
Ich hoffe, Herr Stanley hat Dr. Kirk die Gelegenheit geboten sich zu rechtfertigen. Wie das aber auch sein mag, so habe ich es für meine Pflicht gehalten, hier hervorzutreten und das Publikum durch Ihre Spalten von den sympathischen und freundlichen Gesinnungen,[S. 315] welche Dr. Kirk stets für seinen alten Freund und Mitreisenden empfunden hat, zu unterrichten.
Ich bin, verehrter Herr,
Ihr gehorsamer Diener
HENRY A.
CHURCHILL.“
Hier folge ein Brief, der Dr. Livingstone ein Lächeln abgewinnen wird ebenso wie dies bei mir der Fall war. Er stammt von dem „moralischen Idioten“ Scherif, dem Halbblutschneider, welcher aus dem Koran prophezeite, dass Dr. Livingstone todt sei, und auf diese Prophezeiung hin des Doctors Waaren gegen Elfenbein verkaufte.
(Mitgetheilt aus dem Auswärtigen Amt durch Lord Enfield.)
„Zanzibar, 10. März 1871.
Mylord!
Ich habe die Ehre, Ihnen in der Uebersetzung Abschriften von Briefen, die ich eben aus Udschidschi erhalten habe, zu übersenden, woraus ersichtlich, dass vor fünf Monaten Dr. Livingstone sich an einem Manakoso benannten Orte befand und Leute und Vorräthe, die ich ihm im letzten Jahre geschickt habe, erwartete, sowie dass diese ihn jetzt erreicht oder wenigstens von Udschidschi an den Ort, wo er sich befindet, abgesandt worden sind.
Da es jetzt Zeit ist die Briefe, die mit der gegenwärtigen Gelegenheit abgehen sollen, zu schliessen, bin ich nicht im Stande, bei den Arabern, die diese Länder kennen, Erkundigungen über die Lage der genannten Ortschaften einzuziehen, von denen ich jedoch vermuthe, dass sie sich im Westen des Sees befinden.
JOHN KIRK.“
(Uebersetzung.)
„An den Consul Kirk von Scherif Bascheik bin Ahmed.
Ich habe Ihnen mitzutheilen, dass am 15. Schaban (10. November) ein Bote von dem Volke von Menama mit Briefen von den dortigen Arabern und einem von dem Doctor angekommen ist und dass diese Briefe vom 20. Rejib (15. October) datirt waren.
Als Antwort auf meine Fragen haben sie mir mitgetheilt, dass der Doctor gesund ist, obwol er leidend gewesen, und dass er sich zur Zeit mit Mohammed bin Gharib in der Stadt Manakoso befindet, wo er auf Karavanen wartet, da er ohne Hülfe und Mittel ist und nur wenig Begleiter, nämlich acht hat, sodass er nicht weiter ziehen oder hierher kommen kann.
[S. 316]
Wir haben zwölf von unsern Leuten mit amerikanischen Tuchen, Kaniki, Perlen, Zucker, Kaffee, Salz, zwei paar Schuhen, Kugeln, Pulver, Seife und einer kleinen Flasche Medicin (Chinin) abgeschickt.
Alles was er braucht, haben wir ihm geschickt und ich bleibe in Udschidschi und warte auf seine Befehle.
Datirt den 20. Schaban 1287 (15. November 1870).
[Richtige Uebersetzung.]
JOHN KIRK.“
Aus den Protokollen der Königl. Geographischen Gesellschaft:
Sir Ruderick Murchison theilte mit, er habe einen Brief von Dr. Kirk vom 30. April 1871 erhalten, in welchem dieser die Mittheilung macht, er habe, obgleich kein Eingeborener von Zanzibar je in Manemeh (dem Ort, aus dem man zuletzt vom Dr. Livingstone etwas gehört) gewesen sei, doch festgestellt, dass er ungefähr eine Monatsreise, also etwa 200–300 engl. Meilen westlich vom Tanganika liegt und ein blühender Elfenbeinmarkt ist.
Dr. Kirk ist der Meinung, dass Livingstone dorthin gegangen sei, um einen westlich gelegenen See, in welchen die Gewässer von Cazembe flössen, von dem er gehört, zu untersuchen, und um festzustellen, ob sie nach Westen und in den Congo, oder nach Norden und in das Nilbecken laufen. Ferner hofft er, dass Livingstone, wenn er den Ausfluss des Tanganika festgestellt habe, sich zufrieden geben und die übrige Arbeit spätern Reisenden überlassen werde, da er mehr als fünf Jahre auf Reisen und gewiss sehr der Ruhe bedürftig sei.
Es ist sehr erfreulich zu hören, dass reichliche Vorräthe den Doctor bei seiner Rückkehr in Udschidschi erwarten.
Dr. Kirk fügt hinzu, er könne, da die Regenzeit bald vorüber sein wird, Briefe und Packete in ungefähr einem Monate nach Udschidschi, d. h. etwa zum 1. Juni befördern.
Der Vorsitzende sagte, er fände es etwas schwer zu glauben, dass fast 300 Meilen zwischen Manakoso und dem See Tanganika liegen sollen. Denn der Brief, den die mit den Vorräthen in Udschidschi beauftragten Araber von Livingstone erhalten, hätte nur 25 Tage gebraucht. Nun wäre aber die Durchschnittsschnelligkeit einer Reise in diesen Ländern nur 10 Meilen pro Tag, sodass nach der Zeit, die die Briefe gebraucht hätten, nur ein Zwischenraum von 250 Meilen, mit Einschluss der Fahrt über den See, zwischen Udschidschi und Manakoso liegen könne. Es sei übrigens doch sehr erfreulich zu hören, dass Livingstone sich nicht in einem unbekannten Kannibalenlande, wie früher angenommen, befände, sondern in einem blühenden Elfenbeinmarkt, zwischen welchem und der Seeküste beständige Handelsverbindung sei.
[S. 317]
26. Juni 1871. Sir Henry Rawlinson sagte an diesem Tage in seiner Ansprache als Vorsitzender unter andern auf geographische Angelegenheiten bezüglichen Dingen folgendes:
Mit Rücksicht auf unsern andern grossen Afrikaforscher Livingstone befinden wir uns noch immer in einem Zustande der peinlichsten Ungewissheit. Wir erfahren aus den letzten Berichten des Dr. Kirk in Zanzibar, die von Mitte August datiren, dass die arabischen Kaufleute, mit denen Dr. Livingstone vom Süden nach Manyemeh gereist war, von diesem Orte nach Udschidschi gegangen seien und im Anfang des Monats Juni täglich in Unyanyembé erwartet würden. Von Livingstone selbst war jedoch in letzterer Zeit keine directe Kunde nach Zanzibar gelangt, sondern Dr. Kirk hatte nur auf seinen andauernden Aufenthalt in Manyemeh geschlossen. Die zweite für ihn bestimmte Sendung Vorräthe sei mittlerweile durch Unyanyembé nach Udschidschi befördert und Dr. Kirk erwartete ängstlich Nachrichten über die Ankunft des amerikanischen Reisenden Herrn Stanley an diesem Orte. Dieser Herr, der vom richtigen Forscher-Typus sein soll, hat das an der Küste belegene Bagamoyo im letzten Februar verlassen, um nach Udschidschi zu gehen, und wollte mit Livingstone zusammenkommen, ehe er weiter ins Innere ging, sodass wir binnen kurzem aus dieser, wenn nicht aus einer andern Quelle definitive Nachrichten über den jetzigen Zustand unseres grossen Reisenden und seine zukünftigen Plane bekommen müssen. Wer Herrn Stanley persönlich kennt, weiss viel von seinem entschlossenen Charakter und seiner Fähigkeit, in Afrika zu reisen, zu erzählen. Seine Expedition ist gut ausgerüstet worden, er erfreut sich des grossen Vortheils, Bombay, das wohlbekannte Factotum von Speke und Grant in seinen Dienst genommen zu haben. Ich kann noch hinzufügen, dass er nur von seinen eigenen Hülfsmitteln abhängt und, wie es scheint, von einer blossen Liebe zu Abenteuern und Entdeckungen getrieben wird, und brauche wol kaum zu sagen, dass er, wenn es ihm gelingt, uns Livingstone wiederzubringen oder ihm dabei behülflich zu sein, das grosse Problem des obern Wassersystems des Nils und Congos zu lösen, von dieser Gesellschaft ebenso herzlich und warm begrüsst werden wird, als wenn er ein englischer Forscher wäre, der unter unsern unmittelbaren Auspicien handelt.
Aus dem Vorhergehenden ersieht man, dass Sir Henry Rawlison an dem Tage sehr liebenswürdig von mir gesprochen hat.
Die nächsten Briefe, die über Livingstone und mich einliefen, sind vom 25. und 22. September 1871 und lauten folgendermassen:
„Zanzibar, 25. September 1871.
Lieber Sir Roderick!
Sie werden aus dem ans Auswärtige Amt gerichteten Berichte ersehen, dass Schwierigkeiten in Unyamwezi entstanden sind, welche[S. 318] Udschidschi von der Küste abgeschnitten haben, und da wir von Udschidschi schon einige Zeit keine Nachrichten bekommen haben, so können wir noch lange warten, ehe wir Gewissheit über Dr. Livingstone’s Bewegungen erhalten.
Alles was ich sagen kann ist, dass mir Berichte aus jenem Orte fehlen; weder er noch sein arabischer Freund Mohammed bin Gharib war daselbst angekommen; aber es gab ein Gerücht, das ich für werthlos halte, dass sie beide über Wemba um das südliche Ende herumgehen würden.
Ich kann noch keine genauen Nachrichten über Manyema erhalten; ein jeder kennt es, doch ist, wie ich finde, noch keiner dort gewesen. Ich habe Leute gesehen, die von Udschidschi aus über den Tanganika gesetzt sind und Karavanen sich auf die Reise nach Manyema haben begeben sehen, doch scheint es ein ziemlich neuer, ungewöhnlicher Handelsweg zu sein.
Ich freue mich, dass der Gouverneur von Unyanyembé von seinem Posten entfernt werden soll; er ist es, gegen den der Krieg dort geführt worden und wenn er getödtet wäre, würden wir alle zufriedener sein.
Herr Stanley war in Unyanyembé und im Kampf, die Araber aber haben ihn im Stiche gelassen; vier von seinen Leuten wurden getödtet, er selbst entkam aber. Die Aussicht, dass er jetzt weiter gehen kann, ist gering; doch kann ich wirklich nicht sagen, wo er hingehen will; denn er hat seine Plane hier niemandem mitgetheilt. Ich habe Briefe an Dr. Livingstone an Stanley zur Weiterbeförderung geschickt und diesem auch die Sachen für Livingstone (die von der zweiten Sendung nämlich, denn die erste hat Udschidschi schon erreicht) anvertraut.
Ich glaube, er wird es sich angelegen sein lassen, zuerst mit Livingstone zusammenzutreffen; ob er aber, nachdem er selbst gesehen, was sich am besten thun lässt, weiter gehen oder zurückkehren wird, kann ich nicht sagen. Er lag am Fieber krank, als er schrieb, ist aber wieder leidlich wohl geworden.
Die Leute, welche hier angekommen sind, kehren morgen wieder zurück und sollten in 25 Tagen da sein, denn der Weg ist schön und Gras und Nahrungsmittel sind in Fülle vorhanden.
Ihr aufrichtig ergebener
JOHN KIRK.“
„Zanzibar, 22. September 1871.
Mylord!
Soeben durch Spezialboten, die Unyanyembé vor etwa einem Monat verlassen haben, empfangene Briefe bringen uns die Nachricht von einem schweren Unglück, das der dortigen arabischen Colonie zugestossen ist und wahrscheinlich den Weg nach Udschidschi und Karague für die nächste Zukunft versperren wird.
In Bezug auf die Hauptereignisse stimmen alle Berichte überein; aber natürlich sind die Briefe Herrn Stanley’s, eines Amerikaners,[S. 319] der sich an Ort und Stelle befand, die ausführlichsten und zuverlässigsten. Ich verdanke Herrn Webb, dem hiesigen amerikanischen Consul, einige Einzelheiten, die in diesen Briefen erzählt werden, welche ohne Zweifel anderswo in extenso werden veröffentlicht werden. In Kürze ist die Lage folgende: Die arabische Colonie des Innern, deren Mittelpunkt Unyanyembé ist, hat seit einiger Zeit unter der Führung von habgierigen, grundsatzlosen Leuten gestanden, deren sowol an Eingeborenen wie an den ärmeren Arabern verübten Erpressungen seit einiger Zeit Gegenstand von Klagen bei Seyd Barghasch geworden sind, welcher ausser Stande ist, sich bei einer solchen Entfernung in die Dinge zu mischen, solange dieselben für die Araber gut gehen. Ein Häuptling, dessen Dorf eine Tagereise auf der Hauptstrasse von Udschidschi nach Karague entfernt liegt, zog sich die Ungnade der Unyanyembé’schen Ansiedler zu und sein Wohnsitz wurde darauf durch eine Truppenmacht von etwa 1500 mit Flinten bewaffneten Soldaten angegriffen. Da er einsah, dass er das belagerte Dorf nicht halten könne, zog er sich mit seinem Gefolge zurück und legte sich in einen Hinterhalt, um die Angreifer auf ihrem Rückzuge zu überfallen, wo sie mit Elfenbein und anderer Beute beladen waren. Der Erfolg war für die Araber sehr unglücklich; viele derselben wurden getödtet mit Einschluss von 10 oder 20 Vornehmen, die guten hiesigen Familien angehören. Der arabische Rückzug artete bald in eine wilde Flucht aus und es ging dabei viel Vermögen verloren. Glücklicherweise gelang es Herrn Stanley, der am Fieber erkrankt und geschwächt war, nach Unyanyembé zurückzukehren; er wurde aber von den Arabern im Stich gelassen, deren Betragen er als ungemein feig schildert.
Das ist beständig der Zustand der Dinge in Central-Afrika. Der Weg nach Udschidschi wird jetzt auf einige Zeit versperrt sein und es ist sehr ungewiss, wann wir wieder etwas von Dr. Livingstone hören können. Einer der Leute, die jetzt hergekommen sind, berichtet, dass ein Gerücht im Umlauf sei, Mahomed bin Gharib und der Weisse (Dr. Livingstone) würden von Manyema über Marungu und Wemba zurückkommen. Das Gerücht ist jedoch, meines Erachtens, nichts werth, doch kann ich es immerhin erwähnen.
Die letzten von Herrn Churchill abgesandten Gegenstände haben Unyanyembé, wie ich schon früher berichtet, erreicht. Jetzt erfahre ich jedoch, dass der Führer, dem sie anvertraut worden, am Tage nachdem er nach Udschidschi abgezogen, gestorben ist und die Güter nach Unyanyembé zurückgebracht worden sind. Ich habe jetzt wenig Zutrauen zu dem Scheikh Said bin Salim und werde Herrn Stanley schreiben, der bisher wol nicht im Stande gewesen sein wird, den Ort zu verlassen, und ihn bevollmächtigen, Einrichtungen zu treffen, die Güter zu befördern oder, wenn er das nicht kann, für mich nach seinem besten Urtheil zu handeln, um dieselben vor Plünderung zu schützen; bei dem jetzigen Stande der Dinge aber wird es ein sehr grosses Glück sein, wenn sie überhaupt gerettet werden und je ihren Bestimmungsort erreichen.
[S. 320]
Die Boten werden sich in ein paar Tagen auf ihren Rückweg machen und sollten im Stande sein, ihre Reise bequem in 70–75 Tagen zu vollenden, denn der Weg ist so weit frei und Nahrungsmittel reichlich vorhanden.
Für den arabischen Elfenbeinhandel ist die jetzige Lage der Dinge sehr ernst; sie haben sich jetzt weit im Innern niedergelassen und sich mit Tausenden von Sklaven, die aus dem Lande selbst sind, umgeben; ohne diese können sie nicht auskommen und doch können sie ihnen nicht Vertrauen schenken, denn sie sind alle bewaffnet und können sich gegen ihre Herren wenden.
Der Häuptling, mit dem sie Krieg führen, ist mit Waffen wohl versehen und eine seiner Karavanen befindet sich jetzt mit mehreren hundert Fässern Pulver auf dem Wege ins Innere. Um diese Leute auf ihrer Reise anzuhalten, haben die Wasagara bereits den Befehl erhalten, sie anzugreifen und zu plündern; das kann jedoch auch nur der Anfang ähnlicher Angriffe auf arabische Karavanen sein, denn die wilden Stämme werden sich wenig darum kümmern, wen sie angreifen, wenn man sie erst zum Plündern ermuthigt hat.
Ich habe die Ehre u. s. w.
JOHN
KIRK,
politischer Agent und Consul für Zanzibar.
An Earl Granville.“
Kapitän R. F. Burton theilte mit, dies sei nicht das erste mal, dass Unfriede zwischen den arabischen Handelsgemeinschaften und den Eingeborenen von Unyanyembé und Unyamwezi ausgebrochen sei. Der jetzige Stand der Dinge könne noch 2–3 Jahre anhalten; wenn aber Livingstone es zu vermeiden wünsche, durch diesen Bezirk zu ziehen, so würde es keine Schwierigkeiten für ihn haben, seinen Rückweg südlich vom See Tanganika zu nehmen. Zu gleicher Zeit würde ein muthiger Weisser, wie Livingstone, der die Sprache der Eingeborenen spricht, im Stande sein, sicher durch Ortschaften zu ziehen, in welche sich kein Schwarzer hineinwagen darf. Er habe nicht die geringste Furcht in Bezug auf Livingstone, sondern sei davon überzeugt, dass im Augenblicke, wo ihm irgend etwas geschähe, die Nachricht sich sofort an die Küste verbreiten und der Gesellschaft fast so rasch wie durch den Telegraphen zukommen würde.
27. November. Sir Henry Rawlinson zeigt an, dass er der Versammlung eine Mittheilung über einen andern Gegenstand, an dem die Geographische Gesellschaft ein ebenso warmes Interesse nehme, nämlich über Dr. Livingstone zu machen habe. Bei der letzten Versammlung habe er Veranlassung gehabt, Briefe, die von Dr. Kirk an unsern hochgeehrten verstorbenen Vorsitzenden und an die Regierung von Bombay geschickt worden, vorzulesen, in denen er Unruhen beschrieben,
welche zufällig in Afrika ausgebrochen und die Verbindung zwischen der Meeresküste und dem See Tanganika unterbrochen hätten. Ueber denselben Gegenstand hätte das Auswärtige Amt eine[S. 321] Depesche von Dr. Kirk seitdem erhalten, ein Duplicat einer früher gelesenen, an die Regierung von Bombay gerichteten Depesche. Er wünsche jetzt die Massregeln anzukündigen, die der Vorstand am heutigen Tage infolge des Empfangs dieser Briefe beantragt habe. Dem Vorstande und ihm selbst schiene es jetzt, dass die bisher gehegte Hoffnung, durch Herrn Stanley, den amerikanischen Reisenden, mit Dr. Livingstone in Beziehung zu treten, aufzugeben sei und daher sei es Pflicht des Vorstandes, auf andere Mittel zu sinnen, dies zu erreichen. Er beabsichtige jetzt, sich an das Auswärtige Amt zu wenden, damit entweder direct von diesem oder durch Zusammenwirken desselben und unserer Gesellschaft Mittel geschafft würden, mit dem Innern, wo sich Livingstone vermuthlich aufhielte, in Verbindung zu gelangen. Der eine Plan bestände darin, eingeborene Boten abzusenden, denen man eine Belohnung von 100 Guineen für das Ueberbringen eines eigenhändigen Briefes von Dr. Livingstone an die Seeküste aussetze; der andere von einem unserer Afrikareisenden herrührende Vorschlag laute, eine directe, von einem erfahrenen, dazu geeigneten Europäer geleitete Expedition hinzuschicken. Welcher von diesen Plänen am räthlichsten erscheine, werde vom Resultat der Unterhandlung mit dem Auswärtigen Amt abhängen; die Gesellschaft könne aber versichert sein, dass der Vorstand kein Mittel unversucht lassen werde, festzustellen, ob Dr. Livingstone in Manyema zurückgehalten werde, wo er den Berichten zufolge zusammen mit dem arabischen Händler Mohammed bin Gharib so lange gelebt haben soll.
Herr Hormuzd Rassam sprach auf eine an ihn gerichtete Anfrage seine Meinung dahin aus, dass nach seinen Erfahrungen in Abessinien die beste Art, Nachrichten über entfernte Individuen zu bekommen, diejenige sei, Eingeborene als Boten auszuschicken. Bei drei verschiedenen Gelegenheiten habe er sich dieser Methode bedient, von Massowah aus mit den Gefangenen von Magdala in Verbindung zu treten. Er habe drei verschiedene Boten gebraucht, einen christlichen, einen mohammedanischen und einen Eingeborenen von Westabessinien. Diese habe er auf verschiedenen Routen abgesandt und sei vollkommen überzeugt gewesen, dass der eine von den Bewegungen der andern nichts gewusst habe. Zwar habe einer derselben einen selbstfabrizirten Brief zurückgebracht; die beiden andern aber seien etwa zehn Tage vor der verabredeten Zeit mit authentischen Nachrichten zurückgekehrt. Einige in Muscat lebende Araber, die bis an den Tanganika-See gereist seien, hätten versichert, man könne, mit Perlen und andern Tauschartikeln gehörig versehen, ohne Schwierigkeiten hin- und zurückreisen.
General Rigby war der Ueberzeugung, dass der von Herrn Rassam empfohlene Plan vollständig misglücken werde. Zwar könnten in Abessinien einzelne Reisende von einem entfernten Punkte des Landes an einen andern reisen, aber auf der Ostküste Afrikas sei dies unmöglich. Dort müssten alle Reisende von durch Bewaffnete geschützten Karavanen begleitet werden. Nur Handelskaravanen machten die Reisen an die Seen und diesen wäre es ganz gleichgültig, wie viel[S. 322] Zeit sie darauf verwendeten; wenn die Gesellschaft sich darauf verliesse, dass ein einzelner Eingeborener sich einer Karavane anschlösse und darauf warte, bis er mit einer andern zurückkehren könne, so könnte sie wol fünf Jahre oder noch länger warten. Er sei überzeugt, dass der einzige Weg, sich mit Livingstone in Verbindung zu setzen und ihm Hülfe zu bringen, darin bestehe, einen unternehmenden englischen Reisenden von Zanzibar mit einer kleinen bewaffneten Truppe und ausreichenden Vorräthen abzusenden.
Herr Rassam wollte nur noch hinzufügen, dass er durch Boten mit Häuptlingen in den entfernten Galla-Ländern in Verbindung getreten sei, die man nur durch eine Reise von 30–40 Tagen habe erreichen können. Seiner Meinung nach werde es nichts schaden, wenn man beide Pläne versuchte.
Der Vorsitzende theilte mit, der Vorstand habe sich entschlossen, zuerst den Versuch mit den eingeborenen Boten zu machen und wenn dies misglückt sei, könnten sie das ernstere Unternehmen einer Expedition in Angriff nehmen.
Die folgende Correspondenz, welche auf die an Dr. Livingstone gesandten Vorräthe Bezug hat, ist vom Auswärtigen Amt veröffentlicht worden:
DR. LIVINGSTONE AN DR. KIRK.
„Udschidschi, 30. October 1871.
Mein Herr!
Am 25. und 28. habe ich Ihnen zwei eilige Briefe gesandt, welche (der eine für Sie, der andere für Lord Clarendon bestimmt) nach Unyanyembé befördert worden sind. Ich war gerade hier ganz abgemattet an Geist und Körper angekommen, als ich fand, dass Ihr Agent Scherif Bascha alle von Ihnen geschickten Waaren zu eigenen Gunsten für Sklaven und Elfenbein verkauft hatte. Er hatte den Koran um Rath gefragt und herausgefunden, dass ich todt sei. Auch schrieb er an den Gouverneur von Unyanyembé, er habe Sklaven nach Manyema gesandt, die mit dem Berichte zurückgekehrt seien, ich sei todt; er erbat sich deshalb vom Gouverneur die Erlaubniss, die Waaren zu verkaufen. Scherif Bascha wusste jedoch von Leuten, die aus Manyema von mir gekommen waren, dass ich in der Nähe von Udschidschi in Bambarre sei und auf ihn und meine Güter warte. Als aber meine Freunde hier gegen den Verkauf meiner Waaren protestirten, antwortete er ihnen jedesmal: “Ihr wisst nichts über die Angelegenheit; ich allein weiss, dass der Consul mir den Auftrag gegeben hat, einen Monat in Udschidschi zu bleiben und dann die Sachen zu verkaufen und zurückzukehren.„ Als ich ankam, sagte er, Ludha hätte ihm das befohlen. Von den Banyanischen Sklaven, die[S. 323] Sie hergeschickt, erfahre ich, dass sich Ludha an Ali bin Salim bin Raschid, eine notorisch unehrliche Persönlichkeit, gewandt und dieser ihm Scherif Bascha als Führer der Karavane anempfohlen habe. Kaum hatte dieser den Oberbefehl erhalten, so begab er sich zu Muhamad Nassur, der ihn mit 20 Kisten Seife und 8 Kisten Branntwein versah, die er im Einzelverkauf auf der Reise ins Innere losschlagen sollte. In Bagamoyo bekam Scherif eine Menge Opium und Schiesspulver von zwei dortigen Banyanen, deren Namen mir unbekannt sind. In ihrem Hause öffnete Scherif die Seifenkisten und steckte ihren Inhalt in meine Ballen; die Branntweinkisten liess er uneröffnet und brauchte Pagazi, die aus meinen Ballen bezahlt wurden, zum Transport des Opiums und des Schiesspulvers. Die Banyanen und Scherif hatten also ihre eigenen Handelsspeculationen verfolgt, anstatt die Beziehungen zwischen zwei Regierungsbeamten zu vermitteln und von da ab wurden alle Reiseausgaben aus meinen Vorräthen bezahlt und Scherif war im Stande, seinen Mitschuldigen 5 Frasilehs Elfenbein im Werthe von etwa 60 Pfd. Sterl. aus Unyanyembé zu schicken. Wiederum wurden die Pagazi von mir bezahlt. Er beeilte sich keineswegs, mir zu Hülfe zu kommen, sondern brachte 14 Monate auf der Reise zu, auf einer Entfernung, die man in drei Monaten hätte zurücklegen können. Wenn man zwei Monate Aufenthalt durch Krankheit abzieht, so bleiben noch 12 Monate, von denen neun den Privatinteressen der Banyanen und des Scherif gewidmet waren. Er hat meine Güter verprasst, indem er sich das Beste an Speise und Trank, was das Land darbietet, kaufte; er hat in meinem Zelte gewohnt, bis es so verfault und zerrissen war, dass ich es nicht ein einziges mal brauchen konnte; er hat sich zwei Monate an drei verschiedenen Orten aufgehalten, um Branntwein, Opium, Schiesspulver und Seife zu verkaufen und als dies geschehen war wollte er, nachdem er in Udschidschi angekommen, nicht weiter ziehen. Hier wird allgemein berichtet, er sei einen ganzen Monat betrunken gewesen, und alles Durra, Pombé und den Palmwein hat er mit meinen schönen Samsam-Perlen gekauft. Er hat 24 Meter Calicot monatlich für sich, 8 Meter für jeden seiner zwei Sklaven, 8 Meter für seine Frau und 8 Meter für Awathe, den zweiten Führer, verausgabt. Als er mir die sieben Banyanen, von Ludha gemiethete Sklaven, nach Bambarre schickte, bewilligte er mir nur zwei Frasilehs der gröbsten Perlen, die er offenbar für meine schönen Samsam eingetauscht hatte, ein paar Stücke Calicot und aus Gnade und Barmherzigkeit die Hälfte des Kaffees und Zuckers. Die Sklaven kamen ohne Lasten. Schliesslich ging Scherif soweit, wie bereits berichtet, alles mit Ausnahme der andern Hälfte des Kaffees und Zuckers und eines Bündels unverkäuflicher Perlen sowie von vier Stücken Calicot zu verkaufen. Er zog von hier fort, deponirte jedoch, da er von Unruhen hörte, die in Unyanyembé ausgebrochen, sein Elfenbein in einem nahe belegenen Dorfe, kam zurück, nahm sich die vier Stück Calicot, und ich habe von all dem schönen Calicot und den Perlen, die Sie[S. 324] mir zugesandt, nicht einen Meter oder eine einzige Reihe Perlen bekommen. Awathe, der zweite gemiethete Führer, schaute dem von Scherif verübten Raube von der Küste an zu und hat nie dagegen Einspruch erhoben oder einen Bericht darüber an seinen Miethsherrn erstattet. Vor Ihnen hat er sorgfältig ein Leiden verborgen, welches ihn daran verhinderte, mir auch nur einen Dienst zu leisten. Er hatte nämlich einen Bruch lange, ehe er gemiethet worden, und mir hat er gesagt, dass die grosse Fleischgeschwulst plötzlich bei seiner Ankunft in Udschidschi entstanden sei. Es ist kein Wasserbruch, sondern Fleischbruch und seine eigene Erzählung beweist, dass der Schmerz, den er simulirte, ganz aufgehört hatte, als sich einer meiner Freunde, Dugumbe, dazu erbot, ihn in kurzen, bequemen Tagereisen zu mir zu führen. Er schlug dies aus, da er glaubt, die Banyanen hätten so viel Macht über uns, dass er seinen vollen Lohn für die ganze Zeit, in der er meine Waaren verzehrt hat, bezahlt bekommen werde, obwol er ausser Stande war, seinen Dienst zu versehen. Dugumbe erbot sich auch, ein Packet Briefe, das dem Scherif als meinem Agenten übergeben worden, mir zu bringen; als er ihm aber mittheilte, er sei im Begriff, sich auf die Reise zu machen, kam nichts zum Vorschein. Das Packet ist wol zerstört worden, damit ich nicht die Liste von Waaren zu sehen bekäme, die Sie mir durch einen gewissen Hassani nach Unyanyembé geschickt haben. Indem ich mich gebührenderweise Ihrem Urtheil unterwerfe, fordere ich doch alle dadurch entstandenen Ausgaben, wie sie in Ludha’s Büchern enthalten sind, von den Banyanen zurück, die betrügerischerweise aus einer Karavane, die mir Hülfe bringen sollte, ein Mittel gemacht haben, um ihre eigene Geldgier zu befriedigen. Muhamad Nassur kann die Namen der übrigen banyanischen Mitschuldigen Scherif’s angeben, welche es zugelassen haben, dass die mir zugedachte Hülfe in eine Speculation verwandelt worden ist; sie sollten die von Ludha mitgeschickten Sklaven bezahlen und sich ihre Auslagen von Scherif wiedergeben lassen. Ich berichte diesen Fall sowol an die Regierung Ihrer Majestät, als an Sie und glaube, dass Sie dadurch besser im Stande sein werden, dafür zu sorgen, dass mir Gerechtigkeit widerfahre und den Banyanen Scherif und Awathe sowie den banyanischen Sklaven, welche mich, anstatt den in Ihrer Gegenwart eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, in aller Weise schikanirt und gehindert haben, die gebührende Strafe zutheil werde. Indem Sie die Angelegenheit meiner Vorräthe und Leute dem Banyanen Ludha anvertraut haben, scheinen Sie nicht gewusst zu haben, dass unsere Regierung ihren Beamten verbietet, Sklaven zu benutzen. Der Commissar und Consul in Loanda auf der Westküste hat nach dem fernen St. Helena geschickt, um ziemlich dumme Diener zu bekommen, nur damit er sich nicht die Ungnade des Auswärtigen Amtes dadurch zuziehe, dass er geschickte portugiesische Sklaven, die zur Hand waren, benutze. Unter den sehr schwierigen Verhältnissen, von denen Sie reden, da die Cholera wüthete und Sie weder meine bereits übermittelten Instructionen, freie Leute und nicht Sklaven zu miethen, noch die in dem verlorenen[S. 325] Packete enthaltenen Geldanweisungen erhalten hatten, war es vielleicht am einfachsten, sich an Ludha zu wenden; ich hoffe indess, Sie werden mich nicht für undankbar halten, wenn ich darauf hinweise, dass dies doch ein grosser Irrthum war. Ludha ist zwar höflich, aber der Sklavenhandel und fast jeder andere Handel wird hauptsächlich durch das Geld der Banyanen vermittelt, die britische Unterthanen sind und den grössten Theil des Profits empfangen, es aber verstehen, das Odium der Sklaverei geschickt auf die Araber zu wälzen. Sie hassen uns Engländer und freuen sich mehr, wenn uns etwas misglückt, als wenn es gelingt. Ludha hat seine eigenen und andere banyanischen Sklaven zum Jahreslohne von 60 Dollars hergeschickt, während die gewöhnliche Bezahlung für Freie aus Zanzibar 25–30 Dollars beträgt. Er wird enorme Interessen für das vorgeschossene Geld verlangen, angeblich 20–25 Procent, und selbst wenn Scherif’s Behauptung, dass Ludha ihm befohlen, nicht weiter als nach Udschidschi zu gehen, sondern nach einem Monat alles zu verkaufen und zurückzukehren, vollständig unwahr wäre, so ist es doch sehr merkwürdig, dass jeder der banyanischen Sklaven es aufs bestimmteste behauptete, dass sie mir nicht folgen, sondern mich zur Umkehr zwingen sollten. Ueber Leute, welche wussten, dass sie ihr Gehalt nicht weiter beziehen würden, hatte ich natürlich keinen Einfluss. Es ist auch sehr merkwürdig, dass die Zwecke Ihrer Karavanen so vollständig durch Banyanen, die fast unter dem Schatten des Consulats mit Scherif unter einer Decke stecken, vereitelt werden können und Ihnen weder ein Dragoman, noch andere Ihrer besoldeten Untergebenen das anzeigt. Diesen konnte doch der Charakter des Ali bin Salim bin Raschid und seines Gefährten Scherif kaum unbekannt sein. Wie kann man sie aber ohne glaubwürdige Zeugnisse in Dienst nehmen?
Ihr ergebenster
DAVID LIVINGSTONE.“
„Nachschrift.
16. November 1871.
„Ich bedauere es sehr, dass ich gezwungen bin, Ihnen den vorstehenden sehr unliebsamen Gegenstand vorzutragen; ich habe aber soeben Nachrichten und Briefe erhalten, welche die Sache doppelt ernst erscheinen lassen. Herr Churchill hat mich durch einen Brief vom September 1870 benachrichtigt, dass Ihrer Majestät Regierung mir gütigst eine Unterstützung von 1000 Pfd. Sterl. geschickt hat. Zuerst seien Schwierigkeiten entstanden, Sachen im Werthe von 500 Pfd. Sterl. abzusenden; zu Anfang November jedoch sei dies möglich geworden. Wiederum aber haben Sie Sklaven gemiethet und einer derselben erzählt mir jetzt, dass sie vier Monate oder bis zum Ende des Februar 1871 in Bagamoyo liegen geblieben sind. Niemand hat sich während der ganzen Zeit um sie bekümmert. Als aber ein Gerücht zu ihnen drang, dass der Consul käme, beeilten sie sich abzureisen, zwei Tage vor Ihrer Ankunft, welche gar nicht mit ihren[S. 326] Angelegenheiten zusammenhing, sondern durch eine Reise in Ihrem eigenen Privatinteresse bedingt gewesen sei. Diese Sklaven kamen im vorigen Mai nach Unyanyembé, dort sei, nach ihrem Berichte, der Krieg im Juli ausgebrochen, und dies gab ihnen einen guten Vorwand, dort zu bleiben. Damit ist ein ganzes Jahr verstrichen, in welchem 500 Pfd. Sterl., welche die Regierung mir zugeschickt hat, dazu verwendet worden, Sklaven ein gutes Leben zu bereiten. Wie der Mann, der in Versuchung gerieth, zu verzweifeln, als er die Photographie seiner Frau zerbrochen hatte, möchte ich fast die Hoffnung aufgeben, jemals aus Zanzibar Hülfe zu bekommen, um den noch übrigen kleinen Rest meiner Aufgabe zu lösen. Ich brauche freie Menschen, nicht Sklaven, und solche sind in Zanzibar in Masse zu haben. Wenn aber die Sache dem Ludha, anstatt einem energischen, von Ihrem Dragoman oder andern Beamten überwachten Araber anvertraut wird, so kann ich noch zwanzig Jahre warten und Ihre Sklaven können sich lustig machen ohne ihre Pflicht zu thun.“
DR. LIVINGSTONE AN DR. KIRK.
„Unyanyembé, 20. Februar 1872.
Mein lieber Kirk!
Da ich mir durch Herrn Stanley 50 Freie aus Zanzibar kommen lasse, um im Stande zu sein, meine Aufgabe zu Ende zu führen, so bitte ich Sie, Ihren Einfluss beim Sultan zu meinen Gunsten zu verwerthen, damit dieser mir einen tüchtigen Führer verschaffe, der sie rasch herbringt und bei mir bleibt, bis ich meine Arbeit zu Ende geführt; und zwar muss es ein Mann von gutem Charakter sein, der gern für mich arbeitet und auf keinen Fall meine Expedition mit seinen Privatspeculationen heimsucht. Diesen Punkt muss man ihm deutlich auseinandersetzen. Wenn er aber ein guter energischer Führer ist, so werde ich ihm, sobald wir in das Land kommen, wo es viel Elfenbein gibt, dafür eine reichliche Belohnung zutheil werden lassen, obwol er die Reise auf meine Kosten gemacht hat. Wenn derselbe früher mit einer Karavane gereist ist, so wird er die Pflichten kennen, die er dem Haupte derselben schuldet. Bei seiner Ankunft hier werden wir aus der Weise, in welcher er Herrn Stanley’s Befehlen in Bezug auf die Leute und Esel nachgekommen ist, ersehen, ob er sich dazu eignet, mich weiter zu begleiten. Seine Pflicht ist, wie Sie andern sehr richtig gesagt haben, die ihm ertheilten Befehle auszuführen und darauf zu sehen, dass die andern dasselbe thun, ohne Rücksicht auf die Sitten oder Gewohnheiten anderer Karavanen. Ich wünsche, dass Sie Herrn Henry M. Stanley die Summe von 500 Pfd. Sterl. von dem Gelde geben, das Ihnen zu meinem Nutzen von Ihrer Majestät Regierung übermittelt worden, damit er dasselbe für mich verwende, und Sie werden seine Empfangsbescheinigung als ausreichendes Anerkenntniss meinerseits annehmen. Er weiss, was ich an Leuten und Waaren nöthig habe, und ich bin überzeugt, dass[S. 327] Sie Ihren ganzen consularischen Einfluss darauf verwenden werden, ihm das zu verschaffen, was ich brauche und die Expedition möglichst rasch ins Innere zu befördern. Wenn Sie zwei Briefe, die hastig am 28. October 1871, gleich nachdem ich in Udschidschi angekommen, geschrieben wurden, nämlich einen an Sie, den zweiten an Lord Clarendon gerichteten, nicht erhalten haben, so haben Sie sich vielleicht dazu verleiten lassen, wieder banyanische oder andere Sklaven statt freier Leute zu miethen. Zaudern Sie jetzt aber nicht, sondern seien Sie so gut, sie sofort wieder zu entlassen, mag es kosten, was es wolle. Ich habe Herrn Stanley einen Wechsel auf Bombay mitgegeben für den Fall, dass Sie alles Geld, das Ihnen von der Regierung übersandt worden, verausgabt haben. Sklaven sollen mir durchaus nicht geschickt werden, denn alle, die ich bisher gehabt, kamen hier von der Idee erfüllt an, dass sie mich nicht begleiten, sondern zur Rückkehr zwingen sollten und sie beschworen es (fälschlicherweise natürlich), dass Sie, der Consul, ihnen diese Instruction ertheilt hätten. Ich schliesse eine Quittung für einen Taschenchronometer ein, den mir vielleicht der Kapitän eines Kriegsschiffes leihen kann, ohne dass er ihn für sein eigenes Schiff entbehrt. Ehe ich hiervon und von Geldangelegenheiten zu sprechen aufhöre, möchte ich nur noch hinzufügen, dass Eile von grösster Wichtigkeit ist und dass, wenn Ihnen irgendeine andere Methode, rasch Geld zu bekommen, einfällt, z. B. von Herrn Young oder von meinen Bankiers Coutts und Comp., so bitte ich Sie, dieselbe einzuschlagen. Ich verpflichte mich hierdurch, das Ganze sofort durch einen Wechsel zu berichtigen, wenn Herrn Stanley’s Leute Unyanyembé erreichen. Aus einigen von Herrn Webb an Herrn Stanley gesandten Zeitungen ersehe ich, dass Sie der Meinung sind, dass Waaren und Packete, die Sie Banyanen mitgeben, in etwa einem Monat Udschidschi erreichen können. Der Kasten aber, den Sie verpackt haben, war ungefähr vier Jahre unterwegs. Waaren und wahrscheinlich auch Briefe, die mir durch einen gewissen Hassain hergeschickt worden, sind ganz und gar verschwunden. Durch Scherif mir übersandte Briefe waren vierzehn Monate unterwegs nach Udschidschi und ein Packet davon war vernichtet. Alle Güter sind für Sklaven und Elfenbein verkauft worden. Irrthümlicherweise haben Sie Earl Granville veranlasst, im Hause der Lords zu sagen, dass alle meine Bedürfnisse befriedigt seien. Ich brauche mich nicht weitläufiger darauf einzulassen, sondern es genügt wol, wenn ich Ihnen einen kurzen Ueberblick der Schicksale der durch Ludha und seine Sklaven mir zugekommenen Vorräthe gebe. Die Briefe befanden sich vierzehn Monate unterwegs nach Udschidschi und sind überhaupt nur dadurch hergekommen, dass Herr Stanley sie zufälligerweise zu sehen bekam und mir mitbrachte. Die von Ihnen gesandten Sklaven wollten ihn nicht nach Udschidschi begleiten. Warum hat man sie alle so instruirt, dass sie mir nicht folgen? Sie haben mir erzählt, dass sie sich vier Monate in Bagamoyo aufgehalten haben. Dort verschwanden drei Beutel Perlen und ein Ballen Tuch; dann verprassten die beiden[S. 328] Führer meine Güter hier. Der eine ist an den Pocken gestorben und der noch am Leben befindliche Athman hat am hellen Tage die Riegel und Schlüssel von Herrn Stanley’s Vorrathshaus zerbrochen und ihm Güter gestohlen. Er ist entlassen.
Ich bin u. s. w.
DAVID
LIVINGSTONE,
Ihrer Majestät Consul in Inner-Afrika.“
DR. KIRK AN EARL GRANVILLE.
„Zanzibar, 9. Mai 1872.
Ich habe die Ehre zu melden, dass gestern Herr Stanley, dessen bevorstehende Ankunft ich bereits angekündigt habe, nach Zanzibar gekommen und mir Briefe von Dr. Livingstone übergeben hat, von denen ich hierbei Copien übersende. Da Dr. Livingstone es geflissentlich vermeidet, auch nur Andeutungen von seinen während der letzten drei Jahre, wo er nichts von sich hat hören lassen, ausgeführten Arbeiten zu geben und ebensowenig etwas von den neuen Forschungen mittheilt, die er vor hat und für welche er durch Herrn Stanley 50 Bewaffnete verlangt und eine Ausgabe von 500 Pfd. Sterl. veranlasst, so muss ich es Herrn Stanley überlassen, dem das Geheimniss anvertraut worden, es in der Weise, wie es den Interessen seines Auftraggebers am besten passt, bekannt zu machen. Herrn Stanley sind Dr. Livingstone’s Tagebuch und seine sämmtlichen Notizen anvertraut worden mit dem speciellen Befehle, nichts über seine Route oder seine Pläne hier kund werden zu lassen; und Briefe, die früher geschrieben wurden und einige Nachrichten enthielten, sind entweder unterdrückt worden oder verloren gegangen. Der Rest von den durch die Regierung bewilligten 1000 Pfd. Sterl., welche Eure Lordschaft Herrn Churchill übergeben hat, ist schon auf Ihren Befehl der Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung von Livingstone übergeben worden und befindet sich in den Händen des Herrn W. O. Livingstone, der jetzt diese Expedition repräsentirt, nachdem sich die andern Mitglieder vernünftigerweise zurückgezogen haben, da sie erfahren, dass sich Dr. Livingstone ungefährdet in Unyanyembé befindet, wo er leicht zu erreichen ist und reichliche Vorräthe für die Jahre hat, die er sich noch im Lande aufzuhalten gedenkt. Herr Stanley hat mir die Liste von Sachen gezeigt, die jetzt von ihm bestellt worden, von denen sich fast alle bereits unter den für die Expedition beschafften Gegenständen und in den Händen von Herrn W. 0. Livingstone befinden. Daher werden wol die kostbaren Baumwollenwaaren und Perlen, die schon für die Reise angeschafft worden, verkauft werden, da Dr. Livingstone sie, wie wir wissen, nicht mehr nöthig hat. In den Händen der Expedition befinden sich auch funfzig gezogene Karabiner, sodass es überflüssig sein wird, noch neue Auslagen in dieser Beziehung zur Bewaffnung der funfzig Mann[S. 329] zu machen, die Herr Stanley aussuchen wird. Jetzt erübrigt es fast nur noch, Sklavenketten zu kaufen, die Dr. Livingstone für die Begleitmannschaft bestellt hat, um sie für den Fall zu brauchen, dass die Leute sich weigern, ihre Pflicht zu thun, wie es die vorigen gethan haben. Doch ist die Leitung der ganzen Angelegenheit, soweit sie sich auf diese Expedition bezieht, in den Händen von Dr. Livingstone’s Sohn, und die Auswahl der Leute wird ausschliesslich von Herrn Stanley besorgt. Die Expedition wird, auf die ausdrückliche Bitte Dr. Livingstone’s, sofort in leichter Marschordnung abziehen. Die weitläufige Correspondenz, die ich einschliesse, zeigt deutlich, dass der Agent Scherif Bascha, dem der Transport der Vorräthe nach Udschidschi anvertraut worden, dies in der nachlässigsten und unehrlichsten Weise besorgt hat. Es scheint jedoch, dass die Handelsspeculationen, die auf dem ersten Theile der Reise unternommen wurden, hauptsächlich mit Gütern bewerkstelligt worden sind, die er sich an der Küste geliehen und mit den Regierungsvorräthen zusammengethan hat, um sich die Kosten des Transports zu ersparen. In Udschidschi ist er mit einem grossen Vorrath von Regierungswaaren angekommen, welche, wenn er sie ehrlich abgegeben hätte, noch lange für Dr. Livingstone’s Bedürfnisse ausgereicht haben würden. Hier erst brachte er im Glauben, dass Dr. Livingstone nicht aus Manyema zurückkehren werde, die werthvollsten Sachen bei Seite und schickte nur wenig davon an den Doctor.
Die zum zweiten mal abgesandten Vorräthe, genau dieselben, wie das erste mal, sind in Unyanyembé angekommen. Diese Expedition wurde zuerst von Herrn Churchill organisirt und abgeschickt; die Leute hielten sich aber noch nach der Abreise des Herrn Churchill von Zanzibar an der Küste auf. Da ich Ursache hatte zu argwöhnen, dass dies der Fall sei, schickte ich zuerst einen Consulardiener hin und folgte dann selbst. Als sie von meiner bevorstehenden Ankunft hörten, machten sie sich schleunigst auf den Weg. Es blieben aber noch einige Lasten übrig, die ich persönlich aus Bagamoyo abzuschicken hatte. Diese Güter sind jetzt in Dr. Livingstone’s Händen und in Bezug auf sie habe ich den damals in Unyanyembé anwesenden Herrn Stanley, als ich erfuhr, dass dort der Krieg ausgebrochen sei, gebeten, für mich zu handeln und sie Dr. Livingstone zu übermitteln. Zu der Zeit war es hier noch nicht bekannt, dass Herr Stanley ausgezogen war, um Dr. Livingstone aufzusuchen, denn dies hatte er bei seiner Abreise sorgfältig verheimlicht; da ich aber wusste, dass ein Weisser sich an Ort und Stelle befände, so bat ich ihn, alles Mögliche zu thun, um die für einen Reisecollegen bestimmten Güter weiter zu befördern. Ein grosser Theil der Livingstone’schen Correspondenz mit unserm Consulat bezieht sich auf förmliche Anklagen des Sklavenhaltens, die gegen mehrere der bedeutendsten Mitglieder der britisch-indischen Gemeinde gerichtet sind. Ich stehe dafür ein, dass ein jeder der Leute vollständig jedes Wort des Contractes verstanden hat, und ferner dass sich diese Leute, die angeblich Sklaven von Banyanen sind, für Freie ausgegeben haben.[S. 330] Dass sie sich sehr schlecht bewährt haben, unterliegt keinem Zweifel. Doch erzählt mir Herr Stanley, er sei gezwungen gewesen, obwol er selbst seine Expedition führte, seine Leute in Sklavenketten marschiren zu lassen, um ähnliches Unglück zu vermeiden, und Dr. Livingstone gibt in einer eigenhändigen Zuschrift den Befehl, Ketten für die Leute, die ihm jetzt zugeschickt werden, zu kaufen. In Bezug auf die alte Angelegenheit der Johannesen und Dr. Livingstone’s Geldforderungen an sie, erwarte ich Eurer Lordschaft Befehle; da aber Johanna nicht innerhalb meines Jurisdictionsbezirks liegt, so schliesse ich das darauf bezügliche Schriftstück im Original bei. Ich enthalte mich aller Bemerkungen über den unhöflichen Ton dieser officiellen Briefe, sowie über die schimpflichen persönlichen Insinuationen, die sich auf mein und Herrn Churchill’s Betragen beziehen. Ich bin aber bereit, wenn es nöthig ist, auf jeden Punkt, über den Eure Lordschaft eine Erklärung wünscht, Rede und Antwort zu stehen. Ich bin ganz ausser Stande, es mir zu erklären, warum Dr. Livingstone, der als Consul Ihrer Majestät accreditirt ist, nicht selbst sofort die stärksten Massregeln ergriffen hat, um dem Sklaven- und sonstigem Raube Einhalt zu thun, von dem er sagt, dass er durch junge Nassicks, britische Schutzbefohlene, begangen worden, welche, wenn sie jetzt nicht zu seiner Eskorte gehören, wenigstens durch ihn in das Land gebracht wurden und sich zur Zeit in demselben Lager befanden. Wenn er an Ort und Stelle, mit der ganzen Autorität eines Consuls versehen, nicht Macht genug hat, das zu unterdrücken, was er als Augenzeuge schildert, wie kann er erwarten, dass die Gerechtigkeit die Schuldigen aus einer solchen Entfernung erreiche, zumal sie sich in einer Gegend befinden, die durchaus nicht unter der Gewalt des Sultans von Zanzibar steht.“
[Auszug.]
DR. KIRK AN EARL GRANVILLE.
(Erhalten am 22. Juli.)
„Zanzibar, 18. Mai 1872.
Ich habe die Ehre mitzutheilen, dass, nachdem wir die sichere Kunde erhalten, Dr. Livingstone befinde sich bei guter Gesundheit und im Besitz reichlicher Vorräthe, aber ohne die Absicht, jetzt Afrika zu verlassen, in dem dreissig Tagereisen von der Küste entfernten Unyanyembé, der Führer der zu seiner Aufsuchung und Unterstützung bestimmten Expedition, Lieutenant Dawson, zu der Ueberzeugung gekommen ist, dass seine Dienste als Hydrograph und gewandter Landvermesser unnütz geworden seien. Da Dr. Livingstone’s Sohn noch darauf besteht, sich zu seinem Vater zu begeben, und Lieutenant Henn unter diesen Umständen es kaum für rathsam hielt, ihn allein ziehen zu lassen, übernahm dieser das Commando, nachdem Lieutenant[S. 331] Dawson zurückgetreten war. Der Missionär Herr New, der sich der Expedition als Dolmetscher angeschlossen, erbot sich auch, mitzugehen, und die neue Expedition war zum Aufbruch bereit, als auch Herr New aus dem Grunde ablehnte, er könne bei reiflicherer Ueberlegung die zweite Stelle nicht annehmen. Seine Entlassung wurde sofort angenommen. Darauf begaben sich Lieutenant Henn, Herr W. O. Livingstone und die aus Eingeborenen bestehende Wachmannschaft auf das Festland von Afrika, wo die Güter schon unter Lieutenant Dawson zusammengebracht worden waren. Die Expedition war bereit aufzubrechen und unter Auspicien, wie sie wol nie besser gewesen, als Herr Stanley, der amerikanische Zeitungscorrespondent, der vor einem Jahre abgereist war, in Bagamoyo ankam. Herr Stanley verlor keine Zeit, Herrn Lieutenant Henn davon zu benachrichtigen, dass er Befehle von Dr. Livingstone habe, jede Expedition, die zu ihm stossen wolle, zurückzuschicken, und dass er und seine Expedition durchaus nicht willkommen, sondern Livingstone nur zur Last fallen würde, da er (Herr Stanley) eigenhändige Befehle des Doctors habe, die Leute und Vorräthe, deren er noch bedürfe, zu besorgen. Da es bei Lieutenant Henn’s Rückkehr in Zanzibar aus der ganzen Haltung von Dr. Livingstone’s offizieller Correspondenz ersichtlich war, dass ihm keine Hülfe, die nicht von Herrn Stanley, dem Agenten, dem er Vertrauen schenke, käme, willkommen sei, zog sich Lieutenant Henn natürlich zurück; Herr W. O. Livingstone aber bestand noch darauf, seinen Vater unter allen Umständen in Gesellschaft von Herrn Stanley’s Leuten aufzusuchen und es wurden ihm daher die Vorräthe anvertraut. Herr Stanley beeilte sich auch, die 500 Pfd. Sterl., wegen deren ihn Dr. Livingstone in einem Briefe, dessen Abschrift ich beilege, an mich gewiesen hatte, mir abzuverlangen. Ich theilte ihm darauf mit, dass ich derartige Fonds nicht besässe, da infolge Befehls von Euer Lordschaft alles der letzten Expedition übergeben worden und dass Herr W. O. Livingstone die ganze Verantwortlichkeit für dieselben habe. Herr Stanley vernichtete darauf einen Livingstone’schen Wechsel über die Summe von 500 Pfd. Sterl., der auf Bombay ausgestellt war. Herr W. O. Livingstone hat es nach Durchlesung der Briefe seines Vaters abgelehnt, Herrn Stanley’s Expedition zu seinem Vater zu begleiten, dagegen Herrn Stanley alles, was er an Vorräthen und Geld brauchte, übergeben und die amerikanische Expedition ist gestern nach der Küste abgereist. Ich füge hier noch hinzu, da sonst vielleicht mein Betragen falsch dargestellt werden könnte, dass sich Herr Stanley, um Vorwürfen zu entgehen, die daraus entstehen könnten, dass seine Leute nicht rechtzeitig in Unyanyembé ankämen, an mich mit der Bitte gewandt hat, für ihren Abgang zu sorgen, nachdem er Zanzibar verlassen. Dieses habe ich sofort aufs bestimmteste abgelehnt und ihm gesagt, es sei mir unmöglich, mit Dr. Livingstone nach dem, was er gethan und gesagt habe, noch anders als in meiner officiellen Eigenschaft zu verhandeln. Herr W. O. Livingstone hat hier die überschüssigen Vorräthe der Expedition verkauft und[S. 332] wird seine Rechnung der Königl. Geographischen Gesellschaft einreichen.“
Aus dem Obigen ersieht man, dass Dr. Livingstone eine förmliche Klage bei Herrn Kirk einreicht und natürlich auch genöthigt ist, seinen Freund in der formellen Weise „Mein Herr!“ anzureden. Er fährt dann fort die Erfolge der verschiedenen von Zanzibar an ihn abgesandten Karavanen zu schildern und gesteht es in einer Nachschrift ein, dass er es sehr bedauere gezwungen zu sein, über so unangenehme Dinge zu schreiben.
In den Briefen Dr. Kirk’s, die es offenbar bekunden, dass er diese Klage übel aufnimmt, findet man, dass dieser darauf durch folgende gegen Dr. Livingstone und mich vorgebrachte Beschuldigungen erwidert:
1) Dr. Livingstone hat es „geflissentlich“ vermieden, die geringste Andeutung über seine Arbeiten während der letzten drei Jahre, wo er nichts von sich hat hören lassen, und in Bezug auf seine neuen Forschungen zu machen.
2) Herr Stanley hat besondere Instructionen, ja nichts über seine (zukünftige) Route oder Pläne bekannt werden zu lassen.
3) Früher geschriebene Briefe, in denen sich hierüber einige Nachrichten befanden, sind unterdrückt worden oder verloren gegangen.
4) Herr Stanley ist gezwungen gewesen, seine Leute in Sklavenketten marschiren zu lassen, um ähnliches Unglück zu vermeiden, wie das von Livingstone erduldete.
5) Dr. Livingstone verlangt in einem eigenhändigen Schriftstücke Ketten zu diesem Zweck (um Unglücksfälle zu vermeiden), für die Leute, die jetzt zu ihm ziehen.
6) Der Ton der officiellen Briefe Dr. Livingstone’s ist unhöflich und die persönlichen Insinuationen in Bezug auf mein und Herrn Churchill’s Betragen sind schimpflich.
7) Ich wundere mich, dass Dr. Livingstone ausgerüstet mit der Consularautorität nicht die Macht hat, dem Morden, dem Sklaven- und sonstigem Raube, der öffentlich von jungen Nassicks, britischen Schutzbefohlenen, verübt worden, ein Ziel zu setzen.
8) Herr Stanley hat keine Zeit verloren, Lieutenant Henn zu versichern, dass ein schriftlicher Befehl Dr. Livingstone’s ihn[S. 333] ermächtige, eine jede Expedition, die zu ihm stossen will, wieder zurückzuschicken.
9) Es geht deutlich aus der Haltung von Dr. Livingstone’s officieller Correspondenz hervor, dass er nur Hülfe, welche durch seinen vertrauten Agenten, Herrn Stanley, ihm zukommt, willkommen heissen werde.
10) Herr W. O. Livingstone hat, nachdem er seines Vaters Briefe durchlesen, es abgelehnt, Herrn Stanley’s Expedition zu seinem Vater zu begleiten.
Da Dr. Livingstone nicht hier ist und ich die obigen Beschuldigungen ebenso widerlegen kann, als ob er selbst in England wäre, und da ich an einigen der Beschuldigungen auch betheiligt bin, so ist es meine Pflicht, sie so deutlich wie möglich auseinanderzusetzen. Ich erwidere also in derselben Reihenfolge, wie oben die Behauptungen aufgeführt sind, Folgendes:
1) Dr. Livingstone hat es nicht geflissentlich vermieden, Aufschlüsse über seine zukünftigen Pläne oder frühern Arbeiten zu geben. Vielmehr hat er wiederholt Briefe geschrieben, von welchen ich Abschriften in seinem Tagebuche gesehen, welche Einzelheiten über seine Entdeckungen enthalten.
2) Ich habe nie besondere Instructionen erhalten, nichts über Dr. Livingstone’s zukünftige Route oder Pläne bekannt zu machen und zwar weder von Dr. Livingstone, noch von Herrn Bennett, was dadurch bewiesen wird, dass ich dem Correspondenten des „Daily Telegraph“, als er mich in Marseille besuchte, um Nachrichten zu bekommen, dieselben bereitwillig gegeben habe.
3) Briefe mit Nachrichten von Dr. Livingstone an Dr. Kirk und Lord Clarendon, die bald nach seiner Ankunft in Udschidschi geschrieben, wurden durch Kuriere nach Unyanyembé geschickt und von Sayd bin Salim in Empfang genommen. Sie sind also später „unterdrückt worden oder verloren gegangen“, nämlich auf dem Wege zwischen Sayd bin Salim in Unyanyembé und dem britischen Consulat in Zanzibar in der Zeit, wo ich mit Dr. Livingstone von Udschidschi nach Unyanyembé reiste.
4) Ich war nur dazu gezwungen, die wenigen widerspenstigen Leute und Deserteure in Ketten marschiren zu lassen, Leute, die beständig meine Expedition dadurch gefährdeten, dass sie unser Eigenthum auf dem Wege liegen liessen oder meutern wollten.
[S. 334]
5) Dr. Livingstone hat mir, auf meinen Rath hin, versprochen, den moralischen Einfluss einer Kette auf Widerspenstige und Deserteure zu versuchen, wie ich es auch gethan; denn irgendein Strafmittel ist in Central-Afrika für die Unverbesserlichen ebenso nothwendig, wie die Gefängnisse in civilisirten Ländern.
6) Der Ton von Dr. Livingstone’s Briefen ist nicht unhöflich. Unhöflichkeit lag durchaus nicht in seiner Absicht; es sind nur formelle Beschwerden.
7) Wäre Dr. Livingstone selbst mit despotischer und königlicher Autorität versehen gewesen, so wäre er doch ebenso machtlos wie bei Consularautorität, wenn er nicht die Mittel hatte, sie mit Gewalt zur Geltung zu bringen. In den Wildnissen von Central-Afrika hätte er nicht britische Schützlinge mit der Todes- oder Gefängnissstrafe belegen können, wenn er auch die Autorität aller civilisirten Völker, aber nicht die Mittel besässe, dieselbe mit Gewalt zur Geltung zu bringen. Er konnte Uebelthäter eben nur entlassen.
8) Hier rathe ich den Lesern das Schlusskapitel zu lesen.
9) Es geht keineswegs aus der Haltung der officiellen Briefe Dr. Livingstone’s an Dr. Kirk hervor, dass er nur eine von Herrn Stanley ihm gesandte Hülfe willkommen heissen werde. Dr. Livingstone wusste gar nicht, dass das britische Publikum eine Hülfsexpedition für ihn organisirt habe. Da er dies nicht wusste, bat er mich, alles für ihn zu thun, was ich könne; die Leute und Vorräthe aber, deren er bedurfte, wurden ihm von Zanzibar einzig und allein aus englischem Gelde geschickt.
10) Herr W. O. Livingstone hat nicht nach Durchlesung der Briefe seines Vaters „es abgelehnt, Herrn Stanley’s Expedition zu seinem Vater zu begleiten“, sondern Herr Livingstone hat sich nur auf den freundschaftlichen, ärztlichen Rath des Dr. Kirk zurückgezogen, welcher meinte, dass es bei seinem damaligen schwächlichen Gesundheitszustand für ihn sehr unklug, wenn nicht gefährlich sei, den Versuch zu machen, nach Unyanyembé während des schlimmsten Monsuns, der je über Ost-Afrika hingezogen, zu gehen.
Ich schliesse mit der Hoffnung, dass die Empfindungen, welche Dr. Kirk jetzt gegen Dr. Livingstone zu hegen scheint, höflichern und duldsamern Platz machen werden, wenn letzterer heimkehrt, um dann die innige Freundschaft vollständig[S. 335] wiederherzustellen, welche früher den Verkehr zwischen diesen beiden alten Bekannten charakterisirte, als sie zusammen in den Regionen des Zambezi und Nyassa-Sees reisten und lebten. Ich glaube, ich kann seitens des Dr. Livingstone eine herzliche, freundliche Erwiderung auf diese Empfindungen in Aussicht stellen. Was mich betrifft, so würde mich nichts mehr freuen, als wenn wir allesammt wieder recht gute Freunde würden. Dr. Livingstone kennt die Gesinnungen, die ich für ihn hege, sehr wohl, und Dr. Kirk kann überzeugt sein, dass ich für ihn aufrichtige Bewunderung empfinde.
Das Folgende ist die allerletzte Nachricht von Dr. Livingstone (im Auswärtigen Amt am 19. October 1872 angekommen) und beweist genau, was ich gesagt habe, dass dieser gegen Dr. Kirk keine Unhöflichkeit beabsichtigt oder daran gedacht hat, sein Verfahren anzugreifen, und dass ich seine Empfindungen im vorhergehenden Absatz richtig gedeutet habe.
DR. LIVINGSTONE AN LORD GRANVILLE.
„Unyanyembé, 1. Juli 1872.
Mylord!
Ich muss daran erinnern, dass ich sehr grosse Unannehmlichkeiten dadurch erlitten, dass Sklaven statt Freier für mich engagirt worden sind. Dies hat mir volle zwei Jahre gekostet, mir ein unnützes Marschiren von 1800–2000 Meilen auferlegt, mich viermal der Gefahr eines gewaltsamen Todes ausgesetzt und ausserdem eine unbestimmbare Summe Geld gekostet. Gewisse Banyanen, indisch-britische Unterthanen, an deren Spitze ein gewisser Ludha Damdschi steht, scheinen uns ihre Sklaven für mehr als das doppelte Gehalt eines Freien betrüglicherweise aufgedrungen zu haben, und die sämmtlichen Sklaven waren von dem Gedanken erfüllt, dass sie mir nicht folgen, sondern mich zur Rückkehr zwingen sollten. Durch das Geld und die Waaren dieser Banyanen wird fast der ganze Sklavenhandel dieser Gegend vermittelt. Sie haben sich unehrlicher Agenten bedient, um die Karavanen zu führen und dies hat es zu Wege gebracht, dass ich zu vier verschiedenen malen ausgeplündert worden bin. Niemals wird ein Händler in dieser Weise beraubt. Ich habe eine Klage hierüber an Dr. Kirk abgesandt und in meinem Brief vom 14. November eine Copie desselben in der Hoffnung eingeschlossen, dass er, wenn es nöthig wäre, vom Auswärtigen Amte Unterstützung bekäme, damit mir Gerechtigkeit widerfahren und er die Sache rasch in Angriff nehmen könne, denn die Banyanen und ihr ungerechter Agent Scherif haben ihre Privathandelsspeculationen zwischen Dr. Kirk und mich[S. 336] zwischengeschoben und uns, ohne dass wir es wussten, dazu verführt, Sklaven zu brauchen, obwol wir uns dem widersetzt hatten, dass Kapitän Fraser dasselbe auf seiner Zuckerplantage thue. Ich bedauere es sehr, zufälligerweise erfahren zu haben, dass Dr. Kirk meine förmlichen Anklagen gegen die Banyanen als einen versteckten Angriff auf ihn selbst betrachtet hat; wenn ich dies vorhergesehen hätte, so hätte ich bestimmt alle meine Verluste stillschweigend ertragen. Ich habe niemals mit ihm Streit gehabt, obwol wir Jahre lang zusammen waren, und ich hatte keineswegs die Absicht, ihn zu beleidigen. Aber das öffentliche Interesse, das sich an dieser Expedition bethätigt, zwingt mich zur Veröffentlichung aller der Hindernisse, welche sich dem entgegengestellt haben, dass ihre Aufgabe nicht schon vollendet worden ist. Ich habe die Banyanen und ihre Agenten als die Ursache aller meiner Verluste dargestellt und gezeigt, dass der Gouverneur hier ihr hauptsächlichster Agent ist. Dies wird durch die Thatsache bestätigt, dass Scherif und die erste Sklavenbande jetzt bei ihm aufs bequemste in Mfutu leben, einem Dorfe, das etwa 12 Meilen von dem Ort, an dem ich dieses schreibe, entfernt ist.
Da ich, wie ich in meinem obigen Briefe erwähnt habe, ausreichende Vorräthe besitze, die mich in den Stand setzen, in kurzer Zeit meine Arbeit möglichst zu beendigen, und da die erste und zweite Sklavenbande sich als so sehr ungenügend erwiesen hatte, war es mir sehr darum zu thun, dass nicht wieder Sklaven kommen sollten; ich bat daher Herrn Stanley, mir 50 Freie in Zanzibar zu miethen und für den Fall, dass er Sklaven begegne, dieselben wieder zurückzuschicken, ohne Rücksicht darauf, was für Ausgaben an sie gewandt worden seien. Diese wollte ich gern alle bezahlen. Ich hatte keine Idee davon, dass dies dazu führen würde, eine englische Expedition, die in grösster Freundlichkeit mir zu Hülfe geschickt worden, an ihrer Weiterreise zu verhindern. Ich bin vom aufrichtigsten, tiefsten Danke für die edle Anstrengung meiner Landsleute erfüllt und bedauere es sehr, dass meine Vorsichtsmassregeln gegen eine nochmalige Sklavenexpedition den selbstverleugnenden Eifer von Ehrenmännern gedämpft haben, die durchaus keine Spur vom Geiste von Sklaven an sich haben.
Wie ich jetzt auseinandersetzen werde, hätten sie mir jedoch wenig in der Richtung nützen können, die ich einzuschlagen beabsichtige. Besässen wir aber einen Telegraphen oder selbst nur eine Briefpost, so hätte ich ihnen Arbeiten nach einer andern Richtung vorgeschlagen, die dem Vorstande der Geographischen Gesellschaft genehm gewesen wäre.
Seit zwölf Monaten wird hier Krieg geführt. Derselbe ähnelt unsern kleinen Kaffernkriegen, bereichert aber niemanden. Aller Handel wird dadurch gehemmt und im ganzen Lande herrscht allgemeine Gesetzlosigkeit. Ich beabsichtige, diese Verwirrungen dadurch zu vermeiden, dass ich nach Süden nach Fipa gehe, dann um das südliche Ende des Tanganika und darauf über den Chambeze, dem Ufer des Sees Bangweolo entlang nach Westen ziehe. Wenn ich mich [S. 337]dann auf 12° südl. Br. befinde, so gedenke ich in gerader Richtung nach Westen an die alten Quellen zu gehen, von denen es heisst, dass sie an jenem Ende der Wasserscheide liegen, und mich von dort nach Norden zu den Kupferminen von Katanga zu wenden, die nur ungefähr zehn Tage südwestlich von den unterirdischen Höhlen sind. Von dort aus kehre ich nach Katanga zurück, das zwölf Tagereisen nach Südsüdwesten vom Ende des Lincoln-Sees liegt. Daselbst angekommen, werde ich der Vorsehung aufrichtig danken und über den Kamolondo-See nach Udschidschi und in die Heimat zurückkehren. Durch diese Reise hoffe ich den Theil des Landes, an dessen Erforschung mich die Sklaven gehindert haben, kennen zu lernen. Ich bin nämlich aus der Gegend des Zusammenflusses des Lomame mit Webb’s Lualaba zurückzukehren gezwungen worden. Der Lomame ist die Verlängerung des Lincoln-Sees in das centrale Seesystem — in Webb’s Lualaba. Die hier angedeutete Route macht meine Rückreise nutzbar, indem sie mich aussen, oder sagen wir südlich um alle die Quellen zusammen herumführt, wogegen die Route, welche durch Manyuema führt, nicht dazu taugen würde, um den Faden der Forschungen wieder aufzunehmen. Jene bringt mich auch ausserhalb des Bereichs des von Udschidschi oder von der Küste aus betriebenen Sklavenhandels und Blutvergiessens, was die Manyuema jetzt zu rächen anfangen. Wenn ich mich jetzt zurückzöge, wie ich es von ganzem Herzen zu thun wünschte, so würde ich mir bewusst sein, die Entdeckung der Quellen unbeendet gelassen zu haben und alsbald einen Nachfolger zu bekommen, der die Nichtigkeit meiner Ansprüche nachweisen würde. Und was noch schlimmer wäre als das, die Banyanen und ihre Agenten, von denen ich glaube, dass sie sich verschworen haben, alle meine Pläne zu vereiteln, würden wesentlich ihre Absichten durchgesetzt haben. Ich kenne jetzt schon viele von den Völkerschaften, mit denen ich ganz freundschaftlich verkehre, nachdem ich in der Gegend weit gereist bin und den Irrthum verbessert habe, zu dem ich dadurch verführt wurde, dass der Chambeze von den Portugiesen und Andern Zambesi genannt wird. Ich möchte sehr gern die Basañgo besuchen, die nahe an meinem Wege wohnen, werde mich aber doch auf sechs bis acht Monate beschränken, um das Versäumte wieder gut zu machen. Vor ungefähr fünf Generationen ist ein Weisser in die Hochlande von Basañgo gekommen, die gerade im Osten von der Wasserscheide liegen. Derselbe hatte sechs Begleiter, welche jedoch alle starben, und schliesslich wurde dieser Führer, Tscharura genannt, zum Haupt der Basañgo gewählt. In der dritten Generation hatte er 60 kräftige Speerträger zu directen Nachkommen. Dies lässt auf eine ebenso grosse Zahl weiblichen Geschlechts schliessen. Sie sind von sehr heller Farbe und leicht daran zu erkennen, dass es niemandem, ausser der königlichen Familie, gestattet ist, Korallenperlen zu tragen, wie sie Tscharura eingeführt hat. Ein Buch, das er mitgebracht, ist erst vor kurzem verloren gegangen. Das Interesse des Falls liegt in seinem Zusammenhange mit der berühmten Theorie Darwin’s über die Entstehung der Arten, denn er beweist, dass eine[S. 338] verbesserte Varietät, wofür wir Weissen uns doch bescheidentlich halten, nicht dem ausgesetzt ist, durch grosse Zahlen, wie einige gemeint haben, überwuchert und vernichtet zu werden.
Zwei Mazitu-Häuptlinge leben in der Nähe der Route. Ich würde sie sehr gern besuchen und für die Engländer Gerechtsame zu erlangen suchen, wie sie den Arabern von Seyd Madschid gewährt worden sind, bin aber jetzt viel zu reich, um mich unter Diebe zu begeben. Zu einer andern Zeit hätte ich getrost hingehen können, weil nach dem schottischen Sprichwort „niemand die Hosen eines Hochschotten stiehlt“. Wenn es einigermassen gut geht, so hoffe ich in acht Monaten von jetzt ab wieder in Udschidschi zurück zu sein. Sollte jemand die Klugheit meiner Entscheidung in Frage ziehen oder mich im Verdacht haben, wenig Liebe für meine Familie zu empfinden, indem ich diese letzte Reise unternehme, so kann ich mich vertrauensvoll um Billigung an den Vorstand der Königl. Geographischen Gesellschaft wenden, der den Gegenstand vollständig versteht.
Hätte ich vorher wissen können, dass diese letzte Expedition herkommen würde, um mich aufzusuchen, so würde ich sie als Zweigexpedition benutzt haben, um den Victoria-See zu erforschen, zu welchem Zweck die gewählten Seeoffiziere ohne Zweifel vorzüglich geeignet gewesen wären. Das Skelet eines Bootes, das Herr Stanley hier gelassen hat, hätte ihren Zwecken dienen können und sie hätten das ganze Verdienst einer unabhängigen Forschung und ihrer Erfolge gehabt. Ich bin längere Zeit in Gesellschaft von drei intelligenten Sanheli gereist, die je drei, sechs und neun Jahre in dem östlich vom Victoria-See belegenen Lande gelebt haben, der dort Okara, hier aber Mkara genannt wird. Sie haben mir drei oder vier Seen beschrieben, von denen nur der eine seine Gewässer nach Norden entsendet. Okara scheint der eigentliche Victoria-See zu sein. Ungefähr aus seiner Mitte gibt er einen Arm nach Osten ab, welcher Kidette heisst, in den eine Menge Reusen gelegt und wo viele Fische gefangen werden. Er ist drei Tagereisen zu Boot lang und verbindet sich mit dem See Kavirondo, der wol nicht ein See, sondern nur ein Arm des Okara genannt zu werden verdient. An demselben lebt ein sehr schwarzes Volk, das Vieh hält. Weiter nach Osten befinden sich die Masai. Südöstlich von Kavirondo liegt der See Neibasch oder Neybasch; dessen südlichem Ufer entlang sind sie drei Tage gereist und von dort aus haben sie den Berg Kilimandscharo gleichfalls im Südosten gesehen. Der See hatte keinen Ausfluss. Als fern im Norden von Kavirondo liegend beschrieben sie den See Bariñgo (nicht Bahr Ngo). Ein Fluss oder Flüsschen, der Ngare na Rogwa heisst, fliesst in denselben von Süden oder Südosten. Sein Name bezeichnet, dass er etwas salzig ist. Bariñgo entsendet einen Fluss nach Nordosten, welcher Ngardabasch heisst. Das Land im Osten und Norden von Bariñgo heisst Burukineggo und man erzählt sich, dass dort Gallahs mit Kamelen und Pferden leben; meine Berichterstatter haben sie aber nicht gesehen. Ich gebe ihre Nachrichten nur so, ohne ihren Werth zu untersuchen. Ihr Zweck war das Plündern und sie konnten[S. 339] wol kaum in Bezug auf die Zahl der Seen im Irrthum sein, wo nach unserer Annahme sich nur einer befindet. Der Okara oder eigentliche Victoria-See ist der grösste und enthält viele sehr grosse Inseln. Ich habe nicht den geringsten Wunsch, in seine Nähe zu gehen weder jetzt noch in Zukunft, sondern wünsche nur meine eigene Aufgabe gut zu Ende zu führen und glaube, dass ich wol einige Ausdauer für mich in Anspruch nehmen darf. Wenn mir jedoch der Auftrag würde, noch irgendwo sonst hinzugeben, so würde ich mich bestimmt auf grosse Kränklichkeit oder dringende Privatangelegenheiten berufen. Man hat mir nachgesagt, dass ich unter den Arabern wie einer derselben lebe; dies kann nur heissen, dass ich auf gutem Fusse zu denselben stehe. Sie nennen mich oft den „Christen“ und ich habe nie diesen Charakter in irgendeiner Beziehung verleugnet.
Eine eigene Skizze einer Längenaufnahme, welche ich an Sir Thomas MacLear an der Königlichen Sternwarte am Cap geschickt habe, ergibt 27° östl. als die Länge des grossen Flusses Lualaba und die Breite von 4° 9′ südl. Er verläuft ungefähr zwischen 26° und 27° östl. L. und liegt daher nicht so weit westlich, wie es meine Rechnung, die ich ohne Uhr in dichten Wäldern und zwischen gigantischem Gras ausführte, festgestellt hatte. Es ist daher weniger wahrscheinlich, dass es der Congo ist, und ich könnte wol auf demselben mit Baker zusammentreffen. Mit Bezug auf die alten Quellen kenne ich schon die vier Ströme, die ohne Frage in der Nähe von oder an dem westlichen Ende der Wasserscheide entstehen. Herr Oswell und ich hörten etwa im Jahre 1851, dass der Kafue und Liambai (der Obere Zambesi) an einer Stelle entsprängen, obwol wir damals etwa 300 Meilen davon entfernt waren. Die beiden Flüsse Lomame und Lufira kommen aus derselben Gegend; der einzige Punkt, der noch zweifelhaft, ist die Entfernung ihrer Quellen voneinander und diesen möchte ich sehr gern feststellen. Ich schicke astronomische Beobachtungen und eine Kartenskizze durch einen Eingeborenen an Sir Thomas MacLear. Die Karte ist sehr unvollständig, weil mir alle bequemen Mittel für das Zeichnen derselben fehlten und keine Lage sollte als festgestellt oder veröffentlicht betrachtet werden, bis sie auf dem Observatorium von neuem berechnet worden ist.
Es ist ziemlich viel Gefahr dabei, so zu verfahren, doch nicht so viel, wie wenn ich die Sache meinem Freunde, dem Gouverneur, vertraute. Eine frühere kartographische Skizze, eine Menge astronomischer Beobachtungen und fast alle meine Briefe sind hier verschwunden; aber es ist besser, dass sie den Gefahren des Transports durch einen Eingeborenen ausgesetzt sind, als dass sie mich über zahllose Gewässer begleiten. Die Furcht, mein Tagebuch ganz und gar zu verlieren, hat mich dazu geführt, es Herrn Stanley anzuvertrauen, damit meine Tochter es bis zu meiner Rückkehr verwahre, und ich hoffe, dass es sicher angekommen ist. Ich warte hier nur, bis meine 50 Leute eintreffen. Die natürliche Besorgniss, die ich für die Sicherheit meines Sohnes Oswell empfinde, der durch die zwischen diesem kalten Hochland und der Küste liegenden Fieberdistricte[S. 340] reist, wäre um das Dreifache vermehrt worden, wenn die Herren von der Marine mitgekommen wären.
Zum Schluss erlauben Eure Lordschaft, dass ich Ihnen sowie dem Vorstande und den Mitgliedern der Königl. Geographischen Gesellschaft sowie allen denen meinen herzlichsten Dank sage, die freundlichst in irgendwelcher Weise dazu beigetragen haben, für meine Sicherheit zu sorgen. Ich fühle es aufrichtig, dass niemand in der Welt mehr Ursache zu dem tiefsten Danke hat, als
Ihr gehorsamster Diener
DAVID
LIVINGSTONE,
Ihrer Majestät Consul in Inner-Afrika.“
[Ergänzend sei hier erwähnt, dass die von H. M. Stanley in Zanzibar organisirte neue Expedition am 12. August 1872 in Unyanyembé eintraf, worauf Dr. Livingstone am 25. August eine neue Reise nach dem Bangweolo-See antrat. Er ging dem südöstlichen Ufer des Tanganika-Sees entlang und um dessen Südende in das Land des Cazembe, wo er den Ufern des Bangweolo-Sees an der Nord-, Ost- und Südseite folgte. Am 1. Mai 1873 erlag er im Dorfe Tschitambo’s in Ilala der Dysenterie. Seine treuen Diener, unter der Führung von Susi[10], trugen die Leiche nach der Ostküste, von wo sie nach England übergeführt und am 18. April 1874 in der Westminster-Abtei zu London beigesetzt wurde.]
[S. 341]
Die folgende Correspondenz und namentlich das letzte Schreiben, das von einer schönen, werthvollen, mit Brillanten besetzten goldenen Tabatière begleitet war, wird von mir stets als eins der angenehmsten Resultate meines Unternehmens geschätzt werden.
H. M. S.
„Auswärtiges Amt, 1. August.
Mein Herr!
Earl Granville gibt mir den Auftrag, Ihnen den Empfang eines Päckchens anzuzeigen, welches Briefe und Depeschen von Dr. Livingstone enthält, das Sie so gut waren, an Ihrer Majestät Gesandten in Paris zur Ueberlieferung an das hiesige Amt zu übergeben, und ich habe den Auftrag, Ihnen den Dank Seiner Lordschaft dafür auszusprechen, dass Sie sich dieser interessanten Documente angenommen haben.
Ihr ergebenster Diener
ENFIELD.“
An Herrn Henry M. Stanley, London.
„London, 2. August.
Herr Henry M. Stanley hat mir heute das Tagebuch meines Vaters, des Dr. Livingstone, überliefert, so wie es von meinem Vater adressirt und gesiegelt ist und mit den darauf befindlichen von meinem Vater unterzeichneten Instructionen. Für seine dafür bewiesene Sorgfalt, sowie für alles, was er zu Gunsten meines Vaters gethan hat, schulden wir ihm den besten Dank. Wir haben durchaus keine Ursache, es zu bezweifeln, dass es wirklich meines Vaters Tagebuch ist, und ich bezeuge hiermit, dass die Briefe, die er uns mitgebracht hat, Briefe meines Vaters sind und von niemand anderm herrühren.
T. S. LIVINGSTONE.“
„2. August 1872.
Mein Herr!
Ich habe gar nicht gewusst, bis Sie dessen Erwähnung thaten, dass irgendein Zweifel über die Authenticität von Livingstone’s Depeschen, die Sie Lord Lyons am 31. Juli übergeben haben, existirte. Aber infolge dessen, was Sie mir gesagt haben, habe ich die Sache untersuchen lassen und finde, dass Herr Hammond, Untersecretär des Auswärtigen Amtes, und Herr Wylde, Chef des Departements für Consularangelegenheiten und Sklavenhandel, nicht den geringsten Zweifel an der Echtheit der Schriftstücke hegen, welche Lord Lyons erhalten hat und die sich jetzt im Druck befinden.
[S. 342]
Ich kann nicht umhin, diese Gelegenheit dazu zu benutzen, Ihnen meine Bewunderung der Eigenschaften auszudrücken, die Sie in den Stand gesetzt haben, den Zweck Ihrer Mission zu erreichen und ein Resultat zu erzielen, das sowol in den Vereinigten Staaten wie auch hier zu Lande mit so grossem Enthusiasmus begrüsst worden ist.
Ihr gehorsamer
GRANVILLE.“
An Herrn Henry Stanley.
„Auswärtiges Amt, 27. August.
Mein Herr!
Es gereicht mir zu grosser Freude, Ihnen auf Befehl Ihrer Majestät mitzutheilen, dass dieselbe die Klugheit und den Eifer, den Sie an den Tag gelegt haben, um eine Verbindung mit Dr. Livingstone zu eröffnen und dadurch Ihre Majestät von Sorgen zu befreien, die sie gemeinsam mit ihren Unterthanen in Bezug auf das Schicksal dieses ausgezeichneten Reisenden empfunden hat, im höchsten Grade zu schätzen weiss.
Die Königin beauftragt mich, Ihnen ihren Dank für den dadurch geleisteten Dienst auszusprechen zugleich mit ihren Glückwünschen, dass Sie Ihre Mission, die Sie so muthig unternommen, mit so grossem Glück durchgeführt haben. Gleichzeitig wünscht Ihre Majestät, dass ich Sie ersuche, das diesen Brief begleitende Andenken von ihr anzunehmen.
Ihr ergebenster
GRANVILLE.“
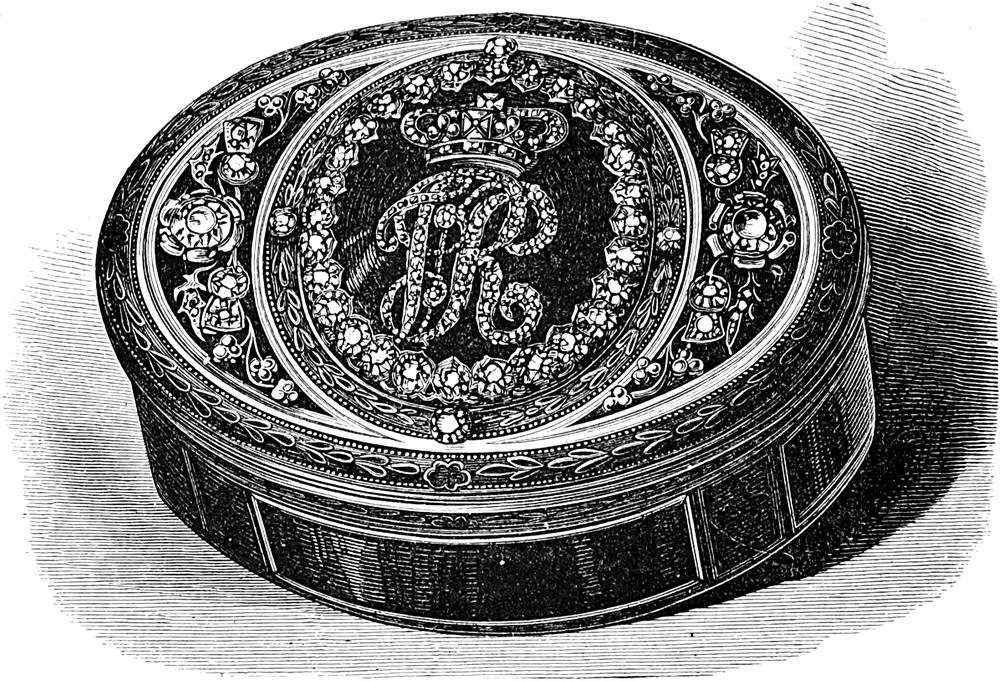
[10] Vgl. V. L. Cameron, „Quer durch Afrika“ (2 Bde., Leipzig, F. A. Brockhaus, 1877), I, 143.
[S. 343]
|
Boma
|
Einhegung.
|
|
Bubu
|
Schwarze Perlen.
|
|
Diwan
|
Aeltester, Häuptling oder obrigkeitliche Person.
|
|
Doti
|
Vier Yards Tuch.
|
|
Dowa
|
Medicin.
|
|
Fundo
|
Zehn Halsbänder oder zehn Khetes.
|
|
Ghulabio
|
Eine Art Perlen.
|
|
Hafde
|
Eine Art Perlen.
|
|
Hamal
|
Lastträger.
|
|
Honga
|
Tribut.
|
|
Ismahili
|
Bezeichnung der Eingeborenen für eine besondere
Art Tuch.
|
|
Kadunguru
|
Eine Art ziegelfarbener Perlen.
|
|
Kaif-Halek
|
„Wie geht es Ihnen?“
|
|
Kaniki
|
Ein blaues, in Indien fabricirtes Zeug.
|
|
Khambi
|
Lager.
|
|
Khete
|
Ein Halsband oder ein Zehntel Fundo.
|
|
Kirangozi
|
Führer.
|
|
Kitambi
|
Eine Art Tuch.
|
|
Kiti
|
Sessel.
|
|
Kitschuma-tschuma
|
„Kleine Eisen“, eine Leberkrankheit.
|
|
Lakhio
|
Eine Art rosafarbener Perlen.
|
|
Lunghio
|
Blaue Perlen.
|
|
Lunghio mbamba
|
Kleine blaue Perlen.
|
|
Lunghio rega
|
Grosse blaue Perlen.
|
|
M
|
Ein Präfix, das zur Bezeichnung
eines Einwohners eines Landes dient,
z. B. M-dschidschi = ein Bewohner von Dschidschi.
|
|
Manyapara
|
Aeltester oder Unterhäuptling.
|
|
Matama
|
Holcus sorghum oder das arabische Durra.
|
|
[S. 344]
Mbembu
|
Waldpfirsich.
|
|
Merikani
|
Ungebleichte in Amerika fabricirte
Baumwollenstoffe.
|
|
Mganga
|
Ein Medicinmann oder Zauberdoctor.
|
|
Miezi-Mungu
|
Ein Ausdruck für „Gott“ in Kiswahili-Sprache.
|
|
Mtemi
|
Synonym für König.
|
|
Mtoni
|
Nullah (Wasserlauf).
|
|
Muhongo
|
Tribut.
|
|
Mulungu
|
Bezeichnung der Eingeborenen für „Gott“.
|
|
Mukunguru
|
Wechselfieber.
|
|
Mvuha
|
Donner.
|
|
Ngombe
|
Eine Kuh.
|
|
Pagazi
|
Ein Lastträger.
|
|
Poscho
|
Nahrungsmittel.
|
|
Sami-Sami
|
Rothe Perlen.
|
|
Schamba
|
Ein Feld.
|
|
Schasch
|
Ein Muslintuch.
|
|
Scheikh
|
Ein Titel, der aus Höflichkeit einem ältlichen
Mann gegeben wird.
|
|
Schukka
|
Zwei Yards Tuch.
|
|
Sohari
|
Eine Art farbiges Tuch.
|
|
Sungomazzi
|
Grosse Glas- oder Porzellan-Perlen.
|
|
Toudschiri
|
Eine besondere Art Tuch.
|
|
U
|
Ein Präfix, das zur Bezeichnung eines Landes
dient, z. B. Udschidschi = das Land von Dschidschi.
|
|
Uganga
|
Arznei.
|
|
Wa-
|
Ein Präfix, das zur Bezeichnung
mehrerer Einwohner eines Landes dient,
z. B. Wadschidschi = Bewohner von Dschidschi.
|
|
Waschensi
|
Eine verächtliche Bezeichnung für „Eingeborene“.
|
|
Yambo
|
„Wie geht es?“
|
|
Ziwa
|
Ein Pfuhl, ein See.
|
|
Ziwani
|
Ein Teich.
|
[S. 345]
Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.